* Texte und Bilder sollten unter einer freien Lizenz (am besten CC-BY) stehen.
* Archivalienabbildungen sollten in exzellenter Auflösung und ohne Wasserzeichen/Copyfraud zur Verfügung stehen. Regelmäßig sollten auch kleinere mehrseitige Digitalisate angeboten werden.
* Alle Beiträge sollten ihre Quellen korrekt nachweisen und auf einschlägige Materialien im Netz verlinken.
* Das Blog sollte Heimatforschern die Möglichkeit bieten, kurze miszellenartige Beiträge mit wissenschaftlichem Anspruch zu veröffentlichen (wie man sie z.B. in Heimatkalendern lesen kann).
Immerhin läßt sich der laut Pressemitteilung „anonym bleibende“ Spender (oder Verkäufer?) nicht auch noch öffentlich dafür beweihräuchern, dass er die jahrzehntelang in seinem trauten Heim gehorteten kommunalen Unterlagen nun endlich herauszurücken geruht hat. Unbequeme Fragen kann Herr Köppen in solchen Fällen ja schlecht stellen, sonst würde ihm von den anderen Dachböden seines Sprengels in Zukunft gar nichts mehr zugehen.
Diese privaten Sammel-Banausen sind eine Plage! Würden sie wenigstens selbst etwas Sinnvolles mit den unverdient ersessenen Schätzen anfangen, könnte man noch Verständnis aufbringen. Aber nein, sie hocken bloß faul darauf herum wie der Drache auf seinem Gold und grinsen schadenfroh über die dummen Historiker, die bei ihren Recherchen immer wieder ins Leere laufen. Wer der Öffentlichkeit potentielles Archivgut vorenthält, ist letztendlich auch nicht besser, als ein aktiver Geschichtsfälscher. Rückwärts auf einen Esel setzen und aus dem Dorf treiben!
Peter Kunzmann
Ergänzungen zum Architekten Markmann (siehe Fußnote 7):
Ein recht ähnlich aussehendes, etwas bescheideneres kommunales Projekt von ihm ist das 1904 eingeweihte Amtshaus in Mengede (Amt Castrop). Mehr dazu hier: http://www.heimatverein-mengede.de/heimatblaetter/heimatblatt_nr2.html
Auch das alte Kreishaus in Altena von 1908 stammt von ihm.
Zur Biographie: Das Dortmunder Adressbuch von 1894 nennt direkt unter Heinrich mit der selben Adresse eine gewisse „Louise Markmann, Witwe“. Das dürfte die Mutter des Architekten gewesen sein. Der Täufling von 1868, dessen Mutter Henriette hieß, wäre damit endgültig redundant. L(o)uise führt schließlich bei Familysearch zur Bestätigung des wohl aus einer anderen (welcher???) Quelle eruierten Geburtsdatums: Heinrich Gottfried Mar(c)kmann, 1818-1864, heiratete am 13.5.1851 L(o)uise geb. Wolters, 1824-?; ihr Sohn Friedrich Gottfried Heinrich wurde am 29.8.1852 geboren und am 22.9. d.J. in der ev. Reinoldikirche getauft (alles in Dortmund).
Leider verraten die Mormonen nichts über Geschwister dieses Heinrich Markmanns. Sollte es, wie im Architektenregister von Bücholdt angegeben, in Dortmund zur gleichen Zeit zwei Architekten namens Markmann (Heinrich und Hans bzw. Johannes) gegeben haben, wäre es nicht ganz unwahrscheinlich, daß es Brüder waren – vielleicht (sofern sie sich nicht innerhalb der Familie Konkurrenz machen wollten) sogar Partner in einem gemeinsamen Büro. Dessen Leitung hätte dann sicherlich beim erstgeborenen Heinrich gelegen, weshalb der jüngere Hans selten öffentlich in Erscheinung trat. Dies nur als vorsichtige Hypothese, die sich wahrscheinlich anhand der Dortmunder Personenstandsunterlagen oder bei der Reinoldi-Kirchgemeinde weiter verfolgen ließe. Aus den kärglichen Spuren von Hans gleich auf seine Nicht-Existenz („Verwechslung mit Heinrich“) zu schließen, ist jedenfalls nicht zwingend.
Über Heinrichs Wirken in Lippstadt gibt es eine Veröffentlichung: Roland Pieper, Architektur im Stilpluralismus um 1900: Lippstädter Bauwerke des Dortmunder Architekten Heinrich Markmann, Lippstädter Heimatblätter 89 (2009), S. 137-160 (liegt mir allerdings nicht vor). Womöglich enthält der Aufsatz auch für Siegen interessante biographische Informationen.
Gibt es in unserem Stadtarchiv Meldeunterlagen der Siegener Hotels Anfang des 20. Jahrhunderts? Bei seinen Besuchen hatte sich Markmann vermutlich mit vollem Vornamen eingetragen. Sollte er einen Bruder Hans gehabt und ihn mitgebracht haben, umso besser.
Peter Kunzmann
Ich finde es super, dass es jetzt auch einen Blog gibt, in dem über die Geschichte unserer Region berichtet wird. Die WordPress-Blogs bieten prima Möglichkeiten, weil sie einfach zu erstellen und zu bearbeiten sind. Werde den Blog abonnieren, damit ich auf dem Laufenden bleibe und ihn weiterempfehlen…;-))
Weiterhin viel Erfolg für Ihre Arbeit! Gruss Anntheres
Den diskussionsfreudigen Siegerländer Beteiligten Ria Siewert (Stadtarchiv Kreuztal) und Thomas Wolf (Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein) ein virtueller herzlicher Dank und weiterhin gutes Flanieren im Web 2.0 !
Damit hat der Blog schon einmal einen seiner Zwecke erfüllt. :-) Aber ich kann Ihnen eines versichern: noch in diesem Frühjahr wird ein weiteres interessantes archivisches Weblog seinen Betrieb aufnehmen. Es bleibt spannend!
„….. Wolfgang Suttner spricht die Möglichkeit einer Übernahme der Ostdeutschen Sammlung durch ein Kommunalarchiv auf vertraglicher Basis an. Auf dieser Grundlage könne klar geregelt werden, wie mit den Ausstellungsstücken umzugehen sei. Eventuell gäbe es Möglichkeiten für eine solche Lösung im Stadtarchiv. Auch könnten Teilbestände privater Nachlässe aus den Familien der Vertriebenen aus archivalischer Sicht möglicherweise interessant sein. Vor diesem Hintergrund erscheine es sinnvoll, zur nächsten Sitzung einmal Kreisarchivar Thomas Wolf einzuladen.
Die verschiedenen Möglichkeiten zur Sicherung der Ostdeutschen Sammlung werden intensiv diskutiert.
Landrat Paul Breuer unterstreicht, da die Ostdeutsche Sammlung im Besitz des BdV sei und sich die derzeitigen Standorte in der Zuständigkeit der Stadt Siegen befinden, könne der Kreis SiegenWittgenstein in dieser Angelegenheit lediglich eine Vermittlerrolle übernehmen. Man werde sich vor diesem Hintergrund seitens Kreises für die Erarbeitung von Lösungsansätzen einsetzen. Zentraler Punkt dabei müsse sein, für die Nachwelt mit ihren völlig unterschiedlichen Beziehungen zur Vertriebenenkultur das Verständnis für deren Bedeutung zu erhalten und dabei die Spezifika der Region Siegerland und Wittgenstein herauszuarbeiten. …“
Quelle. Beirat für für Vertriebenen- und Aussiedlerfragen, Öffentliche Sitzung, 29.02.2012, Niederschrift, S. 3
Vielleicht hätte man auch erwähnen sollen, daß Jung-Stilling .
h e u t e
.
vor allem in esoterichen Kreisen bekannt ist durch die (angeblichen) „nachtodlichen Belehrungen“, die dort diskutiert werden.
.
Kostenlos downloadbar sind diese von der Universität Siegen:
. http://www.uni-siegen.de/fb5/merk/stilling/
.
Dort auf „Downloads“ gehen.
Es handelt sich um das Diakonissenmutterhaus Friedenshort.
Standort: Freudenberg, Friedenshortstraße 46, früher Triftstraße 46.
Infos dazu im Stadtarchiv Freudenberg.
Danke für die Klärung! Kienzler war laut der im Kreisarchiv vorhandenen Personalakte mit der Planung des Gebäudes betraut. So erklärt das Bild im Nachlass Kienzlers.
Nachdem via Twitter nach der entlegenen Literatur gefragt wurde, folgt hier nun das Vollzitat:
„Die neuen Landräte
In der ersten Zeit kamen und gingen die Landräte. Einer musste innerhalb von 48 Stunden den Kreis wieder verlassen. Alle waren keine Verwaltungsbeamten, waren ungeeignet. Einer schikanierte die Leute, gab noch Anweisungen, obwohl alle Bediensteten längst wußten, daß er entlassen war, nur er selbst noch nicht.“ Dies trifft nur für ein kurze Spanne nach der Besetzung zu.“
Folgende Fußnote ergänzt diesen Absatz:
„Meine Chefs bei der Kreisverwaltung waren folgende Landräte und später Oberkreisdirektoren: Landräte Sandkuhl/Berleburg, Ewald Belz/Erndtebrück, Heinrich Treude/Aue, Osterrath/Saßmannshausen, Ludwig Bade/Feudingen, Müller, Heinz/Erndtebrück, Werner Möhl/ Laasphe. Landräte, später OKD: Schläper, Wendland, Nacken (in einer Bezirksversammlung wird erklärt, er sei jetzt OKD), Liebetanz (i. A.), Brombach (i. A.), Basarke, Markowsky (i.A.) Brossok (i.A.), Basarke, Lemnitz (i.A.) Oberregierungs- und Vermessungsrat); Richter, Lückert““
aus: Heinz Strickhausen: Berleburg. Eine Kleinstadt in der Nachkriegszeit, 2001, S. 65
Eine Überprüfung des Einwohnerbuches der Kreise Wittgenstein und Biedenkopf 1928/29, Siegen 1928, ergab, dass sich beide Nachnamen nicht finden lassen; sie stammen wohl nicht aus alteingesessenen Familien.
Wenn man es genau wissen will, wird man wohl am britischen Nationalarchiv nicht vorbeikommen.
Aus den Informationen des Bundesarchivs:
„Die Akten der britischen Militärregierung in Deutschland von 1945 bis 1949/55 befinden sich in den National Archives. Sie wurden mit dem elfbändigen Inventar „Akten der Britischen Militärregierung in Deutschland. Sachinventar 1945-1955 (=/Control Commission for Germany British Element. Inventory 1945-1955, hrsg. von Adolf M. Birke, Hans Booms, Otto Merker; unter Mitwirkung von Deutsches Historisches Institut London, Niedersächsisches Hauptstaatsarchiv Hannover, München 1993)“ erschlossen.“
Dieses Inventar lieferte zwar (bei allerdings nur eiliger Durchsicht) nicht den ganz großen Knüller, aber einige der Akten könnten durchaus etwas zu konkreten Landratsernennungen in der Provinz Westfalen enthalten. Lieber Herr Wolf, lassen Sie sich doch von Ihrem Chef einfach mal eine Dienstreise spendieren. Und wenn Sie in Kew nichts über die Wittgensteiner Landräte finden sollten, können Sie sich dort immer noch an ein paar alten Schätzchen aus Nassau-Siegen erfreuen oder im nahen Garten spazieren gehen.
Peter Kunzmann
Danke für den Hinweis!
Wie ich gerade gesehen habe, erfreuen sich diese „nachtodlichen Belehrungen“ ja weiter Verbreitung! Immerhin über 60000 Downloads!
Auch bei „Google“ findet man viel dazu.
Im Gästebuch dort wettern welche gegen einzelne der Botschaften, die ihnen nicht in den Kram passen.
Aber das alles ist ziemlich „hoch“!
Ich will damit sagen, daß man schon genau mitdenken muß um das alles zu verstehen.
Jetzt intressiert mich noch woher diese kommen?
Sind das viele Schreiber oder nur einer?
Es handelt sich um eine sehenswerte kleine Ausstellung.
Die in der Filmanimation gezeigten Schriftzeichen / Symbole
sollten noch näher untersucht werden.
Detlef Köppen
In einer noch unverzeichneten Korrespondenzakte, die die Ausgangspost der Wittgensteiner Landräte von Juni 1945 bis August 1947 enthält, findet sich ein Schreiben des Landrates Carl Nacken an den Regierungspräsidenten Fritz Fries in Arnsberg vom 25. September 1945. Dort heißt es wie folgt:
„Sehr geehrter Herr Präsident!
Herr Schläper hält sich immer noch in meiner Residenz auf. Vor einiger Zeit hat er auch den Herrn Kommandaten der engl. Militär-Regierung aufgesucht, um über seine weitere Verwendung mit diesem Rücksprache zu nehmen. Der Herr Kommandant stand auf dem Standpunkt, daß ein Mann der einmal Landrat war, doch genügend Qualitäten besitzen müsse, um irgendwie einen leitenden Posten begleiten zu können. Ich sollte Herrn Schläper in meinem Amt Beschäftigung geben. Ich bedaure, Ihnen mitteilen zu müssen, daß ich an Herrn Schläper kein Interesse habe. …..“
Dieses Schreiben bestätigt erstmals „offiziell“, dass es einen Landrat Schläper im Kreis Wittgenstein gegeben hat!
1) Danke für die Rückmeldung!
2) Verstehe ich Sie richtig, dass Einträge über neue kreisrelevante (Foto-)Bestände uninteressant sind?
3) Was würden Sie denn gerne hier lesen?
Antwort des Landesarchivs NRW, Abteilung Rheinland, 27.4.2012: “ …. Von Personen mit dem Namen Wendland haben wir 50, von Personen namens Schläper 13 Entnazifizierungsakten. Bei keiner der Personen ist als Berufsbezeichnung Landrat angegeben, keiner wurde vom Hauptausschuss für den Landkreis Wittgenstein, keiner vom Hauptausschuss für den RB Arnsberg entnazifiziert. … . Allerdings ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass Personen, die unmittelbar nach Kriegsende in hohe öffentliche Ämter kamen, frühzeitig von der britischen oder sogar noch der amerikanischen Militärregierung überprüft wurden und dann später nicht mehr vor einen deutschen Ausschuss mussten. Insofern kann es auch sein, dass Sie Unterlagen nur in National Archives in Kew finden werden. ….“
Da mein vor etlichen Wochen an unseren geschätzten Kreisarchivar gerichteter diskreter Hinweis offensichtlich kein Gehör fand, hier noch einmal und nunmehr öffentlich der Einspruch:
Die Schüler der Wiesenbauschule sind anhand der im Siegener Universitätsarchiv vorhandenen Unterlagen (Bewerbungen, Einschreibelisten, Zeugnisbücher, Prüfungsakten und manches andere) wahrscheinlich lückenlos nachweisbar. Spuren eines „Heinrich Otto“, der mit dem späteren Landrat identisch gewesen sein könnte, haben sich darin nicht finden lassen. Aus welcher „Quelle“ die irreführende Angabe abgeschrieben wurde oder ob hier die Phantasie mit dem Autor durchgegangen war, ist nebensächlich; der Fehler wäre jedenfalls schon vor zwei Jahren mühelos vermeidbar gewesen. Eine simple Rückfrage vor der Publizierung hätte nebenbei auch die Illusion ausräumen können, an der Wiesenbauschule seien Anfang des 20. Jahrhunderts „Ingenieurwissenschaften studiert“ worden.
Es ist ohne jeden Zweifel erfreulich, dass studentische Praktikanten (um einen solchen handelte es sich auch beim Autor dieser biographischen Skizze) im Kreisarchiv die Gelegenheit finden, sinnvolle historische Forschung zu üben und die Früchte ihrer Bemühungen in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Den jugendlich frischen Texten ein wenig redaktionelle Prüfung und Nachbearbeitung durch die „alten Hasen“ zu widmen, bevor sie ins Netz gestellt werden, wäre allerdings oft nicht überflüssig. Letztendlich tut man den publizistisch noch unerfahrenen Autoren keinen Gefallen damit, ihre Irrtümer oder Stilblüten vorzuführen; und was von der Öffentlichkeit als gewissermaßen „amtliche“ Geschichtsschreibung eines Archivs wahrgenommen wird, sollte so verläßlich wie möglich sein.
P.K.
1) Diskrete Hinweise sind im Web 2.0 kontraproduktiv.
2) Ein Blog, zumal siwiarchiv, versteht sich als Laboratorium. Unfertiges hat dort durchaus seinen Platz.
3) Siwiarchiv ist kein wissenschaftliches Blog. Eine peer review findet nicht statt.
4) Älteres Material, das nicht entstellend falsch ist, wird aufgenommen und soll hier diskutiert werden – s.o.
5) Der Artikel Kraumes ist mit Quellenanhang versehen, so dass erkennbar ist, woher die zu Recht angemerkte Information stammt.
Lieber Herr Wolf!
Zu 1) Die Existenz des „Web 2.0“ verpflichtet nicht dazu, direkte Kommunikationswege von Mensch zu Mensch nun abzuschaffen und künftig alles sofort im öffentlichen Bereich abzuhandeln.
Zu 2/3/4) Die biographische Skizze ist auf Mai 2010 datiert, also schon zwei Jahre alt. Ihre Erstveröffentlichung erfolgte nicht „labormäßig“ am 5.5.2012 auf Siwiarchiv, sondern zuvor auf den offiziellen Webseiten der Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein. Wenn dort etwas zur Kreisgeschichte angeboten wird, verläßt man sich als Leser darauf, dass es Hand und Fuß hat. Auch mir wäre der Fehler nicht aufgefallen, hätte ich nicht versucht, in den Wiesenbauschul-Akten ergänzende Details zur frühen Biographie Heinrich Ottos zu finden.
zu 5) Der Quellenanhang läßt nicht erkennen, woher diese spezielle Information stammte. Es ist mir auch egal, wie der Fehler zustande kam. Gewundert hat mich nur, dass weder der Autor (Geschichtsstudent) noch die Betreuer (Archivare) seinerzeit auf die Idee gekommen waren, die naheliegenden und sehr einfachen lokalen Nachfragemöglichkeiten (Aufwand für Anruf oder eMail ca. eine halbe Minute) in Anspruch zu nehmen.
Und noch einmal zu 1) Kontraproduktiv ist es für mich eher, die Weltbevölkerung mit solchen nur einen sehr eingeschränkten Personenkreis interessierenden Kommentaren zu überschütten.
Beste Grüße an Sie und den Rest der Menschheit,
Peter Kunzmann
1) „Die Schüler der Wiesenbauschule sind anhand der im Siegener Universitätsarchiv vorhandenen Unterlagen (Bewerbungen, Einschreibelisten, Zeugnisbücher, Prüfungsakten und manches andere) wahrscheinlich lückenlos nachweisbar.“
Wurde bei Ihrer Prüfung auch das im Bestand „Kreis Siegen, Kreisausschuss“ unter Nr. 538 vorhandene Aktenverzeichnis zu Rate gezogen, um die von Ihnen in Erwägung gezogenen Lücken (s. o.) weitestgehend auszuschließen?
2) Haben Sie die unter 1) erwähnte Ergänzungsüberlieferung auf möglicherweise einschlägige Unterlagen überprüft?
2a) Möglicherweise hat Otto ja auch die Wegebauschule besucht. „Nicht erfasst sind die Besucher der von 1901 bis 1939 bestehenden Wegebauschule, da über diese keine listennmäßigen Auf-zeichnungen verfügbar waren, „ heißt dazu im Schülerverzeichnis der Wiesenbauschule, in Ermert, Otto/Heinrich, Rudolf: 150 Jahre Bauwesen in Siegen. Von der Wisenbauschule zur Universität 1853 bis 2003, Siegen 2003 beigelgte CD?
3) Die Berufsbezeichnung „Kulturbautechniker“ bzw. „Techniker“ entstammt Selbstzeugnissen Ottos, die, wenn ich mich nicht ganz irre, in dem im Quellenverzeichnis aufgeführten Artikel in der „Freiheit“ Einfluß gefunden haben.
Die Berufsbezeichnung „Techniker“ findet sich in den Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft und des Volksgerichtshofes.
4) Noch einmal: Der Text sollte im weitesten Sinne populärwisssnschaftlich verfasst werden. Zu diesem Zweck wurde bspw. auf Fußnoten verzichtet. Benutzte Quellen und Literatur sind angegeben. Die Verwendung des Terminus „Ingeniuerwissenschaften“ ist der geforderten Verständlichkeit geschuldet und sicherlich unpräzise.
5) Wird der Text jetzt deswegen schlechter, weil er womöglich lückenhafte Quellen nicht benutzt hat, die keine Aussage über Heinrich Otto treffen?
6) Der Text versteht sich als Überblick, auf der weitere Forschungen aufgebaut werden können, dies findet sich bereits auf der ersten Seite des Textes. Jeder kann und darf nun weiter zur Biographie Heinrich Ottos forschen. Nach der Endfassung des Textes gab es den Hinweis, dass Heinrich Otto dem Siegener Soldatenrat angehört haben könnte. Ein Beleg ist m. W. noch nicht gefunden.
Ein Weiterforschen ist übrigens nicht durch die Veröffentlichung auf der Kreishomepage geschehen, weil dort entsprechende Möglichkeiten einer Diskussion nicht vorgesehen sind. Daher: siwiarchiv bleibt Labor bzw. Werkstatt.
7) Dieser Text – und er wird somit zu einer Quelle – hat allerdings Forschungen zur Geschichte der Friedensbewegung im Siegerland in Gang gesetzt.
Der Beitrag von Herrn Kraume war nicht der Anlass für meine Arbeit über die Friedensbewegung im Bezirk Sieg-Lahn-Dill. Damit hatte ich bereits vor der Einstellung des Beitrages von Herrn Kraume in den Internetauftritt des Kreises Siegen-Wittgenstein begonnen. Dieter Pfau wies mich auf den Beitrag hin. Ich konnte daraufhin einiges richtig stellen und das Foto vom Führerschein von 1927 beisteuern.
Danke für die Richtig- und Klarstellung!
Na gut, lieber Herr Wolf, vergraulen wir eben die Leser, die hier Spannenderes zu finden hoffen.
Zu 1) Die Formulierung „wahrscheinlich lückenlos“ war eine reine Vorsichtsmaßnahme: Prinzipiell sollte bei historischen Recherchen unterschieden werden zwischen dem, was objektiv nicht existierte, und dem, was der Rechercheur bloß nicht gefunden (oder gesucht) hat. Wenn ich allerdings einen halben Arbeitstag vergeblich dafür geopfert habe, den gewissen Heinrich Otto zu finden, dürfen Sie das „wahrscheinlich“ getrost ignorieren. Hätte er die Schule bis zur theoretischen Prüfung absolviert, wäre er auf jeden Fall mehrfach (nämlich mindestens einmal pro Halbjahr im Zeugnisbuch) aktenkundig geworden, auch wenn alle anderen Nachweise zufällig verlorengegangen sein sollten.
„Kreisausschuss Nr. 538“ kenne ich, ist aber in dem Zusammenhang irrelevant.
Zu 3) Ich habe nicht bestritten, dass Herr Otto kurzzeitig den Beruf eines Kulturbautechnikers ausgeübt haben könnte. Ob zu seinen Selbstzeugnissen auch gehörte, dass er dafür in Siegen ausgebildet worden sei, muß ich eben in der alten „Freiheit“ gelegentlich nachlesen. Spekulationen führen uns am jetzigen Punkt nicht weiter.
Zu 4) Was kann denn ein „unpräziser“ Terminus zur „geforderten Verständlichkeit“ beitragen? Hier wird doch gerade ein Miß-Verständnis provoziert, nämlich dass die Wiesenbauschule mit den zeitgenössischen Technischen Hochschulen vergleichbar gewesen sei.
Zu 5) Woher hätte der Autor wissen sollen, dass er in dem potentiell zuständigen Siegener Archiv keine positive Aussage über Herrn Otto finden würde, wenn er nicht nachfragt? Es gibt hier biographisches Material zu hunderten Schülern, auch Korrespondenzen Ehemaliger mit der Schule, Dienstzeugnisse usw.
Ich habe außerdem nicht behauptet, der Text sei schlecht. Der zweite Satz macht ihn aber auch nicht besser. Das kann mir natürlich alles völlig egal sein; ich bin nicht das Gewissen des Kreises Siegen-Wittgenstein. Bedauerlich finde ich nur, dass hier (wie so oft) versäumt wurde, mit wirklich ganz minimalem Aufwand (menschliche Kommunikation) den Erkenntnisprozess voranzubringen. Es gibt schon genug volkstümliche Legenden, gegen deren Konservierung Historiker und Archivare machtlos sind. Auch in tausend Jahren wird man sich im Siegerland unverdrossen am Stammtisch erzählen, dass Wilnsdorf von Wieland dem Schmied gegründet worden sei, dem Dörfchen Freudenberg im Mittelalter Stadtrecht verliehen worden sei, und was sonst noch das patriotische Herz erwärmen mag. Gegen kollektive Vorurteile kommt niemand mit Fakten an. Von Vertretern der „Zunft“ (angehenden Historikern, betreuenden Archivaren) läßt sich aber doch wohl wünschen, dass sie dieser Mentalität nicht ungewollt Vorschub leisten.
Zu 7) Klar, ich bin auch für den Weltfrieden.
Peace & love,
P.K.
Nur zwei Nachfragen:
1) Wurde die übrige Kreisüberlieferung auf Schülererwähnungen hin überprüft?
2) Könnte Otto denn Wegebauschüler gewesen sein – s. Nr. 2a) meines Kommentar?
Aus Privatbesitz (Großnichte Ottos) liegt hier seit heute als PDF-Datei eine Zeichnung der Gesteinsschichten eines Heinrich Otto für die Wegebauschule in Siegen vor. Die Zeichnung wurde für die Klasse W. 1913/194 erstellt; der betreuende Lehrer war: Gamann, Heinrich bis 1901 Nebenamtlicher Lehrer *1854 †05.03.1932 , 1891 – 1924 WBS Baukunde, Physik, Mechanik, Geometrie, geometr. u. Technisches Zeichnen, Stereometrie, Rechnungswesen
Ein zulässiges Indiz für die Annahme, dass Heinrich Otto, die Weisen- und Wegebauschule in Siegen besucht hat?
Na sehen Sie, geht doch! Das ist nicht nur ein zulässiges, sondern sogar ein überzeugendes Indiz dafür, dass Heinrich Otto die Wegebauschule in Siegen besucht hatte. Allerdings nicht die Kulturbauschule (früher Wiesenbauschule genannt). Diese war (trotz mancher Überschneidungen und der gemeinsamen Unterbringung) etwas anderes. Die Formulierung „zum Kulturbautechniker ausgebildet“ war mir Anlaß genug, mich bei der Recherche auf den Bestand derjenigen Schule zu beschränken, die eine solche Ausbildung angeboten hatte.
Heinrich Otto, „Bureaugehilfe“, hatte vom 2. Oktober 1913 bis zum 27. Juni 1914 die Wegebauschule besucht und die Entlassungsprüfung bestanden. Eine Berufsausbildung war dieser einjährige „Vor- und Hauptkurs“ gewiß nicht. Ob er anschließend zum Führen irgendwelcher Titel (definitiv aber nicht „Kulturbautechniker“) berechtigte, muß ich noch eruieren.
Aus dem Jahresbericht 1914/15 erfährt man, dass die „Abgangszöglinge [einschl. Otto] bald nach der Entlassung in geeigneten Stellen untergekommen“ waren, wohl vor allem im Straßenaufsichtsdienst. „Die Nachfrage war bald nach Ausbruch des Krieges so erheblich, dass sie auch nicht annähernd befriedigt werden konnte.“
Heinrich Ottos Vater Adolf war übrigens Gerber.
In den Akten haben wir auch einen zweiseitigen eigenhändigen Lebenslauf des jungen Otto, den ich bei Gelegenheit hier nachtragen werde, sofern mich der Scanner nicht im Stich läßt.
Hello! Is it okay that I go a bit off topic? I am trying to read your blog on my iPhone but it doesn’t dslaipy properly, any suggestions? You can always email me at Thanks! Ethan
Zu einigen Punkten der Darstellung, die es aus meiner Sicht schon 2010 fragwürdig machten, diese Studenten-Arbeit mit der Autorität der Kreis-website auszustatten:
– „Russische Zwangsarbeiter“? Die meisten waren tatsächlich ukrainische Zwangsarbeiter, gemeint ist mit „russisch“ wohl aber „sowjetisch“? Außer im antikommunistischen Propagandajargon der Adenauerzeit/im Alltagsgerede ist „russisch“ ungleich „sowjetisch“.
– Zu Ottos „Hinwendung zum Kommunismus“ bzw. „Aufbauleistungen …. des Kommunismus“ (in der Britischen Zone??? Nach etwa einer bislang unbekannten, kurzzeitigen Etablierung sozialistischer Verhältnisse durch die britische Militärregierung, wie sie vorausgegangen sein müsste???): Da werden wohl KPD und Kommunismus miteinander verwechselt. Die hier vorgenommene Gleichsetzung von KPD und Kommunismus ist antikommunistischer Propagandajargon der Adenauerzeit/Alltagsdiktion. Man fragt sich, wie ein junger Mann auf sowas kommt..
– „bekleidete den Posten des …“: Propagandajargon, „Posten“, nicht gerade eine wissenschaftliche Kategorie.
– Otto habe zur „Führungsschicht“ der lokalen KPD gehört: zweifelsohne gehörte er zu den führenden Akteuren/der Führungsgruppe der KPD im UB Siegen. Den quantitativen Umfang einer sozialen „Schicht“ erreichte diese Gruppe in dieser kleinen Partei wohl nicht.
– Die RGO-Gewerkschafter waren durchaus nicht nur Mitglieder der KPD. Natürlich gab es dort auch Mitglieder anderer Parteien und Parteilose. Wenngleich die KPD den entscheidenden Einfluss ausübte, so wäre die Etikettierung „kommunistische RGO“ doch allzu undifferenziert. Das gilt in gleicher Weise für die Annahme, es handle sich um eine „Abspaltung“ vom ADGB. Die „Abgespaltenen“ waren von der ADGB-Führung in sehr vielen Fällen rausgeschmissen worden.
– Es wäre gut gewesen, darauf hinzuweisen, dass der UB Siegen der KPD in den 1920er/30er Jahren die politischen Kreise Siegen und Altenkirchen umfasste.
– Otto gehörte mindestens in den 1920er Jahren der Liga gegen den Kolonialismus an. Das war eine im Siegerland mit seinen starken antisemitischen wie generell xenophoben Traditionen außerordentlich seltene Mitgliedschaft.
– M. W. war die „Demokratische Arbeitsgemeinschaft“ zu keinem Zeitpunkt ein Personenverbund, sondern für die kurze Zeit ihrer Existenz ein Zusammenschluss der Parteiführungen von SPD, KPD, LDP (= später FDP) und CDU. Die CDU wurde in dieser Zeit von Zentrums-Leuten wie Albert Schopp, die LDP von eher Linksliberalen wie Josef Balogh geführt. Es gab einen Kreisausschuss und Ortsausschüsse mindestens in Brachbach, Mudersbach, Niederschelden, Niederschelderhütte.
– „Der Modus der Bestellung [richtiger: „Berufung“] hatte zur Folge, dass die linken Parteien überrepräsentiert waren und die CDU unterrepräsentiert.“ Auf welche Zahlen kann der Verfasser seine Behauptung stützen?! Gewählt wurde doch wohl 1945 noch nicht? Es wäre auch gut zu sagen, dass es 1945 darum ging, Weichen zu stellen.
– Otto sei „aus undurchsichtigen Gründen“ aus der KPD ausgeschlossen worden. Da wird suggeriert. Entweder man weiß es oder man weiß es nicht. In diesem Fall schweigt man oder spricht im äußersten Fall von „unbekannten Gründen“. M. W. – das nebenbei – ging es darum, dass Otto ein Verhältnis mit der Frau des lokalen KPD-Vorsitzenden unterhielt. Aber bitte, auch nur eine Annahme. Von einem Zeitzeugen, einer Spezies also, die bekanntlich bei aller Autorität aus natürlichen Feinde des Historikers besteht.
– Was vor allem dem Text fehlt, das sind die Belege. Die können durch eine lückenhafte Quellen- und Literaturliste (was ist z. B. mit Blanchet?) nicht ersetzt werden.
Mit Grüßen aus dem oberbergischen Ausland
Ulrich Opfermann
Dank an die Herren Opfermann und Kunzmann für die kritische Durchsicht und die ergänzenden Fakten! Hier wird redaktionelles Arbeiten erstmals auf siwiarchiv nachvollziehbar gemacht – auch dafür danke!
1) Der Text ist in der Tat frag-würdig. Ein weiteres Beispiel: War Heinrich Otto nach dem Verlust beider Unterschenkel während des ersten Weltkriegs in der Tat in der Lage nach dem ersten Weltkrieg im kaufmännischen Bereich, als Postbediensteter und als Landwirt zu arbeiten? Während Bürotätigkeiten durchaus denkbar erscheinen auf die obige Einlassung Kunzmanns sei verwiesen, ist dies für eine Tätigleit in der Landwirtschaft nur schwer vorstellbar. Hier gilt es die Quellen zu prüfen.
2) Blanchet, Philippe: Die CDU : ein Aspekt des Neubeginns des politischen Lebens im Siegerland 1945-1949 / Philippe Blanchet
(Lille, Univ., Hausarb. 1979) – 1979 ist sicher zur weiteren Präzisierung heranzuziehen.
3) Von zu Hause aus bleibt mir für heute noch die Zweifel Kunzmanns auszuräumen, dass dies für die Leser von siwiarchiv.de uninteressant sei. Gestern war der erfolgreichste Tag in der Geschichte von siwiarchiv.de: 176 Besucher klickten insgesamt 1124 Seiten des Blogs an. Auch sind es schon 150 Besucher mit 339 Seitenzugriffen. Der Blick in der Werkstatt der Historiker und Archivare ist also interessant!
4) Übrigens zum Vergleich der derzeit gültige Wikipedia-Artikel: „Heinrich Otto (Nordrhein-Westfalen)
Heinrich Otto (* 5. August 1893 in Siegen; † 31. Juli 1983) war ein Landtagsabgeordneter der KPD in Nordrhein-Westfalen.
Otto war 1946 Landrat des Kreises Siegen und in der ersten Ernennungsperiode Mitglied des ernannten Landtages von Nordrhein-Westfalen.“
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Otto_%28Nordrhein-Westfalen%29
Traute Fries weist zur frag-würdigen Berufstätigkeit Heinrich Ottos auf folgende Quellen hin:
1) Der Pazifist Nr. 8 v. 22.2.1925, „Pazifisten sind Freiwild in der „freiesten Republik“ Unglaubliche Unternehmer-Freiheiten.“:
[…] „Der erfolgreiche Leiter der pazifistischen Bewegung im Siegerlande, unser Freund Otto, war jahrelang als Angestellter bei einer Siegener Firma tätig. Er ist, obgleich 100 Proz. kriegsbeschädigt, zum 1. Januar 1925 gekündigt worden.“
2) Bernd Schlenbäcker, Biographische Erkundungen zur Zeitgeschichte des Siegerlandes, Kassel 1978, S. 185. „Er [H.O.] war ja schwerbeschädigt und eine Zeitlang war er dann noch beschäftigt. Nachher gab er die Beschäftigung auf und lebte nur noch zum Einsatz für die Friedensgesellschaft. Er konnte sich das erlauben auf Grund von seiner Kriegsbeschädigtenrente.“ (Interview Wilhelm Fries)
Eine wenn auch nur schwache Spur läßt sich vielleicht noch verfolgen (von jemandem, der Zeit hat): Es ist anzunehmen, dass auch in Siegen besondere Kurse für Kriegsversehrte angeboten worden waren. Da Heinrich Otto in einem Adressbucheintrag als „Maschinentechniker“ geführt wurde, wäre es denkbar, dass er nach seiner Verwundung einen entsprechenden Kurzlehrgang besucht hatte. Hierfür wären in Siegen die Eisenfachschule (Akten allerdings verloren) oder die Städtische Fortbildungsschule in Frage gekommen. Hilfreich wären wohl die Unterlagen des „Kriegsbeschädigten-Fürsorge-Ausschusses für den Kreis Siegen“, wo immer diese (wenn überhaupt) liegen. Der Ausschussvorsitzende war anscheinend Landrat Bourwieg. (Die Online-Findbücher zu den Beständen „Landratsamt“ und „Kreisausschuss Siegen“ sind vom Landesarchiv leider vor Monaten aus dem Verkehr gezogen worden.) Beim LWL-Archivamt würde ich in den Beständen 610 bis 612 nur Allgemeineres vermuten, aber man kann ja nie wissen …
P.K.
1) Dem Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein lagen bis zur Publikation hier auf siwiarchiv folgende Reaktionen von in der Siegerländer Zeitgeschichte bewanderten Personen vor:
a) “ …. .es gibt halt immer was zu mäkeln, das sehen Sie ja. Das soll aber den Blick auf das positive Anliegen und seine ansonsten doch wohl gelungene Umsetzung nicht trüben.“
b) “ …… Eine schöne Arbeit, die mir viel Neues eröffnete. Für mich war vor allem die Kontaktaufnahme mit Kämer neu und interessant! …..“
2) Die unpräzise Formulierung, dass die RGO kommunistisch seien, scheint u.a. ihren Ursprung in der Darstellung D. Pfaus zu haben – s. „Christenkreuz und Hakenkruez. Siegen und das Siegerland am Vorabend des „Dritten Reiches“, Bielefeld 200, S. 197).
3) Als weitere Quelle zur Biografie diente das in Kraumes Literaturliste angegebene Handbuch Opfermanns. Der maßgebliche Eintrag sauf S. 243 soll hier zitiert werden: „Otto, Heinrich
*5.8.1893, gest. 31.7.1983 Siegen, Siegen, Kulturbautechniker, im 1. Weltkrieg schwer verletzt (beide Unterschenkel amputiert), KPD (1928ff.), als Bezirksleiter der DFG intensive Aktivität im Raum Siegerland/Dillkreis, Liga gegen den Kolonialismus, nach der Machtübergabe mehrfach inhaftiert, noch in der Zusammenbruchphase Reorganisation der KPD, Politischer Leiter Kreis Siegen (=Stadt Siegen, Krse Siegen, Olpe, Wittgenstein)(bis 1947), Anfang der 1950er JahreAusschluß, dann parteilos, Beratender Ausschuß für den Land- und Stadtkreis Siegen (1945-46), LR Kr. Siegen (1946), Mitgl. Kr-Vorst. Verband der Kriegs-, Bomben- unbd Arbeitsopfer, erster Arbeitsdirektor der Hüttenwerke Geisweid AG, (später Stahlwerke Südwestfalen AG) ….“
Findet sich hier etwas über Heinrich Otto, das über das bisher hier publizierte hinausgeht:
Deutsche Kommunisten: biographisches Handbuch 1918 bis 1945
Autoren Hermann Weber, Andreas Herbst
Verlag K. Dietz, 2004
Länge 992 Seiten?
Wen es denn interessiert: Der persönliche Nachlass von Kreisbaurat Sommer befindet sich im Stadtarchiv Siegen (Sammlung 442, 2 Kartons, 19 Positionen).
Moin aus Norden, Ostfriesland
Mein Name ist Axel Schade, ich bin gebürtiger Siegener, wohne aber bereits seit 2001 aus gesundheitlichen Gründen an der Nordsee. Als Frührentner braucht man ein Hobby, meines ist es, die Geschichte der Sportfreunde Siegen aufzuarbeiten. Dazu stehe ich auch mit dem Verein, in persona mit dem Medienbeauftragten Daniel Schäfer, in Kontakt. Nun zu meinem Anliegen. Ich suche zur Person Alfred Sommer Fotos. Insbesondere aus dem Bereich Sportfreunde und ganz speziell zum ersten Stadion, das Alfred Sommer geplant und gebaut hat. Der Stadtplatz auf der Schemscheid. Können sie mir diesbezüglich Auskunft geben, ob es Fotos gibt und wie ich an Kopien derselben kommen kann. Gruß Axel Schade,
In der Ausstellung “Geschichtsforum Wiederaufbau Siegen” – s. http://www.siwiarchiv.de/2012/05/siegener-architekturgeschichte-1950er-jahre/ – findet sich auch eine Biographie Sommers. Stephan Hahn, Mitglied des Geschichtsforums, weist folgende Gebäude Sommers aus den Nachkriegsjahren nach:
– Gustav-von-Mevissen-Str. 21, Einrichtung einer zweiten Wohnung durch Einbau einer Küche im ersten Obergeschoss, 1954
– Kirchweg 72, Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses (Damen- und Herrenfriseurgeschäft), 1949
– Koblenzer Str. 61, 63, Projekt Garagenbau [damals: Koblenzer Str. 29]
-Siegbergstr. 51, Wohnhaus, (nicht durchgeführt)
– Sandstr. 5, Wiederaufbau des zerstörten Wohn- und Geschäftshauses (Laden, Büro und Wohnung), 1955
– In der Hüttenwiese 28, Lagerhalle, (mittlerweile abgebrochen)
– Marienborner Str. 127, Bau eines Holzlagerschuppens 1951, Bau eines Treibgasflaschenlagers in einer bestehenden Garage der Fa. Richard Bernshausen Holz- und Kohlenhandlung,1956 (mittlerweile abgebrochen bzw. abgebrannt)
– Spandauer Str. 48 + 52, Bau eines Wohn- und Geschäftshauses mit zwölf Wohneinheiten mit vier Garagen, 1960
– Bahnhofstr. 5, Errichtung von Läden in Behelfsbauweise auf dem Trümmergrundstück Cafe + Restaurant Sommer, 1950, nicht durchgeführt
– Bahnhofstr. 5, Errichtung einer Projektionskammer für einen Reklamestand der Westdfeutschen Werbezentrale für Wirtschaftswerbung Hanaua, 1950 (ohne Genehmigung zeitweise errichtet)
Sehr geehrte Damen und Herren.
Ich suche Informationen zur Jugendzeit und Erziehung(Studium)des
Grafen Adolf von Neuenahr Alpen Limburg,der von seinem Vetter Graf
Hermann von Neuenahr Moers als Vormund betreut wurde.
Für Antworten bedanke ich mich im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Uwe Lex
Siegener Zeitung, 23. Mai 2012, S. 4:
„…. Und nach einer genauen Einweisung, was kleine Studenten während der Vorlesung alles nicht machendürfen, konnte Prof. Hering dann samt Powerpointpräsentationen loslegen. ….“
“ …. Der interessierte Nachwuchs zeigte sich – zum Teil mit Wasserflaschen ausgestattet – wie ein richtiger Student von seiner besten Seite und hörte Prof. Dr. Sabine Hering gespannt zu. Die Hochschulprofessorin verstand es, die Geschichte, wie die Universität ins Siegerland kam kundgerecht in einer Art Märchenform dazustellen. Wichtig war es den damaligen Initiatoren, dass bildungsschwache Regionen in den Genuss von Ausbildung kamen. Das ist mittlerweile längst gelungen. ….“
Kleine feine Kirche Ein Beitrag-MEDIATHEK – WDR.devon Marion Seemann, 30.05.2012:
Die Johanneskirche in Freudenberg-Oberfischbach ist ein kleines, eher unauffälliges Gotteshaus. Doch hinter der schlichten Fassade verstecken sich auch Besonderheiten. So ist sie eine der wenigen Kirchen im Siegerland, deren Turmuhr einmal in der Woche noch per Hand aufgezogen werden muss. http://www.wdr.de/mediathek/html/regional/2012/05/30/lokalzeit-suedwestfalen-johanneskirche-denkmal.xml
WDR, Nachrichten Lokalzeit Südwestfalen, 5.6.2012:
„Die Hauberge im Siegerland sollen UNESCO-Weltkulturerbe werden. Dafür will sich der CDU-Bundestagsabgeordnete für den Kreis Siegen-Wittgenstein, Volkmar Klein, einsetzen. Der Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrates, Georg Schirmbeck, glaubt, dass das gute Werbung für die ganze Region sein kann. Er findet, in einer Region in der Forstwirtschaft müsse viel intensiver zusammengearbeitet werden und dafür lohne es sich, öffentlich zu werben. Die Aufnahme in eine UNESCO-Liste sei darum bestes Marketing.“
also im „gästebuch“ dort tummeln sich ja fast nur gaudikids!
dem jungstillinggeist sein bruder, schneckenbremser und viele andere sind dort auch mit bild vertreten.
Danke, Herr Wolf, sehr hübsch geworden.
Das soll natürlich nur eine Ergänzung zu Ihrem Beitrag „Aus dem Fotoarchiv des Kreises“ (19.6.), speziell zum dortigen letzten Bild, sein. Dieses zwischenzeitig von der Kreisverwaltung genutzte Gebäude ist vor genau 100 Jahren für die damalige Wiesenbauschule erbaut worden; heute beherbergt es die „Realschule am Häusling“. Der Namenspatron für die Straße, Louis Ernst, war 1882-1900 Direktor der Wiesenbauschule und zuvor einige Jahre lang Siegener Reichtagsabgeordneter gewesen. In seine Direktorenzeit fiel der Bau des ersten Domizils der Wiesenbauschule (und der Gewerblichen Fortbildungsschule) in der Martin-Luther-Straße, heute Hans-Kruse-Straße.
P.K.
Auch die Thüringische Allgemeine erinnert heute an den 120. Geburtstag Walter Krämers – durchaus mit Siegen-Bezug:
“ ….. So konnten auch mit großer Genugtuung Siegener und Weimarer Bürger erleben, dass sich ihr jahrzehntelanger Kampf für eine Anerkennung der Leistung Walter Krämers gelohnt hat. Der konservative Stadtrat von Siegen hat nunmehr beschlossen, dem Sohn der Stadt, Walter Krämer, ein Denkmal zu setzen. Bürgermeister Steffen Mens [sic!] Begründung zeigt die neue Position: „Es geht bei dieser dauerhaften Ehrung um das humanitäre und selbstlose Handeln und Wirken, das eindeutig über weitem die Kritik an seiner Person überstrahlt“.
Für Weimarer Bürger und Besucher der KZ-Gedenkstätte hat der VVN/BdA Siegerland-Wittgenstein und die Lagergemeinschaft Buchenwald-Dora im Vorraum zum Krematorium eine neue Erinnerungstafel angebracht. Hier kann der Besucher innehalten oder mit einer Blume des 120. Geburtstages von Walter Krämer gedenken.“
Quelle: http://weimar.thueringer-allgemeine.de/web/lokal/leben/detail/-/specific/Im-Gedenken-an-Walter-Kraemer-1927538088
Im Wikipedia-Artikel zu Bourwieg – http://de.wikipedia.org/wiki/Bourwieg – finden sich folgende Hinweise:
– 1883 Mitglied in der Burschenschaft Franconia Freiburg (Quelle: Ernst Elsheimer (Hrsg.): Verzeichnis der Alten Burschenschafter nach dem Stande vom Wintersemester 1927/28. Frankfurt am Main 1928, S. 50.)
– „hatte drei Söhne, von denen die beiden Ältesten im Ersten Weltkrieg fielen“
Bravo, eine gelungene Rezension! Endlich spricht jemand aus, was jedem auffallen muss, sich aber niemand traut offen zu sagen.
Gerade der letzte Absatz kann nicht genug betont werden. Ein „Alternativer Stadtführer 2.0“ wurde nicht nur bewilligt, nein, er nahm gleich mehreren Anträgen im Programm „Toleranz fördern“ die Möglichkeit der Förderung!
Es ist mehr als Unverständlich und mit „Siegener Klüngel“ auch nicht mehr treffend zu beschreiben!
Danke für die ehrliche Rezension, Herr Hesse!
Auf zum Arbeiten an dem mangelhaften Geschichtswissen unserer Kinder!
Die Frage ist nur, wer macht mit? – Überforderte und ausgebrannte Lehrer und Pädagogen, von neuen pädagogischen Versuchen gebeutelte Schüler, überforderte Eltern?
Der Eloge schließen wir uns doch gerne an: „Die ‚Siegerlandbibliothek“ ist aus dem Kulturbereich der hiesigen Region nicht mehr wegzudenken […].“ Und wir zitieren weiter: „Bis vor kurzem als Wissenschaftliche Bibliothek der Stadt Siegen im Oberen Schloss untergebracht, befindet sie sich nun nach ihrem Umzug in Stadtarchiv Siegen im KrönchenCenter in neuen Räumlichkeiten. Sie heißt nun ‚Wissenschaftliche Bibliothek zur Regionalgeschichte‘ […] und gehört zu den wenigen deutschen Regionalbibliotheken“, so ein Bericht in der Zeitschrift “Siegerland“ (Bd. 84, Heft 1 (2007), S. 91). Dem Vernehmen nach soll diese (Freihandbibliothek, rund 15.000 Medieneinheiten) sogar ein wenig zugänglicher sein als ihr Uni-Pendant, und man wird sogar beraten! Insofern ist es schon ärgerlich, dass diese Institution im Zentrum der Stadt – für jedermann zugänglich – in der Berichterstattung über die Siegerlandsammlung der UB nur eine Randnotiz im letzten Absatz wert ist.
Der Vollständigkeit halber: am 24. Mai 2012 vermeldete die „Westfälische Rundschau“: „Hilchenbach entdeckt Hindenburg“ . Die Diskussion um einen Umbenennung der dortigen Hindenburgstraße wurde vom Ehrenvorsitzenden des CDU-Stadtverbandes angeregt.
Die für Juni angekündigte Behandlung einer Bürgereingabe Ruths im Hilchenbacher Hauptausschusses hat laut Ratsinformationssystem noch nicht stattgefunden. Der Ausschuss tatgt erst am 29. August wieder.
In ihrer heutigen Print-Ausgabe berichtet die Siegener Zeitung, dass die Hindenburgstraße in Hilchenbach nicht umbenannt werden wird. Der Straßenname soll vielmehr als Mahnmal erhalten bleiben. Ein Hinweistafel soll über Paul von Hindenburg informieren.
In der Print-Ausgabe der Siegener Zeitung vom 3.9.2012 findet sich der erste Leserbrief zur Nicht-Umbenennung der Hindenburgstraße, insbesondere zum Text der geplanten Hinweistafel („Völlig verfehlt“).
Heute findet sich in den Print-Ausgaben der Siegener Zeitung („Neutralität aufgehoben“) und der Westfälischen Rundschau („Sieger-Land“) ein gleichlautender Leserbrief des ehem. Hilchenbacher Stadtdirektors Dr. Hans Christhard Mahrenholz zur Beibehaltung der Hindenburgstraße in Hilchenbach. Tenor: Mahrenholz war bei seinem Amtsantritt 1962 in Hilchenbach verwundert über die Existenz einer Hindenburgstraße. Um die von ihm empfundene Unausgewogenheit ausgeglichen, schlug er vor eine Nachbarstraße nach Friedrich Ebert zu benennen.
Niederschrift der Hauptausschusssitzung v. 29.8.2012:
“ ….. 4. Änderung des Straßennamens „Hindenburgstraße“
Bürgereingabe von Herrn Wolfgang Ruth
Vorlage Nr. 377
Herr Hasenstab stellt den Sachverhalt kurz dar.
Beschluss:
Der Hauptausschuss macht sich die Sachdarstellung unter Ziffer 4. der
Vorlage zu eigen und beschließt:
1. Eine Umbenennung der Hindenburgstraße erfolgt nicht.
Dabei macht der Hauptausschuss deutlich, dass die Beibehaltung des
Namens nicht mit einer fortwährenden Ehrung der Person Hindenburg
gleichzusetzen ist.
Die Mitglieder sind sich der Fehler und Versäumnisse Hindenburgs
vollauf bewusst.
2. Auf einer Schrifttafel am Straßenschild ist auf die umstrittene
Rolle Hindenburgs bei der Machtergreifung der Nationalsozialisten
hinzuweisen.
3. Auf die Behandlung der Thematik „Hindenburg“ im Rahmen des
Geschichtsunterrichts der Hilchenbacher Schulen ist hinzuwirken.
Abstimmungsergebnis: Einstimmig mit 12 Ja-Stimmen
Ausschnitt an: 360, 147 ….“
Quelle: https://sdnet.kdz-ws.net/gkz040/tops.do?tid=MnzMduEbsGSvGJ
In der Print-Ausgabe der Siegener Zeitung v. 7.9.2012 findet sich ein weiterer Leserbrief (Prof. em. Dr. Ulrich Penski) für die Beibehaltung der Hindenburgstraße und gegen die „verkürzte Sichtweise“ der beabsichtigten Hinweistafel. Folgender Aspekt ist neu: “ …. Umso mehr verwundert es, dass die Bürgereingabe zur Umbenennung nicht etwa von antifaschitischen Gruppierungen stammt, die in verbreiteten Netzwerken solche Umbenennungen betreiben, sondern aus der Mitte des politischen Spektrums. …..“:
Erneuter Anlauf zur Umbennung der Hindenburgstr. in Hilchenbach – allerdings: “ …. Die damals vermiedene öffentliche Debatte soll es auch 2018 nicht geben. Er werde „das Thema nicht nochmals in den Hauptausschuss bringen“, ließ Bürgermeister Holger Menzel den CDU-Politiker wissen. Der lässt das nicht auf sich beruhen und hat sich nun an den Landrat als Chef der Kommunalaufsicht mit der Frage gewandt, ob diese Entscheidung des Bürgermeisters „sachgerecht“ sei. …..“ Quelle: Westfalenpost, 24.5.2018.
Kommentar Steffen Schwabs, Westfalenpost 24.5.2018 dazu: “ …. Die Hindenburgstraße trägt ihren Namen, weil die Nazis im Hilchenbacher Rat 1933 wollten, dass die Stadt sich an Hindenburg erinnert. Wenn sich der heutige Hilchenbacher Rat in dieser Gesellschaft nicht wohl fühlt, sollte er den Namen ändern.
Solche Konsequenz wird aber nicht zu erwarten sein, weil sie weitere Folgen hätte. Denn da ist ja immer noch Bernhard Weiss, Vater des heutigen Eigentümers der SMS group, Heinrich Weiss, der der Stadt gerade den Kulturellen Marktplatz Dahlbruch ermöglicht. Und Weiss war nun einmal nicht nur hoch geschätzter Unternehmer und IHK-Präsident, sondern auch als Wehrwirtschaftsführer im Flick-Prozess des internationalen Militärgerichtshofs in Nürnberg wegen Sklavenarbeit verurteilt worden. Ein Vorbild? Wie Hindenburg?“
Westfälische Rundschau, 30.5.2018, teilt das Ergebnis der Prüfung mit:
„Nach Hauptsatzung der Stadt und Geschäftsordnung des Rates sei „dem Hauptausschuss die Behandlung von Eingaben (….) vorbehalten,“ …. Dem Bürgermeister komme „kein Recht im Sinne einer eigenen materiellen Vorprüfung und anschließenden Verwerfungskompetenz zu.“
Heißt also der Hilchenbacher Hauptausschuss muss sich mit der Eingabe beschäftigen, die Hindenburgstr. in Paul-Benfer-Str. umzubennen.
Auch der der Städte- und Gemeindebund hat eine erneute Behandlung des Antrages empfohlen, so dass der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Hilchenbach am 21.11. das Thema beraten wird.
Quelle: Siegener Zeitung (Print), 16.10.2018
Daß die Universität Siegen, wo immer sie kann, fleißig die Trommel rührt, ist nicht neu. Was sie der Öffentlichkeit präsentiert, sind PR-Texte im Gewand der Sachinformation. Diese sollte man ernst nehmen, aber nicht ernster als andere Werbeanzeigen, die, sagen wir, Hustenbonbons oder Babywindeln anpreisen.
Daß die Universitätsbibliothek die besagten „kleineren Schriften“, die „graue Literatur“, sammelt, die Siegen-Wittgenstein plus Nachbargebiete betreffen, darf man ihr glauben. Indes sind die Lücken erheblich. Es fehlt der UB, um den Überblick über all das, was erscheint, zu bewahren, schlicht an Personal und Know how. Wer je solch „graue“ Schriften gesucht hat, weiß, wie oft er auf lokale Archivbestände, private Hilfe oder die Landsbibliotheken Dortmund und Münster verwiesen war.
Und noch eins: Die Siegerlandsammlung zählt nicht (!) zum Freihandbestand, der dem Nutzer offensteht. Sie steht im geschlossenen Magazin. Wie sagt man so schön? „Aus den Augen, aus dem Sinn.“
Wie jeder andere hatte auch Artur Franz das gute Recht, ein widerspruchsvoller Mensch zu sein. Nistkastenbau für sympathische Käuze und Dokumentierung der heimischen Fauna sind Leistungen, für die er Anerkennung verdient. Nicht Anerkennung sondern kritische Hinterfragung verdient er als Trophäenjäger. Zoologische Leichensammlungen wie die von ihm angelegte sind immer das Ergebnis von Naturfrevel und als Anschauungsobjekte in der heutigen Zeit mit ihrem überreichen Bild- und Filmangebot längst nicht mehr erforderlich, um z.B. Biologiestudenten zu belehren. Jeder Eingriff in die lebende Umwelt, wenn er nichts besserem als der Dekoration des Arbeitszimmers dient, ist überflüssig; besonders ärgerlich wird die Sammelleidenschaft aber, wenn sie zu solchen Auswüchsen führt, wie man sie in der Siegener Zeitung illustriert findet: Stolz wie ein Großwildjäger vor dem erlegten Nashorn posiert die Biologie-Professorin mit Schmetterlingskästen voller Beweisstücke für exzessiven Raubbau: Anscheinend wurde einst skrupellos abgeräumt, was immer vor das Netz geriet, egal wie selten oder bedroht. Wie viele Siegener Biologiestudenten haben bei ihren Spaziergängen wohl schon einmal einen Schwalbenschwanz oder Segelfalter gesehen? An aufgespießten Kadavern herrscht beim „Vogel-Franz“ kein Mangel. Als Highlight der Sammlung sieht man an die 15 Exemplare des in Deutschland seit 1936 (und inzwischen weltweit als einzige nichttropische Schmetterlingsart) streng geschützten und hierzulande fast ausgestorbenen Roten Apollofalters. Welche Überraschungen mögen sich in der Sammlung noch verbergen?
Wie eingangs angedeutet, mag man es der Gedankenlosigkeit oder Getriebenheit des Menschen Adolf Franz zugute halten, dass er die Widersprüchlichkeit seiner Aktivitäten selbst nicht bemerkte. Ihn aber postum zur (Zitat SZ:) „Naturschutz-Legende“ zu stilisieren, ist wohl doch ein wenig unangemessen.
P.K.
„Fehlendes Personal“: Korrekt.
„Fehlendes Know how“: Bitte mal erläutern. Soll das wenige Personal daraus schließen, dass es zu dämlich ist?
„Erhebliche Lücken“: Es gehört nicht zu den Pflichtaufgaben der UB Siegen, sämtliche Lücken zu schließen. Die „Siegerlandsammlung“ kann und soll kein Konkurrenzunternehmen zu den Landesbibliotheken sein. Und so schlecht ist sie ja nun auch wieder nicht bestückt, dass man sich ihrer schämen und sie totschweigen müsste.
„Freihandbestand“: Ja, das war irritierend und ist, wie ich gerade sehe, schon korrigiert worden (übrigens unabhängig von dem schriftlichen Rüffel).
„Aus den Augen, aus dem Sinn“: Was weggeschlossen ist („und zwar für immer“), kann wenigstens nicht so leicht gestohlen werden. Immer positiv sehen!
P.K.
Dank an den nunmehr als Lepidopterologen geouteten Kollegen Kunzmann für die klaren Worte, dem gibt es an sich nichts hinzuzufügen. Außer nochmal meine Fassungslosigkeit beim Anblick des Bildes auszudrücken: Ist die abgebildete Großwildjägerin wirklich Professorin? Oder vielleicht doch nur die ahnungslose Praktikantin der SZ ???
Einzelnachweise zur Lahntalsperree im Landesarchiv NRW, Abt. Rheinland (s. o.):
NW 72 Staatskanzlei , Landesplanung:
345 Lahntalsperre [bei Laasphe] Bd. l 1953-1955
Enthält : Darin : Karten
Altsignatur : 803 i
346 Lahntalsperre Bd. II 1955
Altsignatur : 803 i
Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft
Raumordnung und Landesplanung
NW 310 Nr. 24
Landesplanungsgemeinschaft Westfalen, Sitzungen des Verwaltungsrates
Bd. 5
Feb.-Mai 1960
enthält u.a.: Raumordnungsplan Lahntalsperre
NW 310 Nr: 786
Lahntalsperre Bd. 1: 1955 bis 1957
enthält nur: gutachtliche Vorarbeiten für einen Raumordnungsplan; Gutachten über Auswirkungen und Folgemaßnahmen des Baues (Dr.-Ing. W. Schütte)
Aktenzeichen: 73.00 (732)
Quelle zu Anmerkung 12: Plenarprotokoll 2/56 http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMP02-56.pdf
S. 2073 rechts oben
Spiecker: „Man kann doch wohl behaupten, daß damals gerade die Kirchen das einzige öffentlich-sichtbare Widerstandszentrum gebildet haben!“
(Frau Finger (CDU): „Sehr richtig!“)
Mehr gibt die Stelle nicht her.
In der „Liste der Bestände des Staatsarchivs Marburg mit Angabe ihres Umfanges“ (1963) von Johannes Papritz findet sich auf S. 80 eine Erwähnung der westdeutschen Archivtage.
Eine Durchsicht des „Archivars“ ist erforderlich, denn so findet sich bspw.:
Westdeutscher Archivtag am 10. Juni 1967 in Altena. In: Der Archivar 20, 1967, Sp. 313 (s. a. Kreisarchiv des Märkischen Kreises, Zeitgeschichtliche Sammlung Nr, 140 „Einladung zum Westdeutschen Archivtag am 10.06.1967 in Altena“, „Der Märker“, Westdeutscher Archivtag in Altena 16, 1967 Heft 07/S. 141)
Ein kleiner Hinweis: Die Fußnotenverlinkung ist kaputt, alle Links führen zu „file:///I:/KREISARC/Texte/Maria%20Elisabeth%20Hedwig%20Finger%20geborene%20Schwunk.doc#_ftnref33“
Weiterhin gibt es auch Fußnotenplugins für WordPress, welche die Fußnoten wie üblich hochstellen. Das sieht irgendwie gewohnter aus.Ebenfalls fände ich es nett, wenn im Text nicht unbedingt allgemeinbekannte Gruppierungen verlinkt werden, sofern sie einen Wikipedia-Artikel haben. Die Westdeutsche Frauenfriedensbewegung wäre ein Beispiel und wenn man ein „neues Genre“ etabliert, hat man ja die Freiheit, dieses Genre etwas zu prägen. Aber ich mecker einfach zu gerne zu viel, der Artikel ist extrem gelungen und ich bemäkle einige Kleinigkeiten. Weiter so!
Danke fürs Mäkeln!
1) Ich werde mich um ein Fußnoten-Plugin bemühen. In diesem Fall habe ich den Text nur schnell aus Word herüber geschaufelt. Hochstellen könnte ich zur Not auch mit den Editor …..
2) Entgegen meiner Gewohnheit zu verlinken findet sich hier im Text gar nichts. Asche auf mein Haupt! Ich persönlich gehe gerne großzügiger mit Links um. Die Zielgruppe des Blogs sind ja nicht nur Historiker und Archivare, sondern auch, vielleicht sogar eher, regionalgeschichtlich „Erstinteressierte“.
Landesarchiv NRW – Abteilung Rheinland – BR 2093 Nr. 187: Westdeutsche Archivtage (1910-1939), enthält v.a. Einladungen, darunter eine Anzeige des Westdeutschen Archivtags am 25. September 1910 im Odenwald
Landesarchiv NRW – Abteilung Rheinland – BR 2094 Nr. 115, enthält nur Teilnehmerliste des Westdeutschen Archivtags am 17. Juli 1965 in Dortmund
Vielen Dank für die Ergänzung!
Neben der Bedeutung für die regionale Archivgeschichte werfen diese regionalen Archivtage, der südwestdeutsche existiert ja noch und ein norddeutscher ist mir bei der Literatursuche via google books auch über den Weg gelaufen, einge allegemine archivgeschichtlichenFragen auf: Gab es auch mittel- und ostdeutsche Archivtage? Wer waren die Initiatoren? Welche Archivthemen wurden wie behandelt? Warum hat m. W. nur der südwestdeutsche Archivtag überlebt ? ……
Der Westdeutsche Archivtag 1962 fand Anfang Juli in Koblenz statt. Am 6. Dezember 1961 befasste sich die Dezernentenkonferenz unter der Leitung von Oberbürgermeister Willi Werner Macke mit der Tagung. „Es nehmen etwa 120 bis 150 Personen teil. Koblenz hat durch die Beherbergung des Staatsarchivs und des Bundesarchivs einen Namen in diesen Kreisen bekommen. Ein Empfang der Tagungsteilnehmer durch den Herrn Oberbürgermeister erscheint daher angebracht. Die entstehenden Kosten sollen zur Hälfte vom städt. Verkehrsamt und zur anderen Hälfte aus den dem Herrn Oberbürgermeister persönlich zur Verfügung stehenden Mitteln getragen werden“ (Stadtarchiv Koblenz Best. 623 Nr. 9955, S. 184). In der Sitzung vom 23. Mai 1962 wurde beschlossen: „Herr Beigeordneter Dr. Richter (Kulturdezernent) wurde gebeten, mit Herrn Archivrat Dr. Becker [vom Staatsarchiv Koblenz] den Empfang, evtl. im Rathaussaal, zu besprechen“ (StAK 623 Nr. 9955, S. 255).
Die Koblenzer Rhein-Zeitung berichtete dann in ihrer Ausgabe Nr. 156 vom 9. Juli 1962: „Die Teilnehmer des Westdeutschen Archivtages wurden am Samstagmorgen [7. Juli 1962] durch den Kulturdezernenten der Stadt Koblenz, Beigeordneten Dr. Richter, im Rathaussaal empfangen. Dr. Richter hieß die Gäste im Namen von Rat und Verwaltung willkommen und gab seiner Freude darüber Ausdruck, daß der Westdeutsche Archivtag in Koblenz stattfinde. Er betonte in seiner Ansprache, Koblenz als ehemalige rheinische Provinzialhauptstadt fühle sich noch immer verpflichtet, geistiger Mittelpunkt am Rhein zu sein. Die Stadt bemühe sich sehr um ihre zahlreichen kulturellen Institutionen und unterstütze sie so weitgehend wie möglich. Der Direktor des Staatsarchivs Koblenz, Graf Dr. Looz-Corswarem, dankte für die freundlichen Worte und die herzliche Aufnahme. Unser Bild zeigt (von links nach rechts) den Direktor des Staatsarchivs, Graf Dr. Looz-Corswarem, den Leiter des Bundesarchivs, Direktor Dr. Bruchmann, den Beigeordneten der Stadt Koblenz, Dr. Richter, und Archivdirektor a. D. Dr. Schmidt [ehemals Staatsarchiv] mit Gattin. Das Zusammentreffen der Wissenschaftler, das der Festigung der kollegialen Beziehungen diente, fand nach einem Mittagessen auf dem Rittersturz seinen Abschluß mit einer Besichtigungsfahrt zur Marksburg.“ Die Abbildung in der Rhein-Zeitung ist identisch mit dem bereits erwähnten Foto aus der Sammlung des Landeshauptarchivs Koblenz (LHA Ko Best. 710 Nr. 4759), siehe http://www.archivdatenbank.lha-rlp.de.
In den Beständen des Landeshauptarchivs Koblenz findet sich noch folgende, einschlägige Akte:
LHA Ko Best. 630,001 (Stadt Neuwied) Nr. 3092: Planung des Westdeutschen Archivtags in Neuwied, 1968.
Dank an Kollegin Grosche-Bulla!
“ …. „Die Studierenden finden die Sammlung toll“ sagt Kaludia Witte, viele Fingerabdrücke an den Vitrinenscheiben seien ein eindeutiges Zeichen. Von den ausgestopften Tieren hat Artur Franz keins geschossen oder gefangen. Auf seinen Spaziergängen fand er verendete Tiere oder Bekannte brachten ihm ihre Funde vorbei. …..“ Ziat aus dem Siegerländer Sonntagsanzeiger, 22. Juli 2012, S. 11, Link zur PDF-Datei: http://neu.swa-wwa.de/PDF/22.07.2012/SWA.S11-A-X.22.pdf
Einen Bericht über die Schiffstaufe findet man in der Siegener Zeitung vom 20.8.1966. Der Reeder und Kapitän war Otto Albers. Mit Hapag-Lloyd hatte das Schiff demnach nichts zu tun.
P.K.
Eigentlich hatte ich nicht grundlos „Fortsetzung folgt“ geschrieben. Nun denn der Kollege aus dem Archiv der Hapag-Lloyd war tatsächlich hilfreicher, denn der Rest der Antwort lautete:
“ …..Ich habe …. einen Hinweis auf Ihr Schiff gefunden, den Sie
aber vermutlich schon kennen: http://de.wikipedia.org/wiki/Sietas_Typ_33 . Die Sietas-Werft gibt es immer noch ( http://www.sietas-werft.de/ ).
Falls Sie es nicht schon unternommen haben, empfehle ich Ihnen, sich mit Herrn Kiedel, Archivar beim Deutschen Schifffahrtsmuseum, in Verbindung zu setzen (kiedel@dsm.museum oder info@dsm.museum). Wegen Fotografien verweisen wir gelegentlich an die Schiffsbuchhandlung Wolfgang Fuchs (umfangreiches Schiffsfoto-Archiv der deutschen Handelsflotte seit 1870, http://www.hafenfuchs.de).“
Die SIETAS-Werft antwortete auf meine Anfrage:
“ ….. Die SIETAS Werft hat im Jahre 1966 und 1974 Schiffe mit dem Namen „SIEGERLAND“ an die Reederei Otto Albers in Hamburg- Neuenfelde abgeliefert.
Warum die Reederei den Namen „SIEGERLAND“ für die Schiffe gewählt hat wissen wir nicht.
Die ReedereI Otto Albers gibt es heute nicht mehr.“
Den anderen Hinweisen bin ich noch nicht nachgegangen -aus Gründen.
Guten Tag,
ich bin ein Enkel von Otto Albers und bin eben durch Zufall auf diese Seite gestoßen. Meine Oma kam aus Kreuztal, daher die Verbindung zum Siegerland.
Wünsche allen einen schönen Tag
Otto Köhler erinnert mit seinem Artikel „Als der Geier starb. Teil 1“ in linken Tageszeitung „Junge Welt“ (28./29.7.2012, Nr. 174, S. 10-11) an den Tod Friedrich Flicks.
Auch das 25jährige Jubiläum wurde gefeiert. Der Siegerländer Heimatkalender 1988, S. 176, vermerkt für den 2. Juli 1987 folgendes:
„Anläßlich des 25jährigen Bestehens des Gillerbergheims eine kleine Jubiläumsfeier, zu der auch ein Forstdirektor aus Düsseldorf sowie andere prominente Gäste gekommen waren. Allenbacher Tanzgruppe trug zur Unterhaltung bei.“
Mal wieder die Geschichte von Keil und Klotz
Das konnte ja nicht ausbleiben, dass der selbst ernannte Internet-Archivordnungshüter seinen Senf zur Schließung des Stadtarchivs durch’s Netz schleudern musste.
Just davor hatte ich seinerzeit gewarnt (Herr Wolf mag sich erinnern): Wer unbedingt einen regionalen Blog zum Archivwesen einrichten will, muss damit rechnen, dass irgendein Schnüffler im hintersten Winkel der Republik (oder gar noch weiter draußen) vor seinem Bildschirm hockt und seine von jeglicher Kenntnis örtlicher und sachlicher Eigenheiten säuberlich befreiten Kommentare absondert . Warum wohl sind dem Großinquisitor des Netzes unsere regelmäßigen Schließungen der letzten Jahre, alle auf unserer homepage angekündigt, entgangen? Wie abgehoben von der Archivwirklichkeit muss einer sein, um die Notwendigkeit einer temporären Schließung in einem Kommunalarchiv mittlerer Größe derartig zu verkennen? Was nämlich tut das Häuflein der von Personalnot und Arbeitsüberlastung geplagten Archivmitarbeiter in den drei Wochen (das macht auch an der holländischen Grenze immer noch keinen Monat)? Es verzeichnet Akten, Akten und nochmals Akten, wohl auch Fotos und Karten, alles zur Steigerung des benutzerfreundlichen Archivangebots.
Schließlich: Über die Gründe, warum der Text unserer Ankündigung dieses Jahr etwas strenger ausgefallen ist, will ich mich gar nicht äußern. Noch immer ist jedem, der während der Schließung mit einem angemessenen Anliegen zu uns kam, die Tür geöffnet worden. Davon spricht allein die jetzt schon feststehende Zahl an Ausnahmeterminen eine beredte Sprache. Aber für Nachfragen resp. saubere Recherchen haben Vielschreiber ja keine Zeit.
Und ein Letztes: Am 26.02.2012 schrieb ein gewisser Klaus Graf auf Archivalia: „Nach dem Treffen der Hochschularchivare in Siegen machte ich Gebrauch von den großzügigen Öffnungszeiten des Stadtarchivs Siegen …“ Ja, was denn nun? Um es mit des Kritikers eigenen Worten zu sagen: „Gesabber“.
PS: Da ich nun wirklich keine Veranlassung sehe, während meiner Dienstzeit auf jede Blähung im Netz zu reagieren (die pflege ich zur benutzerfreundlichen Beantwortung von sachlichen Anfragen zu nutzen), war ich leider genötigt, diese Zeilen während meiner Freizeit zu schreiben. Auch schade…
In der Print-Ausgabe der Siegener Zeitung v. 11.8.2012 findet sich in der Rubrik „Heimatland“ der Artikel von ph: „Vom Wunsch zur Wirklichkeit. 50 Jahre Jugendwaldheim auf dem Giller. Eine Erfolgsgeschichte“ – beachtenswert das Bildmaterial daus dem Zeitungsarchiv.
In einer noch unverzeichneten Akte der Kreisverwaltung Siegen Wittgenstein, die Vorarbeiten zu folgender Publikation – Landkreistag Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Landräte und Oberkreisdirektoren in Nordrhein-Westfalen 1945–1991. Düsseldorf 1992 – enthält, findet sich folgender Hinweis:
“ …. Nach Erinnerung des Oberkreisdirektors a. D. [Wilfried] Lückert (Vorsitzender des Wittgensteiner Heimatvereins) wurde 1945 von der englischen Militärregierung ein Mann namens „Schläper“, der als Evakuierter in Berleburg lebte, zunächst als Landrat eingesetzt – etwa für 4 Wochen. Er wurde abgelöst durch einen Studenten, der als Dolmetscher bei der Militärregierung tätig war. Sein Name war Wendtland. H. Wendtland wurde nach kurzer Zeit von Herrn Nacken abgelöst. (s. auch beil. Ansprache des Landrates Nacken S. 2 unten)
Nähere Informationen zu den Herren Schläper und Wendtland sind nicht zu bekommen. ….“
Da schau her: „Er wolle nunmehr mit Herrn Flick verhandeln“ etc.
Seinerzeit „Landschaftspflege“, jetzt „Private Public Parntership“.
Da spart der Spender bei den Steuern, im konkreten Fall. Wenn’s wg. leerer Kassen als Prinzip anerkannt ist, dann zudem generell. Die Idee hat sich ja inzwischen rundum durchgesetzt,: die Sätze sind heuer so niedrig sind wie nie, für den, der hat. Eine echte Erfolgsgeschichte ;-)
Aus den hier zitierten Äußerungen geht nicht hervor, ob Friedrich Flick tatsächlich Geld für das Gillerbergheim gespendet hat. Allerdings bleibt bemerkenswert, dass man mit Flick diesbezüglich sprechen wollte. Ist dies Flicksche „Landschaftspflege“ oder „Flick-Pflege“ durch die „Landschaft“?
“ …. „Das ist ein Bodendenkmal von europäischem Rang.“ … Bis zum 20. September noch dürfen Grabungsleiterin Dr. Jennifer Garner (Deutsches Bergbaumuseum Bochum) und ihr Team weiter buddeln. Dann läuft die Genehmigung aus, sie müssen das Grabungsgelände wieder verfüllen. …. So jedenfalls die Auflage der Behörden, das Waldgebiet ist schließlich Wasserschutzgebiet. …..Die Waldgenossenschaft Niederschelden, die Heimatgruppe Niederschelden und der Heimatverein Niederschelderhütte wollen nicht tatenlos zusehen, sie untersützen die Archäologen im Ansinnen, das Grabungsgelände samt Öfen für die Nachwelt zu sichern. …..Kreisheimatpfleger Dieter Tröps (Bürbach war gestern Morgen auch vor Ort. Unterstützung hat er den grabenden Experten und den Heimatfreunden zugesagt. …. Paul Breuer müsste die Untere Landschaftsbehörde bzw. die Untere Wasserbehörde dazu bewegen, dass die Grabungsstätte nicht im Herbst verfüllt werden muss. …..“
Quelle: Siegener Zeitung (Print), 25. August 2012, S. 3, „ist am 20. September für immer Schluss?“
Die Siegener Zeitung und die Westfälische Rundschau berichten am 29.8.2012 über den gemeinsamen Antrag der Kreistagsfraktionen der CDU, FDP und der UWG, der eine abschließende archäologische Erkundung des Geländes beinhaltet. Link zur gemeinsamen Pressemitteilung der genannten Parteien.
In der Siegener Zeitung vom 18. August 2012 (Sonderseite „100 Jahre Bismarckhalle“) findet sich der Bericht „Milchbar gehörte zur Pacht“:
“ …. Zum Pachtgegenstand gehörte in den fünfziger Jahren auch die sogenannte Milchbar im benachbarten Stadtbad. …..“. Folgende Pächter führt der Bericht auf: Eheleute Hans Tepe aus Münster 1955 – 1958, Eheleute Bingener 1958, Eheleute Munkelwitz 1959 – 1960, Eheleute Marianne und Werner Gerlach 1960 – 1964.
Dank an Frau Luke für den Hinweis!
Bis zum Ende der Sommerferien in NRW wurde „Lambert und Laurin“ insgesamt 62 heruntergeladen (- Danke für die schnelle Zahlenlieferung gebührt Herrn Müller von outline development!). Erfahrungsberichte, Kritik, gerne auch Lob sind sehr erwünscht.
Interessant wäre zu wissen, warum die Synagoge als Motiv gewählt wurde. Das Motiv hat in der Entstehungsphase für leichte „Verwirrung“ bei einigen Passanten gesorgt, die vereinzelt auch die Künstlerin gefragt haben, was das wohl für eine Kirche sei. Ist eine Informationstafel an der Stelle geplant? Hoffentlich ist darin dann nicht auch von „der in 1938 abgebrannten Siegener Synagoge“ die Rede. „1938 von den Nationalsozialisten in Brand gesteckten/ zerstörten Synagoge“ o.ä. wäre treffender.
Ansonsten ist das Projekt künstlerisch wertvoll und bringt etwas Farbe nach Siegen. Bleibt zu hoffen, dass an der Stelle keine illegalen Graffiti gesprüht werden.
Aus dem Newsletter der Körber-Stiftung zum Geschichtswettbewerb:
“ Liebe Freundinnen und Freunde der historisch-politischen Bildung,
am 1. September hat der neue Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten begonnen. Bis 28. Februar 2013 können Kinder und Jugendliche zum Thema »Vertraute Fremde. Nachbarn in der Geschichte« auf Spurensuche gehen. Wir bieten zur neuen Ausschreibung umfangreiche Materialien und Fortbildungen für Schüler und Tutoren an.
Im europäischen Geschichtsnetzwerk EUSTORY kommen die Preisträger vergangener Wettbewerbe zu zwei Akademien im September zusammen, das FutureLab Europe begrüßt neue Teilnehmer und in zahlreichen Veranstaltungen in und außerhalb Hamburgs widmen wir uns der historisch-politischen Bildung und der Zukunft Europas. Mehr dazu in diesem Newsletter.
Start des neuen Geschichtswettbewerbs
Die neue Ausschreibung
In der neuen Ausgabe von spurensuchen dreht sich alles um die Ausschreibung »Vertraute Fremde. Nachbarn in der Geschichte«. Historische und aktuelle Nachbarschaftsgeschichten, Hintergrundartikel und Tipps sowie die »Gelben Seiten« mit den vollständigen Wettbewerbsunterlagen bereiten Jugendliche und Tutoren auf den Wettbewerb vor. Einzelhefte und Klassensätze können unter edv@awu.de bestellt werden. Basisartikel und Gelbe Seiten stehen auch online – – http://www.koerber-stiftung.de/bildung/geschichtswettbewerb/thema-nachbarn/magazin-spurensuchen.html – zur Verfügung.
Weiteres Material zum Wettbewerb
Zum Start des Geschichtswettbewerbs erscheint eine Sonderausgabe des Online-Magazins »Lernen aus der Geschichte«. Die vorgestellten Projektbeispiele, Onlinequellen und Unterrichtsmaterialien widmen sich ganz dem Thema »Nachbarn in der Geschichte«. Didaktiker und Praktiker geben Methodentipps zur historischen Projektarbeit.
Das Magazin zum online lesen und PDF-Download: http://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und-Lehren/Magazin
Sonderwettbewerb zu deutsch-französischen Beziehungen
Grenzüberschreitende Projekte zur deutsch-französischen Nachbarschaftsgeschichte haben eine doppelte Preischance. Sie können im Geschichtswettbewerb und einem Sonderwettbewerb der Körber-Stiftung mit der Föderation deutsch-französischer Kulturhäuser eingereicht werden. Diese Initiative unter der Schirmherrschaft der Bevollmächtigten für deutsch-französische Kulturbeziehungen, Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer, gehört zum Begleitprogramm der Feierlichkeiten zum 50. Jubiläum des Elyséevertrags.
Nähere Informationen hier: http://www.koerber-stiftung.de/bildung/geschichtswettbewerb/sonderinitiative/deutsch-franzoesischer-wettbewerb.html
Sonderinitiative »Deutsche und Polen: gegeneinander, nebeneinander, zusammen.«
Wettbewerbsarbeiten zur deutsch-polnischen Nachbarschaft haben in einer gemeinsamen Initiative mit der KARTA-Stiftung, unserem EUSTORY-Netzwerkpartner in Polen, ebenfalls eine doppelte Chance. Der polnische Geschichtswettbewerb »Historia Bliska« (Geschichte ganz nah) thematisiert in der nächsten Ausschreibung das Verhältnis Polens zu seinen Nachbarstaaten. Beiträge zu den deutsch-polnischen Beziehungen nach 1945 können unter bestimmten Bedingungen an beiden Wettbewerben teilnehmen oder Sonderpreise erringen. Ausschreibung der Sonderinitiative: http://www.koerber-stiftung.de/index.php?id=3733
Workshops für Schüler und Lehrer
Tutoren, und solchen, die es werden wollen, bieten unsere Lehrerworkshops Methodentraining und Erfahrungsberichte sowie Themen- und Quellenbeispiele zur Ausschreibung »Nachbarn in der Geschichte«.
Im bundesweiten Lehrerworkshop für »Einsteiger« sind noch einige Plätze frei. Er findet vom 16. bis 18. September im KörberForum in Hamburg statt.
Mit unseren Kooperationspartnern in den Bundesländern organisieren wir in den nächsten Wochen Tagesworkshops zum Geschichtswettbewerb, die überwiegend als Lehrerfortbildung anerkannt sind.
Termine und Anmeldemöglichkeiten: http://www.koerber-stiftung.de/bildung/geschichtswettbewerb/fortbildung/lehrerworkshops.html
Schülerworkshops zur DDR-Geschichte
Deutsch-deutsche Nachbarschaftsgeschichten gilt es bei zwei weiteren Schülerworkshops zu entdecken. Das sächsische Kultusministerium veranstaltet vom 20 bis 22. September das erste sächsische Geschichtscamp. Das »Zeitwerk« des Landesjugendrings Brandenburg lädt vom 1. bis 5. Oktober zum Workshop »Leben mit der Mauer« ein. Bei beiden Veranstaltungen sind nur noch wenige Plätze verfügbar.
Informationen und Anmeldemöglichkeit: http://www.koerber-stiftung.de/bildung/geschichtswettbewerb/fortbildung/schuelerworkshops.html
Hinweise zur Archivarbeit
Jeder Ort und jede Familie hat eine eigene Nachbarschaftsgeschichte. Ein Blick in die Quellenübersichten, die unsere Partner aus Staats- und Stadtarchiven zusammengestellt haben, kann aber dennoch inspirieren, in welchen Beständen sich das »Wühlen« vor Ort lohnt.
Eine Übersicht über Archive mit eigenen Ansprechpartnern für Schülerprojekte findet sich auf den Seiten des Arbeitskreises Archivpädagogik und Historische Bildungsarbeit.
Auch die Archive der Stasi-Unterlagenbehörde BStU und ihrer Außenstellen unterstützen den Wettbewerb. Dennoch braucht die Bearbeitung und Bereitstellung dieser Quellen etwas Zeit. Anträge zur Nutzung von Akten sollten daher möglichst frühzeitig gestellt werden. Um eine schnelle und kostenlose Bearbeitung zu erreichen, ist eine Bescheinigung der Schule unbedingt nötig und der »Spurensucherpass« des Wettbewerbs hilfreich.
Geschichtswettbewerb und Web 2.0
Seit August ist der Geschichtswettbewerb mit einem eigenen Profil auf Facebook vertreten. Unter http://www.facebook.com/geschichtswettbewerb informieren wir über die Angebote rund um den Wettbewerb und Neuigkeiten von unseren Kooperationspartnern. In den nächsten Wochen werden wir zudem das eine oder andere Fundstück zum Thema Nachbarn in der Geschichte ausgraben und präsentieren.
Bereits seit dem Frühjahr ist der Bereich Bildung auf Twitter – https://twitter.com/sven_tetzlaff – präsent. Auch dort gibt es regelmäßig Informationen und Denkanstöße zur historisch-politischen Bildung. Und wer selbst aktiv werden möchte, dem empfehlen wir diesen lesenswerten Twitter-Leitfaden speziell für Historiker. …..“
Wir liegt leider der Artikel (Siegener Zeitung (Print), 25. August 2012, S. 3, “ist am 20. September für immer Schluss?”) nicht im Original vor, aber nach meiner Einschätzung sollten die Behörden hier einen Ausnahmeregelung machen. Es ist grundsätzlich richtig, dass wenn das Grabungsgelände in einem Wasserschutzgebiet liegt, die Stelle eigentlich wieder verfüllt werden muss. Ein dauerhaftes Offenhalten der Stelle ist sicher eine Prüfung wert, ebenso die Abwägung der Interessen des Wasserschutzes und der Heimatpflege bzw. des Fremdenverkehrs. Ich denke, dass der Gewinn durch die Ausgrabung für die Wissenschaft wie auch für den Tourismus und die Heimatpflege für die Region nicht zu verachten ist. Es wird sicher schwierig sein, die Öfen zu konservieren und einen freien Zugang zu ihnen trotz des Wasserschutzgebietes zu gewährleisten, aber man könnte auch über eine Translozierung der Öfen nachdenken. Und wenn es nur das „Anheben“ im Block ist, so dass die Öfen zukünftig oberirdisch stehen würden. Für Niederschelden wäre eine Art Freilichtmuseum bzw. archäologische Station sicher eine Bereicherung zumal sich die Heimatgruppe Niederschelden und der Heimatverein Niederschelderhütte sicher bei einem solchen Unterfangen beteiligen würden.
In der heutigen Print-Ausgabe der Siegener Zeitung findet sich ein Leserbrief „Regisseur, nicht Akteur“ zur Rolle Hindenburgs als Militärbefehlshaber und Politiker in der Weimarer Zeit. Ein sich auf Wolfgang Pyta berufendendes Zitat: “Er sei nicht Akteur, sondern Regisseur des Untergangs [der Weimarer Republik] gewesen!”
Ergänzungen zu Landrat Dörnberg:
1) Unser Heimtland 1967, S. 10:
“Nachdem sich am 18. August 1866 der Norddeutsche Bund konstituiert hatte, wurde am 12. Februar 1867 die erste allgemeine Reichstagswahl ausgeschrieben, für die allerdings das Dreiklassenwahlrecht maßgebend war. Ihr Ergebnis konnte damit damit nur ein die politische Meinung stark verzerrender Spiegel sein. Bei den auch im Wahlkreis Siegen-Wittgenstein-Biedenkopf durchgeführten Wahlen war hier zum Abgeordneten für den Reichstag des Norddeutschen Bundes der Landrat Freiherrn von Dörnberg aus Siegen gewählt worden. Auf ihn wurden 11547 Stimmen abgegeben; sein Mitbewerber, der Kreisgerichtsdirektor v. Beughem aus Neuwied, erhielt 5182 Stimmen. Dies geht aus einer am 19.Februar 1867 im Siegener Kreisblatt (früher Intelligenz-Blatt) erschienenen amtlichen Bekanntmachung hervor.
Dieser Wahl war ein wochenlanger Wahlkampf voraufgegangen, der in zahlreichen Veröffentlichungen des Intelligenz-Blattes seinen Niederschlag fand. Jetzt, wo die Wahl vorbei war, hielt es der Königl. Landrat v. Dörnberg für an der Zeit, in bezug auf einige ihm gemachte Vorwürfe eine Art von Rechenschaftsbericht abzulegen …..”
Klingt als wäre die Beschäftigung mit dem ersten Wahlkampf in Siegen-Wittgenstein nicht uninteressant.
2) In der Siegener Zeitung vom 21.5.1965 findet sich eine Würdigung der “Statistischen Nachrichten” (1865) durch den Siegener Stadtarchivaren Dr. Wilhelm Güthling: “…. Gleichzeitig aber erschien, ebenfalls als Druck der Vorländerschen Druckerei eine Veröffentlichung des Kreises Siegen. Auf 170 Seiten waren hier “Statistische Nachrichten über den Kreis Siegen aus den Jahren 1860-1865 ….zusammengestellt von dem Königlichen Landrat Freiherr von Dörnberg”. Diese Schrift ist offensichtlich ohne Zusammenhang mit der Fünfzigjahrfeier [der Zugehörigkeit Westfalens zu Preußen, Anm. Bearb.] erschienen. Sie ist vielmehr eine echte Landeskunde, für die wir heute, nach hundert Jahren, der damaligen Kreisverwaltung besonders dankbar sein müssen. …… Man kann nur bedauern, daß keiner seiner Nachfolger ….. ähnliche “Statistische Nachrichten zusammengestellt hat..”
Heute in der Printausgabe der Siegener Zeitung (S. 3) wird über die Kreistagssitzung (s. o.) berichtet:
„…. Eine finanzielle Beteiligung [des Kreises] an dem Projektsei aufgrund fehlender gesetzlicher Verpflichtung nur im Rahmen einer freiwilligen Leistung möglich, hieß es dazu in der Sachdarstellung des Kreises. Im Vorfeld der Grabungen habe es Kontakt zur Unteren Landschaftsbehörde gegeben, die für die Grabung eine Ausnahmegenehmigung erteilt habe, die über das Jahr 2009 [!] hinaus stillschweigend weiter verlängert worden sei „und die auch zukünftig stillschweigend weiter verlängert werden wird“ [!]. Eine mögliche Verfüllung und eventuelle Zerstörung von Bodenfunden hatten die Fraktionen in ihrem Antrag ebenfalls befürchtet. Dagegen wies der Kreis darauf hin, dass eine behördliche Verpflichtung zur Verfüllung des Geländesnicht bestehe. Der Antrag wurde in der Kreistagssitzung einmütig [!] und ohne Aussprache [!!] angenommen.“
Schön, wenn wir schnell und erfolgreich helfen konnten. Die Idee wurde übrigens von der CDU (maßgeblich Werner Schulte und Bernd Brandemann) initiiert und an UWG und FDP herangetragen. Als Historiker konnte ich mich da eh nicht verwehren und die FDP-Fraktion sah das genauso. Ein spannendes Grabungsprojekt. Es wäre schön, wenn man auch unseren Vorschlag aufgreifen würde, das Grabungsfeld didaktisch zu erschließen, um zu verstehen, was dort ausgegraben wird.
Ich habe von 1938 -56 in Siegen gelebt.Eisernerstr.26.Ich habe mich im Internet umgeschaut,aber ich erkenne kaum noch etwas.Werde demnächst noch einmal die Stadt besuchen. Sami
Die Siegener Zeitung berichtete heute [erst ? – s.u.] im Print, dass
Vertreter der CDU-Stadtratsfraktion mit dem Bundestagsabgeordnete
und CDU-Kreisvorsitzenden Volkmar Klein die Ausgrabungsstätte besuchten. haben. Zitat: „….. Wie dies [Zugänglichmachung für Besuchende] zukünftig geschehen könnte, darüber hat sich der Archivtekt Christian Welter schon Gedanken gemacht. Er präsentierte erste Entwürfe zur Einhausung des Areals.“
Über den (?) Besuch bloggte Volkmar bereits am 17.9.2012 (mit Bild): http://www.volkmarklein.de/index.php?option=com_content&view=article&id=1356:1792012-eisen-und-stahl-praegen-siegerlaender-identitaet-&catid=56:blog&Itemid=112
„Redaktion des Unger Blattes“??? Wohl ein Tippfehler. Schnabel war Redakteur des ab 1835 in Gummersbach erschienenen „Agger-Blattes“.
Bei der Eröffnung dieser neuen „Baustelle“ wäre es hilfreich, Genaueres über den Hintergrund zu erfahren. Will die Auszubildende und/oder das Kreisarchiv an dem Thema dranbleiben / soll etwas Umfassenderes erarbeitet werden / sind unsichtbar für die Siwi-Leser schon weitere Stellen (Archive) in die Recherchen involviert worden? Wenn die Angelegenheit so vage gehalten ist, verspürt man nicht unbedingt das Bedürfnis, mit einzusteigen. Und man will sich ja auch nicht aufdrängen. :-)
Das Kreisarchiv stellt bei Recherchen zu Persönlichkeiten und Themen der Kreisgeschichte die ermittelten Informationen für eine evt. spätere Verwendung zusammen. Verfügt das Kreisarchiv über eine Pratikantin/einen Praktikanten so werden die Recherchen auf das vor Ort schnell Ermittelbare ausgedehnt.
Das Kreisarchiv hat in diesem Fall ferner das Landesarchiv NRW nach einer Personalakte, sowie das Universitätsarchiv Marburg nach einer Promotionsakte befragen. Sobald Ergebnisse vorliegen, werden sie hier als Kommentar eingestellt.
Nichts spricht dagegen, diesen Eintrag als Start für eine tiefere Beschäftigung mit Schnabel zu verwenden. Bei der Bedeutung für die Geschichte der Universität Siegen, wäre der „Bildungshügel“ vielmehr der geeignetere Platz als das ehem. Mädchengymnasium. ;-)
Nach der Personalakte hatte ich in Münster vor ein paar Jahren schon gefragt. Anscheinend gibt es dort keine. Informationen zu Schnabel finden sich dort aber in anderen Akten.
Das Universitätsarchiv Bonn hat eine Akte über den Studenten Schnabel. Der Umfang ist so gering, dass man sicher eine Kopie erbetteln kann.
Ein paar Briefe Schnabels (v.a. an den Chemiker Emil Erlenmeyer) liegen mir als Kopie bzw. Digitalisat vor, die müßte man also nicht noch einmal bestellen.
Die Korrespondenz mit Justus von Liebig ist verschollen. Anfrage beim Giessener Liebig-Archiv: negativ. (Einen Brief Liebigs an Schnabel gibt Kruse in seiner Gymnasiums-Festschrift 1936 nur nach einer Abschrift Suffrians wieder; diese soll in den Akten der Bürgerschule enthalten sein.)
Einen Nachlass Carl Schnabels jun. (zuletzt Prof. an der Bergakademie Clausthal), in dem man auch Unterlagen seines Vaters erwarten könnte, gibt es im Uni-Archiv Clausthal nicht.
Zu den von Schnabel jahrelang gehaltenen öffentlichen Vorträgen im Siegerland (Siegen, Kreuztal) sollte noch regional recherchiert werden.
Und so weiter.
P.K.
Danke für die ausführliche Antwort! Die Korrespondenz mit Erlenmeyer haben Sie dem Archiv des Deutschen Museums in München entnommen? Kalliope weist auf ein Brief dort hin, sowie auf einen Brief Schnabels an Johann Friedrich Benzenberg im Düsseldorfer Heinrich-Heine-Institut.
Deutsches Museum München: Schnabel an Erlenmeyer, Siegen 8.9.1869.
Heine-Institut Düsseldorf: an Benzenberg, Gummersbach 13.11.1836 (Bericht des jungen Lehrers über ein Schülerprojekt: Beobachtung von Sternschnuppen).
Ferner (nicht in KALLIOPE) Hugo-Dingler-Archiv in der Hofbibliothek Aschaffenburg: Schnabel an Erlenmeyer, Siegen 5.11.1846, 15.1.1847, 28.6.1847, 11.2.1849. Erlenmeyer, damals noch Student bei Liebig in Giessen, war mit den Siegener Hanekroths näher verwandt, was vielleicht seine frühe Bekanntschaft mit Schnabel erklärt. (Im Dingler-Archiv – H.D. war ein Enkel Erlenmeyers – sind übrigens auch 5 Briefe von Louis Ernst an den Chemiker aus den 1890er Jahren vorhanden.)
Nachtrag zum Lebenslauf:
Vorname der Mutter laut Personenstandsunterlagen (Stadtarchiv Siegen): Wilhelmine; wäre zu klären.
Schnabel war zweimal verheiratet: 1. Hermine (wie oben angegeben), aus dieser Ehe mind. 5 Kinder; 2. (1855) Charlotte Sophie geb. Manger, 1822-1867. Eugen, Sohn aus 2. Ehe, war beim Tod des Vaters (den er standesamtlich anzeigte) „Handlungslehrling“ in Siegen.
Der Sohn Carl hat einen autobiographischen Roman „Unter grünen Tannen“ hinterlassen, der aber in Bezug auf den Vater unergiebig ist. (Man erfährt immerhin, dass klein Carlchen daheim einmal Prügel bezog, weil er Vaters Mineraliensammlung geplündert hatte.)
Geheimes Staatsarchiv Berlin: I HA, Rep. 76, Va, Sekt. 3, Tit. X, Nr. 4, Bde. 1 u.2, ent. Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Seminars Bonn, darin auch Erwähnungen Schnabels.
LAV NW W: Regierung Arnsberg Nr. 463 = Konduitenlisten: Hilft nicht weiter (Schnabel aufgeführt, aber keine „besonderen Bemerkungen“).
LAV NW W, Oberpräsidium Nr. 214 a, Höhere Bürgerschule Siegen 1842-65, enth. Berichte Schnabels an OP Vincke über die von ihm im Sommer 1843 in Kreuztal gehaltenen naturwissenschaftlichen Vorträge für Gewerbetreibende.
Ebenda fol. 176-178: Charakterisierung Schnabels in einem Bericht der Kgl. Regierung an das Oberpräsidium 1849 „betr. die Haltung der höheren Bürgerschule zu Siegen“.
Die für eine Biographie evtl. relevanten Passagen aus diesen Archivalien liegen mir in Abschrift vor.
Alles bereits Vorhandene reicht m.E. für ein wirklich abgerundetes Lebensbild längst nicht aus. Es bleibt noch viel zu tun!
P.K.
Danke für die freundliche Belehrung; die Großschreibung von Eigennamen ist auch dem Stadtarchiv bekannt. In der Vorlage für den Kulturausschuss ist der Text in Großbuchstaben gesetzt und so auch im Ratsinformationssystem der Stadt Siegen zu finden. Der Beitrag wurde nicht vom Stadtarchiv in den Blog gestellt.
Im Universitätsarchiv Marburg ist unter der Signatur 307d Nr. 71 II die Promotionsakte Schnabels erhalten. Sie enthält das Promotionsgesuch, die Stellungnahmen der Professoren dazu, einen handgeschriebenen Lebenslauf in lateinischer Sprache, das Abiturzeugnis, das Abgangszeugnis der Universität Bonn, ein handgeschriebenes Exemplar der Dissertation in lateinischer Sprache sowie das Doktordiplom.
Hartmut Prange weist darauf hin, dass in der Liste der nach Theresienstadt deportierten Personen Jakob Wolff aus Arfeld fehlt und stellt daher dankenswerterweise seine Forschungsergebnisse zur Familie Wolff zur Verfügung:
„Henriette und Jakob Wolff aus Arfeld
Henriette Wolff, geb. Löwenstein, geboren am 5. Oktober 1872 in Arfeld. Sie war Tochter des David Löwenstein (1840-1910) und seiner Frau Karoline Löwenstein, geb. Löwenstein aus Arfeld. David Löwenstein arbeitete in Arfeld als Metzger und wohl auch als Viehhändler. Die Familie Löwenstein muss damals schon seit einigen Generationen in Arfeld gelebt haben. [6]
Jakob Wolff, geboren am 21. März 1875 in Altena. Als Beruf ist in verschiedenen Urkunden des Standesamts Arfeld Handelsmann, Metzger und Viehhändler angegeben.
Ob Jakob und Henriette in Arfeld oder in Altena geheiratet haben, ist nicht bekannt. Eine Heiratsurkunde ist nicht erhalten geblieben, sodass auch das Jahr der Eheschließung nicht belegt ist. [6]
Henriette und Jakob Wolf sind 1936 nach den Angriffen auf ihr Haus zur Familie des Sohnes Karl Wolff und seiner Frau Rose nach Treis an der Lumda gezogen.
Die Schmierereien und Angriffe auch auf weitere Häuser in Arfeld und den benachbarten Dörfern sollten als „Letzte Warnung“ verstanden werden. Das deutet eher auf Angehörige des RAD-Lagers Elsoff als Anstifter hin, als auf die „Dorfjugend“, die allerdings mitgemacht hat. (s. Opfermann, [4])
Henriette und Jakob Wolff sind am 14. September 1942 aus Treis verschleppt worden. Am 27. September 1942 wurden sie mit einem Transport von Darmstadt nach Theresienstadt deportiert.
Der Sohn Karl Wolff starb 1940 an den Folgen der Misshandlung in Buchenwald. Rose Wolff hat nach dem Tode ihres Mannes Karl zwischen 1940 und 1942 noch vergeblich versucht, sich und ihre Familie über Verwandte in Bad Nauheim und Frankfurt in Sicherheit zu bringen.
Karl Wolffs Frau Rose oder Rosi Wolff, geb. Plaut, * 31.10.1900 in Ottrau bei Ziegenhain, ihre Kinder Liesel, * 23.10.1929 in Gießen (Stieftochter), Bernd Jakob, * 14.05.1935 in Gießen, und die Schwester von Rose Wolff, die Witwe Jenny Wolff (?, nach [2]), geb. Plaut (Jg. 1900 ?; Jenny Kleeberg, geb. Plaut, * 20.05.1898 Ottrau (lt Gedenkbuch) ), sind am 14. September 1942 aus Treis verschleppt worden. Am 27. September 1942 wurden sie ebenfalls mit einem Transport von Darmstadt nach Theresienstadt deportiert.
Henriette Wolff starb in Theresienstadt am 30. Juni 1943.
Jakob Wolff wurde am 16. Mai 1944 von Theresienstadt in das Vernichtungslager Auschwitz gebacht. Für tot erklärt.
Rose Wolff und ihre Kinder Liesel und Bernd Jakob wurden vermutlich von Theresienstadt nach Treblinka weiter transportiert. „Verschollen“. Das gilt ebenfalls für Jenny Wolff.
Für Henriette und Jakob Wolff liegen Stolpersteine in Arfeld, Hauptstr. 30. Vier Stolper-steine liegen für die übrigen Familienmitglieder in Staufenberg-Treis, Hauptstraße 66.
In den 16:30 Lokalnachrichten auf Radio Siegen wird über die Eröffnung des Burbacher Gemeindearchivs vermeldet: „Die Gemeinde Burbach hat seit heute ein neues Archiv. Es befindet sich im Kellergeschoss der Grundschule Burbach. Für rund 150.000 Euro wurde es barrierefrei umgebaut. Bisher waren die Akten der Gemeinde im Keller oder auf dem Dachboden des Rathauses gelagert. Bei einem Tag der offenen Tür am Samstag gibt es für Interessierte einen Rundgang durch das neue Archiv.“
Patricia Ottilie, Burbacher Gemeindearchivarin, ist mit einem kurzem Statement zu hören: http://www.radio-siegen.de/aktuell/lokale-news/index.html
Landrat von Dörnberg gilt seit seiner Dienstzeit u.a. in Ostpreußen auch als maßgeblicher Unterstützer bei der Vermittlung Siegerländer Wiesenbaumeister für viele Einsatzbebiete in den Ostgebieten, besonders für die Provinzen Ost- und Westpreußen. Zuvor war er als Direktor des Kultur- und Gewerbevereins des Kreises Siegen besonders guter Kenner (und Förderer) des Siegener Wiesenbaues in seiner frühen Entwicklung.
Zur Vereinstätigkeit ist anzumerken: Der Verein ist maßgebender Förderer und zunächst einziger Träger:
1. Der ersten Wiesenbaukurse im Wiesenbau seit 1834 und 2. Der Gründungsverein der landwirtschaftlichen Sonntagsschule als Siegener Wiesenbauschule seit 1844 und dessen Wiedergründung (nach Auslaufen zwischen 1848 ff) im Jahr 1853 als Wiedergründung (offiziel: Neugründung) als die berühmte „Siegener Wiesenbauschule“, die später bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts in der Trägerschaft des Kreises Siegen unterrichtete, dann vom Land NRW übernommen wurde.
Diesen o. g. Hinweis zu dem ehemaligen kgl. Landrat des Kreises Siegen habe ich bei meiner Ausarbeitung über den Siegener als Notiz über den Wiesenbau erhalten; nähere Einzelheiten sind leider nicht (mehr) bekannt. Da die Siegener Wiesenbaumeister (und die Siegener Wiesenbauschule mit mehreren von Siegen maßgeblich geförderten Fachschulgründungen) als Pioniere im „Deutschen Reich“ und Mitteleuropa gelten, die „frühesten Fachschulen speziell im Wiesenbau“ einrichteten oder mitbegründeten, kommt dem „Siegener Wiesenbau“ und „seinen Förderern“ eine besondere Bedeutung zu.
Meine (umfangreichen) Ausarbeitung beschäftigen sich im Wesentlichen mit Wiesenbau-Themen, die bisher nicht -oder nur wenig- behandelt wurden. Dazu zählen die frühesten örtlichen Nachrichten in der nassau-oranischen Zeit (seit dem 15. Jahrhundert), möglichst frühe Beispiele örtlicher Wiesenbautätigkeiten, die Biografien früher Förderer Im örtlichen Wiesenbau, die ersten Wiesenbaumeister und ihre Betätigung im In- und Ausland. Die Situation des Wiesenbaues in Deutschland und im Siegerland und die Gründungen von Fachschulen im Wiesenbau.
Für Hinweise zum Thema zur Ergänzung meiner Ausarbeitung bin ich dankbar.
Vielen Dank für die Ergänzung!
Ihnen wird sicher der Bestand „Kreis Siegen, Kreisausschuss“, des Landesarchivs NRW, Abt. Westfalen, bekannt sein, der einschlägige Unterlagen zur Wiesenbauschule enthält. Der Bestand ist auch mikroverfilmt nach Rücksprache im Stadtarchiv Siegen benutzbar. Daneben verweise ich auf die Bestände „Regierung Arnsberg, Schulen“ und „Oberpräsidium Münster, Kirchen,Schulen, Juden“ im Landesarchiv in Münster.
Ebenfalls gehe ich davon aus, dass Sie sich bereits an das Archiv der Universität Siegen gewendet haben. Denn auch ist Einschlägiges zu Ihren Fragestellungen vorhanden.
Das Stadtarchiv Siegen vermeldete unlängst die Übernahme eines Wiesenbaumeister-Nachlasses: „Über einen wertvollen Zuwachs seiner Sammlungsbestände konnte sich jetzt das Stadtarchiv Siegen freuen. In den neuen Räumlichkeiten im KrönchenCenter übergab die Weidenauer Diplom-Sportlehrerin Susanne Müller Dokumente und Gegenstände aus dem Nachlass ihres Großvaters, des Kreiswiesenbaumeisters des Dillkreises Heinrich Müller, als Depositum zur dauernden Aufbewahrung“
Ich verweise auch auf die regionalgeschichtliche Bibliothek des Siegener Stadtarchivs.
Nach der Vorgabe des Stichworts durch Herrn Wolf kann ich wieder einmal bemängeln, dass Münster die Online-Findbücher für die Bestände Landratsamt und Kreisausschuss Siegen immer noch nicht wieder zugänglich gemacht hat. Wie lange liegt es jetzt zurück, dass diese zwecks Überarbeitung aus dem Netz genommen wurden? Vor vielen Monaten hatte mir das Landesarchiv die Auskunft erteilt, man müsse sich nur noch ein paar Tage gedulden …
Ihre Sammlung, lieber Herr Hellmann, dürfte inzwischen so umfangreich geworden sein, dass allgemein gehaltene Bitten um Hinweise kaum noch wirklich Neues für Sie ergeben werden. Sie haben da schon einen klaren Wissensvorsprung. Man müsste jeweils am konkreten Detail sehen, wo sich vielleicht noch gezielt weitergraben läßt.
Noch Plätze frei für die Impuls-Tagung „Kulturlandschaft betrachten, bewahren und beleben: Wege zur Erschließung historischer Kulturlandschaft in der Kulturregion Südwestfalen.“
Heute überschreibt die Siegener Zeitung in der Print-Ausgabe ihren Bericht über den Tag der offenen Tür mit „Archiv begeisterte“ – ein Titel, der Archivierende erfreut!
Finde ich gut…;-))
Ein Archivar muss heute auch in Sachen Medien bewandert sein und die neuen Medien nutzen und sich vernetzen. Das passiert hier schon seit einiger Zeit…
Anntheres
Die Petition, die gerade auch für kleinere Archive nicht unwichtig ist, wie die Stellungnahme des VdA darlegt, hat bis jetzt 2.290 Mitzeichner. Als erster Erfolg des breiten öffentlichen Drucks – auch der Bibliotheksverband hat reagiert – darf der Verkaufsstopp der Bücher durch das betroffene Antiquariat gelten. Weitere Unterzeichnungen sind aber bis zur vollständigen Rückabwicklung gerne gesehen.
Alle Proteste und Vorwürfe verpuffen, wenn nicht erforderliche Maßnahmen über die kommunale Zuständigkeit hinaus getroffen werden, um Wiederholungen zu verhindern. Wenn ein Behördenleiter seinen Archivar suspendiert, ist das eine Maßnahme innerhalb der Behörde, geht er damit aber an die Öffentlichkeit, ist das ein Bauernopfer zur Ablenkung der eigenen Verantwortung.
Erneuter offener Brief des VdA vom 28.11.2012 zur Causa Stralsund:
“ …. „Kein Archiv würde ohne Not oder äußeren Druck wertvolles Kulturgut veräußern. Auftrag und Selbstverständnis der Archive, Entscheidungen, Handlungen und Erinnerungen als einzigartiges, unersetzliches kulturelles Erbe zu sichern und von Generation zu Generation weiterzugeben, stehen dem diametral entgegen. …..Muss ein Stadtarchiv erst unter tragischen Bedingungen einstürzen oder sich ein Skandal wie in Stralsund ereignen, bis wieder die zentrale Bedeutung des historischen Kulturgutes für die Stadtgesellschaft in das Bewusstsein der Verantwortungsträger und der allgemeinen Öffentlichkeit rückt?“
Quelle: http://vda.archiv.net/index.php?id=1
Das Aktionsbündnis Bahnhof Siegen des BUND Siegen-Wittgenstein und des VCD Siegen-Wittgenstein-Olpe verfügt über eine eigene Homepage: http://www.aktionsbuendnis-bahnhof-siegen.de/ . Die Seite dokumentiert zurzeit 2 Leserbriefe, die sich mit der historischen Dimension des Projektes auseinander setzen.
Je spezieller die Anträge sind, um so mehr Anlass zu Eifersüchteleien werden sie geben und folglich den fein ausballancierten interregionalen Frieden stören. Der Thüringer Kloß ist ja ohne jeglichen Zweifel ein beeindruckendes immaterielles Weltkulturerbe (schon Goethe wird ihn gegessen haben). Ohne ihn (den Kloß) hätte die Menschheitsgeschichte einen anderen Verlauf genommen. Doch läßt sich Gleiches ebenso vom verwandten Vogtländer Kloß behaupten. Und damit würde die UNESCO mit der Ehrung des einen und somit Diskriminierung des anderen einen Konflikt zwischen den Freistaaten Thüringen und Sachsen (den später als „Kloßkrieg“ in die Annalen eingehenden) heraufbeschwören, an dem nun wirklich niemand Interesse haben kann, schon gar nicht in der Weihnachtszeit. Hier sollte man sich also auf den „mitteldeutschen Kloß“ einigen.
Auch im Siegerland wäre ein möglichst allgemein gehaltener Antrag dem Konsens förderlich. Es gilt, die Anhänger von Siegerländer Hauberg, Siegerländer Kunstwiese, „Siegerländer Krüstchen“ (identisch, aber um Gottes Willen nicht zu verwechseln, mit dem Wittgensteiner, dem Sauerländer und all den anderen Krüstchen) und sonstigen regionalen Kulturleistungen unter einen Hut zu bringen. Was spräche eigentlich dagegen, um es allen recht zu machen, „den Siegerländer an sich und als solchen“ zum immateriellen Weltkulturerbe ausrufen zu lassen?
P.K.
Interessant fände ich es, neben den erwähnten regionalgeschichtlichen auch über archivfachliche Themen informiert zu werden, also z.B. aktuelle Übernahmen, angewandte Bewertungsmodelle, Erfolge und Probleme bei der Überlieferungsbildung. Zugegebenermaßen bin ich mir aber nicht sicher, ob so etwas in das Profil von siwiarchiv passt, ob die Zielgruppe vielleicht doch lieber interessierte Nutzer sind als die Kollegenschaft. Meiner subjektiven Einschätzung nach arbeiten die Archivarinnen und Archivare in Deutschland im Alltagsgeschäft eher nebeneinander als miteinander – vielleicht auch weil wir weithin keine Blogs haben, um einen entsprechenden Austausch zu pflegen. Die Archive im Kreis Siegen-Wittgenstein hingegen, die haben ja eins, vielleicht wären da also auch solche Themen drin…
Genau dies steht eigentlich auch im Editorial des Blogs – daher vielen Dank für den Hinweis! Denn siwiarchiv soll auch archivisches Arbeiten vermitteln. Wir tun dies bis jetzt nur zu selten. Ihre Anregungen werde ich gerne an den Arbeitskreis weitergeben.
Ich werde gerne den Anfang machen und auch hier unsere Gedanken zur Überlieferung der Kriegsgefangenenentschädigungsakten vorstellen – s. a. Anfrage im forum-bewertung. Das Kreisarchiv hat auch Vorstellungen zur Überlieferung der Personalakten angestellt, die wir gerne zur Diskussion stellen.
Allmählich kommt die Universität Siegen in den Ruf, schlampig oder gar kriminell mit ihr anvertrauten Kunstwerken umzugehen. Nun bin ich nicht die Universität und brauche mich um deren generelle Ehrenrettung nicht zu kümmern; im hier vorliegenden Fall ist aber ein Kommentar angebracht.
Der Text zum erwähnten Druck in der Ingenieurschul-Festschrift von 1967 lautet: „Blick auf Siegen – nach einem Gemälde von Hermann Manskopf, freundlicherweise zur Verfügung gestellt von der Siemag-Feinmechanische Werke Eiserfeld“. Das interpretiere ich so, dass die Siemag das bei ihr hängende Gemälde für diese Broschüre reproduzieren ließ, also wahrscheinlich kurz an die ausführende Druckerei (Vorländer) zur professionellen Ablichtung ausgeliehen hatte. Daraus zu schließen, das Original habe als Siemag-Leihgabe jemals in der Ingenieurschule gehangen, scheint mir doch etwas weit hergeholt zu sein.
Erwähnt wird im Blog-Beitrag ferner, eine Anfrage bei Frau Prof. Blanchebarbe im Siegerlandmuseum sei „negativ verlaufen“. Das kann ich so recht nicht glauben, denn eine Schwarz-Weiß-Abbildung eben dieses Gemäldes („Stadtansicht von Siegen in Spachteltechnik vom Giersberg aus gesehen“) findet sich in Frau Blanchebarbes Beitrag „Der Maler Hermann Manskopf (1913-1985)“ in der Zeitschrift Siegerland 70 (1993), S. 69-74. Da dort (bis auf eine Ausnahme) keine Bildquellen angegeben sind, vermute ich, dass für die Druckvorlagen auf Bestände des Museums zurückgegriffen wurde. Anscheinend war das gesuchte Bild anläßlich der „umfangreichen Retrospektive im Siegerlandmuseum“ zu Manskopfs 80. Geburtstag, woran der Aufsatz erinnert, ausgestellt worden.
P.K.
Zu Güthlings wissenschaftlicher Karriere ist auch der Aufsatz von Burkhard Dietz: Überlieferung und Rezeption der Werke von Erich Philipp Ploennies im 18. und 19. Jahrhundert, in: Zeitschirft des Bergischen Geschichtsvereins 97 (1995/96), S. 1-86, heranzuziehen.
2 Antworten vermuten nicht ganz abwegig, dass es sich um den Tod(estag) Moltkes handele. Doch siwiarchiv ist ein regionalarchivisches und -historisches Weblog. Daher: Weitersuchen!
Liebe Herr Wolf, auch aus Potsdam herzlichen Glückwunsch!
Mein Lösungsvorschlag: Die Zeitungen lagen im Grundstein zum ehemaligen Amtskrankenhaus Haus Hüttental des Kreisklinikums Siegen in Weidenau, dessen Grundstein (nach Wikipedia) am 8. Mai 1891 gelegt wurde.
Richtig! Man hätte gar nicht den Umweg über die Wikipedia gehen gehen müssen, denn http://www.siwiarchiv.de/?s=April+1891 hätte auch zur Lösung geführt.
Neben den Zeitungen undbefanden sich noch die Gründungsurkunde, eine Spendeliste ein Briefumschlag, die Blankopostkarte sowie 2 Münzen in dem Behältnis. Zeitungen und die beiden Schriftstücke werden voraussichtlich zeitnah restauriert werden. Weiteres dann hier im Blog.
Wieder ein interessantes Thema! Generell wollte ich mal sagen, dass ich es wirklich erstaunlich finde, wie viel ihnen immer an Berichten einfällt :-) das würde man in dem Archiv eines so „unscheinbaren“ Ortes gar nicht vermuten. Ich lese siwi-archiv immer gerne, obwohl ich gar keinen regionalen Bezug habe und bekomme viele Anregungen. Danke!
Der Ratschlag für Bildformate zur digitalen Archivierung ist arg verkürzt. TIFF unkomprimiert kann teuer werden, was den Speicherverbrauch angeht. Es lohnt sich aber, wenn man nur eine Kopie aufbewahrt, denn im Katastrophenfall kann man aus einer defekten Festplatte oder DVD wesentlich mehr Dateien retten, als wenn man Formate wie JPEG für Fotos und PDF mit JPEG-Kompression für Akten verwendet hätte. Hat der Verein eine bessere Speicherlösung mit sicherem Backup, so würde ich letztere Formate (in höchster Qualitätsstufe) empfehlen. JPEG2000 ist (noch) eher etwas für Institutionen, die sich Profisoftware leisten können.
Das Thema ist in der Tat sehr lohnenswert. Auch ich bekomme öfters Anfragen von Privatleuten, wie sie am besten ihre privaten Nachlässe und Vereinsunterlagen archivieren sollten bzw. wie sie sie für eine Anbietung an ein Archiv vorbereiten können. Und beides sollte man in jedem Fall unterstützen.
Ich meine die Präsentation deckt alle Themenfelder, die interessieren, ab. Ich würde dennoch den rechtlichen Aspekt etwas mehr hervorheben, da viele unsicher im Umgang gerade mit personenbezogenen Daten sind, was vor allem die Mitgliederlisten betrifft. Die Übersicht über die archivrelevanten Unterlagen finde ich gut, dennoch wäre ein Hinweis auf Webarchivierung sinnvoll – auch wenn sicherlich keine Zeit bleibt die Umsetzung zu besprechen. Aber gerade Websites spiegeln die Vereinsgeschichte sehr gut wider. Bei der Frage, womit verzeichnet werden sollte, würde ich von Textverarbeitungsprogrammen abraten. Excel wäre m.E. die Mindestanforderung. MidosaXML würde ich ebenfalls empfehlen (ohne Fragezeichen), da sich hier eine Excel-Tabelle erfolgreich importieren und mappen lässt. Außerdem ist damit die Online-Präsentation auch mit Digitalisaten recht leicht umsetzbar. Falls also jemand im Vereinsarchiv sich nicht scheut, sich in das Programm einzuarbeiten, ist dies für diese Anforderung eine gute Lösung. Bei dem Punkt Digitale Archivierung finde ich das Speichermedium auch sehr wichtig und würde hier darauf verweisen, dass CDs, DVDs etc. besser nicht verwendet werden sollte, sondern mindestens auf verschiedenen externen Festplatten doppelt gespeichert wird und diese an zwei verschiedenen Orten aufbewahrt werden sollten. Sicherlich kommt auch die Frage auf, ob die Speicherung in einer Cloud sinnvoll ist, sich der Verein aber im Klaren sein muss, dass dann der Anbieter auch Zugriff auf die Objekte haben könnte (personenbezogene Daten!). Über die Bild-Formate (wie auch Audio und Video) lässt sich stets streiten, aber der Verein sollte wissen, dass die Bildformate unterschiedliche Qualitäten mit sich bringen und TIFF derzeit etabliert ist, aber jpg für die Verwendung im Web nötig ist, gegebenenfalls also Bilder in zwei verschiedenen Formaten und diese jeweils mehrfach gesichert vorliegen müssten. Außerdem fände ich den Hinweis erofrderlich, dass dieses Vorgehen noch keine digitale Archivierung bedeutet, sondern nur als digitale Sicherung der Objekte verstanden werden kann.
Weiterhin viel Erfolg bei diesem Thema und ich freue mich auf weitere Berichte dazu.
@Jevgeni Vielen Dank für die Strategie! Externe Speicherplatte wird sicherlich auch vorgeschlagen – wie steht es mit der Glas-Disc?
@Frau Prof. Schwarz: Vielen Dank für die Durchsicht und die ausführlichen Hinweise! Ihren Anregungen werde ich für den nächsten Termin einarbeiten.
Klaus Graf weist auf Archivalia zurecht auf die Vermittlung des Provenienzprinzips hin. Ebenso richtig ist der Hinweis auf das Beratungsangebot anderer Archive, z. B. auf das für den Landesteil Westfalen zuständige LWL-Archivamt in Münster.
… und ich fuhr als Leichtmatrose 1966 auf dem MS Siegerland für die British and Irish Steampacking in Charter zwischen Liverpool und Dublin mit Abstechern nach Cork.
Und habe tolle Erinnerungen und Stories an die Zeit :-))))
an tom schilling kann ich mich nicht erinnern.
aber die zeit für die B&I Line war in jeder hinsicht schon toll !
da kann ich herrn schilling zustimmen.
ich hab noch viele bilder von der siegerland.
da fing meine seefahrtszeit an.
Hallo Herr Kapitän Welte,
vieleicht können sie sich an mich erinnern,
Mein Name ist Andreas Bartkowiak meine Zeit auf der MS Siegerland ist mir bis Heute noch in ereinnerung, für mich die schönste Zeit meines lebens.
Ich Heuerte am 27.05.1978 in Rotterdam an und dann began mein Abenteuer.
Würde mich freuen von Ihnen zu höhren, vieleicht können sie mir einige abzüge aus dieser zeit zukommen lassen.
Bereits 1936 wandte sich die Stadt Siegen auf Anregung eines in Hamburg lebenden Heinrich Irle an die Hapag in Hamburg und den Norddeutschen Lloyd in Bremen mit der Bitte eines ihrer Schiffe auf den Namen „Siegerland“ zu taufen. Zitat aus der Antwort des Norddeutschen Lloyd an den Herrn Oberbürgermeister: „Daß auch die Stadt Siegen und das Siegerland den Wunsch besitzt, den Namen ihres Landes durch ein deutsches Schiff vertreten zu sehen, ist begreiflich, zumal dieser Name, wie Sie selbst sagen, noch wenig bekannt ist. Aber gerade aus diesem Grund dürfte der Name ‚Siegerland‘ bei der Einstellung der Welt zu unserem deutschen Vaterlande im Auslande ganz anders ausgelegt und ihm eine Bedeutung gegeben werden, die keinesfalls erwünscht sein kann. Sie werden daher auch verstehen, wenn wir aus diesem Grunde Ihrer Bitte … nicht entsprechen können.“ (Quelle: Stadtarchiv Siegen, Best. Stadt Siegen D 313)
Wir haben Interesse, an dem Genealogentag teilzunehmen. Ist eine Anmeldung erforderlich? Welche Vorträge, Arbeitsveranstaltungen sind vorgesehen? Welche Kosten enstehen?
Eine gut gemeinte Aktion, die wie alle gut gemeinten Aktionen begeisterte Anhänger finden wird. Dennoch drei spontane Fragen:
1. Welches Publikum hofft der Herausgeber zu erreichen? Das unverbindliche Stöbern mag recht unterhaltsam sein, für gezielte thematische Erkundungen eignen sich die völlig unstrukturierten großen Dateien jedoch nicht.
2. Von welchen Auswahlkriterien läßt sich der Herausgeber leiten und warum? Kommentarlos aus ihren komplexen Zusammenhängen gerissen, sind Quellentexte für den historischen Erkenntnisgewinn oft wertlos.
3. Soll man über die Formulierung „im Auftrag des Stadtarchivs herausgegeben“ gründlicher nachdenken oder sie lieber schweigend auf sich beruhen lassen?
P.K.
Schweigen! Schweigen! Schweigen!
Der Herausgeber hat soeben zugesagt, alle Hinweise auf eine Beteiligung des Stadtarchivs bzw. meiner Person zu tilgen.
Das fand ich sehr spannend zu lesen (kam über Twitter drauf;-), da das ISG Frankfurt seit mehreren Jahren in Zusammenarbeit mit dem Landessportbund Hessen Seminare für Archivare von Sportvereinen anbietet.
Von den Themen sind neben der richtigen Aufbewahrung von Archivalien auch digitale Archvierung (Hinweis auf Datenträger= keine CD´s usw.), richtige Foto-Archivierung und zuletzt Datenschutzhinweise/ Fotorechte besonders gefragt. Auch machen alte Schriften oft Probleme.
Umgekehrt erfahren wir Archivare, ob/ was die Vereine an interessantem Material haben…
Ob es ein Spezialgefängnis war, kann bezweifelt werden. Dass da ein Gestapo-Gefängnis war, war bekannt, noch bevor Radio Siegen davon Wind bekam, und zwar spätestens seit Dieter Pfau die Lagepläne gefunden hat. Von damaligen Kommunisten gibt es Zeitzeugenberichte sowohl in Strafakten der Generalstaatsanwaltschaft als auch in später veröffentlichten Berichten.
Dieter Pfau publizierte in „Kriegsende 1945 in Siegen. Dokumentation der Ausstellung 2005“, Bielefeld 2005, im Zusammenhang mit dem Prozess gegen den Gestapo-Beamten Otto Faust auf S. 183 eine Lageskizze der Büroräume der Geheimen Staatspolizei – Außenstelle- im Landgerichtsgebäude Siegen. Die Skizze weist sieben Büroräume im Dachgeschoss aus (Pförtner u. „Dollmetscher“, Regitratur, 4 Vernehmungsbüros und einen Raum für den Fernschreiber). Pfau gibt folgende Quelle an: R- LG National Archives (vorm. Public Record Office), Kew bei London FO 1060 Nr. 1430.
Dass sich dort das Landgericht samt Gefängnis und die Gestapo befand war ja bekannt, so dass ein „Spezial-Gefängnis“ durchaus plausibel ist. Aber welche neu aufgetauchten Dokumente, von der die Siegener Zeitung heute spricht, mögen dies sein, die eine so aufwändige Untersuchung (Mauerritzen, Fußböden) begründen?
Auch die Westfälische Rundschau und der WDR berichten heute.
Mich beschleicht der Eindruck, dass nicht die richtigen Fragen gestellt wurden:
1) Warum fragt denn keiner beim Pressesprecher des LWL-Denkmalamtes nach?
2) Die aufgefundenen Schriftstücke gehören eigentlich in das Landesarchiv NRW. Warum fragt denn dort keiner nach.
3) Brauchen wir eine weitere Gedenkstätte wirklich oder wäre ein Ausbau des Aktiven Museums nicht ausreichend – eben um eine Dokumentation der Funde, so sie denn etwas hergeben?
„interessante Idee“, da scheinbar schon Gedanken hinsichtlich einer möglichen Nutzung angestellt werden (wobei ich die Frage des Journalisten nicht kenne), obwohl angeblich noch gar nicht bekannt ist, was genau dort gefunden wurde/ wird.
Abgesehen davon fände ich eine wie auch immer geartete NS-Gedenkstätte auf dem WiWi-Campus (noch dazu in direkter Nachbarschaft zum AMS) nicht naheliegend.
In der heutigen Printausgabe der Siegener Zeitung findet sich ein überaus denkmalschutzkritischer, fast schon polemischer Leserbrief. Das Thema scheint zu interessieren …..
Ob sich hinter folgenden Archivalien die neuen Aktenfunde verbergen: LWL-Archivamt für Westfalen, Archiv LWL, C 711 (Landeskonservator) 1041, 305 Altakte – Unteres Schloß 1946 – 1977, 1925 – 1940?
Karl Heinz Gerhards teilt gestern via E-Mail mit: “ ….. „Für die Siegerländer Familienkunde ist insbesondere der Rau-Vorfahre Adam Bäumer (+ 1674), einer der Ahnherren der weitverzweigten Siegerländer Familie Bäumer und deren Töchternachkommen (zu denen ich auch zähle) interessant. Auf die Berichterstattung über meinen Vortrag in SIEGERLAND, Bd. 89, Heft 2, 2012, S. 289, darf ich hinweisen.“
Der E-Mail beigefügt war ein Schreiben von Prof. Dr. Klaus Goebel an Herrn Gerhards, dass nach dessen Publikation (s. o.) weitere familienkundliche Forschungsergebnisse (u.a. auch von Herrn Gerhards) eine ergänzende Veröffentlichung lohnenswerte erscheinen lassen.
Ich bin als dreieinhalbjähriges Kind 1947/48 Patient in der Heilstätte Hilchenbach gewesen. Mein damaliger Arzt war Dr. Kruse, der später in Salchendorf praktizirte.
Ich möchte wissen, in welchem Gebäude die damalige Heilstätte untergebracht war.
Das Gebäude der ehemaligen Heilstätte Hengsbach ist heute das Altenpflegeheim der Diakonie, Haus Obere Hengsbach; zunächst wurde das Gebäude 1971 an die AWO veräußert, die dort ein Internat, einen sonderkindergarten und eine Werkstatt für Behinderte einrichteten… Alles weitere kommt noch in den folgenden Beiträgen..
Entschuldigung Herr Jud,
das war das Gebäude in Siegen..
Von dem Gebäude in Hilchenbach weiß ich (bisher) nur, daß es sich Richard-Masrtin-Heim nannte und dem „Verband evangelischer Arbeitervereine“ in NRW gehörte..
In 2009 wurde das Richard-Martin-Haus (vorher Richard-Martin-Heim) dann an Herrn Fuhrmann,vom Helberhäuser Seniorenheim Abendfrieden verkauft.
Das Gebäude ist heute noch vorhanden, in unmittelbarer Nähe der Straße nach Brachthausen.
Umfangreiche Informationen gibt´s beim Stadtarchiv Hilchenbach, Herr Gämlich.
Gab es kein Gestapo-Gefängnis im Unteren Schloss? Zumindestens schreibt dies die Siegener Zeitung in ihrer Samstagsausgabe. Zumindestens fanden sich im derzeitigen Bauzustand keine Spuren, ebenfalls nichts (zu und) in den neuen (!) Aktenfunden. Eine endgültige Stellungnahme der Denkmalpflege steht noch aus.
S.a. WP/R, 8.3.2013
Wenn sich nun ein Gestapo-Gefängnis im Unteren Schloss in Siegen nicht nachweisen lässt, so wäre doch eine Aufarbeitung der Geschichte des Gefängnisses sicherlich nicht uninteressant.
Hierzu müsste u. a. folgende Bestände des Landesarchivs NRW, Abt. Westfalen, in Münster sichern:
1) Q 901 Justizvollzugsamt Westfalen-Lippe, Hamm, 210 Archiveinheiten, Laufzeit: 1919-1996
Dieses Amt war für die Aufsicht, Verwaltung und Bewirtschaftung der Gefängnisse zuständig.
2) Q 925 Vollzugsverwaltung, 90 Archiveinheiten, Laufzeit, 1929-1950.
Im ITS Arolsen befindet sich in der Gruppe P.P. der Ordner 418 (Inv. 1892). Dieser enthält wohl Auszüge aus Haftbüchern des Landgerichtsgefängnis Siegen mit 1280 Namen.
Weitere Hinweise auf durchzusehende Bestände sind gerne willkommen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Experiment Siwiarchiv ist eine schöne digitale Wegmarke, die besonders für Auswärtige viel Licht in die dunklen Täler des Siegerlandes wirft. Bin gern zu Gast hier und erfreue mich an Vielfalt und Lebendigkeit sowohl historisch als auch archiv(ar)isch.
Herzlichen Glückwunsch zum 1. Geburtstag und viel Erfolg weiterhin!
Für eine Geschichte des Gefängnisses insgesamt müssen sicherlich auch die einschlägigen Archivalien in den Beständen „Kreis Siegen, Landratsamt“ und „Kreis Siegen, Landratsamt neu“ des Landesarchivs NRW, Abt. Westfalen, zu Rate gezogen werden.
Kann man schon.
Aber:
1) die Metallteile des Ordners rosten und schädigen das Papier.
2) die liegende Aufbewahrung ist platzsparender als die stehende
3) Jede Verpackung schützt vor Brand-, Wasser oder sonstigen Schäden
4)Jedes Licht schädigt das Papier
5)Staub ist Nährboden für papierschädigende Sporen, Pilze, etc.
Ich hoffe, dass dies den Aufwand erklärt.
Für die nachher der Veranstaltung fernbleibenden Interessenten wird es erfreulich sein, dass Herrn Gleitsmanns Ausführungen (schon als Referat auf dem Deutschen Historikertag 2012 präsentiert) nun auch schriftlich zugänglich sind. Seinen aktuellen Zeitschriftenaufsatz zum Thema findet man seit kurzem als Open-Access-Dokument hier: http://ejournal.uvka.de/spatialconcepts/archives/1622
Bedauerlich ist, dass solche Vorträge vom Veranstalter immer auf eine so späte Tageszeit gesetzt werden. Das führt zur Diskriminierung von Menschen, die nicht motorisiert sind und für den weiten Heimweg keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr finden. Es kann ja, um beim heutigen Beispiel zu bleiben, nicht Sinn der Sache sein, sich 60 oder 90 Minuten lang von einem (wenn auch qualifizierten) Loblied auf den Siegerländer Hauberg berieseln zu lassen. Die sehr komplexe Thematik bedürfte der vertiefenden Diskussion, für die eben nach der Einführung keine besinnliche Ruhe mehr bleibt, wenn erst um halb Acht begonnen wird.
P.K. (nachher abwesend)
Das ist ja doch eine ansehnliche Menge. Dank dem Foto hat man auch eine gute Vorstellung davon. Das ist ja durchaus einige Arbeit.
„Übergrößen“ sind nehme ich an alle Unterlagen, die größer als DIN A4 sind (Pläne usw.)?
PS: Ein interessantes Blog ist das hier. Als „normaler“ Mensch hat man ja üblicherweise keine Ahnung davon, was ein Archiv so genau tut. Ich finde es wirklich faszinierend, hier einen kleinen Einblick zu bekommen.
Vielen Dank für das Lob! Die Darstellung archiv(ar)ischer Arbeit ist einer der Gründe, warum wir dieses Blog schreiben. Schön, dass es Ihnen gefällt.
„Übergrößen“ meint im Kreisarchiv Formate über 33x21cm (Folio). Im konkreten Bestand handelt es sich um Unterlagen der Rechnungsführung.
Normal ist dies tatsächlich nicht. Aber: ich halte die abgegebende Stelle für unbedingt archivwürdig, so dass ich tatsächlich mit solchen Präparaten umzugehen lernen muss. Diese Präparate werden evt. auch noch von der abgenden Stelle selbst benötigt.
Haben Sie einen Verdacht , um welche Stelle es sich handeln könnte?
Es handelt sich um Handakten des Landrats, die er daheim während eines kühlen Bades im Gartenteich studiert hatte. Dabei war ihm diese Libellenlarve zwischen die Seiten gekrabbelt. Was sagt das Naturschutzgesetz dazu???
P.K.
1) Glauben Sie wirklich, dass ein Landrat Libellenlarven präpariert? Nein, es handelt sich nicht um Handakten des Landrates ;-).
2) Ich denke die abgebende Stelle hatte das Naturschutzgesetz im Blick.
1) Vielen Dank für die Ergänzung!
2) Ja, es könnte auch ein i sein. Allerdings findet sich kein bekannter Eigenname, der so endet in Münster. Auf eine Anfrage beim LWL-Archivamt haben wir verzichtet.
Danke für die Ergänzung! Übrigens ein Bild Naunins findet sich im Bildarchiv des LWL-Medienzentrums. Sein Nachlass verwahrt das das LWL-Archivamt unter der Bestandssignatur 909. Naunins Personalakte befindet sich ebenfals dort: Best. 132/C 11 A K 374
Ich fürchtete schon, ein pflichtbewusster Archivar hätte in irgend einem feuchten Behördenkeller die kleinen Tierchen als Untermieter in einem alten Aktenordner gefunden und sie als für die „Originalizität“ der Akte bedeutsam und daher erhaltenswert eingestuft. ;-)
Werden die Viecher jetzt auch gelocht, abgeheftet (in einem metallfreien Hefter versteht sich) und in einen säurefreien, langzeitbeständigen Archivkarton gelegt? ;-)
Fliegen und womöglich Spinnen, die von tapferen Verwaltungsbeamten durch Zuschlagen der Akten getötet wurden, finden sich durchaus in alten Akten. Auf deren Präparierung wird jedoch archiv(ar)ischerseits i.d. R. verzichtet. ;-)
Wie diese neue Archivgut möglichst dauerhaft aufbewahrt werden kann, ist eine Frage, die ich noch klären muss. Sobald ich eine gangbare Lösung gefunden habe, wird es sicher hier im Blog zu lesen sein.
Es handelt sich vermutlich um das Hotel Elephant in Weimar. Es wurde 1938 vom 1898 in Siegen geborenen NS-Architekten Hermann Giesler errichtet. Sein Bruder war Paul Giesler, unter anderem Gauleiter von Westfalen-Süd, später von München-Oberbayern.
Darf man fragen, ob die Bewerbungen erfolgreich waren? Ich weiß zwar nicht, was damals üblich war, aber der dritte Brief scheint mir doch ziemlich unbeholfen formuliert zu sein (besonders für eine Bewerbung); die Schreiberin hatte anscheinend nicht allzu viel Erfahrung im Schreiben „offizieller“ Briefe. Wobei man vermutlich bei einer „Hausgehilfin“ weniger strenge Maßstäbe angelegt haben dürfte, als bei einem Beruf, wo es auf Schreibfähigkeiten ankommt?
Ich freue mich übrigens, wieder ein paar Beispiele aus den bearbeiteten Unterlagen in Form von Abbildungen zu sehen, zumal ich mir vorstellen kann, dass das nicht nur einen gewissen Aufwand bedeutet, sondern dass aus Datenschutzgründen auch darauf geachtet werden muss, nicht „zu viel“ zu zeigen. Ich hoffe, die Reihe wird noch etwas fortgesetzt? Es sind ja anscheinend bisher erst die Personalakten behandelt worden, und wenn ich es richtig verstehe sind noch Akten aus diversen anderen Bereichen vorhanden.
Abschließend noch eine eher allgemeine Frage: Wissen die Stellen, von denen die Akten stammen, in der Regel vorher Bescheid, welche Akten später im Archiv landen, und können dann dementsprechend etwas sorgfältiger arbeiten? Nicht, dass es der Normalfall wäre, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Verwaltungsakten im Extremfall auch aus einem Haufen Notizzetellen und anderer kleinteiliger Unterlagen verschiedener Formate bestehen könne, zusammengehalten von hunderten Heftklammern. Nachdem ich ja nun weiß, dass im Archiv die ganzen Klammern entfernt werden müssen, kann ich mir vorstellen, dass solche Akten eine ziemliche Arbeit bedeuten würden. und hinterher stünde man vor dem Problem, diverse lose kleine Zettelchen zu haben, die zu klein zum Einheften sind.
PS: Auch wenn es schon etwas spät ist: Ich wünsche Allen Mitarbeitern des Kreisarchivs Siegen-Wittgenstein ebeso wie allen anderen Lesern hier frohe Ostern!
Vielen Dank für die Ostergrüße!
Zu dem Erfolg der Bewerbungsschreiben kann nichts sagen, gehe aber davon, dass diese erfolgreich waren, da sonst keine Personalakten entstanden wären.
Aus archivrechtlichen Gründen ist das hier vorgestellte Schriftgut anonymisert. Auf eine Berichterstattung aus den Personalakten zu verzichten, wäre aber bei einer Berichterstattung über die Bestandsbearbeitung kontraproduktiv gewesen. Für die abschließende Bestandsbearbeitung (Findbuch) sind Aussagen über den Dokumentationswert eines Bestandes sowieso erforderlich. Nichts anderes ist das, was bisher hier geschehen ist.
Die Bearbeitung der Sachakten steht tatsächlich noch aus und die Berichterstattung wird fortgesetzt.
Die archivische Einflussnahme auf die konkrete Aktenführung einer Verwaltung ist in der Regel gering. Ferner ist einer der wichtigsten Ziele archivischer Überlieferungsbildung die Dokumentation des Verwltungshandels, also auch der mehr oder weniger gelungenen Aktenführung. Die von Ihnen erwähnten Post-it-Zettel müssen ggf. in geeigneten Umschlagen an entsprechender Stelle in der Akten überliefert werden.
Mein Kommentar war auch in keinster Weise als Kritik an dem Vorgehen gedacht. Auch wenn ich zugegebenermaßen nicht viel Ahnung von der genauen Gesetzeslage habe (bin kein Jurist), scheinen mir die hier gezeigten anonymisierten Ausschnitte völlig unproblematisch, es weiß ja niemand, um wen es sich jeweils handelt. Vielmehr wollte ich zum Ausdruck bringen, dass ich Verständnis dafür habe, dass man so eine Akte nicht mal eben komplett einscannen und hochladen kann (auch wenn ich es interessant fände, einfach mal „durchzublättern“).
Bei den hier gezeigten Bewerbungen finde ich übrigens auch die alte Handschrift der zweiten und dritten Bewerbung interessant, das ist ja nur in einer Abbildung erkennbar, nicht in einer Abschrift. Ich habe versucht, es zu lesen, es fällt mir allerdings schwer. Ist aber sicherlich eine Frage der Gewohnheit. (Kleinkarierterweise ist mir allerdings aufgefallen, dass es statt „noch per Eilboten“ „auch per Eilboten“ heißen müsste.)
Wird die Sache mit dem „Findbuch“ in einer späteren Folge erklärt? Es wäre sicherlich interessant zu erfahren, wie die Akten inhaltlich so erschlossen werden, dass man hinterher weiß, wo man findet, was man sucht.
1) Die archivrechtlichen Regelungen sind leider leider sehr restriktiv. Ob etwas problematisch ist oder nicht, liegt bei der betroffenen Person. Eine nicht anonymisierte Fassung einer Personalakte kann ohne Zustimmung der Person 10 Jahre nach Tod der Person bzw. 100 Jahre nach Geburt publiziert werden.
2) Da für Sachakten eine Frist von 30 Jahren gilt, könnte vielleicht eine interessante Sachakte publiziert werden.
3) Danke für den Hinweis auf den Verleser! Er wurde korrigiert.
4) Das Findbuch wird zu gegenbener Zeit erklärt werden.
Die Fristen für die Personalakten sind tatsächlich deutlich länger als erwartet. Einerseits ist das sicherlich bedauerlich, aber andererseits beruhigt es mich ehrlich gesagt auch etwas.
Ich bin zwar in Sachen Datenschutz nicht gerade übervorsichtig, aber ich fände es doch etwas unschön, wenn irgendwelche Unterlagen, die private mich betreffende Angelegenheiten enthalten, einfach veröffentlicht werden würden. Solange es nur fremde Leute zu Gesicht bekommen, wäre es mir noch egal; aber man wüsste ja nicht, ob es nicht zufällig jemand findet, der mich kennt, und das wäre mir unangenehm. Ist nicht so, dass ich großartige Geheimnisse hätte, aber ein bisschen Privatsphäre muss trotzdem sein.
Ich warte dann dann mal ab, was die zukünftigen Artikel bringen bezüglich des ominösen Findbuchs. ;-)
Ich hatte die beiden Videos zufällig vor ein paar Tagen bei YouTube gefunden und mich gewundert, warum sie nicht im Blog erwähnt werden. Nun ja, das hat sich ja jetzt aufgeklärt.
Interessant, bei der Arbeit sozusagen über die Schulter schauen zu können. Vielen Dank dafür!
Die Akten sehen doch „abwechslungsreicher“ aus, als ich angenommen hatte. Man sollte meinen, das so ein Stapel Papier eine eher homogene Angelegenheit ist, aber die Blätter haben teils unterschiedliche Formate und Farben (und dementsprechend wohl auch Inhalte).
Ich war allerdings zugegebenermaßen etwas überrascht von dem *Ratsch*, ich hatte irgendwie erwartet, dass man in einem Archiv die Unterlagen sozuagen mit Samthandschuhen anfasst. Aber die Hefter werden ja ohnehin entsorgt, da spielt das natürlich keine Rolle, und man will ja auch vorankommen.
Schlaue Idee, das vordere Deckblatt der Hefter mitzuheften, sodass man gleich erkennen kann, wo die nächste Akte losgeht und was der Titel ist.
Die „Ausbeute“ war ja eher gering (im ersten Film eine Büroklammer und eine Heftklammer und im zweiten Film gar nichts), aber ich schätze, wenn es mehr wird, verflucht man irgendwann den Erfinder der Heftklammer? ;-) (So schnell würde ich es übrigens nicht schaffen, eine Heftklammer aus dem Papier zu bekommen. Sicherlich eine Frage der Übung.)
PS: Irre ich mich, oder ist der Hefter im zweiten Film „anders herum“ als der im ersten (Behördenheftung/kaufmännische Heftung)? Da würde ich vermutlich schon ziemlich durcheinanderkommen.
Die Filme waren zur „Überbrückung“ der Osterferien im Blog vorgesehen, daher zunächst die Publikation auf youtube. ;-)
Dies erklärt auch, warum die Metallausbeute so gering war. Es ist durchaus üblich, dass Akten mehr Metall enthalten: s. http://archiv.twoday.net/stories/6006919/ . Auszubildende der allgemeinen Verwaltung, die ein Praktikum beim Kreisarchiv machen, dürfen i. d. R. einen Tag lang entmetallisieren – in der Hoffnung auf einen späteren bewußteren Umgang mit Büro- und Heftklammer.
Welches Ablagesystem jeweils verwendet wurde, spielt beim „Umbetten“ keine Rolle. Wir nehmen, wie es kommt und dokumentieren so die Arbeitsweise der jeweiligen Stelle.
1) Das auch für Kommunalarchive maßgebliche Archivgesetz des Landes NRW können Sie hier einsehen.
2) Eine knappe Findbuch-Definition finden Sie bei Wikipedia.
Seit nunmehr drei Jahren befasse ich mich mit der Deutschen Friedensgesellschaft, Bezirk Sieg-Lahn-Dill. Da ich nun zu Ende komme, begegnet mir auch Frau Hedwig Finger. Dazu der Hinweis, auf S. 4 steht irrtümlich Hedwig „Zimmer“.
Das unter Anmerkung 32 von Dr. Opfermann aufgeführte Mitgliederverzeichnis (Nachlass meines Vaters) ist nicht aus den Jahren 1963/64. Es ist aus den ersten Nachkriegsjahren, denn es enthält einen großen Teil der Mitglieder, die bereits vor 1933 Mitglied der DFG waren. Auch der Hinweis: Karl Ley, Freusburg, spricht dafür. Ley war bis 1950 „Herbergsvater“ auf der Freusburg. In dem Mitgliederverzeichnis von 1961 der DFG Siegen (NL W. Fries) ist der Name Hedwig Finger nicht mehr enthalten. Es sind immerhin noch 24 Namen enthalten. Mir liegt das Rundschreiben Nr. 3 der Aktionsgruppe Siegerland der Notgemeinschaft für den Frieden Europas v.. 31.7.1952 vor. (Das ist die von Dr. Dr. Gustav Heinemann 1950 gegründete Gruppe.) Dazu gibt es die Einladung gleichen Datums für die öffentliche Versammlung am 5.8.1952 im Kaisergarten. Frau Hedwig Finger, Landtagsabgeordnete, war mit dem Thema: „Die Wiederaufrüstung und die Frau“ vorgesehen. Der Student Dieter Zitzlaff wollte die Frage: „Ist die heutige Jugend unpolitisch?“ beantworten. Es darf also nicht heißen „Später trat sie der DFG bei.“ Vermutlich trag Hedwig Finger der im Frühjahr 1946 wieder gegründeten Ortsgruppe Siegen der DFG bei. (Es existiert ein Artikel vom 10. Mai 1946, vermutlich der „Feiheit“. Ein Datum der Versammlung ist nicht angegeben. Die Versammlung könnte schon im März stattgefunden haben. da in einer Resolution dem Präsidenten der DFG, Freiherr von Schoenaich, Gruß und Glückwünsche zum 80. Geburtstag (16.2.1946) übermittelt wurden.
Ja, die Fristen der Länder sind recht einheitlich. Allerdings muss ich noch auf das Bundesarchiv hinweisen; dort gelten sogar noch längere Fristen: § 5 (2) Bundesarchivgesetz.
Ach so, ich dachte, ein Archiv würde die Akten ggf. neu ordnen für eine einheitliche chronologische Ordnung.
Was die Heftklammern angeht: Falls ich jemals beruflich irgendwo landen, wo potentiell archivwürdige Akten erstellt werden (halte ich für unwahrscheinlich, ist aber bisher nicht auszuschließen), verspreche ich, damit sparsam umzugehen. ;-)
Siegener Zeitung berichtet in ihrer heutigen Printausgabe über Kürzung der Mittel für Denkmäler in NRW und verweist auf die Online-Petition. Als regionale Bespiele werden der „Alten Flecken“ in Freudenberg und die eisenzeitliche Montanregion Siegerland mit ihren jüngsten Funden in Siegen-Niederschelden erwähnt
Glücklicherweise handelte es sich nur um Feuchtigkeit und Schmutz, die bei Bauarbeiten an das Archivgut gelangt sind. Schimmel hätte noch eine aufwändige Dekontaminierung nach sich gezogen.
Ich bin immer wieder über die Arbeitsergebnisse der Restauratorinnen und Restauratoren erstaunt. Der Dank gilt der Werkstatt des LWL-Archivamtes. Soviel Werbung darf sein!
kleine Ergänzung:
a) 100%igen Alkohol gab und gibt es nicht.
b) in der äußeren Medizin wird vergällter (nicht unvergällter!) Alkohol, der nicht trinkbar ist, verwendet.
c) unvergällter Alkohol (Weingeist), der genießbar ist, fällt unter die sog. Branntweinsteuer.
Ergänzend zu meinem Vorredner möchte ich anmerken, dass „vergällter Alkohol“ nicht bedeutet, dass der Alkohol verdünnt ist, sondern dass ein Stoff (Vergällungsmittel ) zugesetzt wurde, um ihn ungenießbar zu machen, wodurch er nicht mehr unter die Steuerpflicht fällt, da er nicht mehr trinkbar ist.
Sehr geehrter Herr Dick, wir besitzen von Hermann Manskopf ein Bild in Spachteltechnik : Siegen-Unterstadt mit Martinikirche und dem Bau der Siegbrücke. Der Dicke Turm hat noch einen geraden Abschluß, also ohne Haube/Glockenspiel. Da es sich um ein Geschenk handelt, haben wir keine Idee was den Wert des Bildes angeht. Kennen Sie Bewerter von Manskopfbildern?
Ich habe heute diesen Beitrag von Ihnen gelesen. Ich habe an Kunstwerken von Siegerländer Maler. Sollten Sie Interesse haben ihr Bild zu verkaufen würde ich mich freuen wenn sie mit mir Kontakt aufnehmen.
Besten Dank.
Maria Ihne
Oh toll, endlich wieder einen kleinen Einblick in die Heilstättenangelegenheiten. :-)
An „Korrekturen und Ergänzungen“ würde ich mich eventuell versuchen (ohne Erfolgsgarantie, die alte Handschrift ist mir immer noch recht ungewohnt), allerdings ist bisher nur die letzte Seite der Rechnung veröffentlicht (dafür allerdings gleich drei mal).
Nein, die Bücher werden nicht umgebettet. Eine restauratorische, buchbinderische Bearbeitung der Bücher ist nur dann angezeigt, wenn z. B. die Heftung der Blätter mit Metallteilen erfolgt ist, oder die Bindung sich löst. Diesmal also kein „Ratsch“.
Das freut mich zu hören. Es wäre irgendwie schade um die Bücher, wenn man sie in Einzelseiten zerlegen würde. So wirken sie doch um einiges originalgetreuer.
Betr. S. Vogt——- Werter Herr oder Dame, bin auch hobbymässig kunstinteressiert, habe vor ca. 20 Jahren in der Tschechei (Liberec/ Reichenberg) bei privaten Leuten (keine Kunstsammler¨) zufälligerweise ein Gemälde gesehen, es war signiert mit S. Vogt! Ein wunderbar gemaltes grosses Gemälde, Landleben auf dem Felde, es hat mich sofort fasziniert, grossartiger Künstler! Grösse vielleicht 1,5 m x 1,2 m, in starkem Goldrahmen gefasst! Ich wollte es damals auch kaufen, vielleicht für 1 oder 2 tausend DM, hatte aber damals nicht das richtige Fahrzeug um es in die Schweiz zu transportieren und der Zoll hat mich damals auch abgeschreckt!!! Habe aber damals Fotos gemacht, falls es sie interessiert schicke ich diese per E-mail oder per Post, gratis und franko selbstverständlich! Wo diese Leute resp. Gemälde jetzt ist, – weiss ich nicht, habe keinen Kontakt mehr! Leider! Hoffe Ihr Interesse geweckt zu haben!Also, auf bald! H. Beyeler
Ein SUPER Bildband, die Bilder sind einsame Spitze und die Texte von Dr. Lückel sind von einem echten Kenner geschrieben, ein TOLLES Geschenk für alle, die Wittgenstein lieben oder KENNENLERNEN WOLLEN – nur klasse, dieses Buch!!!! *****
Aller möglichen Persönlichkeiten wird bei uns hier im Siegerland gedacht — und ich habe auch nichts dagegen!
Aber immer wieder muß man erfahren, daß unser Stilling zuhause in seiner Heimat ein Unbekannter geworden ist. Leider!
Wäre da nicht das Krankenhaus und verschiedene Straßen nach ihm benannt, so wäre sicher auch der Namen heute so gut wie ganz vergessen.
Um so erfeulicher finde ich es, daß die Ev. Studierendengemeinde einem ausgewiesenen Kenner von Jung-Stilling Gelegenheit gibt, unseren Landsmann jungen Akademikern vorzustellen.
Weitere Vorträge dieser Art in heimischen Vereinen könnten dazu führen, daß auch die weltweit bekannte „Lebensgeschichte“ wieder gelesen wird.
Als Zeithistoriker war mir bislang nur der VDA bekannt, der schwer rechtslastige „Verband für das Deutschtum im Ausland“, nach dem NS-Ende einige Jahre verboten, vor einigen Jahren endlich doch wenigestens umbenannt.
Nun erfahre ich von einem Zusammenschluss mit ebenfalls diesem Kürzel, aber kleinem „d“, der sich auch noch dagegen zur Wehr setzt, dass mit dem Vorwand „facebuch“ die flächendeckend komplette, für die Historiografie (und die kritischen Mmedien) unverzichtbare Datenbestände vernichtet werden sollen. Ich lese ja noch regelmäßig die Zeitung, davon hatte ich aber noch gar nichts erfahren. Jedenfalls dankeschön an die aufmerksamen Archivare vom VdA!
Lieber Herr Beyerle, wenn es Ihnen nichts ausmacht…ich hätte sehr grosses Interesse an Ihren Fotos…es wäre sehr interessant, ein Bild zu sehen, das dem unnützen Inferno von Dresden entging…Danke…Herzliche Grüsse
Lieber Gerd, habe die Fotos Herrn Wolf geschickt! Seid bitte nicht enttäuscht, die Fotos sind extrem schlecht, mit einer alten Sofortbildkamera gemacht im Jahr 1995, damals gabs leider noch keine Cam’s, oder jedenfalls nhatte ich noch keine! – Viel besser wäre es – wenn wir das Gemälde nach Deutschland holen würden, der grossartige Maler S.Vogt hätte es alleweil verdient, vielleicht hängt er ja noch da! Wenn Du Lust hast – melde Dich bei mir! Grüsse aus der Schweiz!
Die Literaturliste zu Siegrfried Vogt muss um folgenden Ausstellungskatalog ergänzt werden:
Sächsischer Kunstverein Dresden: Kunstausstellung Gau Sachsen Brühlsche Terasse 13.Juni bis 22.August 1943, Dresden 1943
im Familienbesitz befindet sich noch ein Teil des Bilderzyklus: Krieg und Gefangenschaft, bestehend aus Aquarellen, Bleistiftzeichnungen und Ölskizzen. Für Interessierte könnte ich den Teil, zu dem ich Zugang habe, ins „net“ stellen. Falls Ihr daran interssiert seid, meldet Euch bitte kurz.
Tur mir leid, ich habe die Nachricht erst jetzt gelesen.
Aus beruflichen Gründen kann ich mich erst um den Jahreswechsel 2013/14 der Sache annehmen.
Würde gern dann auch Kontakt aufnehmen.
Ein Vortrag mit salopp formuliert „steilen Thesen“. Denn viele Fragen bleiben.
Wie wichtig ist die Mentalität für Bauprojekte? Sind die vorhandenen Ressourcen (Finanzen, Baustoffe) nicht grundlegender?
Gibt es den Bautyp des Becherhauses nur in den ev. Gebieten des Siegerlandes? Wenn nein, überspringt die sicherlich calvinistisch geprägte Mentalität quasi die Religionszugehörigkeit?
Waren die Becherhäuser wirklich nur „Arbeiterhäuser“? Wenn es andere Bauherren gab, wie sind diese im Blick auf die These einzuordnen?
Wenn die verwendeten Baustoffe (Bims, Stahl) modern und erschwinglich waren und wenn die Becherhäuser Fertighäusern gleich produziert werden konnten, warum baute man in der Erscheinungsform so rückwartsgewandt, so antimodern?
Wurden andere calvinistisch geprägte Regionen Südwestfalens (z. B. märkisches Sauerland) als Vergleich herangezogen?
„mittags von 15 Uhr bis 15 Uhr“ Klingt schaffbar. Ein allzu langer Mittagsschlaf ist da bei den Nachbarn aber nicht drin. ;-)
Ich hätte allerdings noch eine allgemeine Frage: Wie kommen die Unterlagen überhaupt ins Kreisarchiv? Die Heilstädte war wenn ich es richtig in Erinnerung habe als e.V. organisiert, unterstand also nicht direkt dem Kreis. Inwieweit ist das Kreisarchiv da überhaupt „zuständig“?
Sorry für den Verschreiber in der Hausordnung: die Mittagsruhe ging von 13 – 15 Uhr..
Und nun zur „Zuständigkeit“:
Richtig: die Heilstätte war als e.V. organisiert, dieser Verein lief unter Beteiligung des Landeswohhlfahrtverbandes, der Kreise Siegen, Olpe und Wittgenstein, des damaligen Amtes Eiserfeld und der damaligen Gemeinden Eiserfeld, Niederschelden, Gosenbach und Eisern; im Verwaltungsrat saß bspw. immer der Oberkreisdirektor Kuhbier.
Außerdem wurde nach der Auflösung des Vereins in 1967 der Verwaltungsrat Fischbach als Übergangsverwalter/ sog. „Liquidator“ eingesetzt; dieser saß beim Kreis.
Zitat aus einer Vereinbarung, ebenfalls zu finden in den Archivalien: „(…) Die Krankenakten der Anstalt werden mit deren Auflösung vom Landdkreis Siegen übernommen und dem Gesundheitsamt zur Verwaltung übergeben…“
via Mailing-Liste „Westfälische Geschichte“:
„Volkskundliches Museum Wilnsdorf feierte 20. Geburtstag
Der vergangene Sonntag im Museum Wilnsdorf war eine wahrlich runde Sache. Nicht nur, dass die volkskundliche Abteilung ihr 20jähriges Bestehen mit einem gelungenen Aktionstag feierte. Auch zu den Anfangstagen des Museums schloss sich ein Kreis. Denn wo am Sonntag 500 Besucher bestaunen konnten, wie zahlreiche Akteure historisches Handwerk wiederbelebten, waren Mitte der 1980er Jahre tatsächlich noch Handarbeit und Muskelkraft gefragt.
Was viele Besucher nicht wissen: Wo heute das Museum Wilnsdorf steht, war früher eine alte, ausgediente Industriehalle zu finden, in der bis 1985 produziert wurde. „Allerdings liegt der Fokus des Volkskundlichen Museums ein bisschen weiter in der Vergangenheit“, erzählt Museumsleiterin Dr. Corinna Nauck bei einem gemeinsamen Rundgang mit Wilnsdorfs Bürgermeisterin Christa Schuppler. Dem Leben und Arbeiten zu Beginn des 19. Jahrhunderts im südlichen Siegerland hat sich das Haus verschrieben, die Idee dazu entstand in den 1980er Jahren, als für ein Festbuch anlässlich des 800jährigen Bestehens Wilnsdorfs umfangreiches Wissen zusammengetragen wurde. Wissen über die Geschichte des Wilnsdorfer Raumes, das nicht einfach verloren gehen sollte. Und so begannen nach den Jubiläums-Feierlichkeiten die Vorarbeiten für die Einrichtung eines Volkskundlichen Museums: nämlich Sammeln, Sichten und Sortieren.
Im Mai 1993 war es soweit, das Museum Wilnsdorf öffnete seine Türen. Hinter ihnen verbirgt sich noch heute ein Museum der besonderen Art. Die Exponate stehen hier nicht abgeschieden in Vitrinen, losgelöst von Zeit und Raum. Das Museum gleicht vielmehr einem Bilderbuch, ganze Szenen aus der Lebens- und Arbeitswelt vor 100 Jahren wurden nachgestellt: Eine komplette Schusterwerkstatt ist zu sehen (ein Original aus dem Nachlass einer Wilnsdorfer Familie), eine Schneiderei, ein Kaufmannsladen und vieles mehr. Besonders eindrucksvoll ist die Front eines Siegerländer Fachwerkhauses, um die sich die Kompositionen über zwei Etagen verteilen. „Wir legen sehr viel Wert auf Detailtreue, auf Authentizität“, betont Dr. Nauck. Und mit sichtlichem Stolz fügt sie hinzu: „Bisher haben wir dazu weder von Wissenschaftlern noch von Besuchern Kritik erfahren“.
Vielmehr erhält sie immer wieder die Bestätigung, dass gerade die lebendige Darstellung, die Fülle an Details das besondere Flair des Wilnsdorfer Museums ausmachen. Selbst für langjährige Besucher gibt es stets Neues zu entdecken. Ohne das gelungene Konzept zu ändern, fügt Corinna Nauck der Ausstellung neue Stücke hinzu oder tauscht ältere Exponate aus. Dabei kann die Museumsleiterin auf einen umfangreichen Fundus zurückgreifen: Im Magazin lagern so viele Dinge, dass die Ausstellung noch fünfmal bestückt werden könnte. Diesen Hort weiß übrigens auch die Kulturabteilung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe zu schätzen und fragt oft und gerne nach Leihgaben. „Aktuell haben wir historische Badeanzüge für eine Wanderausstellung zum Thema Camping zur Verfügung gestellt“, verrät Corinna Nauck.
Aber nicht nur in der Ausstellung hält das Volkskundliche Museum die Siegerländer Geschichte lebendig. Immer wieder werden bunte Feste und Aktionstage veranstaltet, die hautnah einen Blick in die Vergangenheit erlauben – so wie am vergangenen Sonntag. Im Museum und auf dem Hof waren Imker, Butterfrau, Haubergsvorstand, Schmied und viele andere aktiv. Bei letzterem ließ es sich auch Christa Schuppler nicht nehmen, kräftig anzupacken. Wilnsdorfs Bürgermeisterin ist überzeugt von der Lebendigkeit des Museums: „Die Ausstellung ist spannend zusammengestellt, und gerade für Kinder und Jugendliche gibt es viele Angebote, um das Museum auf eigene Faust erkunden zu können“. Aber auch für alle anderen ist das Museum mit seinen regelmäßigen Festen, Aktionstagen, Sonderausstellungen und kulturellen Veranstaltungen immer wieder einen Besuch wert.
Im Herbst wartet übrigens schon der nächste Geburtstag darauf, gebührend gefeiert zu werden: Im Oktober wird die Kulturgeschichtliche Abteilung des Museums zehn Jahre alt. Natürlich wird auch dieses Jubiläum wieder zum Anlass für einen besonderen Aktionstag genommen, zu dem das Museum am 3. Oktober einladen wird. Besucher erwartet dann eine spannende Reise durch die Zeit, von der Steinzeit über die römische Antike bis hin zum Mittelalter.“
s. dazu: Steffen Schwab „Straßenschild für Unbelehrbaren. Erneute Kontroverse um Nazi-Funktionär und Heimatforscher Lothar Irle“, in: Westfälische Rundschau v. 15. Juni 2013:
„….. „Es wäre nicht das Schlechteste, ihn einfach verschwinden zulassen“, empfiehlt Dr. Elkar zum Umgang mit dem Heimatforscher, der sich nie von seiner NS-Vergangenheit distanzierte – wenn es denn nicht Menschen gäbe, die ihn stets aufs Neue verehrend würdigten. Für den aus seiner Sicht unwahrscheinlichen Fall einer Straßenumbenennung hatte Dr. Elkar zwei Vorschläge „Blaukehlchenweg“ für die vom Aussterben bedrohte Vogelart. „Oder einfach die Eisenhüttenstraße ein wenig länger machen.“ ….“
Wilhelm Güthling in: Torsten Musial: Staatsarchive im Dritten Reich: zur Geschichte des staatlichen Archivwesens in Deutschland, 1933-1945, Berlin 1996, S. 150,. 153, 154, 194. Die Quintessenz der Belegstellen findet sich in der auf S. 192 beginnenden Zusammenstellung der in den besetzten Gebieten eingesetzten Archivare:
Belgien, Nordfrankreich:
Güthling, Wilhelm (Reichsarchiv Potsdam): Okt. 1941 bis 13. Jan. 1942
Paris:
Güthling, Wilhelm (Reichsarchiv Potsdam): 7. Okt. 1940 bis 5. Okt. 1941
Das wäre wohl einer der Gründe, warum das wohl kein Job für mich wäre, auch wenn ich Archive recht interessant finde. Es fiele mir wohl zu schwer, Unterlagen zu entsorgen, ich hätte immer Angst, dass irgendwas dabei ist, wo sich später herausstellen könnte, dass es interessant oder wichtig ist. Da wäre das Archiv schnell voll. ;-)
Aber ist die große abgeschlossene Tonne nicht ein bisschen „overkill“? Datenschutz ist natürlich wichtig, aber es sind ja keine Staatsgeheimnisse, die darin entsorgt werden, sodass wohl eher nicht befürchtet werden muss, dass sich da jemand unberechtigterweise ein paar alte Rechnungen draus klaut. Selbst in Krankenhäusern, wo man ja durchaus mit sensiblen Patientendaten zu tun hat, habe ich bisher für solche Zwecke bestenfalls einfache Pappkartons mit passender Beschriftung gesehen.
1) Ja, die Bewertung von Archivgut ist die „Königsdisziplin“ des Archivierens, deren Ziel die möglichst dichte Überlieferung aller kommunaler Lebenswelten ist.
2) Die Tonne ist tatsächlich etwas „too much“, denn weder besonders schützenswerte personenbezogene Unterlagen, noch Unterlagen die noch einem Betriebsgeheimnis unterliegen wurden wohl vernichtet; so sprach für die Vernichtung in dieser Tonne: sie befindet sich im Gebäude des Kreisarchivs und stellt für alle enentuellen Fälle eine datenschutzkonforme Vernichtung dar.
Zu 1) Eine „Königsdisziplin“, bei deren Ausübung man aber auch nicht zu viel grübeln darf. Ist der Archivar phantasievoll genug, um zu jedem Blatt Papier ein potentiell mögliches Recherchethema zu imaginieren, für das gerade dieses Schriftstück unverzichtbar wäre, blockiert er sich selbst und kann ruhigen Gewissens überhaupt nichts kassieren. Wer würde seine Hand dafür ins Feuer legen wollen, dass nicht irgendwann ein Historiker und dank dessen Arbeit die Gesellschaft Nutzen aus den Einzelrechnungen über Obstlieferungen an die Heilstätte Hengsbach ziehen würde, die nun in der Mülltonne gelandet sind? Könnte nicht eine ganz unscheinbare Information auf einem dieser Belege gerade diesen künftigen Forscher – weil er sie mit anderen unscheinbaren Informationen in Verbindung bringen kann – zu unvorhersehbaren Fragen und Erkenntnissen führen – ein Zufallsfund mit weitreichenden Folgen? Wie viele Verbrechen blieben unaufgeklärt, wenn Kriminalisten nach dem Vorbild von Archivaren arbeiteten und bei der Spurensicherung nicht buchstäblich jede Faser eintüten sondern alles ignorieren würden, dessen Bedeutung für den Fall ihnen nicht auf der Stelle einleuchtete?
Archive sind keine idealen Rückzugsgebiete in dieser unvollkommenen Welt. Archivare lindern kein Elend und retten nicht die Menschheit. Wie jeder andere Zeitgenosse verzichten auch sie – vielleicht oder hoffentlich ein bißchen weitsichtiger – emsig auf den Erhalt von Informationen, und zwar insgesamt auf den überwiegenden Teil dessen, womit an den Schreibtischen dieser Welt Tag für Tag das geduldige Papier gefüllt wird. Für Archivare, die dem Wahn der prophetischen Unfehlbarkeit nicht erlegen sind, ist dies unbefriedigend, aber alternativlos. Deshalb kann die Arbeit in Archiven nur schicksalsergebenen und desillusionierten Menschen empfohlen werden.
(Übrigens nicht nur die Arbeit, sondern auch die Benutzung: Ein Archiv ist ein Konzentrat dieses irdischen Jammmertals, kein Schlaraffenland. Der Aspekt scheint mir bei all der archivpädagogischen Euphorie unserer Zeit übersehen zu werden.)
P.K.
„Ein Archiv ist ein Konzentrat dieses irdischen Jammmertals, kein Schlaraffenland.“ Sätze für die Ewigkeit – mit der Tastatur in Stein gemeißelt. Würde nicht der Autor selber einem radikalen Kassieren das Wort reden, man müsste den Kommentar allen Archiven dieser Welt zum ewigen Aufbewahren ins Stammbuch schreiben. Dank und nochmals Dank von einem
Schicksalsergebenen
Ehrenamtliche Archivtätigkeit ist eine reizvolle Aufgabe, von der schon viele kleinere Archive profitiert haben, wie hier das des Kirchenkreises Wittgenstein. Da Herr Burkardt noch nicht im Ruhestand ist und seinen Dienst weit ab von Wittgenstein verrichtet, würde mich interessieren, wieviel Freizeit er investiert, um diesen Spagat zu schaffen.
„Spagat“ trifft den Nagel auf den Kopf. Eine Wochenstundenzahl möchte ich für die Arbeit ungern angeben, das variiert, je nach Anfragenanfall. Im Schnitt rechne ich mit einem halben Tag Arbeit im Archiv pro Wochenende für die laufenden Verzeichnungsarbeiten. Dazu kommen Recherchen nach Bedarf. Entschädigung ist die Arbeit mit reizvollem Quellenmaterial zur Lokalgeschichte …
Das Siegerlandkolleg in Siegen wird im Internet gerade scharf kritisiert. An der Festschrift zum 50. Bestehen des Kollegs hat auch ein Mann mitgearbeitet, den der Staatsschutz der rechtsradikalen Szene zuschreibt und der für die NPD im Siegener Rat ist. Der Mann holt sein Abitur am Siegerlandkolleg nach. Das Siegerlandkolleg wollte den Mann nicht von der Mitarbeit an der Festschrift ausschließen. In der Schule oder im Unterricht sei er nie durch rechtsradikale Äußerungen aufgefallen.“
Quelle: WDR. Lokalzeit Siegen, Nachrichten v. 3.7.2013
„Weiter Ärger um Festschrift
Das Siegerlandkolleg bekommt wegen seiner Festschrift jetzt auch Kritik aus der Politik. Einen Artikel in der Festschrift zum 50. Bestehen des Kollegs hat der Siegener Sascha Maurer verfasst. Der Staatschutz rechnet ihn der rechtsradikalen Szene zu. Der Siegener Landrat Paul Breuer findet, dass das Siegerlandkolleg einen großen Fehler gemacht hat. Das Kolleg könne kein Interesse daran haben, mit Maurer in Verbindung gebracht zu werden, so Breuer. Sascha Maurer holt am Siegerlandkolleg derzeit sein Abitur nach.“
Quelle: WDR. Lokalzeit Siegen, Nachrichten v. 4.7.2013
Gemäß eines Fernseh-Beitrages in der heutigen WDR-Lokalzeit Südwestfalen wird die Festschrift ohne den Beitrag von Sascha Maurer erscheinen. Unter der Adresse http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit/lokalzeit-suedwestfalen/ ist die Lokalzeit nach Ausstrahlung noch sieben Tage im Internet abrufbar.
1) „Artikel von NPD-Ratsmitglied wird entfernt
Der Artikel des Siegener NPD-Ratsmitglieds Sascha Maurer wird nun doch aus der Festschrift zum 50-jährigen Bestehen des Siegerlandkollegs entfernt. Regierungspräsident Gerd Bollermann wolle nicht in der selben Festschrift auftauchen wie der bekannte Siegener Rechtsradikale, teilte die Bezirksregierung mit. Bollermann hatte ein Grußwort für die Festschrift verfasst. Die Mitarbeit von Maurer hatte im Internet und auch in der Politik für heftige Kritik gesorgt. Sascha Maurer hatte einen Artikel über das Einzugsgebiet des Kollegs in der Festschrift verfasst.“
Quelle: WDR, Lokalzeit Südwestfalen, Nachrichten v. 5.7.2013
2) „Neonazi steuert Beitrag hinzu
Siegerlandkolleg steht für Festschrift aktuell in der Kritik
Das Siegerlandkolleg in Weidenau steht aktuell für seine Festschrift zum 50. Geburtstag in der Kritik. Sie enthält einen Beitrag von Sascha Maurer. Er sitzt für die NPD im Siegener Rat und macht am Siegerlandkolleg sein Abitur nach. Der Beitrag über „Das Siegerlandkolleg in Tabellen, Grafiken und Karten“ ist nach Ansicht des Kollegs ein reiner Fachaufsatz und keine politische Abhandlung. Außerdem ist Maurer noch nie durch rechtsradikale Aussagen in der Schule aufgefallen. Deshalb gilt auch für ihn der Gleichbehandlungsgrundsatz. Durch Druck von außen soll der Beitrag jetzt allerdings aus der Festschrift rausgenommen werden. “
Quelle: Radio Siegen, Nachrichten v. 5.7.2013
3) „… Die Arbeit in der Festschrift beschäftigt sich mit der geografischen Darstellung des Einzugsgebietes des Siegerland-Kollegs. Sie ist aufgeführt im dritten Kapitel und beschreibt mit einem weiteren Text eines anderen Autoren „Das Siegerland-Kolleg in Tabellen, Grafiken und Karten“.
„Das ist ein reiner Fachaufsatz“, sagt der Kollegleiter Alfons Quast, „keine politische Abhandlung. Der 14-seitige Text mit Grafiken und Tabellen ist das Ergebnis eines sogenannten freiwilligen Projektkurses. Die Schüler arbeiten selbstständig ein Jahr lang an einem bestimmten Thema und präsentieren. Viele nutzen das als Vorbereitung für das Studium“, erläutert Alfons Quast.
Grundsätzlich gelte an der Schule der „Gleichbehandlungsgrundsatz“, so Quast weiter. Mauerer habe ihm zudem zugesichert, „die ungeteilte Würde aller Menschen“ zu achten. …..“
Jens Plaum „NPD-Politiker schreibt Text für das Siegerland-Kolleg. Sascha Maurers Arbeit in der Festschrift zum 50-jährigen“, in: Westfälische Rundschau, Print v. 5.7.2013
Ist das wieder eines dieser Rätsel, die uns von der Arbeit abhalten und am Ende nie aufgelöst werden? Na gut, dann rate ich mal: Es sind Prüfungsarbeiten von Absolventen des Hilchenbacher Lehrerseminars (andere mußten zum Abschluß Herbarien anlegen), aus den frühen 1920er Jahren (also Generation Lothar Irle), wobei die Blätter von den berühmten Palmen im Park des Stifts Keppel stammen. Wenigstens einen Trostpreis habe ich mir damit verdient!
Lieber Kollege, was soll man denn ernsthaft dazu sagen, wenn Sie zwar um Informationen bitten, aber selbst keine herausrücken wollen? Wie kommt das Kreisarchiv SiWi zu so etwas? Sind die überhaupt authentisch, d.h. „frühe Neuzeit“, keine modernen Nachahmungen orientbegeisterter Kunstgewerbler? Was ist Ihnen schon bekannt und was erwarten Sie? Wollen Sie von der Menschheit wissen, wie Sie im Archiv mit den Schätzchen umgehen sollen? (Siehe dazu z.B. „Eine Methode, Palmblattmanuskripte zu restaurieren und konservieren“ von 1975, http://www.iada-home.org/ta75_105.pdf ) Die Schrift ist anscheinend singhalesisch; es läßt sich also wild spekulieren, dass die Manuskripte während der Zugehörigkeit Siegens zu Oranien aus der damaligen niederländischen Besitzung Ceylon irgendwie hierher gelangt waren. Nur bringt das niemanden weiter. Fragen Sie doch einfach mal gezielt bei ausgewiesenen Experten nach. Als nächstliegender Anlaufpunkt bietet sich das Südasien-Institut der Uni Heidelberg an.
P.K.
nein, keine Hintergedanken! Gerade einmal Vermutungen, um welche Sprache es sich handelt. Diese 3 Stück wurde mir gestern von einem Nutzer des Archivs übergeben mit dem Hinweis, dass ich einmal sehen solle, worum es handelt. Dies wollte ich nicht alleine machen …..
Danke für den Hinweis zur Restaurierung der Stücke!
Gruß den Hügel hinauf!
T.W.
Weit gefehlt, Kollege Kunzmann! Die Generation Irle verschmähte Palmblätter als Beschreibstoff, von Dr. I. sind lediglich Runenmanuskripte auf herkömmlichem Eichenlaub überliefert.
Die hier vorliegenden Palmblätter stammen dagegen aus dem Kreisarchivbestand „Korrespondenzen des Landrats“. Heraldische und ikonografische Elemente weisen eindeutig auf den Maharadscha von Eschnapur als Verfasser hin. Der empörten Diktion des im seltenen ostsinghalesischen Dialekt verfassten Schreibens nach zu urteilen, handelt es sich ganz offensichtlich um die Antwort auf eine landrätliche Anfrage nach Überlassung einer Herde indischer Elefanten, die als Mammuts am Rothaarsteig angesiedelt werden sollten. Damaliger Projektleiter war ein gewisser Fritz Lang. Die Wisente sind demnach allerhöchstens zweite Wahl – und sehr wahrscheinlich Wittgensteiner Kühe im Wisentgewand.
Reicht doch für den Trostpreis.
Und einen schönen Sommer noch.
Ruhm und Ehre unserem Stadtarchivar! Bei nochmaligem Betrachten des Palmblattes Nr. 2 (das mit dem niedlichen Elefanten) fiel es auch mir wie Schuppen von den Haaren.
Des Maharadschas Empörung läßt sich gut nachvollziehen. Eine Elefantenherde im Tausch gegen ein paar heilige Siegerländer Kühe? Welch ein Affront! Jedoch muß das Geschäft am Ende trotzdem zustande gekommen sein, denn der vierköpfigen Eli-Herde wurde im Siegerland ein würdiges Denkmal errichtet: Es steht in Langenholdinghausen, an der Straße nach Meiswinkel, direkt vor der Steinmetzwerkstatt. Die heute unter einem anderen Namen florierende örtliche Wein- und Bierstube (mir nicht unbekannt) hieß seinerzeit „Zum Rüssel“, weil die tierischen Dickhäuter (und auch schon der eine oder andere menschliche) dort getränkt wurden, nachdem sie ihr Tageswerk im Hauberg vollbracht hatten. Nach ausgiebiger Zecherei suchten unsere Freunde eines Abends das nahegelegene Dorf Holzklau (jenseits der Grenze zum Freudenberger Hoheitsgebiet) heim und vergnügten sich dort so übermütig, dass die Einwohner in alle möglichen, d.h. zwei, Richtungen entflohen. So kam es zur Gründung der Orte Ober- bzw. Niederholzklau, während an die ursprüngliche Siedlung dazwischen heute nichts mehr erinnert außer einem rudimentären Bestand „Gemeinde [Mittel-]Holzklau“ im Stadtarchiv Freudenberg. Auch das im Besitz des Haubergsvorstehers befindliche letzte bekannte Exemplar des anonymen Traktats „Anweisung zum Holzdiebstahl oder: Wozu Bäume umständlich züchten, wenn es auch anders geht? Eine Erwiderung an Herrn von Carlowitz. Von einem wahren Siegerländer Patrioten. Herborn 1714“ wurde ein Opfer der Trampeltiere. Recht getan!
Um dem höheren Blödeln hier noch weitere Nahrung zu geben: gehörte Siegens berühmtester Fürst Johann Moritz nicht zu den Trägern des Elefantenordens(s. Alfred Lück: Das Haus Nassau-Siegen und der dänische Elefantenorden. In: Siegerland. Blätter des Siegerländer Heimatvereins e.V. Bd. 31 (1954), S. 65-66)?
Aber auch sachdienliche Hinweise werden weiter gerne angenommen.
@Peter Kunzmann, @Jaganath: Ihren Hinweis, sich an ein Ostasieninstitut zu wenden, habe ich gerne aufgegriffen.
@Jaganath: Ich hatte auf Indisch bzw. Thailändisch getippt.
Niemand hat ein Ostasieninstitut vorgeschlagen. „Jaganath“: Südostasien (Burma = heute Mianmar); ich: Südasien (Ceylon = Sri Lanka). Dafür gibt es jeweils spezielle Institute. Falls Ihr Benutzer die Blätter im Urlaub auf dem Flohmarkt erworben hat, wird er sich vielleicht noch an das Land erinnern. (Manche Zeitgenossen machen es erfahrungsgemäß aber auch gern spannend: „Ich weiß zwar schon das meiste, aber mal sehen, ob der Archivar auch so schlau ist wie ich und selbst darauf kommt.“ Das motiviert enorm!)
P.K.
Beide genannten Institute sind eingeschaltet. Ich habe heute meinen Kopf ein wenig woanders, daher bitte ich um Entschuldigung.
Die Manuskripte stammen aus keinem Urlaubskauf, sondern wurden meinem Nutzer überlassen mit dem Hinweis bei der Schrift handele es sich um Hebräisch.
Aus Heidelberg kommt die Bestätigung, dass es sich um die birmanische Sprache handelt! Danke an Jaganath für den Hinweis und Danke an Dr. Gieselmann, Heidelberg, für die schnelle Reaktion!
„Stadt plant Archiv ohne Kunst- und Museumsbibliothek
Geschätzte Kosten sinken durch den Verzicht um 21,6 Millionen Euro
Der Rat hat die Stadtverwaltung beauftragt, den Neubau des Historischen Archivs am Eifelwall mit dem Rheinischen Bildarchiv, aber ohne die Kunst- und Museumsbibliothek (KMB) zu planen. Wenn diese Entwurfsplanung steht, muss der Rat noch über den Bau selbst entscheiden. Die geschätzten Kosten für das Gebäude belaufen sich auf etwa 76,3 Millionen Euro, 21,6 Millionen weniger als wenn die die Kunst- und Museumsbibliothek in den Bau integriert worden wäre. Der Rat beauftragte die Verwaltung, weitere Einsparpotenziale etwa durch den Verzicht auf eine Klimaanlage im Vortrags- und Ausstellungraum und eine Verkleinerung der Dienstbibliothek im Planungsprozess zu nutzen. Die Finanzierung des Neubaus erfolgt aus dem Wirtschafts- und Erfolgsplan der städtischen Gebäudewirtschaft.
In seinem Beschluss begrüßt der Rat das Angebot der Universität zu Köln, in Hinblick auf die Kunst- und Museumsbibliothek zusammenzuarbeiten. Er beauftragte die Stadtverwaltung, auf Basis des vom Rektorat der Universität zu Köln vorgelegten Angebots eine Rahmenvereinbarung zur wissenschaftlichen und administrativen Kooperation vorzubereiten. Die Zusammenarbeit soll das Leistungsangebot der KMB steigern und Synergieeffekte realisieren. Der Rat beauftragte die Stadtverwaltung weiterhin, die mit Unterstützung des Landes begonnene Initiative zur Zusammenarbeit von Universität und KMB fortzusetzen und weitere Kooperationspartner zu gewinnen.
Mit der Entscheidung für den Bau des Historischen Archivs ohne die Kunst- und Museumsbibliothek sind Umplanungen erforderlich, die mit einer zeitlichen Verzögerung von etwa sieben Monaten einhergehen. Die damit verbundenen Kosten können nach derzeitigerb Einschätzung durch die vorher angeführten Einsparpotenziale aufgefangen werden. Im Vergleich zu den eingesparten Kosten überwiegen die finanziellen Vorteile bei weitem.
Das vom Kanzler der Universität zu Köln übermittelte Kooperationsangebot gilt in allen Punkten bis auf die mögliche Beteiligung an den Betriebskosten auch für den Fall, dass die KMB nicht in den Neubau des Historischen Archivs zieht.
Stadt Köln – Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stefan Palm“
Pressemitteilung der Stadt Köln, 19.7.2013
Meine Frau und ich waren befreundet mit Ludwig Kirchhoff und haben einige Bilder von ihm.
Wir wären interessiert zu erfahren, wo Bilder von ihm ausgestellt werden.
Hallo Heinz Werner,
wir haben von den Eltern ein Bild von Ludwig Kirchhoff geerbt. Dahlien. Auf Holz gemalt. Ölgemälde.
Können sie uns ein Signum von Kirchhoff zusenden, da wir nicht wisse, ob es der Ludwig Kirchhoff ist.
Vielen Dank.
Grüße aus Köln.
Christel Bülow
Hallo Heinz-Werner,
Ich habe ein mit Kirchhoff signiertes Ölgemälde auf Holz aus dem Jahr 1946 von meinen Eltern, die im Sauerland lebten, geerbt. Es stellt Hortensien in brauner Kugelvase dar. Ich würde gern die Signatur mit der von Ludwig Kirchhoff vergleichen. Können Sie mir weiter helfen?
Liebe Grüße aus Mainz
Margit Bode
Danke für die Antwort. Die Signatur unter dem Holzschnitt entspricht in keiner Weise derjenigen auf meinem Gemälde. Die Signatur auf meinem Gemälde ist in geraden Druckbuchstaben gehalten. Mich würde die Signatur unter dem Dahliengemälde interessieren, da sie aus demselben Jahr stammt. Liebe Grüße aus Mainz Margit Bode
Insgesamt eine sehr aufschlussreiche Projektdokumentation mit der Findbuchveröffentlichung als Abschluss. Dazu möchte ich noch anmerken:
Bei schneller Durchicht scheint mir der für einzelne Klassifikationsgruppen vergebene Hinweis, die Sperrfrist laufe bis 1997, entbehrlich. Gleichzeitig dürften z.B. im Personalbereich viele Akten tatsächlich noch gesperrt sein, und das mit völlig unterschiedlichen Fristen.
Insofern ist es für die interessierte Öffentlichkeit sinnvoller, Sperrvermerke je Akte zu ermitteln oder durch einen pauschalen Hinweis auf im Einzelfall eingeschränkte Nutzung hinzuweisen.
Kleine Anregung: Vielelicht ist es sinnvoll, alle 32 Einträge des „Tagebuch einer Bestandsaufnahme“ irgendwie zu bündeln, damit dies für Praktiker schnell und umfassend greifbar ist.
Kollegiale Sommergrüße!
Stellungnahme des VdA zum Ratsbeschluss, 22. Juli 2013:
„Der Rat der Stadt Köln hat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause am 18. Juli 2013 mit den Stimmen von SPD, Grünen und Freien Wählern beschlossen, die Planungen für den Neubau des Historischen Archivs der Stadt Köln wieder aufzunehmen.
Nach dem aktuellen Ratsbeschluss sollen in den Neubau am Eifelwall nur das Stadtarchiv und das Rheinische Bildarchiv einziehen. Ursprünglich war geplant, die Kunst- und Museumsbibliothek im Gebäude zu integrieren und dieser bedeutenden Spezial- und Fachbibliothek eine neue Heimat zu geben.
In den vergangenen Wochen und Monaten setzten sich Fachgremien, Berufs- und Wissenschaftsverbände, Interessensgemeinschaften, Künstler- und Bürgerinitiativen aus dem In- und Ausland dafür ein, den im April 2013 verhängten Planungsstopp für den Neubau des Stadtarchivs und der Kunst- und Museumsbibliothek wieder aufzuheben. Die von Thomas Wolf (Siegen) initiierte Online-Petition fand in kurzer Zeit fast 9.000 Unterzeichner.
Der VdA ist zunächst erleichtert darüber, dass die Stadt Köln sich ihrer großen Verantwortung gegenüber dem Historischen Archiv bewusst ist und grundsätzlich zu der Entscheidung steht, einen Archivneubau am Eifelwall zu errichten. Der VdA bedauert allerdings sehr, dass die Politik nicht am Gesamtkonzept (Stadtarchiv + Rheinisches Bildarchiv + Kunst- und Museumsbibliothek) festhält.
Der VdA wird zusammen mit Fachgremien und Berufs- und Wissenschaftsverbänden die Fortschritte der Um- und Neubauplanungen sowie den Baufortschritt kritisch begleiten und sich ggf. erneut zu Wort melden.“
Link: http://www.vda.archiv.net/aktuelles/meldung/243.html
Da die Reihe nun anscheinend abgeschlossen ist, möchte ich nochmal sagen, dass es mich freut, dass ich auf diese Weise einen kleinen Einblick in die Arbeit eines Archivs bekommen konnte. Wenn man, wie ich und wie wohl die meisten Menschen, damit nicht selbst zu tun hat, weiß man vielleicht, dass es Archive gibt, aber nicht, was sie so genau tun. Ich denke, es ist wichtig, dass sowas auch öffentlich erklärt wird, damit auch Leute, die damit nicht zu tun haben, erfahren, was ein Archiv macht und wozu es wichtig ist (und warum es sinnvoll ist, dafür Steuergelder zu verwenden).
Als ich den Speicher Aufgeräumt habe Entdeckte ich ein Illustrierte Frauen Zeitung von 1889 wo Bilder Abb,. von allen Bekannten Namen denn es in der Zeit gab.
Was kann ich damit Anfangen ?
Die Illustrierte Frauen Zeitung Ausgabe der Modewelt mit Unterhaltungsblatt.
Sechzehnter Jahrgang 1889 – 1890 Modenblatt Berlin,
Verlag von Franz Lipperheide in Berlin W.,Potstdamer Straße 38. Drug von Otto Dürr .Besitze ihn.
Eintritt in den Siegerländer Heimatverein im Jahre 1922
Mitgliedsnummer 2454
Wilhelm Schmidt, Bergmann, Obersdorf bei Eisern
Siegerland Band 6, 1. Heft, Mai 1924
Aus einer E-Mail des Stadtarchiv Lippstadt von heute: “ …. In dem betreffenden Verzeichnis [Anm.: Adressbuch] von 1940/41[!] ist ein Fritz Müller als Oberstfeldmeister, Geiststraße 47 aufgeführt, 1951 unter derselben Adresse als Wachmann. 1954 ist dort die Witwe Auguste Müller genannt, …“ Außerdem ein Sohn (?) und eine Tochter (?)
Weitere Veröffentlichungen von Wilhelm Schmidt:
De Gummizitt (Die Gummizeit)
Untertitel: Zor nationale Revolution 1933
Siegerländer Nationalzeitung (SNZ) vom 16.06.1933
Om Raerer Kirfich (Auf dem Rödgener Friedhof)
SNZ 30.03.1934
Ohser Goarel (Unserer Patentante)
SNZ 28.03.1934
Struthwalds Weiher
Beilage zur SNZ “ Volkstum und Heimat“ (Im Stadtarchiv Siegen nicht vollständig überliefert) 25.08.1934
Det Remmelche ( Der kleine Brunnen)
Volkstum und Heimat 10.11.1934
Dr Buhr om Kontor (Der Bauer im Kontor)
Volkstum und Heimat 26.01.1935
Eine Recherche in den weiteren Jahrgängen der SNZ steht noch aus.
Eintritt in die NSDAP:
Aufnahmeantrag gestellt am 17.03.1940
Aufnahme zum 01.04.1940
Mitgliedsnummer 7954924
Auskunft durch das Bundesarchiv Berlin vom 08.08.2013
Weitere Veröffentlichungen in der Siegerländer Nationalzeitung (SNZ)
Dr Aedde ah sin Jong (Der Vater an seinen Sohn)
SNZ 31.03.1934
Det Loehschealln (Das Lohschälen)
SNZ 17.05.1934
Neblung (dieses Gedicht heist später November)
SNZ 20.11.1933
Dr Aedde ah sin Jong (Der Vater an seinen Sohn, andere Fassung s.o.)
SNZ 26.07.1933
Mitte Juni 1933 veröffentlichte die Siegerländer National-Zeitung, Tageszeitung der regionalen NSDAP, von Wilhelm Schmidt ein politisches Gedicht „De Gummizitt. Zor nationale Revolution 1933“. Es stellte einen Abgesang auf die als verjudet beschriebene Weimarer Republik dar. Dem Weimarer „Gummivolk“ stellte Schmidt die Vertreter der neuen Ära, also die NSDAP und ihre deutschnationalen Bündnispartner, gegenüber, für die er sich entschieden habe („lewer doch die stracke Li“). Die repräsentierten den „deutschen Geist“. Undeutsches werde den „deutschen Menschen“ nun ausgetrieben werden.
Am 30. Juni 1933 kam es in Wilnsdorf zu Ausschreitungen durch SA-Angehörige. Sie richteten sich gegen den Schneidermeister Ferdinand Heupel. Er wurde mit Koppeln, Riemen und Stuhlbeinen von einer Gruppe zusammengeschlagen. Vier Wochen war er bettlägerig und trug bleibende Schäden davon. Eine zweite Gruppe wandte sich dem pensionierten Polizeibeamten Friedrich Ströhmann zu, prügelte ihn und hielt ihn im Amtshaus fest. Am 15. Juli fanden weitere Ausschreitungen durch SA-Angehörige im Amt Wilnsdorf statt.
Schmidt wird selbstverständlich über das Dorftelefon die Ausschreitungen mitbekommen haben. Er war ja ein aufmerksamer Beobachter der Heimat. Was er hörte, hielt ihn doch nicht vom weiteren Verfertigen ns-tauglicher Texte ab. In den folgenden Monaten entstand eine Verherrlichung Adolf Hitlers („Reichskanzler Adolf Hitler. Ehrenbirger vah Oeberschdorf“) . Mit diesem sei den Dorfbewohnern, soweit es sich bei ihnen um „Li … uß echtem, ditschem[so!] Holz“ handelte, ein sowohl „ditscher Mah voll Kraft on Geist“ als auch „änzjer Stern en Deutschlands Naecht“ erschienen. In Schmidts völkische Vorstellung von Deutschtum passte die Dorfnachbarin Hedwig Danielewicz, intellektuell, emanzipiert, konvertierte „Rassejüdin“, sicher nicht. Sie repräsentierte Schmidts „Gummivolk“.
Seine Zustimmung zum Regime noch einmal zu überdenken, bot sich dem „feinsinnigen Lyriker“ (so der NS-Multifunktionär, Heimatfreund und Dichterkollege Lothar Irle) in den folgenden Jahren zunehmend Gelegenheit. Die Einrichtung des KZ-Sytems, die Vertreibung und Enteignung der jüdischen Minderheit, dann die Pogrome im November 1938, die Agitation gegen „lebensunwertes Leben“ und der Einstieg in die Krankenmorde: dieser Radikalisierungsprozess fand nicht nur außerhalb, sondern natürlich auch innerhalb des Siegerländer Gebirgskessels statt, fand mediale Beachtung und wurde natürlich auch auf den Dörfern in seinen Einzelheiten kommuniziert.
Schmidt überdachte nicht, er festigte seine Haltung. Die nächsten bislang bekannten politischen Gedichte liegen aus dem Jahr des Überfalls auf Polen, des Kriegsbeginns also, vor. Wilhelm Schmidt übertrug die offizielle Propaganda in den Dialekt. Auf deutschem Boden („ditsche Ähr“) könne man weiterhin ruhig schlafen („Pionier off Mineposte“). Es werde zur Zeit eben „ahm Groeßditsche Reich“ gebaut. Dazu bedürfe es des Glaubens an den „ererwte Besetz ohser Ahle“, an „Heimat on Volk“ sowie an den Boden. Der diene nämlich sowohl als „Born“ wie auch als Bestimmungsort zu versenkender Wurzeln[so!], beste Mittel gegen den bösen „Fortschreattsgeist“ („Gedanke zom säjjerlänner Wärterboch“).
Schmidt kam unter dem Eindruck der Entwicklung nicht wie mancher andere zu vermehrter Distanz, er radikalisierte sich mit. Dafür steht seine Entscheidung zum Eintritt in die NSDAP 1940. Im Jahr darauf wurde Hedwig Danielewicz in die Vernichtung deportiert. Auch diese Nachricht erreichte Obersdorf.
„Ahgestammte Art“ und „Heimatähr“ – Blut und Boden – blieben durch die Zeiten Schmidts dichterische Grundlagen. Dass daran irgendetwas nicht gestimmt haben könnte, hat er zumindest öffentlich zu keinem Zeitpunkt verlauten lassen.
s. a. Hermann Engelbert: Hinterhüttsche Chronik, Kreuztal 1994, S. 423: “ …. Auch im Kreistag sind einige der „Herren“ [gemeint sind Nationalsozialisten, der Verf.] eingezogen. Sichtbar halten sie bei der Mitarbeit auf „gute Form“. ….“ [Eintrag für das Jahr 1932]
„ …. Unsere Siegerländer Muttersprache ist bei den braunen Häuptlingen verpönt, man sieht darin separatistische Bestrebungen und schließt sie in der öffentlichen Arbeit aus. Die Siegener Zeitung hat ein ganz anderes Gesicht bekommen und ist längst nicht mehr die alte Heimatzeitung. ….“ [Aus: Hermann Engelbert: Hinterhüttsche Chronik, Kreuztal 1994, S. 450 [Eintrag für das Jahr 1943]
Diese tagebuchartige Notiz des sozialdemokratisches Lehrers aus Kreuztal lässt mindestens zwei Deutungen. Die naheliegendste, eine offizielles Verbot von Mundartdichtung in der Siegerländer Presse, bedarf zwar noch der Prüfung, aber für das benachbarte Sauerland, das ebenfalls einige Mundartdichtern und -dichterinnen beheimatete, lässt sich ein solches Verbot laut Auskunft des Mundartarchivs in Eslohe nicht nachweisen.
Oder es handelte sich lediglich um eine verlegerische oder redaktionelle Entscheidung der 1943 mit der nationalsozialistischen Siegerländer Nationalzeitung Siegener Zeitung, deren Hintergrund hier nur vermutet werden kann.
„Geheime Information“ Nr. 32/312 vom 26.7.1941, in: Verfügungen, Anordnungen, Bekanntgaben, hrsg. von der Partei-Kanzlei, Bd. 1, München 1942, S. 218:
„Es ist nicht erwünscht, daß Dialekte literaturfähig gemacht werden; u.a. sollen Wanderbühnen, die Theaterstücke in Mundart aufführen, nicht in Berlin auftreten. In der Presse darf höchstens ausnahmsweise einmal Dialekt in einer kleinen Ecke gebracht werden. Auch im Rundfunk wird streng hiernach verfahren werden.“
(Zitiert nach: Hanno Birken-Bertsch, Rechtschreibreform und Nationalsozialismus, Göttingen 2000, S. 78, Anm. 87.)
Von einem generellen Verbot des Mundartgebrauchs in der NS-Zeit kann jedoch nicht die Rede sein. Davon zeugen allein die vielen in den 1930er Jahren erschienenen deutschen Dialektwörterbücher (einschließlich des Siegerländer), deren Erarbeitung teilweise großzügig von der DFG gefördert wurde, oder auch die ca. 300 Schallplatten umfassende Sammlung „Lautdenkmal reichsdeutscher Mundarten“ 1967/37. Siehe hierzu http://www.staff.uni-marburg.de/~naeser/ld00.htm
Ob allerdings etwas an dem kolportierten Gerücht wahr ist, dass speziell der sächsische Dialekt wegen seines „unheldischen“ Klanges geächtet werden sollte, muss an dieser Stelle offenbleiben. Und auf persönliche Kommentare zum Siegerländer Platt (wobei womöglich Formulierungen wie „akustische Körperverletzung“ gebraucht würden) verzichte ich als friedfertiger Berliner lieber.
P.K.
Zur Rolle der Mundartdichtung im Nationalsozialismus gilt es wohl auch folgende Literatur auszuwerten:
– Stefan Wilking, Der Deutsche Sprachatlas im Nationalsozialismus: Studien zur Dialektologie und Sprachwissenschaft zwischen 1933 und 1945, Hildesheim u.a. 2003 (Germanistische Linguistik Bd. 173/174).
– Klaas-Hinrich Ehlers: „Staatlich geförderte Dialektforschung 1920 bis 1960“ , in: Niederdeutsches Jahrbuch 130 (2007): 109-126, Link zum PDF
– Kay Dohnke u.a. (Hg.), Niederdeutsch im Nationalsozialismus. Studien zur Rolle regionaler Kultur im Faschismus, Hildesheim 1994
– Bürger, Peter: Faschistische Volkstumsideologie und Rassismus statt Wissenschaft. Zur Studie „Mundart und Hochsprache“ (1939) von Karl Schulte Kemminghausen. In: Niederdeutsches Wort. Beiträge zur niederdeutschen Philologie. Bd. 51 (2011), S. 1-24.
s. a. Arendt, Birte (2010): Niederdeutschdiskurse. Spracheinstellungen im Kontext von Laien, Printmedien und Politik. Berlin (Philologische Studien und Quellen, 224) [312 S.]
Arendt widmet sich auf wenigen Seiten der Einstellung der Nationalsozialisten zum Niederdeutschen (S. 109-115).
Hallo,
per Zufall bin ich auf diese Anzeige gestoßen und finde diese sehr interessant. Erst einmal zu meiner Person: Ich bin eine geborene Syberg und zwar genau dieser Linie. Ich habe eine Frage, in wie fern soll es da spuken?Es wäre lieb, wenn Sie mir etwas mehr über dieses Haus erzählen würden. LG
Zur Spukgeschichte hören Sie bitte den 2. Beitrag von Radio Siegen zum Verkauf des Schlosses. Nach meiner Minute schildert Frau Beer die Spukgeschichte.
Zur Geschichte von Schloss Junkernhees lies sich auf die Schnelle folgende Literatur ermitteln:
Wagener, Olaf: Burgen und Befestigungen in Kreuztal und Hilchenbach. Ein kulturhistorischer Führer, Kreuztal 2012
Gerhard Oberländer, Manfred Reitz, Klaus-Dieter Zimmermann (Hrsg.): Osthelden-Junkernhees. Ein Bilderbuch, Kreuztal 1990
Beer, Evelyne Beer, Falko [Hrsg.]: 475 Jahre Schloß Junkernhees und die ehemalige Wasserburg Hees (13. Jh.) 1523-1998, Schloß Junkernhees 1998
Scholl, Gerhard: Unsere Junkernhees. Schloß und Umgebung zwischen gestern und heute, Kreuztal 1974
Annerose Stöber: Schloß Junkernhees- ein Kleinod des Siegerlandes [geschichtliche Ausarbeitung zum Fach Städtebau], Siegen 1980
Eduard Manger: Geschichtliche Nachrichten über Ferndorf, Junkernhees, Langenau und Burgholdinghausen, Siegen (1880)
Heute fand sich ein Schreiben des Bundesarchis v Berlin v. 26.8.2013 (R1-2002/K-156) mit Kopien aus den personenbezogenen Sammlungen des ehemaligen Berlin Document Center (BDC) enthaltend Auszüge aus der sogenannten Parteikorrespondenz (PK) und der NSDAP-Gaukartei in der Post. Folgendes Ergänzende zu Friedrich Wilhelm Müller ließ sich ermitteln:
1) „Erklärung
Hierdurch erkläre ich als Nationalsozialist
auf Ehrenwort, daß ich das mir von Adolf Hitler und den
preußischen Wählern übertragene Mandat zum Preußischen
Landtag stetsim Sinne meines Führers ausüben will.
Sobald der Führer Adolf Hitler mich von meinem Mandat
abberuft, erkläre ich auf Ehrenwort, seiner Weisung zu
folgen. Im Falle meines Ausscheidens aus der Partei
lege ich selbstverständlich mein Mandat in die Hände
Adolfs Hitlerund meiner preußischen Wähler zurück.
Vor- und Zuname: Friedrich Wilhelm Müller
Adresse: Obersdorf Post Siegen Kreis Siegen Westfalen
Mitgliedsnummer: 55 069
Datum: 26.3.1932
Ort: Obersdorf“
2) Reichsschatzmeister (NSDAP) an Gauleitung Westfalen-Süd in Bochum, München, 10.1.1934:
„Anliegend übersende ich Ihnen Besitzurkunde nebst 2 Ehrenzeichen für Pg. Fritz Müller/Mitgl.-Nr. 55069 mit dem Ersuchen um Weiterleitung.
Auf Grund einer Verfügung des Stellvertreter des Führers kann Pg. Fritz Müller als M.d.R. nicht mehr bei der Sektion Reichsleitung geführt werden. Ich ersuche deshalb den Genannten mit Wirkung vom 1.1.34 der Sektion Gauleitung zuzuteilen.
Zur Anlage der Gaukartei-Karte teile ich Ihnen nachstehend die Personalien des Genannten mit:
Fritz Müller, geboren am 16.197 zu Obersdorf, Bergmann, aufgenommen unterm 14. Jan. 1927, unter Nummer 55069, wohnhaft: Obersdorf, Kreis Siegen.
Ihr Konto Ehrenzeichen wurde mit RM 2,50 belastet.“
3) Aus der Gaukartei-Karte geht hervor, dass Fritz Müller am 30.4.1935 in Dortmund, Arndtstr. 56 wohnte. Auf der zweiten Karte findet sich der Hinweis, dass Müller später in Dortmund auf der Kreuzstr. 90 wohnte und der NSDAP-Ortsgruppe angehörte. Er scheint bereits im November (?) 1936 nach Lippstadt, Geiststr. 47, verzogen zu sein. Nun gehörte er der dortigen NSADP-Ortsgruppe an.
Auf den ersten Blick dachte ich an Zeichenmaterial, z. B. vom Katasteramt. Aber so wirklich passt das nicht.
Handelt es sich womöglich um Werkzeug zur Restaurierung von beschädigtem Archivgut und stammt somit aus dem Kreisarchiv selbst? Soweit ich die dargestellten Gegenstände überhaupt identifizieren kann, könnten sie meiner (höchst unprofessionellen) Ansicht nach durchaus aus einer solchen Restaurierungswerkstatt stammen.
„Welche Verwaltungseinheit der Kreisverwaltung benötigte diese Arbeitsutensilienn?“ Das Kreisarchiv selbst. Ist ja auch eine Einrichtung des Kreises, oder? ;-)
Ich liege sicherlich meilenweit daneben, aber es geht ja eh nur um den Spaß an der Freude. :-)
Mist, so ein Ärger. Da hatte ich mit meinem ersten Eindruck doch richtig gelegen! :D
Tja, als ich Praktikum beim Katasteramt gemacht habe, hat man schon lange nicht mehr per Hand kartiert. (Und ehrlich gesagt finde ich es nicht allzu schade, dass ich mich damit auf keinen Fall mehr auseinander setzen muss.)
Hätte ich wenigstens irgendwas gewonnen, sodass ich jetzt auch einen Grund habe, mich zu ärgern? ;-)
Wer kann mir helfen mit der Adresse der Wwe. oder Kinder von Herbert Kienzler bzgl. der Rechte an der Veröffentlichung von Zeichnungen aus seinem damaligen Buch über Siegerländer Fachwerkhäuser?
Einen Beitrag zu der Wilnsdorfer fixen Idee lieferte schon vor etlichen Jahren Jürgen Kühnel: Wieland der Schmied, ‚Guielandus in urbe Sigeni‘ und der Ortsname Wilnsdorf, in: Diagonal. Zeitschrift der Universität Siegen 1997, Heft 1, S. 169-181 (Nachdruck in: Siegerland 75 (1998), S. 41-50; nochmals nachgedruckt im aktuellen Band 34 (2013) von Diagonal, S. 217-232). Aber es hat keinen Zweck, mit wissenschaftlichen Argumenten gegen den Aberglauben eines ganzen Dorfes vorgehen zu wollen. Die Legende wird am Ende immer stärker sein.
Und in der nächsten Folge unserer lokalhistorischen Exkursionen besuchen wir den Michelsberg bei Siegen-Eiserfeld. Der heißt bekanntlich deshalb so, weil der Erzengel Michael dort einmal in einer Köhlerhütte übernachtet hatte, während ein paar Kilometer weiter Schmidts Wieland ihm seine neue Rüstung schmiedete.
P.K.
Vermutlich stammen diese unscheinbar-schönen Stücke nicht aus dem Staatl.Vet.Unters.Amt, sondern aus dem Kr.Vet.Unters.Amt, lies „Kreis-Veterinär-Untersuchtungsamt“?? Gibt’s etwa auch für das Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein eine Reisewarnung?
1) Bis zur Auflösung dauert es noch etwas, wenn Sie sich bis Freitag gedulden können …..
2) Das Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein kann gefahrlos bereist werden. Wollen Sie die Stücke persönlich in Augenschein nehmen? ;-)
Offizielle Erläuterung zum Entwurf
Im Zentrum des Entwurfs findet sich ein Weg. Dieser Weg symbolisiert den Weg der Menschheit in die Moderne. Er führt vorbei an drei massiven Wänden aus verschiedene Materialien, die unterschiedliche historische Zeitabschnitte veranschaulichen sollen. Die Zeit des Nationalsozialismus (Bronze), über die Nachkriegszeit und die Zeit des Wiederaufbaus (Stahl) hin zur Neuzeit (Beton).
Ausgangspunkt ist der Tag der Befreiung des KZ Buchenwald. Säulenbuchen, Kopfsteinpflaster und Auswahl der Sitzmöbel stellen den Bezug zum historischen Ort her.
Die Bronzetafel gibt eine Situation wieder, die unmittelbar im Bezug zum Wirken Walter Krämers in Buchenwald steht. Die Darstellung ist angelehnt an eine Zeichnung des niederländischen Künstlers Henry Pieck (ehemaliger Buchenwald Häftling, *19.04.1895 ? 12.01.1972 ) mit dem Titel „Vor dem Revier angetreten“ (Die Verwendung des Motivs geschieht mit ausdrücklicher Genehmigung der Familie Pieck. Diese wurde eingeholt von Bram Peters, dem Leiter des Liberty Parks im holländischen Overloon) und zeigt Häftlinge, die auf ihre Behandlung im Häftlingskrankenbau des Konzentrationslagers Buchenwald wartend auf einer Bank verharren.
Des Weiteren ist das Lagertorgebäude aus der Innensicht mit weit geöffnetem Tor, welches die Befreiung symbolisieren soll, dargestellt. Deutlich lesbar ist die Inschrift auf dem Lagertor „Jedem das Seine“.
Es wird ein unmittelbarer Bezug zum Park in seiner Funktion als Patientengarten hergestellt.
Auf der einen Seite die Häftlinge vor dem Revier. Was dürfen sie hoffen an einem solchen Ort – wehrlos, ausgeliefert? Auf der anderen Seite der betrachtende Patient. Mit welch unterschiedlichen Gefühlen kann er sich in Behandlung und Pflege begeben. So ähnlich die Rollen auch scheinen, unterschiedlicher könnten sie wohl kaum sein.
„Jedem das Seine“ lautet die zynische Formel auf dem Lagertor des KZ Buchenwald. Eine Formulierung, die heute noch jedem geläufig ist, aber beschädigt ist, durch den menschenverachtenden Gebrauch der Nazis. Was kann der Ausspruch heute für Menschen bedeuten, die sich mit ihren kleinen und schweren Leiden ins Krankenhaus begeben? Bei allen Bedenken, Sorgen und Ängsten können wir heute doch die Gewissheit haben unabhängig vom Ansehen unserer Person bestmögliche medizinische Versorgung zu erhalten. Mit dieser Gewissheit kann man weiter schreiten durch das weit geöffnete, einladende Portal, welches direkt zur Eingangspforte des Klinikums führt. Das Wissen um die demokratischen Errungenschaften der Moderne, die es zu bewahren gilt, vor dem Hintergrund der Verbrechen und Verfehlungen der Vergangenheit sollen sich Menschen an diesem Gedenkort immer wieder verdeutlichen können.
Der Eid des Hippokrates war von jeher Leitmotiv ärztlichen Handelns. Wenn auch heute nicht mehr von Ärzten in rechtsverbindlicher Weise geleistet, findet er doch Widerhall in modernen Leitbildern ärztlicher Ethik. Im Bewusstsein der Patientinnen und Patienten ist er jedoch allgegenwärtig und, auch wenn im Wortlaut sicher selten bekannt, eine wesentliche Basis des Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und Patient.
Das Gebot, Kranken nicht zu schaden, die Schweigepflicht und die klare Aussage, chirurgische Eingriffe nur den dafür ausgebildeten Fachleuten zu überlassen, sind Säulen des Eid des Hippokrates. Ein Bruch dieser Regeln, wie durch die Ärzteschaft im Nationalsozialismus, wird sich in der Geschichte der Menschheit wohl kaum noch einmal finden lassen. Allein die Bereitschaft von Ärzten im Konzentrationslager, einem Ort des Leidens und Mordens, ihren Dienst zu tun, ist kaum nachvollziehbar. Die zahllosen überlieferten Verbrechen von Ärzten an ihren „Patienten“ verschlagen uns immer wieder die Sprache.
Im Krankenbau des KZ Buchenwald, war es kein Arzt, sondern der gelernte Schlosser Walter Krämer, der half die Ehre eines ganzen Berufsstandes zu retten, in dem er sich medizinische Kenntnisse aneignete und sie zum Wohle seiner Kameraden einsetze.
Auf einer Gedenktafel soll den Besucherinnen und Besuchern sein Lebensweg in Erinnerung gebracht werden.
Anlässlich des SPD-Gemeindeverbandes Wilnsdorf zum Parteijubiläums war wauch die Wegebenennung Thema: “ …. Im Lichte dieses aufopferungsvollen Einsatzes dieser Personen [Anm.: Gemeint waren die Pfarrer Theodor Noa und Wilhelm Ochse (kath.)] wurde im anschließenden Gespräch auch die Benennung einer Straße im Wilnsdorfer Ortsteil Obersdorf nach dem Dichter Wilhelm Schmidt kritisiert. Zahlreiche Teilnehmer äußerten ihre Ablehnung darüber, dass jemand diese Ehrung erhalte, der erst 1940 in die NSDAP eingetreten sei, als schon die planmäßige Verfolgung Andersdenkender und die gezielte massenhafte Ermordung der Juden voll im Gang war. ….“
Quelle: http://www.spd-wilnsdorf.de/ , Aktuelles v. 3.9.2013
Es liegt jetzt noch wieder ein paar Tage zurück, soll aber doch die kurze Erinnerung noch wieder wert sein: der Überfall auf Polen – Alltagsjargon auch heute noch: „Polenfeldzug“ – am 1. September 1939. Bekanntlich wurde der äußere Anlass wie in einer endlosen Zahl von vergangenen und wohl auch künftigen Kriegen im Geheimen fabriziert, auf die Kriegserklärung verzichtet und losgelegt, da es sich ja um Schutz und Verteidigung handeln würde, um hehre Ziele gehe etc. pp.
Und Wilhelm Schmidt, der Dorfdichter? Stand an der Front und war nun ein Frontdichter, siehe Siegerland, Zeitschrift des Siegerländer Heimatvereins, H. 2-3, 1939, S. 35:
Pionier off Mineposte
Oa wäj, oa wäj, Franzoese
On protzig Tommyheer:
Et sall ou schleecht bekomme,
bliet weg va ditscher Ähr!
…
Dehähm, om stelle Räädche
Wird itz dr Sandmah goah –
Dat sie ea Roh konn schloafe
Ech he off Poste stoah.
…
So adressierte es Schmidt an seine Heimatfreunde: die Wehrmacht greife nicht an, sie setze sich gegen eine Bedrohung zur Wehr, sie verteidige, mit viel fremdem Blut den Boden. Interessant ist nun, dass man schon sehr naiv gewesen sein muss, um diese Lüge zu glauben, denn das Regime selbst stellte es durchaus ehrlicher dar, was ja denn auch für Begeisterung sorgte. Die Bildaussage des folgenden Filmplakats ist klar und eindeutig: wir walzen alles nieder, was uns beim Erobern im Weg ist:
Über das Stichwort „Erobern“ zurück zu Wilnsdorfer Straßennamen: da gibt es nämlich noch die Ostland-Straße. Auf die passt das Plakat eigentlich auch ganz gut. Sie trägt den Namen des Reichskommissariats Ostland, übrigens erst seit 1967. Das Reichskommissariat wiederum erhielt diesen Namen von einem der Eroberungsziele der schon zu Kaisers Zeiten agierenden und Ziele vorschlagenden Großraumpolitiker („Nach Ostland wollen wir reiten“).
Im Reichskommissariat Ostland, genauer im Generalbezirk Weißruthenien lag Minsk. Im Ghetto in Minsk wurde bekanntlich im Juli 1942 Hedwig Danielewicz, die heute in Obersdorf so Geehrte, umgebracht. Und in die Ostland-Straße mündet die trotz Falschschreibung eindeutige Stöcker-Straße. Sie ist nach dem „Vater der antisemitischen Bewegung“ (so er selbst) Adolf Stoecker benannt. Der war der Heros der Siegerländer protestantischen „Christlich-Sozialen“, wie die nette Selbstbezeichnung für eine antisemitische, außerhalb von Siegen-Wittgenstein bedeutungslose, hier hegemoniale Parteibewegung lautete. In ihrem offenen Rassismus, in ihrer Hetze nicht nur, aber vor allem gegen die jüdische Minderheit unterschied sie sich von anderen antisemitischen Organisationen und Bewegungen ihrer Zeit in nichts. Es war eben schon alles da, als die Nazis und ihre Partner ihr Regime errichteten, wie der Antisemitismusforscher Wolfgang Benz einmal feststellte. Auch in diesen Dörfern.
Wilhelm-Schmidt-Weg, Ostland-Straße, Gedenkstein für Hedwig Danielewicz, Stöcker-Straße. Es lässt sich also dem Straßen- und Ortsbild einiges entnehmen. Also, liebe Aufklärer, an Stoff fehlt es nicht und die Gemeinde Wilnsdorf sorgt ja für kurze Wege.
Im Zusammenhang mit dem Fall Wilhelm Schmidt muss meiner Meinung nach dringend über die Umbenennung der Lothar-Irle-Straße in Kaan-Marienborn nachgedacht werden. Bei Irle liegen die Dinge noch eindeutiger als bei Schmidt.
1) Es gilt zu beachten, dass der Wilherlm-Schmidt-Weg in die Zuständigkeit der Gemeinde Wilnsdorf, die Lothar-Irle-Str. in die der Stadt Siegen fällt.
2) Eine Aufstellung weiterer problematischer Straßennamen findet sich hier: http://strassensiwi.blogsport.de/strassennamen-uebersicht/
“ …. Eine Woche später, am 21. Juni 1933, ekalierte der Konflikt im Eichener Walzwerk [Anm.: Die NSBO verlangte die Absetzung des technischen Betriebsleiters Arnold Lerg, s. Literatur wie unten, S. 102-106]. Bereits vormittags kursierte im Amt Ferndorf das Gerücht, der Betriebsleiter Lerg solle aus dem Betrieb herausgeholt werden. Nachmittags gegen 16 Uhr erreichte das Kreuztaler Polizeikommissariat die Nachricht, dass in Krombach ein ganzer SA-Sturm zusammengezogen werde. Gegen 18 Uhr hatte sich vor dem Eingang zum Eichener Walzwerk eine große Menschenmenge eingefunden, die mit dem Ruf „Lerg heraus, Lerg heraus“ die Auslieferung des Betriebsleiters verlangte. Als der leitende Polizeikommissar Pabst am Werkstor eintraf, berichtete ihm der SS-Truppführer Werner Kurth aus Kreuztal, er habe mit einer Anzahl SS-Männer die erregte Menge von Tätlichkeiten abgehalten und für die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung gesorgt.Schließlich habe er um die Unterstützung durch die Ortspolizei nachgesucht. Im Vorraum des Verwaltungsgebäudes traf Pabst auf drei NS-Funktionäre, die mit der Werksleitung über die Beurlaubung von Arnold Lerg verhandeln wollten: der Siegener NSDAP-Reichstagsabgeordnete Müller, sowie zwei Beauftragte der der Siegener Kreisleitung der NSBO, Bedenbender und Blöcher. Die NS-Funktionäre konnten trotz Verweis auf den wachsenden Unmut der Arbeiter weder den anwesenden Direktor des Eichener Walzwerks, Notthoff, noch dessen über Telefon zugeschalteten Vorgesetzten in Niederschelden, Direktor Klein, zu einer Beurlaubung des Betriebsleiters bewegen. ….“, aus: Dieter Pfau, Die Geschichte der Juden im Amt Ferndorf (1797-1943). „Den Juden ist aber hier kein Leid zugefügt worden.“, Bielefeld 2012, S. 105-106.
Arnold Lerg durfte in der Folge den Betrieb nicht mehr betreten. Er wurde festgenommen und kurzzeitig inhaftiert.
Nach dem NS-Ende gehörte er zu den Gründern der CDU, die er im Kreistag vertrat.
Und noch ein Detail zum Thema Zeitgeist und zum Widerspruch dazu, zu dem das Stichwort MdR Müller Anlass bietet:
Der Bruder Clemens von Arnold Lerg wurde wegen Abhörens feindlicher Sender denunziert und zu anderthalb Jahren Zuchthaus verurteilt. Das war eine für das sog. Rundfunkverbrechen, das meist ungeahndet blieb, ungewöhnlich hohe Strafe.
Anmerkung zu den Veröffentlichungen:
August Schmidt. Dokumentation in Briefen. Solingen: Schmidt 1975. 102 S.
Bevor sich jemand, wie ich, die Mühe macht das Buch per Fernleihe zu bestellen: es nicht von dem hier gemeinten Wilhelm Schmidt verfasst worden, sondern einem Namensvetter zuzuordnen.
Veröffentlichung von W. Schmidt in der SNZ am 17.05.1939
De Isener Hedde
(siehe auch den Überblick „unselbstständige Veröffenlichungen“
Wilhelm Schmidt: De Isener Hedde, Siegerland 20, 1938, S. 63)
Die Nachfrage nach einer Rentenakte bei der wohl zuständigen Knappschaft hat ergeben, dass diese sehr wahrscheinlcich nicht mehr vorhanden ist. Entsprechende Akten werden dort 6 volle Kalenderjahre nach Tod Tod des Leistungsempfängers kassiert. Eis ist daher bei Wilhelm Schmidt von einer Kassation im Jar 1973 auszugehen.
Eine Datenspeicherung auf elektronischen Weg wurde ab Mitte der 70er Jahre praktiziert, so dass auch dort nichts zu finden ist.
Rückschlüsse auf die Einkommensverhältnisse über die Witwe Schmidts sind ebenfalls nicht möglich deren Akte ist wohl 1997 kassiert worden, die eventuell noch vorhandenen Daten werden lediglich auf die Witwenrente verweisen.
Bei einem kurzen Besuch gestern im Landesarchiv in Münster war eine Personenrecherche zu Wilhelm Schmidt nicht erfolgreich – weder in der Datenbank für Münster noch für Düsseldorf. D. h. weiteres ausschließlich auf Wilhelm Schmidt bezogenes Schriftgut ist dort zurzeit nicht zu erwarten.
Gleiches gilt auch für das Bundesarchiv in Berlin, das heute mit Az.2002/K-156 folgendes mitteilte: „Nach den nun abgeschlossenen Recherchen in den hier überliefen personenbezogenen Beständen sowie relevanten Sachbeständen konnten keine Hinweise auf Unterlagen zu Wilhelm Schmidt ermittelt werden.“
Veröffentlichung von Wilhelm Schmidt in der Siegerländer Nationalzeitung
vom 11.09.1942
Gedicht „Om Räddche“ eingebettet in den Beitrag
„Dr Mettelpunkt“.
Medienecho zum Aufruf für die geplante Ausstellung zum Ersten Weltkrieg an der Siegener Heimatfront:
1) „Der Geschichtsverein und das Archiv der Stadt Siegen planen für das kommende Jahr eine große Ausstellung zum Ersten Weltkrieg. Dessen Beginn jährt sich dann zum 100. Mal. Ziel der Ausstellung ist es, den Alltag zwischen 1914 und 1918 in Siegen und den umliegenden Dörfern darzustellen, die heute zum Stadtgebiet zählen. Die Organisatoren hoffen auf zahlreiche Leihgaben aus der Bevölkerung. Fotos und Alltagsgegenstände aus der Zeit des Ersten Weltkriegs nimmt das Stadtarchiv Siegen entgegen. Das befindet sich im Krönchencenter in der Oberstadt.“
Radio Siegen, 19.9.2013
Zum Hören: http://radio-siegen.de/_pool/files/beitraege/652997.mp3
2) In den Print-Ausgaben von Siegener Zeitung und Westfälischer Rundschau finden sich heute ebenfalls Artikel über den Aufruf.
Am 7. Oktober 1934 beantragte Wilhem Schmidt, damals in der Eiserfelder Helsbachstr. wohnhaft, die Verleihung des Ehrenkreuzes für Frontkämpfer des ersten Weltkrieges. Wilhelm Schmidt gehörte demnach als Pionier der 1. Kompanie des 4. Pionier Battalions in Magdeburg an. Er leistete Pionier- und Infanteriedienst in Frankreich und Belgien vom 27. August 1917 bis zum 11. November 1918. Ferner erhielt er das „Eiserne Kreuz“ II. Klasse. Das beantragte Ehrenkreuz wurde ihm zu Beginn des Jahres 1935 verleihen.
Quelle: LAV NRW, Kreis Siegen, Landratsamt Nr. 2278
Auswertung von Dieter Helmes: Aufstieg und Entwicklung der NSDAP im Siegerland vor der Machtübernahme, [Siegen-]Hüttental 1974, nach Erwähnungen von Fritz Müller:
Literaturhinweise:
Friedrich Alfred Beck, Kampf und Sieg. Geschichte der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterparte im Gaus Westfalen-Süd von den Anfängen bis zur Machtübernahme, Dortmund 1938
Dort u. a.: S. 17-18: Mitgliederliste des NSDAP:
505. Friedrich Müller, 35 900
506. Fritz Müller, 55 069
Weigand Paul: Die deutschen Gaue seit der Machtergreifung –
Westfalen Süd – , Berlin 1940 (Hrsg. Paul Meier, Benneckenstein)
S. 104:
“ …. Nach der Neugründung der NSDAP und der Gründung weiterer Ortsgruppenwuchs die SA an. …. Fritz Müller … kam […] bis 1927 in die SA. ….”
Quelle: Beck, S. 116
“ …. Wir entfachen das Feuer
Oberdielfen im Siegerland
Wegen anderweitiger Benutzung des vorgesehenen Lokals hielt Parteigenosse Müller, Obersdorf, eine Versammlung in der Dorfschmiede, der Arbeitsstätte des rührigen Parteigenossen Kretzberg, Oberdielfen, ab. Es wurden 10 Neuaufnahmen (Bergleute, Fabrikarbeiter und Handwerker) und einge Zeitungsbezieher gewonnen.”
Quelle: Völkischer Beobachter, 4. Juni 1930 zur Gründung der Ortsgruppe am 1. Juni 1930 nach SNZ, 29. Juni 1935
S. 87: Reichstagswahl 6.11.1932
„ …. Auf der Liste des Wahlkreises 18 war der Siegerländer Fritz Müller auf Platz 7 gesetzt worden und wurde damit wieder in den Reichstag gewählt. …“
S. 51 Kreistagswahl 17.11.1929
Ergebnis 10,9 %, 3 Sitze: Abg. Fritz Müller, Paul Preußer, Heinrich Klein
S. 36 [Ortsgruppe Niederschelden]„ …. So fand in Oberschelden schon 1927 eine Versammlung der NSDAP statt, in der Münz, Bedenbender, Müller (?) und ein Parteigenosse aus Siegen sprachen ……“
S. 137:
Fritz Müller, Obersdorf, 35 900 (Mtgliedsnr.) [Quelle: SNZ, 16. Juni 1934, Friedrich Alfred Beck, Kampf und Sieg. Geschichte der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterparte im Gaus Westfalen-Süd. Von den Anfängen bis zur Machtübernahme, Dortmund 1938, S. 17-18]
S. 34 -35 „ ……Die Ortsgruppe Eisern wurde 1925/26 gegründet und bestand zu einem großen Teil aus Bergleuten. So kamen von der Grube Ameise Männer wie Hannes Bedenbender und Fritz Müller. Über diese Grube wurde folgendes geschrieben: „Auf der Grube Ameise wurden unter der Führung eines Werksstudenten im Anfang 1924 einige Bergleute in die tief deutsch-revolutionäre Front eingegliedert. Als guter Literaturkenner und ausgestattet mit besten organisatorischen Fähigkeiten verstand es dieser junge Mann, seine fünf ersten Kameraden zu Fanatikern der Idee zu erziehen, und schon 1926 war die Grube Ameise als die Hochburg des Nationalsozialismus weithin bekannt. Nachdem der aktive und sehr begabte junge Führer aus unergründlicher Veranlassung heraus in ein anderes Lager hinüberwechselte, stand die Organisation, die er an seinem Arbeitsplatz geschaffen hatte, schon so fest, daß sie nicht mehr zu erschüttern war. Die neue Ortsgruppe wurde damals als Sammelgruppe dem Bezirk mit einer Gesamtmitgliederstärke von 16 Mann gemeldet. …..“
Im Sommer 1926 gehörten folgende Männer der Ortsgruppe Eisern an: …. Fritz Müller Obersdorf …..
Im August 1927 fand die Weihe der Ortsgruppenfahne statt. Der damalige Gauleiter Karl Kauffmann war Schirmherr der Veranstaltung.
„Zum ersten Male marschierte anläßlich dieser Begebenheit im Siegerlande eine uniformierte SA-Kapelle die aus Elberfeld verpflichtet worden war unter Vorantritt des Spielmannzuges des evangelischen Posaunenchores Eiserfeld. Der Kostenaufwand für diese Feier betrug 265 RM. Dieser Betrag in bar, daneben noch die Verpflegung der auswärtigen SA-Männern aus dem Bezirk Lenne, Volme und Dillenburg wurde im Umlageverfahren von den Parteigenossen zwangserhoben.“
[Quelle: Beck, S. 414, SZ, 9.12.1933, SNZ 16.6.1934]
Eine Recherche im Lesesaalrechner des Landesarchivs NRW, Abt. Westfalen in Münster ergab 2 Archivalien, die wohl im Zuge einer weiteren Recherche zu Fritz Müller eingesehen werden sollten:
1) Q 568g (Amtsgericht Siegen, Grundakten Obersdorf) Nr. 21455: F. W. Müller, Auguste Müller, Heinrich M., Hartmut M., Sieglinde M., Inge Sellmann, 1939-1957
2) Deutsche Arbeitsfront (Findbuch C 26) Nr. 1: Der DAF-Gau Westfalen-Süd in Karten und Zahlen zusammengestellt vom Organisationsamt des DAF-Gaus Westfalen Süd, enthält: Organisationspläne des DAF-Gaues, Karten des DAF-Bezirks Westfalen, des DAF-Gaues Westfalen-Süd, Karte der 24 Kreise des Gaues mit Einzeichnung der Ortsgruppengrenzen, Verzeichnis der KReis- und Ortsgruppen der DAF im Gau Westfalen-Süd
Ein weiterer Mosaikstein zur Biographie Schmidts aus dem Museum Wilnsdorf. Frau Dr. Nauck gebührt Dank für den Hinweis und die folgende. Transskription:
Ein Postkarte Helen Jung-Danielewiczs an Wilhelm Schmidt aus dem Museumbestand zu Frau Dr. Hedwig Jung-Danielewicz, datiert Düsseldorf, den 6. Juli 1930:
„Sehr geehrter Herr Schmidt!
Da am 3. August evangelisches Missionsfest in Obersdorf und am Nachmittag Wald-Gottesdienst ist, müssen wir schon die kleine Gedenkfeier zur Einweihung der Eisengussplatte [gemeint ist die Plakette am Elternhaus Jung-Dörflers] auf Sonntag den 27. Juli festsetzen. Ich hoffe, dass Ihnen das recht ist, und dass Sie durch Ihre Worte dazu beitragen werden, die Feier zu verschönen und ihre Bedeutung den Teilnehmern zum Bewusstsein zu bringen. Da sich an die kleine eigentliche Feier eine Bewirtung der Kinder anschließen soll, wollen wir schon um 3 Uhr anfangen. Für die Gäste von außerhalb ist ein Kaffeestündchen im Josephshaus vorgesehen, wohin ich Sie auch mitzukommen bitte.
Eine Auswertung der online abrufbaren, stenographischen Berichte der Reichtatgssitzungen für die Wahlperioden, in denen Friedrich Wilhelm Müller Reichstagsmitglied war, hat folgendes Ergebnis:
Verhandlungen des Reichstages VI. Wahlperiode Band 454, Berlin 1932
1. Sitzung 30.8.1932: anwesend
2. Sitzung 12.9.1932: anwesend
Namentliche Abstimmung über die Anträge der Abgeordneten Torgler und Genossen auf Aufhebung der Verordnungen des Reichspräsidenten vom 4. und 5 September (Reichsgesetzblatt I S. 425 und 433) – Nr. 118. 119 der Drucksachen – sowie über den Misstrauensantrag der Abgeordneten Torgler und Genossen gegen die Reichsregierung von Papen – Nr. 44 der Drucksachen –
Müller (Westfalen) Ja
Verhandlungen des Reichstages VIII. Wahlperiode Band 457, Berlin 1934
1. Sitzung 21.3.1933 Staatsakt in Potsdam: anwesend
2. Sitzung 23.3.1933 Ermächtigungsgesetz anwesend
Namentliche Abstimmung: Schlußabstimmung über den von den Abgeordneten Dr. Frick, Dr. Oberfohren und Genossen eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Behebung der Not von Volk und Reich – Nr. 6 der Drucksachen
Müller (Westfalen) Ja
3. Sitzung 17.5.1933
Verhandlungen des Reichstages IX. Wahlperiode Band 458, Berlin 1936
1. Sitzung 12.12.1933 fehlt entschuldigt
2. Sitzung 30.01.1934 anwesend
3. Sitzung 13.7.1934: keine Angaben zur Anwesenheit vorhanden
4. Sitzung: Trauerkundgebung für den verstorbenen Reichspräsidenten Hindenburg, 6.8.1934: keine Angaben zur Anwesenheit vorhanden
5. Sitzung 21.5.1935: keine Angaben zur Anwesenheit vorhanden
6. Sitzung 15.9.1935 (Reichsparteitag): keine Angaben zur Anwesenheit vorhanden
7. Sitzung 7.3.1936: keine Angaben zur Anwesenheit vorhanden
Ich bin im Besitz zweier Gemälde von Hanna Achenbach-Junemann
Mohnblumen in Vase und bunter Blumenstrauß in Glasvase.
Beide Gemälde sich gerahmt (leider 1 Rahmen an einer Ecke defekt).
Besteht Ihrerseits Interesse diese zu Erwerben?
Mit freundlichen Grüßen Gabriele Hauk
Bisher konnten noch keine Aussagen über eine Mitgliedschaft Müllers im Obersdorfer Gemeinderat gemacht werden. Ein gerade veröffentlichter Fund der VVn-BdA Siegerland-Wittgenstein – http://www.vvn-bda-siegen.de/Aktuelles.html#wilnsdorf – zeigt nun, dass auch die Protokolle dieses Gremiums durchgesehen werden müssen, um die politischen Aktivitäten Fritz Müllers vollständig darstellen zu können.
Als Teilnehmer der Veranstaltung sage ich eindeutig: positiv, auch wenn ich eine eigene Umsetzung derzeit noch nicht absehen kann. Hilfreich in dem Zusammenhang: http://archive20.hypotheses.org/905
Hier in Greven macht die Stadtbibliothek sowohl Facebook https://www.facebook.com/StadtbibliothekGreven als auch ein Blog http://schulbloggreven.wordpress.com/ (das aber nur Grundschullehrkräfte erreichen soll. Rückmeldungen sind offenbar rar). Es gibt also guten Grund, nicht stehenzubleiben.
Das Wasserzeichen der „Biblia Latina“ ist ein Pro Patria-Wasserzeichen und zeigt den Freiheitslöwen, eine alte holländische Wappenfigur der Oranier, der in seiner rechten Pranke ein Schwert und in der linken Pranke ein Bündel mit sieben Pfeilen hält. Hinter dem Löwen befindet sich eine sitzende weibliche Gestalt mit Helm und einer Stange mit Dreizack in der rechten Hand: die griechische Göttin der Weisheit, des Krieges und des Friedens, Pallas Athene. Ein Palisadenzaun umrandet die beiden. Oben links über diesem Bild steht der Schriftzug „ProPatria“. Das Pro Patria-Wasserzeichen, das auch Hollandia-Wasserzeichen oder „Hollandse Magd” genannt wird, ist in den Niederlanden, Deutschland, Frankreich und weiteren europäischen Ländern weit verbreitet für Papiere im Folio-Format.
Aus: http://www.bibliotheca-johannei.de/bestand/besondere-bucher/biblia-latina/
Ein Leserbrief des VVN-BdA Siegerland-Wittgenstein, der die ausgebliebebene Distanzierung des Wilnsdorfer Rates zur Ehrenbürgerschaft Hindenburgs thematisierte und der bereits in der Westfälischen Rundschau und in der Siegener Zeitung abgedruckt wurde, befindet sich in den Kommentaren zu diesem Facebook-Eintrag: https://www.facebook.com/walter.kramer.52?fref=ts .
Das Motiv wurde im 17. Jahrhundert auch auf gußeisernen Kaminplatten verewigt; eine schöne Abbildung hier: http://www.westlandlondon.com/stock/firegrates/firebacks/item/9449/detail.htm?page=3
Über den „Dreizack“ im Wasserzeichen läßt sich streiten. Die Kaminplatte zeigt definitiv keinen solchen, sondern einen Speer mit aufgesetztem Freiheitshut, was im historischen Kontext (niederländischer Freiheitskampf) stimmig ist. Die Deutung der allegorischen Figur als „Hollandia“, eben als das personifizierte Vaterland (patria), wäre näherliegend, ohne damit Bezüge zur Göttin Athene ausschließen zu müssen.
Aber, lieber Herr Wolf (ich erlaube mir, mich zu wiederholen): Wer Auskünfte sucht, möge doch bitte sein Anliegen klar formulieren. Ihre Frage „Wer weiß mehr?“ kann in so viele Richtungen führen, dass man sich nicht recht zur Beschäftigung motiviert fühlt. Was interessiert Sie denn nun konkret? Alles über frühneuzeitliche Wasserzeichen? Alles über genau dieses eine Wasserzeichen? Alles über ein mit diesem Wasserzeichen versehenes uns unbekanntes Objekt? Alles über die „Pro Patria“-Ikonographie auf Papier, Gußeisen und anderen Trägern? Alles über Frauen und Löwen? Wenn Sie eine präzise Frage stellen würden (unter Preisgabe der Ihnen schon vorliegenden Informationen), könnte sich möglicherweise irgendwo im Land ein Experte angesprochen fühlen. So aber …
„Pro archivo!“
P.K.
Ach Herr Kunzmann, zunächst einmal Danke schön für die Ergänzung!
Gönnen Sie uns doch den Spaß, ergebnisoffen eine allgemeine Frage zu stellen. Wäre präziser gefragt worden, wäre vielleicht nicht der für die Region nicht uninteressante Hinweis erfolgt, dass die figürliche Darstellung sich auch auf gusseisernen Ofenplatten befindet.
Lieber Herr Wolf, ich gönne Ihnen jeden Spaß! Im Archiv gibt es davon ja nicht allzu viel.
Wie ich inzwischen sehe, sind diese Ofenplatten hierzulande ein alter Hut. Siehe dazu u.a. Eugen Fritz, Die Pro-Patria-Kaminplatte. Ikonografische Betrachtung der Bildelemente und grafischen Vorlagen, in: Siegerland 63 (1986), S. 33 ff.
P.K.
Links zum pro patria Wasserzeichen:
1) Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz verwesit auf den wahrscheinlichen Herstellungsort: Stennert in Hagen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
2) National gallery of Australia mit Literaturhinweisen
Literatur:
Nana Badenberg: Das Pro-Patria-Wasserzeichen : zur Geschichte eines filigranen Motivs, 1699-1914, Basel 2010. 2012 erhielt die Autorin den Förderpreis der Schweizer Papierhistoriker für ihre Diplomarbeit.
Theo Gerardy: Die Hollandia-Wasserzeichen von F. C. Drewsen & Sohn 1822-1835.Versuch eines neuartigen Kataloges, in: Papiergeschichte, Bd. 8, 1958, Nr. 1: 1-8
Theo Gerardy: Die Hollandia-Wasserzeichen des nordwestdeutschen Raumes im 19. Jahrhundert, Oegstgeest 1961
Wisso Weiß: Sie ist in alter Volkskunst anzutreffen: die “ Hollandia“, ein patriotisches Wasserzeichen der Holländer. In: Nationalzeitung, Berlin, 34(1981-95-23)
Zu 1) Die Ähnlichkeit ist wirklich frappierend. Guter Fund, Herr Wolf! Laienhafte Frage: Waren Schöpfformenmacher immer exklusiv für einzelne Papiermühlen tätig, oder gab es bei so massenhaft verbreiteten Motiven wie der Hollandia Serienfertigung? In dem Fall wäre die Zuordnung zu Stennert nicht zwingend.
In Stennert war die Dynastie Vorster ansässig (wohl drei Papiermühlen im Besitz konkurrierender Brüder); auch niederländische Fachkräfte sind belegt (siehe http://www.blogus.de/Pmuehlen.html ). Literatur zur regionalen Papiergeschichte läßt sich leicht recherchieren. Hinweisen möchte ich bloß noch auf Alma Langenbach, Westfälische Papiermühlen und ihre Wasserzeichen, 2 Bände, Witten 1938. Das ist Frau Langenbachs Münsteraner Dissertation, anscheinend ein Standardwerk zu dem Thema.
Besteht Ihr geheimnisvolles Objekt nur aus einem Blatt? Sind wirklich keine Initialen des Papiermachers vorhanden, oder haben die nur nicht auf das Bild gepaßt? (Gönnen Sie mir den Spaß, Ihnen dämliche Fragen zu stellen?)
P.K.
1) Es ist sicherlich nicht auszuschließen, dass es quasi Wasserzeichenmuster gab – vor allem vor dem Hintergrund, dass das Hollandia-Papier weit verbreitet war. Insofern ist Stennert-These schon etwas spekulativ.
2) Das Wasserzeichen befindet sich selbstredend auf einem Bogen Paier. Mir ist jedoch keine „Signatur“ aufgefallen. Überprüfen muss ich jedoch, ob das „Stennert-Papier“ nur vom Arnsberger Regierungspräsidenten verwendet wurde, wie ein zweiter Fund dies nahelegt.
Liebe Kollegen,
der hier angestoßene Diskussion möchte ich mich gern mit einer Frage anschließen und hoffe auf Unterstützung. Ich habe ebenfalls bei einer meiner Hildesheimer Handschriften (geschrieben um 1783) das WZ Pro Patria(wie im australischen Katalog: The ‚Maid of Dort‘ form of the Pro Patria watermark) gefunden, hinzutreten jedoch noch die WZ: H C M, und ab fol. 124: RC (verschlungen) mit Krone darüber, WZ: Polle,WZ: Felde. Das Papier erscheint wie aus einer Werkstatt. Ich konnte zwar in Polle eine Papiermühle ausfindig machen (s. hier:), aber die WZ nicht konkret am Beispiel zuordnen bzw. die WZ Felde oder RC weiter zuordnen. Mit herzlichen Grüßen R. Kunert
Kompetente Ansprechpartner (die wohl kaum Siwiarchiv zur Kenntnis nehmen) findet man hier:
Deutsches Buch- und Schriftmuseum Leipzig, Papierhistorische Sammlungen http://www.dnb.de/DE/DBSM/Bestaende/PapierhistSammlung/papierhistsammlung_node.htm
Das Museum hat auch eine umfangreiche Wasserzeichensammlung und ist außerdem Herausgeber der Internationalen Bibliographie zur Papiergeschichte.
P.K.
Hallo,
ich bin in Besitz eines Aquarells von Hermann Manskopf, gerahmt45 x 34,5 cm in den Außenmaßen. Es stellt eine Landschaft dar und die original Signatur ist von 1933.
Meine Frage stellt sich nun, wenn ich das Bild veräußere, wie viel kann man hierfür bekommen?
Ein Foto davon kann ich Ihnen umgehend zusenden.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen!
Über den aktuellen „Marktwert“ des Bildes könnten Ihnen am ehesten die regionalen Museen, allen voran das Siegerlandmuseum und das Museum Wilnsdorf, sowie regional tätige Kunsthistorikerinnen bzw. Galerien Auskunft geben. Adressen finden Sie im Kulturhandbuch des Kreises Siegen-Wittgenstein.
Auskunft von Dr. Heinz Braun, Göttingen, vom via E-Mail am 3.11.2013, den ich auf Vermittlung von Dr. Uta Gärtner, Berlin, angeschrieben hatte und der selbst ein Jahr in Myanmar/Birma/Burma gelebt hat: “ ….. Die Sprache ist eindeutig Myanmar/Birmanisch/Burmesisch, d.h. die Handschrift kommt aus Myanmar/Birma/Burma. ….. Leider ist mir außerhalb des Landes noch keine astrologische Handschrift – um die handelt es sich eindeutig – in die Finger gekommen. Es sind 4 (?) astrologische Handschriften, erkennbar an der Kürze des Blattes – die „normalen“ Handschriften sind über 50 cm lang und haben 2 Schnürlöcher -. Bei der ersten läßt sich das Datum erkennen: 1933, also eine relativ junge Hs. …..“
Auf folgende Ergänzung der Liste wurde von Kollegin Riedesel hingewiesen: Krämer, Fritz: Ein Diedenshäuser überschreitet die Sonnenlinie, in: Krämer, Fitz (Hrsg.): Wunderhausen Diedenshausen, Wunderthausen, Diedenshausen 1978, Seite 449-454.
herrlich und spannend! Vielen Dank für diesen schönen Beitrag zur Blogparade! Das in Sie gesetzte Vertrauen bestätigen die Handlungen des Archivs – prima! Ich bin sehr neugierig, wie die Geschichte weitergeht.
Gestern zufällig (!) beim Zeitunglesen entdeckt:
Stellungnahme von Johannes Oechelhäuser zur schlechten Wasserqualität des von ihm genutzten Leimbachs, in: Siegerländer Intelligenz-Blatt vom 6. Oktober 1826, S. 157-159.
Ergänzend noch dieses:
„Eine zweite Papiermühle war 1821 zu Rudersdorf bei Siegen errichtet worden, aber 1840 schon wieder eingegangen. Die Gründung der letzten heute [1936] noch stehenden ‚Papiermühle am Effertsteich auf der Schemscheid‘ erfolgte ein Jahrzehnt später. Der Bruder des obengenannten Johannes Oechelhaeuser, Jakob Heinrich Oechelhaeuser, erhielt am 9. Oktober 1834 Erlaubnis, an seiner Walkmühle am Effertsteich einen Anbau zu setzen, und am 14. April 1835 erschien eine öffentliche Bekanntmachung, nach der die Gebrüder Johannes und Jakob Oechelhaeuser um die Konzession nachsuchen, in ihrer bei dem Effertsteich gelegenen Walkmühle eine Papiermühle anlegen zu dürfen. Die Errichtung dieser Papiermühle auf der Schemscheid geschah jedoch allein durch Jakob Heinrich Oechelhaeuser, der damit der Gründer des Unternehmens war.“
Hermann Klingspor, 100 Jahre Papierfabrik Jakob Oechelhaeuser G.m.b.H. in Siegen, in: Wochenblatt für Papierfabrikation 67 (1936), Nr. 2, S. 27-28. (Klingspor war seit 1928 Inhaber der Firma.)
Und jetzt suchen wir mal fleißig nach Wasserzeichen der Oechelhäuser-Brüder!
P.K.
Danke Herr Kunzmann,
genau diese weiteren Angaben zu den Siegener Papiermühlen standen im Entwurf für meinen nächsten (III) Beitrag, aber nun stehen sie schon mal da…
Tut mir leid, dass ich Ihnen zuvorgekommen bin. Aber es bleibt ja noch genug für Sie zu tun. Den kurzen Beitrag von 1936 faxe ich Ihnen am Montag rüber (an welche Nummer???), falls er Ihnen nicht zufälllig (!!!) schon vorliegen sollte.
Mir fällt gerade ein, dass in den „Siegener Beiträgen“ mal ein Aufsatz über Johannes Oechelhäuser stand (Band 6).
P.K.
Dieter Pothmann, Johannes Oechelhaeuser (1787-1869) – einer der ersten Papiermaschinenfabrikanten in Deutschland, in: Siegener Beiträge Bd. 6 (2001), S. 37-52; ferner vom selben Autor: Zum 200. Jahrestag des Robert’schen Patentes: Johannes Oechelhaeuser, einer der ersten deutschen Papiermaschinen-Hersteller, in: Wochenblatt für Papierfabrikation 128 (2000), S. 102-114. Obwohl es verständlicherweise viele Überschneidungen gibt, handelt es sich um zwei separate Aufsätze Pothmanns.
P.K.
man glaubt es nicht:
Wilhelm Schmidt: Tafel an Geburtshaus von Karl Jung-Dörfler. Ansprache bei der Weihe 1930 in Obersdorf, in: Siegerländer Heimatkalender 66, 1991, S. 161-162.
Ein Baustein zur Rezeptionsgeschichte Wilhelm Schmidts. Man sehe aber auch die Sendung „Mittendrin in Obersdorf“ der WDR Lokalzeit Siegen vom 27. April 2009: http://www.youtube.com/watch?v=w7duU5zIOuI . Dort werden ab 2min 35 eine Holztafel mit Zeilen Schmidts vorgestellt und eine Gedicht gelesen.
Martin Schulz hat ein Handbuch der SA mit zahllosen Bildern und Zeichnungen illustriert.
Was soll man da annehmen?
Als Lehrer war er jähzornig und unangenehm.
Seine Wasser in Wasser Maltechnik ist verunglückt.
Man sollte ihn in Ruhe lassen.
Sein Nachfolger Willy Schütz war das Gegenteil von ihm.
Grossartiger Künstler und Lehrer, Assistent bei Oscar Kokoschka gewesen.
Hallo Frau Deubner,
hatten Sie meinen Großvater als Lehrer kennengelernt?
Ich weiß als Enkelin, dass mein Großvater einer jüdischen Familie Schutz gegeben hat. Hierfür hat er sein Leben auf das Spiel gesetzt. Den jüdischen Kerzenleuchter, den er dafür geschenkt bekam, habe ich heute noch.
Heike Schulz
Der erste Teil der Gleichung steht so im Text. Wenn man (worin sich anscheinend alle Redner einig waren) behauptet, 1. deutsche Einwanderer hätten die USA in überdurchschnittlichem Maße positiv beeinflußt, 2. die „US-Mentalität“ (was immer das sein soll) sei problematisch, 3. das würde sich zum Guten ändern, wenn man sich wieder auf die positiven deutschen Einflüsse besänne, dann folgt daraus rein logisch der zweite Teil der Gleichung: Die Einwanderer aus anderen Ländern hätten die jungen USA weniger positiv beeinflußt als die Deutschen oder seien gar schuld an den Unerfreulichkeiten der US-Politik. Die Italiener hatten die Mafia mitgebracht, die Iren den Alkoholismus, die Engländer das Fausstrecht („Motto: Der Stärkere gewinnt“ – eine in Deutschland und speziell im Siegerland wohl absolut unbekannte Lebenseinstellung???), die Chinesen das Fast Food, usw. — Kann man denn nicht einfach mal die Proportionen wahren? „Ergebnisse einer Volkszählung aus dem Jahr 1979 zeigten, daß fast 29 Prozent aller Amerikaner deutsche Vorfahren hatten.“ (http://usa.usembassy.de/etexts/ga-ad092883.htm) Wen wundert es, dass sich darunter auch Menschen befanden, die „positiven Einfluss“ auf die amerikanische Gesellschaft hatten, z.B. die erwähnten „Bergbau-Fachleute“. Jede andere Siedlernation könnte aber das gleiche von sich behaupten. Manche Siegerländer scheinen aber ein Problem damit zu haben, dass sie ganz normale Menschen wie alle anderen sind und dass ihr Ländchen nicht der Nabel der Welt ist.
P.K.
Ich habe nicht die Ausstellung kommentiert, sondern den obenstehenden Text.
Historische wie aktuelle Belege für provinziellen Dünkel finden Sie auch ohne mich bis zum Abwinken. (Ich behaupte nicht, dass es sich dabei um ein exklusiv Siegerländer Phänomen handeln würde.)
P.K.
Hier noch die Angaben aus den Personalveränderungen des Reichsarbeitsdienstes:
Müller, Wilhelm
30.01.1936: Ernennung v. Ofm./NSAD z. Oberfeldmeister/Reichsarbeitsdienst
01.04.1936: Ernennung z. Oberstfeldmeister 6/208a Brün (Abteilungsführer)
01.08.1938: Versetzung v. 6/204 Abtf. Brün n. 3/204(W IV – Westwall) Abtf. Gemünd-Malzbenden
31.08.1942: Ausgeschieden 3/204(Abtf.) Kierspe und Rangverleihung als Arbeitsführer
Hier die Angaben aus den (PV) Personalveränderungen und (DAL) Dienstaltersliste, wie ich sie vorgefunden habe:
Müller, Wilhelm
30.01.1936: Ern. v. Ofm./NSAD z. Oberfeldmeister/RAD
208a (PV 3 v. 04.02.1936 S. 39 RDA-Oz. 54)
01.04.1936: Ern. z. Oberstfeldmeister
6/208a(A 1)(PV 8 v. 29.06.1936 S. 430 RDA 29.6.36/42)
01.01.1937: Stichtag: 6/208a Abtf. – RDA 29.6.36/42
(DAL I v. 01.01.1937 S. 50 Lfd.Nr. 517)
01.08.1938: Vers. v. 6/204 Abtf. Brün n. 3/204(W IV) Abtf. Gemünd-Malzbenden
(PV 54 v. 20.07.1938 S. 7 Lfd.Nr. 110)
31.08.1942: Ausgesch. 3/204(1)
(PV 47 v. 25.09.1942 S. 240 Lfd.Nr. 8)
31.08.1942: Rangverl. Arbeitsführer
3/204 Abtf.(PV 49 v. 10.10.42 S. 246)
Bei Bedarf sende ich auch die Daten von anderen RAD-Führern.
Danke! Verstehe ich es richtig, dass es sich um periodisch erscheinende Veröffentlichung des DAF handelt. Wenn ja wo liegen diese (Bibliothek, Archiv)?
Hallo Leute,
in Siegen gab es auch einen Arbeitsdienstführer Dr. Ludwig Kirchhoff, welcher die Arbeitsdienstgruppe 209 leitete und am 30. Juni 1937 ausgeschieden ist.
Wer hat dazu weitere Informationen?
Hallo liebe Leser,
hier noch einmal die Daten mit den Quellen:
Kirchhoff, Dr. Ludwig
18.12.1935: Ern. v. Arbf./NSAD z. Arbeitsführer/RAD
(Vbl. 35 Nr. 869 S. 343 Oz. 93)
01.01.1937: Stichtag: 209 Siegen Gruppenführer – RDA 18.12.35/99
(DAL I v. 01.01.1937 S. 16 Lfd.Nr. 72)
30.06.1937: Ausgeschieden – 209(1)
(PV 38 v. 24.07.37 S. 9 Lfd.Nr. 1)
Vbl. = Verordnungsblatt für den Reichsarbeitsdienst
DAL = Dienstaltersliste
PV = Personalveränderungen für den Reichsarbeitsdienst
RDA= Rangdienstalter
Anknüpfen kann man immer!
Zu Dr. Kirchhoff s. http://akteure-und-taeter-im-ns-in-siegen-und-wittgenstein.de/verzeichnis/gesamtverzeichnis#kirchhoff. Im Berliner Bundesarchiv lassen sich zu Akten zu einen Dr. Ludiwig Kirchhoff finden:
– R 77/12489 [Personalakte des Reichsarbeitsdienst] Kirchhoff, Ludwig, Dr., geb. 14.03.1897, 1933 – 1945
– R 9361-I/11138, Sammlung Berlin Document Center (BDC): Personenbezogene Unterlagen der NSDAP
Hallo Leute,
von der „Arbeitsgauleitung XXB Westfalen-Süd“ (Gaustab in Dortmund)
wurde eine Broschüre mit dem Titel „Der Arbeitsdienst Westfalen-Süd“ herausgegeben. Sie erschien 1934, 1936 und 1939.
Wer stellt mir gegen Kostenerstattung von diesen Broschüren Fotokopien zur Verfügung?
Noch eine Ergänzung zum Arbeitsführer Dr. Kirchhoff.
Der Stab der Arbeitsdienstgruppe 209 befand sich zuerst in Hilchenbach. Wann er nach Siegen wechselte ist mir noch unbekannt (vermutlich 1935).
Vielleicht stammt Dr. Kirchhoff aus Hilchenbach?
Ergänzung zu 2) Kirchhoff, Dr. Ludwig:
00.05.1934: Stichmonat: Ostfm., AG-Ltg. XXB Dortmund, Unterkunftswesen
(Der AG Westfalen-Süd, Dortmund 1934, S. 62)
3) Comblain,(?),
00.05.1934: Stichmonat: Arbf., Gruppenführer 209 Siegen
(D. AG Westfalen-Süd, Dortmund 1934, S. 15)
Ihren Veranstaltungshinweis nehme ich gern in der Rubrik >Veranstaltungen< auf der von mir betreuten o.a. Website (http://www.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de) auf. Soweit Sie uns / mir weitere Dokumente zum Inhalt der Sendung und/oder zu deren Aufzeichnung überlassen bzw. an meine E-Mail-Anschrift zusenden können, wären wir Ihnen dafür dankbar.
Mit freundlichem Gruß aus Bremen!
Günter Knebel,
gebürtig (Jgg. 1949) aus Siegen-Weidenau
… schade, dass die beiden „Schulen ohne Rassismus“, das Löhrtor-Gymnasium und die Realschule Am Oberen Schloss, und das Jugendparlament nicht in der Auflistung der Akteure erwähnt wurden; waren sie doch mit ihren Projekten (u.a. Stolpersteine) am Ge(h)denken beteiligt und auch an ihrem Standort im Rathaus sehr präsent …
Ob hier weitere Hinweise zu Fritz Müller enthalten sind, muss noch geprüft werden: Gründel, Reinhard: Das Siegerland in der Zerstörungsphase der Weimarer Republik. Eine regionalgeschichtliche Untersuchung von Bedingungen, die zur faschistischen Machtergreifung führten. Schriftliche Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt zur Sekundarstufe I im Fach Geschichte, Gesamthochschule Siegen, Mai 1979
Der Sauerländische Gebirgsverein (SGV) brachte mindesten drei Bände
mit folgendem Titel heraus:
„Euch grüßt die Heimat“
Untertitel: Feldpostgabe des SGV an seine feldgrauen Mitglieder zu Weihnachten 1940 (1941,1942,).
Die Bände waren nicht im Handel zu erwerben.
Auf der ersten Seite befindet sich jeweils ein Zitat Hitlers und auf der folgenden Seite ist ein Bild Hitlers abgedruckt.
In den Bänden befinden sich verschiedene Gedichte und Erzählungen mit deutlichen Bezügen zur Nnationalsozialistischen Blut und Boden Ideologie westfälischer Heimatdichter,unter anderem Beiträge von Josefa Berens – Totennohl.
In der Ausgabe 1940 ist das Gedicht “ Em Saijerland“ von Wilhelm Schmidt abgedruckt und in der Ausgabe von 1942 das Gedicht „De Hornerbläser em Nassauer“.
Damit ist auch eine überregionale Tätigkeit Schmidts belegt.
Wenn im Rahmen der Eisenstraße Südwestfalen mit öffentlichen Geldern kurze thematische Filme produziert werden, sollte deren Inhalt besser recherchiert werden: Beispiel:
1. Die zu Beginn des Films zu sehenden Reste der Bergbausiedlung Altenberg stammen aus dem 13. Jahrhundert. Der Kommentar spricht von urkundlichen Erwähnungen im 17. Jahrhundert.
2. Das Naturschutzgebiet befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Gruben Altenberg und Heinrichsegen. Im Film wird von der Grube Victoria gesprochen.
Die Gründungsversammlung des neuen Trägervereins
4Fachwerk e.V.-das Mittendrin-Museum ist
am Dienstag 14.01.2014 um 19.00 Uhr im
Rathaus Freudenberg, Ratssal,
Mórer Platz 1, 57258 Freudenberg
Der Verein 4Fachwerk wurde am 14.01.2013 um 20.14 Uhr im Ratssaal des Rathauses Freudenberg von 40 Mitglieder gegründet.
Der Vorstand besteht aus :
Dieter Siebel, Vorsitznder
Dr. Ingrid Leopold, stellv. Vorsitzende
Heinrich Hubbert III, stellv. Vorsitzender
Bernd Brandemann, Schriftführer
Peter Mannes , Schatzmeister
Susanne Bensberg-Kreus, Beisitzerin
Christian Berner, Beisitzer
Michael Müller , Beisitzer
Ulrich Tiede, Beisitzer
Die nächsten Ziele des Vereins sind die Eintragung in das Vereinsregister,
die Erlangung der Gemeinnützigkeit, der Übernahmevertrag mit der Stadt Freudenberg und natürlich die Gewinnung weiterer Mitstreiter.
Vielen Dank für den Beitrag! Der zunächst die jüngere deutsche Archivbloggeschichte skizziert und einen Einblick in die Speyersche Archivblogkonzeption gibt.
„Born to be filed“, tumblr-Blog eines Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste FR Archiv, der an der Fernweiterbildung Archiv an der FH Potsdam teilnimmt folgt als Zweiter Kollege unserem Aufruf zur Blogparade und betont die grenzenlose Kreativität der Archivierenden: http://fam03pf.tumblr.com/post/74392230103/warum-sollten-archive-woruber-wie-bloggen-ein-aufruf . Vielen Dank!
Über diese Fortbildung wird gebloggt. Zweit Einträge sind bereits verfügbar:
1) Begrüßung durch Dr. Walter Hauser, Prof. Dr. Bärbel Kuhn und Dr. Astrid Windus, 24.1., 15 Uhr: http://1914lvr.hypotheses.org/950
2) Eröffnungsvortrag „Grenzenloser Krieg? Der Erste Weltkrieg in Computerspielen“ von Prof. Dr. Angela Schwarz, Siegen, 24.1., 15.15 Uhr: http://1914lvr.hypotheses.org/952
Weiterer Blogeintrag zu den Impulsvorträge von Dr. Jens Aspelmeier: „Biene Maja – ein Bestseller für Kinder und Soldaten“, Prof. Dr. Bärbel Kuhn: „Le Tour de la France et de l’Europe – Lektionen für Kinder (1877–1916)“ und Prof. Dr. Angela Schwarz: „Krieg und die Frage von Grenzen in modernen Computerspielen – Materialien“, 25.1., 14.30 Uhr: http://1914lvr.hypotheses.org/1024
Felicitas Noeske bloggt für ihre tolle Bibliothek und ihr (legales, weil mit Zustimmung des Staatsarchivs bestehendes) Gymnasialarchiv. Sie hat aber Archivalia für ihren beitrag zur Blogparade ausgewählt
Bitte um Pardon, ich hatte den Beitrag von Klaus Graf nicht gesehen, als ich meinen unten drunter setzte. Ich danke ihm, dass ich „Archivalia“ für den kleinen Artikel benutzen durfte, denn mein Blog „Bibliotheca Altonensis“ ist eher eine kommentierte Bilderschachtel (auch als solche gedacht) und Texte werden dort weniger wahrgenommen als in Archivalia.
Ihnen beiden vielen Dank für den schönen Beitrag! Das Schularchivblog sollte meines Erachtens sein Licht nicht so unter den Scheffel stellen – wer mit Peter Behrens aufwarten kann, der darf unbescheidener daherkommen.
Dankeschön, Ihr Aufruf hat mich zu jenem Artikel bei Archivalia inspiriert: http://archiv.twoday.net/stories/640154217/
Falls er konveniert, mögen Sie ihn gerne hier einreihen, ich würde mich darüber freuen!
Siegener Zeitung berichtete heute von der empörten Reaktion der Kreisgruppe des Bundes der Vertriebenen und von der Freude des Siegener Kunstvereins auf eine spannende Veranstaltung.
„Das Gasthaus Stünzel ist das Wahrzeichen des gleichnamigen Wittgensteiner Höhendorfs. Es war ein legendärer Ausflugsort für betuchte Sommmerfrischler und Jäger aus dem Siegerland. Jahrzehntelang stand es leer und drohte zu verfallen. Holländer haben nun das alte Gasthaus gekauft und restaurieren es gemeinsam mit Bewohnern aus Stünzel.“
Link zum Beitrag in der WDR- Lokalzeit Südwestfalen vom 31.01.2014 : http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit/lokalzeit-suedwestfalen/videodasaltegasthaus100.html
Hallo Herr Graf, Wikisource ist ergänzt wird ab sofort hinsichtlich der digitalen Münsteraner Bestände kurrent gehalten. Danke für den Hinweis! Beste Grüsse, Thomas Reich
– Die Denkmaldiskussion aus der Sicht des „betroffenen“ Historikers: http://www.hans-hesse.de/ . Auch dessen Facebook-Seite – https://www.facebook.com/hans.hesse.75 – enthält Einträge zur Diskussion.
– Aus der Sicht eines Kommunalpolitikers stellt sich die Diskussion wie folgt dar: http://gerhard-koetter.de/?p=5706 .
– Die Printausgaben der Siegenr Zeitung nach der Veranstaltung enthalten einige Leserbriefe.
Auch Radio Siegen widmete sich dem „Monument men“ in zweiBeiträgen am 13.2.14.
Auf das Blog der Kunsthistorikerin Tanja Bernsau sei hier hingewiesen. Bernsau hat die Geschichte der Einheit am Sammelpunkt Wiesbaden untersucht und einige Beiträge dazu gepostet.
Hier nun noch der Hinweis auf das frisch geschlüpfte Blog des Archivtags Rheinland-Pfalz / Saarland: http://archivtag.hypotheses.org/uber
Wir hoffen auf rege Beteiligung! ;)
Beste Grüße,
Andrea Rönz
Vielen Dank für diesen Beitrag! Der Einsatz von Blogs zur Konkretisierung des Berufsbildes „Archivar/in“ stellt m. E. eine wichtige und auch bald wahrzunehmende Aufgabe des archiv(ar)ischen Berufsverbandes dar.
Das Archiv im Rhein-Kreis Neuss setzt seine historische Vortragsreihe „Geschichte im Gewölbekeller“ fort: Am Dienstag, 11. März, referiert Dr. Friedrich Weber aus Siegen über das Thema „Kapelle – Kirche – Krankenhaus: Vincenz Statz (1819-1898), Architekt der Neugotik“. Der Vortrag wird in Zusammenarbeit mit dem Kreismuseum Zons angeboten.
„Auf Vincenz Statz gehen die Baupläne für die Zonser Kirche St. Martinus zurück. Er hat aber auch an vielen anderen Orten im Rheinland und darüber hinaus Spuren hinterlassen. Wir hoffen, dass der Vortrag, bei dem auch interessantes Bildmaterial präsentiert wird, auf großes Interesse stößt“, so Archivleiter Dr. Stephen Schröder.
Alle Veranstaltungen der Geschichtsreihe finden im historischen Gewölbekeller unter der Nordhalle von Burg Friedestrom in Dormagen-Zons statt und schließen mit einem gemütlichen Beisammensein. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Nähere Informationen unter Telefon (02133) 530210.
Auf Statz gehen auch die die Folgenden Bauten im Nachbarkreis Altenkirchen zurück: Katholische Pfarrkirche St. Ignatius Betzdorf und Katholische Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt Mudersbach.
Vielen Dank für diese Blogparade samt Fazit – vorbildlich. Ich erlebte es immer wieder, dass die Initiatoren von Blogparaden das Potenzial nicht ausschöpften, eine Zusammenfassung bzw. Bewertung der Beiträge unterließen. Ihr habt das anders gemacht: Beiträge kommentiert (auch das ist leider nicht Usus) sowie in Euer Netzwerk hineingeteilt.
Die Beiträge bieten viele Denkanstöße für Kulturinstitutionen insgesamt, aber auch für mich. Ich hoffe, dass angehende Archivare das Bloggen für sich entdecken, ihr Arbeits-/Forschungsgebiet Fachleuten und Laien gleichermaßen näher bringen. Stoff zum Nachdenken dürfte für viele da sein. Wenn sich etwas aus der Blogparade auch für Euch ergibt, freue ich mich über die Berichterstattung hier.
Schöne Grüße aus München und bis bald in Stuttgart
Tanja Praske
Auch ich freue mich sehr über das Fazit, es gibt auch Anlass noch einmal in die Beiträge hineinzulesen und alle noch einmal im Überblick zu sehen. Schön, dass ich als Kommentator „von außen“ dabei sein durfte, ich habe dadurch viel mehr über die bloggenden Archive erfahren und freue mich darauf, über Blog und Twitter in Kontakt zu bleiben.
Herzliche Grüße, Marlene Hofmann
Eine sehr interessante Sache diese Blogparade. Sie reicht in jedem Fall auch in andere Instituionen hinein. Spannend, was von außen dazu gepostet und geschrieben wurde. Es ist richtig, dass ein BLog die Sichtbarkeit eines Archivs nach außen, aber auch nach Innen erhöht. Der Zuspruch von der Seite der Auszubildenen lässt hoffen, dass die nächste Generation grundlegend anders mit dem Thema Web 2.0 umgehen wird, als die gegenwärtige.
Herzlichen Glückwunsch zu Deinem Buch.
Ich finde es sehr wichtig, daß es noch Menschen, wie Dich gibt, die das kulturelle Erbe in Wort und Bild festhalten.
Vieles wäre schon längst in Vergessenheit geraten, würde es nicht Menschen geben, die wie Du, historisches wieder in unseren Gedanken lebendig werden lassen.
Ich wünsche Dir, lieber Heinz, weiterhin viel Kraft und Spaß und sende Dir einen ganz herzlichen Gruß!
Karo
(entnommen aus meinem Gästebuch)
Die nicht unerwartet deutliche Kritik Grafs sei zum Lesen empfohlen.
siwiarchiv versteht sich primär nicht als wissenschaftliches Rezensionsorgan (s. Editorial und hier). Es verweist zunächst lediglich auf neue erschienene Literatur und freigegebene Webangebote zur regionalen Geschichte. Sollten Literatur oder Webangebote Mängel aufweisen, so kann hier daher gerne entsprechend kommentiert und ggf. darüber diskutiert werden. Dies gilt umso mehr, wenn Webangebote zur Diskussion keinen Raum bieten.
ebidat.de hat sich über die letzten 10 Jahre ja schon sehr vorteilhaft entwickelt. Diese Arbeit ist wirklich zu würdigen.
Einen wirklich wichtigen Beitrag zu den Burgen und Schlössern im deutschsprachigen Raum leistet seit Jahren auch Andreas Hein. Früher mit seinem Burgeninventar. Heute mit alleburgen.de.
Er listet hier über 2.300 Burgen und Schlösser in NRW auf. Akribische Recherche und unermüdliche Arbeit an seiner Website haben diese für mich zur Nummer Eins der Burgenseiten gemacht, wenn es darum geht einen ersten Überblick zu den sogar unbekanntesten Anlagen zu bekommen.
Ich finde es grundsätzlich gut, dass es so etwas wie das Ebidat-Projekt überhaupt gibt. Mängel an der Quellen-Arbeit mögen schon sein, aber eine wissenschaftliche Datenbank, die alle allein in Deutschland ca. 18.000 – 22.000 Schlösser, Burgen, abgegangene Burgen und Burgruinen erfasst, fehlt bislang. Da hat auch das umfassende „Alleburgen“ erst 1/10 geschafft.
Radio Siegen berichtet heute von der Kulturausschusssitzung der Stadt Siegen am 18.3.2014 und TOP 6 wurde über dem Sachstand berichtet:
„Walter-Krämer-Platz“ beim Kreisklinikum in Weidenau
Entwurf der Platzgestaltung soll bald öffentlich vorgestellt werden
Bis zum Herbst soll der Bereich vor dem Haupteingang des Kreisklinikums in Weidenau künstlerisch als „Walter-Krämer-Platz“ gestaltet sein. Der Westerwälder Bildhauer und Maler Erwin Wortelkamp wird das machen. Wie genau der Platz einmal aussehen wird, soll in einigen Wochen vorgestellt werden. Das hat die Siegener Stadtverwaltung im Kulturausschuss angekündigt. Wortelkamp und die Führung des Kreisklinikums seien im Moment in der Endabstimmung des Projekts. Vorgesehen ist eine Plastik an der Gebäudefassade, ein Wortelkamp-Bild werde in der Eingangshalle hängen. Traute Fries von der SPD nannte die Symbolik Wortelkamps „sehr zutreffend für das Wirken Walter Krämers“. Fries äußerte aber die Befürchtung, dass so mancher Besucher das Kunstwerk nicht verstehen werde. Der Siegener Kommunist Walter Krämer war in der NS-Zeit mehrfach festgenommen und inhaftiert worden. Im KZ Buchenwald betreute er Mithäftlinge medizinisch. Das brachte ihm den Beinamen „Arzt von Buchenwald ein“. Die israelische Gedenkstätte Yad Vashem ehrte Walter Krämer mit dem Titel „Gerechter unter den Völkern“.
Christian Trojans hat eine Computer Animation zu einer Wasserhebemaschine erstellt. Sie ist auf der Grundlage von Archivalien des
Wirtschaftsarchives in Dortmund am Beispiel der Wasserhebemaschine des
Bergwerks Guldenhardt / Dermbach (Bestand F 40 Wendener Hütte)konstruiert worden.
Im Dorfbuch Kaan – Marienborn, erschienen 1957 und verfasst vom bekannten Siegerländer Nationalsozialisten Lothar Irle finden sich auch drei Gedichte von Wilhelm Schmidt.
Auf Seite 104 bezeichnet Irle Schmidt als „..der prächtige Heimatdichter..“.
Gut bekannt waren beide sicher miteinander und Seilschaften innerhalb der
der Heimatszene hielten so manchen Sturm der Zeit aus.
Was sie heute vereint?
Nach beiden ist nun eine Straße benannt!
Ein klasse Heft – Frau Dr. Achingers Art. über die letzten Juden in Arfeld lohnt allein den Kauf, aber auch die anderen Art sind recht interessant und gut aufgearbeitet. Herr Dr. Lückel leistet echt gute Arbeit – besser als das Siegerländer Geschichtsheft! DANKE – und kauft es!!!!!!
„…. Die Printausgabe 324 Seiten, 9.99 € ist …. auch erhältlich. Über amazon und im Regionalen Buchhandel ( Hugendubel, Mayersche, Mankelmuth Weidenau, Kreuztal und Betzdorf, Braun in Neunkirchen, Bergbaumuseum Herdorf- Sassenroth….“
Frdl. Hinweis Achim Heinz via E-Mail v. 2.4.14
Ist dies eine öffentliche Veranstaltung, d.h. können interessierte Menschen ohne Voranmeldung teilnehmen? Vielen Dank für eine baldige Rückmeldung und freundliche Grüße.
M.W. ist dies eine öffentliche Veranstaltung. Ansprechpartner der Arbeitsgemeinschaft ist Gerhard Moisel, Haus der Kirche, Burgstr. 21, 57072 Siegen. Dort können Sie zur Sicherheit nachfragen.
Da ich leider nicht teilgenommen habe würde ich gerne wissen, ob der Vortrag zu einem späteren Zeitpunkt nochmal wiederholt wird. Vielen Dank und freundliche Grüße!
Dieser Artikel von Schmidt (W[ilhelm] Sch[midt]: Det Reise: Freaher – ho – on spärer, Siegerländer Heimatkalender 1964, S. 177-178) erschien bereits drei Jahre zuvor in: Aus dem Siegerland 11, 1961, H. 2, S. 4-5
Für mich als ortsunkundigen schwierig, aber ich tippe auf das Kreishaus Siegen-Wittgenstein. Architekt: Günter Reichert, 1974 wurde der Grundstein gelegt, offiziell eingeweiht wurde der Bau 1978. So, ich hoffe, dass ich da keinen Bock geschossen habe.
Oh, den Lösungsweg vergessen.
1. Google Bilder Suche um markante Hochhäuser in Siegen zu finden (habe mal auf Siegen getippt).
2. Am ehesten kam das Kreishaus hin.
3. Viele Fehlversuche in Google.
4. Auf slideshare was zu den Kreishäuser im Kreis Siegen-Wittgenstein gefunden.
5. Hoffentlich in der Eile richtig gelesen.
es ist ein Foto des Kreishauses. Da ich am 1.8.1977 meine Ausbildung zunächst im Ordnungsamt in Weidenau begonnen habe, bin ich einer der ersten Azubis gewesen, die im Mitte September 1977 bereits in das Kreishaus einziehen durften. Ich Landmädel in diesem großen Glaspalast in Siegen, ich bin immer sehr stolz darauf gewesen. Der Architekt war Herr Günter Reichert, der – so glaube ich- einen Architektenwettbewerb gewonnen hat.
Auch die Nachbearbeitung der Tagung in Stuttgart findet sich auf: http://archive20.hypotheses.org/ . Bilderimpressionen , Dokumentation der Tweets, Präsentationen und Volltexte sind bereits online.
Ich vermute, dass es nicht das Kreishaus in Siegen ist. Es sieht ihm zwar ähnlich, aber die Proportionen der beiden Schenkel der Fassade stimmen nicht.
Der Entwurf des Kreishauses Siegen wurde bei einem Bauvorhaben in Stuttgart ähnlich ausgeführt, wobei ich nicht weiß, welches Gebäude zuerst geplant wurde. Das Gebäude auf dem Foto scheint das damalige GENO-Haus bzw. das Gebäude der heutigen DZ-Bank in Stuttgart, Heilbronner Straße 41, zu sein. Hier stimmen auch die Proportionen mit dem obigen Bildausschnitt.
Architekten dieses Gebäudes waren Professor Walter Belz und Professor Hans Kammerer (http://www.geno-haus.de/372.aspx). Die offizielle Offizielle Einweihung war danach am 10. Mai 1973, erbaut wurde es in den Jahren davor. Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Hochh%C3%A4user_in_Stuttgart) gibt das Baujahr mit 1972 an.
Gratulation! Wer, wenn nicht Sie, sollte die Lösung ermitteln können.
Von den Baudaten spräche ja einiges für die These, dass der Stuttgarter Bau zuerst geplant wurde. Allerdings stellt sich nun auch die Frage, ob noch weitere Hochhäuser mit dieser Fassadengestaltung gebaut wurden.
Eine Evaluierung und Aktualisierung des ArchivG NRW halte ich für angebracht. Allein der § 7 (7) zeigt die anachronistische Sichtweise, wenn geregelt wird: „Das Landesarchiv kann in besonders begründeten Fällen auf Antrag nach Ablauf der Schutzfristen die Überlassung von Vervielfältigungen von Archivgut an Archive, Museen und Forschungsstellen zulassen.“
Dies widerspricht der Open Data und Open Access Idee, verhindert die Zusammenarbeit mit historischen oder genealogischen Vereinen und negiert die Existenz von Digitalisaten.
Der Open Data Grundsatz muss in das ArchivG NRW einfließen.
Archivalia verweist und kommentiert die „Regelungen über den Zugang für Wissenschaft und Forschung zum Archivgut der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in der Bundesrepublik Deutschland und des Deutschen Rundfunkarchivs „
Ich würde sagen, dass das eine Legende für eine Liste, Karte oder für Aktenbestände ist, die eine Mitgliedschaft in (oder die räumliche Zuständigkeit von) Knappschaftsvereinen oder Knappschaftspensionkassen angibt. Es gab einen Rheinischen Knappschaftsverein, einen Heller Knappschaftsverein, einen in Brilon, einen in Müsen etc. „Beamten“ sind die heutigen Angestellten.
Alternativ könnte es auch was mit Vereinsfarben oder einem Element der Knappenuniformen zu tun haben, aber da kenne ich mich leider gar nicht aus…
Bitte um Pardon für meine Scherzantwort oben, aber ich habe derlei noch nicht gesehen. Ich kann mir nur etwas wie eine – optische – Kennzeichnung durch Farben (vielleicht von Ablagen im Regal? Farbige Deckel/Kästen o.ä.?) vorstellen, für die das Abgebildete so etwas wie eine Art Legende ist?
In Büros und Kanzleien machen sie solche farbigen Kennungen von Ordnern manchmal. Die Farben scheinen in einer Art Zickzackkurs „anzuschließen“? Jedenfalls irgendetwas „Räumliches“, auch wohl älter (die Schrift ist bemühte ältliche Schönschrift…)
Nur eine Vermutung: Es geht um Akten der Bergämter bzw. -Reviere, die ja teilweise aufgelöst und neu zugeordnet wurden? Es gab Bergreviere in Hellertal, Arnsberg, Müsen und in Brilon ein Oberbergamt, daher die Beamten ;-) Und Deutz-Ründeroth habe ich auch gefunden
Sonst bleibt mir nur noch die Eisenbahn, aber da passt Müsen überhaupt nicht rein. Nettes Rätsel! Hab ich wieder viel über unser NRW gelernt :-)
Die Bezeichnungen lassen auf eine organisatorische gebietliche Unterteilung schließen. Beamtenabteilungen gab es unter anderem auch zu Zeiten der NSDAP.
Die farbliche Kennzeichnung lässt den Schluss zu, dass es sich hierbei um eine Anordnung/Reihenfolge und/oder Zuständigkeitsbereiche handelt. (Postverteiler, Schriftverkehr etc.)
Oh, hätt ich gar nicht gedacht. Aber wir wissen nun immer noch nicht so recht, was es genau erklärt: Reiter, Tabs, Ordnerrücken? Gibt es ein Foto dessen, was da in der Legende schematisch dargestellt wird?
Die Tafel beschreibt der farbliche Kennzeichnung der Amtsbücher: „Farbe ist das erste sichtbare Unterscheidungsmerkmal in der Registratur.“ (kommerzieller Link: http://www.zippelag.de/registraturlexikon-zippel.html
Nach erneuter Recherche im Internet (Berg- und Hüttenmännische Zeitschrift)handelt es sich wohl um Knappschaftsvereine (Krankassen/Pensionskassen) der hiesigen Region unter Bezugnahme deren geographischer Zusammengehörigkeit.
Na denn mal GLÜCK AUF !!!
Über den Quellenwert solcher aus vielen disparaten Vorlagen kompilierten „Biographien“ muss man sich keine Illusionen machen. „Bauschule in Siegen“ z.B. ergibt für einen jungen Mann, der im 19. Jahrhundert Architekt werden wollte, wenig Sinn. Etwas anderes als die „Wiesenbauschule“ kann man sich darunter kaum vorstellen, und in deren Schülerverzeichnis taucht Carl David Neuburger erwartungsgemäß nicht auf (lediglich ein Fritz Neuburger, geb. 12.4.1877 in Siegen, am 25.7.1891 ohne Abschluß ausgeschieden). In dem als Referenzwerk genannten Allgemeinen Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart („Thieme/Becker [Bd.] 25 [S.] 404“) findet sich der zusätzliche Hinweis „studierte in Berlin“, was auf die dortige „Königlich preußische Bauakademie“ schließen läßt. Wo Neuburger den für ein Architekturstudium mindestens erforderlichen Realschulabschluß erworben hatte, ist unklar, in Siegen jedenfalls nicht (sofern die Schülerlisten bei Kruse, Geschichte des höheren Schulwesens … 1936 verläßlich sind).
P.K.
Vielen Dank für die Hinweise! Könnten die spärlichen Funde darin begründet sein, dass Neuburger kein Architekt, sondern Baumeister war – s. Wikipedia-Eintrag? Dafür hätte er wohl nur eine (Bau-)Gewerbeschule besuchen müssen, die es wohl in Siegen gegeben haben wird – auch dies ist also noch zu überprüfen …..
M. E. ist es erstaunlich, dass Neuburger in der regionalen, biographischen Literatur nicht erwähnt wird, die doch normalerweise auf jeden Siegerländer hinweist, der es in der „Fremde“ zu etwas gebracht hat.
In der Tat war in Siegen 1858 eine städtische „Baugewerkschule“ (Fortbildungsschule für Bauhandwerker) eröffnet worden. Die könnte also der Maurer-Sohn Neuburger besucht haben. Ob ihn das zum „Baumeister“ qualifizierte, lassen wir erstmal offen. Als „Architekt“ führt ihn das zitierte Künstlerlexikon, was an eine Zusatzausbildung (vielleicht das Studium in Berlin) denken läßt. Wegen der umfangreichen Kriegsverluste bin ich, was die Überlieferung der Bauakademie angeht, nicht sehr optimistisch, aber Sie können ja mal im Archiv der TU Berlin nach den alten Matrikeln fragen.
Übrigens fehlen im digitalisierten DBBL, soweit ich sehe, die Seiten 903-927 mit den Quellenangaben (oder ich bin zu blöd, um sie dort zu finden). Die im Eintrag zu Neuburger angegebenen Siglen bedeuten: Wilhelm Neumann, Lexikon baltischer Künstler, Riga 1908; Bernhard Becker, Aus der Bauthätigkeit Rigas und dessen Umgebung in der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts, Riga 1898; Thieme/Becker siehe oben; Rigascher Almanach 44 (1901).
P.K.
In der Bibliographie zur baltischen Bau- und Kunstgeschichte 1939-1981, Berlin 1984, ist nichts auf Neuburger und seine Tätigkeit in Riga Bezügliches zu finden.
In Daina L?ce, Pirmais R?gas pils?tas arhitekts Johans Daniels Felsko (1813–1902), Riga 2012, findet sich der Hinweis (S. 323) auf ein Grundriss des Rigaer Doms von Karl Neuburger im Historischen Staatsarchiv Lettlands.
Bei weiteren Recherchen müßte auch die lettisierte Namensform „Karls Neiburgers“ beachtet werden (das „i“ ist kein Tippfehler). Z.B. liefert die Anfrage „Neiburgers Riga“ bei Google Books ein paar möglicherweise interessante Treffer (Snippets), denen der architekturbegeisterte Kreisarchivar vielleicht nachgehen möchte.
Die Eingringungsrede der Kultusministerin wurde gerade zu Protokoll gegeben und der Entwurf eiinstimmig in den Kulturausschuss überwiesen. Die Volksvertreter wollen wohl nur noch nach Hause ……
Zu 1) meine Studie unternimmt erste Schritte in die Richtung, Klanglandschaften und Geräuschkulissen für städtische Räume zu untersuchen. Siegen, Weidenau und Geisweid (Gde Hüttental) sind seit dem frühen 20 Jhd. hochindustrialisierte Ort, in welchen die Stahl- und Metallverabeitenden Betriebe prägend sind. Untersuchung über eher ländlich strukturierte Räume vergleichbar dem Siegerland oder dem Wittgensteiner Raum gibt es meines Wissens nach nicht. Hinsichtlich des Straßenverkehrlärms würde ich erwarten, dass dieser im Vorfeld der Errichtung der Hüttental-Straße von seiten des NRW-Verkehrsministeriums untersucht, gemessen und begutachtet wurde.
2) Gewerbeaufsichtsamt (Regierungspräsidium), Stadtausschuss zur Genehmigung gewerblicher Anlagen, Verkehrsbetriebe, Gesundheitsamt, Bau-, Verkehrs und Gewerbepolizei etc., Tiefbauamt, Städtische Betrieb/Elektrizitätswerk etc.
3) Diejenigen, die noch in den städtischen Ämter lagerten. Das sind für Essen noch ziemlich viele.
4) Auf jeden Fall würde ich eine aktive Dokumentation von Sound-Landschaften befürworten? Da ließen sich sicherlich spannende Projekte mit den unterschiedlichen Studiengängen der Universität Siegen und dem Kreisarchiv bzw. der lokalen Wirtschaft entwickeln.
Mein Kontakt:
Dr. Heiner Stahl
Lehrkraft für besondere Aufgaben (LfbA)
Neuere und Neueste Geschichte/ Europäische Zeitgeschichte seit 1945
Universität Siegen
Philosophische Fakultät
Historisches Seminar
Raum: AR B 2110
Adolf-Reichwein-Str. 2
57068 Siegen
Laienhafte Frage: Wie verträgt es sich mit dem Naturschutz-Status der Halde, dass anscheinend „ein Recycling der Schlacke unter Berücksichtigung fortschreitender Technik“ erwogen wird?
P.K.
Ich vermute, dass das Arnsberger Verwaltungsgericht lediglich die denkmalschutzrechtlichen Aspekte geprüft hat. Falls ein Objekt aus denkmalrechtlicher Sicht zweifelhaft ist, so spielen die wirtschaftlichen Verwertungsmöglichkeiten des Eigentümers eine wohl zu beachtende Rolle. Dies steht jedoch, wie Sie richtig bemerken, im Gegensatz zum geltenden Naturschutz für die Halde. Leider bin ich allerdings ebenfalls kein Jurist, der eine belastbarere Aussage treffen könnte, und kann nur hoffen, dass dieser Fall höchstrichterlich entschieden wird.
Übrigens am 23.7. um 17:00 findet eine Natur- und pflanzenkundliche Führung „Monte Schlacko – botanisch gesehen“ des Naturschutzbund (NABU) Siegen-Wittgenstein (Leitung: G. Rinder, C. Kosch, N.N) – Treff: Sackgasse der Haardter Berg Straße nördlich der Universität Siegen. Quelle: http://www.biologische-station-siegen-wittgenstein.de/cms/upload/bilder/downloads/prog_2014_a6quer_140228web.pdf, S. 60.
Einbringungrede zum Archivgestz NRW ist online:
„Wertvolles, unersetzliches Archivgut zu bewahren und die entsprechenden Nutzungsmöglichkeiten sicherzustellen, ist für die Landesregierung eine sehr wichtige Aufgabe. Ihr kommt in Nordrhein-Westfalen ein verfassungsrechtlicher Rang zu.
Der Verfassungsauftrag richtet sich dabei gleichermaßen an Land, Gemeinden und Gemeindeverbände. Um ihn zu erfüllen, ist eine gesetzliche Regelung unverzichtbar.
Alle Bundesländer und der Bund haben daher Archivgesetze verabschiedet. Das nordrhein-westfälische Archivgesetz vom 16. März 2010 tritt am 30. September 2014 außer Kraft. Die Befristung war Anlass, das 2010 weitgehend neu gefasste Gesetz auf seine Tauglichkeit und auf eventuell notwendige Änderungen hin zu überprüfen.
Von den Fachleuten in den Archiven wurden nur wenige Änderungen vorgeschlagen. Das hat die Einschätzung der Landesregierung bestätigt, dass sich das geltende Archivgesetz bewährt hat. Auch außerhalb Nordrhein-Westfalens gilt es als modern und zukunftsfähig.
Vor allem zwei inhaltliche Änderungen sind nach Auswertung der fachlichen Rückmeldungen vorgesehen:
Erstens. Mit Blick auf die Archivierung digitaler Unterlagen ist eine Erweiterung des Aufgabenspektrums für das Landesarchiv vorgesehen.
So soll auch anderen staatlichen und kommunalen Kultur- und Gedächtniseinrichtungen die Nutzung eines sogenannten „Speicherknotens“ des Landesarchivs ermöglicht werden.
Zweitens. Auf Wunsch der kommunalen Familie sollen Regelungen, die bisher nur für das Landesarchiv Gültigkeit haben, auf die kommunalen Archive übertragen werden.
Das betrifft unter anderem die Mitwirkung bei der Feststellung von Austauschformaten zur Archivierung elektronischer Dokumente – oder die Einbindung der kommunalen Archive, wenn es um die Planung und Einführung beziehungsweise Veränderung von IT-Systemen geht.
Außerdem sollten auch die Kommunalarchive – wie jetzt schon das Landesarchiv – das Recht haben, Unterlagen bereits in den Verwaltungen einsehen und so auf ihre Archivwürdigkeit prüfen zu können.
Mit diesen wenigen Änderungen wird Nordrhein-Westfalen auch weiterhin über ein praxistaugliches Archivgesetz verfügen: über eine gute gesetzliche Grundlage, die es dem Landesarchiv und den kommunalen Archiven erlaubt, ihre wichtigen Aufgaben auch in Zukunft fachgerecht wahrzunehmen“
Link: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMP16-58.html#_Toc388036353
„Hexenjäger“ – „Hainchens bedeutender Sohn“.
Ein Beispiel dafür, wie blind die Lokalgeschichtsschreibung gegenüber anderweitiger Regional- und Landesgeschichte ist.
1) Es handelt sich um einen „Archivschrank“.
2) Die Kamera wurde an die Stirnseite des Schranks aufgelegt und das Objektiv zeigte in Richtung Decke. Durch digitale Bildbearbeitung wurden die Farben invertiert und/oder andere Filter benutzt.
Lösungsweg: Derartige Schränke kamen mir aus dem jüngst erschienenen Blogeintrag über eine „Nacht im Archiv“ bekannt vor.
1) Regal und kein Schrank!
2) Kamera ist auch richtig – und war auch nicht so schwer ;-).
3) Programmname ist eigentlich unerheblich, aber was habe ich mit dem Bild genau gemacht. Einen Hinweis kann man auf den Web 2.0-Kanälen von siwiarchiv finden, dann muss man nur noch etwas googlen – oder man kann es selber ausprobieren ;-)
Damit das Ganze nicht noch alberner wird, sollte sich jemand anderes über das kleine Präsent freuen :-). Mit freundlichen Grüßen und einen schönen Feiertag wünschend…
Hallo Zusammen! Haben am vergangenen Sonntag versucht,den neuen Pfad zu wandern. Jedoch OHNE ein Wanderzeichen und Ortskenntnis war dieses schlecht möglich. Wie kann man einen so schönen Weg einweihen ohne an eine Ausschilderung zu denken. Mfg M. Affholderbach Bitte um Rückmeldung
Wandern Sie statt dessen auf dem Fachwerkwanderweg
„Wilder Mann“ in und um Freudenberg. Natürlich gibt es dort eine Beschilderung. Wie wäre es mit Pfingsten? Ich empfehle anschließende Waffeln mit Kirschen im Weinhaus „Zum Knoten“!
Der aktuelle Stand der Petition lautet 592 Mitzeichnende, davon 316 aus NRW. Auch aus dem Kreisgebiet haben schon erfreulich viele diese Petition unterschrieben. Vielen Dank!
Auflösung des Vatertagsrätsels:
1) Es handelt sich um eine Regalwand der Rollregalanlage des Kreisarchivs Siegen-Wittgenstein.
2) Das bearbeitete Bild befindet sich mit dem Titel „Archive like Ruff“ auf dem Flickr-Account von siwiarchiv. Es verweist auf den deutschen Fotografen Thomas Ruff, ein Schüler der Siegerländer Fotografen Bernd und Hilla Becher. Ruff beschrieb das Vorgehen für seine aktuelle Ausstellung in Gent. Er „nutzt historische Fotografien unterschiedlichster Herkunft und Genres. „Historische Fotografien besitzen in der Regel eine braune Patina. Wenn man diese Fotografien ins Negative dreht, entsteht ein schöner Blauton, den ich übernommen habe.“
So musste das s/w-Bild nur mit der Bildbearbeitung in ein Sepia-Bild umgewandelt werden, dann davon das Negativbild erstellt werden.
1.: Wassermühle
2.: bei Salchendorf / Netphen 1930
3.:“Fotograf nicht überliefert“ (LWL)
Die Google-Bildersuche führt schnell zum Ziel, d.h. zum LWL-Bildarchiv.
Siehe dort: http://www.lwl.org/marsLWL/pic/7371
Aber irgendein Haar in der Suppe wird es wohl noch geben, sonst wäre es ja zu leicht gewesen.
P.K.
Ich glaube auch nicht, dass man über eine zweite Mühle nachdenken muß. „Bei Salchendorf“ in der LWL-Bildbeschreibung ist eine sinnvolle Angabe zur Lage der Helgersdorfer Mühle gewesen. Salchendorf war von der Einwohner- bzw. Häuserzahl her mindestens zehnmal größer als das benachbarte Helgersdörfchen und deshalb als Orientierungshinweis in einer Fotosammlung besser geeignet, wenn diese nicht ausgesprochen wissenschaftlichen Zwecken dienen sollte. Wegen der Datierung und des Fotografen müßte man beim Landschaftverband anfragen, wie authentisch dessen Angaben sind und ob dort evtl. Korrekturbedarf besteht. Sollte es sich um einen Fehler handeln, wären davon möglicherweise noch andere Aufnahmen der Siegerländer Bildreihe betroffen.
Ist die genau Lage der ehemaligen Mühle eigentlich bekannt? Falls das Haus nicht mehr stehen sollte, könnte vielleicht noch die kleine Brücke (am linken Bildrand) weiterhelfen. (Da ich zu den zukunftslosen nicht-motorisierten Deppen gehöre, kann ich nicht selbst hinfahren und suchen.)
P.K:
Zur genaueren Erforschung dieser „Auswanderwelle“ scheint es ratsam folgende Akten des Bestandes „Kreis Siegen, Landratsamt (alt)“ auszuwerten:
1) Nr. 114 Auswanderungen, 1910-1929
2) Nr. 115 Auswanderungen und Auswanderagenten, 1921-1932
3) Nr. 116 Nachforschungen nach ausgewanderten Personen, Todesnachrichten, 1925-1932
4) Nr. 1207 Polizeiliches Meldewesen, 1898-1931
Eine kurze Beschreibung der 1812 „an den Meistbietenden“ zum Verkauf stehenden Mühle:
„Die herrschaftliche Mahlmühle zu Helgersdorf hat einen oberschlächtigen Mahlgang, ist 2stöckig unten massiv, im 2ten Stock von Holz erbauet, und nebst dem ihr angebauten Eishause mit Stroh gedeckt. Sie enthält eine kleine heitzbare Stube für einen Müllerknecht. Die Grundfläche ist 4 1/2 Ruthe groß. Überdem gehört dazu ein kleiner obig der Mühle gelegener Weiher. Die Taxe beträgt 309 Fr. und das Brand-Assecuranz Quantum 290 fl.“
Zeitung des Großherzogthums Frankfurt, Beilage zu Nr. 116 vom 25.4.1812, letzte (ungezählte) Seite, rechte Spalte oben; Zugang via Google books.
(Außerdem sollten „im Canton Netphen“ die Mühle Irmgarteichen und das Schloß Hainchen verkauft werden.)
P.K.
Jetzt online: Dokumentation zur Fachtagung „Erinnern für die Zukunft“*** Mehr als 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten am 21. Mai 2014 beispielhafte Einblicke in Projekte aus Bildungspartnerschaften von Gedenkstätten und Schulen und erörterten die Frage, wie das Erinnern in der Einwanderungsgesellschaft anschlussfähig gestaltet werden kann. Die Dokumentation zur Veranstaltung finden Sie hier: http://www.medienberatung.schulministerium.nrw.de/Medienberatung/Dokumentationen/2014/04-Fachtagung-Gedenkst%C3%A4tten.html
Eine ganz andere Form von Sounds werden in der heutigen Ausgabe der ZEIT (Nr. 27 vom 26.6.2014, S. 16) beschrieben: Wie hörte sich das Abspielen von Aufnahmen auf einem Kassettenrekorder an? „Nichts läuft mehr, Der tonlose Abschied von der Kompaktkassette“ von CST in der Rubrik „Der Klang der Zeit“. Diese Kolumne soll nun zweiwöchentlich erscheinen.
“ …. Das Blog siwiarchiv stelle eine gute und ressourcenschonende Möglichkeit für die Archive im Kreis Siegen-Wittgenstein zur archivischen Öffentlchkeitsarbeit dar. …..“ – so Thomas Krämer in der Ergebnissicherung der Sektions zu kooperativen Web 2.0 Anwendungen im Archiv.
Monika Marner fasste den Beitrag zusammen.
Tatsächlich fasste eine Kollegin / ein Kollege aus dem Blogger-Team den Beitrag zusammen, hat aber offensichtlich vergessen, sich mit der eigenen Kennung anzumelden. Da ich selbst auf dem Podium war und nicht die Gabe der Bilokalität besitze, habe ich zu den Sektionen 5 und 6 nicht gebloggt. ;-)
Zum gegenwärtigen Projektstand s. Westfälische Rundschau, 27.6.2014: “ …. Zwar zeigte sich Wortelkamp auskunftsfreudiger, den Start der Bauarbeiten kennt er allerdings auch nicht, aber: Die Verantwortlichen seitens der Klinik hätten von der zweiten Augusthälfte gesprochen.
„Meine Unterlagen sind beim Kreisklinikum“, betonte er. Wenn die Krankenhausleitung sage, es geht los, könnten die Arbeiten starten. „An mir wird es nicht liegen.“ Detailfragen zwischen Klinik und Künstler seien weitgehend geklärt. Er sprach von einem Lichtmast und einem Parkschein-Automaten. Beides müsste versetzt werden. Zudem stehe ein Verteilerkasten im Weg. ….“
1) Wer bin ich?
Paul Kanstein, * 31. Mai 1899 in Schwarzenau (Bad Berleburg); † 7. September 1981 in St. Wolfgang (Sterbedatum nicht genau bekannt)
2) Welche gefährliche Situation ist gemeint?
Verhaftet wegen des engeren Kontaktes zu den Drahtziehern des Hitlerattentates am 20.07.1944. Freilassung.
3) Wer war der “Königsberger Freund”?
Fritz-Dietlof Graf von der Schulenburg, * 5. September 1902 in London; † 10. August 1944 in Berlin-Plötzensee
1933 waren beide in Königsberg „beschäftigt“ und traten in etwa zur selben Zeit der NSDAP bei. Schulenburg gehörte später der Widerstandsbewegung an und plante die Operation Walküre mit.
Lösungsweg:
Die erste Suche führte über die „Königsberger Tage“ zum Ort Königsberg und die Schlacht um Königsberg. Der erste Ansatz war Elisabeth Gräfin von Bassewitz (1899–1980), hier fehlte jedoch ein Zusammenhang zu Wittgenstein und dem „Freund“.
Im zweiten Versuch mit den Begriffen Königsberg und Dänemark, verbunden mit dem Geburts- und Sterbedatum fiel ein Treffer auf Paul Kanstein.
Der Rest ergab sich dann aus dem Biographieausschnitt bei Wikipedia.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Kanstein)
Klaus Graf hat dieses Rätsel als Erster richtig gelöst. Gratulation! Wegen des Gewinns werde ich mich via E-Mail melden.
Eigentlich hatte ich den Hinweis auf die regionale Literatur erhofft: Elisabeth Strautz: Paul Kanstein – ein Mann, der “ … den Persönlichkeiten des 20. Juli freundschaftlich verbunden war, ihre Ziele gebilligt und zumindestens moralisch unterstützt hatte“, in Siegener Beiträge. Jahrbuch für regionale Geschichte 9 (2004), S. 207-210.
An dieser Stelle verweise ich auch auf die online verfügbaren Zeugenaussagen Kansteins im Archivs des Instituts für Zeitgeschichte (ZS 552): http://www.ifz-muenchen.de/archiv/zs/zs-0552.pdf .
Zur verspäteten Freischaltung des Gewinners s. http://archiv.twoday.net/stories/910175680/ und http://archiv.twoday.net/stories/909746123/
In Siegen wurde 1577 ein Junge geboren, der nur sehr kurz in dieser Stadt wohnte, wahrscheinlich wusste er gar nicht, dass er dort geboren wurde.
Heute schmückt sich die Stadt Siegen mit diesem Menschen bei jeder Möglichkeit. Eine Straße, ein Gymnasium ein Kunstpreis ist nach ihm benannt.
Die Stadt ist stolz auf ihren „Sohn“. Eigentlich verbindet diesen Jungen nicht mehr mit Siegen als Ernst Bieberstein mit Hilchenbach.
Der eine hat ein positives Image das der Geburtsort gerne übernommen hat, der andere ein negatives, das der Geburtsort gerne ablegen würde.
Dennoch bleibt Hilchenbach sein Geburtsort.
Zu Raimund Hellwigs Aufsatz zu dem Obersdorfer Wilhelm Schmidt:
Es ist sicher eine Überraschung, dass die Zeitschrift sich einmal für ein Thema öffnet, dass die regionale NS-Geschichte berührt. Wie diese Neuerung zu verstehen sein könnte, möchte ich hier gar nicht ansprechen, auch wenn sie es wert wäre. Mir geht es um ein paar sachliche Fehler in Hellwigs Aufsatz, die mir beim ersten Lesen in den Blick fielen:
– Hellwig nennt als Freund von Wilhelm Schmidt den Hilchenbacher Fritz Forschepiepe. Der wurde aber nicht, wie Hellwig schreibt, im Zuge der „Gleichschaltung“ aus dem Deutschen Jugendherbergswerk herausgedrängt. Der war Lehrer, Mitglied der NSDAP und zeitweise Blockleiter. Mit dem DJH hatte er nichts zu tun. Der Herausgedrängte war dessen Bruder Hermann Forschepiepe.
– Er beschreibt die Zusammenarbeit zwischen Schmidt und dem Heimatdichter und Lehrer Adolf Wurmbach. Dabei beruft Hellwig sich auf eine Schrift „Erich Koch, Adolf Wurmbach, Selbstverlag“. Verfasser und Titel gibt es nicht. Mag sein, Hellwig meinte den protestantischen Pfarrer Erich Schmidt. Der schrieb
a) „Deuter der Heimat – Mahner der Zeit. 15. Juli 1891 – 17. Januar 1968. Zur Erinnerung an seinen Geburtstag vor 100 Jahren. Ein Büchlein gegen das Vergessen“, 1991 erschienen im Verlag der Wielandschmiede in Kreuztal und
b) „Adolf Wurmbach als Pazifist. Das totgeschwiegene Jahrzehnt“, das leider nie erschien, sondern Manuskript blieb.
– Schmidt verschweigt bei aller Verehrung von Wurmbach nicht, dass dieser vor der Konversion zum Pazifisten 1924 einer der zeittypischen Chauvinisten war. Zwar wurde er 1934 zwangsweise in den mit Ruhegehalt ausgestatteten Ruhestand versetzt, aber seit 1938 gab es mit Unterstützung aus NSDAP und Gestapo Bemühungen zur Wiedereinstellung, die auch erfolgreich waren. Wurmbach wurde vollständig rehabilitiert. Bitte mal in die Entnazifizierungsakte gucken! Im Nationalsozialismus kehrte Wurmbach dorthin zurück, wo er 1924 unterbrochen hatte, um nach 1945 erneut Pazifist zu sein.
– Hellwig: Wurmbach sei „alles andere als lininentreu“ gewesen. Ach? Wurmbach war der klassische Wendehals. Im NS veröffentlichte er laufend in den regionalen Medien, vor allem aber in der National-Zeitung der NSDAP völkische und auch kriegspropagandistische Texte, oft in einem der „großen Zeit“ angepassten germanisierenden Duktus. Wurmbach und Schmidt passten, auf andere Weise als Hellwig suggeriert, gut zusammen, obwohl der erste der NSDAP nicht beitrat: „Mit ihren Leibern schirmen der Besten viel/Und heißem Herzen Marken und Heimstatt dir,/Damit sie leben oder sterben -/Segne der Himmel den Schwur! – für Deutschland.“ (Wurmbach, zum Kriegsbeginn 1939).
Raimund Hellwigs Beitrag verdient gewiss eine grundsätzlichere Reaktion als nur die Korrektur einiger seiner sachlichen Fehler. Soviel sei aber doch schon auf die Schnelle einmal mitgeteilt.
Der Artikel „Die späte Entnazifizierung des Wilhelm Schmidt“ von Raimund Hellwig findet sich im „Siegerland“ Heft 1 (2014), Seite 156-163, und eine erste Stellungnahme dazu findet sich hier: http://www.siwiarchiv.de/?p=7428#comments .
Gestern ging ich in meinem Beitrag zu Raimund Hellwigs Aufsatz Über „Die späte Entnazifizierung des Wilhelm Schmidt aus Obersdorf darauf ein, dass er Literatur einsetzte, die es nicht gibt und dass er Wilhelm Schmidt mit NS-Gegnern freundschaftlich verband, die es nicht gab, um den NS-Kritiker auch in Schmidt zu suggerieren.
Heute zunächst noch einmal zu formalen Mängeln.
Abgesehen davon, dass der ganz überwiegende Teil von Hellwigs inhaltlichen Aussagen bei mageren 17 Fußnoten unbelegt bleibt, ist das, was Fußnoteninhalt sein soll, durchweg ungeeignet, etwas zu belegen. Sei es,
– dass der Literaturangabe mindestens die Seitenangabe, aber zusätzlich vielleicht auch Verfasser, Erscheinungsort und Jahr fehlen (FN 7, 10, 11, 12, 13, 14),
– dass ein als „Nekrolog“ ausgewiesener, in eine Fußnote gesetzter Auszug aus einem Personenlexikon kein bisschen Nekrolog enthält (FN 11),
– dass der archivalische Ort komplett fehlt (FN 15),
– dass die Anmerkung die Aussage nur fortführt, ohne aber auf irgendeine Quelle zu verweisen (FN 6, 9, 16),
– dass die Aussage nicht belegen kann, weil die für NSDAP-Amtsträgernamen in den als Quelle pauschal angegebenen „Siegerländer Adressbücher“ Namen gar nicht enthalten oder nur solche der höheren Hierarchieebenen (FN 4) oder weil die genannte Literatur überhaupt nicht existiert (FN 8) oder
– dass ein Hauptstaatsarchiv Düsseldorf inzwischen nicht mehr existiert (FN 3).
Hellwig ruft mit dieser Arbeitsweise die von ihm verantwortete Neuauflage der älteren Schrift „Siegen unter dem Hakenkreuz“ von 2011 in Erinnerung. Der Rezensent Alexander Hesse stellte damals fest, dass die Fülle der Fehler enthülle, „dass der Text nicht nur schludrig geschrieben, sondern auch nie gründlich Korrektur gelesen wurde“. Damit fällt die mangelhafte bis ungenügende Form, die kräftig ins Inhaltliche durchschlägt, auf die Zeitschrift „Siegerland“ zurück, die das zuließ.
Was den Umgang mit Inhalten angeht, beschränke ich mich hier auf zwei Punkte:
1. Hellwig spricht von einer „völkischen Grundhaltung“ vieler westfälischer Heimatdichter, auch Schmidts „Oeuvre“ „völkisch angehaucht“. Das sehen die Schmidt-Kritiker auch so, meinen aber etwas anderes, denn zugleich bemerkt Hellwig, „von Wilhelm Schmidt sind politische Äußerungen nicht überliefert“. Der Leser darf demnach meinen, „völkisch“ sei so was wie „volkstümlich“, „besonders volks- und heimatverbunden“, habe aber jedenfalls nichts mit Politik zu tun. Dem ist nicht so, wenn Schmidt das „Ererbte“ dem „Fortschrittsgeist“ gegenüberstellt, Franzosen und „Tommies“ vor Übergriffen auf „deutsche Heimaterde“ warnt, in der die Geschichte „wurzele“ bzw. in die Wurzeln zu versenken seien, die „heilig“ ist und „Treue der angestammten Art“ gegenüber einfordert, zumal man „mit liebendem Herzen am Großdeutschen Reich“ baue usw.
Hellwig sollte sich vor Eintritt ins Thema erkundigt haben, was mit dem in der Diskussion um westfälische Heimatdichter zentralen Begriff des „Völkischen“ und auch mit „Völkischer Bewegung“ gemeint ist.
Dazu zwei Handbuchartikel: Günter Hartung, Völkische Ideologie, in: Uwe Puschner,Walter Schmitz,Justus H. Ulbricht (Hrsg.), Handbuch zur „Völkischen Bewegung“ 1871-1918, München/New Providence/London Paris 1996, S. 22-41, und Hellmuth Auerbach, Völkische Bewegung, in: Wolfgang Benz, Hermann Graml und Hermann Weiß herausgegebenen Enzyklopädie des Nationalsozialismus, Stuttgart 1997, S. 784.
Hartung: „…’völkisch’ hatte im allgemeinen Gebrauch bereits am Ende der Weimarer Republik seine neutrale Bedeutung fast völlig eingebüßt. … der Große Brockhaus (definierte) … ‚Verdeutschung des Wortes ‚National’ im Sinne eines auf dem Rassegedanken begründeten und daher entschieden antisemitischen Nationalismus.“ (S. 24)
Auerbach: „Der V[ölkischen Bewegung]. Liegen drei Hauptkomponenten zugrunde, die … nach dem Ersten Weltkrieg ins Extreme getrieben wurden: 1. die sozialdarwinistische Vorstellung vom ‚Kampf ums Dasein’, in dem sich der Starke, Wertvolle durchsetzt; 2. damit verbunden die Notwendigkeit eines Kampfes um Lebensraum für das germanische dt. Volk, v. a. im Osten Europas; 3. ein ‚rassisch’ begründeter Antisemitismus.“
2. An keiner Stelle findet sich nach Hellwig bei Schmidt Antisemitismus. Das Gedicht „De Gummizitt“, das Schmidt der „nationalen Revolution 1933“ verehrte, spreche an keiner Stelle von der „Gummizeit“ als von einer „verjudeten Republik“. Hellwig scheint nicht geläufig zu sein, dass dort wo Antisemitismus gut verwurzelt ist, nicht ständig explizit von Juden die Rede sein muss, wenn Juden gemeint sind. Die sind nämlich auch so leicht zu erkennen/zu benennen.
1886 war in der antisemitischen Tageszeitung Siegerländer Volksfreund in einer „Volkserzählung“ die Rede von einem „dicken Herrn, aber mit nicht ganz geraden Füßen und einer dicken goldenen Uhrkette“. Oder 1892 von einem Ignatz Barteck, vermutlich, aber unbeweisbar „wucherische Geschäfte“ betreibend. Moral sei, so dieser „Ignatz“, „ein Ding wie ein Gummiband“. Man könne „heutzutage“ alles machen, wenn man dafür nur eine unschuldige Form finde. Lernen könne man das nicht. Man müsse „das Talent dazu im Blute haben“.
Dergleichen konnten die Siegerländer generationenlang lesen, das übt sich. Der Antisemtismusforscher Wolfgang Benz spricht von „Bildern in den Köpfen, die als abrufbare Codes funktionieren“ (Wolfgang Benz, Bilder vom Juden. Studien zum alltäglichen Antisemitsmus, München 2001, S. 11). Er ist auch überzeugt, der „antisemitische Code“ (Shulamit Volkov) lebe fort.
Jedenfalls dürfte er 1933 das Erkennen umstandslos ermöglicht haben, wenn es in der „Gummizeit“ z. B. hieß „Gummili hah och en Gott/deam sie deen beat Herz on Leppe/amer dä dm Socher sech/offenbart als Foererkreppe“ und die Aufforderung „Awer weg vahm ditsche Geist!/Ruß uß ohse ditsche Mensche!“ folgte.
Wobei zu sehen ist, dass für viele Antisemiten „die Definition über das ‚Blut’ … sekundär mit der des ‚jüdischen Geistes’ verbunden“ war, „als Herrschaftsinstrument des Judentums“ (Werner Bergmann in der Enzyklopädie des NS, S. 366). Das hätte Schmidt sicher nicht so geschrieben, verstanden hätte er den Satz sicher.
Mit ein wenig Aufwand müsste es dem Verfasser möglich gewesen sein, sich zu Themen kundig zu machen, zu denen er dann schrieb, ohne auch nur ein Grundwissen zu haben. Offenbar war – ungeachtet des Faktors Bequemlichkeit – anderes wichtiger als Kompetenz in der Sache. Darauf wird noch weiter einzugehen sein.
Im Berliner Bundesarchiv finden sich zu Neuhaus in den Beständen des ehemaligen BDC:
NSDAP-Gaukarteikarte
Karteikarte NS-Lehrerbund
Akte Parteikorrespondenz
Akte SS-Führerpersonalunterlagen
Akte Rasse- und Siedlungshauptamt-SS
Darüber hinaus liegt hier eine Akte aus dem Bestand Präsidialkanzlei unter der Signatur R 601/2077 – Laufzeit 1940 – vor. Es handelt sich konkret um einen Ernennungs-Vorschlag des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung. (lt. E-Mail v. 28.7.2014, Az.: Az.: 1002/K-156)
Eigentlich kann es nur die Endung „-fe“ sein, weil es keine lokale Kombination von Ednungen im Kreisgebiet und Lage der Orte entsprechend des Musterbildes gibt.
Aber die Zahl der bundesweiten Treffer stimmt nicht überein, es gibt bundesweit 94 Treffer. Wenn man die Endung auf „-nfe“ erweitert, gibt es sogar nur 2 Treffer in unserem Kreis und die Buchstabenzahl passt nicht in den schwarzen Balken des Musterbildes. Wahrscheinlich ist also mein Lösungsvorschlag falsch.
Ob Wurmbach zwischen 1931 und 1943 Schriftleiter des Siegerländer Heimatkalenders war, erscheint fraglich. Zumindestens bis zum Tode von Dr. Hans Kruse (1941) scheint dies nicht der Fall gewesen zu sein – s. zu Kruse: http://www.siwiarchiv.de/?p=1451 .
Weiterer Wurmbach-Fund:
“ Eltern den Stock weg ! “ [Beitrag gegen die Prügelstrafe:] in: Schule und Elternhaus. Halbmonatsschrift für Eltern und Erzieher. Blätter für aufbauende Kultur., Berlin-Hermsdorf. Ohne Jahresangabe ( um 1931 )
English version:
Currently the state parliament of North Rhine Westphalia is verifying the practicability of the newly instated “Archive Act NRW”. Also the historians of NRW are following these investigations with great concern…, since in § 10 clause 5 phrase 2 of this draft (see below) it is stated, that the inalienability of records now only applies for municipal documents.
But town and county archives in North Rhine Westphalia do not only store municipal documents derived from official registries, but also diverse documents such as papers of important personalities, club records or collections of photographs, posters and newspapers. According to the laws currently valid, archived goods are not inalienable, therefore may be sold. The redraft of the new law does not contain any change. Historical researchers in NRW cannot agree to this: All communally archived goods need to be inalienable. To effectively protect the cultural heritage of our country, § 10, clause 5, phrase 2 must be removed without replacement from the National Archives Act!
Modern municipal archives have long been more than only the archives of the government, they are archives of the citizens, depicting the social life in its entire width. In a civilian society with an increasingly retreating government, certificates from the private sector concerning the lives of citizens are becoming increasingly important. As these sources are fundamental to regional and local historical studies, their results must be verifiable according to historical science standards, claiming a proof with the original. If this cannot be guaranteed, for example through loss or sale, all research loses value. Ultimately this opportunity for a sale of communally archived goods puts an end to all research concerning the regional history of North Rhine Westphalia. Just one example: The most important source for the history of the city of Jülich during the Weimar Republic, after the destruction of most of the official documents in late 1944, is the collection of the local press prints in the city archives. A sale of this collection would end all further research concerning this topic.
As the successful protest against the sales from the high school archive of Stralsund in 2012 proved, a wide consensus against the sale of communally archived goods, therefore also items so far being valued as archived goods, does exist. Regarding alienations, especially sales are problematic, since they remove the archived goods from public accessibility and split them up in the case of collections, resulting in a entire loss of the historical source. The protection, the state constitution provides for monuments of history and culture, must also be ensured for archived goods. In the other provinces archived goods are generally inalienable.
But city and county archives in North Rhine-Westphalia store not only documents of official origin, derived from the official registries, but also diverse documents such as papers of important personalities, club records or collections of photographs, posters and newspapers. After the Archives Act now in force this collection items is not inalienable, and can therefore be sold. The draft law revision provides for no change. Historical research in NRW can not agree explain: The entire municipal archives in NRW must be inalienable. To effectively protect the cultural heritage of our country, § 10, paragraph 5, sentence 2 must be removed without replacement in the National Archives Act!
!
Because modern municipal archives have long been more than authorities archives, they are citizen archives that depict the social life in its entire width. In a civil society with an increasingly retreating government certificates from the private sector over the lives of citizens are becoming increasingly important. These sources are fundamental to regional and local historical studies, their results must be verifiable historical science standards following the original. This is no longer the case – for example, through loss or just sell the sources – decreases the value of the research. Ultimately therefore means the possibilities of disposing of municipal archives from for the scientific regional history in NRW. Just one example: The most important source for the history of the city of Jülich during the Weimar Republic, after most of the official documents in the destruction of the city was destroyed in late 1944, is the collection of the local press in the city archives. A sale of this collection would stop any further research.
How has the successful protest against the sales from the high school library Stralsund shown in 2012, there is a great consensus, local cultural goods, including archival properly valued collection items, be regarded as inalienable. In the sale is to think primarily of sales beyond the affected cultural heritage of its public accessibility in the rule and destroy in the case of collections by dismemberment as a historical source. The protection of the state constitution for the monuments of history and culture must also be ensured for archival. In the other provinces archive is generally inalienable.
Ernst Graf wurde am 11.01.1889 in Rinsdorf als Sohn der Eheleute Bergmann Philipp Graf und Karoline Hoffmann geboren.
Er war auch der erste von 19 Kriegstoten aus dem kleinen Ort Rinsdorf.
Der zweite Kriegstote aus Rinsdorf war sein fünf Jahre älterer Bruder der Grubensteiger Ewald Graf.
Der berufliche Werdegang von Ernst Graf war sicher etwas ungewöhnlich, die meisten jungen Rinsdorfer seiner Generation folgten ihren Vätern erst als Haldenjungen und später als Bergmänner auf die Gruben, besonders in Eisern.
Quelle: Kirchenbuch Rödgen, evang.,
Herbert Diehl, Rinsdorf gestern und heute, 1976,
3 weitere NAchträge zu Wurmbach:
1) Dieter Pfau: Die Geschichte der Juden im Amt Ferndorf (1797-1943). „Den Juden ist aber hier kein Leid zugefügt worden“. Kreuztaler Rückblicke. Eine Veröffentlichung aus dem Stadtarchiv Kreuztal Band 1, Bielefeld 2012. Die Publikation enthält Erhellendes zum Verhältnis Wurmbachs zur jüdischen Bevölkerung.
2) Ein must read: „Wo ich zehren muß vom Vorrat meiner Seele.“ Zwischen Tradition und Moderne: Der Pazifist Adolf Wurmbach. Kindheit, Jugend und Gelsenkirchener Jahre bis 1933. In: Literatur in Westfalen. Beiträge zur Forschung 4. 1998. Hrsg. im Auftrag des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe von Walter Gödden. Paderborn, München, Wien, Zürich: Schöningh 1998, S. 135-174.
3) Hermann Engelbert schreibt in seiner „Hinterhüttschen Chronik“ (Kreuztal 1994, S. 406) zur 700-Jahr-Feier Siegens Folgendes „…. Im August heftige Zeitungskämpfe, ob unser Heimatdichter Adolf Wurmbach aus Littfeld, ein vaterländisch-„gesinnter“ Mannist. Sein Weihespielzur 700-Jahr-Feier der Stadt Siegen wird abgelehnt. …..“
Seit einiger Zeit beschäftige ich mich mit Untersuchungen nach dem Lebenslauf von Ernst Szymanowski (später Ernst Biberstein). Diese Geschichte von einem Mann der als Pastor anfing und im Nürnberger Einsatzgruppenprozess 1947 zum Tode verurteilt wurde fasziniert mich.
Im Buch von Gerhard Hoch ‚Ernst Szymanowski-Biberstein – Die Spuren eines Kaltenkirchener Pastors‘ wird geschrieben: „Geboren wurde Ernst Szymanowski am 15. Februar 1899 in Hilchenbach, Kreis Siegen / Westfalen. In Mühlheim an der Ruhr besuchte er die Volksschule. 1906 wurde sein Vater Ernst Szymanowski als Eisenbahnbeamter nach Neumünster versetzt.“ Sie schreiben, dass die Familie schon am 30. April 1901 nach Neumünster umgezogen sei. Dazu habe ich einige Fragen:
* Weil der Name seiner Mutter mir nicht bekannt ist, möchte ich gerne eine Kopie seiner Geburtsurkunde empfangen;
* Gibt es eine Notiz über den Umzug nach Neumünster? Ist es möglich mir davon eine Kopie zu schicken?
* Es gab auch noch einen jüngeren Bruder; wurde er auch in Hilchenbach geboren? Gibt es davon auch eine Geburtsurkunde? Dann gerne auch eine Kopie.
Wenn daran Kosten verbunden sind, dann höre ich das gerne.
Mit freundlichen Grüßen,
Gerben Dijkstra
Anjer 51
2678 PC De Lier
Niederlande
Radio Siegen, Podcast, 21.8.2014: „Ältester Bergbau im Siegerland. Bei Kreuztal ist ein Bergbauschacht aus dem 13. Jahrhundert gefunden worden. Er gilt als der älteste Fund bei uns in Siegen-Wittgenstein.“: http://radio-siegen.de/_pool/files/beitraege/735526.mp3
Beiträge in der Siegener Zeitung der Jahrgänge 1930/32 von Wilhelm Schmidt
Dr Ädde ah sin Jong – Gedicht, Mundart,
SZ 03.05.1930
Zur Reichspräsidentenwahl – Gedicht, Mundart,
SZ 09.04.1932 (veröffentlicht einen Tag vor dem zweiten Wahlgang zur Reichspräsidenwahl 1932),
Wä en Freund bim Koenig haedd – Gedicht, Mundart,
SZ 28.05.1932
Dr Rärrer Kirfich – Gedicht, Mundart,
SZ 19.11.1932
Am 06.10.1931 fand in der Eisefelder Turnhalle ein Familienabend des Evang. Volksdienstes statt.
Redner waren (Gustav Adolf ?) Weigelt, Eiserfeld, der eine Lobesrede auf das Wirken und Schaffen Stöckers hielt und Professor (Karl ?) Veidt.
Zwischen den Redbeiträgen trug Wilhelm Schmidt einiges aus eigener Dichtung vor.
SZ 07.10.1931
“ ….. Bei einer Anhörung im Landtag unterstützten die Landschaftsverbände aus dem Rheinland und aus Westfalen-Lippe die Forderung eines generellen Verkaufsverbots. Das Archivgesetz liegt dem Landtag derzeit zur Überprüfung vor.“
Quelle: WDR.de, Kulturnachrichten, 28.8.2014
s. a. Pressemitteilung der Piraten-Fraktion zur heutigen Archivgesetzanhörung in NRW:
“ …. Die Sachverständigen haben bestätigt, dass am Archivgesetz NRW Verbesserungen vorgenommen werden sollten. Es darf kein Archivgut zweiter Klasse geben, deshalb muss zukünftig auch kommunales Sammlungsgut vor dem Verkauf geschützt werden – schließlich ist Kulturgut keine Handelsware und sollte nicht zur Haushaltssanierung der Kommunen verscherbelt werden. Außerdem müssen die Regelungen zur digitalen Archivierung und Digitalisierung klarer gefasst werden. Wir fordern, dass möglichst viele kulturell wertvolle Unterlagen den Menschen im Internet zugänglich gemacht und auch weiterverwendet werden können. Kultur gehört allen Menschen. …..“
Link: http://www.piratenfraktion-nrw.de/2014/08/nordrhein-westfalisches-kulturgut-in-gefahr/
Gern und mit Nachdruck unterstütze ich diesen überfälligen Appell für die Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes! Danke für die Initiative! Astrid Rothe-Beinlich, MdL BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; Vizepräsidentin im Thüringer Landtag
Ich besitze zwei signierte Gedichtbände von Wurmbach (Blumen im Brachland). Als Literaturwissenschaftler (M.A.) und Siegerländer überlege ich schon seit einiger Zeit, eine Dissertation oder eine Biographie über ihn zu verfassen. So langsam müsste ich mich entscheiden. Es gibt bis auf wenige wissenschaftliche Aufsätze kaum Literatur über diesen Dichter, da er kaum über das Siegerland hinaus gewirkt hat (- bis auf die Gelsenkirchener Tage) und mit seiner betont christliche Weltsicht keinen weiten Leserkreis gefunden hat. Ich kenne den Teilnachlass in Kreuztal. Das westfälische Handschriftenarchiv hält sich mesitens sehr bedeckt, das liegt wohl am Leiter des Archivs.
Beiträge von Wilhelm Schmidt in der Beilage zur Siegener Zeitung
„Unser Heimatland“:
1926 (erster Jahrgang)
Eam Heidemich, Gedicht, Mundart, Seite 32
Am alten Stollen, Gedicht, Hochdeutsch, Seite 47
Frehjohr, gedicht, Mundart, Seite 80
Det Veelwennche, Gedicht, Mundart, Seite 112
Dr schlagfertige Mechel, Gedicht, Mundart, Seite 125
Noahsommer, Gedicht, Mundart, Seite 176
1927
Dr Stefftekopp, Gedicht, Mundart, Seite 15, unterzeichnet mit Welmes Willäm,
E Peffekus, Gedicht, Mundart, Seite 96, Welmes Willäm,
1928
De Hornbläser eam Nassauer, Gedicht, Mundart, Seite 48, Welmes Willäm,
En goare Uhlouw, Anekdote, Mundart, Seite 96, Welmes Willäm,
1929
De Schläfe, Gedicht, Mundart, Seite 95
1930
kein Beitrag
1931
kein Beitrag
1932
kein Beitrag
1933
kein Beitrag
1934
Zur Nachtschicht, Gedicht, Hochdeutsch, Seite 140
1935
Dr Stoat vam najje Hus, Gedicht, Mundart, Seite 64
Dat Freamdwort, Gedicht, Mundart, Seite 77
Auszug: On bliewe ditsch eam Wäse, vah allem Waelche fräj –
Ohs Ditschland, et wird läwe, bliebt et sr sealwer träj!
1936
Wie dr Pinnejoest sin Arwet net feanne konn, Gedicht, Mundart, Seite 16
1937
kein Beitrag
1938
kein Beitrag
1939
Die letzte Ausgabe 1939 der Beilage „Unser Heimatland“ bringt
bewußt eine vielzahl von mundartlichen Gedichten und Beiträgen,
allerdings keine von Wilhelm Schmidt.
1940 (letzter Jahrgang bis zum Wiedererscheinen nach dem Krieg)
Die Nummer 2 des Jahrgangs 1940 ist eine
„Schwänke und Andekdoten-Nummer“
die aus schon früher veröffentlichten Beiträgen besteht.
Dr Fillste, Gedicht, Mundart, Seite 18, 1924
Dr Schlagfertige Mechel, Gedicht, Mundart, Seite 19, 1926
Wie Franzes Ädde sech binah ohglecklich gemmacht hädde, Gedicht, Mundart, Seite 19, 1930
Dr Hermedeicher Keandsguck, Gedicht, Mundart, Seite 20, 1925
Schlechter geschmack oarrer goahre Margarin, Gedicht, Mundart, Seite 20, 1925
Det Hondsexame, Gedicht, Mundart, Seite 24, 1936
Wie dr Pinnejoest sin Arwet net feanne konn, Gedicht, Mundart, Seite 28, 1936
Decke Duffeln, Gedicht, Mundart, Seite 31, 1925
Die Ausstellung im Mittendrin-Museum enthält ein Familien-Brettspiel
„Kampf gegen Russland“. Durch diese Siel wird augenfällig, wie weit die
eigentlich unbeteiligten Kinder vor 100 Jahren mit dem Thema 1.Weltkrieg konfrontiert wurden.
Bereits am Eröffnungstag protestierte ein Besucher (verm. Putin-Versteher)
gegen dieses Ausstellungsstück. Man sieht es ist Gesprächsstoff gegeben.
1.) Jugendstilvilla, Poststraße 44, Bad Berleburg
2.)
Die Villa wurde 1897 durch die Holzwaren-fabrik Breimer als Wohnhaus erbaut. Im Laufe ihrer Geschichte hat das Gebäude zahlreiche Nutzungsänderungen erfahren und vielfach den Eigentümer gewechselt. Trotz der häufigen Nutzungsänderungen hat die Villa ihr charakteristisches Aussehen bis heute bewahrt, so dass die Stadt Bad Berleburg das Gebäude einschließlich der Garteneinfriedung am 15.10.1984 in die Denkmalliste eingetragen hat.
Die Villa ist ein dreigeschossiges, massiv errichtetes Bauwerk. Das Sockelgeschoss ist in hammergerechtem Bruchsteinmauerwerk her-gestellt. Die Mittelgeschosse sind in verputztem Ziegelmauerwerk ausgeführt, haben Verzierungen im Eckbereich und abgesetzte Fensterlaibungen. Das Dachgeschoss besteht aus sichtbarem Fachwerk mit ausgemauerten Gefachen. Das Walmdach ist mit Pfannen gedeckt und weist auf der Ostseite eine Ziereindeckung aus.
Der erste Eigentümerwechsel erfolgte in den 30-er Jahren des 20. Jahrhunderts, als die Samesreuther Müller-Schuss Metallbau (SMS) die Villa, sowie die sich nordwestlich anschließenden Fabrikationsanlagen aufkaufte. Mit dem neuen Besitzer ging die erste Umnutzung des Gebäudes einher, da die Villa nun auch im Untergeschoss als Bürogebäude genutzt wurde. 1973 erfolgte die Aussiedlung der Firma SMS und der Kreis Wittgenstein wurde neuer Eigentümer. Im Zuge der Umsiedlung wurden die Fabrikgebäude abgerissen.
1980 erwarb die Stadt Bad Berleburg die Villa, nutzte sie als Musikschule und später als Jugendzentrum. Das Umfeld der Villa wurde als öffentliche Grünfläche umgestaltet, wobei der alte Baumbestand im Nahbereich der Villa mit einbezogen wurde. Eine grundlegende Renovierung erfolgte 1993 durch die Wittgen-steiner Kliniken Allianz, die die Villa von der Stadt Bad Berleburg langfristig angemietet hatte. Im Erdgeschoss wurde ein Kur- und Verkehrszentrum eingerichtet. Das Obergeschoss beherbergte die Praxisräume der Kurärztin. Auf der gleichen Etage ist das städtische Standesamt nebst Trauzimmer untergebracht.
Park und Gebäude dienen seither zahlreichen Brautpaaren als repräsentative Fotokulisse. Zwischenzeitlich ist die Praxis durch eine Versicherungsagentur ersetzt worden. Für die nahe Zukunft sind weitere Nutzungsänderungen nicht ausgeschlossen. Die Dachgeschossnutzung knüpft mit zwei Wohnungen an die ursprüngliche Nutzung der Villa als Wohnhaus an.
Quelle: AG Historische Stadt- und Ortskerne NRW
Bildausschnitt erkannt an der Farbgebung und der Fensterform, den Rest lieferte Google……
Meines Wissens handelt es sich um die Jugendstilvilla in Bad Berleburg (neben dem Bürgerbüro). Derzeit wird es für verschiedene Zwecke genutzt wird (u.a. für standesamtl. Trauungen).
„Die Villa, die im Jahre 1897 von der Unternehmerfamilie Koch als Wohnhaus auf der kurz zuvor aufwendig fertiggestellten Stadtchaussee, der heutigen Poststraße, erbaut wurde, galt neben dem etwa 2 Jahre eher fertiggestellten Landratsamt, welches zuvor in der Oberstadt angesiedelt war, als repräsentatives Aushängeschild unserer damaligen Kreisstadt Berleburg“ (Zitat Homepage Stadt Bad Berleburg).
Kürzlich schaute ich noch wieder in die Entnazifizierungsakte von Adolf Wurmbach und musste leider feststellen, ich hatte bis dahin etwas übersehen.
In seinem Fragebogen hatte Wurmbach unter „Mitarbeit an Zeitschriften u. Zeitungen“ zwar eine Vielzahl von Titeln angegeben, nicht aber die Siegerländer National-Zeitung der Siegerländer NSDAP, in der er ja seit der ersten Hälfte der 1930er Jahre ständig Lyrik publizierte. Das wird er 1949 wohl kaum vergessen haben. Mutmaßlich dürfte es wohl auch mindestens dem einen oder anderen Angehörigen des Entnazifizierungsausschusses bekannt gewesen sein, so dass diese offenbare Lücke allen hätte bekannt sein können.
Wurmbach gab auch an, er habe nur „belletristische“ Texte publiziert, mit Politik und z. B. NS-Kriegspropaganda habe er nichts zu tun gehabt. Das war eine Suggestion und ebenfalls unzutreffend. Da musste man nur mal in die ja nicht untergegangene Ausgabe des Heimatkalenders für 1939 reingucken und die Beiträge zum Kriegsbeginn aufblättern. Wiederum kaum zu glauben, dass das entsprechende Kriegseinstiegsgedicht von Wurmbach (oder auch die späteren von ihm) im Ausschuss so völlig unbekannt gewesen sein sollen.
Dass Wurmbachs „Bergmannsgedichte“ (1942) von dem bekannten nationalsozialistischen Polit-Komponisten Georg Hermann Nellius so wertgeschätzt wurden, dass der sie vertonte, musste der Dichter nicht im Fragebogen mitteilen, war aber gewiss ebenfalls im Siegerland nicht gänzlich unbekannt geblieben.
Schlussfolgerung: Nicht nur Wurmbach selbst arbeitete fleißig nach dem „Zusammenbruch“ an seiner Mythisierung zum unermüdlichen Friedenskämpfer, sondern ein ganzes Netzwerk, denn Lichtgestalten fehlten wohl?
Hier noch ein Einblick in das von mir so genannte Kriegseinstiegsgedicht von 1939 (jährte sich erst kürzlich):
„O Deutschland, reich an Liedern und Wälderpracht -/Doch steht dir auch die Sprache des Zornes an,/Damit du züchtigest den Frevler,/Der an den heiligen Frieden rühret./Mit ihren Leibern schirmen der Besten viel/Und heißem Herzen Marken und Heimstatt dir,/Damit sie leben oder sterben -/Segne der Himmel den Schwur! – für Deutschland.“
Erfrischender Beitrag!!! Leider muss immer damit gerechnet werden, dass „Netzwerke“ wie das oben erwähnte bis in die Gegenwart hinein aktiv sind und, vor allem wenn Nachfahren der betreffenden Prominenten am Hebel sitzen, dem Schlachten (un-)heiliger Kühe nicht tatenlos zusehen werden. Beispielsweise wäre es (wie ich aus gut unterrichteten Kreisen erfahren durfte) vermutlich nicht zu empfehlen, die längst überfällige Aufarbeitung der Amtsführung eines gewissen bundesverdienstkreuzbehangenen Siegener Bürgermeisters während der NS-Zeit öffentlich vorzunehmen: Nicht nur, dass man sich als Autor leicht um Kopf und Kragen schreiben könnte; auch Schikanen gegen die benutzten Archive und das als Plattform in Frage kommende Printmedium wären nicht auszuschließen. Ob solche Seilschaften auch im Falle Wurmbachs auf der Lauer liegen, weiß ich nicht.
P.K.
Sehr geehrter Herr Kunzmann und Herr Dr. Opfermann, haben sie eigentlich Beweise für solche Verschwörungstheorien? Wir sollten bei den Fakten bleiben, alles andere ist wissenschaftlich unseriös.
Wenn ich Herrn Dickel richtig verstanden habe, geht es sich um Belege für das von erwähnte Netzwerk der „Heimatliteraten“.
Hallo Herr Kunzmann,
Herr Wolf hat es genauer ausgeführt, ich habe es nur ein bisschen plakativer formuliert.
Mit vielen Grüßen,
Matthias Dickel, M.A.
Die Frage ist nun, welche Belege lassen sich finden? Indizien für ein Netzwerk in der Siegerländer Heimatliteratur der 20er bis 70er Jahre des 20. Jh. sind die häufig ungebrochenen Bibliographien einzelner Protagonisten (bspw. Lothar Irle, Otto Krasa, Adolf Wurmbach, Wilhelm Schmidt, Hermann Böttger) in den maßgeblichen regionalen Publikationsorganen („Siegerland“, Siegerländer Heimatkalender“, etc.). Ferner könnte ein weiteres Indiz die Mitgliedschaft der „Netzwerker“ im Siegerländer Heimat- und Geschichtsverein sein. Ein Blick auf die Rezensionen der eigenständigen Werke könnte ebenfalls hilfreich sein. Vielleicht ergeben sich bei einer Auswertung der Entnazifizierungsakten weitere Hinweise.
„Netzwerk“ und „Seilschaft“ sind genauso plakative Formulierungen wie „Verschwörungstheorie“; wir müssen darauf nicht herumreiten. Auch Sie werden sicher nicht anzweifeln, dass es im Siegerland nach wie vor nicht wenige Menschen gibt, die sich untereinander gut kennen, aus mir persönlich unerfindlichen Gründen Adolf Wurmbach für einen begnadeten Dichter und eine denkmalgeschützte Lichtgestalt halten (was ja nun mal sein jahrzehntelang kolportiertes Image ist) und kein Interesse daran haben, dass irgendein Schatten auf ihren Helden fällt. Ich wollte neulich nur daran erinnern, dass das Ideal der „historischen Wahrheitsfindung“ in der Gesellschaft keineswegs große Sympathie genießt. Und eine erste Unmutsbekundung ist ja auch prompt gekommen (von Ihnen), kaum dass jemand (U.O.) am Denkmalssockel zu kratzen wagte. Solange sich der Protest auf entrüstete Siwiarchiv-Beiträge beschränkt, ist das auch gar kein Problem. Es können sich aber (vielleicht nicht gerade bei Wurmbach, bei anderen Persönlichkeiten der Zeitgeschichte sehr wohl) durch Recherchen Erkenntnisse ergeben, deren öffentliche Darstellung von gewissen „Denkmalschützern“ für justiziabel gehalten würde. Und vor Gericht ginge es dann nicht um dokumentierbare Geschichtswissenschaft, sondern darum, welche Partei den gerisseneren Anwalt engagieren kann. Teuer und rufschädigend würde es für den Beklagten auf jeden Fall, unabhängig vom Ausgang.
P.K.
Danke Herr Wolf, das war eine sachliche Antwort! Ich werde mich vorerst an der Diskussion nicht weiter beteiligen, um zu verhindern, dass das Thema hier im Forum weiter hochkocht.. Denn ich sehe die Wurmbach-Problematik aus einer anderen, der literaturwissenschaftlichen Warte. Mit besten Grüßen, Matthias Dickel
Hallo,
habe von 1923 noch 4 Feldpostkarten gestempelt Weidenau-Sieg in meinem Besitz. Wenn gewünscht kann ich diese gerne zur Verfügung stellen.
Da auch die Geschichtswerkstatt Siegen in Zusammmenarbeit mit dem Stadtarchiv Siegen für 2015 eine Ausstellung zum 1. Weltkrieg vorbereitet (Arbeitstitel „Siegen an der Heimatfront. 1914-1918. Weltkriegsalltag in der Provinz“, vgl. Eintrag auf siwiarchiv vom 13.09.2013) würden wir uns ebenfalls für diese Feldpostkarten interessieren.
….. zumal der Stempel „Weidenau-Sieg“ auf einen heutigen Stadtteil Siegens, nicht auf Wilnsdorf verweist.
Warum muss eigentlich jedes Dörflein seine eigene Kriegsausstellung veranstalten? Ich halte das nicht für professionell. Bei der überschaubaren Größe des Siegerlandes hätte es doch möglich sein sollen, die Aktivitäten zu bündeln. Und dass die Stadt Siegen etwas Größeres und für den gesamten Kreis Relevantes plant, ist ja lange genug bekannt. Unter dem von den Dörfern hier wiedereinmal verfochtenen Gießkannenprinzip leiden letztendlich die großen wie die kleinen Projekte.
P.K.
„Wer weiß schon, dass die angeblichen Hexen bei lebendigem Leibe verbrannt wurden …“
Ich weiß etwas anderes und das steht in jeder neueren Einführung zum Thema:
„Die Hinrichtung von Hexen erfolgten im angelsächishcen Raum durch den Strang, in Kontinentaleuropa in der Regel durch das Schwert mit anschließender Verbrennung des Leichnams.“ (Johannes Dillinger, Hexen und Magie, Frankfurt 2007, S. 87)
Sehe ich das falsch, oder hätte 1963 der Kreisausschuss vom Kreistag beauftragt werden müssen, sich mit der Angelegenheit zu beschäftigen? In dem Fall könnten sich noch weitere aufschlußreiche Informationen in den Sitzungsprotokollen des letzteren finden, besonders wenn das Thema im Kreisparlament kontrovers diskutiert worden wäre. Auch vermute ich, dass Frau von Bredow sich weniger als Privatperson oder Oberin von Stift Keppel an den Landrat gewandt hatte, sondern eher als Kreistagsabgeordnete (übrigens die erste weibliche seit dessen Gründung).
P.K.
Zur Abrundung könnte man sicherlich noch einmal die Kreistagsprotokolle überprüfen. Der hier eingestellte Text ist im Rahmen eines nur vierwöchigen Praktikums entstanden und, da sich am Ergebnis aller Voraussicht nach nichts ändern wird, wurde auf diese Überprüfung verzichtet.
Ja, Juliane von Bredow ist hier wohl als Kreistagsabgeordnete aktiv. Ob sie allerdings wirklich die erste Kreistagsabgeordnete war, darf bezweifelt werden, denn eigentlich gebührt diese Ehre Lotte Friese-Korn – s. http://www.siwiarchiv.de/?p=6477 .
Danke für die Korrektur! Wenn ich nicht noch weitere Frauen übersehen habe (was der Kreisarchivar monieren würde), waren die drei ersten im Kreistag also: Lotte Friese-Korn (FDP) 1946, Juliane von Bredow (CDU) 1956, Waltraud Steinhauer (SPD) 1966.
P.K.
Ich schrieb:
„In seinem Fragebogen hatte Wurmbach unter “Mitarbeit an Zeitschriften u. Zeitungen” zwar eine Vielzahl von Titeln angegeben, nicht aber die Siegerländer National-Zeitung der Siegerländer NSDAP, … .“
Das muss ich nach erneutem Einblick in die Akte insofern korrigieren, als tatsächlich in der maschinenschriftlichen Auflistung „Nationalzeitung“ nachträglich per Hand hinzugefügt wurde. Von wem ist unbekannt. Handschriftlich hinzugefügt wurden auch Erscheinungsorte und -jahre der Publikationen. Das ist deshalb interessant, weil Wurmbach in seinem Fragebogen ein 1934 gegen ihn ausgesprochenes „Schreibverbot“ behauptete. Ausweislich bereits der handschriftlichen Angaben in diesem Fragebogen kann ein etwaiges Schreibverbot nicht allzu lange angedauert haben.
Es ist nicht auszuschließen, dass die handschriftlichen Nachträge in der Liste ganz oder teilweise von Wurmbach stammen, obwohl sie sich graphisch nicht mit Wurmbachs Eintragungen im Fragebogen decken: das erste ist kursive Schreibschrift, das zweite Blockschrift. Er könnte ja beide Varianten eingesetzt haben.
Festzuhalten ist aber noch, dass die Liste ein Nachtrag zum Fragebogen war. Sie traf ausweislich der Eingangsstempel erst eine Woche nach dem Fragebogen ein.
Die Angabe „Nationalzeitung“ ist demnach ein Nachtrag zu einem Nachtrag. Wann und von wem vorgenommen, ist unbekannt. Gesichert dagegen sind Datum und Autor (Adolf Wurmbach) der Aussage „1934 Schreibverbot“.
Das als präzisierender Nachtrag. Ich hoffe darauf, dass mir meine kürzliche Ungenauigkeit mit etwas Wurmbach-Toleranz nachgesehen wird.
U. O.
Zu Wurmbach fehlt eine umfassende literaturwissenschaftliche Erforschung seiner Arbeiten, um seine eigentliche Haltung zu identifizieren. Man kann nicht nur historisch anhand der Aktenlage einen Menschen erfassen. Ich finde, dass ein solcher „Sockelstoß“, wenn dieser denn stattfinden muss, auf fundierter Basis erfolgen muss. Ich wage einmal die Behauptung, dass man sich mit der publizistischen Situation der nicht völkischen und nationalsozialistischen Schriftsteller im Dritten Reich eingehend auseinandergesetzt haben sollte, bevor man über einen Menschen den Stab bricht.
Das Schreibverbot mit dem Adolf Wurmbach nach seinen eigenen Angaben
in dem Fragebogen der Entnazifizierungsakte im Jahre 1934 belegt wurde,
hat nicht lange Bestand gehabt.
Bereits ab1935 veröffentlicht Wurmbach regelmässig in der Zeitschrift Siegerland, die mir zurzeit erste bekannte Veröffentlichung ist aus dem Heft
Siegerland, 17. Band, 2. Heft, April – Juni 1935.
In diesem Band hat Wurmbach gleich zwei Gedichte:
„Das Backhaus“ und „Meiner Siegerländer Bergheimat“
beide auf Seite 67 und in hochdeutsch verfasst.
Zu Wurmbach, heißt es oben, fehle „eine umfassende literaturwissenschaftliche Erforschung seiner Arbeiten, um seine eigentliche Haltung zu identifizieren.“ Ich unterscheide nicht zwischen einer „eigentlichen“ und einer „uneigentlichen“ Haltung, wohl aber zwischen unterschiedlichen, wechselnden Haltungen zu Nationalismus, Militarismus, Krieg und Nationalsozialismus. Dass Wurmbach jemals als Nationalsozialist anzusprechen gewesen sei, würde ich nicht annehmen. Was aber nicht wegzudiskutieren ist, das sind eben diese wechselnden Positionierungen. Das lässt sich durchaus und auf dem kurzen Weg auch aus seinen Beiträgen zur regionalen Literatur erschließen.
Das sind die kriegspropagandistischen Texte aus dem Ersten Weltkrieg, da sind die pazifistischen Texte aus der Weimarer Zeit (die gewiss mit einer Ablehnung des Nationalsozialismus einhergingen) und das sind kriegspropagandistische Texte aus den NS-Jahren. Natürlich auch viel heimatlich Volksgemeinschaftliches, mal germanisierend formuliert, mal in Treue zum konventionellen Vers und zum Endreim. Und dann nach dem Ende des Nationalsozialismus wieder Pazifistisches.
Ich denke, das genügt schon, um sagen zu können, dass er ein Wendehals war. Warum auch immer.
Um das zu belegen, braucht es die Unwahrheiten nicht einmal, die sich aus Wurmbachs Umgang mit seinem Entnazifizierungsfragebogen erschließen. Aber sie sind schon ein interessanter, in den Kontext passender zusätzlicher Akzent.
Rühret die Hände!
Not macht hart!
Über der Gegenwart,
Über dem Heute
Leuchtet der Zukunft Schein.
Wenn wir leben
Nicht uns allein,
Leben dem Morgenden,
Das sich bereitet
Machtvoll um uns.
Darum rühret die Hände,
Daß Not sich wende
Und Opfer, Verzicht –
Zu Freiheit und Licht!“
(National-Zeitung, 25.4.1936, darunter ein Gedicht von Will Vesper zu u. a. dem „Vaterland“ in seinem „Herzen“)
„Für dich!
Fürs Vaterland sterben,
O heilige Saat,
Du höchstes Opfer
Verklärender Tat!
Ein namenlos Grab
So schlicht und klein,
Es schließt eine Welt
Voll Liebe ein.
Vergessen ist keiner,
Der fern verblich –
Gefallen – o Deutschland
Für dich, für dich!“
(Siegerländer Heimatkalender für 1942, S. 49)
„Sie [= Sparkassengründer] aber wußten auch um die Verpflichtung
Aus solcher Sicht und scheuten Kampf und Opfer
Und Fehlschlag nicht und führten kühlen Hauptes
Und heißen Herzens ihren Kampf und nahmen
Vorweg die Losung, die in unsern Tagen
Ein ganzes Volk zu sich geführt: Gemeinnutz
Geht über Eigennutz!“
(SZ, 5.8.1943, „Adolf Wurmbach, des Siegerlandes Dichter“, so die Zeitung, zur Hundertjahrfeier der Sparkasse der Stadt Siegen)
13 Jahre später:
„Würze zur Tagessuppe
Gibst Kanonen deinem Jungen
Du zum Spiel, mit Angst und Beben
Mußt du später den Kanonen
Deinem Jungen geben.“
(Westf. Rundschau [der SPD] im Getümmel der Atombewaffnungsdebatte, 13.8.1956)
Ulrich Opfermann weist via E-Mail auf neue Einträge zu Lehrerinnen und Lehrer im regionalen Personenlexikon zum Nationalsozialismus in den Altkreisen Siegen und Wittgenstein hin:
Beineke, Albert Friedrich Wilhelm
Bode, Adolf
Bonstein, Wilhelm
Born,Marie
Bredow, Juliane von
Breitenbach, Karl
Hohlsiepe, Wilhelm
Knappmann, Friedrich Wilhelm
Lehmann, Walter
Lepetit, Gustav
Mathi, Ernst Georg
Montanus, Hermann
Mugler, Edmund
Müller, Wilhelm August Robert
Vollmer, Wilhelm
Weigelt, Gustav.
Die Ausstellung im Stadtmuseum wird noch in der Zeit bis zum 22. Oktober 2014 gezeigt. Sie ist jeweils Samstags, Sonntags und Mittwochs von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet.
Mit kollegialen Grüßen
Detlef Köppen
Zu Gustav Busch:
In unserer Jugendzeit (ich bin Jahrgang 1930) war Gustav Busch für uns Geisweider,obgleich er ja an der Klafelder Schule unterrichtete,eine bekannte Persönlichkeit,vor der ich immer Respekt gehabt habe.Als Kinder und Jugendliche kannten wir natürlich nicht den vollen Umfang der geistigen und politischen Haltung die diese Leute während des Dritten Reiches verkörperten.Meine Frau war Schülerin in seiner Klasse an der Bismarckschule,bevor sie eine weiterführende Schule besuchte und sie hat sich eigentlich immer positiv über ihn geäußert.Wenn sie noch lebte und könnte heute, im Regionalen Personenlexikon zum Beispiel,nachlesen,welche
Gedanken und öffentliche Äußerungen G.Busch während der Nazizeit produziert hat,würde sie genau so wie ich total schockiert sein.Neben Walter Nehm von der Geisweider Schule,ist dies schon der zweite Lehrer aus unserer Jugendzeit,der mich heute als älteren Menschen,im Nachhinein so maßlos enttäuscht hat.Um weiteren Enttäuschungen vorzubeugen habe ich beschlossen,mir keine Schriften dieses Personenkreises mehr anzulesen.
PS:Sie können meine E-Mail-Adresse ruhig veröffentlichen.
vielen Dank für den #KultTipp Siegerland – eine facettenreiche Museumslandschaft! Ich drücke fest die Daumen, dass ganz viele Besucher des Portals zu „echten“ Besuchern werden.
pardon, jetzt ließ ich es länger liegen – die Blogparade #KultTipp, bei der Sie auch mitmachten und uns über das Museumsportal Kreis Siegen-Wittgenstein – vielen Dank dafür – vorstellten, vereinnahmte mich komplett.
Jetzt habe ich mich ein klein wenig von der Blogparade erholt, die Einschläge zum Schluss waren heftig. Endlich konnte ich Ihr Blogstöckchen in Ruhe lesen – wunderbar! Das Gute an Blogstöckchen ist, dass sie irgendwann bearbeitet werden können. Bei mir lag es auch ein paar Wochen, bevor ich es beantwortete und weiterwarf. Mit Ihnen haben es jetzt alle zehn Museen und Archive bearbeitet, gestaltet und weitergereicht. Ich bin froh, dass ich ein Institutions-Blogstöckchen wagte, denn auch Ihre Antworten zeigen, wie spannend Archiv- und Museumsarbeit sein kann.
Vielen herzlichen Dank dafür! Und ich hoffe noch mehr Antworten von Ihren Kollegen lesen zu dürfen – Sie werden dadurch für mich unmittelbar und ihre Archive erhalten für mich ein Gesicht, worauf ich mich schon freue!
„Älteste Montanregion Europas“??? „Bis in die Neuzeit eine geistige, religiöse, politische und wirtschaftliche Sonderstellung“??? „Zu Beginn des 20. Jahrhunderts befindet sich das Siegerland auf einem wirtschaftlichen Höhepunkt“??? „Das […] Herz der Bundesrepublik“??? „Die Demontage blieb im Siegerland aus“??? — Kühne Thesen …
P.K.
Kühne Thesen, die der Pressemitteilung der Fa. mundus.tv zum Erscheinen der DVD entnommen wurden.
Die hier vergebenen Fragezeichen darf man gern als Auftrag an Wirtschaftshistorikerinnen und – historiker verstehen. Im Falle der Demontage bspw. ist die Quellenlage erfreulich gut (Landesarchiv NRW) und die bisherige Forschung erstaunlich gering.
„Mit der Veröffentlichung von Revier hinter den Bergen kommen wir einem großen Wunsch vieler Menschen der Region nach, mehr über die Geschichte des Siegerlandes zu erfahren“. Wenn diese Aussage von Herrn Fischbach stimmen würde, dann müssten die anderen Veranstaltungen zur Siegerländer Geschichte jedesmal überlaufen sein. Dem ist aber nicht so!
Die Pressemitteilung ist zunächst nur Marketing in eigener Sache, dann Marketing für das Siegerland, den Siegerländer und die Siegerländerin (?, die bleibt dabei meistens außen vor) und inhaltlich wird solange an Sachverhalten herumgebogen, bis sie in die vorgefasste Meinung passen.
Hier ein Beispiel: „Denn nur Siegerländer wurden in die Zünfte aufgenommen. Dies verdeutlicht die Inschrift auf einem Pokal der Zunft der Gerber die da heißt: „Wer uns getreu in dieser Zunft, den geht auch dieser Becher an. Der Pflichtvergessene sich dieser Gnade nicht mehr rühmen kann“.“ In dem Zitat zur Zunft geht es um Getreue und Pflichtvergessene, aber nicht – wie ich es auch drehe und wende – um SIegerländer. Das entspricht aber dem Niveau der Siegerländer (Heimat-)Geschichtsschreibung, die dadurch glänzt, Altbekanntes immer wieder neu in Worte zu kleiden, niederzuschreiben, zu veröffentlichen und unter das Volk zu bringen – und das einschließlich der vorhandenen Fehler. Der Siegerländer als Erfinder des Perpetuum Mobile der Geschichtsschreibung.
Die Mediengestaltung der DVD enttäuscht sehr. Von einem „Menü“ kann man nicht sprechen, Bonusmaterial (Bei dem Preis!) Fehlanzeige. Und etwas mehr als der schiere Hinweis auf den ursprünglichen Sendeort („Prisma des Westens“) hätte dem Produkt gut getan.
(Ich weiß, dass ich mich wiederhole:) Menschen, die in dörflicher Randlage wohnen und auf den ÖPNV angewiesen sind, werden vom späten Beginn (bzw. Ende) solcher Veranstaltungen eher abgeschreckt. Für die meisten einschichtig tätigen Arbeitnehmer wird wohl der Dienst spätestens um 16 Uhr enden (oder bei Gleitzeit beendet werden können), so dass es kein Problem sein sollte, ab 17 oder 18 Uhr „massenhaft“ Publikum für interessante Vorträge ins Krönchen-Center zu locken. Außerdem entspräche ein früherer Beginn dem menschlichen Biorhythmus besser, da abends die Konzentrationsfähigkeit und Gedächtnisleistung rapide nachlassen, jedenfalls bei Berufstätigen, Schülern, Studenten und ähnlichen Lebewesen. Motorisierte Rentner, die sich vor den Veranstaltungen beim Mittagsschlaf regenerieren können und am nächsten Morgen nicht um 5 Uhr aufstehen müssen, sehen das möglicherweise anders.
P.K.
Am Mittwoch den 03.12.2014 findet die Bauausschusssitzung der Gemeinde Wilnsdorf statt.
Tagesordnungspunkt Nr. 8: Straßenbenennung in Obersdorf
es geht um die Einziehung des Weges „Wilhelm-Schmidt-Weg“.
Weitere Informationen unter:
„Mit dem Band ,Siegerland – Eine Montanregion im Wandel’ ist eine fundierte Aufsatz-Sammlung entstanden, die die Siegerländer Wirtschaftsgeschichte der letzten Jahrhunderte zu einem außerordentlich bunten Bild zusammenfügt. Sie zeigt, wie viele Krisen wir überstanden haben. Sie veranschaulicht zugleich, mit welch harter Arbeit die hier lebenden Menschen dieser Umgebung ihr Dasein abringen mussten. Und auch wie erfolgreich wir dabei über die letzten Jahrzehnte unterwegs gewesen sind.“ Mit diesen Worten fasste Klaus Th. Vetter, Ehrenpräsident der Industrie- und Handelskammer Siegen (IHK), kurz und knapp das neu erschienene Werk zusammen, das jetzt in der IHK vor über 130 Gästen präsentiert wurde. Herausgegeben wurde es
von Prof. Dr. Manfred Rasch. Ergänzt ist das Ganze mit dem „Eisenwald“, einem Siegerländer Heimatfilm aus den 1950er Jahren.
Das rund 330 Seiten umfassende Buch ist ein neuer Sammelband zur Siegerländer Industriegeschichte. Zahlreiche Persönlichkeiten aus der heimischen Region haben daran mitgewirkt. So zum Beispiel Dr. Jaxa von Schweinichen (Geschäftsführer der Walzen Irle GmbH aus Netphen-Deuz), Monika Löcken (Museumsleiterin der Wendener Hütte und des Südsauerlandmuseums) oder der Historiker Dr. Andreas Bingener. Ergänzt wird das Buch durch ein Kapitel von Andreas Rossmann, Feuilleton-Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Sein Thema „Vom Verschwinden der Häuser in die Bilder. Wird das Siegerland, wie es Bernd und Hilla Becher fotografiert haben, nur in ihren Aufnahmen überleben?“
„Nicht nur die Wirtschafts- und Technik-Geschichte findet in dem Band ihren Niederschlag“, erläuterte Rasch im Rahmen der Buchpräsentation. „Es wird gleichzeitig auch der politische wie konzeptionelle Hintergrund erläutert. Vom Hauberg zum Holzkohlenmeiler. Von den Wertpapieren zur ndustriefassade.“ Und nicht nur damals, sondern auch heute sei die Region überaus erfolgreich, spannte IHK-Hauptgeschäftsführer Franz J. Mockenhaupt anschließend den Bogen in die Gegenwart. „Wir sind ein Industrieland auf der Basis von Stahl und Metall“, ging er ins Detail. „Jeder zweite Angestellte bei uns ist direkt beschäftigt in einem Industriebetrieb. Eine Quote, die bundesweit ihresgleichen sucht.“
Quelle: IHK Siegen, Pressemitteilung Nr. 146/November 2014
Da gebe ich Ihnen recht, aber leider war keine Ortsangabe zu ermitteln. Wer also weiß, um welches Gebäude es sich hier handelt, der kann dies gerne hier kommentieren. Ich vermute es im Raum Bad Berleberg, Langewiese, Mollseifen. Schön ware es, wenn ein Bildbeleg „mitgeliefert“ werden kann.
Zur Verortung des Bildes Grobbel Nr.259 die folgende Info:
„Schedas Haus“, Grenzstraße 9, an der Postwiese in Mollseifen.
Das Belegfoto zeigt den Blick von der Rückseite.
Das Foto in siwichrchiv.de wurde von dem auf dem Belegfoto erkennbaren Weg aufgenommen.
Auf der heutigen Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde Wilnsdorf
wurde der Wilhelm-Schmidt-Weg eingezogen.
Die Abstimmung erfolgte einstimmig.
Soviel ich weis, muss das nun noch durch den Rat der Gemeinde,
das sollte aber nach dem heutigen Ergebnis keine Schwierigkeit darstellen.
Ist das nicht das gleiche Motiv wie bei Nr. 2? Wenn man das Beweisfoto des Stadtarchivs Freudenberg (Kommenter zu Adventskalender Nr. 2) zu Rate zieht, sieht man das noch deutlicher.
Ja, es handelt sich auch hier um „Schedas Haus“, Grenzstraße 9, an der Postwiese in Mollseifen. Der Adventskalender ist quasi ein Rätsel ;-). Dass sich Motive aus anderen Perspektiven wiederholen, liegt daran, dass es sich in diesem Kalender um Sammlungsgut eines Postkartenverlags handelt, der auch Mehrmotivkarten hergestellt hat. Zu diesem Zweck wurde ein Motiv in unterschiedlichen Ansichten fotografiert. Zudem schränkte die Jahreszeit die Auswahl ein.
Mein Textvorschlag geht auf die m. E. ganz unzureichende Qualität der bisherigen Darstellung des Landrats Weihe (Larissa Pittelkow, Justus Weihe) zurück.
Dazu die folgenden Anmerkungen:
• „Am 12. Mai 1921 heiratete er [Weihe] Anna Klara Karoline Bertelsmann, Tochter des Direktors der Ravensburger Spinnerei Konrad Bertelsmann und Frieda Schweitzer. … So verrichtete Weihe seine ersten landrätlichen Geschäfte als Vertreter in Usingen und Gelnhausen, wo er seine spätere Ehefrau kennen lernte, deren Vater dort Landrat war.“ Abgesehen von der Grammatik im ersten Satz wäre bei Pittelkow nachzubessern, dass
a) Conrad Bertelsmann, geb. 1835, (übrigens Mitbegründer des Langnam-Vereins) nicht eine „Ravensburger“, sondern die Ravensberger Spinnerei in Bielefeld zwar zeitweise besessen hatte, sie aber mit seinem Tod 1901 verkauft worden war.
b) Er war also nicht ein etwa nur von den Eigentümern eingestellter Direktor, sondern der Inhaber des Unternehmens gewesen.
c) Seine nun verwitwete Ehefrau Frieda Marie Elmire geb. Schweitzer heiratete 1913 ein weiteres Mal, nämlich den Juristen Conrad Delius, von 1919 bis 1933 Landrat in Gelnhausen, der im August 1945 in Allenbach bei Hilchenbach, offenbar bei seinem Schwiegersohn also, verstarb.
Wie passen die Geburtsdaten (Vater/Tochter Bertelsmann) hier zusammen? Es besteht weiterer Recherchebedarf.
• 1931/32: „Simmern war der einzige protestantische Kreis in der Rheinprovinz.“ Allein in der südlichen Hälfte der Rheinprovinz gab es vier mehrheitlich protestantische Kreise. Dennoch ist natürlich zu sagen, dass die Rheinprovinz ganz überwiegend katholisch war.
• „Im Oktober 1933 wurde er Regierungsrat.“ Das geschah nach unterschiedlichen Quellen schon einige Jahre zuvor in Koblenz.
• „Weihes Vorgänger in Siegen, Landrat Goedecke“: Weihes Vorgänger war der nach dem Abgang von Goedecke vertretungsweise eingesetzte Gerhard Melcher.
• Weihe „wurde Mitglied der SS.“ Die Aussage, Weihe sei Mitglied der SS gewesen, lässt annehmen, dass er aktives Mitglied der Allgemeinen SS gewesen sei. Das ist unzutreffend. Weihe war ausweislich der Entnazifizierungsakte Förderndes Mitglied der SS. Das war etwas anderes.
• Zwar sei er Vorsitzender des „Rechtswahrerbundes“, also des NSRB gewesen, der aber sei „von der Partei unabhängig“ gewesen. Das Gegenteil war der Fall. Der NSRB war eine nationalsozialistische Gründung und Formation.
• „Ebenso“ sei Weihe Mitglied von der Partei „angeschlossenen Verbänden“ wie der NSV, dem RBL, dem NSKB, der Deutschen Jägerschaft, dem Tennisklub, dem Deutsch-Österreichischen Alpenverein und dem DRK gewesen. Die Verfasserin weiß offenbar nicht zu unterscheiden zwischen der Partei mit ihren Gliederungen wie SA und SS, den ihr angeschlossenen Verbänden wie dem NSRB oder der NSV und dem, was es in formaler Unabhängigkeit sonst noch so gab: Deutsche Jägerschaft, Tennisklub, DAV oder DRK.
• Die Verfasserin reicht aus unbekannter Quelle die unbelegte Mutmaßung weiter, Weihe „sei zu dieser Zeit [1932] schon Gegner des Nationalsozialismus gewesen“, und sie bekräftigt, „Weihe war bis dahin [bis zur Machtübernahme 1933] Mitglied der Deutschen Volkspartei (DVP) gewesen.“ Er trat 1931, also zum Zeitpunkt seines Dienstantritts als Landrat in Simmern, in die DVP ein. Eine inhaltlich-politische Überzeugung muss hinter dem späten Eintritt nicht gestanden haben. Eine Gegnerschaft zum Nationalsozialismus schließt die Entscheidung nicht unbedingt ein. Siehe auch eine Angabe weiter unten.
• Es heißt beleglos, Weihe sei „im September 1938 sogar aus der Partei ausgeschlossen worden.“ Im Januar 1939 sei dann der Parteiausschluss zurückgenommen worden. Dort, wo dergleichen zu finden sein müsste, im Zentralregister bzw. im Ortsregister der NSDAP im Bundesarchiv, die beide penibel geführt wurden, findet sich zwar Weihes Mitgliedskarte, darauf oder sonstwo aber nicht, dass er jemals ausgeschlossen und anschließend wieder aufgenommen worden wäre, wie man es in solchen Fällen in der Parteiverwaltung dokumentierte.
• Die Verfasserin bezieht sich mit ihrer Behauptung vom Ausschluss darauf, dass „man“ Weihe vorgeworfen habe, … mit einer „unarischen“ Frau verheiratet zu sein … . [Das war] eine ungerechtfertige Intrige. Seine Frau Anna Bertelsmann stammte aus einer sehr angesehen Familie.“ Der Satz reproduziert die antisemitische Perspektive der Nazi-Zeit: hier die Nicht-Arierin, die Jüdin, dort die angesehene „arische“ Familie. Ich gehe davon aus, dass das ebenso wie bei anderen Formulierungen mit falscher oder unklarer Sichtweise keine Absicht war, sondern gedankliches und sprachliches Ungeschick, dennoch m. E. fatal und kennzeichnend für die fachliche Kompetenz der Schreiberin.
• Nichts vom angeblichen Ausschluss/Wiedereintritt ist durch einen Beleg auch nur als Möglichkeit plausibel gemacht. Belegt ist vielmehr das Folgende: Weihe wird eingeräumt, dass er trotz „nicht rein arischer Abstammung seiner Ehefrau … weiter der NSDAP ohne Einschränkung der Mitgliedschaftsrechte angehören kann.“ So kein Geringerer als Adolf Hitler am 20.12.1938 in einem Führer-Erlass (BAB, VBS 1, 1/1.130.017.081).
• Weihe habe ein Buch von Churchill „vor den Flammen der Bücherverbrennung“ gerettet. Die Aussage ist einem Entlastungsschreiben im Entnazifizierungsverfahren entnommen. Es gab im Siegerland keine Bücherverbrennungen, und der Sprecher behauptete sie auch nicht. Es handelt sich um eine Erfindung der Verfasserin.
• „So wurde Weihe Landrat in Radom/Polen. Er arbeitete in Kalisch.“: Radom lag im Generalgouvernement, Kalisch im Warthegau. Hier war er zuerst eingesetzt, nämlich als kommissarischer Regierungsprädident, dann in Radom als Kreishauptmann (Markus Roth, Herrenmenschen. Die deutschen Kreishauptleute im besetzten Polen – Karrierewege, Herrschaftspraxis und Nachgeschichte, Göttingen 2009, 2. Aufl., S. 509).
• „Vor Kriegsende hat er sich außerdem mit Pfarrer Münker für den Rückzug der Truppen aus Siegen eingesetzt.“ Gemeint ist der Mitbegründer des DJH Wilhelm Münker, nicht Pfarrer, sondern Unternehmer. Anzunehmen ist, dass die Verfasserin Münker mit dem Pfarrer Hermann Müller durcheinanderbrachte.
• „Unter Lebensgefahr“ sei Weihe zu einem rettenden General Engel unterwegs gewesen, heldenhaft habe er gegen die Partei und in Todesgefahr für die Bevölkerung gekämpft „wie der Kapitän auf seinem untergehenden Schiff“. Bei Elkar (S. 283f.), den die Verfasserin in ihrer Literaturliste angibt, steht etwas anderes. Der Handelnde ist dort Wilhelm Münker, Weihe eine Figur am Rande ohne jegliche Initiative, ein Angsthase, den Münker zur Fahrt zu Engel habe „nötigen“ müssen. Weihe habe Angst um sich und um seinen Wagen gehabt. Nicht um einen Abzug aus Siegen ging es dabei, sondern um das nördliche Siegerland. Münker diplomatisch oder auch mit Spitze im Entnazifizierungsverfahren zu den Ereignissen: „Landrat Weihe war für alle Maßnahmen im Sinne des Guten und Schönen.“
• „Durch die Übernahme der Regierung, wurden automatisch alle Personen der höheren Ämter festgenommen.“ Der Verfasserin geht es um die Mitteilung, Weihe sei festgenommen und interniert worden. Das war in allen Besatzungszonen die gemeinsame Politik der Alliierten, um NS-Einflussträger und mutmaßlich -Belastete aller Ebenen, also keinesfalls nur „Personen der höheren Ämter“ und auch nicht diese insgesamt durch Isolation in Lagern bis zum Abschluss einer ersten Überprüfung aus dem Verkehr zu ziehen. Die entsprechenden Festnahmelisten gründeten vor allem auf Angaben von NS-Gegnern im Land (und aus der Emigration).
• Zur Entnazifizierung: „Fakt ist, dass die Militärregierung ihn am 12. Juli 1948 unter den Bestimmungen der Verordnung entlastete. Er wurde in die fünfte Kategorie eingestuft: unbedingt tragbar, makellos, ohne Sperre.“ Das ist unzutreffend. Die Militärregierung stufte ihn in III ein, der ungünstigsten Kategorie in den Massenverfahren. Der deutsche Ausschuss (Hauptausschuss) war wie immer freundlicher, aber in diesem Fall auch gespalten. Fünf Mitglieder waren für IV, fünf für V. Deshalb: „Wir bitten die Militärregierung um Entscheidung.“ (1.12.1947) Daraus folgte Kategorie IV ohne Kontensperre, aber mit politischer und Bewegungsbeschränkung (17.12.1947). Erst im weiteren Berufungsverfahren wurde daraus durch die nun wiederum deutschen Ausschussmitglieder V = „unbelastet“. Für seine Beurteilung übernahm der Ausschuss schlicht eins zu eins unbelegte Selbstaussagen und unbelegte Aussagen von Entlastungszeugen.
• „Die Richter“ hätten Weihe entlastet. Gemeint sind die Ausschussmitglieder. Richter gab es in den Verfahren keine, weil sie ja keine Strafprozesse waren. Die Verfasserin scheint den Unterschied nicht zu kennen. Überhaupt scheint sie die Regelungen des Entnazifizierungsverfahrens weder in der Form noch dem Inhalt nach zu kennen.
• Einen Ausschluss aus der NSDAP teilte Weihe im Entnazifizierungsverfahren nicht mit, obwohl er hier ja bestens gepasst hätte. Die Verfasserin hätte aus dieser Leerstelle den notwendigen Schluss ziehen müssen. Den Führererlass ließ Weihe auch fort. Auch das fiel ihr nicht auf, oder sie kannte ihn nicht.
• Über ihre vormaligen Parteimitgliedschaften schwiegen die entsprechenden Entlastungszeugen. Die Verfasserin schweigt darüber oder ist ohne Problembewusstsein. Sie verschweigt auch den Opportunismusvorwurf gegen Weihe (Pg., „um sein Amt zu halten“), der von mehreren Zeugen kam.
• In Übertragung einer Behauptung aus einem dieser zahlreichen Entlastungs- und Leumundsschreiben: „So gelang es ihm, die grundlos inhaftierte Frau von Cantstein zu befreien.“ Das mag so gewesen sein oder auch nicht, es ging jedenfalls um eine Frau von Canstein.
• 1944 habe es viele Lager „für Kriegsgefangene und Fremdarbeiter“ – die Verfasserin scheut den Rückgriff auf die NS-Terminologie nicht – im Kreisgebiet gegeben. „Zu der Zeit waren viele Zivilisten bewaffnet und suchten die Wälder nach Alliierten ab“: einfach nur Unsinn.
Sprachlich-Gdeankliches:
• „Die Entnazifizierungsunterlagen besagen weiter, Weihe habe die Judenaktionen und die Vernichtung der Erbkranken verurteilt und sich nicht an Rassenverfolgungen beteiligt. Trotzdem brannte am 10. November 1938 die Siegener Synagoge …“.
• „Wer nicht starb, wanderte aus.“
• „So konnte sich das Siegerland im September 1944 damit rühmen, ‚judenfrei’ zu sein.“ „Das Siegerland“? Wer bitte hätte das verkündet? Oder ist es die Verfasserin, die findet, damit hätte „das Siegerland“ sich (etwa ganz zu recht) rühmen können?
• Ein Satz wie „Der Nationalsozialismus und der daraus folgende Zweite Weltkrieg haben große Spuren hinterlassen – auch in Siegen. Viele Menschen waren damals am Spiel der Mächte beteiligt“ wird dem Thema wenig gerecht und weist die Schreiberin als themenfremd und/oder als Schwadroneuse aus.
Die inhaltliche Betrachtung breche ich hier ab und komme zur Form:
• Fußnoten fehlen völlig, keine der Aussagen ist einem Beleg zugeordnet.
• Die angegebene Liste von Primärquellen weckt Zweifel, ob bzw. wie sorgfältig nach Belegen gesucht wurden/mit ihnen gearbeitet wurde:
a) „Entnazifizierungsakten“, ohne Bestandsbezeichnung und Signatur
b) Dreimal nennt die Verfasserin zwar Archivalien, bezieht sich aber nur auf deren Nennung in der Literatur „Oberpräsidium Münster generell (z. B. Nr. 7443 lt. Stelbrink)“, „Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin, HA Rep. 77 Ministerium des Innern generell ( z. B. Nr. 4435 lt. Stelbrink)“, „Bundesarchiv Berlin Document Center, Nr. Akte Weihe (lt. Stelbrink)“. Da hat sie sie dann offenbar herausgeschrieben, ohne ins Original zu gucken. In einem Ausnahmefall ist einmal eine Signatur angegeben (Bundesarchiv, R 18/3.819), was darunter zu finden sein soll nicht. Worauf im Text sie sich damit bezieht, natürlich auch nicht. In einem anderen Fall ersetzt die Archivadresse einschließlich Telefonnummer die Angaben („Archiwum Panstwowe w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Zlota 43 Tel: 73-591“).
c) Da wichtige Angaben (Führererlass zu Weihes Parteirechten, Einstufung in Kategorie III, …) im Text fehlen, die in den angegebenen Primärquellen enthalten sind, wurden diese Angaben entweder verschwiegen oder waren unbekannt, weil die Quellen entgegen dem Anschein nicht eingesehen wurden.
d) Ein Quellentyp sind „Zeitzeugen“angaben, nämlich eines Sohns des Landrats. Sie sind reichlich in den Text eingearbeitet. Sie werden gläubig/quellenunkritisch/ungeprüft übernommen. So kann man an die Dinge nicht herangehen. Ohne eine Absicherung/Überprüfung geben diese Angaben Ansichten des Sohns wieder, sind Selbstauskünfte des Sprechers über sich, mehr nicht.
d) Die Angaben zu den als Quellen herangezogenen Medien (Siegener Zeitung u. a.) sind z. T. unüberprüfte, tatsächlich unzutreffende Übernahmen aus Lothar Irles „Persönlichkeitenlexikon“, das exakt dieselben Fehler enthält. Die Originale dürften also gar nicht eingesehen worden sein.
• Das Literaturverzeichnis entpuppt sich als ein (unzureichender) Lesevorschlag zum regionalen NS. Mit dem Aufsatz der Verfasserin hat es kaum etwas zu tun hat, denn die genannten Schriften enthalten in der Mehrzahl tatsächlich entweder gar keine oder nur minimale Angaben zu Weihe.
Zur eingehenderen Beschäftigung mit dem Leben Weihes sei auf folgende Literatur hingewiesen:
Romeyk, Horst: Die leitenden staatlichen und kommunalen Verwaltungsbeamten der Rheinprovinz 1816 – 1945, Düsseldorf 1994, S. 805.
Landratsamt Simmern/Hunsrück: Landkreis Simmern, in: Heimatführer der deutschen Landkreise ; 2, Bonn 1967, S. 100.
Rademacher, Michael, Handbuch der NSDAP-Gaue 1928-1945, Vechta 2000, S. 327 lt. regionalem Personenlexikon zum Nationalsozialismus in den Altkreisen Siegen unf Wittgenstein
Ferner sind diese Archive zu konsultieren: 1) Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen, Münster:
– Kreis Siegen, Landratsamt Siegen generell [z. B. Nr. 1951 Vereinfachung der Verwaltung im Kriege usw. (Handakten des Landrats Weihe) 1941-1944] und Kreisausschuss Siegen generell
– Personalakten Oberpräsidium G 12
– Oberpräsidium Münster generell (z. B. Nr. 7443 lt. Stelbrink)
2) Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin
– HA Rep. 77 Ministerium des Innern generell ( z. B. Nr. 4435 lt. Stelbrink)
– HA Rep. 90 Staatsministerium
– HA Rep. 125 Prüfungskommission für höhere Verwaltungsbeamte
Gerade finde ich in Martin Dröge (Hg.): Die Tagebücher Karl Friedrich Kolbows (1899 – 1945). Nationalsozialist der ersten Stunde und Landeshauptmann der Provinz Westfalen, Paderborn 2009, drei Belege auf die Bekanntschaft von Kolbow und Weihe.
Es ist schon interessant, wie sich die Arbeit an der Biografie zu Weihe entwickelt, angefangen mit dem kleinen Aufsatz von Frau Pittelkow. Angesichts der nachfolgenden notwendigen Korrekturen und Ergänzungen stellt sich die
Frage, ist Frau Pittelkow nicht betreut worden, fühlte sich keiner von Seiten der Universität oder des Kreisarchivs dafür verantwortlich? Manche
Kritikpunkte hätten sich sicherlich frühzeitig beseitigen lassen oder wird hier extrem dem Prinzip des Web 2.0 gehuldigt? Verantwortung sieht anders aus!
1) Der kleine Aufsatz von Frau Pittelkow war mehrere Jahre kritiklos auf der Kreishomepage greifbar und hat solange als ausführlichste Darstellung des Lebens Justus Weihe fungiert. Die Schwächen wurden solange also auch von der regionalen Zeitgeschichte toleriert.
2) Dank gebührt Ulrich F. Opfermann, der diese Schwächen erst vor kurzem gegenüber dem Kreisarchiv benannt hat.
3) Dr. Opfermann hat sich bereit erklärt einen eigenen Text zur Diskussion zu stellen. Auch dafür ein Danke schön!
4) Aufgrund der neuen Lage wurde der Text von Pittelkow nicht mehr verlinkt.
Fazit: Dies ist keine „extreme Huldigung“ des Prinzipes Web 2.0 , sondern ein Beleg für den bisweilen langsamen Fortschritt in der regionalen Zeitgeschichte.
Präzisierung einer Signatur:
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin:
Ober-Examinationskommission bzw.Prüfungskommission für höhere Verwaltungsbeamte, I. HA Rep. 125 Nr. 5341 (Einzelne Prüfungen, W, Weihe, Justus, Regierungsreferendar, Kassel), 1920
Eine weitere Akte findet sich im Bundesarchiv in Freiburgunter der Signatur: PERS 6/223910 (Personalunterlagen von Angehörigen der Reichswehr und Wehrmacht ). Der dort angegeben Dienstgrad lautet Oberleutnant der Landwehr.
Folgende Literatur wurde hier noch nicht erwähnt:
– “Die Juden im Siegerland zur Zeit des Nationalsozialismus”. hrsg. Dietermann, Klaus, Übach, Gerd, Welkert Hans-Joachim, Siegen 1981
– Dietermann, Klaus: Siegen – eine Stadt unterm Hakenkreuz, Stätten des Nationalsozialismus, des Widerstands und heute Gedenkstätten. Siegen 1994 – – Feldmann, Gerhard, Heintz, Mirko: Die “Heimatfront” – Krieg und Alltag im Siegerland. in: “Der Nationalsozialismus im Siegerland, Ein Quellenband zur Regionalgeschichte” hrsg. Flen-der, Armin, Schmidt, Sebastian, Siegen 2000
– Grebel, Markus, Mertens, Joachim: Spuren der Gewalt, Verbrechen von Angehörigen der SA und des FAD im Siegerland in den 30er Jahren. in: “Der Nationalsozialismus im Siegerland. Ein Quellenband zur Regionalgeschichte” hrsg. Flender, Armin, Schmidt, Sebastian, Siegen 2000
– “Krieg und Elend im Siegerland, Das Inferno an der Heimatfront in den 1940er Jahren.” hrsg. Müller, Adolf, Siegen 1981
-Pfau, Dieter: Christenkreuz und Hakenkreuz, Siegen und das Siegerland am Vorabend des “Dritten Reiches”. Bielefeld 2000
– Schmidt, Ihmke: Reaktionär oder modern? – Frauenleben im Nationalsozialismus. in: “Der Nationalsozialismus im Siegerland, Ein Quellenband zur Regionalgeschichte” hrsg. Flender, Armin, Schmidt, Sebastian, Siegen 2000
– Stelbrink, Wolfgang: Die Kreisleiter der NSDAP in Westfalen und Lippe, Versuch einer Kollektivbiographie mit biographischem Anhang. Münster 2003
– Rhein-Hunsrück-Kalender. – 65 (2009), S. 108
200 Jahre Westfalen im Jahre 2015.
Was machen Siegerländer+Wittgensteiner?
Gibt es 2017 ein Jubiläum 200 Jahre Zugehörigkeit in Westfalen?
Immerhin war der ranghöchste Westfale vor Ort zu Besuch.
Kurz. zum Zwischenstand: Man befindet sich noch in der Entscheidungsfindung. Das Kreisarchiv hat sich für 2017 bei einer Wanderausstellung des Landkreistages NRW zur 200jährigen Geschichte der Kreise in NRW als Ausstellungsort angemeldet.
„Für das Magnetbild “Schwarzes Rechteck – Gelbe Scheibe” erhielt er 1971 den NRW-Staatspreis aus der Hand des damaligen Wissenschaftsministers Johannes Rau“.
Nach Recherchen von Bernd Brandemann, Freudenberg, müsste der Satz korrigiert oder erläutert werden, da der Staatspreis des Landes erstmals 1986 vergeben wurde(„Er wurde 1986 erstmalig aus Anlass des 40. Jahrestages der Gründung des Landes vergeben“ – http://www.nrw.de/landesregierung/staatspreis-nordrhein-westfalen/ .
Die filmischen Streifzüge der 1920er bis 1980er Jahre sind im Rathaus der Stadt Bad Berleburg (Stadtarchiv, Bürgerbüro) zu einem Preis von 14,90 € erhältlich oder können zzgl. Portokosten über den Medienshop des LWL – (westfalen-medien@lwl.org), LWL-Medienzentrum für Westfalen, Fürstenbergstraße 13-15, 48147 Münster, Fax möglich: 0251/591-3982 – bezogen werden.
Das DVD-Begleitheft enthält Informationen zu den historischen Filmen.
Alle Jahre wieder das gleiche Rätsel: Als gedenkwürdig deklariert werden genau 348 Opfer, nämlich die ums Leben gekommenen Einwohner der Stadt. Wofür hält man den Tod der unfreiwilligen Gäste Siegens? Kollateralschaden, der keiner Erwähnung bedarf? Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern blieb die Zuflucht in den städtischen Luftschutzeinrichtungen, bei deren Ausbau sie zuvor eingesetzt worden waren, verwehrt, und außer den unmittelbaren Opfern während der Bombardierung gab es sicherlich weitere bei den anschließenden lebensgefährlichen Arbeiten zum Wohle der Stadtbevölkerung, z.B. der Beseitigung von Blindgängern und der Bergung Verschütteter. Oder glaubt man im Siegener Rathaus vielleicht, nur Herr Flick und Konsorten hätten von den billigen Arbeitskräften aus Ost und West profitiert?
P.K.
Der nicht von der Hand zu weisenden und mit gewohntem Verve vorgetragenen Kritik an der Pressemitteilung der Stadt Siegen fehlt m. E. wenigstens ein Lösungsvorschlag. Eine Redaktion des Textes schwebt mir allerdings da nicht vor. Wie wäre es, wenn die bald in der Siegener Oberstadt einziehenden Wirtschaftswissenschaftler mit ihren Studierenden sich mit dem Themenkomplex Zwangsarbeit auseinander setzen? Dies wird dem Charakter der Veranstaltung am 16.12. gerecht, bereichert ihn (hoffentlich) und man darf von wirtschaftsethischen Erkenntnisgewinnen träumen.
Leider irrt der geschätzte Kollege Kunzmann bei seiner „mit gewohntem Verve vorgetragenen Kritik an der Pressemitteilung der Stadt Siegen“: Diese spricht von 348 Menschen, nicht von Einwohnern oder gar von Bürgern der Stadt. Nach älteren, seriösen Quellen ist diese Zahl aufzuschlüsseln nach 290 deutschen Zivilisten, 26 deutschen Soldaten und 32 Zwangsarbeitern, so Flender (1979) und zuletzt D. Pfau (2005). Diese sicherlich in abschließenden Untersuchungen nach oben zu korrigierenden Zahlen wurden in der Vergangenheit so auch immer vom Stadtarchiv kommuniziert.
Eine andere überlieferte Aussage über den Luftangriff lautet z.B.: „Dabei starben 348 Deutsche sowie eine nie festgestellte Zahl ausländischer Zwangsarbeiter“. Ob das auf eine unseriöse Quelle zurückgeht, lasse ich offen; vielleicht kann der Autor dieses Satzes hier etwas dazu sagen. Auf jeden Fall scheint mir die Angabe „nie festgestellte Zahl“ sehr viel wahrscheinlicher zu sein als die (von wem wann und warum?) angeblich gezählten „32“. Und ob es nun 348 oder „nur“ 290 Siegener waren, halte ich für nichtssagend: Jeder Tote war genau einer zu viel, und das läßt sich durch wie auch immer lautende Summen nicht relativieren. Wenn meine Interpretation der städtischen Pressemitteilung unkorrekt war, nehme ich sie zurück. Meinen Eindruck, dass die Stadtvertreter an einer gründlichen Dokumentation der kommunalen Geschichte 1933-45 (einschließlich der sich daraus womöglich ergebenden Konsequenzen für einen gewissen Personenkult) nicht ernsthaft interessiert sind, kann ich bis auf weiteres nicht revidieren.
P.K.
Die Zahlen fußen laut Pfau und, wie das Stadtarchiv bereits kommentiert hat, auf: Hans-Martin Flender: Der Raum Siegen im Zweiten Weltkrieg. Eine Dokumentation, Siegen 1979, S. 50.
Hilfreich wäre nun die Benennung der anderen Quelle!
1) Ich beantworte dann ´mal meine Bitte selber. Kunzmanns Zitat findet sich im Wikipedia-Artikel Siegen und dieser beruft sich wohl auf: Ulrich Friedrich Opfermann: Dezember 1944. „… een licht als van een bliksemschicht en een slag als van de donder …“. In: Siegener Beiträge. Jahrbuch für regionale Geschichte 10 (2005), S. 165. Aus Opfermanns Anmerkungen geht nicht hervor, dass er Flenders Buch benutzt hat. Vielmehr verweist er auf „Siegerländer Chronik von 1940-1949“ in: Adolf Müller (Bearb.): Krieg und Elend im Siegerland. Das Inferno an der Heimatfront in den 1940er Jahren, Siegen 1981, S. 233. Allerdings schlägt Opfermann bereits hier einen Abgleich der Daten des Standesamtes und des Friedhofamtes der Stadt Siegen vor, um die Zahl ausländischer Toten zu ermitteln.
2) Leider liegt mir Flenders Buch nicht vor. Vielleicht könnte jemand dort nach der Quelle für die konkreten Zahlen suchen?
Der Artikel in der SZ vom 13.12.2014 den ich mal als regionalen Start
zur Person Fritz Klein bezeichnen möchte, beschreibt leider nur den
Zeitraum bis zum Ende des 1. WK.
Die Zeit danach wird nur kurz angerissen.
Zitat „Später nach dem Krieg, strebte Fritz Klein eine geistige Verschmelzung von Orient und Okzident an. Wie bereits eingangs erwähnt, pflegte er Kontakt zu zahlreichen Philosophen.“ SZ vom 13.12.2014 Seite 43 „Unser Heimatland“.
Mich würde interessieren, was Fritz Klein
nach dem 1. WK gemacht hat und besonders, wie
war seine Haltung zum Nationalsozialismus.
Vieleicht verfügt jemand über genauere Kenntnisse und kann diese hier mitteilen.
Fritz Klein im Nationalsozialismus wird offensichtlich nicht in den Fokus genommen s. z. B. auch
“ ….. Hauptmann Fritz Klein repräsentierte den Typ des weltläufigen preußischen Offiziers westlicher Prägung. Aus einer Siegerländer Industriellenfamilie stammend, verbrachte der Berufsoffizier seine Militärzeit ganz überwiegend bei einem rheinischen Infanterie-Regiment, meldete sich 1904 für eine einjährige Weltreise ab und wurde zwischen 1910 und 1913 jeweils für ein Jahr als Militärattaché an die Gesandtschaften in Rio de Janeiro, Kairo und Teheran abkommandiert. Schon in jenen Jahren widmete sich der Offizier, vom Dienst nicht allzu sehr beansprucht, den frühen Hochkulturen Ägyptens und Vorderasiens. Nach seiner Orient-Mission 1914–16 entwickelte sich Klein zum heftigen Kritiker der Kriegsziel- und Innenpolitik der 3. Obersten Heeresleitung und machte Kapitalismus und Imperialismus bei allen Kriegsparteien für die Katastrophe des Krieges verantwortlich. Ernüchtert war auch das spätere Fazit seiner Mission: Der „Heilige Krieg“ sei nur ein „scheinheiliger Krieg“ gewesen, da sowohl die persischen wie arabischen „Glaubenskämpfer“ ihren Einsatz überwiegend vom geschäftlichen Standpunkt aus betrachteten. Nach dem Krieg verbrachte Klein seine Jahre als erkenntnistheoretischer Philosoph und erstrebte eine geistige Verschmelzung von Orient und Okzident. Kein anderer der militärischen Führer im Orient, auch T. E. Lawrence nicht, sollte sich so weit von den imperialistischen Grundlagen seiner Expedition und den Denkgewohnheiten seines sozialen Umfeldes entfernen. ….”
in: VEIT VELTZKE: Mission in der Wüste. DIE VERGESSENE ORIENT-EXPEDITION DES PREUSSISCHEN HAUPTMANNS UND OSMANISCHEN MAJORS FRITZ KLEIN UND SEINER MÄNNE, ROTARY MAGAZIN 11/2014, http://rotary.de/gesellschaft/mission-in-der-wueste-a-6577.html (Aufruf: 25.11.2014)
Folgende weitere Literatur konnte auf die Schnelle eruiert werden:
U. Gehrke, Persien in der deutschen Orientpolitik während des Ersten Weltkrieges, Darstellungen zur Auswärtigen Politik 1, 2 vols., Stuttgart, 1960
H. Lührs, Gegenspieler des Obersten Lawrence, 5th ed., Berlin, 1936.
Adolf Wurmbach: Schriftsteller und Philosoph Major a. D. Friedrich Klein 80 Jahre alt, Siegener Zeitung, 14.1.1957
Veit Veltzke: „Heiliger Krieg“ – „Scheinheiliger Krieg“: Hauptmann Fritz Klein und seine Expedition in den Irak und nach Persien 1914-1916,in: Wilfried Loth / Marc Hanisch (Hgg.): Erster Weltkrieg und Dschihad. Die Deutschen und die Revolutionierung des Orients, München: Oldenbourg 2014, S 119-144
Siegerländer Heimatkalender 1958 mit kurzem Nachruf auf Fritz Klein
Siegerländer Geschlechterbuch 1937 mit genealogischen Angaben
Im Bundesarchiv befindet sich unter der Signatur N 1541 der Nachlass seines Adjudanten EdgarStern-Rubarth. N 1541/32 enthält „A Dying Empire or The Last Days Of The Sultans or Playing ‚Lawrence‘ On The Other Side“ (Enthält auch:
Deutschsprachiges, selbstgezeichnetes Deckblatt: „Versinkendes Reich“)
Im Buch finden sich auf S. 341 einige spärliche Hinweise zum Verhältnis Kleins zum Nationalsozialismus
1) Missverständnis des „Führers“: Zunächst ging Klein von einer Pazifizierung durch Hitler aus.
2) Parteizugehörigkeit: Klein gehörte der NSDAP von Mai 1933 bis zum 29.11.1934 an. Klein ist „aktiv“ ausgetreten.
3) in seinen Schriften finden sich ab 1938 antisemitische Stereotypen. Ein Vertreten der nationalsozialistischen Rassenideologie ist nicht nachweisbar.
Mein Eindruck: Klein war wohl zu großbürgerlich und zu individuell für den Nationalsozialismus.
In dem für die Forschung zu regionalen Funktionären der NSDAP
wichtigen Beitrag zu Fritz Müller in Band 19 der Siegener Beiträge, Jahrbuch für regionale Geschichte 2014, Seite 182 ff ist leider ein kleiner Fehler.
Die Ehefrau von Fritz Müller Auguste Münker stammte nicht wie angegeben
aus Obersdorf sondern aus Oberdielfen.
Zur Familie Münker in Oberdielfen siehe auch:
Deutsches Geschlechterbuch Band 199 Seite 265 ff.
Ebenfalls ein Dank für die Anmerkung: Da sieht man doch, dass die Siegener Beiträge wahrgenommen werden. Die Redaktion wünschte sich mehr Rückmeldungen – positive wie negative.
Dies zeigt nicht nur, dass die Siegener Beiträge wahrgenommen werden – wer würde ernsthaft daran zweifeln – , sondern es demonstriert, eine der Stärken des Web 2.0: Aktualität. Ohne diesen Hinweis, müsste man evt. ein Jahr warten bis zur Berichtigung in den nächsten Siegener Beiträgen.
Die Zahlen der Toten befinden sich bei Flender auf Seite 50 in
der oben genannten Dokumentation.
Als Quelle wird angegeben „Unser Heimatland Jahrgang 1954
(Verlag Vorländer, Siegen)“
Lieber Kollege Kunzmann, nun wird es aber ganz bunt. Lediglich Ihre zentrale Aussage unterschreibe ich vollinhaltlich: „Jeder Tote war genau einer zu viel, und das lässt sich auch durch wie auch immer geartete Summen nicht relativieren.“ Sollte der letzte Halbsatz aber als Replik auf meine Äußerungen gemeint sein, dann liegen Sie auch hier falsch. Ich habe nicht und Nichts relativiert, sondern unter Hinweis auf die in der Zahl 348 Menschen enthaltenen 32 Ausländer lediglich Ihre irrige Aussage zurechtgerückt, es handele sich dabei ausschließlich um Siegener Bürger.
Kommen wir zu den Zahlen und den Quellen: Die Angaben von Wikipedia habe ich nicht überprüft; Opfermann beruft sich, wie Kollege Wolf schreibt, auf Adolf Müller, Krieg und Elend (1981), und gibt dessen Zahlen für den gesamten Landkreis und den Zeitraum vom 4.2.1944 bis zum 23.3.1945 an: „starben 1.096 Deutsche und eine nie festgestellte Zahl ausländischer Zwangsarbeiter“. Dann kommt erst der Bezug zu Siegen: „Sie [die Bombardierung Siegens, L.B.] forderte 348 Tote (wiederum ohne Ausländer).“ Für die letzte Aussage fehlt bei Opfermann ein Quellennachweis. Flender führt in seinem Buch von 1979 auf S. 50 die von mir genannten Zahlen an und zwar im Rahmen einer Liste, die alle Opfer von Bombenangriffen auf die Stadt Siegen aufführt; dies unter Berufung auf „Unser Heimatland“ 1954. Er kommt zu einer Gesamtzahl von 715 Toten („566 Deutsche Zivilisten, 98 Deutsche Soldaten, 32 Ausländer“).
Die erste Zahl korrespondiert auffällig mit den Angaben im ersten Verwaltungsbericht der Stadt Siegen von 1950, dort werden als Opfer von Fliegerangriffen bzw. der Kämpfe um Siegen 565 Zivilpersonen angegeben. Die gescholtene Kommune gibt dort (S. 6) in der zeitgebundenen Terminologie aber auch an: „Infolge von Krankheit und Fliegerangriffen sind ferner umgekommen: 675 ausländische Zivilarbeiter (einschl. deportierte Personen), 39 ausländische Kriegsgefangenen“.
Worauf kommt es nun an: Nicht auf Zahlen und Summen, denn die sind nichtssagend, siehe oben. Es kommt darauf an, wie mit den Opferzahlen umgegangen wird. Und da konnte jeder, der es wollte, seit 1950 nachlesen, dass in der Stadt Siegen auch die zwangsweise nach hier deportierten und hier umgekommenen Menschen zumindest ‚gezählt‘ wurden. Ob diese Opfer auch immer angemessen gewürdigt wurden, steht dahin.
Lieber Herr Burwitz,
Sie wissen genau, dass Sie von mir keine gemeinen Repliken zu erwarten haben. Mit meiner in der Tat „zentral“ gemeinten Aussage wollte ich nur dem Verdacht vorbeugen, mir ginge es um irgendwelche statistischen Spitzfindigkeiten.
Herrn Opfermanns Originalbeitrag hatte ich gestern gerade nicht zur Hand, deshalb der provisorische Griff nach Wikipedia.
H.-M. Flenders „Quelle“ ist, wie hier schon erwähnt, „Unser Heimatland“. Das sind bekanntlich jährlich zusammengestellte Nachdrucke von Artikeln der „Siegener Zeitung“. Ob der entsprechende Beitrag dort als „seriöse Quelle“ zu betrachten ist oder ihm wenigstens eine solche zugrunde lag, wäre zu klären. Die Widersprüche zu dem von Ihnen dankenswerterweise zitierten Verwaltungsbericht (seriösere Quelle als die Zeitung) springen nun natürlich ins Auge: Laut letzterem „sind ferner umgekommen: 675 ausländische Zivilarbeiter (einschl. deportierte Personen), 39 ausländische Kriegsgefangenen“. Das ist nun wahrlich eine andere Größenordnung als die von Unser Heimatland bzw. Siegener Zeitung insgesamt für den Zeitraum 1940-45 angegebenen 51 Ausländer, auch wenn sich „675+39“ vielleicht nicht nur auf das Stadtgebiet beziehen sollte.
Mit Ihrem letzten Satz „Ob diese Opfer auch immer angemessen gewürdigt wurden, steht dahin“ haben Sie sehr treffend zusammengefasst, worauf ich letztendlich hinweisen wollte: Es mag ja sein, dass die Stadtoberhäupter bei ihrem „Ge(h)Denken“ immer auch eine abstrakte Zahl nicht-Siegener Opfer im Hinterkopf haben. Das ist bestenfalls Sentimentalität. Natürlich entgeht mir vieles, aber jedenfalls ist mir nicht bekannt, dass z.B. im Laufe der vergangenen 70 Jahre seitens der Stadt irgendwelche Bemühungen unternommen worden wären, den Umfang und die Bedeutung von Zwangsarbeit für die Kommune Siegen und ihre Bürger während der Kriegszeit zu ergründen und angemessen zu würdigen. Mir ist auch nicht bekannt, dass sich im Rathaus jemand beim täglichen Blick von der Chefetage hinunter auf die sogenannte „Fißmer-Anlage“ ernsthaft Gedanken darüber machen würde, wem eigentlich diese fragwürdige „Ehrung“ zuteil wird.
Dies etwas in Eile und ohne das Bedürfnis, hier mal wieder (wie es neulich in anderem Zusammenhang moniert wurde) eine Diskussion „hochkochen“ zu lassen.
P.K.
… Nicht schuldig bleiben möchte ich zum Schluß die Erwähnung des vor einigen Jahren von der Stadt in Auftrag gegebenen und seitdem von den Mitarbeitern des Stadtarchivs in mühseliger Kleinarbeit angelegten „Gedenkbuches für die Opfer von Krieg und Gewalt“. Nach bisherigem Stand wurden bereits annähernd 700 ausländische Zwangsarbeiter (Russen, Polen, Franzosen, Belgier, Niederländer, Tschechen) namentlich erfaßt, die während des 2. Weltkriegs in der Stadt Siegen gewaltsam ums Leben kamen, darunter viele Kinder und Jugendliche. (Dank an Herrn Burwitz, der mich gestern darauf aufmerksam machte und fleißig zählen ließ.) Es bleibt nun zu hoffen, dass die Existenz dieses wachsenden Verzeichnisses nicht als Alibi dafür herhalten muss, es bei öffentlich zelebrierter Betroffenheit nach Vorgabe des Terminkalenders bewenden zu lassen. Stadtgeschichtsschreibung, sofern sie wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht werden und sich nicht mit bequem vor Ort recherchierbaren Teilaspekten begnügen will, bedürfte wegen des großen zeitlichen und finanziellen Aufwandes der institutionellen Förderung; verbale Interessebekundungen allein wären nicht ausreichend.
Die von H.-M. Flender 1979 nach „Unser Heimatland“ wiedergegebene ominöse Tabelle war in einer 60seitigen Sonderbeilage zur „Siegener Zeitung“ („Aus Not und Verderben zu neuem Aufstieg“, S. 32) vom 16.12.1954 ohne Nachweis der Quelle (falls es ein Nachdruck war) oder der zugrundeliegenden amtlichen Erhebung(en) veröffentlicht worden.
P.K.
Dieser kostenfressende „Lehr-Stuhl“ ist so unnötig wie ein Kropf.
Die rheinische Landesgeschichte wird vor Ort in den Vereinen viel besser und kostengünstiger vertreten.
Die protestierenden Unterschreiber können ja durch eine monatliche Zahlung einen Stiftungslehrstuhl finanzieren.
Übrigens: warum nicht auch ein „Lehr-Stuhl“ für westfälische Landesgeschichte?
In der Rubrik „Debatte“ der Petition für die Erhalt wurde das Argument, das Vereine kostengünstiger Landesgeschichte betrieben könnten, wie folgt zurückgewiesen: „Die Vereine sind angewiesen auf eine wiss. Instanz wie die Rhein. Landesgeschichte an der Uni mit ihren fachlichen Kompetenzen und die Uni. ist auf die Lebendigkeit, die Kreativität u. das Engagement der Vereine angewiesen. Dies wissen beide u. sollten sich nicht gegeneinander ausspielen lassen. Vereine gegen die Uni et vice versa auszuspielen u. dies noch mit dem – ökonomisch übrigens vollkommen unsinnigen – Argument, dass dies angeblich kostengünstiger sei – ist volks- u. betriebswirtschaftlich schlicht falsch!“
Kritische Bemerkungen von diesem Niveau sollten
nicht der Normalfall auf siwiarchiv.de sein.
Siwiarchiv .de ist einfach keine Bildzeitung!!!
Natürlich hilft der fachliche Blick über die Grenzen hinaus.
Für mich als „Frontschwein“ der regionalen Geschichte ist
die Information über und Kooperation mit anderen Institutionen von Groningen über Den Haag bis Wiesbaden, von Erfurt über Siegen bis Altenkirchen, von Altena über Wenden bis Dillenburg der alltägliche Normalfall.
Das diese Kooperation natürlich auch über die wissenschaftlichen Institutionen hinaus für Geschichts-, Kultur- und Heimatvereine gilt, bedarf eigentlich keiner Erwähnung.
Und für Westfalen-Fans sei gesagt: es gibt es auch das Regionalinstitut für westfälische Geschichte in Münster.
1) Mir fehlt ein Beleg dafür, dass Vereine besser und kostengünstiger wissenschaftliche Geschichtsforschung betreiben können. Ich würde mich sehr darüber freuen.
2) Gibt es eigentlich landeshistorische Stiftungsprofessuren?
3) Zu dieser wenig differnzierten Äußerung soll hier noch lediglich bemerkt werden, dass westfälische Landesgeschichte tatsächlich an der Universität Münster angeboten wird: http://www.uni-muenster.de/Geschichte/histsem/LG-G/ .
Ich stimme Herrn Lars hundertprozentig zu! Es muß jetzt einmal Schluß damit gemacht weden, haufenweise Geld in die Universitäten und dazu noch für Orchideenfächer zu schaufeln. Die Grund-, Haupt- und Berufschulen verkommen
Und was die Bemerkung von Herrn Wolf hinsichtlich der Kostengünstigkeit anbelangt: fast alle Geschichtsvereine haben ehrenamtliche Mitarbeiter; und diese bringen neben ihrer Freizeit auch oft genug Geld ein, um die Forschungszeile zu erreichen.
Mir scheint, historische Forschung soll auf ehrenamtlicher Basis getätigt werden, von solchen Deppen, die ihren Urlaub im Archiv verbringen und dafür noch zahlen. Ich habe beispielsweise für einen längeren Aufsatz nicht nur Zeit investiert, sondern mir entstanden auch erhebliche Fahrkosten, Kosten für Literatur, Vervielfältigungen und Gebühren. Geld für zusätzliche Übernachtungen, beispielsweise in Berlin, hatte ich aber nicht. Irgendeinen Topf, der solche Kosten übernehmen könnte, habe ich nicht gefunden. Honorare können die meisten Vereine nicht zahlen. Die Druckkosten werden aus den Mitgliedsbeiträgen gezahlt. Inwieweit in Vereinen grundsätzliche Forschung betrieben werden kann, sehe ich ganz und gar nicht. Es wäre hübsch, wenn die beiden, Lars und Ellen, denn doch wenigstens ein Beispiel eines Vereins nennen würden, der nicht nur im Geld schwimmt, sondern auch massenweise Mitglieder hat, die mit älteren Akten und sehr alten Urkunden umgehen können. Der Verein, in dem ich Mitglied bin, deckt ein größeres Gebiet ab – hat viele Mitglieder und keinen Pfennig zuviel seiner Kasse. Natürlich lässt sich mit dem Argument, dass Schulen verkommen, alles, aber auch alles tot schlagen. Dagegen möchte ich vor Augen führen, wieviele andere Orte der Kultur schon abgebaut und geschlossen wurden – Museen, Orchester, Archive etc. Vielleicht sollten die Mitglieder von Geschichtsvereinen ja erst mal Archive öffnen und ordnen, in denen sie dann forschen? Lars und Ellen, Sie vertreten hier eine merkwürdige Haltung zur Kultur, finde ich. Vielleicht ist es auch gar keine Haltung – weil es Sie einfach nicht interessiert.
Nachdem ich mir so einiges im Internet angeschaut habe, halte ich die
Uniform, die Schuurman auf dem Foto, das unter dem ersten Link von Herrn Opfermann zu sehen ist, für eine Uniform der „Weerafdeling (WA)“ der
Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) in den Niederlanden. http://www.geschiedenis.nl/index.php?go=home.showBericht&bericht_id=3163
Ein Anhaltspunkt zur Datierung des oberen Fotos sind die Fahrzeuge.
Das Auto in der Mitte ist ein BMW 501/502 „Barockengel“. Der BMW
wurde von 1952 (Produktionsbeginn) bis 1963 gebaut.
Aufgrund der Stoßstange und der Beleuchtung dürfte das abgebildete
Modell aus den Jahren 1954 – 1961 stammen.
Das Auto rechts ist ein Opel Kapitän. Bestimmung vor allem anhand des
Kühlergrills. Der Kapitän gehört vermutlich der Baureihe 56 /57 an, diese
wurde von 1956 – 1958 gebaut.
Somit ist der frühstmögliche Aufnahmezeitpunkt des Fotos 1956.
Vielen Dank! Automobilgeschichte ist nicht gerade der Bereich, wo ich mich wohlfühle. Weil aber auf dem zweiten Bild das ehemalige Nürnberger Haus (heute:City-Galerie) noch nicht steht, hätte ich vorsichtig Mitte der 50er Jahre des 20. Jhdts. getippt. So decken sich Einschätzung und NAchweis ja doch.
Auf dem zweiten Bild ist an der Bahnhofgaststätte das Werbeemblem
für „Siegener Pilsener“ zu sehen. Wo wurde das gebraut und wann stellte die Brauerei ihren betrieb ein?
Es handelte sich wohl um die Siegener Aktien-Brauerei, Siegen .“ …. Gegründet wurde die Brauerei als AG 1892, der Rechtsvorgänger bereits 1846; Spezialitäten „Siegener Pilsener“. Zweck:Betrieb von Brauereien. Erzeugnisse: ober- und untergärige Biere. Spezialitäten außerdem Germania Pils Edelbitter und Kraft-Malz-Bier. ….“ (Quelle: http://www.tschoepe.de/auktion53/katalog/477bis483.pdf, Los-Nr 480, 481). Dieser Quelle zufolge wurde die Brauerei 1957 geschlossen. 1968 erfolgte die Umfirmierung in Siegener Brauerei Gmbh – laut dieser Quelle.
Der größte Bierproduzent im Kreisgebiet hat sich von der Universität Siegen einmal eine Geschichte erarbeiten lassen. Vielleicht geht daraus etwas hervor …..
Noch wieder ein Fund. Diesmal bei Herbert Knorr, Zwischen Poesie und Leben. Geschichte der Gelsenkirchener Literatur und ihrer Autoren von den Anfängen bis 1945 (= Schriftenreihe des Instituts für Stadtgeschichte, Bd. 6), Essen 1995, S. 450. Wurmbach bedichtete für eine Schulfeier den „Tag von Potsdam“ (21.3.1933), einer Goebbels-Inszenierung, bei der Hitler und Hindenburg vor der Reichsöffentlichkeit zusammenkamen, um das historische Bündnis zwischen der älteren und der jüngeren Reaktion und den gemeinschaftlichen Sieg über den demokratischen Verfassungsstaat zu feiern. Knorr gibt ein Faksimile der Maschinenniederschrift wieder, das am Seitenende des Manuskriptblatts abschließt. Es mag also sein, dass es auf einer uns unbekannten zweiten Seite weitergeht. Noch wieder also ein Hinweis, dass ohne Einblick in die Archivalien ein vollständiges Bild nicht möglich ist! Wie auch immer, ein weiteres Selbstbild aus dem deutschen wertebewussten Bildungsbürgertum:
„Tag von Potsdam
Lasst Fahnen wehn von allen Dächern,
Verkünden uns das deutsche Jahr,
Und macht der Glocken Mund zu Sprechern
Der grossen Tat, die Sieger war.
War wie ein Sturm in deutschen Landen
Der Freiheit strahlender Beginn;
Ein ganzes Volk ist auferstanden,
Die Zeit hat einen neuen Sinn.
Der Sonne zu lasst wehn die Fahnen
Der Freiheit siegreich durch die Luft.
Und – Tritt gefasst! Wie Frühlungsahnen
Brichts aus des grossen Friedrichs Gruft.“
Tja, die energische Zuschrift von Ellen macht mich doch staunen. Von irgendwelchen Einsichten in Finanzen und Möglichkeiten der Geschichtsvereine scheint sie nicht getrübt, noch weniger aber von Kenntnissen über das Handwerkszeug, das man mitbringen muss, um überhaupt einen ordentlichen Aufsatz zur Geschichte verfassen zu können. Nur als Beispiel: viele Hobbyhistoriker glauben, dass sie gut ausgerüstet sind, wenn sie „Sütterlin“ lesen können…. angesichts von Akten des 19. Jh. sah ich schon so manchen vollmundig scheitern. Auch die Frage der Finanzen können sich Lars und Ellen vielleicht plastisch vor Augen führen, indem sie sich informieren, was häufige Archivreisen kosten, beispielsweise ins Landesarchiv (wenn man nicht gerade in Duisburg wohnt). Abgesehen davon müssen sich berufstätige Menschen für solche Reisen Urlaub nehmen…. Außerdem möchte auch ich darauf hinweisen, wie es um kulturelle Einrichtungen insgesamt bestellt ist. Seit langen Jahren sind die Kommunen klamm und kürzen, was das Zeug hält. Archive werden gerne ganz geschlossen oder auf ehrenamtlicher Basis „geführt“. So kommt es, dass Menschen städtische Archivalien „verwalten“, die deren Inhalt nicht einmal lesen können….Eine Schande, was sich hier abspielt! Den Hinweis auf Haupt- oder Berufsschulen halte auch ich für ein Totschlagargument. Wenn Sie sich nicht interessieren, Lars und Ellen, sollten sie es frei raus sagen. Aber ist es nicht ein Armutszeugnis für ein Land, dass Theater, Orchester, Museen, Archive usw. immer wieder um ihre Existenz kämpfen müssen und manche den Kampf auch schon verloren haben? Wie gehen wir mit unserem kulturellen Erbe um?
Gerade eben unterschrieben, denn natürlich geht es hier einmal mehr darum, dass Geld verschoben werden kann, das am Hindukusch verballert werden soll oder ähnlich hehren Zwecken zur Verfügung steht. Einmal mehr Kulturabau zugunsten höherer Ziele. Und die’s haben, bleiben außen vor und feixen zufrieden, während die Betroffenen übereinander herfallen. Doofer geht’s nicht?
Stichwort: Kulturabbau zugunsten „höherer Ziele“. Das ist an sich nichts Neues, leider; an Kultur wird immer wieder gerne gespart. Aber sind nicht generell die Mittel zwischen Bund, Ländern und Kommunen falsch verteilt? Muss die „Provinz“ nicht kämpfen, während der Bund gut gesättigt ist?? Das denke ich immer, wenn wieder in Berlin z. B. wieder einmal ein (staatliches) Museum im neuen Glanz erstrahlt, während in Kommunen gekürzt oder ganz gestrichen wird? Und nach Ehrenamtlern geschrieen wird? In diesem Zusammenhang möchte ich noch erwähnen, dass Unkosten, die durch die Ausübung des „Ehrenamtes“ entstehen, nicht einmal bei der Steuererklärung geltend gemacht werden können. Da hält die Finanzverwaltung sich vornehm zurück.
Es gab damals eine kreisfreie Stadt Siegen mit einem eigenen Straßenverkehrsamt. In dieser Stadt wurden Kennzeichen vergeben, die einen einzelnen Buchstaben als Mittelkennzeichen hatten. Im Landkreis Siegen gab es Doppelbuchstaben.
Übrigens:
1) Das heutige System der Autokennzeichen wurde in der Bundesrepublik Deutschland am 1. Juli 1956 eingeführt – s. Wikipedia.
2) Am 1. Juli 1966 erfolgte die Eingliederung der kreisfreien Stadt Siegen in den Landkreis Siegen. Allerdings stammen die Bilder aus Kreuztaler Privatbesitz …..
Alles klar Herr Dr. Opfermann. Was ist nun Ihre Schlussfolgerung? Sie müssen Leben und Werk zusammenhängend betrachten. Es ist eine biographische und literaturwissenschaftliche Analyse seiner Werke in der Periode der NS-Zeit notwendig. Mit einer pauschalen Vorverurteilung sollten Sie vorsichtig sein. Dann müssten Sie die Werke vieler nicht-nationalsozialistischer Künstler, die in dieser Epoche in Deutschland gwirkt haben, aus dem Kanon verbannen (Carossa, Benn, Richard Strauss, Hans Pfitzner, Erich Kästner ( – auch der hat für das Regime gearbeitet) usw.
Hier wird niemand vorverurteilt. Es wurde ein Text bekannt gemacht, der nicht sehr bekannt ist. Obwohl er schon lange veröffentlicht wurde. Offenbar wurde die Arbeit von Knorr, in der der Text nachzulesen ist, in der Heimat Wurmbachs nicht oder nur unzureichend rezipiert. Sollte das besser so bleiben?
Was hat es mit einer „(Vor-)Verurteilung“ zu tun, wenn der Text bekannt gemacht wird? Warum diese Abwehr?
Das Objekt möglicher Abwehr ist m. E. ganz besonders gründlich zu betrachten. Da muss man es wohl auch kennenlernen können? Und es wäre zu diskutieren? Mit dem Ziel, mehr Klarheit zu bekommen? Also ohne die Diskussion gleich mit „Vorverurteilung“ eher schwierig zu machen?
Gerade frage ich mich nach der Bedeutung der Bemerkung, Leben und Schriften seien im Zusammenhang zu sehen. Da fehlt mir was: Zeit (Gesellschaft, Kultur, Politik), individuelles Leben und Schriften. Ein Kontext der nicht ohne Widersprüche in den individuellen Biografien bleiben kann. Das würde ich wohl auch für Wurmbach annehmen. Nochmal: was hat das mit Vorverurteilung zu tun?
Niemand hat hier bislang behauptet, Wurmbach sei ein geradlinieger Aktivist oder auch nur ein passiver Anhänger der NSDAP gewesen. Aber warum soll ausgeschlossen sein, dass er sich opportunistisch verhielt wie andere auch? Und nun einmal kein Widerstandskämpfer, keine „Lichtgestalt“, sondern ein (nicht ganz stummer) Mitläufer war, der unter den gegebenen Bedingungen seinen Vorteil suchte? Und nun eben einmal weiter Gedichte schreiben und gedruckt sehen wollte?
Ob das oder auch eine andere Einschätzung ihm gerecht würde, lässt sich doch nur sagen, wenn man was von ihm weiß. Möglichst viel natürlich. Und eben auch das vielleicht Unerwartete, das Widersprüchliche erfahren konnte.
Als Einstieg zur Person Vinckes bietet sich vor allem an:
Ludwig Freiherr Vincke, Ein westfälisches Profil zwischen Reform und Restauration in Preußen, hrsg. v. Hans-Joachim Behr und Jürgen Klosterhuis, Münster 1994 sowie der gleichzeitig erschienene Katalog: Ludwig Freiherr Vincke (1774-1844). Ausstellung zum 150 Todestags des ersten Oberpräsidenten der Provinz Westfalen, Münster 1994.
Die erste Publikation weist Bezüge zum Siegerland (u.a. Verkehrswesen) auf, die in der Region von den einschlägigen „Forschern“ noch gar nicht wahrgenommen worden sind.
Einen knappen Einstieg in Leben und Werk Vinckes bietet: Schleberger, Erwin: Vincke – ein Leben für Westfalen, in: Gr0ßfeld, Bernhard (Hg.): Westfälische Jurisprudenz, Münster 2000, S. 193 – 218. Dank an P.K.!
Dort findet sich übrigens folgendes Zitat von Annette von Droste-Hülshoff zum Tode Vinckes: „Vincke starb und ward begraben, ohne daß ein Hahn darnach krähte.“
2 Zitate zu Vinckes Wirken im Siegerland:
“ …. Der verdienstvolle, allem Neuen aufgeschlossene Oberpräsident von Westfalen, Freiherr Friedr. Wilh. Ludwig von Vincke, unternahm 1835/36 erste Schritte zu einer geregelten Ausbildung der Wiesenbauer, indem er 50 junge Leute aus den 3 westfälischen Provinzen sowie aus Köln, Kurhessen und Breslau unter Anleitung des Siegener Kreishaubergsoberförsters Friedrich Vorländer am Umbau der Wiesen des Stiftes Keppel im Ferndorftal teilnehmen ließ. …..“
Quelle: Aus einem Text für die Ausstellung der Universitätsbibliothek Siegen zum 150-jährigen Jubiläum „Von der Wiesenbauschule zur Universität“ vom 17.-27. Juni 2003 im Foyer der Universitätsbibliothek und am 28. Juni 2003 zum 2. Alumni-Tag der Universität Siegen im Audimax-Foyer; fußend auf: Annette Schnell: Zur Geschichte der Siegener Wiesenbauschule…, Hausarbeit, Siegen 1980 (maschinenschriftl.).
2) „…. Das Siegerland wurde ein Teil der Provinz Westfalen, deren Operpräsident Ludwig von Vincke der Eisenwirtschaft besonderes Interesse entgegenbrachte. Er sorgte auch dafür, daß das Siegener Einsenwesen 1819 ein „Regulativ zur Verwaltung des Berg-, Hütten und Hammerwesens“ erhielt, das die überlieferten genossenschaftlichen Privilegienzwar mit vollem Recht für veraltet erklärte, sie aber um der Ruhe willen bestätigte – zum Schaden des Siegerlandes. ….“
aus Wilhelm Treue: Wirtschafts- und Technikgeschichte Preußens, Berlin 1984, S. 416
Eine Fundgrube sind natürlich die Tagebücher, deren auf 11 Bände angelegte Gesamtedition leider noch ziemlich am Anfang steht; erschienen sind bislang erst die Bände 1 (1789–1792), 2 (1792-1793) und 5 (1804-1810). Die Jahre 1813-1818 deckt vorläufig eine ältere, separate Ausgabe (von 1980) ab. Die regionalen Vincke-Forscher werden sich also wohl noch gedulden müssen, bevor sie quellenmäßig so richtig aus dem vollen schöpfen können.
P.K.
Die Tagebücher sollten allerdings im Original in Münster einsehbar sein. Aber vielleicht startet man hier mit dem Blick in die Überlieferung der beiden Kreise, die mindestens verfilmt hier vorliegt. So findet sich bspw. im Bestand „Kreis Wittgenstein, Landratsamt“ unter der Nr. 838 ein Aktenband mit dem Titel „Korrespondenz mit dem Oberpräsidenten v. Vincke“ (1833 – 1834), der die Korrespondenz mit dem Oberpräsidenten v. Vincke u.a. wegen Gewerbeförderung u. dem Kreis-Gewerbeverein enthält. Dieser Aktenband kann verfilmt im Stadtarchiv Bad Berleburg eingesehen werden.
Im Bestand „Kreis Siegen, Landratsamt, Schenkung Stadtarchiv, Verzeichnis A“ des Kreisarchivs Siegen befindet sich unter der Signatur A 36 ein Aktenband mit dem Titel „Wegewesen im Kreis Siegen“ (1822 – 1848). Auch hier tritt Vincke in Erscheinung.
Natürlich steht es jedem frei, in Münster mal kurz die Originale durchzulesen. Vinckes Handschrift gilt, vorsichtig ausgedrückt, als Herausforderung. Ich glaube, schon Güthling hatte sich einmal an der Herausgabe der Tagebücher versucht und ganz schnell das Handtuch geworfen. Deshalb ja auch der großzügige personelle und zeitliche Rahmen des laufenden Projektes.
Vincke war ein sehr reisefreudiger Oberpräsident. Aus den persönlichen Notizen sind viele Hinweise auf dienstliche Besuche des Siegerlandes zu erwarten, die nicht immer einen direkten Widerhall in den Behördenakten gefunden haben müssen. Das wären dann Anhaltspunkte für gezielte Recherchen in diversen Archivbeständen, auf die man vielleicht ohne solche Hinweise gar nicht kommen würde. So und nicht anders hatte ich das gemeint. Dass man schon mal mit den selbstverständlichen Provenienzen (Landratsämter, Oberpräsidium, Regierung Arnsberg) starten kann, ist ja trivial.
P.K.
Im Archiv des evangelischen Kirchenkreises Wittgenstein befindet sich unter der Signatur Kirchengemeinde Wingeshausen Nr. 41 ein Aktenband zum Kirchenbau, der u. a. ein Dankschreiben des Pfarrers Ohly an Oberpräsident Vincke für die gestifteten Kirchenfenster und Bericht über deren Einbau (1831) enthält.
Im Kirchenkreisarchiv findet sich weiter unter der Signatur Kirchengemeinde Schwarzenau Nr. 42 (Verschiedenes zur Gemeindeverwaltung) die Mitteilung des Oberpräsidenten von Vincke an die Einwohner von Schwarzenau, dass der Fürst zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein nicht beabsichtige, ihnen die bisher verpachteten Ländereien zu entziehen (1842). Unter der Signatur Kirchengemeinde Schwarzenau 81 findet sich ein kurzes Anschreiben des Oberpräsidenten von Vincke, in der Streitsache der Gemeinde mit dem Fürsten Wittgenstein-Wittgenstein nicht zuständig zu sein (1843).
“ …. Die Spuren der ersten Bauern entdeckten die Archäologen im Siegerland. Hier half ein Hobby-Forscher den LWL-Archäologen dabei, die seltenen Fundstellen aus der Steinzeit um einen neuen Eintrag zu erweitern. Ein Stein-Artefakt sorgte für Begeisterung unter den Fachleuten: Die Dechselklinge stammt aus der Jungsteinzeit und kam bei den ersten Bauern als Beil oder Hacke zum Einsatz……“
Quelle: Mailingliste „Westfläische Geschichte“, 13.1.15
Ich teile gerne den Aufruf zu eurer Blogparade und wünsche euch viele Einsendungen.
Wer den Ablauf einer Blogparade gerne grafisch aufbereitet anschauen möchte – bei MusErMeKu gibt es eine übersichtliche Infografik: http://musermeku.hypotheses.org/1943
Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Wolf,
weiterhin bestes Gelingen mit siwiarchiv. Möge es zukünftig auch noch weitere Nachahmer finden – das Modell ist es wert!
Herzlichen Glückwunsch zum dreijährigen Geburtstag! Nun überschneidet sich gerade die Blogparade zum Wissenschaftsbloggen von de.hypotheses mit dieser hier von siwiarchiv. Das war leider nicht absehbar, obwohl beide zum jeweils dreijährigen Geburtstag sind. Falls siwiarchiv jemals vorhat, die Plattform zu wechseln bzw. sich einer größeren Blog-Community anzuschließen: die Tore von de.hypotheses stehen offen! Alles Gute!
2 Hinweise auf siwiarchiv:
1) Als filmisches Material ist die Siegesparade vom 9.5.1945 bekannt: s. http://www.siwiarchiv.de/?p=4385 (Dank an Kollege Köppen!).
2) Ob die Aktenedition des Siegener Politikwissenschaftlers Bellers zum Thema hilfreich ist, muss geprüft werden: http://www.siwiarchiv.de/?p=3556
Leider fehlt der Band 1807. Meine Bitte gegenüber der SuUB Bremen, den fehlenden Band zu digitalisieren wurde bisher leider nicht gehört. Vielleicht übernimmt diese Aufgabe ja eine andere Bibliothek. Das wäre sehr wünschenswert, damit der Bestand komplett im Netz stehen würde.
– Welche Überlegungen lagen der Auswahl zugrunde? Ich frage, weil Kriterien nicht erkennbar sind.
– Was sollen denn diese Schwärzungen? Geschwärzte Namen zu Vorgängen nichtigen Inhalts noch aus der Kaiserzeit?
Eine merkwürdige Ansammlung, die da ins Netz geriet.
Wünschenswert wäre eine mit den Göttinger Digitalisaten vergleichbar hohe Auflösung des Bandes 1807. Die Datei sollte dann in der DDB zur Verfügung gestellt werden und die bisher schon digitalisierten Jahrgänge der Zeitung komplettieren. Ob dies durch das Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein, das Stadtarchiv Siegen, die Unibibliothek Siegen oder eine andere Einrichtung geleistet werden kann, sollte einmal besprochen werden.
Ich schrieb oben: „ein (nicht ganz stummer) Mitläufer“. Wie liest das Folgende sich? AW schrieb es zum Jahresbeginn 1944 auf S. 4 des Siegerländer Heimatkalenders, ein Vor-Wort an den Leser. Kann man das so lesen und hat einfach nur Freude an den schönen Reimen und dem wohlgeformten Wort? Also, als ob nichts wär?
„Zum Beginn!
Der Tag geht auf so morgenklar,
Ruft ihm entgegen von den Zinnen:
Wir grüßen dich, du junges Jahr,
Zu neuem Kampf, zu neuer Fahr,
Zu neuem Wagen und Gewinnen!
Laß uns mit Großem dich beginnen!
Was ungelöst das alte ließ
In uns, das führe du zum Guten.
Es ist die Welt kein Paradies,
Und muß recht in der Finsternis
Das edle Erz der Bergmann muten.
Geläutert wirds in Feuersgluten!
Zünd an der alten Väter Licht,
Das sie im starken Glauben trugen –
In ungebrochner Zuversicht.
Bei dem sie bis zur letzten Schicht
Das Silber aus dem Berge schlugen –
Und ging die Welt drob aus den Fugen!
Wir fahren ein! Dem jungen Jahr
Glück auf! erschallts von allen Zinnen.
Zu neuem Kampf, zu neuer Fahr
Den Arm gestrafft, das Auge klar
Zu neuem Wagen und Gewinnen!
Laßt uns mit Gott es recht beginnen!“
Danke auch für diesen „Fund“! Ich frage mich, ob man die hier vorgestellten Gedichte Wurmbachs, die in der NS-Zeit entstanden, als so mehrdeutig bezeichnen kann, dass eine „Verteidigung“ möglich ist. Nach Stalingrad noch „ungebrochner Zuversicht“ zu dichten, wirft schon die Frage auf, ob sich hier nicht eindeutig um „Durchhaltelyrik“ handelt, die die Metapher des Bergbaus nutzt …….
da haben Sie beide nun doch recht. Wurmbach beschreibt die Arbeit im Bergwerk als Kampf. Natürlich lässt sich ein Beug zum Krieg herstellen. In diesem Gedicht greift er auf martialische Formulierungen zurück: „Ruft ihm entgegen von den Zinnen“, „Zu neuem Kampf“, „Geläutert wirds in Feuersgluten!“ und „Den Arm gestrafft [!], das Auge klar“. Für einen erklärten Pazifisten und Christen finde ich die Formulierungen doch sehr ungewöhnlich. Die Zeile „Zünd an der alten Väter Licht,
Das sie im starken Glauben trugen –
In ungebrochner Zuversicht.“ spielt auf den religiösen Glauben der Vorfahren an und kann natürlich als Aufruf an die Zeitgenossen zum Festhalten an der neuen Religion des Faschismus verstanden werden.
Wäre eine öffentliche Diskussion über den Dichter und Pazifisten nicht längst überfällig? Vielleicht im Rahmen einer Diskussion innerhalb der Siegener Geschichtswerkstatt? Es gibt zu Wurmbach kaum wissenschaftliche Veröffentlichungen (- eine Ausnahme ist sicherlich die Knorr-Dissertation -), geschweige denn eine erste Biographie.
Radio Siegen, 2.2.15: “Die Suche nach einem Käufer für das rund 500 Jahre alte Gemäuer wurde aufgegeben. Freie Bahn für den Förderverein, der das Gebäude bis zum Herbst für Besucher herrichten will.”
Link zum Podcast: http://radio-siegen.de/_pool/files/beitraege/779416.mp3
Danke für die Meldung! Derzeit läuft der erste Link ins Leere; der dritte funktioniert auch nicht, was aber ein Problem der FH Potsdam zu sein scheint.
Ein allgemeiner Hinweis zum Antisemitismus Vinckes aus der regionalhistorischen Literatur: „…. Der Oberpräsident der Provinz Westfalen und einstige preußische Reformer Ludwig von Vincke äußerte noch 1826 in einem Gutachten, der Jude sei „ein Mensch, der Kunst und Wissenschaft nicht ehrt und sich ihnen nicht widmet, wenn sie nicht unmittelbar zum reichen, raschen Gelderwerb ihm die Aussicht bieten, der den Ackerbau und das Handwerk meidet, weil jede ruhig, anhaltende und körperliche erfordernde Arbeit, die nur langsamen Gewinn verspricht, ihm zuwider ist.“ In einer für den preußischen König bestimmten Stellungnahme machte Vincke als vehementer Anhänger der Judenbekehrung den Vorschlag, alle Juden innerhalb einer Zehnjahresfrist vor die Alternative zu stellen, sich entweder taufen zu lassen oder das Königreich endgültig zu verlassen. ….“
aus: Dieter Pfau: Die Geschichte der Juden im Amt Ferndort (1797-1941). „Den Juden ist aber hier kein Leid zugefügt worden.“, Bielefeld 2012, S. 24
Siehe dazu den informativen Beitrag „Vincke und die Juden“ von
Diethard Aschoff und Rita Schlautmann-Overmeyer in:
H.-J. Behr; J. Kloosterhuis (Hg.), Ludwig Freiherr Vincke. Ein westfälisches Profil zwischen Reform und Restauration in Preußen, Münster 1994, S. 289-308.
Danke für diese Ergänzung! Der Hinweis zu dieser Literatur war der Fußnote zum zitierten Passus nicht zu entnehmen. Auch die Literaturliste enthält den Aufsatz nicht. Ob diese antisemitische Haltung Vinckes Auswirkungen auf die jüdischen Bewohnerinnen und Bewohner im Kreisgebiet hatten, ist wohl noch nicht untersucht worden?
Vinckes Verhältnis zu Juden ist bereits früher in den Blickpunkt geraten – vermutlich unter anderem Vorzeichen: Wilhelm Steffens: Oberpräsiddent Vincke und der 1. Provinziallandtag 1826 zur Judenfrage in Westfalen, in Westfalen 23 (1938), S. 95 – 104
Klasse Fundstück. Der Mitteilung zufolge genügt eine 63jährige Witwenschaft zur Qualifikation für die Ehrenbürgerwürde. Da hätte ich auch noch ein paar …
Das ist einfach nur widerlich und peinlich!!!
Wer welches Gesellschaftssystem besser findet, ist für die Art und Weise der Industriespionage der früheren DDR von keiner Relevanz. Dies gilt genauso für die derzeitige Schulpolitik der Stadt Siegen.
Wenn eine solche unsachliche, persönliche Hetze eines vermeintlichen Vertreter der wissenschaftlichen Intelligenz den Weg in die Presse findet, ist dies schlimm genug.
Der Administratot wird hier ernstlich an seine Aufsichtspflicht erinnert.
Wenn der Archivblog siwiarchiv in seiner Informationsarbeit auf das Niveau der Siegener Zeitung absinkt sollte er besser eingestellt werden.
Prof. Bellers fungiert hier als Gastautor, die historischen Angaben sind mit Quellennachweis belegt und können – gerne – überprüft werden und die Meinungsäußerung des Gastautoren ist bereits publiziert gewesen. Eine Kürzung meinerseits käme daher der Zensur gleich.
Generell ich halte siwiarchiv für den Platz, an dem historische Nachrichten, die mit subjektiven Einschätzungen verquickt sind, sachlich (!) auseinander genonmmen werden können und sollten.
Es ist ja erfreulich, dass der Politologe Jürgen Bellers so tapfer gegen das Unrecht in Ost und West streitet. Vielleicht möchten auch seine an dieser Stelle eines disziplinar- und strafrechtlich relevanten Verhaltens (Verrat von Dienstgeheimnissen ans Ausland) bezichtigten ehemaligen Kollegen Bauingenieure ein bißchen Gerechtigkeit für sich beanspruchen: Was auch immer sich in den 1980er Jahren zugetragen haben mag, Herrn Prof. Bellers Aufgabe ist es wohl kaum, nach der Lektüre einer Stasi-Akte öffentliche Vorverurteilungen vorzunehmen. Wenn sich ihm der begründete Verdacht auf Straftaten ergeben hat, steht es ihm frei, dies zur Anzeige zu bringen. Bis zu einem gerichtlichen Urteilsspruch würde dann, wie immer, die Unschuldsvermutung gelten. Abgesehen davon nehme ich an, dass sich Herr Bellers vor Einsicht in diese Akte verpflichten mußte, keine personenbezogenen Informationen daraus zu veröffentlichen. So riesige Forscherteams haben sich in den 1980er Jahren in Siegen sicher nicht mit Steinzerfall und Keramikplättchen beschäftigt, dass den Mitarbeitern der betroffenen Institute nun keine konkreten Namen dazu einfallen würden.
Schließlich sei daran erinnert, dass Stasi-Akten auch eine Menge grotesken Unsinn enthalten. Wenn ich alles für bare Münze nehmen würde, was in meiner steht, müßte ich mich entweder aufhängen oder totlachen.
P.K.
1. die namen der je mehr als 7 projektmitarbeiter in siegen liegen mir nicht vor.
2. aber die akten sind sehr eindeutig und nicht wie andere, die eher nebulös sind, auch bezüglich meiner stasi-akte und die meiner frau. da steht wirklich oft Unsinn drin. oder hinsichtlich der unklarheiten in stolpes akte. die akten über die uni siegen sind eindeutig und unbezweifelbar.
3. rückschlüsse auf Personen sind durch die projektnennungen nicht möglich, siehe oben. auch dritte außerhalb der Projekte hatten ja zugang zu deren unterlagen. hätte ich stattdessen die gesamten Bauingenieure nennen sollen? das hätte ja den kreis der verdächtigen vergrößert.
4. soll ich nun wirklich zum Staatsanwalt laufen, ich will die leute von damals nicht kriminalisieren. es geht mir nur um die öffentliche Diskussion, und dass wir lernen.
5. strafrechtlich kann man das nicht aufklären, allein wg Verjährung und weil die gerichte sehr zurückhaltend sind. nach ihren Vorstellungen wäre also nichts passiert. da ist die veröffentlichung in einer Regionalzeitung doch zumindest etwas. auch für die opfer.
6. meine Kampagne gegen die linke war vielleicht unangebracht und der Sache nicht dienlich. aber zuweilen bin ich auch etwas verbittert, da meine gesamte Familie infolge DDR-haft bis heute schwerbehindert, auf dauer.
Mit Verlaub, ein paar Anmerkungen:
zu 1) Nachdem die konkreten Projekte genannt wurden, wäre es eine Sache von wenigen Minuten, anhand öffentlich zugänglicher Nachschlagewerke die Namen der Mitarbeiter herauszufinden. Insider aus den Instituten, die dort schon länger tätig sind, bräuchten nicht einmal nachzuschlagen. Das Problem ist weniger, dass vielleicht wirklich schuldig gewordene Personen unter Verdacht geraten, sondern dass es gleichermaßen die Unschuldigen trifft. Irgend etwas von einmal in die Welt gesetzten Gerüchten bleibt bekanntlich immer hängen. Und logischerweise ist es unmöglich (auch Ihnen, mir, dem Papst), zu beweisen, dass man niemals für einen Geheimdienst gearbeitet hat: Die Verleumder können immer kontern, dass man eben bloß seine Spuren erfolgreich verwischt hat.
zu 2) Wie „eindeutig und unbezweifelbar“ kann eine Stasi-Akte sein? Steht in der von Ihnen eingesehenen wirklich drin: „Ich, Mitarbeiter X. / Y. / Z. der Uni Siegen, habe bewußt und vorsätzlich folgende Spionagedienste für die DDR geleistet …“? Und haben Sie von Fachleuten prüfen lassen, ob die an die DDR gelangten Forschungsergebnisse tatsächlich geheim waren und nicht vielleicht schon veröffentlicht oder zur zeitnahen Veröffentlichung vorgesehen?
zu 3) Wenn Unbeteiligte Zugang zu den Projektunterlagen hatten, können die ja wohl nicht so vertraulich gewesen sein, oder?
zu 4) Die öffentliche Behauptung, identifizierbare Mitarbeiter der Uni Siegen hätten geheime Informationen an die DDR weitergeleitet, also Straftaten begangen, sehe ich schon als Kriminalisierung. Auch die Behauptung „An der Uni Siegen fand umfangreiche Industriespionage statt“ ist problematisch, weil sie einige Fragen impliziert: Ist die Uni Siegen womöglich auch heute noch ein Paradies für Industriespione (russische, chinesische, amerikanische usw.)? Hat sich die Uni Siegen unter Mißachtung ihrer gesellschaftlichen Aufgaben in so hohem Maße an die Industrie verkauft, dass Spionage hier besonders lohnenswert war oder ist? Wurden Forschungsaufträge für konkrete Industrieunternehmen mit öffentlichen Geldern finanziert? Das sollen keine Anregungen für Verschwörungstheorien sein; es sind Fragen, die sich aus Ihrem Industriespionage-Vorwurf nun von selbst ergeben. Wenn etwas dran sein sollte, müßte es aufgeklärt werden (allerdings nicht von der Siegener Zeitung oder Siwiarchiv, denn das sind meines Wissens keine Ermittlungsbehörden); wenn nicht, wäre es eine Behauptung, die dem Image der Uni Siegen nicht gerade förderlich ist.
P.K.
lieber herr Kunzmann, dank für die Diskussion, zumal wir ja durchaus freundlich an der uni miteinander umgegangen sind und ich mich an sie gerne erinnere. bin nun pensioniert.
aber: warum darf man die gesamte Reichswehr als faschistisch bezeichnen, obwohl alle meine verwandte dort sicherlich nicht faschistisch waren – im Gegenteil! aber ich ertrage dass, denn das Argument, man dürfe keine nestbeschmutzung betreiben, tötet die meinungsfreiheit.
Landesverrat – und darum, da militärisch relevant, handelt es sich hier – ist nicht erst dann gegeben, wenn man geheimnisse verrät, sondern schon dann, wenn man der Bundesrepublik schadet. das ist der Tatbestand. und schaden hat man verursacht, weil allein durch die übergabe der papiere die Bundesrepublik in ihrem ansehen (das von Ihnen angeführte „Image“) als schwächlicher Staat erschien.
vielleicht gibt es auch heute noch so etwas bei uns, wer will das ausschließen? wir sind da viel zu naiv. der Verfassungsschutz ist ja glücklicherweise schon an der uni aktiv. ausländische studenten haben mir zB erzählt, was „ihre“ Geheimdienste an der uni tun. ich sage die länder nicht, um die Studenten nicht zu gefährden. das geht sehr weit, was da abläuft. nur die deutschen wollen das nicht sehen. aber die welt ist nicht gut.
ich habe nebenbei lange zur stasi geforscht und habe sie auch selbst erlebt.
schließlich: die Mitarbeiter der Projekte und zT die projekte selbst sind nicht in den öffentlichen verzeichnissen der uni und auch nicht im forschungskatalog des BMFT. ZT erscheinen die Projekte sogar unter anderem namen. mehr an Anonymisierung geht wohl nicht.
und ganz zum schluß: ich wurde mal ein Straftat zu unrecht verdächtigt. das ist so im leben. es hat mir nicht geschadet. auch wenn das nie aufgeklärt wurde und sehr öffentlich war. (bild Zeitung) und wenn es mir geschadet hat, dulde ich das wegen der Meinungsfreiheit, die mir sehr wichtig, die aber leider bei uns immer mehr durch antifaschistische, antischwule usw. Kampagnen eingeschränkt wird. sie wissen nicht, was ich jetzt wieder an shitmails bekommen habe. die USA sind da offener. dorthin werde ich bald emigrieren. in vielen erinnert man mich die lage heute an die schwierige Aufarbeitung der nazi-zeit in den 60ern. denn die nazis war ja auch eine linke Bewegung (aber damit meine ich nicht Ihre berechtigten Kommentare. man sollte leute nie unnötig belästigen oder verdächtigen. ich bin sehr libertär.)
beste grüße ihr j bellers
Lieber Herr Prof. Bellers,
das alles ist wahrlich ein weites Feld. Ich bin (wie Sie?) kein Freund fruchtloser Spekulationen und will in Anbetracht meines begrenzten Informationsstandes nun nicht länger auf dem Thema herumreiten. Ihrer Aussage „die Welt ist nicht gut“ stimme ich voll und ganz zu. Alles Gute in Ihrer neuen Lebensphase!
Ihr P. Kunzmann
lieber herr Kunzmann, ich halte die hier aufgeworfenen fragen schon für sehr wichtig und prinzipiell, letztlich für alle Archivare und Historiker. die frage ist schlicht und einfach:
ist snowden der Straftäter, oder die, die Informationen mißbrauchen? oder der Archivar und Historiker? (womit ich natürlich nicht sage, dass ich geheimnisse veröffentlicht habe, im Gegenteil).
denn auch einige Infos von snowden haben sich nicht als richtig herausgestellt. was tun? und darf er wahre geheimnisse veröffentlichen? in den USA gibt es auch gerichte.
aber alles auf die gerichte schieben? das dauert und führt oft zu nichts und kriminalisiert. oder wahrheitskommission an der uni siegen?
ich wäre schon an der Meinung der Archivare interessiert.
beste grüße und dank ihr Jürgen bellers
Man sollte doch einmal in Siegen eine Wahrheitskommission wie in Südafrika einrichten wegen der Stasi-Vorfälle, die ja wohl nicht nur an der uni vorgekommen sind, sondern im gesamten Kreis.
Wenn man andauernd Snowden feiert (obwohl das ja Geheimnis-/Landesverrat ist), dann sollte man sich zumindest zu dieser Kommission verpflichtet fühlen, ohne die Spione vor Gericht bringen zu wollen. Das ist sicherlich eine Aufgabe der Archivare. Oder ist das wieder „widerwärtig“? (s. ersten Kommentar)
MPL
Letztlich liefe dies ja auf eine Ausweitung des hier vorgestellten Forschungsprojektes hinaus, quasi „Stasi im Kreis Siegen-Wittgenstein“, hinaus. Warum Archive dann so zögerlich auftreten? Es sind m. E. vor allem 3 Gründe:
1) bis jetzt noch nicht formuliertes öffentliches oder Nutzungsinteresse,
2) vermutlich nur spärliche und bereits zugängliche, regionale Quellen, und daraus folgend
3) nicht vorhandene personelle und finanzielle Ressourcen.
na ja, Diktaturen sollte man schon aufarbeiten, wer sie trug und förderte, das zum öffentlichen Interesse, und Gelder muß man beantragen, ich würde mitmachen, was an quellen beim mfs, weiß man erst später
Es solle mit diesen Darstellungen niemand kriminalisiert werden, heißt es, und dann im weiteren Verlauf, er, der Sprecher, sei schon mal fälschlich angeklagt worden: „Das hat mir nicht geschadet.“ Nun ja, dann darf ja wohl schon ein bisschen (oder etwas mehr) kriminalisiert werden?
Besonders ärgerlich: die allgemeinpolitische Positionierung. DDR und NS-Deutschland werden gleichgesetzt, was auf Verharmlosung von NS-Deutschland, Massenverbrechen und Krieg hinausläuft. Macht man (völlig zurecht) mit den USA und deren Foltergefängnissen usw., ja auch nicht. Bitte mal ins Geschichtsbuch schauen.
Zur Frage der „Kriminalisierung“ bzw. des Datenschutzes ist, da es sich laut Eigenaussage um ein von der Stasiunterlagenbehörde gefördertes Projekt handelt, davon auszugehen, dass die Benutzung nach den einschlägigen Regelungen des Stasiunterlagengesetzes erfolgt ist. Somit wäre den vorgetragenen Bedenken hinreichend Rechnung getragen.
Die allgemeinpoltische Positionierung wurde hier bereits mehr oder weniger deutlich nachvollziehbar beanstandet. Darauf hat der Gastautor auch reagiert. Bemerkenswert ist allerdings, dass noch nicht die Frage der regionalen Erinnerung an die Opfer der DDR diskutiert wurde, die im Eintrag m.E. ebenfalls diskussionswürdig, weil ebenfalls der Bezug zur Erinnerung an die NS-Opfer (Stolpersteine!) hergestellt wurde, angerissen wurde.
ok, also regionale Erinnerung an die opfer der DDR als forschungsprojekt, wer macht mit? Befragung?
was das BStU-G betrifft, wurden nun wirklich keine namen genannt, auch nicht indirekt erschließbar, selbst die genannten einheiten sind verfremdet, sicher ist sicher, in heutiger zeit wird ja scharf geschossen, insbesondere gegen die, die auch mal ein kritisches wort gegen links äußern, aber das ziehe ich sofort zurück, ich darf ja nicht politisieren
Vielleicht sollten wir hier weitere Fragestellungen sammeln. Die Spionage militärischer Ziele im Kreisgebiet wäre ebenfalls interessant. Die Begleitung von Ost-West-Kontakten im Kreisgebiet ein weiteres, interessantes Thema ……
an archivar: ich würde gerne diesbezüglich in ihr Archiv kommen, um zu recherchieren; vielleicht teilen sie mir mit, ob das aussichtsreich ist: juergenbellers@gmx.de
die wahrheitskommission in Südafrika hat gerade nicht krominalisiert
außerdem sollte man die DDR nicht verharmlosen, ich kenne die opfer, die noch heute in heimen schwerbehindert leben müssen
machen wir uns an die arbeit
für die Politisierung habe ich mich schon entschuldigt, weil nicht der Sache förderlich
seien wir couragiert
Die bekannte These „Die Welt ist nicht gut“ (Bellers u. Kunzmann 2015) ist zu ergänzen: „… und sie wird nicht dadurch besser, dass ich bei jedem Thema meinen Senf dazu gebe.“ Deshalb nur ganz kurz:
Zu einem Leitbegriff der noch jungen Forstwissenschaft wurde „Nachhaltigkeit“ am Anfang des 19. Jahrhunderts. Hier hätte sich für einen über Nassau schreibenden Autor der Hinweis auf G.-L. Hartig angeboten („… denn es läßt sich keine dauerhafte Forstwirthschaft denken und erwarten, wenn die Holzabgabe aus den Wäldern nicht auf Nachhaltigkeit berechnet ist.“ Anweisung zur Taxation und Beschreibung der Forste, 2. Aufl. 1804, S. 1). Forsthistoriker haben später die Bagatelle (wieder)entdeckt, dass das umgangssprachliche Wort „nachhaltend“ schon von Carlowitz in einem ihrer literarischen Klassiker benutzt worden war. Aber natürlich konnte es (bzw. die substantivierte Form) auch nach Carlowitz weiterhin umgangssprachlich für alles mögliche verwendet werden. So auch vom Autor des hier eingestellten Artikels. Der Titel ist irreführend; es geht um frühneuzeitliche Holzeinsparung, nicht um Nachhaltigkeit im forstwirtschaftlichen Sinne als Prinzip der Aufstellung langfristiger Forsteinrichtungspläne.
P.K.
2. Es geht sehr wohl um Nachhaltigkeit im forstwirtschaftlichen Sinn. Dieser besteht darin, dass nur so viel Holz gehauen wird, wie im gleichen Zeitraum nachwächst. Wie im Aufsatz erwähnt, sind absolute Zahlen fast nicht zu belegen. Ihre gewünschten Forsteinrichtungspläne auf Grunddaten basierend wie z. B. Vorrat, Vornutzung, Alter und Ertragstafeln mit Bestockungsgraden, Bonitierungen etc. sind meines Wissens nach für die Frühe Neuzeit nicht existent und erst mit preussischer Herrschaft annähernd zu fassen. Ich kann im Detail z. B. nicht sagen, 1589 wurden auf Fläche xy ein nachhaltiger Hiebssatz angewandt und nur 50fm pro ha Holz gehauen. Stattdessen wurde im Aufsatz der Weg aufgezeigt, dass immer mehr Holz angepflanzt als geerntet wurde. Nicht mehr und nicht weniger.
3. Und so sind diese paar Seiten zu betrachten, als Schlaglichter einer regionalen Alltagswelt, eingebettet in das größere Thema Carlowitz und Nachhaltigkeit.
Der Sinn, wiederholen Sie, besteht darin, „dass nur so viel Holz gehauen wird, wie im gleichen Zeitraum nachwächst“. Für diese Formulierung sind Sie nicht verantwortlich zu machen; sie geistert seit langem in verschiedenen geringfügigen Variationen aber mit jedesmal demselben logischen Grundübel durch die Medienwelt und wird immer aufs neue gedankenlos abgeschrieben. Was soll der erwähnte „Zeitraum“ bedeuten? Welchem anderen soll er „gleich“ sein? Was soll man sich unter dem abstrakten „Holz“ vorstellen? Die vielleicht einzige Möglichkeit, diese sprachliche Fehlgeburt so zu interpretieren, dass nichts Falsches herauskommt, führt zu der Aussage „Auf einer im Jahr x abgeernteten Fläche wird im Jahr x+n nicht mehr Biomasse gewonnen, als in den vergangenen n Jahren nachgewachsen ist“. Trivialer geht es freilich nicht! Aber ich vermute, dass sich hinter der Verklausulierung sowieso nur die bekannte Devise verbirgt: „Wälder sollen in der Gegenwart so behandelt werden, dass sie auch zukünftigen Generationen noch zur Verfügung stehen werden.“ Das ist nun allerdings banal. Ein vorhandener Wald bleibt solange ein Wald, wie er forstlich genutzt wird. Hören Nutzung und Pflege auf, ist er immer noch ein Wald, der allmählich verwildert. Bestand die letzte Kulturmaßnahme im völligen Kahlschlag, bildet sich eine natürliche Waldgesellschaft über die Zwischenstufe der Heide wieder heraus. Wenn ein Wald verschwindet, dann deshalb, weil außerhalb des Forstwesens stehende Interessenten (z.B. argentinische Viehfarmer oder deutsche Gewerbegebietsplaner) sich durchsetzen konnten, nicht deshalb, weil der Förster zu viel Holz schlagen ließ.
Ich bin nicht streitsüchtig und habe auch nicht die Zeit, seitenlang ins Detail zu gehen. Jeder Mensch darf „Nachhaltigkeit“ so interpretieren, wie er will. Ich selbst bleibe dabei, dass die zahllosen frühneuzeitlichen Forstregelungsversuche in Europa Ausdruck hausväterlicher Sparsamkeit waren, einer Tugend, die das kleine Haus des Familienoberhaupts ebenso wie das dem Landesvater unterstellte „große Haus“ des Staates ansprach. Wenn, wie damals gefordert worden war, jemand sein Grundstück mit einer lebenden Hecke umgab und kein gutes Bauholz für einen Lattenzaun verschwendete, war das vernünftige Ressourcenschonung, aber keine forstliche Nachhaltigkeit. Anlaß für die starke Verwissenschaftlichung im Forstwesen seit dem ausgehenden 18. Jahrhunderts war nun gerade die Wahrnehmung, dass simple Sparsamkeit, gesunder Menschenverstand und einseitig kameralistisch geprägte Forstpolitik den besorgniserregenden Verfall der Wälder bislang nicht hatten aufhalten können und erst recht nicht die für die Zukunft befürchtete oder lokal schon eingetretene Bauholzkrise (nicht Holzkrise schlechthin, auch nicht Energieholzkrise) abwenden würden. Mit der komplexen Forschung unter dem Leitmotiv „Nachhaltigkeit“ kam eine neue Qualität in die Behandlung des Forstwesens, die so in den vorangegangenen 2-3 Jahrhunderten eben noch nicht präsent war. Man stellte sich der enorm anspruchsvollen Herausforderung, Forsten so zu planen und zu pflegen, dass sämtliche Interessentengruppen – vom Küfer über den Zimmermann bis zum Schiffsbauer – kontinuierlich und über lange Zeiträume zu ihrem speziell benötigten Holz kamen, ohne sich gegenseitig etwas streitig zu machen. So entstanden um 1800 Pläne, die unter Berücksichtigung teils langer Umtriebszeiten bis weit ins 20. Jahrhundert ausgearbeitet waren, leider aber schnell zu Makulatur werden konnten: Auch Forstexperten waren keine Propheten und konnten beispielsweise in der Segelschiff-Ära nicht voraussehen, dass demnächst kaum noch 150jährige Eichenstämme für Schiffsmasten benötigt würden, dafür aber nun hunderttausende aus jüngerem Buchenholz gesägte Eisenbahnschwellen. Im übrigen ging es bei diesen Sisyphusarbeiten um den Hochwald. Separate Niederwälder hatte man mit im Blick, aber da waren die Verhältnisse unvergleichbar simpler. In der Theorie konnte eine der Energieholzgewinnung dienende geregelte Niederwaldwirtschaft (solange sie nicht durch agrarische Nebennutzungen gestört wurde) gar nicht anders als „nachhaltig“ entworfen werden, weil es keine legitime Konkurrenz verschiedener Interessenten gab. Die Köhler wollten Holz von ganz bestimmter optimaler Stärke haben, was bei der auf Zeitintervallen beruhenden Staffelung von Schlägen eben das Hauen nach einem festen Turnus von meist 18 Jahren (mit standortabhängigen Abweichungen) erforderte. Die Produzenten von Kohlholz wären dämlich gewesen, wenn sie diesen Rhythmus sabotiert hätten. Leider sind Niederwälder so empfindliche Systeme, dass sie nur unter geschützten Laborbedingungen der Theorie gemäß konsequent ökonomisch nachhaltig funktionieren würden. In der offenen Außenwelt stehen Stockausschläge (wie jedes andere noch nicht widerstandsfähige Gehölz) unter so vielen störenden Einflußfaktoren, dass ihre späteren Erträge zu Beginn eines Turnus nicht prognostiziert werden können. Einem gut gepflegten älteren Hochwald wird ein Blitzeinschlag wenig anhaben; man verliert eben einen Baum unter vielen. Im Hauberg könnte der gleiche Blitz unschwer der Auslöser großflächiger Bestandsausfälle sein. Dies nur als ein Beispiel für etliche Faktoren (natürliche wie anthropogene), die innerhalb der kurzen Umtriebszeiten sehr drastisch wirken und zum völligen Kollaps führen können. Und schon kleinere Kalamitäten bringen das ganze System aus dem Takt. Dabei belasse ich es jetzt, und wenn Sie alles ganz anders sehen wollen, soll mir das auch recht sein. Danke jedenfalls für die Anregung.
Noch ein methodischer Hinweis: Wenn man über Rechtsgeschichte arbeitet, ist es sinnvoll, direkt auf die relevanten Rechtsquellen zuzugreifen und sich nicht mit sekundären Überblicksdarstellungen zu begnügen. Rühle von Lilienstern (Rühle ist übrigens Teil des Familiennamens) hatte die Texte der in seinem Weistum referierten „Gesetze, Ordnungen und Vorschriften“ zur Forstpolitik größtenteils schon in den Dillenburgischen Intelligenz-Nachrichten sukzessive abgedruckt. (Leider fehlt ausgerechnet die Ordnung betr. „Hauberge im Siegnischen“ vom 8.2.1718, die ihm anscheinend nicht im Volltext zugänglich gewesen war. Diese stand im Zusammenhang mit der Konsolidierung der Haubergsgüter, wenn es sich dabei nicht sogar um die legendäre und bisher nicht lokalisierte „Güldene Jahnordnung“ handelte). Die Fundstellen sind in dem zum Weistum gehörenden 90seitigen chronologischen Verzeichnis angegeben oder können den jeweiligen D.I.N.-Jahresregistern entnommen werden. Da das Weistum nur den Stand bis Ende 1802 wiedergibt, empfiehlt sich immer die Durchsicht der danach noch erschienenen D.I.N.-Bände. Im Jahrgang 1805, Sp. 617-622, findet man zum Beispiel die sicherlich von Hartig ausgearbeitete (wegen der französischen Besetzung dann nicht mehr wirksam gewordene) letzte Haubergsordnung für das Fürstentum Siegen.
P.K.
Viel hilft bekanntlich nicht immer viel und so ist das unstrukturierte Herunterschreiben von Wissen und Unwissen nicht gerade sachlich und auf den Aufsatz bezogen. Ihr Beitrag liest sich eher nach dem Motto „Ich weiß was, ich weiß was!“.
1. Die Formulierung „Es wird nur so viel Holz gehauen, wie im gleichen Zeitraum nachwächst“ ist kein „Grundübel“ der „Medienwelt“, sondern derzeitig vertretene wissenschaftliche Lehrmeinung. Sie wird in der näheren Umgebung z. B. im Forstlichen Bildungszentrum Neheim und den einschlägigen Universitäten gelehrt.
2. „Was soll der erwähnte ‚Zeitraum‘ bedeuten? Welchem anderen soll er ‚gleich‘ sein? Was soll man sich unter dem abstrakten ‚Holz‘ vorstellen?“ Kurzfassung: Ich berechne den Zuwachs eines bestimmten Bestandes. Diese beträgt z. B. 6,3 Fm/ha im Jahr. Ein Hiebssatz müsste dementsprechend kleiner 6,3Fm/ha im Jahr sein, um als nachhaltig bezeichnet werden zu „dürfen“. Und was soll an Holz abstrakt sein? Alles Biologie, Chemie und Physik.
3. „Bestand die letzte Kulturmaßnahme im völligen Kahlschlag, bildet sich eine natürliche Waldgesellschaft über die Zwischenstufe der Heide wieder heraus.“ Falsch! Die von Ihnen angedeutete natürliche Sukzession definiert sich als I. Waldfreie Fläche, II. Vorwaldstadium mit Pionierbaumarten, III. Zwischenwaldstadium mit den Schlusswaldbaumarten und IV. dem Schlusswaldstadium mit Zerfalls- und Verjüngungsphase. Die Heide entsteht durch menschlich bedingten Nährstoffentzug (Vieh, abplaggen, verbrennen….), ist also alles andere als natürlich.
4. „Wenn, wie damals gefordert worden war, jemand sein Grundstück mit einer lebenden Hecke umgab und kein gutes Bauholz für einen Lattenzaun verschwendete, war das vernünftige Ressourcenschonung, aber keine forstliche Nachhaltigkeit.“ Wo ist der gravierende Unterschied zwischen Ressourcenschonung und forstlicher Nachhaltigkeit?
5. Was haben Kalamitäten – Ihr genannter Blitz – konkret mit dem Aufsatz zu tun? Dass biotische wie abiotische Schäden Bestände schwächen und Holz zerstören ist offensichtlich und kein sachdienlicher Hinweis und keine ernstzunehmende Kritik.
6. Sicherlich ist es immer von Vorteil archivalische Originale in Händen zu halten und nicht eine „Quellenedition“. Aber mal daran gedacht, dass es v. a. die zahllosen Heimatforscher, Ehrenamtlichen etc. sind, die die Siegerländer Vergangenheit am Leben halten und nicht selten Zeit und finanzielle Mittel fehlen? Es handelt sich hier um einen kurzen, wie gesagt schlaglichtartigen Aufsatz, nicht um eine Dissertation, die z. B. im Rahmen einer zweijährigen wissenschaftlichen Anstellung mit Forschungsgeldern finanziert wird.
In Zukunft vielleicht nicht alles unnötig verkomplizieren. Das ist in wissenschaftlicher Sicht auch kein guter Stil. Für konstruktive Kritik und streitbare Aspekte bin ich offen, aber nicht für jemanden, der sich anscheinend auf Kosten anderer gerne reden hört.
Lieber Herr Wolf, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich weiß, wie sehr Ihnen Ihr Blog am Herzen liegt. Um ihn nicht in Verruf zu bringen, ziehe ich mich aus der aktiven Teilnahme zurück und werde deshalb auch auf die Einsendung der Ihnen für die kommenden Tage angekündigten historischen Miszelle verzichten. Alles Gute, Ihr P.K.
Ich respektiere natürlich Ihre Entscheidung. Aber ein paar Worte des Bedauerns müssen Sie leider ertragen: Mit 74 Kommentaren waren Sie, lieber Herr Kunzmann, ein Garant für die Lebendigkeit des Weblogs. Ohne Kommentare, ohne Diskussion, ja auch ohne Aneinandervorbeireden ist ein Blog uninteressant. Zudem haben Ihre Kommentare mit ihren Literaturhinweisen, Quellenfunden und Ihren pointierten Einschätzungen dazu beigetragen aufgegriffene Themen zu vertiefen. Ich erinnere exemplarisch an die Einträge zu Heinrich Otto und Lothar Irle. Schade auch, dass wir hier auf die Miszelle verzichten müssen.
Vielleicht kehren Sie nach einer Zeit des „Blogfastens“ ja wieder zurück. Ich würde mich – wie viele Leserinnen und Leser des Blogs sicher auch – jedenfalls sehr freuen.
Mit Ihrer Replik hatten Sie ganz offensichtlich das Ziel, mich als ahnungslosen Spinner und Dummschwätzer vorzuführen; der pro forma angehängte Nachtrag ändert an der Wirkung des Ganzen auch nichts mehr. Da ich mich auf Siwiarchiv schon öfter zu Kommentaren habe hinreißen lassen, ist ja vorauszusehen, dass sich manche permanent im Hintergrund bleibenden Voyeure nun schadenfroh die Hände reiben: „Endlich hat es diesem Klugscheißer mal jemand so richtig gegeben!“ Nun gut, irgendwie bin ich ja selbst schuld.
Von meinen Ausführungen habe ich nichts zurückzunehmen, wenn auch die angestrebte Kürze wohl auf Kosten der Verständlichkeit ging. In meinem fortgeschrittenen Alter darf ich mir mittlerweile die Freiheit erlauben, ein wenig Vertrauen in das zu setzen, was ich mir in den zurückliegenden Jahrzehnten erarbeitet habe. Wenn Sie hier mit Ihren forstpraktischen Spezialkenntnissen auftrumpfen, um in der öffentlichen Meinung einen Expertenstatus geltend zu machen, ficht mich das nicht an. Ich habe nie behauptet, z.B. eine Ertragsberechnung vornehmen oder mit der Boussole umgehen zu können. Aber das von Ihnen gewählte große Thema ist schließlich kein Monopol praktizierender Forstwirte (auch wenn manche Vertreter der „Zunft“ das vielleicht für sich beanspruchen). In einer ausführlichen Abhandlung hätte ich mich in aller Breite auf Belege gestützt. Naiverweise war ich davon ausgegangen, dass Sie hinter meinen fragmentarischen Andeutungen mehr als lediglich persönliche Phantasieprodukte vermuten würden.
Damit ist von meiner Seite dieses sinnlose Aneinandervorbei-Reden beendet. Wenn Sie das letzte Wort haben wollen, überlasse ich es Ihnen ohne weitere Erwiderung.
Kunzmann
PS 1: Ihr oberlehrerhaft triumphierendes „Falsch!“ akzeptiere ich insofern, als meine ganz nebensächliche Erwähnung der Heide in dieser Knappheit mißverständlich war. Wenn Waldflächen nach langer Übernutzung des Bodens wegen zu starker Rentabilitätsabnahme aufgegeben werden, liegt die für das Entstehen einer (vorübergehenden) Heidevegetations-gesellschaft nötige Voraussetzung der Nährstoffarmut vor. Aber Sie haben natürlich recht, ein aus anderen Gründen gerodeter Wald verwandelt sich nicht automatisch in eine Heide.
PS 2: Wenn Ihnen das Aufsuchen sehr leicht zugänglicher gedruckter Quellen zu mühsam ist, können Sie sich den Aufwand des Publizierens doch ganz sparen; etwas erwähnenswertes Neues entdecken Sie dann sowieso nie. Ich kann nicht verhehlen, dass ich die weit verbreitete wiederkäuende Art historischer „Heimatforschung“, deren Akteuren Lokalpatriotismus viel wichtiger als Erkenntnisgewinn ist, nicht sympathisch finde.
1. Mein Ziel war es nie, Sie als „Spinner und Dummschwätzer“ vorzuführen. Sie sind mir erst seit Ihrem ersten Kommentar zu meinem Aufsatz „bekannt“.
2. Es ging weder darum, irgendeinen „Expertenstatus geltend zu machen“, noch „oberlehrerhaft [zu] triumphieren(…)“ oder ein letztes Wort haben zu wollen.
3.Dieses gibt es – zum Glück – vermutlich in keiner Wissenschaft. Und nur ein kleiner, bescheidener wissenschaftlicher Beitrag war mein Aufsatz. Ich habe primär das „Weisthum“ und die Dillenburgischen Intelligenz-Nachrichten „befragt“ und thats it! Es sind Facetten, nicht mehr und nicht weniger. Eine größere Arbeit würde sicherlich in die Archive nach Wiesbaden, Münster, Den Haag, Siegen etc. führen.
4. Sie haben darauf reagiert, wofür ich Ihnen danke, und Ihre Sicht der Dinge dargelegt. Meinungen treffen aufeinander, der eine weiß dies, der andere weiß jenes. Das ist Wissenschaft! Es geht hier um Inhalte, nicht um persönliche Reputation.
5. Als Historiker, der an „Ihrer“ Universität ausgebildet worden, aber nun einmal Sauerländer ist, sind mir lokalpatriotische Absichten fremd. Und letztlich ist eine „wiederkäuende (…) ‚Heimatforschung‘“ – sofern sie denn betrieben wird – weniger schlimm als die Alternative: Weniger Kultur, weniger Geschichte. Der Staat, das Land spart an dieser Stelle als erstes. Verdienen Sie mit Heimatforschung Ihren Lebensunterhalt und ich ziehe meinen virtuellen Hut!
Übrigens, Herr Kunzmann, mein Beitrag über die Funktion der Dillenburgischen Intelligenz-Nachrichten erscheint in den nächsten Nassauischen Annalen. Bin da ja schon sehr auf Ihre Kritik gespannt :-)!
Bei diesem interessanten Thema für die Region will ich nicht abseits stehen und meinen Beitrag dazu leisten, dass zwar nicht die Welt, aber immerhin das Siegerland ein wenig besser wird.
1. Back the roots, soll heißen, lasst uns die Originaltexte nutzen und nicht die verkürzte Form aus zweiter Hand. Rühle von Lilienstern schrieb im Weisthum: „Jeder soll um seine Wiesen und Gärten jährlich 12 Stämme von 9 Fuß Länge und armsdicker Stärke setzen.“ Hier beginnen schon die Missverständnisse: 12 Stämme von was, von Bäumen aus dem Hoch- oder Niederwald oder von Sträuchern? Wenn man dazu mehr wissen will, muss man schon den Originaltext in die Hand nehmen. Rühle von Lilienstern berief sich auf eine Ordnung aus dem Jahr 1498, die Graf Johann für die beiden Ämter Siegen und Dillenburg erlassen hatte. Nachzulesen ist diese Ordnung im Corpus Constitutionum Nassovicarum: das ist; Sammlung der Gesetze, Verordnungen, Vorschriften und Ausschreiben […], 1. Band, Dillenburg 1796, Sp. 31-64.
Unter Punkt 41 „Von der Wyden setzen“ werden im Stil der Zeit recht weitläufig und umständlich die Untertanen (Hausväter) der Ämter angehalten, jedes Jahr um ihre Wiesen und Gärten „uffs aller Wenigste“ 12 „wyden stemme“ von einer bestimmten Größe (9 Fuß lang und armdick) zu setzen.
2. Es handelt es sich nicht um beliebige Holzstämme, nicht um Eichen oder Buchen, sondern um Weiden, die anzupflanzen waren (diesen wichtigen Hinweis unterschlägt RvL – warum auch immer). Dieser Sachverhalt führt zu der Frage: warum Weiden? Welche Bedeutung könnten Zeitgenossen den Weiden gegeben haben, laut Wikipedia sind sie „schnellwüchsig“ und „relativ kurzlebig“. Sie besitzen also Vorteile und Nachteile. Ihre Schnellwüchsigkeit entlastete sicherlich andere Waldungen.
3. Meine Vorstellung, wie die Verordnung praktisch umgesetzt worden ist, stößt aber an Grenzen. Offenbar sind mehrjährige (armdicke) Weidenstämme (andernorts ausgegraben?, wohl kaum, da die Weiden tiefgründig wurzeln) als Setzlinge an der eigenen Grundstücksgrenze wieder eingepflanzt worden. 12 Stück pro Jahr, über mehrere Jahre, bis alles eingehegt war. Wie ging es dann weiter? Den abgeholzten / abgestorbenen Teil wieder durch neue Anpflanzungen ersetzen?
Bei einer geschätzten Häuserzahl von ein- bis zweitausend (1000 allein im Amt Siegen, vgl. Geschichte des Netpherlandes, S. 43) um 1500 in den beiden Ämtern macht das 12 – 24.000 mehrjährige Weidenstämme pro Jahr, die gepflanzt worden sind. Wo kamen die her? Führte das nicht anfänglich zum Raubbau an Weiden, bis man zum Teil auf die angepflanzten Weiden selbst zurückgreifen konnte und sich alles auf einem höheren Niveau neu einzupendeln begann? Wurde überhaupt der Ordnung nachgelebt? Fragen über Fragen, aber keine Antworten.
4. Ein spannendes Thema, ohne dass der beliebig und inflationär genutzte Nachhaltigkeitsbegriff herangezogen werden müsste. Wer den Begriff nutzt, muss sich zu Recht mit den anregenden Fragen von Herrn Kunzmann und mit einigen neueren Büchern zum Thema auseinandersetzen.
5. Die hier verbreitete optimistische Sicht der Heimatgeschichtsschreibung teile ich ganz und gar nicht. Dazu nur soviel: Sie, die Heimatgeschichtsschreibung, nutzt gerne die Ergebnisse zweiter Hand, wiederholt sie gebetsmühlenartig und lässt jegliche Auseinandersetzung mit der (wissenschaftlichen) Literatur vermissen. Soweit mein Urteil dazu, nach mehr als drei Jahrzehnten regionalgeschichtlicher Forschung.
1. die von Ihnen zitierte Verordnung von 1498 wurde von mir lediglich als Einstieg genommen und Ihre Fragen nach den Baumarten und die Motivation eben diese zu pflanzen wurden anhand von meinen Ausführungen mit den späteren Verordnungen beantwortet. Und ja – anhand des Weisthums. Aber immerhin ist das geradliniger als von „Back [to] the roots“ zu sprechen und wenige Sätze später Wikipedia zu zitieren. Weide finden Sie bei mir genauso wie Schnellwüchsigkeit.
2. „Wie ging es dann weiter? Den abgeholzten / abgestorbenen Teil wieder durch neue Anpflanzungen ersetzen?“ Es ging durch vegetative Vermehrung – Stockausschlag (und Wurzelbrut) – weiter. Die Weide wurde gepflanzt und nach mehreren Jahren abgehackt/-geschnitten. Aus diesem Stock schlugen neue, mehrere Triebe aus. Das gleiche Prinzip wie beim Hauberg und bei Kopfbäumen. Ein Einpflanzen neuer Bäume war nicht notwendig.
3. Ein weiteres Mittel den Bedarf zu decken, waren die von mir angedeuteten ersten „Baumschulen“, die Pflanzgärten, in denen Bäume für Wiederaufforstungen herangezogen wurden.
4. „Wurde überhaupt der Ordnung nachgelebt? Fragen über Fragen, aber keine Antworten.“ Gleichfalls im Rahmen der benutzten Quellen beantwortet: Die stetige Aktualisierung der Verordnungen und die Beschäftigung der Obrigkeit mit der Thematik deutet darauf hin, dass es eine Kluft zwischen Theorie und Praxis gegeben haben muss. Wenn im alltäglichen Leben alles „rund“ läuft, dann bedarf es keiner Anstrengung, Bestehendes zu ändern.
5. Das Diffamieren des Begriffes „Nachhaltigkeit“ macht das, was darunter verstanden wird, nicht weniger sinnvoll. Selbst wenn „Nachhaltigkeit“ inflationär gebraucht wird, so ist diese Wirtschaftsweise, egal in welchem Bereich, nicht verkehrt. Wenn Sie nach dem Prinzip „Nach mir die Sintflut!“ leben wollen, dann bitte.
6. Der Einwand der bescheidenen Literaturrecherche ist berechtigt.
7. Optimistische Heimatgeschichtsschreibung ist dem Aufsatz fremd. Der „Siegerländer“ ist nicht besser oder schlechter als wer anderes. Mein Fazit erwähnt, dass die Region nur ein Fallbeispiel ist und reichsweite Forstordnungen in dieselbe Richtung gingen.
Sehr schön. Passend dazu:
„Was das Goethe-Zitat für den Bildungsbürger des 19. Jahrhunderts war, das ist die Nachhaltigkeit für den umweltbewußten Deutschen von heute: ein wohlklingender Referenzpunkt ohne tiefere Bedeutung. […] Zur Nachhaltigkeit ist, so scheint es, alles Sinnvolle gesagt und auch ein guter Teil des Sinnlosen. […] Der Rekurs auf die Geschichte wirkt vor einem solchen Hintergrund wie der Wunsch nach einem terminologischen Defibrillator.“
Frank Uekötter [Guter Mann. Radkau-Schüler], Ein Haus auf schwankendem Boden: Überlegungen zur Begriffsgeschichte der Nachhaltigkeit, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 64 (2014), Nr. 31-32 (Themenheft Nachhaltigkeit), S. 9-15, hier S. 9 – Link zur PDF: http://www.siwiarchiv.de/wp-content/uploads/2015/03/APuZ_2014-31-32_online.pdf.
Pardon, meiner Meinung nach hat der Hans Wurst nicht diskutiert, sondern lediglich einen in der wissenschaftlichen Welt anerkannten Umwelthistoriker zitiert. Merci.
Die Personalakte zu seiner Zeit als Lehrer und später Oberlehrer (ab 1924) der Wiesenbauschule befindet sich im Universitätsarchiv Siegen (UASi WBS 137) und reicht von 1900 bis zu seinem Tod 1945. Demnach ist er als Oberlehrer erst zum 1. April 1929 in den Ruhestand versetzt worden, dies aber nur, weil eine weitere Verlängerung der Amtszeit (Er war immerhin schon 71 Jahre alt!) aus gesetzlichen Gründen nicht mehr möglich war. Die Todesanzeige datiert vom 23. Febr. 1945, der Nachruf in der Siegener Zeitung vom 1. März 1945. Beigesetzt worden ist er auf dem Lindenbergfriedhof in Siegen.
Lothar W. Holzgreve
Aus gegebenem Anlass wird hier die Position zu anonymen Kommentaren dargelegt:
1) Anonymität ist ein Grundbestandteil aller sozialen Medien. Dies achtet siwiarchiv.
2) Es gibt nachvollziehbare Gründe für die Anonymität.
3) Daher werden entsprechende Kommentare den Regeln unterworfen, die auch für namentlich gekennzeichtete Kommentare gelten:
– Löschung erfolgt nur bei Verstoß gegen rechtliche Regelungen sowie bei Werbung
– Bei Überschreiten blogimmanter Umgangsgepflogenheiten erfolgt ein entsprechender Kommentar des Admin.
Wäre nach dem Wisent-Erfolg nicht auch hier das Auswildern eine Überlegung wert (für ehrenamtliche Schirmherrschaften drängen die Vorschläge sich auf)?
Ein „Wisent-Erfolg“ darf bezweifelt werden. Zum einen werden die Waldbesitzer mit einem nicht unerheblichen Schadfaktor konfrontiert, zum anderen sind ausgewilderte Tiere noch immer an die Menschen gewöhnt.
“ ….. Ein David Joseph, Schutzjude aus Herborn (Von Achenbach, S. 694), ….. trieb … kräftig Handel mit dem Siegener Fürstenhaus. Er durfte noch bis 1735 mit der Erlaubnis der letzten beiden reformierten Fürsten,“im ganzen Land handeln und wandeln.“ David Joseph (ebd.) besaß zuletzt vermutlich ein Warenlager im Wittgensteinischen Flügel des Unteren Schlosses, wo er seine Waren aufbewahrte. Derselbe fand sich im Kirchenbuch der reformierten Gemeinde Siegens (Thiemann, S. 8). Somit haben David Joseph und seine Familie sich ebenfalls taufen lassen. um vielleicht den gesetzlichen Beschränkungen zu entgehen.
Über die alte Bezeichnung der Judengasse in Siegen, woher diese Bezeichnung rührt, für eine parallel zur Straße auf dem Graben verlaufenden Weg, gibt es bis heute nur Spekulationen. Während von Achenbach die Bezeichnung auf das o. a. Warenlager und Abstiegsquartier des Juden zurückführt, vermutet Walter Thiemann (ebd.) in seiner Schrift, daß dies vielleicht auch eine Flurbezeichnung aus dem 13. Jahrhundert sein könne, als in Siegen vielleicht die erste jüdische Gemeinde (s. vorheriges Kapitel) bestand. Jedenfalls wurden die herrschaftlichen Gebäude am Unteren Schloss 1825 abgerissen, damit verschwand auch die Judengasse. Eine endgültige Klärung wird sich wohl nicht mehr finden lassen. ….“ (Quelle: Klaus Dietermann: Jüdisches Leben in Stadt und Land Siegen,Siegen 1998, S. 15.)
Dietermanns Publikation (S. 9 – 19) stellt wohl den derzeitigen historischen Forschungsstand zur mittelalterlichen neuzeitlichen Geschichte der Juden in der Stadt Siegen dar. Ferner sind Walter Thiemann: Von den Juden im Siegerland, Siegen 1970 (2. Aufl.) und Heinrich von Achenbach: Geschichte der Stadt Siegen, 2 Bde, Siegen 1894 zu benutzen. Zur Ersterwähnung eines Juden in Siegen wird auf Bernhard Brilling: Urkundliche Nachweise über die ersten Ansiedlungen von Juden in westfälischen Städten des Mittelalters, in: Westfälische Forschungen 12 (1959) , S. 156, verwiesen. Rüdiger Störkel: Dokumentation zur Geschichte der Juden in Herborn, Herborn 1989, sollte weiteren Aufschluss über die Familie Joseph geben.
nach dem Ende der Zeichnungsfrist stehen 3954 gültige Unterschriften. Insgesamt haben 4006 Personen die Petition für den Erhalt der Rheinischen Landesgeschichte an der Bonner Universität unterzeichnet. Dies ist ein großer Erfolg und ein deutlliches Zeichen für das weitreichende Interesse an einer starken Landesgeschichte an der Bonner Universität. Für die Unterstützung bedanken sich die Initiatoren der Petition herzlich.
Die Petition ist beim Rektor der Universität, Prof. Jürgen Fohrmann, und dem Dekan der Philosophischen Fakultät, Prof. Andreas Bartels, eingereicht worden. Gleichzeitig sind die Zeitungen, welche im Verlauf der Petition über die Entwicklungen berichtet haben, über das Ergebnis und die Einreichung informiert worden.
Über Reaktionen und weitere Neuigkeiten wird informiert.
Zu den „sensationellen“ Funden der Archäologen sollten einige Fragen aus Sicht des Historikers erlaubt sein:
Warum taucht die Bezeichnung „Judengasse“ erst im frühen 19. Jahrhundert in einer schriftlichen Quelle auf, wenn doch eine jüdische Gemeinde bereits im 15. Jahrhundert existierte? Hat sich deren Existenz über gute vier Jahrhunderte im kollektiven Gedächtnis der Siegener bewahrt, um dann unvermittelt hervorzubrechen? Warum findet sich in den schriftlichen Quellen seit dem 15 Jahrhundert, die sämtliche Straßennamen der Stadt aufführen und in Form von Schatzungslisten, Feuerschillingsregistern, Einwohnerverzeichnissen etc. reichhaltig vorliegen, keine Erwähnung einer Judengasse?
Warum findet sich in den Schatzungsregistern des 15. Jahrhunderts kein einziger jüdischer Name, wo doch jetzt in der fraglichen Situation angeblich „der erste Nachweis für eine nennenswerte jüdische Siedlung“ (SZ vom 17.03.2015) gefunden worden sein soll?
Und dann die Stadtmauer! Wo bitteschön verlief denn diese? In der einschlägigen Literatur ist nachzulesen, dass sie im 15. Jahrhundert vom Löhrtor hinter dem späteren Krankenhaus quer über den heutigen Schlossplatz zum Dicken Turm bzw. Kölner Tor verlief, dabei aber just die später so genannte Judengasse von der Stadt ausschloss. Erst im frühen 16. Jahrhundert wurde der Bereich um die Martinikirche durch die Erweiterung der Stadtbefestigung in das städtische Areal einbezogen.
Fazit 1: Die Archäologen haben ausgegraben die Reste eines Kellerfußbodens, der höchstwahrscheinlich zu den Resten der „extra muros“ befindlichen Häuser der „aldestat“ gehörte. Diese wurden in den 1520er Jahren abgerissen, ihre Überbleibsel bei der Errichtung des Wittgensteiner Flügels überbaut. Für die Namengebung „Judengasse“ dürfte das von Dietermann erwähnte Warenlager des Schutzjuden David Joseph in der Remise des Wittgensteiner Flügels verantwortlich sein.
Fazit 2: Wir freuen uns, dass mal wieder Mittelalterarchäologen den Weg nach Siegen gefunden haben und eine städtischen „hotspot“ umgraben. Wir sind auch gerne bereit, unsere Stadtgeschichte anhand archäologischer „Sensationsfunde“ umzuschreiben. (Eine blühende jüdische Gemeinde innerhalb der Stadtmauer des 15. Jahrhunderts wäre sicherlich ein absolutes highlight in unserer an Sensationen nicht wirklich reichen Stadtgeschichte.) Dann aber bitte nicht aus ein wenig altem Fußboden und einigen Keramikscherben Spekulatives in die Welt setzen, sondern im Zusammenspiel von schriftlichen Quellen und Bodenfunden belegbare Fakten schaffen. Diesen Dialog haben die Archäologen des LWL in den neunziger Jahren beim Bau der Karstadt-Tiefgarage vorbildlich vorgemacht (siehe Siegener Beiträge – Jahrbuch für regionale Geschichte 1/1996 Ausgrabungen in Siegen).
Hallo kleiner Bruder, toll!!!!!!!!!!! Da stehst Du im Internet als Verfasser der Geschichte. Das Fach hat Dich ja schon immer interessiert im Gegensatz zu mir.
LG sendet Dir Christa
Es ist eine bemerkenswerte Fleißarbeit. Als Vorsitzende des Heimat- und Verkehrsvereins Hüttental bin ich Bernhard Lohrum sehr dankbar für den Beitrag. Ich hoffe, dass sich viele Menschen für die Arbeit interessieren.
Traute Fries
Die Wahrheit liegt wie so oft vermutlich in der Mitte. Faszinierend ist, dass für den Historiker nur das existiert, was irgendwann mal irgendwo niedergeschrieben wurde. Dass sich nicht alles schriftlich tradiert haben kann, sollten gerade die aussondernden Archivare wissen. Genauso dürfen mündliche Überlieferungen, die sich in ein „kulturelles Gedächtnis“ gebrannt haben, nicht außer Acht gelassen werden. Würde man diese Schriftfixiertheit „der Historiker“ auf die Spitze treiben, müsste die gesamte schriftlose Urgeschichte verneint werden.
Welch bodenloser Unsinn! Nicht jeder frühe Vogel fängt zwangsläufig einen Wurm! Hier geht es nicht um „Schriftfixiertheit“, sondern darum, Ausgrabungsergebnisse an den tatsächlich vorhandenen Schriftquellen zu überprüfen, sonst haben wir nämlich eine „Spatenfixiertheit“. In diesem Zusammenhang empfehle ich dem Kommentator noch einmal die Lektüre des ersten Bandes der Siegener Beiträge (1996, Ausgrabungen in Siegen). Daran zeigt sich, zu welchen stadtgeschichtlich bedeutenden Erkenntnissen die fruchtbare Zusammenarbeit von Archäologen und Historikern führen kann. Im Übrigen lag es nie in meiner Absicht, einen ideologischen Gegensatz zwischen beiden Gruppen zu konstruieren.
Und was die Frühgeschichte angeht, da vertrau ich mal auf die Archäologen, denn sonst habe ich nichts. Aber warum sollte man schriftliche Quellen außer Acht lassen, wenn man sie denn hat?
Und jetzt rudere ich erst mal ein Stück zurück: Meine ‚Gedächtnisfixiertheit‘ hat mich verleitet, den Kommentar am Wochenende aus dem Stand ohne Überprüfung der Quellen zu schreiben. Genaueres Recherchieren in den Archivbeständen hat denn doch eine frühere Quelle für die „Judengasse“ ergeben. In einem Plan des Unteren Schlosses, der vermutlich auf 1802 zu datieren ist, wird diese erstmals erwähnt. Er zeigt aber auch, dass die Judengasse eben nicht da eingezeichnet ist, wo die Archäologen graben. Punktum.
1. Dass die Wahrheit vermutlich in der Mitte liegt und manch ein Historiker einen papiernenen Tunnelblick besitzt, ist sicherlich kein „bodenloser Unsinn“. Mein Kommentar war allgemein gehalten und lediglich Anreiz für jeden, eigene methodische Vorgehensweisen zu hinterfragen.
2. Ich bin bei Ihnen, wenn es darum geht, dass Historiker und Archäologen mehr zusammen arbeiten sollten. Immerhin wird ein und die selbe Vergangenheit erforscht.
3. Einen „ideologischen Gegensatz zwischen beiden Gruppen“ brauchen Sie ohnehin nicht mehr „konstruieren“. Die Historiker bekommen an den Universitäten gelehrt, die Archäologie sei eine reine Hilfswissenschaft. Umgekehrt sieht es nicht wesentlich anders aus. Ein Punkt, den aus zu beseitigen gilt.
4. Ihr Beispiel (Siegener Beiträge 1996) sowie etwa neuere Forschungen des mittelalterlichen Siegerländer Bergbaus zeigen zum Glück, dass es anders geht! Intensive Zusammenarbeiten zwischen Historikern und Archäologen bieten noch viel Potential, das es zu nutzen gilt.
Vollkommen richtig: „Dass die Wahrheit vermutlich in der Mitte liegt“ ist natürlich kein „bodenloser Unsinn“, sondern eine Plattitüde der ergreifendsten Schlichtheit. Der Rest BLEIBT Unsinn! Sich jetzt damit herauszureden, lediglich Anreiz schaffen zu wollen, „eigene methodische Vorgehensweisen zu hinterfragen“ ist Rückzug der billigen Art. Weitere Ausführungen erübrigen sich, zumal Sie mir in Ihren Punkten 2 bis 4 ja in meiner inhaltlichen Kritik grundsätzlich beipflichten. Für mich ist diese absolut überflüssige Diskussion hiermit beendet, es sei denn, Sie haben etwas Substantielles zu den von mir angesprochenen inhaltlichen Fragen beizusteuern.
Eins noch: Wenn anderen „Plattitüde[n] der ergreifendsten Schlichtheit“ vorgeworfen werden, gleichzeitig aber von „Nicht jeder frühe Vogel fängt zwangsläufig einen Wurm!“ gesprochen wird, dann ist genau dies z. B. ein Punkt, wo die eigenen methodischen Vorgehensweisen gerne hinterfragt werden dürfen. Da ich weder im Archiv sitze, noch irgendwelche Befunde/Funde kenne, gibt es nichts Substantielles und ich bin raus.
Zur archäologischen Fundlage s. Westfälische Rundschau v. 24.3.2015: “ …. Zwar habe sein Team „kein spezifisch jüdisches Fundmaterial“ entdeckt, „aber eindeutig eine Bauzeile gefunden“ – und das an eben jener Stelle, wo in einem alten Plan eine „Judengasse“ eingezeichnet sei. In diesem Fall sei „Übertragung das Naheliegende“. ….“
Für einige vielleicht interessant: Wenngleich kurz nach 1802/1806 datiert, finden sich in folgenden Archivalien vielleicht noch Hinweise auf frühere Belege für eine „Judengasse“:
Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen
B 415, 1 Regierung Arnsberg – Domänenregistratur
3.7.7.3 Gebäude
0 III A Fach 107 Nr. 13 – Vermietung der Gebäude im unteren Schloss, Wittgensteiner Flügel halber Mond, Kutschenremise, Judengasse
Laufzeit : 1822 – 1829
Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen
B 415, 1 Regierung Arnsberg – Domänenregistratur
3.9.8.3 Gebäude
0 III A Fach 137 Nr. 3 – Verkauf der sogenannten „Judengasse“ beim unteren Schloss zu Siegen
Laufzeit : 1822 – 1825
Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen
3.3.2.8 Domänenrentämter (Renteien)
Domänenrentamt Siegen
B 481 Si Domänenrentamt Siegen
Verzeichnungseinheiten
876 – Abbruch des Judengasse genannten Gebäudes im unteren Schloß zu Siegen und Verpachtung des Gartens
Laufzeit : 1822-1876
„des Judengasse genannten Gebäudes“ – ein Hinweis, dem wohl mal nachgegangen werden sollte!
Bezieht sich diese Archivalie auf die bereits hier zitierte Textstelle „Jedenfalls wurden die herrschaftlichen Gebäude am Unteren Schloss 1825 abgerissen, damit verschwand auch die Judengasse. Eine endgültige Klärung wird sich wohl nicht mehr finden lassen. ….” (Quelle: Klaus Dietermann: Jüdisches Leben in Stadt und Land Siegen,Siegen 1998, S. 15.)“? Hatte Herr Dietermann die Akte in den Händen oder könnten ihr noch neue Erkenntnisse entlockt werden?
Gratulation zu den Quellennachweisen, denen nachgegangen werden muss! Diese decken sich zeitlich mit den Erkenntnissen aus hier vorliegenden Zeitungsberichten des 19. Jahrhunderts.
Inzwischen hat sich auch Stadtarchivar a.D. Friedhelm Menk der Sache angenommen und einen ersten Fund getätigt: „In dem hölzernen Vorgebäude an der Judengasse vor dem halben Mond in der 2ten Etage befindet sich …“ (Quelle: Landesarchiv Münster, Fürstentum Oranien-Nassau II D Nr. 3 „Inventarium von dem herrschaftlichen untern Schloß zu Siegen mit allen darin befindlichen Gebäuden aufgestelt im Julio 1785“) Full credits to him!
Neben der genannten Quelle könnten ferner die „benachbarten“ Archivalien im Landesarchiv noch interessant sein:
1776-1793
Bauten im Garten des Unteren und Oberen Schlosses zu Siegen
Bestellsignatur : Fürstentum Siegen, Oranien-Nassauische Behörden, Nr. II D 2
Altsignatur : Rentamt Siegen 40
1802
Inventar des Unteren Schlosses zu Siegen
Darin: Grundriß der Hälfte des Unteren Schlosses von 1789
Bestellsignatur : Fürstentum Siegen, Oranien-Nassauische Behörden, Nr. II D 5
Altsignatur : Rentamt Siegen 459,1
1783-1805
Bauerlaubnisse an fürstlichen Gebäuden, vornehmlich in Siegen
Bestellsignatur : Fürstentum Siegen, Oranien-Nassauische Behörden, Nr. II D 9
Altsignatur : Rentamt Siegen 1033
Lieber Bernhard,
vielen Dank für Deine schöne Dokumentation, und das Du sie uneigennützig hier für uns alle präsentierst!
Grüße auch an Deine Frau
Manfred aus Eisern
„Der ARD-Fernsehfilm „Nackt unter Wölfen“ war am Mittwochabend die meist gesehene Sendung. 5,45 Milionen Zuschauer, das enspricht einem Marktanteil von 17,3 Prozent, sahen die Neuverfilmumg des Romans von Bruno Apitz zum 70.Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald.
In der Doku im Anschluss „Buchenwald. Heldenmythos und Lagerwirklichkeit“ informierten sich 4,47 Millionen (MA 15,6 %) über die historischen Hintergründe. Bei den jüngeren Zuschauern (14 bis 49 Jahre) lag der Marktanteil für den Film bei 13,1 % (1,42 Millionen).“
Quelle: ARDtext, S. 422 v. 2.4.15
Das ist ein schiweriges Rätsel, nur die Antwort auf die 1 Frage ist leicht: das Bild zeigt Gerber bei ihrem Tun. Die 2. Frage, wie siwiarchiv darauf aufmerksam wurde, rate ich mal: vielleicht in den eigenen Archiven? Das Siegerland, hab‘ ich gegoogelt (bin nicht von dort), hatte florierende Gerbereigewerbe. Die 3. Frage ist (nicht nur wg. der Grammatik:-) insofern verwirrend, als sie mich auf die 2. Frage zurückweist: das gezeigte Foto mit der Darstellung der Gerber war also an einem Ort aufgenommen, den’s nicht mehr gibt? Einer nicht mehr existierenden Gerberei? Google sagt, dass man in Hilchenbach die Gerberei schloss und die zugehörige Villa abgerissen habe. Eine andere Seite zeigt ein noch verbliebenes Gebäude. Ist so etwas gemeint? http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/bestand.jsp?archivNr=4&tektId=3 http://www.ahlering.de/Gerberei/gerberei.html
(naja, irgendwer muss ja anfangen mit den falschen Antworten…:-)
Danke für Ihren Mut, den Eisbrecher zu geben! Die Beantwortung der ersten Frage ist natürlich korrekt. Allerdings sind sowohl die zweite wie auch die dritte Frage nicht richtig beantwortet. Um die Antwort zur zweiten Frage zu finden, müssen Sie nicht googlen. ;-) Die dritte Frage verlangt einen Spaziergang durch einen der Orte des Siegerlandes mit entsprechender Lederindustrie – s. schon hier: http://archiv.twoday.net/stories/1022414157/#1022415010 .
P.S.: Ich hätte mir gewünscht, daß Sie meinen Fehler in der dritten Frage als Flüchtigkeitsfehler gewertet hätten. :-)
Vielleicht kam’s ja im Film http://www.siwiarchiv.de/?p=7608 vor. Aber Rätsel, deren Antwort sich nicht sicher nachweisen lässt, machen irgendwie keinen Spaß. „Wie wurde siwiarchiv auf das Objekt aufmerksam?“ kann man nicht beantworten. Beim Spazierengehen? Wäre auch eine Antwort, die man als Mitrater nicht falsifizieren könnte.
Mich erfreuen solche Wandbilder immer wieder und ich finde es schade, dass diese Kunstform seit den 1970er Jahren so gut wie ausgestorben ist. Viele davon werden zur Zeit bei Renovierungen und Abbrucharbeiten zerstört (dieses hier z. B.: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ravensburg_Seestra%C3%9Fe_Wandgem%C3%A4lde_Maurer.jpg ) . Ich möchte daher dazu aufrufen, die Wandmalereien und Sgraffito-Werke an den Handwerksbetrieben und auch Wohnbauten des 20. Jh. zu fotografieren und zu dokumentieren, etwa bei den Wikimedia Commons. Die Werke unterliegen der Panoramafreiheit und sind daher urheberrechtlich unproblematisch zu veröffentlichen.
@APraefcke Gratulation! Die zweite Frage ist nun auch schon richtig beantwortet. Ich hatte eigentlich gehofft, dass einer der ca. 40 Besucher der Filmveranstaltung sich am Rätsel beteiligt. Übrigens, handelte es sich bei dem Film um eine Produktion für die FWU, so dass eine verschwindend geringe Möglichkeit besteht, dass man den Film gesehen hat. Ach, das ist Unsinn. ;-)
Die Dokumentation von Kunst am Bau in den 50er bzw. 60er Jahren – somit auch der Sgraffito-Werke – wird gerade in der Stadt Siegen aktuell gepflegt. Ihre Anregung werde ich gerne weiterleiten.
@FeliNo Sie haben tatsächlich noch eine Chance. Sie müssen nur an der richtigen Stelle im Netz suchen – dort, wo man sich in Gruppen gerne alte Bilder der eigenen Kommune ansieht …… Jetzt winke ich gerade mit einem Siegerländer Hauberg.
Bei den US-Truppen wurden die Ereignisse zweifach festgehalten.
Zunächst wurde während der Kampfhandlungen gefilmt. Anschließend gab es die gleichen Szenen „schauspielerisch“ nachgestellt. Dies konnte man der Heimat besser zeigen. Die Aufnahmen zeigen die zweite Variante.
Ich habe gute Erfahrung mit einer Schulung „Die Vereinschronik“, ursprünglich für die Schriftführerinnen des Frauenbundes, dann geöffnet für andere, auch nichtkirchliche Vereine. Dabei geht es um praktische, handefeste Fragen (Welches Material, wie lege ich Beilagen ab, Leitzordner oder Band, Folien mit Weichmacher zum „Schutz“ der wertvollen Stücke, etc.) und um Inhaltliches.
Passend dazu: „Vor 70 Jahren haben die Allierten das Siegerland erobert. Auch die Zwangsarbeiter wurden befreit. Allein in Dreis-Tiefenbach arbeiteten während des Zweiten Weltkriegs mehr als 1.000 Menschen unter anderem aus Russland, England und Frankreich. Sie wurden zum Beispiel bei der Siegener Eisenbahnbedarf eingesetzt – heute Bombardier. Die 94-jährige Hedwig Wilhelm arbeitete damals dort im Lohnbüro und erinnert sich: „Hier hatten die Wachleute abends auf dem Rückweg einen erschossenen Zwangsarbeiter hingelegt und den sollten wir uns angucken. Sie sagten, das ist das Resultat, weil sie geklaut haben. Aber die hatten sich nur gebückt, um was Essbares, vielleicht eine Kartoffel oder ein Stück Brot aufzuheben, und dann wurden sie erschossen.“ 16 russische Zwangsarbeiter und 17 Kinder sind auf dem Friedhof in Dreis-Tiefenbach beerdigt. Die meisten starben an Unterernährung.“
Quelle: WDR Studio Siegen Nachrichten v. 8.4.2015
Wiederum offensichtlich ein erschreckendes Beispiel für sensationalistisches, journalisierendes Geschichtenerzählen anstelle einer analytischen, professionellen Zugangsweise, die für die Geschichtsschreibung um diesen Ort besonders charakteristisch ist, nachdem bislang ernsthafte, kontextualisierende Forschung zur politischen Schulung in der NSDAP stark vernachlässigt worden ist und auf der anderen Seite die journalistische Lieblingsquelle schlechthin, die Zeitzeugenerzählungen, das Geschichtsbild bestimmen. Ein Beispiel, das auch in diesem Film bemüht wird, ist die Legende, wonach in den Luftschutzbunkern NS-Raubgut aus den besetzten Gebieten gelagert worden sei, weil diese Zeitzeugen berichten, dass ihnen dessen Zutritt bei Luftangriffen verwehrt worden sei – das ist auch Thema in einem sehr schlechten, epigonalen „Eifelkrimi“ des Journalisten Stefan Everling („Totenvogelsang“). Demgegenüber muss ich nach mehreren wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu diesem Thema (z.B. in der Zeitschrift „Geschichte in Köln“ 54, 2007 und 56, 2009 sowie zur Schulung in Band 25 der Jahresschrift des Geschichtsvereins des Kreises Euskirchen, ISBN 978-3-941037-83-0) und der Einsicht in alle archivalischen Quellen zu den Ordensburgen selbst sowie u.a. des Einsatzstabes Rosenberg (BAB NS 30 etc., Staatsarchiv Kiew, National Archives Washington etc.) feststellen, dass diese Geschichten bestenfalls Legenden sind, weil sich für diese Zeitzeugen-Erzählungen kein archivalischer Beweis erbringen lässt. Sie werden allerdings – horribile dictu – von den für die Konversion Vogelsangs Verantwortlichen der „Vogelsang ip“ selbst auch noch unterstützt: ein dort angelegtes sog. Archiv – zu dem ich selbst beigesteuert habe – ist für die Forschung nicht nutzbar, und eigene Forschung findet nicht statt, während Fernsehsendungen und Zeitungs-Berichterstattung wie dieses Produkt gefördert werden. Ergebnis: solche Sendungen müssen mit äußerst kritischem Auge und sehr wachem Gehirn wahrgenommen werden.
Super Präsentation, damit lässt sich gut arbeiten. Danke dafür! Aber: Für „Eingeweihte“ erschließt sich die Präsentation. Für Vereinsvertreter bedarf es neben der Präsentation aber auch vollständig ausformulierter Sätze. Sonst bleibt einiges unverständlich. Schließlich betritt der/die ehrenamtliche Vereinsarchivar/-archivarin in der Regel Neuland.
Daher meine Frage: Wird der Vortrag auch als Textfassung publiziert, und wenn ja: wo? Es ist ja ein allgemeines Problem, und es wäre schön, wenn die Nachnutzung des Artikels über den Verweis auf eine ausführliche Darstellung in siwiarchiv möglich wäre (das würde dann nämlich einerseits alle betroffenen Kommunalarchive mit ähnlichem Aufklärungsanspruch deutlich entlasten und über die positiven Auswirkungen an Klicks auf siwiarchiv würde ich mich nicht wundern).
da der unter http://www.siwiarchiv.de/?p=7855 als pdf eingestellte Titel nicht im regulären Buchhandel erschienen ist, rege ich an, dass Sie trotzdem Pflichtexemplare an die Deutsche Nationalbibliothek und an die für Sie zuständige Bibliothek in NRW senden; vielleicht sogar auch an die Staatsbibliothek Berlin oder andere Fachbibliotheken.
Darüber hinaus sind die obigen Titelangaben irreführend, schon allein, weil der eigentliche Verfasser des Manuskripts gar nicht angegeben ist. Ich vermute, dass man in der Behörde Vorort den Vornamen des „Oberregierungs- und Baurat a.D. Meyer“ (vgl. S. 4) noch recherchieren kann. Dann könnte der Titel auf Ihrer Homepage lauten:
### Meyer: Chronik der Wasserwirtschaftsverwaltung 1859-1952. Von der meliorationstechnischen Planstelle beim Oberpräsidium in Münster zum Wasserwirtschaftsamt Münster. Bearbeitet von Dietrich Schedensack. Münster: Staatliches Umweltamt Münster 1995.
Vielen Dank für den berechtigten Hinweis! Die Broschüre wurde vom Landesarchiv NRW, Abt. Westfalen, online gestellt, so dass ich mir erlaube, Ihren Hinweis in der kommenden Woche dorthin weiterzuleiten.
Dienstag, 05.05.2015 um 18:00 Uhr geht es im Unteren Schloß, Raum: US-F 103, los mit dem Vortrag „Oradour hat keine Frauen mehr…/ Oradour hat keine Kinder mehr…“ – Zur Geschichte eines Massakers mit Florence Hervé.
Auch Absagen können im Netz veröffentlicht werden! Gerne hätte der Besucher einen früheren Hinweis auf den Ausfall der Veranstaltung gefunden und nicht erst an der Tür des endlich gefundenen Vortragsraums, der sich nicht wie angekündigt im Unteren Schloss fand! Oder wollte die akademische Linke unter sich bleiben?
Es sollte aber gesagt werden, daß dieses Digitalisat ledglich ein Abdruck der „Jugend“ von Jung-Stilling ist, und dazu natürlich in Frakturschrift.
>>> Die *vollständige* Lebensgeschichte in kritischer Ausgabe, besorgt von Gustav Adolf Benrath, erschien bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, Darmstadt in Antiquaschrift.
Eine neben der von Jung-Stilling selbst geschriebenen Texte auch viele andere Quellen auswertende Biographie mit vielen Abbildungen und Registern erschien zuletzt 2014 im Verlag der Jung-Stilling-Gesellschaft Siegen. Der Titel: „Jung-Stilling. Ein Umriß seines Lebens“. Verfasser ist der Siegener Jung-Stilling-Experte Gerhard Merk.
Lieber Ludwig Burwitz,
der Kommentar trifft mich in der Tonart sehr hart. Muss ich leider gestehe. Unter diesem Eintrag ist er zudem auch noch falsch platziert, denn Ulrich Sander hat gesprochen. Sehr kurzfristig ausfallen wegen des Streiks der GDL (mit dem sämtliche VeranstalterInnen solidarisch sind) ist der Vortrag von Florence Hervé. Ich persönlich bedaure dies auch sehr. Versprochen wurde jedoch ein Nacholtermin, der auch wieder öffentlich angekündigt wird. Voraussichtlich der 19.05. am selben Ort. Die VeranstalterInnen verfügen nicht wie andere, etwa gewisse Verbände, Vereine, Instituationen und Parteien, über einen hauptmatlichen Apparat und viele sind berufstätig. Wenn also am frühen Nachmittag eine Absage kommt, kann nur im begrenzten Rahmen reagiert werden. In diesem wurde aber reagiert. In den Veranstaltungsblog konnte jedoch kein Eintrag mehr erfolgen. Das bedauern wir sehr. Daraus abzuleiten, die VeranstalterInnen hätten unter sich bleiben wollen ist geradzu absurd. Von den Medien bis auf eine Ausnahme wurde die Veranstaltungsreihe komplett ignoriert. Eine einzelne Veranstaltungsangkündigung wäre gesendet worden, aber die betraf ausgerechnet die Abgesagte. Nachberichterstattung über keine einzige. Mir kann etwas durchgegangen sein, dann möge man mich korrigieren. „Befreiung! Was sonst!“ War und ist auch durch die beiden noch ausstehenden Veranstaltungen des AStA und des autonomen Fraunreferats ein bemerkenswerter Beitrag zum 70. Jahrestag der Befreiung. Den haben andere hier nicht auf die Kette bekommen und können sie sicher auch nicht trotz hohem Einsatz von öffentlichen Geldern. Dies beweisen die im Bündnis vertretenen Gruppen an anderer Stelle ebenfalls von den Medien und somit weiten Teilen der Bevölkerung immer wieder. Dies ist meine feste Überzeugung. Nichts für ungut! Freundschaft!
Gern geschehen. Leider ist mir nach einem wieder einmal langen Tag in puncto Rechtschreibung einiges schief gegangen. Ich bitte dies zu entschuldigen. ;-)
Lieber Joe Mertens!
Zugegeben: Die Tonart ist etwas hart geraten, vielleicht zu hart. Spricht aber vielleicht für meine Enttäuschung und meine Erwartungshaltung an die ausgefallene Veranstaltung. Solltest Du dich persönlich getroffen fühlen, dann entschuldige ich mich. Aber: Meine Kritik war keineswegs falsch platziert, sondern direkt im Anschluss an Deine Ankündigung der dann ausgefallenen Veranstaltung. Und: Ich habe nicht aus der fehlenden Information im Veranstaltungsblog abgeleitet, „die VeranstalterInnen hätten unter sich bleiben wollen“, sondern diese Kritik bezog sich allein auf die völlig irreführende Angabe des Veranstaltungsortes: Wir (immerhin zwei Personen) waren nicht die einzigen, die kurz vor 18 Uhr Deinen Veranstaltungshinweis („geht es [los] im Unteren Schloß“) ernstnehmend über den Schlossplatz irrten und auch an Eingangstür des schließlich gefundenen ehemaligen Krankenhauses keinen Hinweis auf die Veranstaltung oder den Ort fanden. Das war mehr als merkwürdig!
So weit meine „klarstellenden Worte“! Für alles Weitere brauchen wir nicht die öffentliche Bühne. Schließe mich an: Nichts für ungut! Freundschaft!
Es war wirklich eine gelungene Enthüllung des Gedenksteins.
Die Gedenktafel ist mit einem schönen Bild von Frau Danielewicz gut
gestaltet.
Der Text weist jedoch schwächen auf, so heist es auf der Gedenktafel
“ Sie wurde ihrer Herkunft wegen ausgegrenzt, verfolgt…“
Frau Danielewicz stammte aus Berlin, das war aber nicht der Grund für ihre
Ermordung.
Da wollte die Gemeinde Wilnsdorf wohl das Richtige schreiben, hat es aber nicht geschafft.
Einen bittern Beigeschmack hat die Einweihung des Gedenksteins dadurch
erhalten, dass vor einigen Wochen das Grab von Karl Jung-Dörfler auf dem Rödgener Friedhof eingeebnet wurde.
Dieses Grab war auch als letzte Ruhestätte von Frau Danielewicz vorgesehen, wenn sie nicht im Minsker Ghetto ermordet worden wäre.
Nach Auskunft der Gemeinde Wilnsdorf ist der Grabstein gesichert und soll
an anderer Stelle des Friedhofs aufgestellt werden.
Denkmalschutz an Ort und Stelle wäre hier angebracht gewesen!
Also, die Ankündigung von siwiarchiv bezog sich auf “Verbrechen der Wirtschaft“
Referent: Uli Sander, Bundessprecher der VVN-BdA
Mittwoch, 06.05.2015 um 19:30 Uhr, VEB Siegen
Der hat wie geplant stattgefunden. Ich habe das komplette Programm drunter gepostet. Und Auftakt wäre gewesen: „Oradour hat keine Frauen mehr…/ Oradour hat keine Kinder mehr…“ – Zur Geschichte eines Massakers
Referentin: Florence Hervé. Dienstag, 05.05.2015 um 18:00 Uhr im Unteren Schloß, Raum: US-F 103. Der musste aber ausfallen.
NACHHOLTERMIN STEHT NUN ABER FEST: Dienstag, 19.05.um 18:00 Uhr im Raum US-F 103 (Campus Unteres Schloss/ Kohlbettstr. 115)
Alles gut! ;-)
Es ist eine Schande, daß die alten Bücher auch als Digitalisat relativ wertlos sind, weil (nach Umfragen) keine 3% (!!!) der Deutschen Frakturchrift lesen können.
1) Ob digitalisierte ältere Bücher tatsächlich angesichts der Frakturschrift eine Schande darstellen, bleibt jedem selbst überlassen. Allerdings ist die Wertlosigkeit tatsächlich relativ, da man online sich sehr schnell mit der Frakturschrift vertraut machen kann. Hier als Beispiel: http://www.suetterlinschrift.de/index.html.
2) Die „Umfragen“ hätte ich gerne präzisiert. Im Netz findet sich diese Diskussion im Herbst 2013. Vielen Dank vorab!
Wer diese Bücher nutzt, lernt die Fraktur. Im Gegensatz zu Kurrentschriften (Handschrift), bei der tatsächlich immer häufiger eine Notwendigkeit zur Transskription vorhanden ist, besteht meines Erachtens bei der Fraktur kein erhebliches Problem. Auch unsere studentischen Hilfskräfte erlernen sie in wenigen Stunden, sobald sie die Kenntnis benötigen.
sollte jemand tatsächlich ernsthafte schwierigkeiten mit druckfraktur haben: in jeder grösseren bibliothek gibt es klassiker und andere literarische texte in fraktur- und in antiquaausgaben. üben.
Frakturschrift ist ein Überbegriff.
Es gibt eine Reihe von einzelnen Schriften, die heute tatsächlich nur von Fachleuten gelesen werden können.
Als Erbstück besitze ich noch das „Lehrbuch der Landwirthschaft“ von Jung-Stilling.
Hier sind auch die einzelnen Zeilen auf jeder Seite so eng aneinander gerückt, daß die Serifen und Haken der Großbuchstaben einer Zeile in die nächste hineinragen.
Hier hilf auch eine Lupe wenig.
Nebenbei: dieses in verschiedener Hinsicht wichtige Lehrbuch hat der Siegener Jung-Stilling-Biograph Professor Merk ebenfalls neu in Antiquaschrift herausgegeben und mit Register versehen.
Ich hatte ja bereits auf den Wikipedia-Eintrag zur Frakturschrift hingewiesen. In der Tat existiert diese Schrift schon lange und mit unterschiedlichen Ausprägungen. siwiarchiv hat in letzter Zeit allerdings nur auf Werke aus dem beginnenden 20. Jahrhundert hingewiesen, die in der Regel nicht die Problematik aufweisen, wie Sie sie für das Werk Jung-Stillings aus dem Jahr 1783 beschreiben.
Die erinnerungskulturelle Perspektive für Vertriebenendenkmäler beschreibt Scholz mit deutlichem Bezug zur Siegener Diskussion (Link s. Eintrag) wie folgt (S. 373):
“ …. Neben der bloßen Historisierung von Vertriebenendenkmälern besteht jedoch auch die Möglichkeit, sie als gültige symbolische Systeme gegenwärtiger historischer Selbstverständigung, aktueller Positionsbestimmung und prospektiver Zukunftsentwürfe zu begreifen. Das würde auf lokaler Ebene eine aktive Auseinandersetzung sowohl mit den existierenden Denkmälern und deren Entstehungs- und Nutzungsgeschichten als auch mit den heutigen Grundwerten und dem historischen Selbstverständnis der Gesellschaft nötig machen. Ein solcher Verständigungsprozess könnte darin münden, vorhandene Denkmäler nicht nur schriftlich zu kommentieren, sondern künstlerisch zu ergänzen oder umzugestalten. Vertriebenendenkmäler könnten so zu Ausgangspunkten der Reflexion über die spezifisch deutsche Verknüpfung von Täter- und Opfergeschichte und die darauf basierende besondere Erinnerungsgeschichte oder gar über die allgemeine Bedeutung von (erzwungener) Migration in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft werden.“
Auch der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen ist mit dem Archivgesetz zufrieden:
“ …. Die Evaluation des ArchivG NRW, die im Jahr 2014 anstand, ist dagegen ein gelungenes Beispiel für die rechtzeitige und umfassende Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Belange. Nachdem das Kulturministerium NRW in seiner Vorprüfung festgestellt hatte, dass die geplanten Änderungen möglicherweise den Datenschutz berühren
könnten, wurde ich frühzeitig beteiligt und um Stellungnahme gebeten. Erfreulicherweise wurden meine Ausführungen (abzurufen unter http://www.ldi.nrw.de) im Weiteren berücksichtigt, so dass die Novellierung des ArchivG NRW letztlich zu keinen Einschränkungen des Datenschutzes führte.
Auch bei der Verarbeitung von Archivdaten ist sorgfältig darauf zu achten, ob Datenschutzbelange betroffener Personen berührt sein könnten. Je frühzeitiger derartige Überlegungen im Rahmen eines Projekts berücksichtigt werden, desto besser.“
Quelle: Datenschutz und Informationsfreiheit. Bericht 2015, S. 91
Vermutlich ist folgender Hinweis bekannt:
“ …. 10. August. Bey dem gestrigen Gewitter hat ein zündender Blitzstrahl das Dorff Freudenberg gantz in Asche gelegt. Es sind auff den Lärmenstreich viel Leuth auß vnserm Ambt herüber gemacht/ aber nichts mehr helffen können vnd nur ein Hauß am Seelbachs Weiher verschonet ist. Alß von denen Hintergegangenen die Mär hier verbreitet worden/ sofort jeder etwas an Victualien und Kleydung gegeben/vmb dem Elend in etwas zu steuern. Wird jeder ein hertzlich Mitleyden mit den Verbranten haben. Der allmächtige Gott verhelff ihnen vor dem Winter zu einem Unterkommen vnd verschon vns gnädig mit so harter straf. ….“
aus: Hermann Engelbert: Hinterhüttsche Chronik, Kreuztal 1994, S. 131
Stimmt! Allerdings scheint sich Gustav Siebels „Zur Geschichte der Stadt Freudenberg“, in: Wilhelm Güthling: Freudenberg in Verrgangenheit und Gegenwart. Festbuch zur 500. Wiederkehr der Bestätigung städtischer Rechte für Freudenberg, Freudenberg 1956, S. 69-70, auf eine ähnliche lautende Quelle zu beziehen.
Engelbert hat öfter auf tatsächlich vorhandene Quellen zurück gegriffen. Für das 18. Jahrhundert hat er beispielsweise Texte aus den Dillenburger Intelligenznachrichten genutzt. Der Freudenberger Text von Engelbert wird sicherlich irgendwo seinen tatsächlichen Ursprung haben. Leider sehr ärgerlich, dass Engelbert keine Quellenangaben gemacht hat.
Heinrich von Achenbach berichtet folgendes: “ …. Aus Nachrichten in siegen´schen Chroniken ist bekannt, daß 1666 am 10. August Freudenberg in Folge eines Blitzschlages abbrannte. ….“ (Quelle: Geschichte der Stadt Siegen, Teil IX Geschichte der Stadt Siegen vom Jahre 1653 bis 1700, Siegen 1894, S. 24, Digitalisat) . Dann gilt es wohl diese Chroniken zu finden, evt. Johannes Textor von Haiger, Nassauische Chronik, 2. Ausgabe: Wetzlar 1712 ……
Die Textor-Ausgabe aus dem Jahr 1712 liegt digitalisiert in München vor und kann online eingesehen. Beim ersten kursorischen Drüberlesen bin ich nicht fündig geworden.
Kurzer Bericht (natürlich auch nicht aus erster Hand) über den Brand im „lustige[n] Flecken Freudenberg“ in: Theatri Europaei Zehender Theil, Frankfurt a. M. 1703, S. 445.
Übrigens der Vollständigkeit halber: Steinseifer nennt folgende Quellen zum Standtbrand 1666:
1) 3 Hausinschriften
2) Siegener „Protocolum deß Extraordninari-Allmoßen-Kosten“ v. 6.9.1666
3) Siegener Kastenrechnung von 1666/67
4) Freudenberger Kirchen- und Kastenrechnung von 1669/70
5) Privilegienbrief von Fürst Johann Moritz v. 1.5.1687
6) Inventarverzeichnis der Ev. Kirchengemeinde Freudenberg v. 18.2.1695
aus: Bernd Steinseifer (Hrsg.): Freudenberg. Beiträge zur Geschichte der Stadt und des frühreren Amtes, Kreuztal 2006, S. 155-156.
Der Freudenberger Stadtbrand wird hier nicht erwähnt. Lediglich der Stadtbrand von Hilchenbach im Juli 1689 (60 Wohnhäuser, Kirche, Pfarrhaus, Schule) und der Stadtbrand von Siegen im April 1695 werden behandelt. Allerdings hat man in beiden Fällen den Kurfürst von Brandenburg um Hilfe in Form einer Genehmigung von Sammlungen gebeten. Im Siegener Fall ist sogar Sammelliste aus der Grafschaft Ravensberg erhalten. Vielleicht hat Johann Moritz ja auch um entsprechende Hilfe gebeten?
Hier ein Link zum Bild des Gedichtes, das in der Freudenberg Kirche hängt, auf ein großformatiges Holzbrett gepinselt, früher direkt auf die Wand geschrieben (Fragmente noch unter der heutigen Farbschicht erhalten).
Gibt es eventuell eine Beischreibung im Geburtenregister 1882 des Standesamtes Siegen, die auf die Beurkundung des Todes verweist? Sollte sich im StadtA Siegen klären lassen…
Dieser Aufforderung kommt das Stadtarchiv Siegen natürlich gerne nach. Leider kein Hinweis auf das Sterbedatum. Dafür einige andere Erkenntnisse (wesentliche und unwesentliche): Beruf des Vaters „Locomotivheizer“, Mutter „geborene Wienand“, Name des Jungen „Robert Christian Heinrich“ laut Nachtrag vom 11.09.1882; also ohne Oscar, der muss später dazugekommen sein.
Im Sterbeeintrag der Ehefrau Gabriele Anna Glashoff geb. Grau (Stadtarchiv München, Standesamt München IV 1399/1948) ist folgender Vermerk angebracht: „Ehemann + September 1946 in Degerndorf, Kreis Wolfratshausen“.
Degerndorf liegt heute in der Gemeinde Münsing, vielleicht lässt sich dort das genaue Sterbedatum feststellen.
Die Witwe wohnte laut Sterbeeintrag zuletzt in „Aufhofen, Kreis Wolfratshausen“ (heute Gemeinde Egling), verstarb jedoch in München.
Anfrage bei der Gemeinde Münsing verlief ebenso erfolglos, wie die von dort angeregte Anfrage an die Gemeinde Brannenburg wegen deren Ortsteil Degerndorf.
Nachtrag: Die Geburtsurkunde Jüchen Nr. 35/1881 weist als Eltern Schreys den evangelischen Lehrer Gerhard Schrey und Johanna Auguste geb. Steinfartz aus. Danke an das Gemeindearchiv Jüchen!
Das Universitätsarchiv München wies heute via E-Mail auf die online verfügbaren, im Druck erschienenen Personal- und Studentenverzeichnisse (1826-1946) hin. Die daraufhin erfolgte Durchsicht der Jahrgänge 1903 bis 1907 verlief erfolglos.
Das New Yorker Stadtarchiv verweist in seiner E-Mail vom 29.5.2015 auf die online verfügbaren Datenbanken der German Genealogy Group. Die beiden, wohl einschlägigen Datenbanken zum Ausländerwesen enthalten keine Hinweise auf Achenbach.
Auskunft des Landesarchivs Berlin vom 1.6.2015: In der Einwohnermeldekartei konnte Oscar Robert Achenbach nicht ermittelt werden. Die Berliner Adressbücher sind im Internet verfügbar: http://digital.zlb.de/viewer/sites/collection-berlin-adresses/. Die Suche in den in Frage kommenden Jahrgängewn 1930 und 1931 verlief erfolglos.
Eine Durchsicht der Adressbücher für die Stadt Siegen aus den Jahren 1902/03 und 1907/08 ergab, dass Achenbachs Vater in der Siegener Sandstr. 63 wohnte, so dass angenommen werden kann, dass Oscar Robert Achenbach 1905 von München aus nach dort zurückkehrte. In der Siegener Straßenkartei fehlte leider die Nr. 63 der Sandstr..
Mr. Dick war nicht bei der Einweihung anwesend. Die Gedenktafel , wie er fälschlicherweise erklärt auf Initiative der Stad Gent gamacht würde aber auf Initiative des Direktors des Westfriedhof Rudy D’Hooghe und ich gemacht würde. Ebenso haben wir die Wiederherstellung der beiden Grafen von Vander Haegen und Ackermann gewährleistet. Seit Jahren haben Frederik Vanderstraeten und ich selbst die Initiative ergriffen die Erinnerung an dieses Ereignis, am Leben in unsere verschiedenen Veröffentlichungen zu halten
– Vanderstraeten Frederik, Luchtschip ontploft boven Gent, Heemkundige Kring De Oost-Oudburg vzw, Deel I in Jaarboek XXXVI, 1999 – Deel II in Jaarboek XL, 2003
– Vanderstraeten Frederik & Dhanens Piet, Luchtschip ontploft boven Gent, uitg. in eigen beheer van de heemkundige kring De Oost-Oudburg, Gent, 2011
– Dhanens Piet i.s.m. De Decker Cynrik, De Zeppelins van Gontrode en
Sint-Amandsberg, in Een eeuw luchtvaart boven Gent, Deel I 1785 – 1939,
Uitgeverij Flying Pencil, Erembodegem, 2008, blz 88 – 114
In der Siegener Zeitung vom 6.6.2015 ergänzt die Reaktion der Seite „Heimatland“ den Beitrag Günter Dicks um den Hinweis auf den Nachruf auf Otto von der Haegen in der Siegener Zeitung vom 8. Juni 1915. Der Nachruf weist u. a. auf die Luftschifffahrten von der Haegens hin.
Der Internationale Archivrat bedankt sich via Facebook bei allen Teilnehmer: „Vielen Dank Archivare aus aller Welt!
International Archives Tag #IAD15 war ein Riesenerfolg „smile“-Emoticon
810 Elemente im Portfolio auf der Webseite http://www.internationalarchivesday.org
510 Einträge in diesem Jahr 380 davon neue Teilnehmer sind, nahmen 130 für das zweite Jahr
Am 9. Juni gab es 1.965.55 Hits, 29,446 Seitenzugriffe und 6,105 Besucher!
Heute haben wir 3.014.247 total Hits und 12,263 Besucher!
Herzlichen Glückwunsch an alle von euch !“
Wir haben gerne teilgenommen!
Dieser Twitter-Event hat nicht nut Spaß gemacht und die Vernetzung mit der weltweiten Archiv(ierenden)gemeinschaft gefördert. Sie hat nicht zuletzt zu 3 sehr erfolgreichen Tagen auf siwiarchiv geführt. Mit siwiarchiv haben wir sowohl am Projekt des ICA teilgenommen, als auch den Twitter-Event ( #IAD15 , #democracy) genutzt, um neue wie auch thematisch passende ältere siwiarchiv-Blogeinträge zu posten. Zur ein Einordnung der folgenden Zahlen sei gesagt, dass siwiarchiv zurzeit täglich durchschnittlich 250 einzelnen Besucher und etwa 500 Seitenzugriffe verzeichnet. Hier nun die Ergebnisse der letzten drei Tage:
9.6.: 459 Besucher, 1705 Seitenzugriffe
10.6.: 319 Besucher, 1265 Seitenzugriffe
11.6. 355 Besucher, 1734 Seitenzugriffe.
Ich verbuche dieses Ergebnis als Erfolg. Wenn bei „herkömmlicher“ Öffentlichkeitsarbeit ähnliche Werte erzielt werden, so glaube, würde in jedem anderen Archiv – auch – gefeiert werden.
Nach dem Brand wurde der „Alte Flecken“ von Freudenberg einheitlich wieder aufgebaut. Diese Leistung bzw. die Vorgabe wird Fürst Johann-Moritz von Nassau-Oranien zugeschrieben.
Es müsste für einen solchen einheitlichen planmäßigen Aufbau eine landesherrschaftliche Vorgabe gegeben haben. Bisher sind weder solche Dekrete oder Planunterlagen bekannt. Wo sind dazu interessante Unterlagen zu finden, die mit diesem Ereignis zusammen hängen?
Im Jahr 1979 ist ein Sonderheft SIEGERLAND (Band 56, Heft 1-2) „Johann Moritz Fürst zu Nassau-Siegen“ erschienen.
Darin verfasste Alfred Lück einen Artikel „Johann Moritz Fürst zu Nassau-Siegen als Landesherr in seinem eigenen Territorium“ und formuliert auf Seite 52:
„Im Jahre 1666 wurde der alte Marktflecken Freudenberg durch ein Großfeuer bis auf ein einziges Haus zerstört. Sofort unterstützte der Fürst den Wiederaufbau. Er gestattete den Bürgern, die Steine der militärisch wertlos gewordenen Burg zum Aufbau der Kellerräume ihrer neuen Häuser zu verwenden. Er ließ einen Bauplan (Fußnote 22) ausarbeiten, nach welchem die Scheunen mit ihrem leicht brennbaren Inhalt an die Straßen vor die Tore gelegt wurden. Zwischen den einzelnen Häusern blieb ein freier Raum, um das Übergreifen der Flammen in Zukunft zu verhüten. Johann Moritz gab für den Wiederaufbau Bauholz und Geld. Das Rathaus ließ er auf seine Kosten errichten und schenkte es dem „Flecken“. Die Kirche wurde erst 1675 vollendet. Ihr Turm ist der einzige Teil des alten Freudenberger Schlosses, der erhalten blieb. (…)“
In der Fußnote 22 heißt es: „Herbert Kienzler: Siegerländer Fachwerkhäuser, S. 62, Siegen 1974, vermutet, dass Pieter Post daran beteiligt war, während Helmut Delius: ‚Die städtebauliche Bedeutung des Grafen Johann Moritz von Nassau-Siegen in ‚Westfalen‘, 29. Band, Heft 1, Münster 1951, Seite 62, dies nicht für wahrscheinlich hält.“
Es wäre interessant zu wissen, ob Lück (1912-1982) eigene Recherchen angestellt hatte oder die „Überlieferung“ wiedergab.
In einer Biographie „Johann Moritz von Nassau-Siegen“ des Autors Holger Kürbis (Sutton-Verlag Erfurt, 2005) las ich auf Seite 80:
„Als im Jahre 1666 der Ort Freudenberg einem Feuer zum Opfer fiel, unterstützte Johann Moritz den Wiederaufbau, sowohl durch steuerliche Erleichterungen als auch in Form von Plänen und Bauvorschriften für die neuen Gebäude, die ein ähnliches Unglück künftig verhindern sollten.“
Antwort des Staatsarchivs München von heute (via E-Mail): “ …. in den Beständen der Regierung von Oberbayern konnten weder ein Einbürgerungsakt bzw. ein Akt zur Aufnahme in das bayerische Staatsgebiet zu Oscar Robert Achenbach noch Unterlagen zur Entlassung
bzw. Ausreise aus dem bayerischen Staatsgebiet ermittelt werden. Im entsprechenden Findbuch konnten für das Jahr 1918 generell keine Einbürgerungen festgestellt werden. Eine Recherche im Bestand des Bezirks- bzw. Landratsamtes München verlief ebenfalls ergebnislos.“
Ich erinnere mich an ein Seminar an der Universität Siegen, in welchem der Siegener Historiker Dr. Wolfgang Degenhardt davon sprach, dass Johann Moritz Freudenberg nach einem universal verwendbaren, stark durchdachten Plan eines niederländischen Architekten errichten lies. Ob es Post war, kann ich nicht mehr sagen. Da Herr Dr. Degenhardt sich mehrfach als „Johann Moritz Experte“ ausgewiesen hat und meines Wissens nach auch in den niederländischen Archiven geforscht hat, sollte man ihn bei Bedarf mal kontaktieren?!
Pouvez-vous me donner l’historique de la Société Fölzer Söhne
Qui était implantée à Hagondange Lorraine pendant la période 1897 à 1918 et 1940 à 1944.
Cette société existe-t-elle encore à Siegen?
Sinon à quelle date a-t-elle cessé son activité?
Merci d’avance de votre obligeance.
Borri
Es liegt ein Druckfehler des Geburtsjahres von Dr.Dr.Karl Neuhaus vor:Das Geburtsjahr war 1910 und nicht 1915! Leider sind keine weiteren spätere biographischen Daten vermerkt, auch nicht in dem Text von Thomas Schattner. Es gibt allerdings Vermutungen.
Die Biographie von Neuhaus zu erforschen, ist aufgrund der vielfältigen, von einander abweichenden Angaben aufwändig. Eben bis zum Geburtstag hin muss alles überprüft werden. Allerdings ist das Jahr 1910 wohl korrekt; es wird übrigens bereits im Eintrag selbst bereits erwähnt.
Die Recherchearbeit finde ich gut gelungen, aber diesen Herrn als „Heimatschriftsteller“ zu bezeichnen, finde ich recht gewagt (bezgl. der geringen Quantität der Publikationen und der fehlenden umfangreicheren Monographien). Ich würde ihn eher als Heimatforscher titulieren.
Vielen Dank für Ihre Antwort. Lässt sich die spätere Tätigkeit nach Ende der Verurteilungszeit ausmachen und wann, bzw wo Herr Dr. Neuhaus verstorben ist?
Neuhaus verlegte seinen Lebensmittelpunkt vom wittgensteinschen Laasphe, da er dort nur schwer Arbeit fand, nach Bonn, wo er in Adressbücher zuletzt als Prokurist geführt wurde. Am 21.12.2000 ist er in Wertheim verstorben.
Für uns Kinder war in den 1960ern und 1970ern die Ruine dieses Hauses, also das erhalten gebliebene Untergeschoss aus Bruchstein, einer der geheimnisvollsten Orte in der Umgebung. Mein Vater, Jahrgang 1928, erzählte uns, dass das mal ein Gasthaus war und dass er dort sogar mal selbst als „Kegeljunge“ gearbeitet hatte. Vorstellen konnten wir uns das alles aber nicht, denn zu unserer Zeit war das „Haus“ ein düsteres, bemoostes Gemäuer unter Bäumen, auf dem oben eine kleine Wiese wuchs. Von daher ist es toll, nach so vielen Jahren jetzt nochmal Hintergrundinformationen zu der Ruine zu bekommen (ah schau, sie hatte sogar einen Namen – Waldhaus!) und gar erstmals BILDER zu sehen, wie das Haus mal aussah. Danke!
Beim Bau der Hüttentalstraße kam die Ruine ja leider abhanden, zusammen mit dem gesamten Wald entlang des Siegufers. Die Ruine war natürlich nur eine Ruine, aber irgendwie gehörte sie eben dazu, war gar der Höhepunkt dieses wunderschönen, lauschigen Wanderweges mit dem rostbraunen Geländer unter den Bäumen entlang der Sieg. Im Wasser schwammen Enten, deshalb war der Weg für uns Kinder der „Wulle-Wulle-Entenweg“. Aber auch das kann sich heute angesichts der sterilen Steinwüste unter der Hüttentalstraße niemand mehr vorstellen, der es nicht selbst gesehen hat.
ganz hervorragend! Vielen herzlichen Dank für diesen erhellenden Beitrag über die Ethik des Archivierens und über dein persönliches Verständnis von Kultur, dass auch durch deine Arbeit geprägt ist.
Das Stichwort „vorurteilsfrei“ finde ich sehr treffend, kam bislang in der Blogparade noch nicht direkt vor, aber indirekt, wenn es auf das Sich-Einlassen-auf-fremde-Kulturen ging.
wunderbar, ich bin begeistert, denn ich war Schüler von von
Fehling und Meyer Lippe in den 50er Jahren der Malschule.
Es gibt ein gutes Gefühl erinnert zu werden an die Meister,
die einem das „Laufen“ lernten;
Danke für die Reaktion! Manche Blogs werden von der Deutschen Nationalbibliothek archiviert – s. http://www.blog.de/thema/dnb/ . Literarische Blogs werden vom Deutschen Litaraturarchiv Marbach gesichert – s. http://www.dla-marbach.de/dla/bibliothek/literatur_im_netz/literarische_weblogs/.
Die technische Archivierung des Blogs ist demnach wohl kein Problem.
Aber wer sich für die große Anzahl regionaler, lokaler oder spezialwissenschaftlicher Blogs kümmert, ist noch nicht ausdiskutiert, geschweige denn, dass die zuständigen Archive, Bibliotheken oder Museen darüber überhaupt sprechen.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Archivierung der blogspezifischen Elemente wie Blogparade oder auch Blogstöckchen Probleme darstellen, über die noch nicht (genügend) nachgedacht wurde.
Pressemitteilung der Stadt Siegen, 6.7.2015:
„Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Nr. 297 „Koch’s Ecke“ fand vor Ort am 27. Mai 2015 eine erfolgreiche Planungswerkstatt mit zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Gemeinsam wurden Ideen gesammelt und Vorschläge erarbeitet, wie das Quartier zukunftsfähig entwickelt werden könnte. ….. “ Übereinstimmend formulierten die Teilnehmenden: “ ….. Das Straßen.NRW-Gebäude wird erhalten und soll als Wohnhochhaus für verschiedene Bewohnergruppen genutzt werden. Alternativ könnte es aber auch als Gründerzentrum mit einem Panorama-/Dachcafé genutzt werden. Die Hammerhütter Schule und das Straßen.NRW-Gebäude sollen saniert und ausgebaut als zentrale Merk- und Orientierungspunkte im Quartier dienen und zur Identifikation beitragen. …..“
Kleine Korrektur (um möglicher Legendenbildung vorzubeugen): 1945 war die Siegener Zeitung verboten; hier dürfte es sich wohl um die „Amtlichen Bekanntmachungen“ der Alliierten Militärregierung handeln.
Gibt es irgendwelche Erkenntnisse darüber, wann der Arbeitskreis Wegeforschung im HB Siegerland-Wittgenstein endlich brauchbare
Ergebnisse (Register, Karten, Buch, Homepage) liefert?
Die Dokumentation der bisher bekannten Wege ist abgeschlossen. Diese wurden (!) und werden durch Exkursionen in der Öffentlichkeit bekannt gemacht. Neu hinzugekommene Wege sollen zukünftig dokumentiert werden.
Der Alten Flecken und die Stadt Freudenberg werden auch im Travel Magazine der Singapore Airlines (Heft Juli 2015) besprochen (frdl. Hinweis Bernd Brandemann).
habe aus dem Nachlass meiner Mutter eine Ölgemälde bekommen.
Dieses Ölgemälde muesste in dern 1970iger-/achtziger Jahren in der Gegend von Olpe, Freudenberg erstanden sein. Aus der Signatur kann ich nur Vogt erkennen. Bei meiner Recherche bin ich auf dieser Seite gelandet.
Das Ölgemälde muss nach meinen Recherchen die historische Altstadt
von ‚Rothenburg o.d. Tauber sein (mit Plönleinbrunnen). Das dieses Gemälde Rothenburg o.d. Tauber darstellt, wurde mir von meiner Mutter zu deren Lebenszeit immer wieder betont. Sie hing sehr an diesem Bild. Eine Aufnahme könnte ich Ihnen zukommen lassen. Ich würde zu gerne wissen, ob ich richtig liege. Zumal es ja sehr interessant ist, dass es ja tatsächlich aus dem Siegerland einen Maler mit diesem Namen gab. Vielleicht kann man ja auch die Signatur vergleichen. Bin oft im Siegerland (wohne allerdings in Düsseldorf). Bin einfach neugierig, und möchte wissen, ob es sich um den besagten Künster handelt,
Überraschende Erinnerungen an meine Kinderzeit, die ich in der Oberen Kaiserstraße 10 verbrachte – das hat mich doch sehr bewegt! Vielen Dank für die Fleißarbeit (und Dank auch an meinen ältesten Volksschulfreund Klaus aus der Unteren Kaiserstraße, Haus Solms, der mich auf die Dokumentation aufmerksam macht) !
Eine interessante Geschichte über die lokale Bürgerinitiative und wie man sich manchmal ins Zeug legen muss, um etwas zu erreichen. Grade solche Begebenheiten sind manchmal interessanter als die große (Welt-) Politik.
Am 17. September wird es in der Sitzung des Kulturausschusses des Landes NRW einen mündlichen Sachstandsbericht zum Digitalen Archiv NRW geben – Link zur Tagesordnung.
Zu den im weitesten Sinne geschichtlichen Themen gehört auch:
FRids e.V. – Die Scouts – Jugendliche Fachexperten als Workshopleiter, Stadtführer und mehr…
Insbesondere dazu gehören die Flecken-Scouts.
Hi,
wenn du magst finde ich es für dich raus. Bin gerade bissel im Stress aber wenn ich in etwa zwei wochen mal zuhause bin schau ich für dich nach.
Scann mir doch einfach die Unterschrift und schick mir eine Mail.
Beste Grüße,
Jens
Neuste Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt: Stasi im Siegerland (Sipri-Akten des MfS der DDR)
Die Strategie der Stasi im Siegerland war erstaunlich breit.
In Siegen waren vor allem betroffen : Industriebetriebe, Hotels, maoistische Gruppen, Friedensgruppen, „EDV-Behörde“ einer Verwaltung, Militär, sogar Schulen. Oft wurden belanglose Informationen „abgeschöpft“, die aber zusammen ein Bild ergaben. Die detaillierten Ergebnisse werden Mitte 2016 veröffentlicht.
Insgesamt finde ich die Seite gut geordnet und gelungen. Allerdings empfinde ich sie etwas zu grau und damit trist. Das scheint im Allgemeinen allerdings eher ein Fall für eine andere (IT-)Abteilung zu sein. Eventuell könnten auf der Seite des Kreisarchivs manche Abschnitte mit anderen Graunuancen hinterlegt werden, um diese Tristesse aufzubrechen. Die weiße Untermalung des Kontaktfeldes ist da schon ein guter Anfang, lenkt aber etwas vom Inhalt ab.
An dem selben Ast, an dem auch das Blatt „Kreisgeschichte / Kreisarchiv“ hängt, hängt ebenso eines mit dem Titel „MdEP, MdB, MdL“. In dem Abschnitt Zeittafeln im Blatt „Kreisgeschichte / Kreisarchiv“ werden allerdings nur die Landtags- und Bundestagsabgeordneten bedacht. Da freuen sich Interessierte sicherlich über eine weitere Zeittafel.
Danke für die Antwort! Das Farbdesign ist durch die CI der Kreisverwaltung festgeschrieben, aber Grau passt doch ganz gut zum Archiv …. Alle Verlinkungen werden zeitnah überprüft werden.
ich habe ein Gemälde von Siegfried Vogt in meinem Besitz, das höchstwahrscheinlich ziemlich unbekannt ist. Es handelt sich um eine Portraitskizze von Susanne Meckel. Dies ist die Enkelin des Architekten Meckel aus Ferndorf. Als ihre Eltern vor 3 Jahren verstorben sind habe ich es beim ausräumen des Hauses gesehen und war sofort davon begeistert. Sie hat es mir darauf hin geschenkt. Je länger ich es in meinem Besitz habe desto mehr verfolgt mich der Gedanke, daß es irgendwann wieder zurück ins Siegerland sollte. Es handelt sich hierbei schließlich um einen Maler, der dort gelebt und beliebt war. Zumal ich keine Kinder habe und es mir unerträglich wäre, wenn es nach meinem Ableben in irgend einem Speicher verstaubt. Meine Frage wäre deshalb. Gibt es im Raum Siegen ein Stadt, bzw. Gemeindemuseum, das daran Interesse hat und es ausstellen würde? Ich würde es als Dauerleihgabe mit Eigentumsübergang nach meinem Ableben verleihen. Bedingung wäre natürlich, daß es in Ehren gehalten und nicht veräußert wird. Verschenken kann ich es leider nicht, da ich ein Geschenk nicht weiter verschenken kann. Mit Frau Meckel habe ich das auch schon abgeklärt. Sie fand die Idee sehr gut.
Fotos des Gemälde schicke ich Ihnen sehr gerne zu. Geben Sie mir bitte eine E-Mail Adresse.
Für eine kurze Nachricht wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Vielen Dank und viele Grüße aus München
Sigi Morgen
vielen Dank für Ihre prompte Antwort und der Auswahl der Museen.
Ich habe Ihnen Fotos von dem Gemälde inc. der Rückseite beigefügt. Bitte überprüfen Sie, ob für das Kreisarchiv das Gemälde von Interesse ist. Ich würde darauf hin mit Frau Meckel sprechen, denn ich würde es gerne gemeinsam mit ihr dem Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein schenken.
Da das Gemälde für mich einen hohen persönlichen Wert hat, wäre mir besonders wichtig, daß es nicht veräußert wird. Außerdem sollte es nicht nur in Kellern verschwinden, sondern gelegentlich bei Ausstellungen den Interessierten gezeigt werden. Damit sich die Menschen in Ihrer schönen Gegend daran erfreuen können.
Bin gestern Abend zufällig auf diese Seite gestoßen und habe versucht den Rest der Karte von Herrn Bärlin zu entziffern. Nach meiner Meinung müsste der Wortlaut folgender sein:
Freudenberg Kreis Siegen / Vereinslazaret Westfalen
Liebe Freunde.
Will Euch mitteilen, daß ich
Euren lieben Brief auf dem
Weg zum Sturm auf Grafen
stafel erhalten habe abends
4 Uhr bekam ich 1 Schuß in den
linken Oberarm es war ein
Wunder wir lagen (schon) mehrere
Stunden da und durfen uns nicht
regen vor dem Feind doch mit Gottes
Hilfe aus dem Feuer zu entkommen
Lebt wohl mit Gott auf Wiedersehen
grüßt Euch alle
Karl Bärlin“
Feldpost
An
Karoline Gall
Affalterbach b d Kelter
O/A Marbach
Württemberg
Das in Klammern gesetzte „schon“ könnte ein Kürzel aus der Stenographie sein. Es würde sinngemäß hineinpassen.
Aus Anlass der spontanen Neubeschriftung des Ostvertriebenendenkmals im Kontext der seit einiger Zeit in Europa auftretenden Flüchtlingskarawanen vor allem aus dem europäischen und dem Nahen Osten sei einmal angemerkt, dass dieser kleine Akt einer begrenzten Regelverletzung doch jedenfalls zum Nachdenken anregte? Was ja doch immer das Beste ist, was sich von einem bemerkenswerten Ereignis sagen lässt. Ich habe daraufhin im Geschichtsbuch gestöbert.
Vom sozialdemokratischern Regierungspräsidenten Fritz Fries aus Siegen zu den Ostflüchtlingen und Ostvertriebenen seiner Amtszeit:
„Das Flüchtlingsproblem … ist eines der vordringlichsten unserer Tage. Mein Protesttelegramm gegen weitere Zuweisung mit Flüchtlingen hat schlagartig die Situation, in der wir stehen, beleuchtet. … Soweit die ortsansässige Bevölkerung helfen kann, muß sie zur Hilfe herangezogen werden, denn zu keiner Zeit hat das Wort von der Liebe zum Nächsten mehr Geltung gehabt als heute … einer trage des anderen Last.“
Wenngleich – so bei anderer Gelegenheit – manches zu bedenken sei:
„… wir sehen, daß unsere Mädels zu einem großen Teil nicht mehr wählerisch sind. … Die Hauptsache ist, daß sie ihrem Genuß leben können. So ist die Geschlechtskrankheit zu einer Volksseuche geworden. Ich kann Ihnen sagen, da, wo sie von Osten eingeschleppt ist, ist die Syphilis meistens in ein bis zwei Jahren tödlich, da sie viel gefährlicher ist als bei uns im Westen. … Wir bekommen jetzt die Leute aus den Balkanstaaten, aus Österrreich und der Tschechoslowakei, wir bekommen sie vornehmlich aus Polen und zu einem Teil aus der russischen Zone. Die Menschen sind besonders in der polnischen Zone von Haus und Hof vertrieben, sie kommen zerlumpt, zerissen, krank und siech ohne Hab und Gut an. Die kranken und siechen Körper sind für alle Epidemien empfänglich, und wir haben daher eine ganz besondere Vorsicht walten zu lassen.“ (Manfred Zabel, Die Heimatsprache der Begeisterung. Ausgewählte Reden und Schriften von Fritz Fries, Siegen 1990, S. 91, 104)
Der nahe und weitere Osten demnach ein irgendwie schon auch so etwas wie ein Seuchengebiet! Von anderem einmal abgesehen (Kaninchenhaltung in der Badewanne, Unkenntnis mitteleuropäischer Sanitärinstallation usw.). Offenbar Annahmen von langer Dauer.
Eine Schwierigkeit immerhin existierte damals offenbar noch nicht: dass die Praxis, weibliches Kopfhaar durch ein Tuch dem männlichen Blick zu entziehen, Aufsehen erregt hätte. Diese Erscheinung nahm ja damals sprunghaft zu! Auch von Aversionen, die fremdartige Bindetechniken beim tuchgewohnten Publikum ausgelöst hätten, hat man noch nichts gehört. Insofern lässt sich m. E. aus dem Ereignis über das reine Nachdenken hinaus auch ein bisschen was lernen.
Dass unsere Grundordnung/der EU-Wertekanon durch die Denkmalsverfremder/-neugestalter verletzt worden wäre, wie laut Zeitung manche staatliche Stellen annehmen, kann ich noch nicht erkennen. In dieser Hinsicht dürfte m. E. eher an Steuerflüchtlinge (mit und ohne Kopftuch) zu denken sein und ein entsprechender Aufklärungs- und Handlungsbedarf bestehen?
mich erreichte eine Anfrage zu den Nach-NS-Amtszeiten von Erich Moning. Da ich in der Recherche auf unterschiedliche Angaben stieß, bitte ich das Kreisarchiv und zugleich die interessierten Leser um Unterstützung bei der Klärung:
b) Nach einer Angabe der Siegener Zeitung vom 19.1.2010 („Mit dem Zusammenbruch des Dritten Reiches Anfang 1945 verlor er sein Kreuz¬taler Amt [als Ferndorfer Amtsbürgermeister], wurde aber bereits ab Juni 1945 als bewährter und letztlich unverzichtba¬rer Verwaltungsfachmann von der britischen Militärregierung zum Kreis Siegen berufen, zunächst als Kreisfinanzdirektor und ab 1947 bis 1963 als Oberkreisdirektor.“, siehe auch: http://www.ferndorf.de/nachrichten.php?id=524) war es bereits 1945.
c) Beide Angaben sind ausweislich seiner eigenen Angaben in der Entnazifizierungsakte unzutreffend. Demnach wurde er 1946 Kreisfinanzdirektor, und 1947 wurde er zum OKD gewählt. Das Wahlergebnis bedurfte der Bestätigung der Militärregierung, die ebenfalls 1947 erging. Moning gibt in seinem Fragebogen das präzise Wahldatum an und auch die Stimmenverhältnisse. Ich sehe keinen Anlass, daran zu zweifeln. Daher findet es sich so auch in dem bekannten Regionalen Personenlexikon (http://akteureundtaeterimnsinsiegenundwittgenstein.blogsport.de/a-bis-z/gesamtverzeichnis/#moning).
d) Inwiefern wurde er zu was „von der Militärregierung berufen“?
Ein Auszug aus unserer Landräte- und Oberkreisdokumentation gibt Auskunft darüber, dass Moning bereits 1946, wenn auch kommissarisch bzw. vertretungsweise Oberkreisdirektor war:
1946-1963 Moning, Erich Dr
“Ich kann nicht mit halber Kraft arbeiten” (aus Kuhbiers Trauerrede, 18.9.1967)
• geb. 11.11.1902 in Schwerte/Ruhr, gest. Mi. 13.9.1967 19:45 Uhr in Buschhütten (Herzinfarkt)
• Heinrich Moning, Oberbahnassistent in Hagen, Marie geb. Nolte; 1 Bruder; Beamtenfamilie
• 1906 verzog die Familie nach Hagen
• Ev., Konfirmation: Psalm 91
• Seit 14.6.1929 verh. mit Hedwig geb. Ackermann (*30.1.1904, gest. 20.5.1990), 4 Kinder
• 1909 – 1913 ev. Volksschule
• 1913-1921: 8 ½ Jahre Städt. Oberrealschule, (1 ½ Jahre Primaner)
• Abitur Ostern 1921
• Banklehre 1.10.1921- Juli 1923 bei Barmer Bank-Verein
• 3.8.1923 – 31.3.1924 Hilfsangestellter bei Stadtverwaltung Hagen (Wohlfahrtsamt, Rechnungsführung)
• SS 1924 – 1927 Studium der Wirtschaftswissenschaften an den Universitäten Tübingen (SS 24, WS 24/25) und Köln (Dipl. Volkswirt: 31.5.1927 (gut))
• Diplom-Arbeit: “Die Theorien der Preis- und Einkommensbildung bei Jevons und Cassel” (gut)
• Diss. In Köln: Arbeitsbeschaffung für Erwerbsbeschänkte” im Mai 1928 (gut) [Referent Prof. Lindemann, Staatsminister a. D. dort auch alle Vorlesungen und Prüfungen besucht]
• 1. Staatsexamen, 2. Staatsexamen
• ab 18.06.1928 wissenschaftlicher Hilfsarbeiter bei der Stadt Finsterwalde
• ab 1. Juli 1929 Bürgermeister der Stadt Hilchenbach
• 3.7.1929 feierliche Einführung (Artikel Kreuztaler Zeitung 3.7.1929, SZ 4.7.1929)
• ab 25.1.1932 Bürgermeister des Amtes Ferndorf (ca. 6000 RM jährlich))
• 29..8.1934 Beamteneid auf A. H.
• 1934 NS-Rechtswahrerbund
• 1934-1939 förderndes Mitglied der SS
• 1.5.1937 Beitritt zur NSDAP
• Tätigkeit für des Kreisamt der NSDAP für Kommunalpolitik: Berichte (Anregungen für die Herausgabe von Gesetzen und Erlassen)
• seit 11.12.1940 Freistellung vom Heeresdienst “entgegen seinen persönlichen Wünschen”
• Anhänger der Bekennenden Kirche, 1933 Einschreiten gegen SA-Auftreten (während des Krieges Beleidigung in öffentlicher Versammlung in Ferndorf) • Landkreis Siegen: Kreisoberverwaltungsrat 1. Juni 1945-Februar 1946
• Kreisfinanzdirektor 5. Februar 1946-Juni 1947
• 1.7.46 vtw. OKD, 23.8.1947 OKD Siegen
• April 1947 Vertreter des Kreises in den Gremien des RWE
• Dez. 1947 Aufsichtsrat der Hüttenwerke Siegerland (Eichener Walzwerk)
• Aufsichtsratsmitglied Westfälische Ferngas AG
• Aufsichtsratsmitglied Gewerkschaft Steinkohlebergwerk Viktoria Matthias Essen
• Schulausschuss Südwestfälische Verwaltungs- und Beamtenschule, Hagen
• Juli 1948 Beirat Ev. Jung Stilling Krankenhaus Siegen
• 1960 Stiftskurator Geseke-Keppel
• 1962-1966 Beirat der Staatl. Ingenieurschule in Siegen
• Oberleiter des Gillerbergheims (Verdienst Ms!?)
• Ehrenmitglied des Siegerländer Turnbundes
• Förderer Turnverein Eichen
• Förderer Ev. Gymnasium Weidenau
• Mitglied des vorläufigen Provinzialausschusses und des beratenden Ausschusses für die Provinzialverwaltung 1947-1953
• Mitglied in Gremien des Landkreistages NW: Vorsitzer des Finanzausschusses 1947-1963, Vorstand 1947-1954, stell. Vorstandsmitglied 1957-1963
• Vor 1963 Vorsitzer der Landeskonferenz der Oberkreisdirektoren in NW
• Mitglied in Gremien des Deutschen Landkreistages: Finanzauschuß
• OKD: 23.8.1947-22.8.1959 u. 23.8.1959-31.12.1963 (vorzeitiger Ruhestand wegen dauernder Dienstunfähigkeit nach Dienstunfall mit PKW in der Nähe von Kleve am 9.11.1962 (Herzinfarkt))
• 1964 Ehrenplakette der IHK
• Dienstwohnung: Fürst Moritz Str. 12/14, später: Bruchstr. Buschhütten
• Trauerfeier 18.9.1967 Bühne der Stadt Siegen: Siegerland-Orchester: Bach, Air, Mendelsohn-Bartholdy, Andante con moto d-moll op. 90, Beethoven, Ouvertüre “Coriolan”
• Verdienst/Würdigung: Verfechter bürgerschaftlicher Selbstverwaltung, Menschenführung, Fleiß, Mann des Ausgleichs
• Themen: Wiederaufbau, Wirtschaftsförderung, Wohnungsbau, kommunale Neugliederung, Kultur- und Gesundheitspflege, Finanz- und Schulwesen, Sozialpolitik, 1953 gegründeter Wasserverband Siegerland (!)
Quellen:
Kreis SIWI, Altregistratur, Personalakten(4 Hefter) Dr. Erich Moning
Häming, Josef: Die Abgeordneten des Westfalenparlaments 1826–1978 (Westfälische Quellen und Archivverzeichnisse, Bd. 2), Münster 1978, S. 459 (Nr. 1085)
Landkreistag Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Dokumentation über die Landräte und Oberkreisdirektoren in Nordrhein-Westfalen 1945 – 1991 stammen, Düsseldorf 1992, S. 704.
SZ 30.5.1973
Sehr geehrter Herr Seysen,
herzlichen Dank für die Entzifferung. So konnte ich jetzt auch den Ort des Kriegsgeschehens herausfinden: Grafenstafel ist das belgische Gravenstafel, bei Ypern, wo im Zuge der zweiten Flandernschlacht der Schreiber Karl Bärlin verwundet wurde. Unsäglicherweise wurde in dieser Schlacht auch zum erstenmal am 22. April 2015 Giftgas (Chlorgas) durch die deutsche Armee eingesetzt, was bei Tausenden von Soldaten zu einem qualvollen Tod führte. Weder der ‚Feind‘ noch die deutschen Soldaten hatten Schutzmasken zur Verfügung. Der Schuss in den Oberarm war so gesehen vielleicht lebensrettend.
Man sollte nicht alles ändern, verlegen und krampfhaft nach Neuerungen suchen.
Das Staatsarchiv in Würzburg hat sich bewährt und sollte dort bleiben. Außerdem dürften die Mittel, die eine Verlegung binden würden, besser angelegt und benötigt werden.
“ ….. Aktives Museum in Warteschleife
In der Warteschleife ist das andere Projekt in der Nachbarschaft: Der Kulturausschuss vertagte die Entscheidung über den Kreiszuschuss für die Erweiterung des Aktiven Museums, das das Obergeschoss des ehemaligen Hochbunkers, der auf den Mauern der von den Nazis zerstörten Synagoge steht, zusätzlich übernehmen kann. 180 000 Euro sollen Stadt und Kreis übernehmen, 420 000 Euro bezahlt das Land. Der Kreis tut sich noch mit der vertraglichen Situation schwer: Eigentümer des Gebäudes ist weder Stadt noch Kreis, sondern eine von Baufirmen getragene Investorengesellschaft.“
Quelle: Westfälische Rundschau online, 24.11.2015, http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/stiftung-will-fuer-philharmonie-in-siegen-bauen-id11319740.html#plx1135264190
Interessant wäre natürlich auch die Angabe (sowohl hier als auch in der Wikipedia), welche Archivalien für diese Auskunft benutzt wurden. So werden die Belege in der primärquellenkritischen deutschen Wikipedia ggf. nicht lange bestehen (hoffen wir das Beste, in letzter Zeit scheint der Wind sich etwas zu drehen).
Für das Archiv selber sind genaue Signaturangaben natürlich auch deshalb von Vorteil, weil diese Recherchierenden bereits etwas mehr auf die Archivalien vorbereitet und diese dann auch schon (bei entsprechendem Vorwissen) selbstständig im Findbuch suchen können.
Insgesamt ein gutes Format, danke dafür!, welches sowohl der freien Enzyklopädie als auch dem Kreisarchiv hilft. Hier bedarf es viel mehr Kooperation in Deutschland.
Nur zur Verdeutlichung: es handelte sich um keine eigene Recherche des Kreisarchivs. Dem Benutzer wurden Auszuge aus unserer Landräte-Dokumentation zur Verfügung gestellt.
FolgendenQuellen wurden ausgewertet:
1) Wolfgang Friedrich von Schenck:
Güthling, Wilhelm: Die Landräte des Kreises Siegen von 1817 bis 1919, in: Siegerland (47) 1970, S. 35-43
Walther Hubatsch (Hrsg.): Grundriß zur deutschen Verwaltungsgeschichte 1815-1945, Bd. 8: Westfalen, Marburg 1980, S. 303
Irle, Lothar: Siegerländer Persönlichkeiten- und Geschlechterlexikon, Siegen 1974, S. 285-286
Romeyk, Horst: Die leitenden staatlichen und kommunalen Verwaltungsbeamten der Rheinprovinz 1816 – 1945, Düsseldorf 1994, S. 716 – 717
Wegmann, Dietrich: Die leitenden staatlichen Verwaltungsbeamten der Provinz Westfalen 1815-1918, Münster 1969, S. 324-325
Siegener Zeitung 30.5.1973
Noch auswerten:
Schindlmayr, Norbert: Zur preußischen Personalpolitik in der Rheinprovinz. Eine Untersuchung über die Anstellung der höheren Regierungsbeamten und der Landräte in den Regierungsbezirken Koblenz und Trier zwischen 1815 und 1848, Diss. Phil., Köln 1969 [gemäß Register]
Weber, Georg (Bearb.): Festschrift zur 100-Jahrfeier des Kultur- und Gewerbevereins für den Kreis Siegen, Siegen 1933
Deutsches Geschlechterbuch Bd. 95, S. 291f. [Bild: Bd. 28, 1951]
Kruse, Hans: Das Siegerland unter preußischer Herrschaft 1815-1915
Nachruf in einer Siegener Zeitung Januar 1848
2) Karl Roth:
Irle, Lothar: Siegerländer Persönlichkeiten- und Geschlechterlexikon, Siegen 1974, S. 274
Landkreistag Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Dokumentation über die Landräte und Oberkreisdirektoren in Nordrhein-Westfalen 1945 – 1991 stammen, Düsseldorf 1992, S. 497.
Siegerländer Heimatkalender 1981, S. 46
Noch auswerten:
Aus dem Siegerland 3. Jg. Heft 5 Mai 1953, 17. Jg. Heft 2 Febr. 1967
Siegener Zeitung 7.12.1954, 21,2,1962, 21.2.1967
3) Willi Kettner:
Irle, Lothar: Siegerländer Persönlichkeiten- und Geschlechterlexikon, Siegen 1974, S.173
Kreis Siegen-Wittgenstein, Akten zur Verleihung des Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland 1978-1979 (17.8.1979)
Landkreistag Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Dokumentation über die Landräte und Oberkreisdirektoren in Nordrhein-Westfalen 1945 – 1991 stammen, Düsseldorf 1992, S. 390.
Siegerländer Heimatkalender 1991, S. 36 [mit Bild]
Siegener Zeitung 30.5.1973, 8.5.1990
Noch auswerten:
Siegener Zeitung 7.4.1961, 14.2.1963, 14.2.1973
“ Aktives Museum: Mues will Kreis überzeugen: (08.41 Uhr)
Die Erweiterung des Aktiven Museums Südwestfalen soll noch im Dezember beschlossen werden. Siegens Bürgermeister Steffen Mues hofft, bis dahin den Kreis überzeugen zu können, sich ebenfalls finanziell zu beteiligen. Der Kulturausschuss des Kreises Siegen-Wittgenstein hatte sich noch nicht entschieden. Er glaubt, für das Projekt seien noch mehr Fördergelder möglich. Mues sagte, alle Fördermöglichkeiten seien geprüft worden. Er hofft, dass der Siegener Stadtrat und der Kreistag im Dezember dem Antrag zustimmen. Sonst würden 420.000 Euro Fördersumme vom Land im kommenden Jahr verfallen. Grundsätzlich seien sich Stadt und Kreis einig, dass die Museumserweiterung ein gutes und wichtiges Projekt ist. Das Aktive Museum Südwestfalen dokumentiert die regionale NS-Geschichte, insbesondere der jüdischen Gemeinde, und ist auch für viele Schulen Anlaufstelle.“
Quelle: WDR, Lokalnachrichten Südwestfalen, 27.11.15, http://www1.wdr.de/studio/siegen/nrwinfos/nachrichten/studios151166.html
Wurden diese Rätsel inzwischen gelöst? Sonst sei an dieser Stelle erwähnt, daß neben den baulichen Veränderungen (Nürnberger Haus, Neugestaltung des Vorplatzes, Entfernen des Kopfsteinpflasters) der Schlüssel zur Datierung im Zeitungskiosk liegen könnte – vorausgesetzt natürlich, man bekommt ein bißchen mehr zu sehen, wenn man diese Stelle so hochaufgelöst neu einscannt, wie es irgend geht. Vielleicht läßt sich eine Zeitung, eine Zeitschrift oder ein Romanheft genauer erkennen. – Beim oberen Foto verdeckt der rechtsstehende Herr leider ein Plakat, dessen Überschrift mit T beginnt und mit A endet (das kann natürlich alles mögliche sein, aber es kann auch etwas ganz besonderes sein …). Lassen sich die beiden Geschäfte neben der Stadtsparkasse identifizieren? Auf der Karosserie des mittleren Taxis spiegelt sich außerdem ein markantes Gebäude, aber das ist wohl der Bahnhof? – Außerdem: ist überhaupt sicher, daß beide Fotos zum gleichen Zeitpunkt aufgenommen wurden? Sieht nicht so aus?
Lieber Sven H.,
nein das Rätsel wurde noch nicht gelöst. Aber wenn es Ihnen gelingt diese Zeitungen zu datieren, dann sind wir vielleicht noch ein Stück weiter:
Leider gab die Vorlage nicht mehr her.
Hey, ein anderes Foto, das offensichtlich unmittelbar vor oder nach dem zweiten Foto aufgenommen wurde – das ist doch eine tolle Fundgrube! Viele Details sind leider nicht zu erkennen, aber es gäbe hier mehrere Lösungsansätze. Lassen sich die Postkarten identifizieren und datieren? Durch die Designs der vielen Zeitungs- und Illustrierten-Logos – die ja oft auch Änderungen unterworfen waren – ließe sich eventuell ein Zeitfenster eingrenzen („Bild“, „Frankfurter Nachtausgabe“, „Westfälische Rundschau“, „Frankfurter Rundschau“, „Frankfurter Allgemeine“, „Die Neue Zeitung“, „Die Welt“, „Der Schlesier“, „Rheinischer Merkur“, „Die ZEIT“, „Handelsblatt“, „Le Monde“, „Neue Post“). Auch die Tatsache, daß hier einige Zeitungen überhaupt zu sehen sind, grenzt den Zeitraum ein – so gab es den Titel der „Frankfurter Nachtausgabe“ erst ab 1951 (https://www.ub.uni-frankfurt.de/wertvoll/ffmztg4.html), die „Bild-Zeitung“ erschien lt. Wikipedia erstmals am 24.06.1952 (Schlagzeile: „[???]raub wie im Gangsterfilm“), und „Die Neue Zeitung“ (rechts) erschien lt. Wikipedia bundesweit nur bis September 1953 (danach nur in Berlin, wo sie im März 1955 eingestellt wurde). Das allein grenzt das Aufnahmedatum des Fotos bereits auf 1952/1953 ein! (Oder 1952-1955, falls „Die Neue Zeitung“ in ihrer auf Berlin beschränkten Ausgabe dennoch in Siegen erhältlich war.) Die „Neue Post“ mit der Schlagzeile „Verführte Jugend“ ist nicht sonderlich aussagekräftig; der abgebildete Herr daneben ist nicht zu erkennen, oder? „Die ZEIT“ am linken Rand wäre mit Hilfe des Online-Archivs auf zeit.de am schnellsten zu datieren gewesen, aber leider kann man außer dem Logo nichts sehen. Comic-Experten wüßten sicherlich sofort, welche Serien im rechten Bereich am Fenster hängen, leider ist es keine „Micky Maus“ … Am vielversprechendsten scheinen die oben links nebeneinander aushängenden Ausgaben der „Revue“ und des „Stern“ zu sein; letzterer hieß in den 1950er Jahren noch „Der Stern“ und hatte ein größeres Stern-Logo. Man müßte jetzt eigentlich nur noch die „Revue“- und „Stern“-Jahrgänge 1952 und 1953 nach dem jeweiligen Cover durchsehen. Neben den ursprünglichen Verlagen und normalen Bibliotheken könnten ebay und zvab.com möglicherweise helfen; bei der Suche wären wohl die Wintermonate auszuklammern, vgl. die belaubten Bäume gegenüber dem Bahnhof (nach Hochsommer sieht es auch nicht gerade aus). – Last but not least: gibt es noch andere Fotos aus derselben Serie, die zeitgleich aufgenommen worden sein dürften und auf denen wichtige Details zu sehen sind?
Richtig! Auch hier ging es schnell. Wenn jetzt noch der Architekt ermittelt wird, dann können wir uns auf die weiteren schönen Bilder konzentrieren.
P.S.: Das Bild vom 3.12. wurde noch nicht aufgelöst ……
Kreishaus Siegen, ehem. Seitenflügel vor der Erweiterung von 6 Achsen zum späteren Hochaus hin und Aufstockung um eine Etage, daher kürzer als bekannt und nur EG und 4 Etagen, vorne Übergang zum alten Kreishaus, das dem Hochhaus weichen musste.
Pläne um die Errichtung (…) ist natürlich gut vorsichtig ausgedrückt, aber ich glaube nicht, dass es sich um die Heilstätte Hengsbach handelt.
An der rechten Seite ist ein Teich oder See, oder?
Welches Krankenhaus -denn etwas in der Richtung scheint mir das Modell auch darzustellen- hat/ hatte nur einen See/ Teich?! – Ich weiß es nicht?
Grüße aus Berlin
Dagmar Spies
Das ist die „Heilstätte auf der Hengsbach“, 1952 im Juli war nach den entsprechenden Beschlüssen der Kreistags- und Kreisausschüsse dann im Juli Baubeginn, Oktober 1953 Fertigstellung der Heilstätte, des Schwestern- und des Ärztehauses.
Lungenheilstätte Hengsbach! Wg. den Staublungen der Bergleute und damals noch relartiv häufigen TBC-Erkrankungen. Fast autark oben links war das Brunnenhaus für die Wasserversorgung, unterhalb eine eigene Kläranlage! Dazwischen ein Minigolfplatz, ein Luxus zu damaliger Zeit !
Gefällt mir · Antworten · 1 · 9 Min · Bearbeitet
Es handelt sich tatsächlich um ein Modell der Lungenheilstätte Hengsbach! Vielen Dank fürs Mitraten und die weitergehenden Informationen!
Als Danke schön 2 weitere Bilder:
Nachtrag II: Bei dem vorderen „Pete“-Heft, dessen Cover zu sehen ist, handelt es sich defintiv um „Eine schreckliche Erfindung“ – Heft Nr. 42 von 1953, vgl. Abbildung und Angaben auf http://www.detlef-heinsohn.de/hefte-pete.htm (etwas weiter unten). Links dahinter dürfte „Der Bund der Gerechten“ – Heft Nr. 41 stecken, vgl. dieselbe Abbildung auf derselben Seite. Nähere Angaben zu den Erscheinungstagen stehen dort nicht, aber da „Pete“ lt. Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Pete_%28Zeitschrift%29) am 8. Oktober 1951 startete und lt. http://www.detlef-heinsohn.de/hefte-pete.htm (das steht dort zu Beginn der Vorstellung der Heftserie) vierzehntägig erschien, ergibt sich für Heft Nr. 42 der 4. Mai 1953 (bei dieser Rechnung liegt der Jahreswechsel 1952/1953 tatsächlich zwischen den Ausgaben 33 und 34, wie es in der Liste auf derselben Seite auch nahegelegt wird). Es steht also schon mal fest, daß dieses Foto an oder nach diesem Datum aufgenommen worden ist, vermutlich in den ersten beiden Maiwochen?
Lieber Sven H., vielen Dank für die Datierung! Toll, was Sie alles in so kurzer Zeit ermittelt haben. Weitere Bilder liegen zwar vor, aber enthalten, wenn ich es recht sehe, keine Einzelheiten, die Ihre Ergebnisse noch präzisieren könnten. Wenn gewünscht, reiche ich diese Bilder aber gerne nach. Allerdings wird dies wohl erst zwischen den Jahren geschehen können.
Nix zu danken, so was macht Spaß. :o) Nachtrag III: Auch wenn die Erwähnung der „Micky Maus“ weiter oben eigentlich augenzwinkernd gemeint war, so ist sie tatsächlich ebenfalls zu finden, gleich links von den linken Postkarten. Es ist Heft 5/1953, vgl. http://coa.inducks.org/issue.php?c=de%2FMM1953-05 (man erkennt die schrägen Streifen der Tapete). Die „Micky Maus“ erschien damals monatlich und ein exakter Veröffentlichungstermin dürfte wohl kaum noch festzustellen sein – der stünde doch wohl sonst im Inducks? Immerhin verdichten sich damit die Hinweise auf den Mai. Links daneben hängt übrigens das „Micky Maus Sonderheft“ Nr. 4 („Im Land des Riesen“ – http://coa.inducks.org/issue.php?c=de%2FMMSH++4), lt. Inducks bereits am 15. April 1953 erschienen.
Nachtrag IV: Da wir in unserer Bibliothek „Die Neue Zeitung“ auf Mikrofilm haben und nun ein überschauberes Zeitfenster – Mai 1953 – offen zu stehen schien, habe ich versucht, die beiden auf dem Foto unterhalb des „Die Neue Zeitung“-Logos erkennbaren zweizeiligen Schlagzeilen auf einer Ausgabe wiederzufinden. Habe den gesamten Mai und mit wachsender Verzweiflung auch den Juni durchgesehen, aber nirgends war auf einer Titelseite in der linken Schlagzeile die zweite Zeile leicht länger als die erste und in der rechten Schlagzeile die erste Zeile bedeutend länger als die zweite. Dann fiel der Groschen, der Mikrofilm spulte ab dem 1. Mai langsam zurück … und siehe da: die auf dem Foto abgebildete „Die Neue Zeitung“-Ausgabe datiert vom 29. April 1953. Zum einen stimmen die Proportionen der Schlagzeilen zweifelsfrei überein, zum anderen befindet sich auf der unteren Hälfte der Titelseite ein Artikel über „Frankfurter Bankräuber vor dem Schwurgericht“ zu „einem der schwersten Banküberfälle in Deutschland“ am 16. August 1952 in Frankfurt-Bockenheim, bei dem zwei Angestellte getötet und ein dritter schwer verletzt wurde (vgl. „Bankraub wie im Gangsterfilm“ in der „Bild-Zeitung“). Das wär’s dann, oder? – Den Scan der Titelseite schicke ich Ihnen per Mail …
Bei dem Gebäude handelt es sich um das 1952 eingeweihte ehemalige Alten- und Pflegeheim am Weidenauer Tiergarten. Wie das Gebäude heute genutzt wird, kann ich leider nicht sagen (vielleicht als Studentenwohnheim?).
Die Architekten waren Hoffmann und Bernshausen, die den Zuschlag für den Bau nach dem Gewinn eines Architektenwettbewerbs erhielten. Weitere Informationen zu dem Bau des Alters- und Pflegeheims in einem Beitrag von Sigrid Rapp-Ridder auf siwiarchiv http://www.siwiarchiv.de/?p=10038
Leider nein. Das Gebäude befindet sich im Siegerland.
Übrigens, es handelt sich auch nicht um das Hallenbad in Siegen-Weidenau, wie in der geschlossenen Facebook-Gruppe „Siegerland in alten und neuen Bildern“ vermutet wurde.
Auf der Homepage des Siegerländer Heimat- und Geschichtsvereins findet sich folgende, erfreuliche Nachricht: „Aufgrund der großen Nachfrage ist das Sonderheft „Hauberg“ der ZS Siegerland als Heft 2/2015 bereits vergriffen!“ Gratulation!
Was hier geschehen soll, ist schlichtweg ein Skandal. Kann und darf man so mit einem uralten, historischen Ortskern umgehen, wie man ihn im weiten Umkreis wohl nicht noch einmal findet. Zur Erinnerung und Information derer, die nicht die erforderliche Ortskenntnis haben: Da steht an der Hauptstraße „Schneidersch Hus“, ein prachtvolles, denkmalgeschütztes Gebäude von 1750, ehemals Gasthof für durchreisende Fuhrtleute und Posthalterei (um 1800), von seinen Besitzern liebevoll gepflegt. Gleich gegenüber, direkt vor der Kirche, das Schleifenbaumsche Haus, auch im Privatbesitz, anno 1731/32 auf Anordnung des Fürstenhauses als Kirchspielschule erbaut. Dann, im Herzen des Ortskernes, die schöne alte Kirche aus der Mitte des 13.Jahrhunderts, im spätromanisch-frühgotischen Stil errichtet. Sie verfügt über ein geschichtsträchtiges Innenleben und besitzt Glocken aus den Jahren 1512 und 1588. In unmittelbarer Nähe finden wir das älteste Pfarrhaus Nordrhein-Westfalens, erbaut 1608, ein bildschönes Baudenkmal von besonderem historischen Wert. Nur wenige Schritte davon entfernt steht die alte Pfarrscheune von 1736. Unmittelbar gegenüber im malerischen Winkel der alte Pfarrweiher mit dem Pfarrbackes, für den der damalige Pfarrer im Jahre 1750 die Baugenehmigung erhielt.
Diesem einmaligen historischen Ortskern will man nun an den Kragen.
Offenbar wurden hier Angstrechnungen erstellt, um den Menschen des Kirchspiels zu erklären, warum man Pfarrhaus und Kirche aufgeben muss.
Tatsache ist aber, dass kaum Kosten auf die Kirchengemeinde zukommen würden, da für solch wertvolle und erhaltenswürdige Bausubstanz genügend Fördermittel zur Verfügung stehen, um die sich offensichtlich niemand bemüht hat. Wie sonst konnte man den Menschen erzählen, dass auf die Gemeinde möglicherweise eine sechsstellige Summe zukommen würde?
Die verantwortlichen Damen und Herren sind hier dringends gefordert die offenbar übereilten Beschlüsse zu überdenken, um den sonst drohenden Raubbau an Kultur und Historie zu vermeiden. Oberholzklau muss erhalten bleiben ! ! ! !
Es ist immer wieder verblüffend zu sehen, welch denkwürdige, in der Heimatpresse eifrig gelobte Novitäten die Siegener Lokalhistoriographie hervorbringt. Der vorliegende Fall betrifft ein „Büchlein“ (S. 7), das, wie es aussieht, seinen Verfasser und Gegenstand vor dem Leser ängstlich zu verbergen sucht; Einband und Titelblatt geben darüber keine Auskunft!
Den Namen des Autors enthüllen die beiden Herausgeber – der Stadtarchivar und der Leiter der Geschichtswerkstatt Siegen – erst in ihrem Vorwort. Sie stellen Tobias Gerhardus als einen Mann der „freien Wirtschaft“ aus dem „Nachbarkreis Altenkirchen“ vor (S. 8). Wer die Ohren spitzt, erfährt: Gerhardus war ‒ nach Besuch der Philosophischen Fakultät Siegen ‒ Praktikant im Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein und bekam, obschon bildungshistorischer Laie, den Auftrag, einen „Zeitstrahl“, eine „kurze Chronik“ des „Lӱz“ zu erarbeiten; daraus erwuchs das besagte „Büchlein“. Gerhardus ist Jungunionist, Ratsherr, Kreistagsabgeordneter, CDU-Stadt-, Kreis- und Bezirksvorstandsmitglied und, wie die Spatzen von den Westerwälder Dächern pfeifen, auf dem Sprung, über kurz oder lang in den Landtag von Rheinland-Pfalz einzuziehen. Es scheint, als wollten die Herausgeber den unbedarften Rezipienten an der Nase herumführen.
Den Umschlag vorn ziert ein Zitat: „Die zeitgemäße Ausbildung des weiblichen Geschlechts“. Wer zu lesen beginnt, bemerkt rasch, dass das Buch nicht hält, was es verspricht; es handelt nicht von „Bildung“ oder (beruflicher) „Ausbildung“, von Weiblichkeitsbild, „Philosophie“ und Alltag einer höheren Mädchenschule. Den Umschlag hinten dominiert ein Text über Ziel und Zweck der „Frauenschule“, die ihre Zöglinge auf die Rolle der „Hausfrau, Mutter und Staatsbürgerin“ vorbereiten sollte; doch gab es am Siegener Lyzeum, von einer flüchtigen Episode 1920/23 abgesehen, einen solchen Frauenschulzweig gar nicht. Die Herausgeber ihrerseits akzentuieren die baugeschichtlichen Früchte des Buches (S. 7). Wer nun erwartet, er erfahre Neues über die Architektur preußischer (Straf-, Kasernen-, Kranken- und) Lehranstalten oder die Erziehungsideale verflossener Zeiten, die, in Stein gesetzt, am „Lӱz“ zu bewundern sind, sieht sich arg enttäuscht.
Die Herausgeber betonen (S. 7), sie hätten, als Tobias Gerhardus Kontakt mit ihnen aufnahm, „spontan“ entschieden, das Manuskript zu publizieren. Gewiss, auf Intuition und „Bauchgefühl“ zu vertrauen, erspart Zeit und Mühe (und ist modisch); bisweilen hilft aber, den Verstand und ein wenig Sorgfalt walten zu lassen. Die „bedeutsame Ausarbeitung“ (S. 7), welche die Editoren dem staunenden Publikum präsentieren, ist, bei Licht betrachtet, Blendwerk und Mogelpackung.
Gute Idee. Immerhin vereint dieses Titelfoto damit die Archive im Kreis Siegen-Wittgenstein – was ja auch Siwiarchiv macht. Und es macht deutlich, wie individuell und eigen es in den einzelnen Archiven im Landkreis aussieht.
Danke für die Meinung! In der geschlossenen Facebook-Gruppe „Archivfragen“ oszilliert die Meinung zurzeit zwischen „langweilig“ und „interessant“. Wir sind auf weitere Einschätzungen gespannt.
In jedem Fall besser als die leere, von Geisterhand bewegte Rollregalanlage – damit assoziiert ein Archivfremder vermutlich nicht viel. Die Fotocollage zeigt ein reales Bild des kommunalen Archivwesens: Es sind Unterlagen vorhanden, die in verschiedenen Stadien magazintechnischer Aufbereitung gezeigt werden. Echtes Archivleben eben! Daumen hoch ;-)
Der Kommentar war auch nicht negativ in Bezug auf das alte Bild gemeint, das ich schon ansprechend fand. Aber als Archivar sieht man die Dinge ja auch mit entsprechendem Vorwissen, was mir erst im Vergleich aufgefallen ist. Insofern: Gut (alt) und besser (neu).
hallo zusammen , der name siegerland wurde gewählt weil die frau von otto albers aus dem siegerland stammte.
ich hab 1966 als moses auf der siegerland angefangen .
Der 2.500. Unterzeichner der Petition kommt aus Siegen. Danke an alle Unterzeichnenden von hier! Diejenigen die noch nicht gezeichnet haben, können dies gerne noch nachholen.
Die Flasche könnte für den OKD Forster zur Verarbschiedung gewesen sein.
Reifezeit von 1975-1999 = Amtszeit im Kreis Siegen, später Siegen-Wittgenstein. Der Emanzipationsgehalt für das Wittgensteiner Bergvolk könnte auf die Zusammenlegung der Kreise Siegen und Wittgenstein anspielen, der „Beitrag zur Völkerverständigung“ eventuell auf Spandau und Emek Hefer.
Das könnte für Karl-Heinz Haepp gewesen sein, der sich lange Jahre mit der Ergänzung unserer Kreis-Bezeichnung mit dem Zusatz Wittgenstein eingesetzt hat. Bekanntlich hat das ja nach der Zusammenlegung der Kreise ein wenig gedauert.
Die Person ist richtig, die Begründung aber zu allgemein. Übrigens den konkreten Anlass findet man auch auf der Homepage des Kreises: http://www.siegen-wittgenstein.de/ .
Karl Heinz Happ gibt via E-Mail folgende Ergänzungen: “ ….. Erwähnenswert ist sicherlich noch, dass mit der Aufnahme der Wittgensteiner Pfähle der Nassauische Löwe „nach hinten“ rücken musste, weil er sonst -wie früher- aus dem Wappen „herausgeschaut“ hätte, was die Münsteraner Heraldiker nicht für richtig hielten.
Festhalten sollte man auch, dass die Flasche von Anne Bade ?? überreicht worden ist; …..“
Zum Thema ist ebenfalls online greifbar:
Buchholz, Matthias: Stichprobenverfahren bei massenhaft gleichförmigen Einzelfallakten : eine Fallstudie am Beispiel von Sozialhilfeakten. In: Historical Social Research 27 (2002), 2/3, pp. 100-223. URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-31255
Vielen Dank für den Beitrag zu Otto Bäcker und die online Veröffentlichung
der Broschüre zum 2. Mai 1933 im Siegerland.
An besagtem Tag war ein weiterer Gewerkschafter und Sozialdemokrat
im Gewerkschaftshaus anwesend Ernst Bruch. Auch er wurde schwer geschlagen und verstarb infolge dieser Misshandlungen 1942.
Bisher gab es in der regionalen Literatur und Erinnerung keinen Hinweis auf ihn.
Ernst Bruch
Ernst Paul Bruch wurde im Jahre 1891 in Weidenau als Sohn des Schankwirts
Wilhelm Bruch und der Emilie geborene Klein geboren.
Er heiratete im Jahre 1913 Anna Katharina Margarethe Jung aus Siegen,
das Ehepaar wohnte im Kirchweg 30.
Während des 1. Weltkriegs war Ernst Bruch Soldat in einem Infanterieregiment.
Nach dem Tode seiner Ehefrau heiratete Ernst Bruch 1923 die Schneiderin Bertha Hoffmann aus Banfe. Diese Ehe wurde geschieden.
Seine dritte Ehe ging er 1929 mit Auguste Martha Maria Knauf ein.
In den zwanziger Jahren trat Ernst Bruch in die SPD ein und wurde Mitglied einer der Freien Gewerkschaften die im ADGB organisiert waren.
Als Sozialdemokrat und Gewerkschafter war sein Eintritt in das von Sozialdemokraten dominierte, in Reaktion auf rechtsextreme Putschversuche entstandene Reichsbanner Schwarz–Rot–Gold ein Zeichen seiner politischen Überzeugung.
Wir dürfen davon ausgehen, dass Ernst Bruch nach seiner Partei- und Organisationszugehörigkeit ein Gegner des Nationalsozialismus war.
In den wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu Beginn der 30er Jahre wurde der Heizungsmonteur Ernst Bruch Hausmeister im Gewerkschaftshaus der sozialdemokratisch orientierten ADGB–Gewerkschaften in der Siegener Sandstraße. Hier hatte er mit seiner Familie eine kleine Dienstwohnung.
Als die Nazis am 2. Mai 1933 die Gewerkschaftshäuser in Deutschland stürmten und damit die Gewerkschaften endgültig zerschlugen, wurde auch das Haus in der Siegener Sandstraße verwüstet. Die anwesenden Gewerkschaftsmitglieder, darunter auch Ernst Bruch, wurden durch das SA-Kommando Odendahl schwer misshandelt.
Im Gerichtsverfahren gegen das „Rollkommando Odendahl“ wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit 1948 schilderten die zu diesem Zeitpunkt noch lebenden Zeugen den Hergang der Ereignisse.
Zeuge Peter Müller: „Auch der Hausmeister Bruch, der inzwischen verstorben ist, wurde an diesem Tage von der SA schwer misshandelt. Er war seit dieser
Zeit bis zu seinem Tode kränklich.“
Das Gericht stellte fest: „Der Hausmeister Bruch wurde so geschlagen, dass sein Körper blutige und blutunterlaufene Stellen aufwies. Er klagte auch über Nierenbeschwerden…“
Die Nationalsozialisten beschlagnahmten das Gewerkschaftshaus. Es fanden dort weitere Misshandlungen von politischen Gegnern statt.
Ernst Bruch verlor seinen Arbeitsplatz und damit die Existenzgrundlage für sich und seine Familie.
Als Gegner des Nationalsozialismus fand er erst 1937 wieder Arbeit bei der Heeresstandortlohnstelle, er wurde dort als Heizer beschäftigt.
Doch Aufgrund der schweren Misshandlungen erkrankte er dauerhaft und erleidet einige Jahre später einen Schlaganfall.
Ernst Bruch verstarb am 4.2.1942 an den Folgen der Misshandlungen vom
2. Mai 1933 im Alter von 50 Jahren.
Bei den Angaben zur Familie Bruch habe ich die Unterlagen der Standesämter Siegen und Weidenau im Stadtarchiv Siegen genutzt.
Alle anderen Angaben enstammen der Entschädigungsakte
LAV NRW Abteilung Westfalen, Regierung Arnsberg, Wiedergutmachung
Nr. 26878 Ernst Bruch,
Hier wird leider statt des ursprünglich verlinkten Videos eine Fernsehshow von ProSieben angezeigt, die so gar nichts mit Latène-Ofen zu tun hat. Es wäre wohl ratsam, diesen Link zu entfernen.
Bild 1: vorne rechts ist ein „Auto“ in das Bild hineinmontiert.Das Auto kommt offensichtlich von links (Koblenzer Straße), wie hat es sich auf die Kreuzung gemogelt, wenn der Linksabbiegerverkehr aus der Frankfurter Straße freie Fahrt hat?
Fein beobachtet! Aber welchen Typ stellt denn dieses ‚Spielzeugauto‘ dar? Kleine Korrektur: Der Linksabbiegerverkehr kommt aus der Spandauer Straße, damals Wilhelmstraße. Zur Datierung: Die Bilder 1 und 2 dürften kurz nach 1963 aufgenommen sein. Damals gab es nach Bau der Spandauer Brücke eine Neuordnung der Verkehrsregelung in der Unterstadt mit Einführung des “amerikanischen Abbiegens“, man beachte das Schild im Vordergrund; diese neuartige Verkehrsführung verursachte dem deutschen Automobilisten viel Unbehagen, was zu täglichen Blechschäden an Kochs Ecke führte. Bild 3 dürfte 1969 aufgenommen sein wg. des eingerüsteten Hotels Koch im Hintergrund; die Neueröffnung nach der Aufstockung war wohl 1970.
Die Achenbach-Ausstellung hätte ich noch mit dem Ehrenbürgerbrief der Stadt Siegen für den Reichskanzler Adolf Hitler ergänzen können. Die Ehrenbürgerschaft wurde im Stadtrat am 1. April 1933 gegen 4 Stimmen der SPD-Abgeordneten beschlossen. Den Wettbewerb für die Ausgestaltung der Ehrenbürgerkassette gewann der heimische Künstler Hermann Kuhmichel. Den Text für den Brief schrieb Museumsdirektor Dr. Kruse. Die Ausgestaltung des Ehrenbürgerbriefs sowie das Abschreiben des Kruse-Textes übernahm Hans Achenbach für 300 RM. Zur Übergabe des Ehrenbürgerbriefs reisten der Gauinspektor Heriinglake und Gauleiter Wagner im Novemeber 1934 nach Berlin. Eine Übergabe schlug fehl, weil der „Kanzler wegen starker Inanspruchnahme“ verhindert war. So schickte OB Fißmer den Ehrenbürgerbrief am 14. Dezember 1934 per Post zum Reichskanzler.
StaSi, 2. Registratur Nr. 368 (Angabe wahrscheinlich veraltet)
Hallo,
rechts hinter den Taxen sind zwei Geschäfte, in einem habe ich meine Ausbildung (1967) gemacht: Grete Füllengraben Miederwaren, habe im Netz nachgeschaut, Frau Füllengraben hat das Geschäft eröffnet am 01.03.1958. Also muss das Bild mit den Taxen nach 1958 entstanden sein. Daneben ist noch die Sparkassenpassage. Der ganze Häuserkomplex, so wie mir bekannt ist, gehörte der Bundesbahn bzw. der Eisenbahnerwohnungsgenossenschaft (heißt heute anders) . Diese hat heute ihren Sitz in Weidenau und die müssten ja noch wissen, wann die Passage gebaut worden ist?
Einem E-Mail-Hinweis folgend hier nun weitere Literatur zu Hans Achenbach:
1) Schwarz, Kirsten: Hans Achenbach – das künstlerische Werk, in: Siegerland, 2009, H.1, S. 64ff
2) Löw, Wilhelm: Hans und Hanna Achenbach – in: Siegerland. Bd 30, 1953, S. 31-38.
3) Heifer, Otto: Von der Landschaft zum Proträt.Der künstlerische Weg des Malers Hans Achenbach, in: Siegener Zeitung Jg. 121 Nr. 213, 11.9.1943
4) Paul Niehaus: Atelierbesuch bei Hans Achenbach. Das Lebenswerk eines Sechzigers, in: Westfalenpost/siegenerländer Zeitung Jg. 6, Nr 116 v. 22.5.1951
6) Alfred Becker und Kirsten Schwarz: Beschreibung der Bleistiftzeichnungen von Hans Achenbach für „Mai“ und „Oktober“, Siegerland Bd. 86 H 2 (2009), Seite 153ff
7) Alfred Becker und Kirsten Schwarz: Beschreibung des Kalenderbildes von Hans Achenbach für den Monat Januar, Siegerland Bd. 86 H 2 (2009), Seite 158ff
8) Alfred Becker und Kirsten Schwarz: Die Kalenderbilder des Siegerländer Malers Hans Achenbach, Siegerland Bd. 85 H 2 (2008),Seite 167ff
9) Alfred Becker und Kirsten Schwarz: Die Kalenderbilder des Siegerländer Malers Hans Achenbach, Siegerland Bd. 85 H 1 (2008), 94ff
10) Erika Falkson: Kinder und einfache Menschen gemalt. Zum 100. Geburtstag von Hanna Achenbach-Junemann, Siegerland Bd. 69 H 3-4 (1992), Seite 79ff
11) Ursula Blanchebarbe: Bilder vom bäuerlichen Leben geprägt. Erinnerung zum 100. Geburtstag von Hans Achenbach, Siegerland Bd. 68 H 1-2 (1991), Seite 11ff
… weil dies eine Tafel ist, die an das Hauptdurchgangslager Wellersberg für Flüchtlinge und Vertriebene erinnert. Die Gedenkstätte für die belgischen Streitkräfte befindet sich auf dem Heidenberg;dort ist auch eine Tafel angebracht.
Die Tafel ist dort noch nicht angebracht. Auf den Artikel in der Westfälischen Rundschau v. 17.9.2015 wird verwiesen. Ferner empfiehlt sich eine Suche im Ratsinformationssystem der Stadt Siegen nach den Begriffen „Wellersberg“ und „Gedenktafel“
Unter dem Titel „Siegerländer Fachwerkhäuser und die Industriegeschichte“ befindet sich in den Siegener Beiträgen 18, 2013, S. 128-147 ein Artikel zu dem Thema. Der geneigte Leser findet darin die „wahre“ Geschichte der Siegerländer Fachwerkhäuser und viele aufgeworfene Fragen.
Ab sofort: Buchung und Reservierung von Gruppenführungen durch die Ausstellung!
Für die Ausstellung „Siegen an der ‚Heimatfront‘. 1914-1918: Weltkriegsalltag in der Provinz“, die vom 17. April bis 19. Juni 2016 im Siegerlandmuseum im Oberen Schloss gezeigt wird, können ab sofort auch Gruppenführungen gebucht werden! Für Rückfragen und Reservierungen steht Herr Christian Brachthäuser vom Stadtarchiv Siegen unter der Rufnummer 0271 / 404-3090 oder per Mail unter c.brachthaeuser@siegen.de zur Verfügung.
Die Veranstalter (Geschichtswerkstatt Siegen e.V. und Stadtarchiv Siegen) weisen aus gegebenem Anlass darauf hin, dass alle Gruppen und Schulklassen unabhängig von einer getätigten Buchung den Eintrittspreis direkt an der Museumskasse zu entrichten haben. Der ermäßigte Eintrittspreis für Kinder, Jugendliche, Studenten bis 26 Jahre sowie Besitzer/innen der Jugendleiterkarte (JuLeiKa) und des Schwerbehindertenausweises beträgt in Gruppen ab 10 Personen 1,00 € pro Person, für Erwachsene 2,50 € pro Person. Zusätzlich zu dem ermäßigten Museumseintritt wird eine Pauschale für die bestellten Führungen erhoben, die bar bei der jeweiligen Ausstellungsführerin bzw. bei dem jeweiligen Ausstellungsführer zu bezahlen ist. Das Honorar für Führungen von Schulklassen beträgt 30,00 €, für Erwachsenengruppen 50,00 €.
Aus organisatorischen Gründen können im Rahmen der Öffnungszeiten des Siegerlandmuseums im Oberen Schloss (dienstags bis sonntags 10.00 – 17.00 Uhr, Montag geschlossen) maximal vier Führungen pro Tag angeboten werden. Die Sonderöffnungszeiten zu Ostern und Pfingsten sind auf der Website des Siegerlandmuseums unter http://www.siegerlandmuseum.de zu entnehmen.
Ich ging davon aus, dass die Unterlagen nur hinsichtlich ihres Inhalts zu prüfen sind, ein zeitlicher Aspekt („Unterlagen, die vor dem TT.MM.JJJJ entstanden sind…“) ist dem IFG nicht zu entnehmen oder?
Was bedeutete das für vor dem 1.1.06 geschlossene Akten, die bis zu weitere 30 Jahre in der Behördenregistratur oder im Zwischenarchiv verbleiben?
Wie Sie richtig ausführen müsste noch genauer als bisher das genaue Zugangsjahr in den Erschliessungsdaten vermerkt werden, um überhaupt prüfen zu können, ob ein Zugang nach IFG ermöglicht werden kann (Bei einigen früheren amtl. Akzessionen ist mir das nicht möglich).
Soll das nun auch bedeuten, dass Unterlagen, die die eigene Person betreffen gem. BDSG auch nur dann eingesehen werden dürfen, wenn sie vor Errichtung des BDSG abgegeben wurden?
Wie siehts mit Schutzfristen aus? Gelten die dann auch nicht je nach aktueller Rechtslage (im BArchG ist ja wohl z. B. ggf. eine Absenkung 30 auf 10 Jahre nach Tod bzw. von 110 auf 100 Jahre nach Geburt peplant), sondern ausgehend vom Abgabezeitpunkt und welche Fristen hier galten?
Es handelt sich um ein Artikel aus dem Jahr 2013. Selbst wenn das Land NRW kein bzw. weniger Geld für den Denkmalschutz zur Verfügung stellt, blieben noch der Bund, der Landschaftsverband Westfalen-Lippe, die Kommune, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, …..
Die Lösung lautet Kreishaus Siegen, Koblenzer Straße. Die Umrisse der Gebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite sind mir sehr vertraut. Um den Erhalt von einem der Gebäude habe ich mich sehr bemüht. Einen schönen Abend.
Christian Welter
Könnte es sich um Banfe handeln mit Blickrichtung über den Ort hinweg auf Auerbachtal (heute mit Fa. WKW bebaut), Gr. und Kl. Alertsberg und Spreitzkopf?
Da war lag ich im ersten Versuch daneben….
Nach nochmaliger Betrachtung und Beratung mit Stefan Leipelt ist es ziemlich sicher der Blick über Laasphe (links die Walmdächer Bahnhofstraße, rechts Altstadt) Richtung Gennernbach.
Standort des Fotografen könnte Kalteborn gewesen sein.
Das Foto ist ca. 100 Jahre alt und man erkennt eine ganze Reihe Häuser im Tal. Deshalb vermute ich mal, dass das Foto über die Stadt Laasphe selber aufgenommen wurde. Weiter vermute ich, dass der Fotograf im Süden der Stadt (Buhlberg?) stand und in Richtung Nord-Nordost d. h. Puderbach (Rote Hardt, Stein, Hermannsberg) fotografiert hat.
Bei den Herren direkt neben Karl Althaus dürfte es sich höchstwahrscheinlich um Folke Rogard (1899-1973) gehandelt haben, von 1949 bis 1970 Präsident des Weltschachbundes FIDE (Fédération Internationale des Echecs); ihm zur Seite (am ganz rechten Bildrand mit Brille) Ludwig Schneider (1907-1975), von 1969 bis 1975 Präsident des Deutschen Schachbundes (DSB).
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich würde mich freuen, wenn Sie mirt die Folge 22 (Thielicke) gegen Rechnung zusenden würden.
Im Voraus danke ich Ihnen herzlich!
In der alten Titelaufnahme der ULB Münster steht: „1 Kt. auf 6 Bl. im Schuber“. Offensichtlich wurden 6 Einzelkarten des Regierungsbezirks beschnitten und zusammengeklebt (deshalb auch sechsmal der Besitzerstempel). „Kreis Siegen“ ist die stehengebliebene Beschriftung des unteren mittleren Blattes und für das Ganze natürlich irreführend.
P.K.
Wer soll das Museum betreiben?
Was würde der laufende Betrieb kosten?
Wie hoch wären die Investitionen?
Wäre das Museum auch auf einer Teilfläche möglich?
Das sind die wesentlichen Fragen, die sich der Siegerländer so stellt, und die stellt er sich seit einem halben Jahrhundert und schafft es nicht, gleichzeitig für die Idee eines Industriemuseums eine Stiftung oder ähnliches zu gründen, die heute weit über eine Millionen Euro Startkapital haben könnte.
Auch wurde es versäumt, sich intensiv darum zu bemühen, einen der Standorte des LWL-Industriemuseums, Westfälisches Landesmusuem für Industriekultur, in das Siegerland zu holen.
Jetzt ein Industriemuseum im Siegerland aufzubauen, wird ungleich schwerer als früher, auch wenn geeignetes Gelände und Gebäude durchaus vorhanden sind. Ich drücke mal meine Hoffnung aus, dass es noch gelingt.
Für die Diskussion ist es vielleicht hilfreich einen Blick auf die Sitzung des Kreiskulturausschuss vom 29.6.2010 zu werfen. Dort wurde die Errichtung einer Dokumentationsstelle Wirtschaftsgeschichte diskutiert: Vorlage und Niederschrift.
Zum Vorschlag Günter Dicks s. a. Artikel in der Westfälischen Rundschau v. 1.4.2016.
Auch ohne das Industriemuseum in Hilchenbach gibt es im Siegerland und
angrenzenden Gebieten ein reiches montangeschichtliches Erbe. Aber wer
kennt es? Ein erstes zartes Pflänzchen könnt die Eisenstraße Südwestfalen sein. Den Tourismusverband SI muss man hier jedoch zum Kampfplatz tragen. Der ist eher für Büffel in Wittgensteiner Wäldern zu haben.
Die Idee eines Siegerländer Industriemuseums ist in Anbetracht der einmaligen historischen Landschaft befürwortenswert, aber die Umsetzung organisatorisch und finanziell nicht praktikabel. Zehn- und hunderttausende Besucher pro Jahr, die notwendig sind, um Gebäudekomplexe wie das ehemalige Hammerwerk Carl Vorländer GmbH pädagogisch wertvoll zu nutzen und die Bausubstanz auch die nächsten 50 Jahre nach neuen (Sicherheits-)Standards zu erhalten, sind leider nicht zu akquirieren. Statt sich einen solchen „Klotz“ ans Bein zu binden, sollten Engagement und spärlich vorhandene monetäre Mittel lieber dazu genutzt werden, bereits Vorhandenes zu unterstützen. Museen, Vereine, zahlreiche Ehrenamtler, die Universität Siegen, die Archive, die LWL-Archäologie für Westfalen etc. zeigen durch Forschungen, Ausstellungen, Publikationen, Exkursionen etc., dass die Region historisch und kulturell blühen kann und genügend Potential besitzt. Diese Breite an Interessen und Schwerpunkten gilt es zu fördern. Schon heute scheitern zahlreiche Projekte an ein paar Hundert Euro, sodass sich die Frage nach einem größeren Museum leider erübrigt.
Sehr nützlich – hierauf wird beim Aufbau des kooperativen Archivs des Städtischen Musikvereins zu Düsseldorf e. V. gegr. 1818 zurückzukommen bzw. zurückzugreifen sein.
Wenn man sich hier so einige Kommentare akademisch ausgebildeter Historiker durchliest, muß man wohl erkennen, daß im „Siegerland“ ( besser bald nur noch als Südsauerland bekannt) das erneut in die Diskussion gebrachte Montanindustriemuseum weniger ein „finanzieller Klotz“ , als vielmehr ein „geistiger Klotz am Bein“ darstellt.
Dies wird allein schon dadurch klar, wenn man bedenkt, daß der Vorsitzende des Fördervereins Siegerlandmuseum (Ulf Stötzel – lt. Pressemitteilung der Stadt Siegen vom 29.1.2016 ) allein über 60.000 Euro aus seiner offenbar gut gefüllten Vereinskasse für die Entwicklung eines tischgroßen 3D-Druckers der Uni-Siegen zur Verfügung stellt, damit man sich später an einem Modell der Bergstadt Siegen mit einigen „sinnigen Lämpchen und Videos“ ergötzen kann, dann weiß man, woran es hier wirklich mangelt.
Genauso unverständlich das Negieren des Verbandes Siegerländer Metallindustrieller e. V. (VDSM), der eigentlich doch ein großes Interesse an einem solchen Industriemuseum entwickeln müßte , aber offenbar befindet sich die Siegerländer Metallindustrie kurz vor dem Konkurs oder der Verabschiedung in die Billiglohnländer.
Dr. Plaum hat hier sicher einen guten Hinweis auf die bisher versäumte Einrichtung einer Förderstiftung für ein auch von ihm seit Jahrzehnten gewünschtes Siegerländer Industriemuseum gegeben. Allerdings taucht da aber wohl die Frage auf, warum hat er als namhaftes Mitglied diese Fördervereins den „großen Vorsitzenden“ nicht schon längst zur Gründung einer solchen Stiftung veranlassen können ?
Dieser „Förderverein“ scheint es also im Grunde auch gar nicht zu wollen und ist mit den diversen Exponaten im Oberen Schloß vollauf zufrieden.
Ich wäre z.B. bereit, trotz meiner bescheidenen Vermögensverhältnisse mind. 20.000,- € in eine solche Förderstiftung einzuzahlen, jedoch braucht es für Gründung und Weiterführung einer derartigen zweckgebundenen Stiftung einige Siegerländer Persönlichkeiten die den Vorteil eines solchen aktiven Montanindustrie-Museums für die Region voll erkannt haben und auch bereits sind sich persönlich für die Verwirklichung eines solchen Projektes wirklich intensiv einzusetzen. Aber wie bisher festgestellt , ist dergleichen nicht zu finden.
Fazit:
Die letzte Chance an historischer Stelle ein Siegerländer Industriemuseum zu etablieren, wird wie Jahrzehnte zuvor, sicher somit wieder einmal nicht genutzt werden. Die Gebäude des Allenbacher Hammerwerkes werden abgerissen, so wie das bereits mit allen anderen Siegerländer Industriekulturgütern zuvor geschehen ist und /oder einem „Hedge-Fonds“ zur Etablierung eines „Outlet-Centers“ oder dergl. überlassen. Die historische Wasserzuführung wird zwecks Straßenverbreiterung oder erforderlicher Parkplätze zugeschüttet . Warum also nicht dabei einige der umstehenden überalterten, kostenintensiven Fachwerkhäuser ( lt. Poggel -“Klotz am Bein“) gleichzeitig mit entsorgen ? Brauch doch niemand , also weg damit für die „Neue Zeit“. Industriekultur kann man sich doch auch woanders ansehen. Das ist dann zwar keine Siegerländer Kultur, aber was macht das schon ?
Sehr geehrter Herr Dick, in meinem Kommentar steht deutlich „Die Idee eines Siegerländer Industriemuseums ist in Anbetracht der einmaligen historischen Landschaft befürwortenswert, aber die Umsetzung organisatorisch und finanziell nicht praktikabel.“ Ihre Aussagen „Warum also nicht dabei einige der umstehenden überalterten, kostenintensiven Fachwerkhäuser (lt. Poggel –‚Klotz am Bein‘) gleichzeitig mit entsorgen ? Brauch doch niemand , also weg damit für die ‚Neue Zeit‘“ haben keinen Bezug zu meiner Argumentation. Ich befürworte ein Museum und den Erhalt historischer Substanz, schätze aber die finanziellen und organisatorischen Rahmenbedingungen, die ein „aktives Montanindustrie-Museum“ in den Gebäuden des Allenbacher Hammerwerkes mit sich bringt, realistisch ein. Egal ob mit Blick auf die Liegenschaft, das Personal oder die Dauer- und Sonderausstellungen – es gilt langfristig und konzeptionell zu planen. Da reichen zum einen ein paar hundert Tausend Euro schnell nicht aus, zum anderen mangelt es am engagierten Nachwuchs, wie z. B. der Altersdurchschnitt in Heimat-/Geschichtsvereinen etc. beweist. Hier gilt es auch anzusetzen.
Weitere Bilder aus der Weltkriegsausstellung findet man auf der Seite der Siegener Geschichtswerkstatt. Ebenfalls dort zu finden die Termine der öffentlichen Führungen durch die sehenswerte Ausstellung.
In Zeiten, in denen das Archivgut in für uns weit entfernten Archiven in verschiedenen Großstädten Westfalens gelagert wird, ist es für die interssierte Bevölkerung und die Vereine der Landgemeinden ein Desiderat, eigene Archivstrukturen vor Ort aufzubauen. Hier verwahren wir demnächst fachgerecht und professionell mehrere tausend Dokumente und Originale unser Dorf-, Kirchen- und Vereinsgeschichte, die wir nicht an Dritte weitergeben werden. Dazu war das Seminar in Siegen sehr hifreich. Archive – dezentralisiert euch!
Eine Ergänzung scheint hier angebracht: Per Archivgesetz NRW (§ 10) sind Kommunen verpflichtet ein Archiv zu unterhalten, so dass das öffentliche Archivgut i. d. R. im Verwaltungssitz auch der Landgemeinden benutzbar sein sollte. Die notwendige, ergänzende Überlieferung zur Dorf- und Vereinsgeschichte kann jedoch aufgrund mangelnder Ressourcen von kleinen Kommunalarchiven nur in den seltensten Fällen archivfachlich befriedigend wahrgenommen werden – so dass eine vertrauensvolle Kooperations zwischen Vereinsarchiven und Kommunalarchiven hier Abhilfe schaffen kann. Archive – arbeitet zusammen!
Ich möchte dem Nutzer „archivar“ zustimmen und Folgendes ergänzen. Wenn Landgemeinden nicht in der Lage sind, ihre Archive selbst zu betreiben, gibt es immer noch die Möglichkeit der kommunalen Zusammenarbeit. Solange sich Gemeinden aber hinreißen lassen, die Sorge um den schriftlichen Niederschlag ihrer Geschichte dem – wenn auch achtbaren – Wirken Privater und privatrechtlicher Organisationen zu überlassen, ist die Identifizierung mit der eigenen Heimat und Geschichte offenbar nicht recht entwickelt. Gerade kleinere Kommunen müssen aufpassen, dass sich ihre Vorstellungswelt hinsichtlich der eigenen historischen Identität nich in den Kategorien von Zimelienmuseen erschöpft. Die Führung eines ordentlichen Archivs ohne archivarisches Fachpersonal ist ohne erhebliche Risiken für eine sinnvolle Bestandsbildung und die Wahrung der wesentlichen Entstehungs- und Nutzungskontexte nicht möglich.
Hinzugefügt werden könnte noch: Die ehemalige Landgemeinde Elsoff ist seit 1975 ein Stadtteil von Bad Berleburg. Das dortige Stadtarchiv ist somit für die kommunalen Unterlagen zuständig und dürfte auch aus der Elsoffer Dorfperspektive kaum zu den „weit entfernten Archiven in verschiedenen Großstädten Westfalens“ gehören. Und auch für die Hinterlassenschaften der Dorfkirche wäre in Berleburg gesorgt (Archiv der Ev. Kirchengemeinde Wittgenstein). Wo liegt also das Problem für die „interessierte Bevölkerung“ dieses Stadtteils? Weit entfernte Archive kämen erst ins Spiel, wenn im Dorf staatliches Schriftgut auftauchen würde (z.B. im Nachlass eines zufällig in Elsoff wohnhaft gewesenen Amtsträgers, der einst dienstliche Akten mit nach Hause genommen hatte) – ein möglicher aber doch eher unwahrscheinlicher Fall.
Niemand wird behaupten wollen, dass das Provenienzprinzip für Archivbenutzer rundum beglückend wäre. Trotzdem kann Anarchie keine Alternative sein!
Ergänzend sei nach auf Folgendes hingewiesen:
„Als „Quantensprung für die Erforschung der heimischen Geschichte“ bezeichnet Kreiskulturreferent Wolfgang Suttner die Übergabe von 132 Mikrofilmen an das Stadtarchiv Bad Berleburg. Auf den Filmen befinden sich historische Dokumente aus dem Archiv des Altkreises Wittgenstein. Die Originale der Dokumente liegen im Landesarchiv in Münster. Die Übergabe ist das Ergebnis einer Kooperation von Land-, Kreis- und Stadtarchiv. Das Landesarchiv in Münster hat rund 340.000 Aufnahmen im Auftrag des Kreisarchivs angefertigt und so Duplikate von den geschichtsträchtigen Unterlagen erstellt, die Interessierte ab sofort im Stadtarchiv in Bad Berleburg einsehen können.
Die Mikrofilme übergaben (am Freitag, 19. Januar 2007) Dr. Johannes Burkhardt, Referent des Landesarchivs NRW, Abt. Staatsarchiv Münster, und Kreisarchivar Thomas Wolf bei einem Besuchstermin im Bad Berleburger Stadtarchiv an Bürgermeister Bernd Fuhrmann und Stadtarchivarin Rikarde Riedesel.
Der vollständige, durch ein Findbuch (Inhaltsverzeichnis über einen Archivbestand) erschlossene und über 1900 Akten umfassende Archivbestand des ehemaligen Kreises Wittgenstein steht damit Forschern nun wieder vor Ort zur Verfügung. Der Bestand umfasst die historische Überlieferung des Landratsamtes, des Kreisausschusses und des Versicherungsamtes des Altkreises Wittgenstein. Die Aufzeichnungen beginnen mit dem Jahr 1805 und reichen bis in das Jahr 1938. Die Unterlagen enthalten darüber hinaus viele Informationen, die Aufschluss über die damaligen Lebensverhältnisse in Wittgenstein geben. So enthalten die Mikrofilme beispielsweise Angaben zur Kirchen- und Schulgeschichte in den einzelnen Ortschaften.
Bernd Fuhrmann, Bürgermeister von Bad Berleburg, zeigt sich hoch zufrieden über das Gelingen dieser Kooperation. Trotz kommunaler Sparzwänge sei mit diesem Projekt der Service sowohl für die Berleburger Lokalforschung als auch der Wittgensteiner Regionalforscher entscheidend verbessert worden.
Zufrieden mit der gelungenen Kooperation sind auch die drei beteiligten Archive und können sich deshalb vorstellen, zukünftig auch bei weiteren Projekten zusammen zu arbeiten.
Dr. Johannes Burkhardt übergab im Rahmen des Besuchstermins zudem ein gebrauchtes Gerät, mit dem die Mikrofilme gelesen werden können. Das Staatsarchiv Münster stellt das Lesegerät dem Stadtarchiv kostenlos zur Verfügung.“
Quelle: Pressemitteilung des KReises Siegen-Wittgenstein, Januar 2007
Vielen Dank an archivar für die Eindrücke vom Tag der Eröffnung. Die Fotos vermitteln einen nachhaltigen Eindruck von der Ausstellung und zeigen, dass sich die Mühen der Ausstellungsmacher gelohnt haben. Allen Interessierten an der Geschichte Siegens und des Siegerlandes sei der Besuch des Museums wärmstens empfohlen, damit auch in Zukunft historische Ausstellungen vor Ort möglich sind.
Das Archivgesetz regelt klar die Zuständigkeit der Kommunalarchive. Das Stadtarchiv Bad Berleburg hat immer eine offene Tür für Fragen und Belange der Vereins- und Dorfüberlieferung. Die Kooperationen mit den Vereinen ist sehr positiv und Abgaben an das Stadtarchiv erfolgen gerade wegen der professionellen Unterbringung (Raumklima, Entsäuerung, Lagerung) und Bereitstellung für Interessierte Nutzer. Dazu kann ich nur einladen.
Die Archivlandschaft ist vielfältig, dies resultiert aus der Entstehung der Überlieferung, die eng mit den Verwaltungsgeschichte verbunden ist. Hier ist das Stadtarchiv gern behilflich, die verschiedenen Facetten kennen zu lernen. Kooperation war und wird hier bei allen groß geschrieben.
Rikarde Riedesel, Stadtarchiv Bad Berleburg
Der Peak am 4.5.2016: Offenbar hat der VHS-Lesekurs riesiges Interesse hervorgerufen. Das sollte Archiven zu denken geben, denn Nutzung ist auch an entsprechende Lesekenntnisse gebunden. Kooperationen scheinen hier derzeit der pragmatische Weg zu sein.
Dann schreibe ich demnächst nur noch über Lesekurse. ;-) Ich kann mir diesen erfolgreichen Tag nicht erklären – auch nicht mit dem Artikel über den Lesekurs. Jedenfalls gab es keine nennenswerten Spam-Aktivitäten an diesem Tag.
Unabhängig von der Statistik-Auslegung stimme ich der grundsätzlichen Einschätzung der Lesekurse zu. Kürzlich fand sich im ZVAB-Blog der dazu passende Eintrag „Buch in Fraktur, ein Mängelexemplar?“. Er wirft ja fast die Frage auf, ob man zukünftig auch Frakturschrift unterrichten sollte …..
Meine Erfahrung mit Schulklassen ist: Fraktur kennen und können Schülerinnen/Schüler heutzutage nur noch im Ausnahmefall. Die Frage ist m.E. keine. Sie ergibt sich aus dem Fortschreiten der Zeit und der Entwicklung neuer Druck- und Schreibschriften, Altes und damit Unbekanntes muss also zukünftig neu in den Kanon des Paläographieunterrichts.
„Der Klang von Archiven“ – mit Akten rascheln und Magazintüren zuschmeißen… Erinnert mich ein bisschen an Böhmermanns Geekchester, http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2650876/Geekchester—The-Hurts.
Es ein schmaler Grad zwischen witzigem Klischee-Bruch und … naja, die ersten Reaktion aus meinem nichtarchivischen Umfeld gingen in Richtung „das passt ja zu Archivaren wie die Faust aufs Auge“.
Danke, dass Sie Ihre Bedenken hier formulieren! Ich würde es sehr begrüßen, wenn Sie die Reaktionen aus Ihrem Umfeld nach dem Getwittere auch hier als Kommentar einstellen. Denn es ist m. E. ein Versuch wert, der auch scheitern darf.
Übrigens: Für den Fall, dass ein Archiv, eine Kollegin oder Kollege nicht soweit gehen will, bleiben ja immer noch die Klassiker: Verweise auf Bestände, Archivgut, Persönlichkeiten, Historische Begebenheiten, …..
Übermorgen wünsche ich jedenfalls Allen, die teilnehmen und/oder mitverfolgen viel Spaß(!).
Solche Klassiker reichen doch schon vollkommen aus (wer mehr möchte, gerne natürlich) – und sie werden z.B. auch beim ISG Frankfurt am 9.6. zum Tragen kommen…
siwiarchiv wird selbstverständlich auch nicht nur Geräusche posten ……
Aber Geräusch und auch Lärm rücken ja immer mehr in den Fokus von Kunst und Wissenschaft. Soundscaping und die historische Lärmforschung als „Spezialität“ der Umweltgeschichte sollen hier als Schlagworte reichen.
Ein weiterer Grund, warum man sich mit den Geräuschen der Archive auseinandersetzen kann, ist ein „Kundengruppe“ für die Archive, die wir gerne vergessen – nämlich diejenigen, deren Sehvermögen eingegrenzt ist. Wie wollen wir Ihnen sonst Archivisches vbermitteln?
Ich finde es sehr progressiv seitens Ihres Archivträgers, dass er Ihnen Rückendeckung für Ihr Engagement in den Bereichen „Lärmforschung“ und „Blinde ins Archiv“ gewährt. Vielleicht berichten Sie an dieser Stelle über Ihre Erfahrungen aus dem heutigen Tag der Archive? Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
So progressiv ist dies gar nicht. Mit Heiner Stahl lehrt gerade ein Vertreter der historischen Lärmforschung gerade an der Universität Siegen, so dass es bereits zwanglose Gespräche über ein gemeinsames Projekt gegeben hat, die das Interesse des Archivs geweckt haben – vor allem haben sie die Frage hervorgerufen, welche Audioquellen hätten wir denn (Antwort: i. d.R. keine).
Vor dem Hintergrund des „Jedermann-Rechts“ im NRW-Archivgesetz erscheint es mir auch nicht eben progressiv, sich Gedanken darüber zu machen, welche Nutzergruppen denn bei zunehmender Erleichterung des Archivzugangs auf Archive zukommen könnten. Seheingeschränkte sind da nur ein Gruppe (s. bspw. auch die Diskussion über „Leichte Sprache“ auf Archivalia)
Bäcker, Otto
Geburtsdatum: 27.11.1887, Geburtsort: Siegen
Sterbedatum: 03.1945
Sterbeort: Konzentrationslager Dachau / Überlingen
Partei vor 1933: SPD
Funktionen vor 1933: Gewerkschaftsfunktionär Deutscher Eisenbahnerverband Siegen ab 1920; Geschäftsführer Deutscher Eisenbahnerverband / Einheitsverband der Eisenbahner Deutschlands Siegen 1923-1933; Stadtverordneter Siegen 1929-1933
Konzentrationslager: Buchenwald 1944; Dachau / Überlingen 1945
Quelle:
Verein Arbeiterpresse (Hrsg.): Handbuch des Vereins Arbeiterpresse, Berlin 1927, S. 552
Enderle, August: Die Einheitsgewerkschaften, Bd. 1, Düsseldorf 1959, S. 155
DGB-Archiv im Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung: Ehrentafel für während des Dritten Reichs ermordete Gewerkschaftsmitglieder, o.O. o. J., S. 6 (Archivalie)
DGB-Archiv im Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung: Erschlagen, hingerichtet, in den Tod getrieben, Bonn 1995, S. 39
Röll, Wolfgang: Sozialdemokraten im Konzentrationslager Buchenwald 1937-1945, Göttingen 2000, S. 270.
In der geschlossenen Facebook-Gruppe „Stadt Siegen in alten und neuen Bildern“ findet sich der Hinweis, daß dieses Kunstwerk von Hermann Manskopf und Six Stiner entworfen und angefertigt wurde.
Gestatten Sie, verehrter Kollege, einige höfliche Nachfragen:
Wann wird es analog zu https://archivalia.hypotheses.org/57107 historische Literatur zur Geschichte von Stadt, Land und Kreis Siegen online geben, kostenlos und nachnutzbar?
Wann werden Fotos aus dem Kreisarchiv Siegen bzw. anderen Archiven des Landkreises unter CC-BY(-SA) nachnutzbar zur Verfügung stehen?
Wann werden historische Bilder unter CC0 zur Verfügung stehen?
Wann wird Siwiarchiv unter freier Lizenz nachnutzbar sein?
Vielen Dank für den Hinweis auf das Olper Projekt und für die daraus resultierenden Nachfragen!
1) Der Kreis hat keine eigene Publikationsreihe, so können wir nichts online stellen. Die älteren Publikationen, die in Frage kämen, „Siegerland“ und „Wittgenstein“, werden von heimatgeschichtlichen Vereinen in eigener Regie herausgegeben. Es entzieht sich meiner Kenntnis, ob dort entsprechende Planungen bestehen.
2) Über ein solches Projekt haben wir noch nicht gesprochen. Ihre Anregung greife aber gerne auf und wir werden dies im Herbst auf unserer Arbeitskreissitzung besprechen.
3) s. 2)
4) Es ist der Bequemlichkeit des inhaltlichen Admin geschuldet, dass eine differenzierts CC-Lizenzen-Vergabe für die Einträge bis jetzt nicht bzw. nur sehr selten erfolgt ist. Bei redaktionell eigenen Einträgen wird zunftig darauf geachtet – hoffentlich.
Besten Dank für die Antworten. Gestatten Sie bitte 2 Nachfragen:
Ist analog zu https://de.wikisource.org/wiki/Schw%C3%A4bisch_Gm%C3%BCnd vorgesehen, gemeinfreie Werke (die darf jeder digitalisieren) zu Siegen und dem Siegerland nachzuweisen und, falls noch nicht geschehen, ins Netz zu stellen?
Wird sich Siwiarchiv dereinst auch am #gemeinfreitag beteiligen?
Gerne doch.
1) Ich beobachte Wikisource ja mit größtem Wohlwollen. Leider fehlen mir dazu die Ressourcen, aber ich hätte da eine Idee ……
2) Dereinst sicherlich.
Was Wikisource angeht, so dürfte die Zahl der gemeinfreien Bücher und Schriften so überschaubar sein, dass die Archivierenden des Kreises in Verbindung mit der Schwarmintelligenz der in Wikisource Wirkenden ein solches Projekt meines Erachtens leicht stemmen könnten.
Hinzuweisen wäre für die westfälische Perspektive auch auf meine Publikation: https://www.lwl.org/LWL/Kultur/HistorischeKommission/publikationen/2005/displaced-persons sowie für das benachbarte Rheinland http://www.brauweiler-kreis.de/geschichte-im-westen/geschichte-im-westen-2003-2/
Darin enthaltene Statistiken sind in der Regel für Westfalen bzw. NRW gemacht und beinhalten damit auch Siegener Zahlen (auch wenn sie in den Veröffentlichungen wegen des abweichenden regionalen Zuschnitts ungenannt bleiben); somit können mit beiden Publikationen auch die Signaturen des Quellenmaterials (in der Regel aus dem UN-Archiv New York, NARA Washington D.C. und National Archives (früher: Public Record Office) Kew/London gefunden werden.
Sofern DP-Lager in Siegen länger als bis 1946 bestanden, lohnt auch eine Recherche im Landesarchiv NRW, Abt. Rheinland (vor allem Bestand NW 0067: http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/bestand.jsp?archivNr=185&tektId=5803&expandId=5790).
Falls es im Siegerland auch Beispiele gab, wo Deutsche ihre Privathäuser räumen mussten, ist auch noch folgender Aufsatz interessant: Stefan Schröder, DP-Lager in requirierten deutschen Straßenzügen, Vierteln und Ortschaften. Ein Beitrag zur Systematisierung dieser Sonderform der Unterbringung von Displaced Persons, in: Sabine Mecking/Stefan Schröder (Hrsg.), Kontrapunkt. Vergangenheitsdiskurse und Gegenwartsverständnis, Festschrift für Wolfgang Jacobmeyer zum 65. Geburtstag, Essen 2005, S. 113-126.
An dieser Stelle sei eine kurze Notiz wiedergegeben, die Johann Jakob Hahnenstein (1774-1854) 1844 rückblickend in das Kalendarium des Oranien-Nassauischen Adreß-Calenders auf das Jahr 1803 schrieb:
„1816 hatten wir ein sehr großes naß jahr was man seit 1740 nicht erlebt haben will. 1740 soll es dem Sagen nach nur Mangel an Fuder des Viehes gefehlt haben. 1816 fehlte es aber an Menschen nahrungs mittel 4 Pfund Brod wurde zu 40 xer oder 20 Albus bezahlt, und war manchmal keines zu haben. Das Nähere des großen Mangel ist in meiner geschriebenen Cronik alles von Tage zu Tage aufgeschrieben und zu lesen
Emmerichenhain 1844
Jacob Hahnenstein“
Leider ist mir nichts über die erwähnte Chronik bekannt.
Kein Eintrag für J. J. Hahnenstein im „Deutschen Biographischen Index“, keine Erwähnung in der „Nassauischen Biographie“ (2. erw. Aufl.). Dank des online verfügbaren Inhaltsverzeichnisses lassen sich 3-4 Seiten Informationen über ihn ermitteln in:
Peter J. Lau, Meine Ahnen der Familien Lau und Caesar, Frankfurt a. M. 2012, darin S. 43 – 45 oder 46: Johannes Jakob Hahnenstein (1774-1854). Das Buch ist in einigen Bibliotheken nachgewiesen, Kopien per Fernleihe also leicht bestellbar.
Das HHStA Wiesbaden hat zwei Handschriften von Hahnenstein (Bestand 1098, Nr. 394 und 395): Hausbuch des J. J. H. (um 1800, also zu früh) und das zeitlich in Frage kommende Mess- und Gewannbuch von Emmerichenhain („Abschrift von J. J. H.“). Letzteres „enthält auch: Einträge über Landwirtschaft …“. Ob diese mit der gewissen Chronik gemeint sind, läßt sich natürlich aus der Ferne nicht sagen.
Vielleicht ist eine Recherche im Bestand I. HA Rep. 89 (Geheimes Zivilkabinett) des Geheimen Staatsarchiv preußischer Kulturbesitz in Berlin erfolgreich dort finden sich unter den Nr. 16593 – 16595 „Zeitungsberichte“ der Regierung in Arnsberg von 1816 bis 1819 sowie unter den Nr 16241 bis16245 „Zeitungsberichte“ der Koblenzer Regierung.
Hier noch eine vielleicht nicht unwichtige Ergänzung! Bei der Durchsicht des „Heimat-Jahrbuchs des Kreises Altenkirchen (Westerwald) und der angrenzenden Gemeinden 2016“ fiel mir der Beitrag von Anka Seelbach: „1816 – Das Jahr ohne Sommer“ ins Auge (S. 90-92). Auf den beiden Druckseiten zwar nicht viel Text, aber dafür weitere Literaturangaben (vorwiegend Bezug nehmend auf ältere Aufsätze im genannten Heimat-Jahrbuch). Leider kein Verweis auf Primärquellen in den Archiven, aber immerhin eine weitere Fundstelle in der Literatur, um bei diesem Thema die regionale „Wahrnehmungsebene“ oder „Überlieferungskultur“ zu berücksichtigen.
Auszug aus der Niederschrift der Kulturausschusssitzung vom 20.6.16:
“ …. Archäologische Ausgrabungsstätte Gerhardseifen in Siegen-Niederschelden
Beratungsverlauf:
Arno Wied definiert die Ausgrabungsstätte Gerhardseifen als ein Bodendenkmal von europaweiter Bedeutung. Er verweist auf das ausliegende Gutachten Der Weg des Eisens aus dem Jahr 2013 sowie auf den Sachstandsbericht im Kreistag (Vorlage 268/2013) und erklärt, es zeichneten sich
inzwischen Umsetzungsentwicklungen ab. So solle die Fundstelle erneut geöffnet und konserviert und vor Ort ein Dokumentationszentrum eingerichtet werden. Die Kosten dafür beliefen sich auf zirka 220.000,- € und sollen aus Mitteln der NRW-Stiftung, einem Denkmalschutzsonderprogramm des Bundes sowie im Wege des Sponsorings durch heimische Unternehmen – hier sei die IHK eingebunden – aufgebracht werden. Zu dann eventuell noch offenen finanziellen Fragen würden Stadt Siegen und Kreis Siegen-Wittgenstein Lösungen erarbeiten, sollte dies erforderlich sein. Darüber hinaus sei die Ausweisung eines archäologischen Wanderwegs vorgesehen, der verschiedene historische Ausgrabungsstätten in der Region miteinander verbinde. So solle die Ausgrabungsstätte Gerhardseifen, die 2012 in die Denkmalschutzliste der Stadt Siegen aufgenommen wurde, wissenschaftlich und touristisch erschlossen werden. In diesem Zusammenhang dankt Arno Wied den örtlichen Heimatvereinen und Waldgenossenschaften, ohne deren großes Engagement das Bisherige nicht hätte erreicht werden können und
auch die geschilderten Planungen nicht umsetzbar seien.
Bernd Brandemann bezeichnet das Bodendenkmal Gerhardseifen als ein Ausgrabungsprojekt der Superlative, da hier die Eisenerzeugung aus drei verschiedenen Epochen an ein und demselben Ort erlebbar werde. Vor diesem Hintergrund sei der Antrag auf Fördermittel der NRW-Stiftung
offensiv zu formulieren, denn dort „wartet man geradezu auf Anträge aus Westfalen“.
Otto Marburger weist auf die Nekropole in Birkefehl hin. Unter der Überschrift Der Weg des Eisens und im Kontext des bevorstehenden 200-jährigen Jubiläums der Kreise Siegen und Wittgenstein könne auch diese Stätte aus der Keltenzeit in die Planungen einbezogen werden.
Winfried Schwarz erklärt, mit Blick auf einen möglichen Finanzierungsbeitrages des Kreises erwarte der Kulturausschuss zu gegebener Zeit eine ergänzende Beschlussvorlage.“
Quelle: Kreistagsinformationssystem, Link: https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz110/sdnetrim/Lh0LgvGcu9To9Sm0Nl.Ha.GWq8Tq8Sj1Kg1HauCWqBZo5Ok9LkyIduGWt9Vs4Qp0Oe.Oa1CXuCWn4Oi0Lg-IbvDauHTp8To1Ok0HbwHau8Vt6Pi6Km0GbyGar8Um5Pm4KezJezIWtFUn5Qn4OfyGauDWu8WGJ/Oeffentliche_Protokollunterlagen_Kulturausschuss_20.06.2016.pdf
Es handelt sich um das Gebäude Erzweg 3 in Burbach:
Lösungsweg:
1. Das Fenster ist auffallend schlicht. Die Funktion steht im Vordergrund.
2. Es ist Teil einer Steinmauer.
3. Es hat keine Fensterläden (damit auch kein Heimatschtuzstil)
4.Daher handelt es sich um den Bauhausstil.
5. Gebäude im Bauhausstil sind im Siegerland sehr selten.
6. Mir sind eigentlich nur zwei Gebäude bekannt.
7. Ein Fotovergleich auf google brachte den Beweis.
Mit freundlichen Grüßen aus der
Fachwerkstadt Freudenberg
Detlef Köppen
Korrekt! Es ist allerdings nicht verwunderlich, dass Sie dieses Rätsel lösen konnten ;-).
Zwei Fragen hätte ich allerdings noch:
1) Wie sind Sie auf das Weimarer Vorbild gestoßen, und
2) Welches Bauhaus-Gebäude sind Ihnen denn noch bekannt?
Weitere Informationen zu beiden Gebäuden findet man in diesem siwiarchiv-Eintrag.
Das Bild zeigt den Zustand des Gebäudes im Juni 2016:
Bauhausstil-Gebäude stehen in Weimar oder Dessau.
Bei der Eingabe Bauhaus und Weimar wurden neben einigen Großgebäuden auch das Haus Horn aufgezeigt. Der gemittelte Dachaufbau lässt das Vorbild erkennen.
Detlef Köppen
Am Samstag, 9. Juli 2016, erschien in der Beilage „Heimatland“ der Siegener Zeitung der Artikel „Leben zwischen den Systemen. Adolf Wurmbach wurde vor 125 Jahren geboren“ von Traute Fries, die auch auf die hier geführte Diskussion eingeht. Darin kann Fries der hier von Opfermann geäußerten Einschätzung Wurmbachs nicht folgen.
Interessant ist die quantitaive Auswertung der Publikationstätigkeit zwischen 1935 und Frühjahr 1945:
„Siegener Zeitung“ bis zum 1. April 1943: 500 Gedichte, Sprüche, Kurzgeschichten
„National-Zeitung“ incl Beilage „Volkstum und Heimat“ bis Frühjahr 1945: 160 Beiträge (52 Beiträge unter dem Titel „Us dr Dorfküüeze“
„Siegerland“ 1935 – 1942: 40 Beiträge
„Siegerländer Heimatkalender“ bis 1943/44: 42 Beiträge.
Ferner verweist Fries auf die besondere Beziehung Wurmbach zum Haus Vorländer/Rothmaler: “ …. 1942 widmete Wurmbach aus Dankbarkeit und Verehrungseine mehr als 80 Gedichte umfassende Sammlung „Bergwerk muss glühen“ Johannes Rothmaler, der ein montanwissenschaftliches Studium absolvierte und vor seiner Tätigkeit im Verlagswesen im Bergbau beschäftigt war. ….“
Schließlich streift Fries den Verbleib der Bibliothek von Adolf Wurmbach: “ …. Große Sorgen bereitete Wurmbach der Gedanke hinsichtlich des Umgangs mit seinem Nachlass, so ist dem Brief an seinem jüdischen Freund Hugo Herrmann zu entnehmen, den er drei Tage vor seinem Tod diktierte. Seine private Bilbiothek wollte er der Öffentlichkeit zugänglich machen. Sie umfasste etwa 3.500 Bücher und ging in 70 Kartons verpackt an die Universität Siegen. Der Bereich Germanistik hatte keinerlei Interesse am Siegerländer Schriftsteller und hat ihn aus der Sicht der Verfasserin verkannt. Nach jahrelangem Hin und Her landeten die Bücher bei der Stadt Siegen, die 1977 im Torhaus des Siegerlandmuseums die „Wurmbach-Bibliothek“ eröffnete. Aus Sicherheitsgründen wurde der Nachlass bereits vor Jahren in den Wellersbergbunker ausgelagert.“
Vielen Dank für den Hinweis zur Datierung! Wir waren von einer Entstehung in den 50er Jahren ausgegangen u. a. wg der Verwaltungsgliederung im heutigen Siegener Norden. Die noch nicht von den Talsperren betroffenen Orte z. B. Nauholz bei Netphen etc. dienten als erste zeitliche Orientierung.
Ich würde die Karte ebenfalls in die 50er Jahre datieren. Grund: Im Bereich Littfeld / Burgholdinghausen ist eine Kleinsiedlung eingezeichnet. Sie ist erst 1952/53 entstanden. Ich vermute, dass die Grenzänderungen in Büschergrund schlichtweg vergessen wurden zu übernehmen.
s. a. Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin:
Ober-Examinationskommission bzw.Prüfungskommission für höhere Verwaltungsbeamte, I. HA Rep. 125 Nr. 4178 (Einzelne Prüfungen, R, Rumohr, von, Regierungsreferendar, Osnabrück ), 1929
Der eingezeichnete Bahnabschnitt Heinsberg (OE) – Röspe + Bahnhof (SiWi) wurde 1945 endgültig stillgelegt. Also Karte vor 1945 entstanden oder – mit Blick auf die anderen Kommentare – später mit veralteten Informationen erstellt.
Weitere Karten aus dem Sieger- und Sauerland befinden sich digitalisiert in den Beständen der Harold B. Lee Library der Brigham Young University (USA): „German Maps (Topographische Karte 1:25,000): A set of topographic maps of pre-World War II Germany, originally printed by the German government, and confiscated by the British and U. S. military after the war. Most of these maps are reprints by the British Geographical Section, General Staff, or the U. S. Army Map Service.” https://lib.byu.edu/collections/
In der Stadtmauer unterhalb der Martinikirche war früher ein
Podest eingelassen auf der eine Figur stand.
Frage: 1. wen stellte diese Figur dar ?
2. warum hat man die Figur entfernt ?
3. wo ist die Figur geblieben ?
Ich habe mal an einer Führung teilgenommen bei der die Renovierung
und Baumaßnahmen in der Innenstadt erläutert wurden. Der Bauleiter
der die Führung machte konnte mir diese Fragen nicht beantworten.
Im Voraus herzlichen Dank für eine Antwort.
bei der genannten Figur wird es sich um die 1957 vom Siegener Bildhauer Hermann Kuhmichel geschaffene Plastik „Die Ausschauende“ gehandelt haben. Das Kunstwerk sollte an das Schicksal der Kriegsgefangenen erinnern, aber auch als Symbol der Hoffnung auf eine Heimkehr und auf Weltfrieden verstanden werden. Am 16. Dezember 1953, also zur 13. Wiederkehr der Zerstörung Siegens am 16. Dezember 1944, wurde „Die Ausschauende“ zunächst im Rathaus aufgestellt, um hiernach Ende März 1959 an den Aufgang zur Martinikirche platziert zu werden. Im Dezember 1959 gelangte die Plastik dann an ihren heutigen Platz – an die Gedenkstätte für die Opfer von Krieg und Gewalt beim Dicken Turm des Unteren Schlosses.
Den Zahlenverdreher in der Datumsangabe bitte ich zu entschuldigen. Die „Ausschauende“ wurde natürlich 16. Dezember 1957 aufgestellt (nicht 1953).
Gruß, CB
Nicht „F. W.“, sondern „F. M.“! Auflösung der Initialen laut KALLIOPE: Franz Maria (demnach eindeutig katholisch). Dort Nachweis zweier Briefe Simmersbachs von 1869 aus Dortmund an Justus von Liebig im Bestand der Bayerischen Staatsbibliothek.
Lebensdaten nach dem Deutschen Biographischen Index: 1841-1910.
Vielleicht ein Hinweis auf die Herkunft: „Das Bergwerksfeld Ernestus [Lennestadt] wurde durch das Bergamt Siegen im Oktober 1854 auf Eisenerz und Schwefelkies an Jacob Simmersbach aus Altenhundem verliehen.“ (Wikipedia bei „Ernestus“).
Einem genealogischen Forumbeitrag zufolge (https://groups.google.com/forum/#!topic/alt.talk.royalty/RWTANPfs1aQ) war F. M. Simmersbach (Sohn Jacobs) ein Urenkel der Schwester Goethes.
Mal sehen, ob sich noch mehr ergibt.
Auch in der Archivdatenbank des Landesarchivs Sachsen-Anhalt findet sich ein Hinweis auf ein Personalakte, genauer Elevenakte Simmersbachs, des Oberbergamtes Halle,: http://recherche.lha.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=1498898 . Leider „fehlt“ dieser Aktenband.
1) In Toni Pierenkempers „Die westfälischen Schwerindustriellen 1852-1913: Soziale Struktur und unternehmerischer Erfolg“ (Göttingen 1979, S. 237) findet sich ein Franz Simmersbach (1841 – 1910) als Direktor der Zeche Centrum in Wattenscheid.
2) Die bereits erwähnte Personalakte in Münster wurde von 1858 bis 1863 geführt. Sie weist als Geburtsdatum den 11.12.1841 aus. Simmersbach wird als Bergexpektant bezeichnet. Der Aktenband enthält:
„Zulassung als Bergwerksbeflissener; Lebenslauf; Zeugnisse; Beschäftigungsnachweise;
Tentamen; Ausbildung des Expektanten; Tätigkeit als Fahrbursche im Arnsberger Revier
(Bergamt Siegen); Gesuch um Entlassung aus dem Staatsdienst.“
Peter Kunzmann weist auf folgenden Nachruf Simmersbachs in der Zeitschrift „Stahl und Eisen“ 30. Jg. (1910) Nr. 5, S. 224 hin: „Stahl und Eisen“, S. 224 (PDF)
Nachtrag:
Abitur in Siegen 1858. Im Jahr zuvor hatte Louis Ernst (siehe http://www.siwiarchiv.de/?p=12559) die Realschule absolviert. Ein Klassenkamerad von Franz Simmersbach war der spätere Unternehmer und Reichstagsabgeordnete Hermann Müllensiefen, de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Müllensiefen. (Quelle: Hans Kruse, Geschichte des höheren Schulwesens in Siegen, Siegen 1936, Schülerliste S. 66*)
2 Ergänzungen:
1) Fritz Heinrich war Mitglied der Bundesversammlung 1954.
Quelle::
Martin Schumacher: M.d.B. – Die Volksvertretung 1946–1972, http://www.kgparl.de/online-volksvertretung/online-mdb.html (22.8.2016)
2) Fritz Heinrich besuchte die Volksschule in Feudingen von 1927 bis 1931 und wechselte dann nach Laasphe, wo er die Volksschule von 1931 bis 1935 besuchte.
Quelle: Amtliches Handbuch des Deutschen Bundestages, Darmstadt 1954, Band 1, S. 241
Das Stadtarchiv Bad Laasphe beantwortete die Fragen nach dem Vorhandensein einer Personalakte sowie den Funktionen Heinrichs im Laaspher Rat wie folgt: “ …. es gibt … eine …. Personalakte von Herrn Fritz Heinrich, der mit Wirkung vom 01. April 1946 als Bürogehilfe bei der Stadt- und Amtsverwaltung Laasphe eingestellt worden war. Dieses Beschäftigungsverhältnis hat er zum 31. Mai 1948 gekündigt.
Seit dem 17. Oktober 1948 bis zu seinem Tod war er Ratsmitglied. Außerdem war er in der Zeit vom 21. Dezember 1951 bis zum 28. Oktober 1954 stellvertretender Bürgermeister und seit dem 28. November 1958 bis zu seinem Tod Bürgermeister der Stadt Laasphe. In der Wahlzeit 1948/1952 gehörte er folgenden Ausschüssen an: Wohlfahrtsausschuss (ab 04.11.1948), Verwaltungs- und Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss sowie Wohnungsausschuss (ab 08.03.1949). In der Wahlzeit 1952/1956 war Mitglied des Hauptausschusses (ab 18.11.1952) und des Verbandsausschusses des Gesamtschulverbandes (ab 19.02.1953). Seit dem 19. November 1956 bis zu seinem Tod war er auch Vorsitzender des Hauptausschusses. ….“
Das Geburtsjahr von Dr. Dr. Karl Neuhaus war nach den vorliegenden Dokumenten eindeutig : 22.07.1910 !!
Siehe hierzu
– Urteil der großen Strafkammer des Landgerichts Siegen vom 15.12.1953
– Vernehmung von Neuhaus durch die Staatsanwaltschaft beim
Kammergericht Bonn am 11.08.1972
– Lebenslauf als Anhang zur Dissertation von Karl Neuhaus
(Tag der mündlichen Prüfung 22.07.1940 )
Vielen Dank für die Berichtigung! In der Einleitung des Eintrages wurde bemerkt, dass es sich um den damals aktuellen regionalen Forschungsstand handelte. Ich verweise auf folgenden weiteren Eintrag auf siwiarchiv, der bereits das richtige Geburtsdatum enthält: http://www.siwiarchiv.de/?p=7450 . Beide Einträge hatten und haben zum Ziel, dass man sich intensiver mit der Biographie des Neuhaus beschäftigt.
Bei meinen Recherchen über Dr. Karl Neuhaus, den ich damals als Lehrer
sehr geschätzt habe, bin ich auch auf ein Foto gestoßen, das ich Ihnen gern zur verfügung stellen kann.
Ließe sich die Aussage auch so formulieren: „Große Teile des Nachlasses befinden sich in Privatbesitz und stehen – mit Ausnahme der im Archiv deponierten Kriegserinnerungen – der Öffentlichkeit nicht zur Einsichtnahme zur Verfügung“? Das wäre, sofern die großen Nachlassteile das öffentliche Wirken des Kommunalpolitikers, Parlamentariers und Schuldirektors Ernst betreffen sollten, diskussionswürdig. Aber eine solche Diskussion will ich hier natürlich nicht anstoßen.
Nein, verehrter Kollege Kunzmann, die Aussage lässt sich nicht so formulieren, denn – mea culpa – der Teufel liegt im Detail, es hätte heißen müssen „Große Teile des Familiennachlasses […]“. Dieser besteht im Wesentlichen aus Aufzeichnungen des Sohnes und des Enkels von Louis Ernst, von letzterem ist lediglich ein weiteres Original enthalten.
Selten ist ein leeres Rednerpult besser abgebildet worden! Am 16.02.2017 wird es auf Fälle besetzt sein, das hat der Referent zugesichert. Also Termin bitte notieren.
Gibt es überhaupt Quellen, in denen die Schusterschlacht in Netphen erwähnt wird? Der o. a. erste Oktobersonntag 1584 fiel auf den 7. Oktober. 1584 galt ja schon der Gregorianische Kalender, oder?
Die Entwendung der Infotafel ist sehr Schade.
Die Gleichsetzung von einer „physisch gestörten Person“
mit einem „Arschloch“ wie auf dem gelben Schild auf dem Foto
GEHT ABER GAR NICHT!
Schade das darunter auch noch die Adresse von Siwiarchiv
angegeben ist.
Ich hoffe, der Schild wird umgehend entfernt!
Der Unterschied zwischen physisch und psychisch sollte doch wohl bei Ihrem Bildungsgrad bekannt sein. Waren Sie hier mal wieder zu schnell beim Schreiben ?
Der Begriff psychisch gestörte Person ist , wenn Sie genau beim Aufkleber hinsehen, wohlweislich in Anführungszeichen gesetzt .
Wie belieben Sie als akademisch gebildete Person diese „gestörten Zeitgenossen“ denn anders zu bezeichnen ?
Wenn zu diesem im Grunde verabscheuungswürdigen Vorfall nur ein solcher Kommentar abgegeben wird, dann wird mir als der offenbar eigentliche „Straftäter“ ( Tatbestand : „Anstiftung zu Diebstahl und Vandalismus“ sowie angeblicher Verunglimpfung „psychisch gestörter Personen“) bewußt was für mich in Zukunft zu tun bleibt.
Die Verwechslung von psychisch und physisch hätte mir wirklich
nicht passieren dürfen, da gebe ich ihnen Recht.
Dies aber nicht aufgrund meines nicht akademischen Bildungsstandes
sondern aus meiner langjährigen Arbeit mit psychisch erkrankten
Menschen und von diesen ist ganz sicher niemand ein A….loch
und auch keiner würde das Plakat entfernen oder zerstören.
Ich verurteile diesen Diebstahl genau wie sie, wehre mich aber
gegen die erwähnte Gleichsetzung und die damit verbundene
Verunglimpfung psychisch erkrankter Menschen.
Sie haben offenbar übersehen, daß die Bezeichnung „psychisch gestörte Person“ sich ausschießlich auf den Täter bezieht und keine allgemeine Gleichstellung psychisch erkrankter Personen mit der Bezeichnung A-Löcher darstellt !
Dieser verstörte Täter ist aber sowohl das eine wie das andere, je nachdem wie „gewählt“ man sich da ausdrücken möchte. ! Ich hoffe doch, daß Sie das so akzeptieren .
Übrigens habe ich bei meinem verständlichen Ärger auch einen Grammatikfehler auf dem Aufkleber platziert. Es muß nicht „psysisch“ , sondern richtigerweise „psychisch“ heißen. Bitte das zu entschuldigen, aber ich bewege mich recht selten in diesem Umfeld.
1) Vielen Dank für die Diskussion!
2) siwiarchiv hat als archivisches Weblog auch die Aufgabe, den Umgang mit im weitesten Sinne erinnungspolitischen Aktivitäten im Kreisgebiet zu dokumentieren. Eine inhaltliche Zustimmung zum Gezeigten ist daraus nicht abzuleiten.
„Die Stadt Siegen beschafft für Verwaltung, Schulen sowie Hausdruckerei ausschließlich Papier mit dem Blauen Engel. Dafür erhielt sie heute im Bundesumweltministerium die Auszeichnung „Recyclingpapierfreundlichste Stadt 2016.
Hallo liebe Archivare, vielen Dank für die schönen Bilder. Da kamen manche Kindheitserinnerungen auf. Leider musste ich feststellen, dass die Bilder Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 18, 24, 27 mit Sicherheit seitenverkehrt sind. Die Bilder Nr 7, 15, 20 sind möglicherweise seitenverkehrt. Alle anderen sind richtig rum :-) Wäre schön, wenn die Fehler korrigiert würden. Vielen Dank für ihre Mühe.
Nach erfolgter Korrektur können sie meinen Kommentar gerne löschen :-)
Vielen Dank für die Korrekturen! Leider kann ich die Bilder nicht mehr entsprechend bearbeiten, so dass Ihr Kommentar stehen bleiben muss. Ein Kopieren via copy and paste ist ja möglich und jede Bildbearbeitung erlaubt dann die Korrektur.
Hallo, vielen Dank für ihre schnelle Antwort. Dass jeder, der die Bilder herunter lädt, sie leicht korrigieren kann, ist schon klar. Es wäre nur schade, dass wenn jemand, der ein seitenverkehrtes Bild online sieht zwar etwas vertrautes sieht, aber gleichzeitig vewirrt ist, weil da etwas nicht stimmt. Dass mein erster Kommentar mit dem Hinweis auf die Fehler stehen bleibt, ist ansich nicht schlimm, aber es hätte nach erfolgter Korrektur keine Gültigkeit mehr :-) MfG
1) s. a. den Eintrag „Steinhauer über den Entwurf zum Bundesarchivgesetz“ in Archivalia, 14.10.2016, Link: http://archivalia.hypotheses.org/59989
2) “ …. Ralf Jacob, Vorsitzender des Verbandes deutscher Archivarinnen und Archivare, sieht durch den geplanten neuen Paragraphen „einen bedenklichen Eingriff in die Möglichkeit der demokratischen Kontrolle der Nachrichtendienste.“
Jacob: „Hier werden weitere Hemmnisse für die Bürger, Wissenschaft und Presse aufgebaut und das Wirken der Nachrichtendienste der demokratischen Kontrolle teilweise entzogen.“ …..“, Quelle: Bild.de, 14.10.16, Link: http://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/frecher-geheimdienst-gesetz-entwurf-48265034.bild.html
Schon mal vormerken: Am 19. Januar 2017 gibt es im Rahmen des Siegener Forums vom Autor Jakob Saß einen Vortrag zum Thema: „Vom Bäcker zum KZ-Kommandanten: Die „erstaunliche“ SS-Karriere des Hachenburgers Adolf Haas“.
Ort: Stadtarchiv Siegen, Markt 25, 57072 Siegen
Beginn: 18.30 Uhr
Ausder Erfahrung wissenschaftlich wie auch genealogisch arbeitender Forscher ist die Verwirklichung der angestebten Änderungen, weil längst überfällig, nur zu begrüßen. Derartige Änderungen sind aber auch für die Archivgesetze der Länder unerlässlich und müssen bis in die Archive der Kreise und Kommunen durchschlagen. Ein (schlechtes) Beispiel: Die im Archiv der Hansestadt Lübeck befindlichen Standesamtsregister sind nicht einsehbar! Auch nicht die Register. Für Anfragen ist ein Formular auszufüllen. Archivmitarbeiter suchen und erstellen gegen viertelstündig berechnete Gebühr dann Kopien. Benutzerfreundlichkeit???
Das Interesse und die Bemühungen für die regionale Geschichte sind sehr löblich, der methodische Ansatz aber leider unbefriedigend. Neben der anmutenden Beliebigkeit der ausgesuchten Bauwerke und deren Überbleibsel wurde das Problem der fehlenden Gleichzeitigkeit ja schon selbst genannt. Verschiedene Epochen und Kulturen in einen Topf werfen und schauen, was dabei herauskommt, hat den Beigeschmack von Kaffeesatzleserei.
Was des Weiteren nicht beachtet wird: Geometrisch betrachtet stellt die Erde ein Rotationsellipsoid dar. Jegliche durch künstliche Verebnung entstandene Karte ist ein Kompromiss zwischen Winkeltreue, Längentreue und Flächentreue. Selbst die abschnittsweise Verebnung durch Meridianstreifen bleibt fehlerbehaftet. Wenn Winkelspielereien betrieben werden, müssten diese am ehesten auf absolut winkeltreuen Seekarten erfolgen. Nur da wird’s mit den beliebten Wallburgen schwierig…
Als Autor der Homepage nehme ich gerne zu den drei Kritikpunkten Stellung.
Punkt 1 („anmutende Beliebigkeit der ausgesuchten Bauwerke“)
Alle keltischen Burgen Wittgensteins und des direkten Umfeldes wurden berücksichtigt. Vor allem die geometrischen Konstellationen direkt benachbarter Anlagen sind dargestellt.
Die Auswahl der Kirchen erfogte aufgrund der Bedeutung oder der direkten Nachbarschaft der Anlagen. Der Grund für die Bedeutung ist jeweils dargelegt.
Punkt 2 („verschiedene Epochen in einen Topf…“)
Auf einer Homepage-Seite werden isoliert die geometrischen Abhängigkeiten von benachbarten Kirchen untersucht (Elsofftal), auf anderen Seiten isoliert die Beziehungen von Burgen – im Ergebnis mit den gleichen Gesetzmäßigkeiten. Erst auf einer zweiten Stufe erfolgt die Kombination von alten Kirchen und keltischen Burgen – wieder mit den gleichen Regelhaftigkeiten.
Punkt 3 („Rotationsellipsoid Erde“)
Messungen über größere Entfernungen sind grundsätzlich fehlerträchtig und daher problematisch. Daher konzentrieren sich die Messungen des untersuchten Raumes auf eng beieinander liegende Objekte mit kurzen Distanzen. Die Toleranzabweichung ist erläutert.
Ist den Wittgensteiner Esoterik-Freunden schon aufgefallen, dass sie sich ziemlich genau auf der gleichen geographischen Breite wie Stonehenge befinden? (Berleburg 51°3′, Stonehenge 51°10′) Wenn die Druiden zur Tag- und Nachtgleiche auf ihren Hirschfellen im Steinkreis saßen, sahen sie die Sonne exakt über dem Wittgensteiner Land aufgehen. Daher der Spruch „Ex oriente lux“. Heute läßt sich das nicht mehr gut beobachten, weil inzwischen der Kölner Dom (50°56′) im Weg steht. Wunder über Wunder!
1. „Alle keltischen Burgen Wittgensteins und des direkten Umfeldes wurden berücksichtigt.“ – viele Wallburgen sind nicht datiert. Statt in keltischer Zeit landen sie womöglich auf einmal im frühen Mittelalter und damit im Kontext ganz anderer Kulturgruppen. Gleiches gilt für die These „Sakrale Raumordnung im Wittgensteiner Land“ – überwiegend ist die Bedeutung von Wallburgen noch gar nicht richtig erforscht. Inwieweit sie sakralen Zwecken dienten, bleibt zu erforschen. Und warum überhaupt Wittgensteiner Land – sie streifen doch auch das Hochsauerland mit Wormbach? Eine „hochgradig strukturierte Sakraltopographie“ und ein „System geodätischer, geometrischer und astronomischer Beziehungen“ macht vor modernen Ländergrenzen halt? Oder liegt es daran, dass TIM-online nur NRW basiert ist und sie deshalb nicht nach Hessen schauen?
2. „Vor allem die geometrischen Konstellationen direkt benachbarter Anlagen sind dargestellt.
Die Auswahl der Kirchen erfogte aufgrund der Bedeutung oder der direkten Nachbarschaft der Anlagen. Der Grund für die Bedeutung ist jeweils dargelegt.“ – Als Grund für die Bedeutung wird meistens Ihr gemessener Winkel angegeben. Aber das ist ja nicht der Grund, warum sie dieses oder jene Bauwerk ausgewählt haben. Warum z. B. nicht die Kirche Schwarzenau, Kapelle Altertshausen oder Christianseck? Wenn Gründe geliefert werden dann z. B. „Der Wilzenberg bei Schmallenberg ist der ‚heilige Berg des Sauerlandes‘ und ebenfalls Wallfahrtsort.“ Derartige Zitate sind unwissenschaftlich und es wird nicht deutlich, wer die Bedeutung, die sie bemessen, begründet – „die“ Kelten, „die“ Christen, die HSK-Tourismusbranche…? Für wen und warum ist die Kirche in Raumland bedeutend? Ich finde keinerlei Begründung.
Wie gesagt, super, dass sich mit Geschichte auseinander gesetzt wird und auch mal andere Überlegungen angestellt werden, aber methodisch ist es leider nicht haltbar. Nur weil bestimmte Zahlen schön ausschauen, kann man keine unterschiedlichen Kontexte, die zumal noch hunderte bis tausende Jahre auseinanderliegen können, in einen Topf werfen.
Die Frage ist doch, ob sich all die methodenkritische Mühe bei etwas lohnt, das sowieso niemand (außer den Vefechtern solcher Hypothesen selbst) für wissenschaftlich fundiert hält. Aber natürlich führt es auch zu nichts, sich über dieses Hobby lustig zu machen (Asche auf mein Haupt!). „Auch mal andere Überlegungen“ anzustellen, mag ja „super“ sein. Überlegungen aber, die seit ungefähr hundert Jahren (ausgehend von England) herumgeistern, sind so „anders“ längst nicht mehr. Unhöflich ausgedrückt: Schnee von gestern, nach dem außerhalb der New-Age-Anhängerschaft kein Hahn mehr kräht.
Im übrigen überraschen die Wittgensteiner „Forschungsergebnisse“ keineswegs. Wer auf der Landkarte Muster sucht, findet sie auch. Auf die mehr oder weniger keltischen Stätten kommt es dabei gar nicht an. Mit dem gleichen Erfolg lassen sich die Positionen von McDonald’s-Filialen oder öffentlichen Bedürfnisanstalten untersuchen. Man kann aber auch gleich eine Tüte Erbsen ausschütten und die Winkel der Verbindungslinien messen. 30°-Winkel und ihre Vielfachen tauchen zwangsläufig mit höherer Wahrscheinlichkeit auf als viele andere. Mit Geographie, Archäologie, Geschichte und sonstigen Realien hat das Phänomen nichts zu tun.
“ …. [Dr. Manuel Zeiler] ist in der Außenstelle Olpe des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe in der Archäologie-Abteilung tätig und untersucht weiterhin vor allem die Wallburgen auf ihre Anordnung. ….“ in: Westfälische Rundschau, 12.10.2016 (Link s.o.). Ob Zeiler New-Age-Anhänger ist oder sich nur mit alten Hüten beschäftigt, muss wohl noch geklärt werden, oder?
Wenn Sie so fragen: Nein, es muß nichts geklärt werden, was nicht behauptet worden war. Niemand beanstandet,dass sich Herr Dr. Zeiler, um den es hier überhaupt nicht ging, für die Thematik interessiert. Dass er die vorgelegten Hypothesen der (Zitat WAZ:) „Hobby-Forscher“ für bare Münze nehmen würde, läßt sich aus dem Zeitungsartikel nicht ablesen. Im Gegenteil: „Diese Untersuchungen stehen immer noch an ihrem Anfang und bilden ein weites Feld“. Ich glaube nicht, dass Herr Dr. Zeiler mit dem „weiten Feld“ die Niederungen esoterischer Phantastereien meint.
Mir ging es ja auch nicht so sehr um Zeiler, sondern um die Rolle der Wallburgen, die – leider kein alter Hut – offsichtlich noch der Bearbeitung harrt:
“ …. Ungeklärt ist auch die Rolle der vielen Wallburgen [im Siegerland].
Hier besteht noch viel Forschungsbedarf, der mit dem seit 2008 von der DFG geförderten interdisziplinär ausgerichteten Forschungsprojekt zum „Frühes Eisen
im Mittelgebirgsraum“ nachgekommen wird. ….“ in: Jennifer Garner, Der latènezeitliche Verhüttungsplatz in
Siegen-Niederschelden „Wartestraße“, in Metalla Nr. 17 Heft 1/2 (2010), Bochum, S. 91.
Vorweg: Mit Esoterik haben die Untersuchungen überhaupt nichts zu tun. Grundlage ist im Gegenteil (knallharte) Geometrie und Mathematik, die keinerlei Abweichung zulässt.
Dr. Zeiler interessiert sich für die Beziehungen der keltischen Burgen untereinander, eine Verquickung von Ringwallanlagen und alten Kirchen lehnt er kategorisch ab. Er ist im übrigen auf einem guten Wege, die kultische Bedeutung der keltischen Bauwerke zu beweisen. Es ist noch nicht allzu lange her, da wurden diesbezügliche Überlegungen ins Lächerliche gezogen.
Selbstverständlich gibt es auch Archäologen, die sich für keltische Landvermessung interessieren oder darüber hinaus sie detailliert untersuchen. Ein prominentes Beispiel ist Professor d´Aujourd´hui aus der Schweiz, mit dem ich korrespondiere.
Er stellt Forderungen an den Nachweis eines Vermessungssystems:
Orientierung, z. B. an den Haupthimmelsrichtungen
ein orthogonales System,
ein antikes Maß.
Die Punkte 1 und 2 sind bei der Anordnung der Bauwerke Wittgensteins und des direkten Umfeldes gegeben, an Punkt 3 arbeite ich. Hierzu gibt es aber schon gute Ansatzpunkte im hessischen Bereich (Burg Eisenberg, Burg Christenberg, Burg Rimberg). Die Verbindungen Kirche Bromskirchen-Kirche Frohnhausen (N-S-Richtung) und Elsoff-Birkenbringhausen (W-O-Richtung) schneiden sich exakt rechtwinklig auf dem Eisenberg bei Battenberg. Die Abweichung von den Haupthimmelsrichtungen ist minimal. Basislinie ist die Strecke Burg Eisenberg-Burg Christenberg mit einem exakten Winkel von 41° von der W-O-Richtung. Für die umliegenden Kirchen sind vielfach 30°-Winkel nachzuweisen. Wie richtig vermutet, scheitert eine kartographische Darstellung am nicht vorhandenen TIM-Online-System für Hessen.
Professor d´Aujourd´hui hält es im übrigen „für wahrscheinlich, dass es christliche Kirchen gibt, die auf antike Spuren zurückgehen“.
Um es noch einmal ganz deutlich zu formulieren: Alle keltischen Burgen Wittgensteins und des direkten Umfeldes wurden berücksichtigt, mit dem Wilzenberg, Burg Kahle, dem Hofkühlberg, Burg Obernau, Burg Rittershausen, Burg Rimberg und Burg Eisenberg auch direkt benachbarte Anlagen außerhalb Wittgensteins. Auch nahezu alle alten Kirchen Wittgensteins sind erfasst. Die Bauwerke in Schwarzenau und Christianseck sind jung, die Kapelle Alertshausen ist als sakrales Bauwerk im Elsofftal sehr wohl berücksichtigt. Ich habe eine Viezahl weiterer geometrischer Bezüge gespeichert, die im Rahmen einer Homepage unmöglich zu präsentieren sind.
Wissenschaftliches Arbeiten bedeutet für mich:
eine Hypothese aufstellen, Gesetzmäßigkeiten und Regelhaftigkeiten feststellen, die für jeden nach- und überprüfbar darzustellen, größmögliche Genauigkeit walten zu lassen und vor allem bei frappierenden Gesetzmäßigkeiten weitere Untersuchungen anzustellen, um zu verifizieren oder zu falsifizieren. Zum Abschluss: Viel Erfolg beim Versuch
fünf Erbsen (sinnbildlich für die benachbarten sakralen Bauwerke im Elsofftal) so auszustreuen, dass alle über 30°-Winkel erfasst werden (bitte absolut exakt), drei weitere daneben (für die Konstellation Kirche Wingeshausen-Burg Aue-Kirche Berghausen), so dass ebenfalls 30°-Winkel zustande kommen und zwei Abstände auf den Millimeter identisch sind.
Leider keine Antwort auf die Frage, wer welchen Bauwerken wann welche Bedeutung zuspricht. In dieser Hinsicht keine Nachprüfbarkeit gegeben und somit unwissenschaftlich. Es bleibt: Bauwerke werden ausgewählt, weil sie ein schönes Winkelmaß bilden, wie sie datieren, welchen Kontext sie besitzen scheint egal. Das ist schade.
Am Labor für technische Datenverarbeitung und Informationstechnik der FH Köln, Campus Gummersbach, gab es 2010 folgendes, regional relevantes Forschungsprojekt: „Topologische Aspekte von Wallburgsystemen“. Informationen dazu sind unter diesem Link downloadbar: http://tdi.gm.fh-koeln.de/dlbrowser/%3EAllgemein%3EInfos%20zu%20Projekten%3EWallburgen .
In der aktuellen Wittgenstein-Bibliographie von A. Krüger finden sich folgende Literaturhinweise zum Suchwort „Wallburg“:
Böttger, Hermann: Ausgrabungen an den Wallburgen bei Afholderbach, Aue, Laasphe und Niedernetphen, In: Siegerland, 1932, Heft 3 und 4, Seiten 42-45
Böttger, Hermann: Die Wallburgen und die Anfänge der Eisenindustrie im Siegerland Grund der Ausgrabungen 1932, In: Heimatland, Beilage zur Siegener Zeitung, Nr. 5, Jg. 8, 1933, S. 74-80
Born, Ernst: Uf der Wuhnige (Wallburg Aue), Wittg. Bd. 32/1968/H. 4/S. 197-198
Kraemer, Adolf: Die Wallburgen und „Burg-Berge“ in Wittgenstein
DschW. 1927/H. 2/S. 54-56
Kraemer, Adolf: Fundstücke aus Wittgensteiner Wallburgen im Museum zu Siegen, DschW. 1938 /Nr. 8/S. 57-58
Radenbach, Hans-Günter: Die eisenzeitliche Siedlungskammer südlich der Wallburg bei Aue, Wittg. Bd. 46/1982/H. 4/S. 131-139
Vitt, Fritz Was unsere Wallburgen erzählen, WHB 38/S. 7-14
Tang, Jürgen Die Wallburg „Burg“, ChronikHesselbach S. 41-43
Herrn Poggels letztem Kommentar ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Nur noch eine ergänzende Frage an Herrn Grebe, bevor ich mich zurückziehe: Was nutzt es Ihrer Hypothese, wenn Sie auf Karten einer Mittelgebirgslandschaft irgendwelche schönen Winkel einzeichnen können, die mit den im dreidimensionalen Gelände vorzufindenden Beziehungen unterschiedlich hoch gelegener Objekte nichts zu tun haben? Oder wollen Sie andeuten, die „alten Kelten“ hätten das Land aus der Vogelperspektive vermessen und anhand solcher Projektionen, quasi am Schreibtisch, den Raum geordnet? Dann könnten Sie freilich auch gleich die prähistorischen Besucher aus dem All ins Spiel bringen, die uns Erdlingen solche „Satellitenkarten“ als Gastgeschenk mitbrachten.
Babylonier, Ägypter, Griechen, Etrusker, Römer – alle haben auf hohem Niveau vermessen, nicht nur im Flachland.
Die Kelten pflegten enge Kontakte zu Griechen und Etruskern.
In den letzten drei Jahrzehnten hat sich die Einschätzung bzgl. der Kelten dank fächerübergreifender Studien stark gewandelt. Inzwischen stuft man sie als hohe Kultur mit teilweise überragenden Fähigkeiten ein.
„Wenn ich es richtig begriffen habe, gehörten die beiden Grafschaften Wittgenstein sofort nach der preußischen Inbesitznahme im Juli 1816 zum Regierungsbezirk Arnsberg.
Digitalisiert liegt vor:
„Patent wegen Besitzergreifung des Herzogthums Westfalen und der Grafschaften Wittgenstein-Berleburg und Wittgenstein-Wittgenstein“, Arnsberg 15.7.1816
in: Amtsblatt für die Provinz Westfalen vom 20.7.1816, Nr. 53, S.305-310.
Demzufolge wurden die Wittgensteins „der hiesigen Kgl. Regierung … unterstellt“, was sich eigentlich nur auf Arnsberg beziehen kann, da das Patent von Vincke dort (und nicht in Münster) ausgestellt worden war.
Die Verordnung betr. den Übergang des Kreises Siegen von Koblenz nach Arnsberg finden Sie im Koblenzer Amtsblatt vom 9.6.1817:
Leider sind die Arnsberger Amtsblätter erst ab 1821 digitalisiert, und die UB besitzt die ersten Jahrgänge auch nicht im Original. Im Stadtarchiv Siegen sind sie aber, soweit ich mich entsinne, vorhanden. Vielleicht könnte man die für unsere Kreisgeschichte relevanten amtlichen Mitteilungen von 1816/17 dort einmal heraussuchen und für Siwiarchiv scannen.“
Dieser irritierende Eintrag erfordert ein Bekennerschreiben. Bei dem Text des „Anonymus“ handelte es sich um eine persönliche E-Mail an den Administrator, die versehentlich fast komplett hier eingestellt worden ist. Ausgereicht hätte der Link zum Patent von 1816, falls eine amtliche Bestätigung des in der Zeittafel genannten Termins nötig gewesen wäre. Ich war mir nicht sicher, ob ich den Einwand von Herrn Sigg richtig verstanden hatte, deshalb wollte ich ihn nicht kommentieren.
Der Übergang an Preußen ist wahrlich nicht einfach, da verliert man schnell den Überblick.
1. Preußen war zunächst einmal mehr an Sachsen als an irgendwelchen Territorien im Westen (u.a. am „Siegerland“) interessiert.
2. Im Verhältnis zu Wittgenstein gestaltete sich die Besitzergreifung des Gebietes des späteren Kreises Siegen umständlicher und zeitaufwendiger. Im Dezember 1813 gelangte zwar Wilhelm Friedrich Fürst zu Oranien-Nassau, der spätere König der Niederlande wieder in Besitz seiner Erblande mit den Fürstentümern Hadamar, Dillenburg, Diez und Siegen, trat diese aber bereits am 31. Mai 1815 im Gebietstausch gegen das Großherzogtum Luxemburg an Preußen ab. Preußen wiederum überschrieb am gleichen Tage die ehemaligen Fürstentümer Dillenburg, Diez, Hadamar vollständig sowie den Freien- und Hickengrund (Ämter Burbach und Neunkirchen) und einige Ortschaften der Ämter Siegen, Netphen und Irmgarteichen – insgesamt eine Bevölkerung von 12.000 Einwohnern – an das Herzogtum Nassau (nicht an das Großherzogtum Niederrhein wie oben angegeben!) . Gleichzeitig verpflichtete sich der Herzog von Nassau, die an ihn abgetretenen Ämter und Gemeinden später im Tausch gegen die Grafschaft Katzenelnbogen, welche Preußen zwischenzeitlich von Hessen zu erwerben beabsichtigte, zurückzugeben.
Lit.: Achenbach, Kreis Siegen, S. 31; Kruse, Das Siegerland, S. 271-273 (mit Nennung der einzelnen Ortschaften); Gesetz-Sammlung f.d. Königlichen Preußischen Staaten 1918, S. 31; Karte für das 12.000 Seelen-Gebiet bei Dango, Wilnsdorf, S. 270.
Zur Geschichte des Kunstdepots in Siegen sind auch folgende Archivalien des Kölner Stadtarchivs einzusehen:
1) Bestellsignatur: Acc. 229 (412 Konservator), 435
Laufzeit: 1945 – 1952
Titel: Kunstschutz ab 1. Mai 1945
Enthält: u.a. Berichte über Besichtigung der Depots in Siegen, Runkel, Schadeck und Heldburg. – Sicherungsarbeiten an Baudenkmälern. – Schutz privater Kunstsammlungen. – Protokoll der Besprechung der Denkmalpfleger und einzelner Museumsdirektoren Nordwestdeutschlands in Bünde am 16.2.1946. – Niederschriften über Tagungen der „Arbeitsgemeinschaft der Rhein. Museen“ am 8.3. und 24.5.1946. – Gründung eines baugeschichtlichen Seminars an der Staatlichen Ingenieurschule für Bauwesen, Dormagen. – Erfassung der Kriegsschäden an Denkmalbauten. – Kunstgutrückführung aus Schloß Dyck.
2) Bestellsignatur: Acc. 229 (412 Konservator), 437
Laufzeit: 1945 – 1953
Titel: Schriftwechsel mit der Militärregierung, dem Provinzialkonservator der Rheinprovinz, der Archivverwaltung beim OP der Nordrheinprovinz über Bergungen, Rückführung von Kunstgegenständen etc. nach dem Kriege. – Listen des Kunstgutes auf Schloß Runkel und Burg Schadeck. – Protokoll über eine Besprechung mit der Militärregierung am 25.1.1946. – Liste der Bergungsorte. – Kunstguttransport von Siegen und Crottorf nach Marburg.
3) Bestellsignatur: Acc. 229 (412 Konservator), 467
Laufzeit: 1944 – 1958 Titel: Bergung und Rückführung von Kunstwerken aus Siegen.
4) Bestellsignatur: Acc. 93 (411 Verwaltung der Museen), A 259
Laufzeit: 1946 – 1947
Titel: Auslagerungen von Kunstgut in Museumsdepots: Schloß Alfter, Dyck, Ehrenbreitstein, Schloß Frens, Gaibach, Amorbach, Geilnau, Gudenau, Schloß Harff, Hohenzollern, Tübingen, Schloß Kuckuckstein, Langenau, Siegen, Marburg, Nordkirchen, Oberaudorf, Unterdiessen, Hochbunker Vingst. –
Enthält: Rückführung des Gitters aus dem Kloster Heisterbach nach Köln. – Liste der auf der Festung Ehrenbreitstein befindlichen Bilder des Wallraf-Richartz-Museums. – Presseausschnitte über die Tübinger Ausstellung. – Bericht des württembergischen Landeskonservators Rieth über die Verlegung der Bilder von Hohenzollern nach Tübingen. Beschlagnahme von Schloß Frens durch die Militärregierung (7.8.46). Schriftwechsel mit Fritz Fremersdorf über die Unterbringung von Museumsgut und die Stellenbesetzung an Kölner Museen. – Rückführung der Kunstsammlungen aus der amerikanischen Zone. – Liste der Museumsdepots der Hansestadt Köln.
5) Bestellsignatur: Acc. 177 (4110 Wallraf-Richartz-Museum), A 354
Laufzeit: 1944 – 1948
Titel: Unterbringung, Betreuung und Rückführung der Gemälde aus dem Bergungsort Siegen; Korrespondenz und Berichte.
via Digitaler Lesesaal des Stadtarchiv Köln
Die noch auf der Agenda des Kreisarchivars stehende Auswertung des an vorletzter Stelle genannten Buches (Kruse) kann jeder selbst vornehmen: http://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/urn/urn:nbn:de:hbz:6:1-23769
Darin S. 273-274: Abdruck von Schencks Bewerbung um die Stelle des Kreisdirektors vom 2.8.1815.
Wie der Heimatverein Holzhausen uns unterrichtete, handelt es sich bei dem Bild nicht um eine Gasstätte in Burbach-Holzhausen, sondern um wohl um eine in Laasphe-Holzhausen.
Der Vorsitzende des 4fachwerk-Vereins ist geradezu Fan der alten Siegerländer Meister (02734 / 7223). Vielleicht könnte zu einem späteren
Zeitpunkt (frühestens 2018)eine neue überarbeitete Ausstellung zu Sänger geben.
Auch der Innenausschuss des Bundestages hat am 14.12.2016 über das Archivgesetz nicht öffentlich beraten und einen Beschluss gefasst, von dem lediglich folgendes bekannt ist:
@Katinka_Mitt deshalb haben die InnenpolitikerInnen der LINKEN gestern im InnA gegen den Gesetzentwurf gestimmt. #BarchG
Das gesuchte Gebäude befindet sich ganz in der Nähe des Kreishauses, genauer gesagt Koblenzer Straße 136, gegenüber der Siegerlandhalle. Es handelt sich um den Sitz des AWO-Kreisverbands Siegen-Wittgenstein/Olpe.
Allseits ein schönes Weihnachtsfest!
Das Stadtarchiv Siegen verabschiedet sich in die Weihnachtsfeiertage mit dem an dieser Stelle sicherlich angebrachten Hinweis auf die üppigen Öffnungszeiten „zwischen den Jahren“. Wir empfangen Besucher in der Zeit vom 27. bis zum 30. Dezember zu den bekannten Öffnungszeiten, Gelegenheit auch für alle von unserer Sommerschließungsperiode Enttäuschten Versäumtes – nach verdauter Printe – nachzuholen.
Wir wünschen allen unseren Besuchern ruhige und besinnliche Feiertage und freuen uns auf regen Besuch im Jahr 2017.
Man kann sicher gute Gründe finden https://archiveowl.wordpress.com/
wegzulassen, wie in der Siwiarchiv-Blogroll. Aber den Menschen draußen im Lande soll mit diesem Kommentar signalisiert werden, dass es noch ein weiteres obkures Archivblog gibt.
Danke für das Lob und die Ergänzungen, die ich mit zwei Ausnahmen eingearbeitet habe! Eigentlich ist ja nicht die primäre Aufgabe von siwiarchiv eine deutsch(sprachige) Archiv-Blogroll zu führen und aktuell zu halten, aber wenn wir die vollständigste Auflistung sind, führen wir diese gerne weiter. Ergänzende Hinweise sind natürlich willkommen.
Im Bestand R 8034-III (Reichslandbund-Pressearchiv, Personalia) des Berliner Bundesarchivs befinden sich unter Nr. 433 Artikel zu Landrat Schroeder aus den Jahren 1910 – 1911.
Das Kulturmagazin perlentaucher.de paraphrasiert den Bericht wie folgt: “ …. Auch in der FAZ kommt das geplante neue Bundesarchivgesetz … nicht gut an. Die Historiker Frank Bösch und Eva Schlotheuber fürchten einmal, dass künftig wichtige Akten zu schnell geschreddert werden. Andere Dokumente, etwa von Bundeskanzlern, landen bei Stiftungen. „Der Gesetzentwurf sieht zudem neue Sonderregelungen für die Nachrichtendienste vor. Diese sollen Akten nur dann an das Bundesarchiv übergeben, wenn ‚überwiegende Gründe des Nachrichtenzugangs oder schutzwürdige Interessen der bei ihnen beschäftigten Personen einer Abgabe nicht mehr entgegenstehen‘. Wann das der Fall ist, entscheiden nach diesem Entwurf die Geheimdienste selbst. Eine zumindest nachträgliche demokratische Kontrolle ihrer Arbeit ist so schwerlich möglich. Die Selbstsicht der Behörde auf die eigene Tätigkeit wird zum Leitmotiv erhoben. Kann oder, besser gesagt, will sich eine Gesellschaft das leisten?“ …..“
Wer wie ich absolut keine Ahnung von Militärgeschichte hat, wird mit der naiven Google-Bildsuche nach „gekreuzte Kanonen“ sofort fündig: http://images.delcampe.com/img_large/auction/000/305/123/787_001.jpg
Demnach handelt es sich um die Hälfte eines französischen Koppelschlosses.
Für „boucle de ceinturon“ + artillerie erhält man auch noch zahlreiche weitere Beispiele auf französischen Web-Seiten. Dieses Bildmotiv war anscheinend während des Zweiten Kaiserrreichs (1852-1870) gebräuchlich.
Link zum einem Video der Laudatio von Hannelore Kraft, Ministerpräsidentin des Landes NRW, auf Rudolf Biermann, 18.1.2017: https://youtu.be/PHrqgyPhrKI
Die damalige Entscheidung des Kommunalpolitiker Rudolf Biermann, sich dem öffentlichen Widerspruch gegen die Namensgebung für das Flick-Gymnasium anzuschließen, ist natürlich wertzuschätzen. Sie zog dann nach sich, dass endlich der Weg frei für die kommunalparlementarische Mehrheit zur Löschung eines Namens frei werden konnte, der Kreuztal im weiten Rund zum schlechten Witz der „Vergangenheitsbewältigung“ gemacht hatte.
Wenn Biermann neben anderem auch dafür jetzt geehrt wird, ist das ebenfalls wertzuschätzen. Leider aber geraten in den zahlreichen öffentlichen Verweisen auf die Ehrung die Hauptakteure aus dem Blick. Das war seit 1981 und beginnend mit der Theatergruppe des Ev. Gymnasiums in Weidenau eine große Zahl von Menschen aus der Region jenseits parlamentarischer Aktivitäten. Aus den Kommunalparlamenten war jahrzehntelang nichts gekommen und kam lange auch weiter nichts. Die genannten und andere Schüler, die verschiedenen Bürgerinitiativen, die Verfasser von erklärenden Schriften und öffentlichen Erklärungen, die Organisatoren vieler öffentlicher Veranstaltungen, die Gesellschaft für Christlich-jüdische Zusammenarbeit (und unter all diesen auch das eine oder andere Parteimitglied) mussten in nahezu dreißig Jahren ihrer Aktivität viel Ausdauer, Kraft und Zeit aufbringen, um in der parlamentarischen Szene nach schmerzhaften Niederlagen am Ende eine hinreichende Unterstützung für diese Umbenennung zu bewirken. Auf Geschichte kommt die Laudatorin mit keinem Wort. Sie musste sich ja auch kurz fassen, denn es waren ja weitere gute Taten zur Begründung der Ehrung zu benennen. Leider beschränkte sie sich bei Nennung von Flick auf den Kriegsverbrecher. Dabei hätte es wenig Zeit gekostet, den Nach-NS-Flick, das Symbol für Korruption in Politik und Gesellschaft, mit einzubeziehen. Den damaligen Hauptakteuren war das immer wichtig gewesen. Diese Defizite sind dann schon ein etwas schade.
Da im Zusammenhang mit der verdienten Ehrung von Herrn Biermann
die Umbennenung des Friedrich-Flick-Gymnasium in den Beiträgen hier
so zahlreich Erwähnung findet, sollte nicht vergessen werden, das es immer noch eine öffentliche Ehrung von Friedrich Flick im Siegerland gibt.
In der Gemeinde Burbach gibt es noch immer eine Friedrich-Flick-Straße.
2010 beantragte die damalige Ratsfraktion der Grünen eine Umbenennung.
Diese wurde mit der Mehrheit von CDU und FDP abgelehnt.
Zitat BM Ewers (CDU) aus der Siegener Zeitung vom 30.6.2010:
„…wir haben hier nicht über die moralische Integrität einer Person zu entscheiden“.
Nicht unweit der Friedrich-Flick-Straße befindet sich noch eine Straße die nach einem weiteren Waffenschmied Hitlers benannt ist, die Ernst-Heinkel-Straße.
Beide Straßenenamen gehören endlich entfernt!
Am 27. Januar 2017 gedenken die Kreuztaler Bürgerinnen und Bürger an die Opfer des Nazi-Terrors.
Zunächst wird im Gedenken an die Genossen Ernst Schweisfurth und Robert König um 14 Uhr an der Ausbildungswerkstatt von ThyssenKrupp in Eichen eine Gedenktafel enthüllt. Die zwei Männer waren im Eichener Walzwerk im Werkschutz tätig und wurden wegen ihrer Hilfe für Zwangsarbeiter in den Konzentrationslagern Neuengamme und Sachsenhausen ermordet.
Um 15.30 Uhr findet am Fred-Meier-Platz die jährliche Gedenkstunde mit Kranzniederlegung statt. Dieter Pfau wird dort der Hauptredner sein. Die Einaldung des Bürgermeisters finden Sie unten im Downloadbereich.
Um 16.30 Uhr hält Frau Dr. Anne Sudrow in der Kapellenschule Littfeld einen Vortrag zur Schuhprüfstrecke im KZ Sachsenhausen, auf der Ernst Schweisfurth umkam. Frau Sudrow arbeitet am Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam und hat über die Verbindungen der deutschen Schuhindustrie zur SS geforscht.
Die Veranstaltungen finden in Kooperation der Stadt Kreuztal, ThyssenKrupp, der SPD-Stadtverbände Kreuztal und Hilchenbach, der Gesellschaft für christlich jüdische Zusammenarbeit und des VVN-BdA Siegerland-Wittgenstein statt.
Lieber Patrick, vielen Dank für den ersten Beitrag zu unserer Blogparade! Es ist eine sehr charmanate Idee, ein inaktives Blog mit neuem Leben zu füllen. Kooperativ sollte dies gelingen. ;-)
In der Tat, eine schöne Idee, ein inaktives Blog wiederzubeleben – schade, dass es eingeschlafen ist! Ich stimme voll zu, dass einr Wiederbelebung mit dem richtigen Themenmix nichts im Wege stehen dürfte :)
Im Januar 2017 hat der WDR intensiv zu Straßennamen in NRW recherchiert, u.a. mit folgendem Ergebnis: “ …. Trotz der zahlreichen Diskussionen um die Ehrwürdigkeit Hindenburgs, gibt es allein in NRW heute noch 65 Straßen und Plätze, die seinen Namen tragen. ……“
Eine interaktive Karte mit problematischen Straßennamen verweist für das Kreisgebiet auf die Friedrich-Flick-Str. in Burbach, auf Hermann-Löns-Str. in Erndtebrück, Kreuztal, Netphen, Siegen, und Wilnsdorf, auf den Hindenburgplatz in Neunkirchen, die Hindenburgstr. in Burbach, Hilchenbach und Siegen und auf die Lothar-Irle-Str. in Siegen.
Link zur Quelle: http://www1.wdr.de/wissen/strassennamen-historisch100.html
Danke für die Transparenz und die ausführlichen Statistiken, die zeigen, dass sich siwiarchiv einen ganz eigenen Leserkreis erschlossen hat! Ein Proargument für die Nutzung von Social Media durch Archive!
Der Beitrag des Stadtarchivs Greven zur Blogparade ist soeben unter http://archivamt.hypotheses.org/4648 veröffentlicht worden.
Auch an dieser Stelle: Herzlichen Glückwunsch, siwiarchiv
Es wäre schade, wenn das Stadtarchiv Greven sich aus der Blogwelt zurückziehen würde, insbesondere auch deswegen vielen Dank für die klare Empfehlung an andere Archive!
Ob das Stadtarchiv Greven weiter bloggt, wird sich zeigen. Vielleicht kann das nach einem Stellenwechsel auch nicht die erste Priorität sein. Ich selbst bin aber für das Bloggen weiterhin offen und sicherlich auch tätig.
Warum in die Ferne schweifen … Ein kleiner Bestand „Schmeißer“ liegt auch hier am Ort vor: Stadtarchiv Siegen Best. Sammlungen Nr. 58. Darin „Bericht über Besichtigungsreise der Bergbausachverständigenkommission in das beschädigte Bergbaugebiet Nordfrankreichs, Versailles 26. September 1919“ (mit einem an die Familie gerichteten Zusatz) sowie ms. Nachruf auf Schmeißer (Autor vermtl. Dr. Kruse)
Danke für die Präzisierung!
Ein bisschen Fernweh sei doch erlaubt, wenn man bedenkt, dass Schmeißer offensichtlich Zeitgenosse von Goldräuschen bzw. deren Auswirkungen in Südafrika, Australien und in Amerika war – dort lässt sogar Jack London grüßen ;-). Selbst die Reise nach Spitzbergen scheint eine Reaktion auf die dortige Kohleförderung zu sein ….
Schmeißer nahm als Berghauptmann für die östlichen Provinzen des preussischen Staates an der Besichtigungsreise in das beschädigte Bergbaugebiet Nordfrankreichs teil, die fand vom 23. – 25. September 1919 stattfand; u. a. folgende Orte wurden besucht: Versailles, Arras, Lievin, Lens, Bethune, Carvin, Eisenwerk Mingles, Corrierers, Drocourt, Dourge
Der an die Familie gerichtete Zusatz vom 8.10.1919 enthält neben persönlichen Eindrücken auch einen Hinweis auf eine weitere Tätigkeit Schmeißers während des Ersten Weltkriegs: “ …. Im Spätherbst 1914 musste ich auf Anordnung der Obersten Heeresleitung einen Plan zur Lahmlegung des polnischen und oberschlesischen Steinkohlbergbaus entwerfen für den Fall, dass der Einbruch der heranflutenden russischen Heere erfolgen sollte. ….“
Für weiterführende literarische Recherchen seien an dieser Stelle auch die zahlreichen Publikationen von Karl Schmeißer genannt, die zum Bestand der Wissenschaftlichen Bibliothek zur Regionalgeschichte im Stadtarchiv Siegen gehören und im Lesesaal eingesehen werden können:
„Der Goldbergbau in der südafrikanischen Republik Transvaal und seine Bedeutung für die deutsche Maschinenindustrie“ (vorgetragen in der Sitzung des Berliner Bezirksvereines vom 21. Februar 1894, zugl. Sonderabdruck aus der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure 38, Berlin 1894)
„Reisebeobachtungen in Süd-Afrika“ (Vortrag gehalten von Herrn Berg-Rath Schmeisser am 13. Juli 1894 im Bezirks-Verein des Vereins deutscher Ingenieure zu Siegen, zugl. Separat-Abdruck der Süd-Afrikanischen Wochenschrift 1894)
„Ueber Vorkommen und Gewinnung der nutzbaren Mineralien in der Südafrikanischen Republik (Transvaal) unter besonderer Berücksichtigung des Goldbergbaues.“ Berlin 1895
„Reisebeobachtungen in den Goldländern Australasiens (10. Oktober 1896, Sonderabdruck aus d. Verhandlungen d. Gesellsch. f. Erdkunde zu Berlin Nr. 8/1896)
„Die Goldlagerstätten und der gegenwärtige Stand des Goldbergbaues in Australasien“ (Vortrag, gehalten in der Abteilung Berlin-Charlottenburg der Deutschen Kolonial-Gesellschaft, zugl. Deutsche Kolonial-Gesellschaft, Abt. Berlin-Charlottenburg, Verhandlungen 1896/97, Heft 4, Berlin 1897)
„Geographische, wirtschaftliche und volksgeschichtliche Verhältnisse der südafrikanischen Republik, sowie deren Beziehungen zu England (Vortrag, gehalten in der Abt. Berlin-Charlottenburg der Deutschen Kolonial-Gesellschaft, zugl. Abt. Berlin-Charlottenburg der Deutschen Kolonial-Gesellschaft, Verhandlungen 1900/01, Heft 1, Berlin 1900)
„Die Geschichte der Geologie und des Montanwesens in den 200 Jahren des preussischen Königreichs, sowie die Entwickelung und die ferneren Ziele der Geologischen Landesanstalt und Berg-Akademie) (Separatabdruck aus dem Jahrbuch der königl. preuss. geologischen Landesanstalt für 1901)
Danke für die Ergänzungen!
Ist in der Bibliothek des Stadtarchivs auch folgender Aufsatz Schmeißers vorhanden:
„Ueber die Gewinnungs- und Absatzgebiete der wichtigeren nutzbaren mineralischen Bodenschätze Rheinland-Westfalens und Nassau“, in: Archiv für Eisenbahnwesen 11 (1888), S. 442 – 456, 630 – 655? Wenn nicht, so kann er in den Sammlungen der ULB Münster online eingesehen werden.
Ebenfalls für die Region relevant – und bevor Kollege Kunzmann zuschlägt – ist folgende Veröffentlichung Schmeißers:
„Über das Unterdevon des Siegerlandes und die darin aufsetzenden Gänge, unter Berücksichtigung der Gebirgsbildung und der genetischen Verhältnisse der Gänge“, in: Jahrbuch d. Preuß. Geolog. Landesanst. 1882, Berlin 1883, S. 48 – 148.
Wenn ich es richtig sehe, fehlt bei den Publikationen Schmeißers auch das von ihm herausgegebene Buch „Oberschlesien und der Genfer Schiedsspruch“, Berlin 1925, das am Osteuropa-Institut in Breslau entstand.
Besten Dank für die Info!
Leider sind bis auf die genannten bibliografischen Nachweise keine weiteren Veröffentlichungen aus der Feder Schmeißers in den Beständen des Stadtarchivs nebst angeschlossener Bibliothek zu ermitteln gewesen.
Kollege Kunzmann wird hier nicht mehr „zuzuschlagen“, wenn die gelegentlichen bibliographischen Anmerkungen vom Kollegen Wolf so empfunden worden sind. Schon John Rambo mußte einsehen: „Ich bin entbehrlich.“
1) Tippfehler sind im Blog immer verzeihlich.
2) Zuschlagen habe ich durchaus nicht negativ empfunden. Ihnen stehen ja durchaus größere bibliographische Möglichkeiten zur Verfügung als dem Kreisarchiv, so dass ich sogar gehofft hatte, dass Sie „zuschlagen“. Entschuldigen Sie, dass die saloppe Äußerung missverständlich war.
3) Generell betrachte ich alle sachlichen Ergänzungen zu diesem Eintrag als Erkenntnisgewinn. Im Rahmen eines einwöchigen Praktikums einer Schülerin der 9. Klasse war nicht mehr möglich als dieser Eintrag, der die schnell greifbaren und auffinbaren biographischen Quellen zusemmenstellen sollte.
Zudem handelte sich insgesamt um ein Zufallsprodukt. Denn im Blog der Berliner Archive wurde auf den Catalogus professorum der TU Berlin hingewiesen. Ein Test in der einfachen Suche mit dem Wort „Siegen“ ergab drei Treffer, die aber noch nicht online eingesehen werden konnten. Die Suche über die Option „Karte“ führte zu Karl Schmeißer [off topic: – ein Problem, das m.E. geändert werden sollte. Klaus Graf weist auf Archivalia auch auf die fehlenden Quellennachweise bei den einzelnen Einträgen hin. Vielleicht kann man da ja etwas ändern].
Bei der Reise nach Skandinavien und Spitzbergen handelt es sich um eine Exkursion des Internationalen Geologenkongresses, der 1910 in Stockholm stattfand. Die erwähnte Publikation ist ein Sonderdruck aus der Schlesischen Zeitung.
Aus Heinz Fischer (Bearb.): Schülerverzeichnisse von 1580 – 1936, S. 68, beigebunden in: Hans Kruse: Geschichte des höhern Schulwesens in Siegen. Festschrift zum 400jährigen Jubiläum des Realgymnasiums in Siegen. Siegen 1936, geht hervor, daß Schmeißer evangelisch war und sein Abitur an Ostern 1875 abgelegt hat. Ferner scheint er mit dem Gedanken gespielt zu haben, den Beruf des Vaters anzunehmen und Medizin zu studieren.
Interessenten an noch mehr Karriere-Details sollten dann nicht versäumen, Das „Abiturienten-Zeugniss der Reife für den Zögling der Realschule I. Ordnung zu Siegen Carl Schmeißer“ im Stadtarchiv Siegen einzusehen (Best. Schulen Nr.65 / 245).
Die gesamte Familie Schmeißer in der Löhrstraße 441 samt Eltern 2 Schwestern, 3 Brüdern, drei als „Schüler“ bezeichneten Mitbewohnern (offensichtlich „Kostgänger“), einem Knecht und zwei Mägden findet sich natürlich in der „Liste sämtlicher Civil-Einwohner im Magistrats-Bezirks Siegen“ (Stadtarchiv Siegen, Best. Stadt Siegen C, Nr. 417).
Ernst Schmeißer als Bruder von Karl ist bekannt und findet sich in Irle, Lothar: Siegerländer Persönlichkeiten und ihre Geschlechter–Lexikon, Siegen 1974, S.292-293 . Heißt der andere Bruder zufälligerweise Heinrich? Denn dann könnte es sich um Heinrich Schmeßer handeln, der an der Berliner Bauakademie von 1872 bis 1875 studierte und die Akademie am 3.7.1875 verlies. Diese Information verdanke ich der o.e. erwähnten Antwort des Archivs der TU Berlin (Sig.: 111-1, Matrikel der Studenten und Gasthörer, Band I Bauakademie 1868 – 1875, S. 83).
Im Nachgang zum Eintrag und den bisherigen Kommentaren recherchiert das Kreisarchiv nach Matrikelunterlagen Schmeißers bei den in Frage kommenden Universitätsarchiven (s.o.). Gestern bereits traf die Antwort des Archivs der TU Berlin ein: Leider lisind die Matrikelunterlagen der Berliner Bergakademie nicht dort nicht erhalten. Allerdings wurde auf folgende s verwiesen:
„- aus der Hochschulgeschichtlichen Sammlung eine Akteneinheit zur Königlichen Bergakademie mit einem Auszug aus dem Berichte Schmeisser´s zur Zusammenarbeit der Geologischen Landesanstalt und der Bergakademie und Stellungnahme gegen die Eingliederung der Bergakademie in die Technische Hochschule Berlin vom 14. Dezember 1905 (Sign. 709 -136)
– und eine Kurzbiographie in: Hugo Strunz, Von der Bergakademie zur Technischen Universität Berlin, 1770 bis 1970, hrsggb. von Förderer der Berliner Fakultät für Bergbau und Hüttenwesen e. V., 1970 (Sign. 813 -37).“
Auch das Universitätsarchiv Bonn hat bereits gestern die Anfrage beantwortet (Az.: 521-0121/17):
Im Immatrikulationsalbum der Universität Bonn findet sich die Eintragung Karl Schmeißers am 26.April 1874 (Signatur: Univ. Bonn Archiv AB-08 Immatrikulationsbuch 1872-1880).
Außerdem geht aus dem Studentenverzeichnis hervor, dass er vom genannten Immatrikulationsdatum bis zum 30.September 1874 an der Universität im Fach Naturwissenschaften eingeschrieben war (Signatur: Univ. Bonn Archiv/Bb/PVSV – SS1876-SS1878).
Danke! Bin ebenfalls ein wenig irritiert gewesen und hätte vorsichtig via E-.Mail prüfen lassen, ob mich mich bei Kruse nicht verlesen habe. Im Nachruf Kruses auf Schmeißer (Siegerland, Bd 8 (1926). S.21) findet sich allerdings als Abitur-Datum Ostern 1874 ……
Es scheint, als habe siwiarchiv eine Fehlmeldung ungeprüft weitergeleitet. Die Schrift „Dimensionen der Verstrickung“ ist keine Dissertation, sondern eine Auftragsarbeit, die Anfang des Jahres zur 200-Jahr-Feier der Bezirksregierung Arnsberg erschien. Wer möchte, kann sie (für 10,- Euro Schutzgebühr) beim Autor und bei der Pressestelle der Bezirksregierung bestellen oder im CAB-Bücherstudio und in der Buchhandlung Sonja Vieth in Arnsberg erwerben.
Die „Fehl“information stammt von der Homepage der Bezirksregierung Arnsberg – s. Link am Ende des Eintrages – und wurde tatsächlich ungeprüft übernommen.
Zum Hintergrund der Studie findet sich auf S. 4 folgendes: “ …. Im Rahmen eines 3-jährigen Forschungsprojektes in Kooperation mit der Universität Münster, dem Staatsarchiv NRW (Abteilung Westfalen) sowie der Arnsberger Bezirksregierung, …..“
Spekulativ: Vielleicht zeigt das Bild den Vorsitzenden des Kreisausschusses (Landrat Bourwieg) ihm Kreise seiner Mitarbeiter: Bulk, Kerbelech, Steuber und Groos.
Bei Bulk könnte es sich um Karl Bulk (*9.1.1865) handeln, der beim Kreis vom 10.2.1888 bis zum 31.3.1930, zuletzt als Kreisausschusssekretär, beschäftigt war. Dies würde den Aufnahmezeitpunkt des Bildes zwischen 1923 (Groos) und 1930 eingrenzen.
Eine Personalakte der dann noch fehlenden Mitarbeiterin Kerbelech konnte nicht ermittelt werden.
Offenbar kommt nicht alles an, was abgeschickt wird.
Also noch einmal mein erster Kommentar, der sich unmittelbar auf Steuber bezog. Es lohnt ein Blick in die Adressbücher aus den Jahren vor und nach dem Ersten Weltkrieg. Dort wird Steuber mehrfach in seinen Funktionen erwähnt.
Lieber Herr Plaum,
da sind Sie im Spam-Filter hängengeblieben. Entschuldigen Sie die etwas späte Freischaltung. Nicht nur ein Blick in die Adressbücher lohnt sich, auch ein Blick in die im Kreisarchiv vorhandene Personalakte (2.14.1./103).
Um die Bildindentifikation zu erleichtern, füge ich ein Bild Steubers aus dem Siegerländer Heimatkalender von 1965 bei:
Zur Vorstellung des Projekts schreibt die Siegener Zeitung am 16.2.2017: “ ….. Das belebte Dorfarchiv in Elsoff stellte Georg Braun vor, dies soll ja in einem Nebengebäude der Michel-Mühle eingerichtet werden. Wie der gesamte alte Dorfkern steckt auch dieses Gebäude, um das Jahr 1770 herum errichtet, voll mit Geschichte, erläuterte Georg Braun. Hier sollen Originaldokumente über das Dorf ein festes Zuhause finden. Das Dorfarchiv könnte ebenso über LEADER gefördert werden. …..“ Link: http://www.siegener-zeitung.de/siegener-zeitung/Erstes-Projekt-kann-bereits-loslegen-4c49599f-c778-4843-af18-b76cc539ec2c-ds
Die Karten hat Guido Schneider für seinen Beitrag „Untergegangene Siedlungen in Wittgenstein“, in: Wittgenstein Bd. 61/1997/H. 2/S. 42-43, erstellt hat. Frdl. Hinweis von Guido Schneider in der geschlossenen Facebook-Gruppe „Wittgensteiner Heimatgeschicgte und Historische Fakten“, Link: https://www.facebook.com/groups/827252654052187/ .
Drei Bemerkungen zum Online-Artikel auf der Website http://www.stadtarchiv-siegen.de:
1) Die Hintergrundinfomationen zum Format gleich in der Einleitung hemmen den Lesefluss. Ich würde sie in eine separate Infobox verschieben
2) Die paralell statfindende Vitrinen-Präsentation im Lesesaal halte ich für eine sehr schöne Idee.
3) Warum findet sich der „detaillierte Bericht“ mit sämtlichen Bildern versteckt in einem PDF-Format und nicht gleich im Online-Artikel?
Zur Siedlungs- und Wüstungsgeschichte Wittgensteins weist die hier bereits, mehrfach vorgestellte Bibliographie des Wittgensteiner Heimatvereins auf folgende Literatur hin:
Bauer, Eberhard: Von untergegangenen Siedlungen im Berleburger Raum. Ein Bericht über die Dissertation von Klaus Deppe: „Methoden und Ergebnisse siedlungsgeografischer Forschungen im Wittgensteiner Land. Dargestellt an vier Wüstungen. Münster 1968, Wittgenstein. Blätter des Wittgensteiner Heimatvereins e. V. Bd. 33/1969/H. 2/S. 63-66
Benkert, Wilhelm: Wirtschaftsgeographische Verhältnisse, Volksdichte und Siedlungskunde der Ederkopf-Winterberg Plattform, Dissertation Marburg 1911, 89 Seiten
Bergmann, Rudolf: Die Wüstung Volpershusen bei Banfe, Heimatbuch Banfetal, S. 49-53
Böttger, Hermann: Grundfragen der frühen Besiedlung Wittgensteins und des Siegerlandes, in: Westfälische Forschungen, Band 8, Münster 1955, Seiten 198-205
Deppe, Klaus: Wüstungen der Gemarkung Berghausen, 800 Jahre Berghausen, Rückblick und Erinnerung 1973, S. 55-69
Deppe, Klaus: Die Wüstungen Schwarzenau und Dambach (Betr. Girkhausen) 750 Jahre Girkhausen 1970, S. 76-91
Dohle, Wilhelm: Von untergegangenen Orten (Wüstungen) im Raum der ehemals Mainzer Vogtei Elsoff, Wittgenstein. Blätter des Wittgensteiner Heimatvereins e. V. Bd. 23/1959/H. 3/S. 137-141
Dohle, Wilhelm: Von untergegangenen Wittgensteiner Siedlungen, Wittgensteiner Heimatbuch I 1965, S. 184-195
Hartnack, Wilhelm: Orts-Wüstungen Wittgensteins, Wittgenstein. Blätter des Wittgensteiner Heimatvereins e. V. Bd. 23/1959/H. 1/S. 13-28
Hinsberg, Georg: Raubritter, Wüstungen und Stadtmauern, Wittgensteiner Heimatbuch 1938/S. 34-38
Homrighausen, Klaus: Vom Wüstfallen bis zur Neubesiedlung Diedenshausens, Dorfbuch Diedenhausen 1997, S. 67-82
Homrighausen, Klaus: Die Neubesiedlung Wunderthausens nach 1500, Wunderthausen. Mehr als 700 Jahre bewegte Geschichte, 2006,, S. 26-43
Kätelhön(auch „Kaetelhoen“), Ernst: Zur Siedlungskunde des oberen Lahngebiets, Dissertation Marburg 1907, 82 Seiten
Laumann, Hartmut: Älteste Besiedlungsgeschichte Wittgensteins, Dorflesebuch 525 Jahre Birkelbach 1475-2000 S. 63-70
Pez, Hans: Die Wüstung Dornhof, Wittgensteiner Heimatbuch 1938 S. 66-69 (vgl. Saßmannshausen)
Radenbach, Hans Werner: Abriss der Siedlungsgeschichte des oberen Edertals, Wittgenstein. Blätter des Wittgensteiner Heimatvereins e. V. Bd. 57/1993/H. 2/S. 76-77
Thielicke, Eduard: Die Besiedlung Wittgensteins, Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Volkskunde Wittgensteins. Jg. 3/H. 1/S. 1-9
Vitt, Fritz: Aus der Siedlungsgeschichte Wittgensteins, Wittgensteiner Heimatbuch 1938 S. 19-23
Weitzel, Edith: Vor genau 500 Jahren gründeten mehrere Bürger aus Offdilln, Roßbach, Weidelbach und Ewersbach das Dorf Birkelbach bei Erndtebrück: Wiederbesiedlung einer Wüstung im Wittgensteiner Land, In: Heimat an Lahn und Dill, Bd. 333 (1997), S. 1, Ill., Zugl. „Hinterländer Anzeiger“ 158 (1997) Nr. 63 vom 15.3.1997, S. 29
Wied, Werner: Beiträge zur Gründung und früheren Geschichte der wittgensteinischen Siedlungen auf dem Rothaarkamm, Wittgenstein. Blätter des Wittgensteiner Heimatvereins e. V. Bd. 57/1993/H. 1/S. 2-16
Wied, Werner: Wüstungszeit-Niedergang-Neubesiedlung, Erndtebrück – ein Heimatbuch des oberen Edertals I, 1977/S. 135-145
vielen Dank für Ihr Feedback und Ihre konstruktiven Anregungen! Gerne greifen wir diese gegebenenfalls bei der Erarbeitung und Gestaltung zukünftiger Onlinetexte auf, müssen jedoch zu bedenken geben, dass wir als Dienststelle der städtischen Verwaltung an die redaktionellen Rahmenbedingungen der Öffentlichkeitsarbeit gebunden sind. Warum wir im Übrigen auch aus einem anderen Grund auf das PDF-Format zurückgreifen, erklärt sich durch die positive Resonanz vieler virtueller Archivgäste, die es offenbar schätzen, parallel Ausdrucke unserer „Klicks in die Vergangenheit“ für den privaten Gebrauch zu erstellen.
„Das Aktive Gedenkbuch für die Opfer des Nationalsozialismus im Kreis Siegen-Wittgenstein führt auch die im Kreisgebiete bis 1945 ermordeten bzw. verstorbenen Zwangsarbeiter auf.“:
leider nur einen Teil, viele fehlen noch. Die Arbeiten mussten unterbrochen werden.
Das Staatsarchiv in Wroclaw informiert mit Schreiben vom 13.02.2017 (Az:
OII.6344.117.2017), dass im Bestand „Höheres Bergamt in Wrocław (Oberbergamt zu Breslau)“ keine Informationen zu Karl Schmeisser gefunden wurden.
Lieber Herr Brachthäuser, die Idee zur historischen Aufarbeitung des Siegener Geschäftsleben finde ich sehr gut. Es wäre schön, wenn noch eine Dokumentation ehemaliger Siegener Verlage und Buchhandlungen folgen würde.
Hallo Herr Dickel,
eine sehr gute Idee, besten Dank für den Hinweis und Ihre freundliche Rückmeldung! Im Idealfall sollten solche Dokumentationen natürlich mit Primärquellen und Fotografien aus den Beständen des Stadtarchivs Siegen belegbar sein. Mal schauen, ob und was die Sammlungsbestände zu dem Thema hergeben…
Viele Grüße,
Christian Brachthäuser
Jens Bemme wünscht sich als Beitrag zur #siwiarchiv5 – wohl vor allem – von den regionalarchivischen Weblogs ein Blogparade zur Radfahrgeschichte: http://jensbemme.de/2017/01/meine-forschungsfragen/ . Vielen Dank für diese Idee!
Das historische Radfahrerwissen der regionalen Radfahrerbünde und lokalen Radfahrvereine vor 1933 bietet jede Menge Stoff für die Heimatforschung, Technik- und Mobilitätsgeschichte. Wie hießen all die Radfahrervereine, wie kooperierten sie vor Ort oder gab es vor allem Konkurrenz? Wer war wann dort Mitglied? Wann begannen wo auch die Frauen Rad zu fahren? Wie hießen die Publikationen und Protagonisten der Szene vor Ort und in den Ländern?
Wie das so ist mit Geburtstagen: Sie stehen im Kalender und dann vergisst man doch, pünktlich zu gratulieren! Hier ein leider verspäteter Beitrag des Bundesarchivs: https://blogweimar.hypotheses.org/283
In die Diskussion um das Verkehrskonzept für das Gelände um das Neunkirchener Rathaus floßen laut Siegener Zeitung vom 18.3.2017 auch Überlegungen zur Unterbringung des Gemeindearchivs ein: “ …. Eine damit verbundene Idee sei beispielsweise, das Bürgerbüro zurück in das Rathaus zu holen und auch für die Bibliothek neue Räumlichkeiten zu finden, vielleicht im Gebäude Kölner Straße 166. Dort könnte auch das Gemeindearchiv eine Heimat finden. …..“
Gerne komme ich der Bitte nach, in einem Blog-Kommentar an meine „Begegnung“ mit Jung-Stilling“ zu erinnern, die ich in meiner alten Wahlheimat Hückeswagen im Bergischen Land hatte. Da er etwas umfangreicher geworden ist, habe ich ihn auf meine Homepage gestellt. Hier der Link dazu. http://norbert-bangert.de/?p=44
Betr.: Suche nach bedeutender Persönlichkeit.
Eine weit über Deutschland bedeutsame Persönlichkeit war und ist auch heute noch in Bezug auf die demokratische Gesellschaftsform der
Jurist (Naturrechtler, Volkssouverenität), Theologe, Staatsphilosoph und Politikwissenschaftler
Johannes Althusius (1567 – 1638), geb. in Diedenshausen, Grafschaft Wittgenstein
Stimmt! Da gebe ich Ihnen recht, dass Johannes Althusius fehlt.
Mit Blick auf das 200jährige Kreisjubiläum habe ich Persönlichkeiten für die Aktion „20 Beste“ bevorzugt, deren Biographie in diesem Zeitraum begann bzw. endete. Es gibt, wie Sie sicher bemerkt haben, nur 2 Ausnahmen: Peter Paul Rubens, um ihn kommt man nicht herum, und Johannes Bonemilch, quasi meine Referenz an das Lutherjahr. Zudem hatte ich den Ehrgeiz alle Kommunen im Kreisgiet zu berücksichtigen. Auch galt es, wenn möglich, Frauen zu berücksichtigen.
Lieber Herr Wecker, Sie haben übrigens den 2.000 Kommentar auf siwiarchiv verfasst. Vielen herzlichen Dank dafür!
In der geschlossenen Facebook-Gruppe „Siegerland in alten und neuen Bilder“ schreibt Günter Dick dazu: „Ich glaube,daß ich die Frage nach dem Standort mit Hilfe von „Google-Earth“ beantworten konnte. Habe heute Frau Siewert informiert. Es ist die Hagener Str. mit Blick nach Süd kurz hinter Krombach in Richtung Eichen. Die rechte Werkhalle existiert nicht mehr, ist Parkplatz . Die linken Werkhallen sind heute das große Logistikcenter der Krombacher Brauerei. Die mäanderförmige Verlauf der Littfe am linken Bildrand kann man auch heute noch beim „google-Foto“ gut erkennen und mit Brücke und Zufahrtsweg schräg zur B 517 nachvollziehen. Geklärt werden sollte m.E. einmal was aus dem am unteren Bildrand noch sichtbaren Doppelgiebel-Fachwerkhaus, das offenbar links neben der heutigen Krombachhalle stand, geworden ist. ….“ Mit freundlicher Erlaubnis von Günter Dick! Vielen Dank dafür!
Die schnelle Einordnung des Fotos hat mich überrascht und gefreut. Aber: Bei näherer Betrachtung des Fotos mit den Hinweisen von Herrn Dick kann ich seiner Meinung nicht folgen. Folgende Gründe sprechen dagegen:
1. Wenn es sich um die von Herrn Dick vermutete Ansicht handeln würde, wäre in der Bildmitte links der Hauptstraße die Krombacher Mühle mit entsprechenden Anlagen wie Gräben und Mühlenteich zu sehen. Das ist nicht der Fall. Die Mühle wurde 1982 abgerissen.
2. Ebenso verhält es sich mit dem Industrie-/Bürogebäude rechts: Dick vermutet es an dem Standort des heutigen Parkplatzes gegenüber der Brauerei. Dies war aber bis in die 1980er Jahre der Standort des Gasthauses Krombacher Hof. Ein Industriegebäude stand dort nicht.
3. Für den vermuteten Blick von Krombach nach Eichen fehlt mir die Bebauung von Eichen im Hintergrund. Wenn die Aufnahme tatsächlich aus den 50er/60er Jahren stammen sollte, müssten auf der rechten Seite der Hauptstraße schon einzelne Gebäude gestanden haben.
4. Insgesamt erscheint mir das Tal zu breit und flach für das Littfetal.
Leider habe ich momentan auch keinen Vorschlag für eine Alternative. Blick von Krombach Richtung Eichen ist def. nicht richtig.
Ich habe ja geschrieben, daß ich glaube es gefunden zu haben. Glaube ist aber nicht Wissen ! Es ist ja erfreulich, daß es noch weitere Intressenten gibt, die sich um Aufkärung der Suchanfrage bemühen. Die Einwände von Herrn Panthöver sind nachvollziehbar, aber könnte es evtl. nicht sein, daß der Standort der Industriehalle (Pfeil) etwas weiter südlich gewesen ist. Dort verläuft auch etwas diagonal im Bild der Weg von Stendenbach bis auf die B 517. Die Brücke über den Bach (Littfe) und der topographische Verlauf des Baches könnten mit dem alten Foto doch eigentlich übereinstimmen. Wenn das aber ebenfalls verworfen wird, kann wohl etwas mit dem Vermerk -Littfeld- auf dem alten Firmengelände-Foto nicht stimmen.
Sehr geehrter Herr Dick, der Platz, den Sie nun mit dem Pfeil markiert haben, war der Standort der Krombacher Mühle. Auf dem Foto ist kein Mühlengebäude, kein Teich u.ä. zu sehen. Außerdem fehlt auf der rechten Straßenseite weiterhin jegliche Bebauung, die dort mit wenigstens einzelnen Häusern hätte vorhanden sein müssen.
Ich glaube, wir sollten uns gedanklich einmal in die weniger industrialisierten Täler des südlichen Siegerlandes begeben. Und: Es kann auch sein, dass das Bild Seitenverkehr wiedergegeben ist. Müsste man einmal spiegeln.
@ Herr Wolf: Wie kann ich hier Abbildungen einbinden? Ich wollte einen Kartenausschnitt hochladen.
Vielen Dank für die Hinweise und Gedanken zu dem Foto. Nach unseren bisherigen Recherchen und Rücksprachen mit Ortskundigen handelt es sich hier wohl gar nicht um Kreuztal.
Möglich ist, dass das Bild versehentlich in das Konvolut der Luftbilder beim damaligen Ankauf gelangt ist und einen ganz anderen Ort im Siegerland zeigt.
Das Bild habe ich mir jetzt mehrmals angesehen. Was mich wundert, ist dass ganz am rechten unteren Rand ein Berg(?), der sehr steil zu sein scheint, sichtbar ist.
Der ganze Rest des Geländes ist flach. Im Siegerland ist mir nicht eine einzige Stelle bekannt, an der man so weit ins Flachland schauen kann.
Ich vermute, dass es weder Kreuztal noch Krombach ist. Sogar irgendein anderer Ort im Siegerland ist meiner Ansicht nach mehr als nur fraglich.
Werte Frau Degenhardt, das ist kein steiler Berg, sondern da zweigt schräg nach rechts ein Weg mit Baumbestand ab. Das wird deutlicher, wenn man das Foto mit einem PC-Bildbearbeitungsprogramm entsprechend aufhellt. Selbst wenn es nun nicht die richtige Stelle sein sollte, die ich versuchte mit „Google-Earth“ zu finden , so sind die topographischen Gegegebenheiten an diesem Ort ( Wegekreuzung + Brücke und Bachverlauf ) zumindest sehr ähnlich. Über ältere Katasterpläne könnte sich ja hier das Kreuztaler Stadtarchiv rel. einfach Klarheit verschaffen, wenn man dort noch nicht mit einer ablehnenden Beurteilung ganz sicher sein sollte.
Werter Herr Panthöfer, wenn Sie das alte Foto vergrößern, sehen Sie hinter der Werkhalle noch vor dem Abzweig nach Stendenbach, mehrere alte Gebäude die durchaus die Mühle gewesen sein könnten. Aber ich vermisse eben auch hier einen Bachzulauf oder Teich, denn ohne Wasser lief da früher wohl nichts. Vielleicht war aber diese Wasserzufuhr um ca. 1958 (angen. Aufnahmedatum, – da in dem Jahr weitere Luftbilder von Gewerbeanlagen, vor allem auch in Siegen u. Weidenau, entstanden ) schon längst eingeebnet. Auf der rechten Straßenseite sind aber sehr wohl auch 2 Wohnhäuser erkennbar. Die Vergrößerung sende ich einmal an Herrn Wolf, da er hier nur die Bilder einstellen kann.
Sehr geehrter Herr Dick,
auch dieser Standort ist für die Krombacher Mühle nicht zutreffend. Schauen Sie sich einmal hist. Karten an. Es handelt sich hier meiner Meinung nach nicht um Krombach und das Littfetal.
Werter Herr Panthöfer, am 12.4. haben Sie aber geschrieben, daß an der von mir mit Pfeil gekennzeichneten Stelle die ehem. Krombacher Mühle (Abbruch 1982) gestanden haben soll und sie da auf der alten Luftbildaufnahme aber keine entsprechenden Gebäude erkennen könnten. Nach Aufhellung des Fotos lassen sich dort aber sehr wohl Gebäude erkennen auch entlang der linken und rechten Straßenseite.
Sehr geehrter Herr Dick, ich empfehle Ihnen, sich in die historischen Begenbenheiten vor Ort einzuarbeiten. Google earth kann nicht das Maß der Dinge sein. Wenn Sie sich einmal eine hist. Karte – die es auch im Internet unter geoportal.nrw. gibt – anschauen, werden Sie sehen, dass die Mühle an einer anderen Stelle stand. Ich möchte das hier nicht weiter ausführen, denn es führt in der Sache nicht weiter.
Nach meiner Meinung fehlt das mittlerweile verstorbene Künstlerpaar Bernd und Hilla Becher (https://de.wikipedia.org/wiki/Bernd_und_Hilla_Becher), deren Kunst in der Region verwurzelt war. Im Vergleich zur verhaltenen regionalen Wahrnehmung sind diese Künstler international hoch angesehen. Die internationale Fotokunst wurde durch dieses Paar nachhaltig beeinflusst. Warum sich unsere Region im Gegensatz hierzu so sehr mit Rubens identifiziert ist mir nicht klar. Antwerpen darf im Gegnsatz zu Siegen mit Recht behaupten mit dem Schaffen von Rubens in Verbindung gebracht zu werden. Rubens ist in Siegen nur unter unglücklichen Umständen zur Welt gekommen.
Vielen Dank für die Kritik, lieber Herr Welter! Es zeigt Ihr Interesse an dieser Mitmachaktion zum 200jährigen Kreisgeburtstag.
Bei der Auswahl der 20 besten Persönlichkeiten aus Siegen Wittgenstein wurden folgende Auswahlkriterien berücksichtigt:
1) die Anzahl von 20 Persönlichkeiten sollte nicht überschritten werden.
2) nach Möglichkeit sollten Frauen berücksichtigt werden. Mit nur drei Frauen habe ich allerdings eine annäherd paritätische Aufstellung leider sehr deutlich verfehlt.
3) Vielfältige Lebensbereiche sollten berücksichtigt werden (z. B. Kunst/Kultur, Wissenschaft, Forschung, Sport, Religion)
4) Die Persönlichkeiten sollten verstorben sein.
5) Die Persönlichkeiten sollten innerhalb der 200 Jahre gelebt haben. Durchbrochen wurde dieses Prinzip bei Peter Paul Rubens und Johannes Bonemilch.
6) Nach Möglichkeit sollten alle Ortschaften des Kreisgebiets berücksichtigt werden. Leider konnte fand sich niemand für die Gemeinde Neunkirchen.
Gerade die Beschränkung auf 20 Personen führt dazu, dass wichtige Personen nicht ausgewählt werden konnten. Dies war uns von Beginn an bewusst.
Zu Bernd und Hilla Becher ist zu sagen, dass die beiden zum meinem Leidwesen tatsächlich fehlen. Als bedeutender Vertreter der modernen Kunst aus dem Kreisgebiet wurde Otto Piene aus Bad Laasphe berücksichtigt. Johannes Althusius, dessen Fehlen ebenfalls bereits angemerkt wurde, lebte ebenso wie Graf Casimir zu Sayn-Wittgenstein Berleburg nicht in den 200 Jahren. Auch das Fehlen von Dieter Bogatzki wurde telefonisch bereits angemerkt. Als Vertreter für den Bereich Sport findet sich Artur Reichmann in der Liste.
Auf fehlende Persönlichkeiten kann gerne hier in den Kommentaren hingewiesen werden.
Die Siegener Zeitung (Print) meldet heute, dass der Kulturausschuss der Gemeinde Neunkirchen einstimmig dem Beschlussvorschlag der Verwaltung gefolgt ist. Ein neuer Anlauf beginnt also. Erfreulich!
Abstimmung zum 200-jährigen Kreisjubiläum:
Wer ist der berühmteste Siegen-Wittgensteiner / „Rechenkünstler und Meistermaler“ , Leserbrief des Deutschen Frauenring e.V. Ortsring Siegen, 28.4.2017:
Uns ist bei der Ausschreibung der Abstimmung über berühmte Siegerländerinnen und Sie-gerländer mit großer Verwunderung aufgefallen, dass der weibliche Anteil im Ausschrei-bungstitel völlig fehlt und dass es auch nur die geringe Anzahl von drei Siegerländerinnen gibt, die es anscheinend wert sind, in das Eliteverzeichnis aufgenommen zu werden. Hier stellt sich uns die Frage, welche Kriterien der Auswahl zugrunde gelegen haben, denn es hat durchaus noch weitere Frauen von Format mit historischer Bedeutung gegeben. Wir erinnern an Maria Rubens, die sich mit all ihrer Kraft und ihrem Vermögen für die Freilassung ihres Mannes eingesetzt hat (so dass P.P. Rubens dadurch überhaupt erst hier geboren werden konnte) oder an Juliane zu Stolberg-Wernigerode, die „Stammmutter Europas“, (160 Enkel und Urenkel), die sich engagiert für die medizinische Versorgung der Bevölkerung einsetzte. Erwähnen möchten wir auch die Pazifistin und Berufsschullehrerin Hedwig Heinzerling, die nicht nur die Volkshochschule Siegen gründete, sondern auch den Deutschen Frauenring in Siegen etablierte.
Weitere Namen herausragender Siegenerinnen finden sich in einer Schrift, die von der Uni-versität Siegen zu berühmten Frauen im Siegerland verfasst wurde. Zu diesem Thema gibt es auch eine Stadtführung der Gesellschaft für Stadtmarketing. Wir finden, es wäre durchaus denkbar gewesen, in der Ausschreibung mit gleichem Anteil 10 Frauen und 10 Männern zu präsentieren, gerade weil Frauen in früheren Jahren weniger Chancen zur Teilhabe an Bil-dungsangeboten hatten.
Weiterhin weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass in allen öffentlichen Bereichen die weibli-che Form in Titeln und Anreden, besser noch in jeglichen Texten, mit bedacht werden sollte. Auch im 21. Jahrhundert ist es noch wichtig, dass Mädchen und Frauen sich angesprochen und akzeptiert fühlen und dass sie weibliche Modelle kennen lernen, an denen sie sich orien-tieren und die sie als Vorbild zu eigenem Engagement nutzen können.
Mit freundlichen Grüßen
Gabriele Fleschenberg / Vorstandsvorsitzende
Hildegard David / Öffentlichkeitsarbeit
Im Sept / Okt 1877 wanderte ein Hermann WEIRICH, *1837, katholisch, samt Frau Maria Schneck u. Sohn Johann nach Süd-Brasilien aus. Die Familie soll aus Siegen, Westfalen, stammen. Sie waren Passagiere des englischen Dampfers Copernicus. Weitere Passagieren waren Personen bzw. Familien mit Nachnamen Neise (oder Weise), Bier, Wamann, Flian (?) u. Marchand.
Ab 1887 waren die Familien Buchholz, Pulverfabrikanten aus Krommenohl (heute eingemeindet nach Marienheide) Besitzer der Germania Brauerei in Wissen Sieg.
Carl Adolf August Schmeisser (geb. 1855-1924 in Siegen) war mit Emil Peters Schwester Eugenie verheiratet, im Aufsichtsrat der Brauerei ab 1910 seine Frau b.z.w. Herr Berghauptmann Schmeiser (Breslau) als Vertreter bis 1922 und ab 1922, Dr. Kurt Schmeisser (1889-1958) ihr gemeinsamer Sohn,
welcher bis 1958 im Aufsichtsrat war.
Zu den Personen Karl Born und Alfred Dörner haben wir bisher keine Informationen. Sind die beiden Namen jemanden bekannt?
Über weitere Angaben würden wir uns freuen.
Danke.
Torsten Thomas
Alfred Dörner (1902-1992) war der christliche Ehemann von Ilse Dörner (1904-1982) geb. Jacobi, deren Eltern Sigismund Jacobi und Klara geb. Sternheim am 27.07.1942 nach Theresienstadt deportiert und am 21.07.1943 bzw. am 05.12.1942 ermordet wurden.
Im Sterberegister Arfeld ist der am 25.06.1830 am Nervenfieber verstorbene Christ Georg Knebel als „Einwohner und Schlosser-Meister im Zoden-Haus“ aufgeführt.
Hier der Eintrag in der Namenliste zum Enkel des Gesuchten:
@siwiarchiv Danke. Habe jetzt den Rest des Dokuments, da kommt ein Sohn vor, der lesbar "Schlosser" ist, und dann ein Enkel, der wieder …???… ist… pic.twitter.com/z6wn4GxYyM
Die alte Berufsbezeichnung für Buchhalter war noch in der 2. Hälfte 19 Jahrh. „Casierer“. Könnte das evtl. hier passen ??? MIr ist diese Bezeichnung bei meinen Recherchen zu Jan Livien van der Haegen,-Kreuztal (1839 -1913) aufgefallen.
Ich denke, A. Sassmannshausen hat den Nagel auf den Kopf getroffen. „Ackerer“, klar, wenn man’s mal weiß, ist es eigentlich nachvollziehbar. Ich war von dem „k“ fehlgeleitet.
Danke an alle Miträtsler, mein Bekannter freut sich sehr über die Hilfe.
Ein niedersächsischer Archivkollege weist in der geschlossenen Facebook-Gruppe „Archivfragen“ darauf hin, dass sowohl der Sterbebucheintrag Christ. Knebels vom 25.6.1830 als auch dessen Traubucheintrag vom 20.12.1815 (bei in der Evangelischen Kirche Arfeld) via ancestry.com online eingesehen werden können.
In der Gruppe gab es auch den Hinweis auf die Lesart „Actuar“ …..
Danke. Ich denke, das k ist wirklich ein k, wenn man sieht, wie das große K bei Knebel geschrieben ist, ist das analog zum kleinen k in Ackerer – dieses Etwas neben dem Buchstaban ist wohl eben kein i-Strich (wie zunächst geglaubt) noch ein u-Strich, sondern das Kennzeichen des Schreibers für ein k – genau wie beim großen K.
Danke für den Hinweis!
Nachreichen möchte ich noch die Quellenangabe zum abgebildeten Zeitungsartikel auf der Facebookseite der VVN:
Westfalen Post vom 9.5.1947
Torsten Thomas
Kommentar Günter Dick, St. Augustin via Facebook , 12.5.2017 [Danke für die Erlaubnis dies hier zu posten!]:
Das Bild wurde im vorzüglichen Bildband „Siegen vor und nach der Zerstörung“ auf Seite 58 von den Herausgeber- Autoren mitveröffentlicht.
Die Ortsbeschreibung ist hier aber leider nicht richtig wiedergegeben worden.
Es handelt sich hier keinesfalls um die Eisenbahnbrücke und dem dahinter liegenden Stadtbad , sondern um die im März 1945 beim Rückzug der „ Wehrmacht“ gesprengte sog. „Weiße Brücke“, die vom Ende der heutigen Bismarckstr. ins Charlottental führte.
Die gemauerte Steinbrücke hatte ganz besondere Konstruktionsmerkmale, die Martin Schulz sehr genau wiedergegeben hat. Das links im Vordergrund stehende dunkle Gebäude ist heute noch dort vorhanden. Ebenso kann der Sichtstandort noch sehr genau lokalisiert werden allein durch das im Vordergrund in der Wiese damals noch vorhandene Schütz für den ehem. Obergraben zur Sieghütte und dem angedeuteten Siegwehr beim Waldhaus.
Das Gemälde ist so hervorragend, daß man beim genauen Betrachten die Silhouette der Nikolaikirche selbst mit Krönchen und dem Oberen Schloß im Meer der Flammen angedeutet noch erkennen kann.
Entgegen der Beschreibung sollte es wohl auch jedem Betrachter einleuchtend sein, daß Martin Schulz ein solch hervorragendes Aquarell, selbst bei einem feuerleuchtendem Himmel, nicht am 16.12.1944 vor Ort, bis in die späten Abendstunden hinein, hat fertigstellen können.
Eine offizielle Berichtigung hielten aber leider weder der Herausgeber ( SHGV ) noch die Regionalpresse SZ und WP für notwendig, bzw. für sinnvoll. Sicher sind das ja auch nur „Peanuts“, die aber leider später drohen den nachfolgenden Generationen als unumstößliche „akademische Historiker-Weisheiten“ überliefert zu werden .
Dieser Bildband ( Herausgeber Siegerländer Heimat-u.Geschichtsverein e.V.) kann man übrigens vorbehaltlos jedem nur sehr empfehlen. Die vielen beeindruckenden historisch wertvollen Dia-Fotos von Erich Koch-Siegen (1914-1986), zeigen jedem überdeutlich ….. wohin politische Überheblichkeit und Massenverdummung unweigerlich hinführt.
Da wir uns bereits im Zusammenhang mit einen kurzfristigen Publikationsprojekt die gleiche Frage gestellt haben, habe ich die Frage an den Heimatbund als Ausrichter der angekündigten Veranstaltung gerne weitergeleitet.
Wenn man wüßte, worauf Herr Burwitz hinaus will …
Ist denn das „Siegerländer [!] Kartoffelbrot“ nicht identisch mit dem gemeinen europäischen Kartoffelbrot, das lange vor 1816 „erfunden“ worden war?
Top, lieber Herr Kunzmann, natürlich, das gemeine europäische Kartoffelbrot wurde schon viel früher ‚erfunden‘. Aber das Artikelchen suggeriert doch, dass das „Siegerländer“ Kartoffelbrot, das echte, vulgo „Riewekooche“ in der Hungerkrise vor 200 Jahren geboren wurde. Also, welcher Gontermann. Harr, Müncker oder Flender oder auch Frau gleichen Namens hat das Wunderwerk zuerst gebacken?
Wenn man nur wüsste …
„Ungeliebte Kartoffel“? Im Zeitungsbericht von Bürgermeister Trainer für November 1816 kann nachgelesen werden, „bis auf diesen Tag sind nur allein in hiesiger Stadt 2961 Karren Cartoffeln eingebracht worden“. Da müssen ziemlich viel ungeliebte Kartoffelfelder bestellt worden sein, in einem Jahr, in dem fast nichts gewachsen ist und Anfang November aufgrund der Witterung noch immer „Cartoffeln im Felde stehen“.
Wenn man nur wüsste …
„Wir können uns heute gar nicht mehr vorstellen, wie die Menschen damals gelebt haben“, sagt der Vorsitzende des Heimatbundes und lädt ein, die Zeit vor rund 200 Jahren wieder lebendig werden zu lassen.
„Wenn man nur wüsste“ …
Fragen über Fragen.
… Und die Fragen nehmen kein Ende. Waren die witterungsbedingt unreif geernteten Kartoffeln denn überhaupt zum Backen geeignet oder meist nur als Viehfutter brauchbar? Zu klären wäre auch, ob in den 1816/17 im Siegerland bewährten Notrezepten für Ersatzbrote ausdrücklich von „Kartoffeln“ die Rede war oder ob Synonyme verwendet wurden, die ebenso gut oder noch wahrscheinlicher auf die Topinambur hindeuten (Erdbirne, Erdapfel u.a.). Die Terminologie der beiden Nutzpflanzen ist ja alles andere als eindeutig. Topinambur-Brot war nun allerdings auch keine Siegerländer Erfindung und ist ebenfalls schon vor 1816 belegt. Eine auf soliden Quellen basierende Kulturgeschichte des „Riewekooche“ darf mit Spannung erwartet werden.
Wenn die Siegener FeministInnen auf eine Formalie „ausdrücklich hinweisen“, sollte ihnen doch wenigstens auffallen, dass sie drei Sätze vorher selbst gegen ihre Forderung verstoßen haben: Oder hatte Juliane zu Stolberg-Wernigerode etwa nur männliche Enkel und Urenkel, aber keine Enkelinnen und Urenkelinnen? Aufschlussreich ist auch, dass die emanzipierten Damen anscheinend Gebärfreudigkeit für ein Kriterium weiblicher Größe halten. Gern würde man(n) die Frauen ja besser verstehen, aber sie machen es einem nicht immer leicht …
Wenn Juliane zu Stolberg-Wernigerode nur im Jubiläumszeitraum geboren worden wäre, dann wäre sie sicher auf meiner ersten Auswahlliste gelandet. Allerdings hätte ich „Bauchschmerzen“ wegen der „Gebärfähigkeit“ gehabt. Kirstin Bromberg weist aber auf pädagogische Verdienste (u. a. Beteiligung an der Leitung von Stift Keppel), auf die Unterstützung des niederländischen Freiheitskampfes und auf naturmedizinischen Kenntisse, die wohl auf freizügig weitergab, hin (in: Frauenrat der Universität-Gesamthochschule Siegen (Hrsg): Auf den Spuren der Siegerinnen. Materialien zu einem Stadtrundgang „Frauen in der Geschichte Siegens“, Band I Frauen im Siegerland, Siegen1996, S. 6-8).
“ …. Die Abstimmung über den „Größten“ Siegen-Wittgensteiner ging am 19. Mai zu Ende. Unten finden Sie das Ergebnis. Welche Namen sich hinter den Fragezeichen der ersten drei Plätze befinden, wird am Samstag, 8. Juli 2017, im Rahmen des „Tags der offenen Tür“ im Kreishaus bekannt gegeben:
Platz 1:
44% – ???
Platz 2:
33.7% – ???
Platz 3:
6.8% – ???
Platz 4: 4.1% – Adolph Diesterweg
Platz 5: 3.9% – Ernst Menne
Platz 6: 3.1% – Peter Paul Rubens
Platz 7: 1.3% – Wilhelm Münker
Platz 8: 0.4% – Carl Kraemer “
Quelle: Kreis Siegen-Wittgenstein, Aktionsseite
Die Liste der deutschen Archive auf der Internetseite der Archivschule Marburg ist inzwischen ersetzt worden durch einen Link auf das Archivportal D. Damit geraten alle früher gelisteten Archive, die noch nicht im Archivportal D vertreten sind, leider aus dem Fokus.
Über die Integration der Daten des Ardey-Archivverzeichnisses sollte die Übersicht von Archiven in Deutschland im Archivportal-D aber weitgehend vollständig sein; nachgewiesen sind über 2.500 Einrichtungen. Falls Archive fehlen, wären wir für einen Hinweis dankbar.
Wie so oft ist eine ungenaue Fragestellung nicht hilfreich. Portale können eine Google-Websuche im Einzelfall ergänzen, wenn es nicht einmal eine Visitenkarte zum Archiv im Netz gibt. Ansonsten gibt es allenfalls regionalen Ersatz für das Minerva-Handbuch von 1974, Auszüge: https://books.google.de/books?id=pgDnBQAAQBAJ
Eine Retrodigitalisierung dieser und anderer Literatur über Archive wäre wünschenswert. Das Konzept Linked Open Data scheitert derzeit an der erbärmlichen Einstellung vieler auch großer Archive, für die Permalinks nicht relevant sind.
Es muss darauf ankommen, zentral möglichst viele aussagekräftige dezentrale Daten zu Archiven verfügbar zu machen.
Die BEACON-Technologie leistet im Prinzip die gewünschte Verknüpfung dezentraler Informationen über eine Schlüsselnummer (mit zugehörigem Normdatensatz).
Internationaler als die GND ist natürlich Wikidata:
Lieber Kollege Dr. Graf, nun will ich ein wenig mehr auf die Vorgeschichte des von Ihnen als „merkwürdig“ bezeichneten Eintrages eingehen. Vielleicht wird dann die Zielrichtung etwas klarer. Das von mir erwähnte Gespräch hatte eigentlich einen ganz anderen Zweck, nämlich die Organisation einer hier auch regelmäßig beworbenen Veranstaltung des Kreisarchivs. Im Laufe des Gesprächs wurde gesagt, dass es ja schwierig sei. Informationen über Archive zu recherchieren. Ich hatte den Eindruck, dass die google-Suchen wenig erfolgreich waren. Zur Beantwortung dieser sehr allgemeinen Frage kam ich auf die Idee, die derzeit vorhandene Portalstruktur in Deutschland (und Europa) möglichst knapp vorzustellen.
In 2 geschlossenen Facebook-Gruppen, die sich der Geschichte der beiden Altkreise Siegen und Wittgenstein widmen, habe [ich] diesen Eintrag geteilt und auch um Kritik /Anregungen gebeten. Bis jetzt liegen dort nur 2 positive Reaktion vor. Ein weitere Mal wurde der Facebook-Eintrag geteilt.
Es wäre m. E. kontraproduktiv, da offensichtlich die gegebene Information ausreicht, in diesem Zusammenhang die von Ihnen angesprochenen, wünschenswerten Verbesserungen der Portale gleich mit anzusprechen. Gleiches gilt auch für die Retrodigitalisierung der einschlägigen Literatur.
Meiner Meinung nach ist es nicht die Aufgabe von siwiarchiv, sich an der deutschen Archivportallandschaft abzuarbeiten. Wenn dieser Eintrag aber dazu einen Beitrag leistet, dann um so besser.
Hoppla, da stolpert man nicht nur über die eigenwillige Grammatik, da stößt auch der Inhalt auf: „2 geschlossene Facebook-Gruppen, die sich der Geschichte der beiden Altkreise Siegen und Wittgenstein widmen“. Was sind das denn für Geheimbünde? Elite-Historiker, deren kostbaren Früchte der Erkenntnis dem Plebs der Zunft verwehrt bleiben sollen? Oder eine Art Siwi-Ku-Klux-Klan, der alle Einsichten wissenschaftlichen Tuns in geheimen Sitzungen massakriert? Wo und wann wird der Schleier dieses Mysteriums gelüftet?
Danke für den Korrekturhinweis, da ist mir wohl ein Wort abhanden gekommen! Nein, bei den Facebook-Gruppen handelt es sich nicht um Geheimbünde. Jede/r auf Facebook-Angemeldete kann dort beitreten. Bei den Mitgliedern handelt es sich im weitesten Sinne um an der Geschichte der jeweiligen Region Interessierte.
Das ist schon interessant und doch eingeschränkt durch die Voraussetzung bei facebook gemeldet zu sein.
Wie kann sich jemand, der – aus welchen Gründen auch immer – nicht bei facebook ist, sich bei den beiden Gruppen sinnvoll einbringen? Gibt es noch andere, (mehr) sinnvolle Zugänge?
Es ist tatsächlich leider so, dass man bei Facebook (FB) angemeldet sein muss, um bei FB „mitzumischen“. Eine andere Möglichkeit, gerade an geschlossenen FB-Gruppen teilzunehmen, ist mir nicht bekannt. Dies gilt auch für alle übrigen Netzwerke: Das Nutzen geschlossener Bereiche ist nur bei Anmeldung möglich …..
Um im Web 2.0 sichtbar zu sein, halte ich ein öffentliches Blog für die beste Möglichkeit: um
a) Erfahrungen zu sammeln und
b) die Möglichkeit zu eröffen, in anderen sozialen Netzwerken sichtbar zu werden, ohne dort angemeldet zu sein.
M.W. erlauben es die gängigen Blogplattformen, dass die einzelenen Einträge in die Netzwerke durch die Leserschaft geteilt werden können. siwiarchiv erlaubt derzeit das Teilen der Einträge in Facebook, Twitter und in google+.
Ich bleibe bei meiner Kritik. Es ist völlig daneben allgemein von „Informationen über Archive“ zu sprechen, ohne zu sagen, was das denn für Informationen sein sollen. Und dass erbärmlich viele Archive keine anständige Website besitzen, daran ändert auch der Hinweis auf Portale nichts.
Lieber Kollege Graf, schade, dass die weitere Information Ihnen offensichtlich nicht genügt. Ich bin nicht auf den berechtigten Hinweis der fehlenden Archivwebseiten eingegangen, da ich den Eindruck habe, dass die meisten öffentlichen Archive, die in den Portalen vertreten sind, auch über einige Webseiten verfügen bzw. über die Webseiten ihrer Trägerinstitution zu erreichen sind.
Für Hessen und Niedersachsen würde ich noch die jeweilige Arcinsys-Instanz (https://arcinsys.hessen.de/ und https://www.arcinsys.niedersachsen.de) ergänzen.
Auch bei Archiven, die keine Bestände in Arcinsys verzeichnet haben, sind oft allgemeine Informationen hinterlegt. Arcinsys Niedersachsen hat das frühere Archivportal Niedersachsen ersetzt.
Demnächst wird wohl auch Arcinsys Schleswig-Holstein zu ergänzen sein.
Dankeschön für den Artikel:“ Adolf Achenbach (1825 – 1903) – Im Schatten des Bruders“
Aus Siegerländer Sicht kann man dieser Auffassung sein. Hört man sich dagegen in Clausthal-Zellerfeld um, sieht der Vergleich schon ganz anders aus. Achenbach hat sich um den Harzer Bergbau und die Oberharzer Wasserwirtschaft sehr verdient gemacht. Er sorgte nicht nur für den Fortbestand des Bergbaus in der Region sondern auch für das Weiterleben der Berakademie Clausthal, denn bereits 1879 war die Schließung vom Preußischen Landtag beantragt worden. Hiebei half ihm jedoch sein Bruder Dr. Heinrich Achenbach. 1900 wurde ihm der Titel ‚Wirklich Geheimer Rat‘ verliehen mit dem Prädikakat ‚Exzellenz‘.
Geboren wurde Adolph Achenbach aber schon am 25. Januar 1825 in Saarbrücken!
Vielen Dank für die freundliche Reaktion! In der Tat lohnt sich vielleicht auch ein intensiverer Blick auf Adolf Achenbach. Der verlinkte Wikipedia-Eintrag und der ebenfalls verlinkte Artikel im Portal „Rheinische Geschichte“ geben ja Hinweise auf weitere online verfügbare Quellen und gedruckte Literatur.
Irles Siegerländer Persönlichkeitenlexikon (Siegen 1974, S. 14) weist nur zwei Zeitungsartikel zu Adolf Achenbach aus: Rhein-Zeitung v. 7.6.1961 und Westfälische Rundschau v. 22.7.1961. Aber das Siegener Stadtarchiv verwahrt den Nachlass seines Bruders Heinrich. In diesem Nachlass befinden Briefwechsel (?) zwischen Heinrich und Adolf Achenbach.
Es ist überhaupt fraglich, ob das Jung-Stilling-Bild, das im Rathaussaal hing, wirklich Jung-Stilling darstellt.
Soviel mir bekannt ist, hat Jung-Stilling nur ein einziges Porträt von ihm als übereinstimmend mit seinem tatsächlichen Aussehen anerkannt, und das ist das Bild von Lips aus dem Jahr 1801. Es ist in der Biographie von Professor Merk (in der 4. Auflage auf S. 53) wiedergegeben.
Anlässlich des Historischen Marktes auf der Ginsburg am vergangenen Pfingstfest hat der Heimatbund Siegerland-Wittgenstein Broschüre zu den „Duffeln“ erstellt, die neben regionalen Kartoffelrezepten auch folgende
“ … Geschichte der Kartoffel in unserer Region“ enthält: „Nach der Entdeckung Amerikas um 1500 brachten die Spanier als erste die Pflanze von Peru und Chile mit nach Europa. Sie bezeichneten sie als „Trüffeln der Inkas“.
Johannes Matthäus (1563-1621), bis 1621 Professor der Arzneikunde in Herborn, pflanzte die erste Kartoffel, die er um 1615 aus England erhielt, in der Grafschaft Nassau. Er betrachtete sie als Zierpflanze und stellte sie in einem großen Blumentopf zur Schau vor das Fenster.
Johann Heinrich Jung-Stillung aus Grund berichtete in „Der Volkslehrer“ von 1784, dass seine Großeltern um 1716 etliche Kartoffeln von Wieder-täufern erhalten haben, vermutlich aus Lohe bei Kredenbach.
In Wittgenstein wurden 1726 zum ersten Mal Kartoffeln im Feld angebaut. 1765 und 1771 haben zehntpflichtige Bauern in Richstein und Winges-hausen Kartoffeln an den Grafen abgeliefert. Davon wurden auch etwa 50 – 60 Scheffel an das Kloster Grafschaft verkauft.
Friedrich der Große war es Mitte des 18. Jahrhunderts, der die Kartoffel in Preußen zum Volksnahrungsmittel machte. Damit begann der Siegeszug der Kartoffel auch in unserer Region. Dies könnte zumindest der Ursprung des Reibekuchenbrotes sein, das aus Frankreich vielleicht bedingt durch die Truppenbewegungen von Napoleon nach Nassau und somit in das Siegerland kam.
Im März 1805 wurde vorgeschlagen, die Keime der Kartoffel auszu-schneiden und diese als Setzkartoffel zu benutzen.
Durch einen Vulkanausbruch im April 1815 wurde eine globale Klimaver-änderung in Nordamerika und Europa hervorgerufen. Es kam zu Missernten und einer schlimmen Hungersnot. Wahrscheinlich ist es, dass in den darauf folgenden Hungerjahren 1816/17 die Kartoffel zum Hauptnahrungsmittel wurde und deshalb auch Reibekuchen gebacken und vielfältige andere Rezepte mit Kartoffeln ausprobiert wurden. ….“
Und inwiefern hilft die Fleißarbeit der Heimatbündler nun Herrn Burwitz bei seiner eingangs aufgeworfenen Suchanfrage nach der Quelle weiter?
Bei Jung-Stilling hätte man noch mehr finden können als den aus dem Zusammenhang gerissenen (und wohl nur irgendwo in der Sekundärliteratur aufgeschnappten) Hinweis auf die Wiedertäufer. Im „Volkslehrer“ (1784, 8. Stück, Seiten 484-500) widmete er sich ausführlich diesem Gemüse. (Zu dessen Anbau durch seine Großeltern ab 1716 siehe dort S. 486.) Auf der letzten Seite (500) empfahl er die Kartoffel dann auch zum Brotbacken.
Ergänzend läßt sich ein ganzseitiger Beitrag zur „Bereitung des Mehles von Kartoffeln“ in den Dillenburgischen Intelligenz-Nachrichten, 41. Stück vom 16.10.1790, Sp. 663-664 anführen.
Ob der Heimatbund etwas für „wahrscheinlich“ hält, ist irrelevant, solange er dafür keine Begründung gibt. (Oder kommt die nach den drei Pünktchen noch?) Die hier aufgeworfene Frage nach Quellenbelegen für die Kartoffelnutzung 1816/17 in den Kreisen Siegen und Wittgenstein bleibt trotz der Publikation des Heimatbundes aktuell.
In Dieter Pfaus „Kreisgründungen Siegen & Wittgenstein. 1816-17 im Jahr ohne Sommer“, Siegen 2017 – Herausgeber ist übrigens der Heimatbund Siegerland-Wittgenstein -, verweist auf S. 10-11 auf das Kartoffelbrotpatent des Fürsten Friedrich Carl zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, bestätigt von der Regierung in Arnsberg am 14. Oktober 1817.
Das Patent ermöglichte die Verringerung der Herstellungskosten von Kartoffelbrot.
In Dieter Wessinghages „Die Hohe Schule zu Herborn und ihre Medizinische Fakultät 1584-1817-1984, Stuttgart 1984, findet sich auf S. 35 (Eintrag zu Johannes Matthaeus) folgendes: “ …. Die Westerwaldbauern begannen erst um 1730 mit dem Anbau dieser aus der Neuen Welt stammenden Pflanze [Anm.: Gemeint ist die Kartoffel]. So kam es, daß seinerzeit die Knolle höchstens auf den Tisch der Adligen kam. ….“
Fazit: Eine Forschungsarbeit in den Adelsarchiven (Nassau-Siegen, Oranien-Nassau, Sayn-Wittgenstein-Berleburg, Sayn-Wittgenstein-Hohenstein) scheint zur Klärung der aufgeworfenen Frage wohl unumgänglich.
Wo ist denn besagte Schrift zu den Kreisgründungen zu erhalten? Emsiges Googeln erbringt nur den Hinweis auf den abgelaufenen ‚Historischen Markt‘ auf der Ginsburg. Kann der am Jahr ohne Sommer 1816 (!) Interessierte die Schrift auch ohne Ginsburg-Besuch erwerben? Warum hat siwiarchiv uns das Werk vorenthalten?
1) Erhältlich wird diese Schrift bei der Geschäftsstelle des Heimatbundes Siegerland-Wittgenstein sein.
1a) Wenn ich es recht sehe, wird das Stadtarchiv Siegen ein Belegexemplar erhalten.
1b) Spätestens im Rahmen des Schriftentauschs wird es allen Archiven im Kreisgebiet bei unserer nächsten Arbeitskreissitzung zugänglich gemacht.
2) „siwiarchiv“ kann leider nicht alles ….. Die Vorstellung der Schrift war für heute vorgesehen gewesen. In Anbetracht der Diskussion um das Kartoffelbrot erschien mir der Hinweis allerdings angezeigt.
Aus den Lebenserinnerungen des Siegener Landrentmeisters Johann Adolf Schenck:
„Das Jahr 1816 war im Allgemeinen ein trauriges Jahr, denn es regnete unaufhörlich, alle Flüsse, Rhein, Main, Mosel, Lahn und Sieg überschritten nicht selten ihre Ufer. Die Ernte der Frucht und besonders der Kartoffeln war so gering, daß sie kaum das tägliche Bedürfnis bis Ende 1816 liefern konnte. Im Monat November wurde noch Frucht, Hafer und Roggen vom Felde gefahren, es war aber keine Frucht mehr, sondern nur Stroh und dies zum Theil schon verfault. […] An meinem Tische aß man nur Schwarzbrod, das wir mit dem Mehl der Erbsen, Dicken Bohnen und Linsen vermischen und backen ließen.“
(Siegerländer Heimatkalender1932, S. 61. Ich spare mir ausnahmsweise die kompletten bibliographischen Angaben.)
Vielleicht könnten die Vertreter der Kartoffelbrot-Jubiläums-Theorie doch endlich , wie es hier vor fast vier Wochen ernsthaft erbeten wurde, Quellen für die angebliche „Erfindung“ des heute beliebten und beim Bäcker erhältlichen Siegerländer Kartoffelbrotes vor exakt 200 Jahren offenlegen – oder aber sich anderenfalls dazu bekennen, dass ihnen die historischen Fakten eigentlich egal sind und sie nur einen Anlass zum Feiern gesucht haben. Geschichtsklitterung ist nicht verboten, aber man sollte dann wenigstens zu ihr stehen und die Phantasieprodukte nicht noch gedruckt für die Nachwelt konservieren.
Meine Herren Archivar und Kunzmann, nutzen Sie doch bitte den im deutschen Sprachraum üblichen Begriff Täufer anstelle von Wiedertäufer. Oder beziehen Sie damit irgendeine Position? Folgen Sie Reformatoren oder Reformatorinnen des 16. Jahrhunderts? Oder übersetzten Sie nur Anabaptists aus dem Englischen?
Tut mir leid, ich wollte Ihre Gefühle nicht verletzen. „Wiedertäufer“ steht wörtlich in dem erwähnten und 1784 im deutschen Sprachraum erschienenen Text von Jung-Stilling. Wenn ich mal wieder in die Verlegenheit komme, den Begriff zu zitieren, setze ich ihn in Gänsefüßchen und füge eine Fußnote mit der politisch korrekten Version hinzu. Die müßte dann natürlich lauten „Täuferinnen und Täufer“, sonst beschweren sich anschließend wieder die Frauenfunktionärinnen.
Lieber Herr Plaum,
1) vielen Dank für den Hinweis!
2) Es handelt sich lediglich um ein Zitat aus der Broschüre des Heimatbundes, und von daher nicht um meinen Sprachgebrauch.
Im gestrigen Vortrag zur Geschichte des (Alt-)Kreises Siegen wies Bernd Plaum u. a. auf die erfolgreiche Beteiligung des Kreises Siegen-Wittgenstein an der „Zukunftsinitiative Montanregion“ des Landes Nordrhein-Westfalen im Jahr 1987 hin. Dies ist sicher in der Chronik zu ergänzen.
Weitere Hinweise zum frühen Radsport im Siegerland:
1) 1894 Erstes Radrennen zur Kronprinzeneiche vom Hilchenbacher Radfahrerclub „Glück auf 1888“ (Quelle: Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein, Bestand 5.4. (Kreiszeitleiste) Nr. 619)
2) Walter Klein (geb. 1905) betrieb in Siegens Welterstraße eine Möbelherstellung mit Innenausbau. Von Jugend auf huldigte er dem Radrennsport als Kunstradfahrer. Er war langjähriger Vorsitzender des Radfahrvereins „Über Berg und Tal“ 1898 Siegen und über 20 Jahre Mitglied im Bund Deutscher Radfahrer. Nach dem 2. Weltkrieg diente er bis 1952 als Bezirksrennfahrwart und Bezirkskunstfahrwart sowie lange Zeit als Bezirksvorsitzender. Er organisierte eine internationale Etappenfahrt Wiesbaden-Siegen-Wiesbaden und war Mitglied der Ehrengilde im BDR und lange Zeit auch in der Ehrengilde.
Quelle: Siegerländer Heimatkalender 1990, S.34
3) Mit „Dünnwällersch“ Otto (Otto Karl Jakob) hat Burbach eines seiner letzten Originale verloren. Bei keinem Fest, bei keiner Feier fehlte der älteste Feuerwehrmann der Großgemeinde. Auch sportlich sorgte er für Schlagzeilen. 1919 begann er seine aktive Laufbahn im Radfahrverein „Burbach 1910“. Seit über 50 Jahren stand er der Waldgenossenschaft Eichener Hauberg vor, im Löschzug Burbach war er 76 Jahre Mitglied. Besonders stolz war Onkel Otto über seine historische Uniform mit Pickelhaube, die er noch mit 90 Jahren beim Maibaumfest trug.
Quelle: Siegerländer Heimatkalender 1995,S.36
Das sind wertvolle Hinweise, danke! Gleich noch als Ergänzungen hier die direkten Links der Einzelseiten des Jahrbuchs der dt. Radfahrer-Vereine 1897 in Wikisource, wo die Korrektur der Volltexterkennung möglich ist. Unterstützung ist dabei willkommen.
Sehr geehrte Damen und Herren!
Herzlichen Dank für Ihre gute Arbeit.
Bei dem Papiermüller Johann Henrich NEUSER, *08.03.1772 Rudersdorf ,
handelt es sich um einen direkten Vorfahren von mir.
Er war verheiratet mit M.Elisabeth Schneider, die am 25.10.1824 verstarb.
Im Dez 1824 gab J.Henrich Neuser in der Frankfurter Ober-Post-Amts-Zeitung
eine Suchanzeige zu seinem Sohn auf , der die Papiermühle übernehmen sollte.
Zu finden unter:
———
Frankfurter Ober-Post-Amts-Zeitung: 1825,1/6 https://books.google.de/books?id=RYhDAAAAcAAJ
1825
(245), Johannes Neuser von Rudersdorf, im Königlich Preußischen Kreise Siegen, Regierungsbezirk Arnsberg ist im August 1822 als Papiermacher-Gesell auf …
———-
Es würde mich interessieren, aus welchen Jahren seine dortigen
Papiere hergestellt/ bzw. benutzt worden sind.
Vielen Dank für die Ergänzung! Die Unterlagen stammen aus dem Bestand 1.1.10. (Kreis Siegen, Landratsamt, Schenkung Stadtarchiv, Verzeichnis A) des Kreisarchivs Siegen -Wittgenstein, dessen Überlieferung im Jahr 1814 beginnt.
In Hans-Dirk Joostens Buch „Mühlen und Müller im Siegerland“, Münster 1996, findet sich folgendes zur Papiermühle in Rudersdorf (S. 255): “ …. An ihrer [Anm.: gemeint ist die ehemalige Ölmühle in Rudersodorf] Stelle wurde 1821 eine Papiermühle durch Heinrich Neuser errichtet, die sich möglicherweise aufgrund der Wasserverhältnisse, des Standortnachteils und der Konkurrenz durch Oechelhaeuser in Siegen nicht sehr lange hält. ….“
Mit diesen vier Zielen, die zum Abschluss von „Offene Archive“ (19. bis 20. Juni 2017, Landesarchiv NRW) nochmals dezidiert die Ziele der Konferenz umrissen haben, endete vor wenigen Tagen die vierte Ausgabe der gleichnamigen Konferenzreihe. Bei den ca. 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern kam besonders das erstmals in dieser Form veranstaltete archivische BarCamp („ArchivCamp“) positiv an, eine ergebnisoffene Tagungsform, deren Inhalt und Ablauf von den Teilnehmenden selbst festgelegt wird.
Auch in Langenholdinghausen gab es einen Radfahrerverein.
Ernst-Otto Ohrndorf, Langenholdinghausen, Band 3, Siegen 1998, Seite 583 f.
Der Radfahrerverein „All Heil“ wurde 1907 gegründet. Im Buch ist die Satzung des Vereins abgedruckt. Interessant ist § 3 in dem festgelegt wurde,
das auch weibliche Personen ab dem 16. Lebensjahr Mitglied werden konnten.
“ Über die Aktivitäten des Vereins im Einzelnen und die Dauer seines Bestehens ist nichts näheres bekannt.“
Der Verein 4fachwerk Mittendrin-Museum entwickelt gerade einen Uhrmacher-Rundweg durch den historischen Stadtkern Alter Flecken
Freudenberg. Der erste Rundgang findet am 15.07.2017 statt.
Zur Rezeption des Fürsten Wittgenstein s. a. den UFA-Film „Preußische Liebesgeschichte“ (1938): https://de.wikipedia.org/wiki/Preu%C3%9Fische_Liebesgeschichte . Es müsste noch recherchiert werden, ob der Film 1950 auch in Wittgensteiner Kinos gezeigt wurde und wie ggf. die Reaktionen ausfielen.
Einige Anmerkungen:
Die Rückversetzung des Oberstudiendirektors Dr. Kurt Müller in eine Studienratsstelle nach dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums von April 1933 hat mit „Mobbing“ nichts zu tun. Das Gesetz erlaubte Entlassung, Zurruhesetzung und Versetzung in ein anderes/niederes Amt von unliebsamen, dem neuen System nicht angepassten Beamten. (S. 22f.)
Die Jahreszahl 1935 (S. 23) in der Chronik von Herrn Wolf ist nicht korrekt. 1935 war die ältere Tochter der Familie Frank, Ruth (Jg. 1912), bereits verheiratet. Sie hatte das Lyz ohne Abschluss verlassen. Tochter Inge (Jg. 1922) schied im November 1938 im Rahmen der Verordnung vom 14.11.1938 des Reichserziehungsministers Bernhard Rust aus. Darin heißt es, es könne „keinem deutschen Lehrer und keiner deutschen Lehrerin mehr zugemutet werden, an jüdische Schulkinder Unterricht zu erteilen. Auch versteht es sich von selbst, dass es für deutsche Schüler und Schülerinnen unerträglich ist, mit Juden in einem Klassenraum zu sitzen. Soweit es noch nicht geschehen sein sollte, sind alle zur Zeit eine deutsche Schule besuchenden (jüdischen) Schüler und Schülerinnen sofort zu entlassen“.
Inge Frank absolvierte von Februar 1939 bis Ende Juli 1940 einen Kurs für Kinderpflege im israelitischen Kinderheim in Köln, Lützowstraße. Details dazu sind im Internet unter http://www.lebensgeschichten.net nachzulesen. Darin ist leider die falsche Jahreszahl 1935 enthalten. Bisher habe ich nicht herausbekommen, was mit der jüngeren Cousine von Inge, Doris Salomon (Jg. 1926), aus Geisweid nach November 1938 geschah. Sie wurde als einziges jüdisches Kind aus der Geisweider Schule (Schulleiter Walter Nehm war Antisemit) entlassen. Nachdem ihre Mutter Jenny Salomon 1941 verstarb, lebte Doris in der Familie des Onkels Samuel Frank und wurde gemeinsam mit ihr Ende April 1942 nach Zamosc deportiert.
Meines Erachtens hätte die mutige Haltung der Oberstudienrätin Annemarie Schaefer (1887-1948), die als stellvertretende Schulleiterin während des Kriegseinsatzes von Dr. Rohdich in der Zeit vom 3. Nov. 1941 bis 13. Juli 1944 die Verantwortung hatte, erwähnt werden müssen. Sie forderte Ilse Meyer (Enkeltochter des vormaligen Kreismedizinalrates Dr. Arthur Sueßmann, nach den Rassegesetzen als Halbjüdin eingeordnet) auf, einfach weiter am Schulunterricht teilzunehmen, als sie 1943 aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen die Schule verlassen sollte. Bei Rückkehr Rohdichs von der Front im Sommer 1944 musste sie dann die Schule verlassen. Annemarie Schaefer wurde nach dem Krieg Stiftsoberin in Stift Keppel.
Zwei Anmerkungen zum Beitrag von Raimund Hellwig. Er schreibt: „1983 erschütterte die erste große Stahlkrise das Siegerland. Plötzlich gab es die konkrete Gefahr, dass der Stahlstandort Geisweid mit damals noch über 10.000 Mitarbeitern geschlossen werden könnte.“ Das stimmt nicht. In Geisweid waren noch nie so viele Menschen beschäftigt. Als ich 1962 dort anfing, waren es rd. 6.000 Mitarbeiter. Mir liegen die Belegschaftszahlen vor.
Die Werksgruppe Siegen mit den Werken Geisweid und Niederschelden beschäftigte 1983 insgesamt 4.570 Arbeiter und Angestellte, davon 3.914 Mitarbeiter in Geisweid und 656 in Niederschelden, darüber hinaus waren rd. 300 Angestellte in der Hauptverwaltung in Geisweid tätig. Woher hat R. Hellwig die Zahl? Auch der Hinweis, dass Helmut Wahl die Fa. Philips in Eiserfeld aufgekauft habe, kommt wohl nicht hin. Das müsste Horst Wahl gewesen sein.
Vielen Dank für die korrigierenden Hinweise!
1) In der von mir zu verantwortenden Chronik fällt der Begriff „Mobbing“ nicht im Zusammenhang mit der vorläufigen Versetzung Dr. Müllers auf der Grundlage des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufbeamtentums vom April 1934. Eine biographische Forschung über Müller ist allerdings eine sehr lohnenswerte Arbeit, die sicher Klarheit in die Siegener Vorgänge bringen wird.
2) Das Jahr 1935 für das Verlassen der jüdischen Schülerin Inge Frank fand sich in der Chronik von Tobias Gerhardus als auch im erwähnten lebengeschichtlichen Online-Angebot der NS-Gedenkstätten in NRW und wurde daher übernommen.
3) In der 2015 von Tobias Gerhardus vorgelegten umfangreichen Schulgeschichte wird eine Aufarbeitung der Schicksale aller jüdischen Schülerinnen des Lyzeums als Manko festgestellt. Sie ist bis heute nicht erfolgt.
Heute findet sich in der Siegener Zeitung ein Leserbrief zum Artikel „Walter Krämer auf Platz 1“ (Siegener Zeitung vom 10. Juli):
„Beim Lesen diese Beitrags stellt sich mir die Frage: Wohin driftet unser Land? Da wird ein Walter Krämer – ein überzeugter fanatischer Kommunist und aktiver Kämpfer der „Roten Ruhr-Armee“, deren erklärtes Ziel ein deutscher Sowjet-Staat war – zum „größten“ Siegen-Wittgensteiner erklärt, nur weil er in der KZ-Haft Mithäftlingen, darunter vor allem Gesinnungsgenossen, medizinische Nothilfe hat angedeihen lassen.
Was kommt als Nächstes: Ernst Thälmann als Ehrenbürger der Stadt Siegen? Wohin führt es am Ende , Menschen zu ehren, deren radikales Denken und Handeln sich nicht im Mindesten von dem der Nazis unterschieden hat? Sind wir auf dem Weg in einen Links-Staat?“
Die Formulierung „nur weil er in der KZ-Haft Mithäftlingen, darunter vor allem Gesinnungsgenossen, medizinische Nothilfe hat angedeihen lassen.“ – aber nicht nur diese – erfordert einen ehr flüchtigen Blick in die Quellen.
Grundsätzlich gilt für die Hilfeleistung Krämers in Buchenwald folgende Feststellung: “ … Wer im Lager geholfen hatte, hatte dies nicht als Kommunist getan, sondern als Mensch, der sich das Gefühl für Recht und Würde bewahrt hatte, im Gegensatz zu denen, die es schändeten. ….“ (aus: Ernst Wiechert: Der Totenwald, ein Erlebnisbericht (1946), Frankfurt/Berlin 1963, S. 132).
Folgende Hinweise lassen es als Beispiele aus der großen Anzahl von Berichten zumindentens fragwürdig erscheinen, dass die Behandlung der „Gesinnungsgenossen“ im Zentrum des Handelns von Walter Krämer gestanden hat:
1) “ …. Im März 1939 setzte er [gemeint ist Walter Krämer] eine eine Schutzimpfung aller Häftlinge gegen Typhus durch, indem er die SS davon überzeugt hatte, daß eine Epidemie auch auf die Wachmannschaften übergreifen würde. 1940 und 1941 wurde diese Impfung wiederholt, seit Anfang 1942 wurden alle Zugänge geimpft. … (aus: Klaus Dietermann/Karl Prümm: Walter Krämer. Von Siegen nach Buchenwald, Siegen 1991, S.81).
2) “ …. Und dort [Buchenwald] erhielt er [Fritz Unger] von dem Genossen Walter Krämer, Landtagsabgeordneter aus Kassel, den ersten Parteiauftrag.
Zwei jüdische Kinder waren aus Block 8 zu holen.
Walter Krämer sah den Genossen Fritz Unger an und sagte: „ Ich verlaß mich auf Dich. Du weißt , was auf dem Spiele steht. Kannst du das machen?“
…. Frage ihn heute, den Unger-Fritz, und er erzählt dir ruhig und nüchtern: „Es war nicht leicht. Aber ich hab´s geschafft. Ich hab mitgeholfen, die beiden Kinder zu retten. Das eine war der Seppel Graf aus Offenbach a. M. und der andere, das war der Noah Dreister. Die beiden haben wir auf Block 7 versteckt. Monatelang.“ (aus: Fritz Unger „Und weil der Mensch ein Mensch ist …..“, Hrsg. Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft – Bezirksvorstand Karl-Marx-Stadt, (o. J.), S. 8
3) “ …. Selbst SS-Aufsehern ließ er [Walter Krämer] seine medizinischen Kenntnisse zukommen, so heilte er z. B. den gefürchteten Lagerkommandanten Koch von dessen Syphilis. Dieses Wissen, so wird vermutet, war Anlass ihn und seinen besten Freund und Stellverteter im Lager, Karl Peix, erschießen zu lassen. …..“ Quelle: Aktives Gedenkbuch für die Opfer des Nationalsozialismus im Kreis Siegen-Wittgenstein, Eintrag Walter Krämer
Eine Ergänzung zur Beteiligung Walter Krämers an der Roten-Ruhr Armee: „…. Er beteiligte sich aktiv beim Kapp-Putsch als Mitglied der Roten Ruhr-Armee. Nach kurzer Mitgliedschaft in der USPD trat er 1920 der KPD bei. Er war 1923 in Siegen deren 2. Vorsitzender. Mit 14 weiteren Genossen wurde er noch im selben Jahr verhaftet und 1925 im Leipziger Sprengstoffprozess zu drei Jahren und sechs Monaten Haft wegen Vorbereitung zum Hochverrat verurteilt. Mit seinen Genossen saß er die Haftzeit zum großen Teil in Cottbus ab. Wegen schwerer Krankheit seiner Frau wurde er 1927 freigelassen. ….“ (Quelle: http://aktives-gedenkbuch.de/index.php/Detail/Object/Show/object_id/376). Dies ist also bekannt und wird keineswegs verschwiegen. Mehr noch findet sich in Klaus Dietermann/Karl Prümm: Walter Krämer. Von Siegen nach Buchenwald, Siegen 1991, S. 71: “ ….. Zahlreiche Anekdoten der KPD-Überlieferung ranken sich um die enormen Körperkräfte Walter Krämers. Er, der unbequeme, der Rebell, hat diese beserkerhaften Kräfte sicher zum Einsatz gebracht im Kampf mit den kaiserlichen Offizieren der MArine 1918, in der „roten Armee“ an der Ruhr, in den Saalschlachten und Straßenkämpfen mit der SA in denletzten Jahren der Weimarer Republik, und die Intensität und Totalität des körperhaften Engagements prägte auch seine Tätigkeit als Revierkapo in Buchenwald. ….“
Ich würde Walter Krämer gerne mit einer eigenen Briefmarke Individuell ehren vergleichbar denen, die zum Jubiläum „200 Jahre Kreise Siegen-Wittgenstein“ mit großem Erfolg verausgabt worden sind. Ebenfalls in Betracht käme eine sog. Pluskarte Individuell, das ist eine Ansichtskarte mit auf der Anschriftenseite aufgedruckter Briefmarke. Für die Gestaltung der Ansichtskarte könnte ein Wettbewerb, z.B. in den heimischen Schulen, erfolgen. Der von einer Jury oder der Öffentlichkeit in einer Abstimmung prämierte Siegerentwurf im Ansichtskartenformat 16,2 x 11,4 cm ziert anschließend die Walter-Krämer-Pluskarte. Die Deutsche Post Philatelie könnte hierzu einen passenden Walter-Krämer-Sonderstempel herausgeben und nach Siegen mitbringen.
Finde ich Mitstreiter für meine Idee?
Der Leserbrief von Gerd Reißfelder in der SZ vom 12. Juli 2017 hat mich veranlasst, hierauf eine Erwiderung zu schreiben, die am 17. Juli 2017 in der Siegener Zeitung als Leserbrief veröffentlicht worden ist.
Das Siegerland kann m.E. stolz darauf sein, im Rahmen der regionalen Erinnerungskultur auf einen Widerstandskämpfer in der NS-Zeit wie Walter Krämer verweisen zu können.
Dies haben auch Siegens Bürgermeister Steffen Mues und der Ex-Landrat Paul Breuer, beide CDU-Mitglieder, erkannt, die sich maßgeblich für die in 2014 erfolgte Bezeichnung des Vorplatzes des Kreisklinikums in Siegen-Weidenau als „Walter-Krämer-Platz“ eingesetzt haben.
Walter Krämer ist im Bewusstsein der hiesigen Bevölkerung längst noch nicht als bedeutender Siegerländer verankert. Daran wird wohl auch das aktuelle Abstimmungsergebnis bei der Wahl zum größten Siegen-Wittgensteiner zunächst nichts ändern.
Arthur Radvansky, ein 2009 verstorbener Jude aus Prag, der für die „Aktion Sühnezeichen“ bei Grabpflegearbeiten auf dem Jüdischen Friedhof in Prag und bei Vorträgen in den Siegerländer Schulen viele Jahre lang Jugendlichen aus dem Siegerland über seine leidvollen Erfahrungen, u.a. in den Konzentrationslagern Buchenwald und Auschwitz, in der NS-Zeit berichtet hat, war ein Zeitzeuge, den Walter Krämer im KZ Buchenwald zweimal operiert hat und dem er dadurch das Leben gerettet hat. Durch seine Aussagen über das Verhalten des KZ-Häftlings Walter Krämer als „Arzt von Buchenwald“ hat er dazu beigetragen, dass dieser von der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem im Jahr 2000 posthum als „Gerechter unter den Völkern“ ausgezeichnet worden ist. Wer – wie ich – einmal die Gelegenheit hatte, sich mit Artur Radvansky während einer Studienfahrt nach Auschwitz über Walter Krämer zu unterhalten, wird dieses Gespräch zeitlebens nicht vergessen und sich auch nach dem Tod dieses Zeitzeugen für ein ehrenhaftes Gedenken an Walter Krämer als gebürtigen Siegener einsetzen.
Als Briefmarkensammler würde ich Walter Krämer gerne nachträglich zum 125. Geburtstag noch mit einer eigenen Briefmarke Individuell ehren, vergleichbar denen, die zum Jubiläum „200 Jahre Kreise Siegen-Wittgenstein“ mit großem Erfolg verausgabt worden sind. Ebenfalls in Betracht käme eine sog. Pluskarte Individuell, das ist eine Ansichtskarte mit auf der Anschriftenseite aufgedruckter Briefmarke. Für die Gestaltung der Ansichtskarte könnte ein Wettbewerb, z.B. in den heimischen Schulen, erfolgen. Der von einer Jury oder der Öffentlichkeit in einer Abstimmung prämierte Siegerentwurf im Ansichtskartenformat 16,2 x 11,4 cm würde anschließend die Walter-Krämer-Pluskarte zieren. Die Deutsche Post Philatelie könnte hierzu einen passenden Walter-Krämer-Sonderstempel herausgeben und nach Siegen mitbringen.
Ich sehe mich als mit beiden Füßen auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehenden Bürger dieses Staates. Ich bin dankbar dafür, mir eine eigene Meinung nicht nur bilden, sondern diese auch, ohne Repressalien befürchten zu müssen, öffentlich kundtun zu können.
Ideologisch bedingte Blindheit auf dem rechten oder linken Auge und stereotype Kriterien behindern, ja verhindern eine ausgewogene Würdigung des Einzelfalles, wenn es um die Frage geht, ob eine Person für eine öffentliche Ehrung in Betracht kommt. Im übrigen ist jede Ehrung nur ein Kind ihrer Zeit und muss sich immer eine kritische Hinterfragung durch zukünftige Generationen unter Berücksichtigung neu hinzugekommener Erkenntnisse gefallen lassen.
Übrigens käme nach meinen bisherigen Erkenntnissen aus meinen heimatgeschichtlichen Forschungen über das Leben von Dr. Tony Riecke (1907 – 1989), einer langjährigen Deuzer Landärztin, die Mitglied in der NSDAP und ihren Untergliederungen war, für sie wegen ihrer unbestrittenen Verdienste in über 50 Jahren als Hausärztin ebenfalls eine Ehrung durch die Benennung einer Straße oder eines Platzes nach ihr in Betracht, z.B. in der Nähe ihrer damaligen Arztpraxis im Umfeld des ehemaligen Deuzer Bahnhofs. Einen Gedenkstein gibt es dort ja bereits. Und noch gibt es genügend Zeitzeugen, die sogar fest davon überzeugt sind, dass Dr. Tony Riecke ihnen durch ihre zutreffenden Diagnosen einmal das Leben gerettet hat.
Folgende Hinweise erfolgten per E-Mail:
“ … [I]n der Bildmitte sieht man Herrn Hans-Jürgen Beineke, ehem. KT-Mitglied, ehem. Landrat/stellv. LR.
Der zweite Herr von rechts ist Herr Kreisdirektor Volker Behnsen.
Der Herr ganz links könnte Herr Stadtverordneter Prof. Dr. Karl-Heinz Ostholthoff, Stadt Siegen, sein (VWL-Professor an der Uni-GH Siegen). ….“
Es verwundert doch sehr, wie Herr Lerchstein vorschlägt, Dr. Tony Riecke mit der Benennung einer Straße oder eines Platzes zu ehren. Wie in den Ausführungen korrekt angegeben, war Riecke während des NS Mitglied der NSDAP und weiterer NS-Organisationen. Laut dem Regionalen Personenlexikon zum Nationalsozialismus in den Altkreisen Siegen und Wittgenstein war sie Untergaugruppenführerin in der NS-Frauenschaft, Mitglied im BDM, Mitglied im Nationalsozialistischen Deutschen Ärztebund. Sie engagierte sich in den Organisationen, in denen sie Mitglied war. Dies legt eine Mitgliedschaft aus politischer Überzeugung nahe und geht über ein passives „Mitläufertum“ hinaus.
Es ist absolut inakzeptabel, eine solche Person, die sich während eines Teils ihres Lebens für die Unterstützung einer rassistischen und menschenverachtenden Diktatur engagiert hat, mit der Benennung einer Straße oder eines Platzes zu ehren. Diese Ehrungen sollten Persönlichkeiten vorbehalten bleiben, die eine absolut reine Weste haben und mit ihrer gesamten Persönlichkeit und ihrem gesamten Lebenslauf als Vorbild dienen. Bei Frau Dr. Riecke kann ich dies nicht sehen, auch wenn sie nach dem Krieg eine engagierte Landärztin gewesen sein soll. Das genügt für eine Ehrung nicht.
Ich danke Herrn Panthöfer für seine Meinungsäußerung. Vor Beginn meiner Recherchen zum Leben von Dr. Tony Riecke hätte ich wahrscheinlich ähnlich Stellung bezogen. Je mehr ich über sie in Erfahrung gebracht habe, um so differentierter stellte sich jedoch für mich die Beurteilung dieser Ärztin dar. Ihr 1934 in Meschede 85-jährig verstorbener Großvater Dr. Emil Scholand, in dessen Haushalt sie viele Jahre ihrer Kindheit und Jugend verbracht hat, hat sie maßgeblich bei der Berufswahl beeinflusst. Er war in Meschede ebenfalls 52 Jahre lang Landarzt. Er war die zweite Persönlichkeit, die zum Ehrenbürger der Stadt Meschede gewählt worden ist. Wie hätte dieser Mann sich verhalten, wenn er zwei Generationen später geboren worden wäre, war mein erster Gedanke. Von der Wesensart her lagen er und seine Enkelin wohl sehr nahe beieinander. In meiner Abhandlung über Dr. Tony Riecke ist nachzulesen: „Aus Überzeugung trat Dr. Riecke 1933 als Mitglied Nr. 3.902.800 in die NSDAP ein und gehörte seit 1935 dem Nationalsozialistischen Deutschen Ärztebund (NSDÄB) an. Sie war seit 1937 in Deuz die Ortsleiterin der NS-Frauenschaft und seit 1938 Untergaugruppenführerin im Bund Deutscher Mädel (BDM). Während des 2. Weltkriegs war sie die verantwortliche Ärztin für die Kriegsgefangenen und zivilen Zwangsarbeitskräfte in verschiedenen Betrieben (u. a. Siegas in Rudersdorf und Walzengießerei Hermann Irle in Deuz). 1947 erfolgte ihre Entnazifizierung in der geringst belasteten Kategorie „Mitläuferin“, zunächst mit und 1948 dann ohne Vermögenssperre. (Regionales Personenlexikon zum Nationalsozialismus in den Altkreisen Siegen und Wittgenstein; URL: http://akteureundtaeterimnsinsiegenundwittgenstein.blogsport.de/a-bis-z/gesamtverzeichnis/2/#riecke )
Über diese Zeit berichtete sie: “Als einziges, stets vorhandenes Vitaminmittel benutzte ich Wiesenkraut und Kartoffelpresssaft, vor allem in den Gefangenenlagern. Kein kriegsgefangenes Kind hatte ernsthafte Gesundheitsstörungen.“ Eine aus Salchendorf stammende Frau erinnerte sich daran, dass Dr. Riecke ihre Mutter um Essen für die Zwangsarbeiterkinder gebeten und auch etwas erhalten hat. Im Aktiven Gedenkbuch für die Opfer des Nationalsozialismus im Kreis Siegen-Wittgenstein ist bis dato auch kein im Zuständigkeitsbereich von Dr. Riecke verstorbenes Kind von Zwangsarbeitern aufgeführt. (URL: http://aktives-gedenkbuch.de/index.php/Search/Index?search=Kind)“
Mir war natürlich bewusst, dass ich mit meiner Anregung eine kontroverse Diskussion in der Öffentlichkeit anstoßen würde. Das war aber auch beabsichtigt. Eine pauschale Beurteilung von Dr. Riecke nur nach den bisherigen Aktenunterlagen aus der NS-Zeit greift meines Erachtens einfach zu kurz. Ich würde es daher sehr begrüßen, wenn von dritter Seite noch weitere Informationen über ihr Verhalten in der NS-Zeit zusammengetragen werden.
Vielen Dank für die Liste! Wenige Ergänzungen zu den Personen:
1) Willi Kettner
2) Hans Mohn, Stadtdirektor in Siegen von 1975 – 1985
3) Siegfried Förster, Bürgermeister der Stadt Siegen in den 70er Jahren
4) Volker Behnsen (1933 – 2017), Kreisdirektor des Kreises Siegen(-Wittgenstein), 1972 – 1992
Danke für die Hinweise! Zu Landrat Werner Möhl liegen dem Kreisarchiv folgende Informationen vor. Das Bild mag erklären, warum wir ihn nicht erhannt haben: Lebenslauf Möhl (PDF).
Auf Nachfrage teilt das Archiv des Liberalismus heute via Facebook mit:
“ ….[B]ei dem Herren (2.v.l.) handelt es sich definitiv nicht um Horst-Ludwig Riemer. Dieser hatte u.a seinen Haarscheitel immer auf der anderen Seite. ….
Leider konnten wir auch nicht ermitteln, wer die besagte Person ist…..“
Guten Tag, wir haben damals zusammen in der Familie einen Kelimteppich erstellt, bzw. 2, der lag eine Zeitlang bei uns in den Zimmern. Er hatte dieses großflächige Muster. Das dicke Garn wurde mit einer großen Nadel entweder unter oder über das vorgegebene Muster gezogen. Zum Schluss hat meine Mutter die Rückseite mit einem stabilen Tuch versehen, damit es hält. Die Teppiche sind ca. 30 – 40 cm breit und ca. 1 m lang. So eine Art Läufer. Wenn Sie interessiert sind, melden Sie sich bitte. Mit freundlichen Grüßen Hannelore Gerstmann
Zum Leserbrief „Wohin driftet das Land?“ (Siegener Zeitung vom 12. Juli) – s. o. – erschien heute in der Siegenr Zeitung ein weiterer Leserbrief:
„Herrn Reißfelders Geschichtsverständnis offenbart klaffende Lücken in der Kenntnis der historischen Entwicklung unseres Landes. Der Autor stört sich an einer Mehrheitsentscheidung, durch die – in Zeiten eines europäischen Rechtsrucks – der kommunistisch motivierte Humanist Walter Krämer zum größten Sohn Siegen-Wittgensteins gewählt wurde. Hierbei versucht Reißfelder, Krämers Kampf in der Roten Ruhrarmee 1920 zu skandalisieren. Herr Reißfelder missdeutet die Rote Ruhrarmee als eine Moskauer Einflussagentur, die einen „deutschen Sowjet-Staat“ zu errichten suchte. Die Rote Ruhrarmee war jedoch ein Zusammenschluss sozialdemokratischer, linkssozialistischer, kommunistischer und in christlichen Gewerkschaften organisierter Arbeiter zur Abwehr eines Militärputschversuches, der aus Deutschland einen autoritären Ständestaat machen wollte. Die Einheit der arbeitenden Menschen rettete die Republik.
Das Wirken des Kommunisten Krämer steht für diese demokratiefördernde Einheit von 1920, welche fatalerweise in den Schicksalsjahren 1932 und 1933 fehlte. Das Ausbleiben eines vergleichbaren Zusammengehens in der Endphase der Weimarer Republik führte letztendlich dazu, dass die Nazis Menschen in Konzentrationslagern quälen konnten, und zwar nicht nur Krämers „Gesinnungsgenossen“, wie sich Herr Reißfelder despektierlich und pietätlos ausdrückt. Wer diese historische Lehre der deutschen Geschichte ignoriert, sollte sparsam mit hysterischen Zukunftsprognosen umgehen.
Erinnert sei noch daran, dass in Siegen mit Namen wie Hindenburg und Fissmer nach wie vor Personen eine öffentliche Ehrung erfahren, die – anders als Krämer – den Nazis den Weg bereiteten oder diese unterstützten.
Das Foto wurde anlässlich der Inbetriebnahme der Obernautalsperre am 07.11.1972 gemacht.
Von links: Herrmann Schmidt (Landrat Kreis Siegen), Diether Deneke (Landwirtschaftsminister NRW), Werner Möhl (Landrat Kreis Wittgenstein), Hans-Georg Vitt (MdL) und Karlheinz Forster (Kreisdirektor Altkreis Siegen).
Die Herren stehen vor dem Schieberhaus am Fuße des Dammes.
Ich war damals auch dabei, aber Achtjährige durften nicht mit aufs Foto…
Ein Teil der Gäste macht einen „undeutschen“ Eindruck.
Es könnte sich um eine Delegation aus dem Partnerkreis Emek Hefer handeln. Dazu könnte es beim Kreis Vergleichsfotos geben.
Guten Tag, ich muss an meinen Kommentar zu „Mithilfe 3“ erinnern, auch hier wieder links und rechts bei der Bildunterschirft vertauscht – oder? Und im Text darunter Althaus neben Forster (1.v.l., lt. Bildbeschriftung): Wo ist nun Althaus: beim Bild ist Althaus 1.v.l., laut Text aber zweiter 2.v.r., aber Forster ist tatsächlich 1.v.r. (ihn erkennen wir aus früheren Fotos) und Althaus wo?. Vielleicht ist dieser kleine Fehler ja auch strukturell bedingt und in den Unterlagen so vorgegeben, dann ist er auch aus archivischer Sicht dauerhaft erhaltenswert!
1) Vielen Dank für den Hinweis! Die Bildunterschrift wurde entsprechend geändert.
2) „Neben“ im Text des Eintrages ist im Sinne von „zugleich mit“ zu verstehen. Ich bitte die dadurch entstandene Irritation zu entschuldigen.
3) Gerne darf auch die Frau im Hintergrund 1. v.l. identifiziert werden …..
Es handelt sich wohl um:
Hans Eitel Plato Eustach Graf von Görtz-Wrisberg, geb. 17. Dez. 1856, gest. 6. Nov. 1914), verh. am 14.10.1902 in London mit Augusta Giller, geb. Kassel, 13. Juni 1865 – gest. Eisenbach, 2. Okt .1942).
Zu Eustach Graf von Görtz-Wrisberg liegt eine Prüfungsakte im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin vor: I. HA Rep. 125, Nr. 1636
(Ober-Examinationskommission bzw. Prüfungskommission für höhere Verwaltungsbeamte >> 02 Prüfungswesen >> 02.02 Einzelne Prüfungen, A – Z >> 02.02.07 Einzelne Prüfungen, G), Laufzeit:1885).
Der Herr links von Herrn Forster ist Dr. Diether Posser.
Der Herr mit der Augenklappe müßte auch zum Kabinett Kühn gehören. Er ist auf einem Foto zu sehen in dem Buch „Portrait einer Stadt Hüttental“.
Vielen Dank für die Hinweise! Ein Blick in das Bildarchiv des Landtags bestätigen die Angaben. Damit kann man den Zeitpunkt der Bildaufnahme zwischen Sept. 1968 (Einttritt Possers in die Landesregierung) und Dez. 1974 (Ende der Amtszeit Karl Althaus) vermuten.
Weitere Personen aus der Region, die in Auschwitz-Birkenau umgebracht wurden, finden sich in den „Sterbebüchern von Auschwitz. Fragmente. Namensverzeichnis A-Z, hrsg. vom Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau, Red. Jerzy Debski u.a., München u.a. 1995“. Einfach nach Nachnamen oder nach Ortsnamen suchen. Unter dem Suchbegriff „Berleburg“ werden z.B. etliche Personen nachgewiesen.
Die Aufnahme wurde im damals neuen Kreishaus im Sitzungssaal (heute Raum 1317) aufgenommen. Der zweite Herr von rechts könnte (!) Kreisdirektor Volker Behnsen sein, allerdings deutet das Wappen auf der Krawatte eher auf einen Vertreter der Stadt Siegen. Rechts neben Forster könnte (!) der Siegener Bürgermeister Hans Reinhardt sein, obwohl ich den nur mit Brille kenne.
Bei den Bezirksbürgermeistern aus Spandau hätten wir aufgrund der zeitlichen Eingrenzung die Wahl zwischen Herbert Kleusberg oder Walter Werner Salomon.
Auf den Tag genau 4 Jahre und 5 Monate später ist es sicher an der Zeit, eine kleine Korrektur anzubringen: Der Spandauer Bezirksbürgermeister Salomon hieß Werner, nicht Walter. Ob er der Herr mit dem Berliner Bären auf Revers und Krawatte ist, würde eine Anfrage beim Bezirksamt Spandau / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sicher unschwer ergeben, zumal diese Abteilung ohnehin für die Pflege der Städtepartnerschaften zuständig ist. Nur Mut, lieber Herr Wolf, die Berliner beißen nicht (wenn sie auch manchmal knurren).
Na ich weiß nicht … Gesichtsvergleiche waren noch nie meine Stärke. Wenn das Bild genau 1979 entstand: Das war Kleusbergs letztes Amtsjahr vor der Pensionierung. Er war 65 Jahre alt, Salomon 53. Altersschätzungen sind aber auch nicht meine Stärke. Für Salomon könnte sprechen, dass er vielleicht einen Antrittsbesuch in der Partnerstadt Siegen absolvieren wollte. Und nachgewiesener Brillenträger war er auf jeden Fall in späteren Lebensjahren. Aber womöglich ist der Herr noch jemand ganz anderes gewesen (Stellvertreter?). Wie gesagt, die Spandauer können sicher problemlos helfen und unseren müßigen Spekulationen ein Ende setzen.
Danke für die Hinweise! Im Bildarchiv des Landtages NRW liegen Bilder von Hans Reinhardt, die ihn ohne Brille zeigen und Ihre Vermutung stützen. Wenn es also Reinhardt ist, dann dürfte die Aufnahme wohl zwischen 1979 (in diesem Jahr ist Reinhardt ersterOberb Bürgermeister der Stadt Siegen geworden) und 1983 (dem Todesjahr Hermann Schmidts) entstanden sein.
Es ist definitiv Hans Reinhardt. Das Foto könnte ihn aber auch in seiner Zeit als Landtagsabgeordneter bzw. als Beigeordneter der Stadt Siegen zeigen. Dann hätte er bei diesem Termin den Bürgermeister Friedemann Keßler vertreten. Oberbürgermeister der Stadt war Reinhardt übrigens nie. Diesen Titel trug meines Wissens zuletzt Friedemann Keßler.
Vielen Dank für die Information! Es wird doch sicherlich noch mehr im Stadtarchiv zum Kriegerdenkmal geben: Akten, Protokolle der Stadtverordnetenversammlung, Zeitungsberichte und Fotos?
Eigentlich hatte ich das Digitalisat wegen des passenden Termins und wegen der Tatsache eingestellt, dass dies nicht, wie sonst auf siwiarchiv üblich, den Beständen der Landesbibliothek in Münster entnommen wurde, sondern vielmehr dem rheinischen Pendant in Düsseldorf. Also: es lohnt auch ein Blick in die dortigen digitalen Bestände, um sich ggf. für einen Archivbesuch vorzubereiten.
Zwischen Vomhof und Forster ist Kreisdirektor Volker Behnsen zu sehen. Der Herr rechts von Forster kommt mir sehr als Kreistagsmitglied aus meiner Erinnerung. Vielleicht Hans Berner, seinerzeit m. W. auch mal stellvertretender Landrat?
Zwischen Kettner und Vomhof ist angeschnitten das Profil von Hans-Jürgen Beineke, Kreistagsmitglied, erkennbar.
Vielen Dank für die Informationen! In einer geschlossenen Facebook-Gruppe erfolgte übrigens bereits die Bestätigung, dass es sich bei dem Mann rechts neben Forster um Hans Berner, der von 1961 bis 1994 dem Siegener Kreistag angehörte, handelt. Von 1975 bis 1984 war er, wie Sie richtig schreiben, stellvertretender Landrat des Kreises Siegen(-Wittgenstein).
Würde auf Blefa oder Schäferwerke tippen. Beides Hersteller von Getränkebehältern b.z.w Fässern wie man Sie im Hintergrund sieht. Personen sind mir leider nicht bekannt
Ja, ich tippe auf die Schäfer-Werke GmbH auf dem Pfannenberg. Ich denke, die Person rechts von Forster ist der geschäftsführende Gesellschafter Theo Schäfer, Herr Forster pflegte stets einen sehr guten Kontakt zu ihm (bis heute). Der Logik folgend wäre dann die Person links ein angestellter Geschäftsführer oder Prokurist. Von der Statur und dem Alter her könnte das auch Theo’s Bruder Gerhard Schäfer sein, aber ich finde, die Gesichtszüge passen nicht.
s. a. Pressemitteilung der Universität Siegen, 17.8.2017:
„Blick auf das Bundeskanzleramt
….
Die Bundesregierung lässt die NS-Vergangenheit zentraler Behörden in Deutschland erforschen und fördert zu diesem Zweck zehn Projekte. Eines der Forschungsprojekte ist an der Universität Siegen angesiedelt und richtet den Blick auf das Bundeskanzleramt. Die Historiker Professorin Dr. Angela Schwarz und Dr. Heiner Stahl analysieren in den kommenden Jahren die Praktiken des Bundeskanzleramts in der Nachkriegszeit – ein Thema, das noch nie systematisch untersucht worden ist. Der Titel ihres Projekts lautet: „Kontaktzone Bonn: Praktiken öffentlicher Kommunikation und Verlautbarung in der frühen bundesrepublikanischen Mediendemokratie (1949-1969)“. Das Forschungsprojekt wird mit 250.000 Euro gefördert.
„Es ist ein Trugschluss zu denken, dass mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 die Stunde Null begann“, sagt Projektleiterin Prof. Schwarz. Im Bundeskanzleramt als Schaltzentrale der Regierung habe man sich – wie in anderen Bundesämtern und Regierungsstellen – nach 1949 nicht zwangsläufig völlig von der NS-Zeit abgekehrt. Es habe zum einen gewisse personelle Kontinuitäten gegeben. Zum anderen hätten Akteure gewisse Praktiken zuvor über Jahre und Jahrzehnte eingeübt. „Strukturen und Verfahren, die unter dem NS-Regime angewandt worden waren, sind nach 1949 nicht einfach verschwunden“, erklärt Prof. Schwarz. Das beginne etwa bei bewährten Formen der Kontaktaufnahme, ginge über Netzwerkpflege und Informationsübermittlungen bis hin zur Einbindung der PressevertreterInnen bei Gala-Dinners oder Reisen. Auf der anderen Seite standen die JournalistInnen als Empfänger, die die angebotenen Informationen wiederum innerhalb ihrer Rahmenbedingungen umzusetzen hatten. Dieses Wechselspiel zwischen einem sich etablierenden Bundeskanzleramt und der sich in der Demokratie neu formierenden Presse steht im Mittelpunkt des Forschungsprojekts der Uni Siegen.
Prof. Schwarz möchte dabei außerdem untersuchen, wie der Westen die Presse- und Medienlandschaft im Zeitraum von 1949 bis 1969 beeinflusst hat – es geht sozusagen um die „mediale Westbindung“. Das Forscherteam analysiert zum Beispiel, wie sich neue Erkenntnisse aus Massenpsychologie und Werbetechniken auf die Nachkriegsmedien auswirkten. „Mich freut besonders, dass die Universität Siegen neben finanziell und personell gut ausgestatteten Institutionen mit ihrem Antrag Erfolg hatte“, sagt Schwarz.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters hatte das Forschungsprogramm ausgeschrieben. Insgesamt stehen Fördermittel in Höhe von 4 Millionen Euro für den Zeitraum 2017 bis 2020 zur Verfügung. Die Auswahl der Projektanträge erfolgte auf der Grundlage des Votums einer siebenköpfigen Expertenkommission aus unabhängigen WissenschaftlerInnen, die die Kulturstaatsministerin berufen hatte. Wegen der ressortübergreifenden Bedeutung des Bundeskanzleramts wird es zu dessen Geschichte gleich zwei Forschungsprojekte geben – eines von der Universität Siegen und ein weiteres vom Institut für Zeitgeschichte in München gemeinsam mit dem Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam.
Kontakt
Univ.-Prof. Dr. Angela Schwarz
Geschichte – Neuere und Neueste Geschichte, Universität Siegen
Telefon: 0271 740-4606 (-4502 Sekretariat)
E-Mail: schwarz@geschichte.uni-siegen.de„
Es lohnt sich ein Blick in die Unternehmensgeschichte der Schäfer-Werke im Internet. Da gibt es einen Button „Unternehmensgeschichte“ oder so ähnlich, da findet man alte Aufnahmen der Brüder Schäfer und kann sie mit den Herren links und rechts von Forster vergleichen.
@Elke Hofmann
@Reinhard Kämpfer
Vielen Dank für die Hinweise! Beim ersten Betrachten des Bildes habe ich zunächst direkt an die Blefa-Werke in Kreuztal gedacht – aus archivischen Gründen liegen diese mir etwas näher.
In der Facebook-Gruppe „Siegerland in alten und neuen Bildern“ wurde allerdings Ihre Vermutung, dass es sich um die Neunkirchener Schäfer-Werke handelt, bestätigt.
Die Firmenegeschichte – da sind Sie mir zuvor gekommen, Herr Kämpfer – kann man unter diesem Link einsehen: https://www.ssi-schaefer.com/resource/blob/12740/204c6b8c740bd82ceb0644702c95e4a3/broschuere-deutsch–75-jahre-ssi-schaefer-jubilaeumsbroschuere-2012–dam-download-de-1714–data.pdf . Zur Identifikation der Personen ist sie m. E. leider nur bedingt hilfreich.
Sie können auch Frau Annette Pritz, Referat Landrat, befragen. Sie war ja sehr lange Jahre Sekretärin und persönliche Referentin von Herrn Forster und hat sicherlich so manchen Termin auch persönlich begleitet.
Das Foto mit den vier Schäfer-Brüdern habe ich unter folgendem Link gefunden: http://www.schaefer-werke.de/de/ueber-uns/geschichte/
Zumindest bei Theo Schäfer ist eine deutliche Übereinstimmung festzustellen. Bei Gerhard Schäfer bin ich mir auch nicht sicher, zumal die Familienmitglieder ja nicht so gut miteinander harmoniert haben.
Die in der Miszelle erwähnte Schrift J. J. Vorländers „Die Waldwirthschaft im Wiehen-Gebirge“ (https://books.google.de/books?id=pJ5XAAAAcAAJ) enthält auch ein Gutachten seines Bruders Friedrich, Stifts-Oberförster in Allenbach/Keppel und ehemals Kreis-Haubergs-Oberförster. Für forstgeschichtlich interessierte Siegerländer also nicht ganz uninteressant.
Danke für den Hinweis! Vermutlich war Johann Jakob Vorländer (geb. 1773) der Vater der beiden: https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction.action?detailid=v5751153 . Dem steht allerdings Lothar Irles Angabe (Persönlichkeitenlexikon, S. 356) entgegen, dass Johann Jacob (geb. 1752 in Oberndorf, Vater herrschaftlicher Jäger und von 1785 bis 1815 Stiftsjäger zu Stift Keppel) der Vater der beiden war.
Die Lebensdaten des Vaters „1752-1823“ finden Bestätigung bei Wilhelm Hartnack, Stift Keppel im Siegerland 1239-1951, Band 3, S. 420.
Die Genealogie ist wegen der Vornamenvergabe etwas verwirrend. Johann Henrich Vorländer (um 1709 – 1786) war zweimal verheiratet. Sohn aus erster Ehe: Johann Henrich (1746-1825); Sohn aus zweiter Ehe: Johann Jacob (1752-1823). Johann Henrich d. J. hatte einen Sohn Johann Jacob (1773-1831); Johann Jacob d. Ä. hatte die Söhne Johann Jacob und Friedrich. Der in der Hessischen Verzeichnung genannte J.J.V. war also ein Halbcousin (falls es das Wort geben sollte) des Geodäten und Haubergs-Oberförsters.
Das Stadtarchiv Hilchenbach verweist völlig zu Recht auf die Archive der Siegener Zeitung und des Mindener Tageblatt zur Erforschung der Biographie J.J. Vorländers.
Jost Schmid-Lanter, Zentralbibliothek Zürich, weist zu Recht auf seinem ebenfalls online greifbaren Aufsatz hin: „A previously unknown likeness of the St. Gallen Globe: New speculations about his origins“, in: Journal of International Map Collector´Society, Spring 2016 No. 144, S. 12 – 21, Link: https://www.zb.uzh.ch/Medien/spezialsammlungen/karten/b_imcos_ausgabe_144_low_res.pdf
Meine Tante, die Schwester meines Vaters, war im „Gänseaquarium“ , so nannte man damals auch das Lyzeum, als Putzfrau beschäftigt. Ich habe sie dort bei ihrer Arbeit nur einmal besucht. Da war ich so 5 Jahre alt. Heute bin ich 73. Vor 20 Jahren als gebürtiger und dort gelebter Siegener nach Tschechien ausgewandert. Habe nicht nur E-Mail, auch Skype.Nodda.
Hallo,
zu der HFG-SI (Historische feuerwehrgruppe Siegen) habe ich jede Menge Bilder, die ich selbst gemacht habe.
Ich war zur Gründung des vereins selbst im vorläufigen Vorstand, habe die Satzung geschrieben und war möglichst bei jedem Event dabei, obwohl ich selbst nie Feuerwehrmann war.
Falls Interesse an der sehr umfangreichen Sammlung besteht, dann erbitte ich Kontakt unter derhinterlegten EMail Adresse.
Anlässlich dieser sogenannten „kleinen wissenschaftlichen Sensation“ wäre eine Erinnerung an die schon früher in Fellinghausen durchgeführten analogen Experimente nicht verkehrt. Siehe dazu die detaillierten Ausführungen von Alfred Becker: http://siegerlaender-hauberg.info/index.php/lateneofen
In der geschlossenen Facebook-Gruppe „Stadt Siegen in alten und neuen Bildern“ findet sich eine Postkarte, die auch die hier abgebildete Innenansicht zeigt.
Hallo zusammen. Ich bin im Besitz eines Bildes, gemalt von H.? Achenbach, gemalt wurde die Eremitage. Leider kann ich die Signatur nicht richtig lesen, würde aber gerne mehr über das Bild erfahren. Weiß jemand an wen ich mich wenden könnte? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß
Zur Sütterlinschrift erreicht uns folgender Literaturhinweis:
Bettina Irina Reimers: Ludwig Sütterlins Konzept einer Schrift – Methode und Praxis des Schreibenlernens, in: Reh, Sabine/Wilde, Denise (Hrsg.): Die Materialität des Schreiben- und Lesenlernens. Zur Geschichte
schulischer Unterweisungspraktiken seit der Mitte des 18. Jahrhunderts. Bad Heilbrunn/Obb 2016, S. 231 – 256.
Danke an PK!
Ich erinnere mich daran, dass der Ankauf der Bilder durch den Kreis Siegen-Wittgenstein eine ausgesprochen schwierige Angelegenheit war. Die Tochter von Otto Arnold hatte ursprünglich vor, die Bildrechte in die USA zu verkaufen. Mein geschätzter Chef Horst Schneider hat sich unendlich Mühe gegeben, die Bilder im Siegerland zu behalten.
Nun ja, das waren halt gewiefte Verhandler. Wer mit seinen astronomischen Forderungen in der ganzen Region vor die Wand läuft, bringt mal eben einen potenten Ami ins Spiel. Dann wird schon einer weich …
Eine Anmerkung zu Punkt 4:
Das etwas irreführend als „Dokumentationsstelle“ bezeichnete Unternehmen wird sicherlich jeder begrüßen – warum aber muss es unbedingt exklusiv beim Kreisarchiv angesiedelt sein und das dortige Raumangebot schmälern? Die erste Konzeption ist 10 Jahre alt; inzwischen gibt es „Zeit.Raum Siegen“ mit anscheinend ganz ähnlichen Motiven, nur eben bisher lokal statt regional orientiert. Was spricht dagegen, den Horizont des schon bestehenden Projektes einfach zu erweitern und als neuen Kooperationspartner das Kreisarchiv mit ins Boot zu holen? Soweit Präsentationen in einem „Schauraum“ angeboten werden sollen, wären dafür räumlich das Siegerlandmuseum und geschichtsdidaktisch die Uni prädestiniert, nicht das Kreisarchiv. Dieses könnte sich auf die fachhistorische Zuarbeit konzentrieren, womit die bereits für die „Dok.-Stelle“ vorgesehene Archivmitarbeiterin gut ausgelastet wäre und sich nicht von den pädagogischen und logistischen Aspekten, für welche die anderen Partner zuständig sind, ablenken lassen müsste.
Ich würde es sehr begrüßen, wenn dieser Gedankengang in die politischen Diskussion Einzug findet. Denn die Errichtung der Dokumentationsstelle ist ein Beschluss der Kreistages, den die Verwaltung ja zunächst einmal umzusetzen hat.
Ich konnte nur eine PDF-Datei mit 2 nicht aufeinander folgenden Seiten öffnen. Soll das nur eine Leseprobe sein oder wurde versehentlich nicht der gesamte Text als PDF-Datei zur Verfügung gestellt?
Wie sieht es vom damaligen Aufnahmeort dort heute aus?
Wäre es nicht eine Herausforderung für den Heimatbund Siegen-Wittgenstein, die Geschichtswerkstatt Siegen oder einen
örtlichen Heimatverein? Die Uni Siegen wollte doch das
regionalgeschichtliche Wissen generieren. Hier könnte ein Anfang sein.
Die reich illustrierte 67 Seiten starke Broschüre („Buch“ wäre eine Übertreibung), die das Stadtarchiv Hachenburg 2016 vorlegte, ist ein autobiografischer Einstieg ins Thema gewesen, sicher durch den lokalen Bezug auch für manchen Hachenburger und Siegerländer Leser. Dafür ist dem Verfasser zu danken.
Es geht aber leider nicht ohne ein paar Anmerkungen zu dieser Schrift und ihrer Präsentation. Als ihr Autor im Rahmen des Siegener Forums vor einiger Zeit seine Forschung darstellte, war ihm die Mitteilung wichtig, Adolf Haas sei kein Antisemit gewesen. Dazu kam Widerspruch aus dem Auditorium. Das wiederholte sich dann, wie das Internet ausweist, auch andernorts, in Celle: http://www.bunteshaus.de/index.php/news/467-der-kz-kommandant-adolf-haas-war-ein-ns-moerder.
Die Reaktion des Autors auf die Kritik überzeugt nicht, auch nicht, wenn er dazu übergegangen ist, Haas nicht als einen „radikalen“ Antisemiten zu sehen.
Adolf Haas beantragte ausweislich seiner NSDAP-Nr. 760.610 bereits 1930 die Mitgliedschaft in einer Partei, die permanent den zu diesem Zeitpunkt militantesten Antisemitismus im deutschen Parteienspektrum demonstrierte. Es wäre lebensfremd anzunehmen, dieses herausragende Merkmal seiner Partei habe er nicht recht bemerkt oder es wäre ihm irgendwie gleichgültig gewesen. Der Sichtweise eine militante Praxis folgen zu lassen, war unter den Bedingungen des Verfassungsstaats und noch starker Gegenkräfte zum Faschismus zu diesem Zeitpunkt eher schwierig. Die allmähliche Radikalisierung des modernen Antisemitismus bis schließlich hin zu den Massenverbrechen musste erst noch in Gang kommen. Haas ging diese Entwicklung Schritt für Schritt mit. Ein Widerspruch ist nicht bekannt, zu keinem Zeitpunkt und würde kein bisschen ins Bild dieses Paradenazis hineinpassen.
Wenn das frühe Bekenntnis von Haas zu seiner Partei ein Bekenntnis auch zum Antisemitismus war, was heißt das dann?
Der „moderne Antisemitismus“ geht – so die Rassismusforschung – bei „den Juden“ von der Fiktion einer geschlossenen, homogenen ethnisch-biologischen und ethnisch-kulturellen Bevölkerungsgruppe („Volksgruppe“, „Volk“) aus. In einer Hierarchie der „Völker“ seien diese Juden – kenne man einen, kenne man alle – ganz unten einzuordnen. Ganz oben: als arischer Antipode, eine ebenso homogene „deutsche Volksgemeinschaft“, die Oberguten.
Das ist ganz ohne den körperlichen Übergriff auf die vielleicht verhasste, vielleicht aber auch nur einfach als gefährlich, störend oder sonstwie abgelehnte Gruppe die radikale Verneinung der Gleichheitsvorstellung und der daraus abgeleiteten Menschenrechte. Und das soll noch nicht radikal sein? „Radikal“ werde der Antisemit erst, wenn er Schaum vor dem Mund habe oder zum Totschläger greife?
Sollte es wirklich so sein, dass der Autor Jakob Saß Antisemitismus es für akzeptabel hält, wenn Antisemiten unterhalb solcher Grenzen bleiben? Akzeptanz für Antisemitismus, Diskursfähigkeit zugestanden, nur „radikal“ soll er nicht sein? Ich gehe mal davon aus, dass Saß das nicht so sieht, dass er einfach nur ohne große Überlegung in eine übliche ideologische Falle hineingelaufen ist, in die Extremismus/Radikalismus-Falle.
Sie setzt das Böse mit „Radikalismus“ gleich, versetzt es an politische Ränder und verortet das Gute in einer angeblich ideologiefreien gesellschaftlichen und politischen Mitte. Er sei, sagt Jakob Saß in Entgegnung der Celler Kritik, jemand, „der Faschismus, Rassismus, Antisemitismus und sonstige radikalen Ideologien ablehnt“. Auch „radikalen“ Humanismus? Auch „radikale“ Aufklärung? Auch eine „radikale“ Praxis der Menschenrechte?
Bei der allüberall aufgestellten Falle handelt es sich um Politikmodell auf Schülerniveau (Wolfgang Wippermann), also für die Schule. Seine pädagogische und mediale Verbreitung scheint im Kontext seiner politischen Nützlichkeit zu stehen, sein Erklärungswert ist gleich Null.
Im Fall Haas beweist sich das durch die justizielle Perspektive. Die fragte nicht nach dem Grad persönlicher „Radikalität“ von Akteuren (sehr, mittel, wenig), sondern war sachorientiert. In den 1960er Jahren ging es in Wien um die Verfahrenseröffnung zu Anton Burger, Adolf Eichmann, Adolf Haas usw. Die Justiz fragte schlicht nach „ihrer Mitwirkung … an der Endlösung der Juden/Jüdinnenfrage u. Mitschuld am organisierten Massenmord“ (https://collections.ushmm.org/findingaids/RG-17.003M_01_fnd_de.pdf).
Und noch ein Punkt: in dem Online-Beitrag von Sass heißt es, „so entwickelte sich in Bergen-Belsen ein eingeschränktes kulturelles Leben.“ Innerhalb der Opfergemeinschaft, weil vereinzelt Opfer etwa Täter porträtieren mussten? Oder innerhalb gar einer auf diese Weise gegebenen Opfer-Täter-Gemeinschaft? Nein, Täter bedienten sich ihrer Opfer auch zu „kulturellen“ Zwecken, in Bergen-Belsen, in Auschwitz, in Buchenwald und an anderen Vernichtungsorten. Das als „kulturelles Leben“ einzuordnen, geht völlig daneben.
Ist eigentlich bekannt, dass es auch in Siegen in diesen Jahren einen „Republikanischen Club“ gab (der sich in der damals in der Burgstraße existierenden Gaststätte traf)?
In der regionalen Literatur erscheint der „Republikanische Club“ m. W. nur (?) in Verbindung mit dem Schülerinnenstreik am Lyzeum. Eine eigenständige Publiaktion ist mir nicht bekannt und wäre daher – auch in Anbetracht des Jubiläums – lohnenswert. Vielleicht auch in einem größeren Zusammenhang – NPD-Parteitag in Siegen 1968, Sit-in auf der Haardter Kreuzung in (Siegen-)Weidenau, ……
Der „Republikanische Club“ begegnete mir an zwei Orten:
– in Gesprächen in der ersten Hälfte der 1970er Jahre (ich kam 1972 nach Siegen) mit damaligen Akteuren aus SPD und DKP und deren Umfeld. Inzwischen gab es wohl einen Riss in der ursprünglichen Gemeinsamkeit.
– in einem längeren Gespräch mit einer Kollegin viele Jahre später, die damals als Noch-Schülerin mit Leuten aus der Szene gut bekannt war.
Vielen Dank für die kritische Würdigung der bisherigen Forschungsergebnisse! Bleibt zu hoffen, dass diese in die von Saß beabsichtigte Biographie – https://www.startnext.com/adolf-haas-biografie – Einzug findet.
Hallo Herr Schneider, Beiträge und Kommentar können Sie bequem mit einem RSS-Reader abonnieren. Links zu den beiden RSS-Feeds finden Sie am Seitenende. Den Reader müssen Sie bei sich installieren.
Lieber Kollege Dr. Graf, siwiarchiv stellt tatsächlich seinen Leserinnen und Leser unkommentiert Informationen zu veröffentlichten Findmitteln vor – im Vertrauen darauf, dass die Leserschaft sich selbst ein Bild vom Nutzen des Vorgestellten macht, indem sie z. B. das Findmittelvorwort lesen. Meist erfolgen die Veröffentlichungen auf siwiarchiv nicht grundlos. Es ist in der Tat so, dass Kommunalarchive Anfragen erhalten, die lediglich Abbildungen kommunaler Wappen zum Inhalt haben. Vor diesem Hintergrund mag selbst diese von Ihnen als bescheiden bewertete Information sowohl für die Kolleginnen und Kollegen in westfälischen Kommunalarchiven – sofern sie denn siwiarchiv lesen – , als auch für deren potentiellen Nutzerinnen und Nutzer hilfreich sein.
Aufgrund der Malerei oberhalb des Fensters sowie des Daches würde ich das Bild im Schweizer Raum verorten. Wenn die Ortsangabe Krombach stimmen sollte: Es gibt ein Krombach bei Herisau, Kanton Appenzell Ausserrhoden. Vielleicht gibt es in der Google Bildersuche etwas dazu…
Zur Geschichte des Landgerichtsgefängnisses Siegen ist der Bestand „Landgerichtsgefängnis / Justizvollzugsanstalt Siegen“ (Signatur : Q 925) des Landesarchivs NRW, Abt. Westfalen, auszuwerten, denn er enthält 90 Akten in18 Kartons (Generalakten und Gefangenenpersonalakten) mit einer Laufzeit von 1925 bis 2003. Im Kartenbestand des Landesarchivs NRW, Abt. Westfalen, befinden sich Baupläne von Massnahmen der 70er und 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts.
Gut, recherchierter Artikel. Nicht zu vergessen, dass der Zugang zum lebenswichtigen Holz nur einigen wenigen Erben vorbehalten war. Ein Grund warum Förster und Jäger seit jeher von den einfachen Leuten verhasst waren. Sie glaubten daran, dass Gott den Wald für alle Menschen hat wachsen lassen und sahen in ihrer Not nur selten ein fürs Brennholzsammeln bestraft werden zu sollen.
Mein Beitrag mit dem Titel „Zukunft der Kommunalarchive – Kommunalarchive der Zukunft“ ist soeben im Archivamtblog erschienen unter https://archivamt.hypotheses.org/5985
Oben im Text hat sich offenbar ein Fehler eingeschlichen. Unter den Arbeiten von A. Sonntag wird auch ein Wohnbau für Herrn Barich aufgeführt. Bei Herrn Barich handelt es sich um Dr. h.c. Karl Barich, der von 1954 bis 1970 Vorsitzender des Vorstandes der Stahlwerke Südwestfalen, anschließend bis 1975 Vorsitzender des Aufsichtsrates war. „Die Villa im Bungalowstil“ ist mithin Dienstwohnung dieses Unternehmens und nicht der Birlenbacher Hütte!
Ergänzung zu den Kirchenbauten:
Dortmund, Maria Heimsuchung (Do-Bodelschwingh), 1975-1977, Gemeindezentrum mit integrierter Kirche und Turm, vgl. Paul Montag u.a. (Hgg.), Die katholische Kirche in Dortmund, Paderborn 2006, S. 344-345.
Danke für die Ergänzung! eine ausführliche Bearbeitung der Bauten des Architekturbüros Sonntag steht noch aus und jeder weitere Hinweis ist daher hilfreich. Interessant wären auch die Industriebauten Sonntag kennen zu lernen.
Anm. des Administratoren:
Dieser anonyme Kommentar wurde als Spam gewertet und daher gelöscht. Auf Punkt 9 der im Editorial genannten Grundregeln von siwiarchiv wird eindringlich und letztmalig hingewiesen.
Vielen Dank für diesen ebenso wichtigen wie anregenden Beitrag zur Blogparade! Er nimmt sich mit der Archivpolitik eines der wichtigsten archivischen Arbeitsfelder an, denen sich die Archive bzw. Archivierende in Zukunft widmen müssen – um im Verteil“kampf“ der Kulturinstitutionen gehört zu werden.
Es wäre schön, wenn Artikel, die aus fremder Feder stammen und unter dem Label „Stadtarchiv Siegen“ hier eingestellt werden, letzterem vor Veröffentlichung einmal vorgelegt würden. Man könnte dann die gröbsten Fehler ausmerzen!
Anm. des Administrators:
1) Für das Einstellen ohne Rücksprache entschuldige ich mich.
2) Dem Eintrag ist m. E. allerdings deutlich zu entnehmen, dass es sich nicht (!) um einen redaktionellen Eintrag des Stadtarchivs handelt, sondern lediglich um einen „Linktipp“. Damit ist deutlich, dass Fehler nicht vom Stadtarchiv zu verantworten sind.
Alle guten Dinge sind drei – vielen Dank für diesen Beitrag, der alle zukünftigen archivischen Baustellen – jenseits der Technik – darstellt und erläutert! Einer Zusammenfassung der Blogparade vorgreifend würde ich sagen, dass die 3 bis jetzt vorliegenden Beiträge zur Blogparade ein beachtliches Bild der archivischen Zukunft zeichnen.
Meine Dinosaurier-Generation ist (sicher zum Leidwesen der Blogparadeure) noch nicht restlos ausgestorben. Es wäre also aus Pietätsgründen nett, wenn der Unfehlbarkeitsanspruch der Bloggerszene in der Öffentlichkeit vorerst noch etwas weniger offensiv artikuliert werden könnte. Habt ein bißchen Geduld! In absehbarer Zeit wird es keine Störenfriede mehr geben, und diese konstruktivistisch verhunzte Welt gehört euch ganz allein.
Nebenbei: Die Idee des simultanen Säuglingspflege- und Archivarbeitsraumes ist einfach genial! Wenn sich der Sprößling nach dem Stillen über die Archivalien erbricht, kommt endlich mal Leben in die Bude.
Sehr geehrter Herr Kunzmann,
in meinem Beitrag gehe ich auch für die Zukunft davon aus, dass Archivnutzung auch im Lesesaal stattfinden wird, in vielen Archiven auch teilweise noch mit nicht digitalisierten Akten & Co., die man anfassen kann. Sollte der Eindruck entstanden sein, Archivarinnen und Archivare würden das nicht vermissen, möchte ich widersprechen. Und Nutzerinnen und Nutzer als Störenfriede – das ist nicht mein Verständnis von heutiger und zukünftiger Archivarbeit, womit ich sicherlich nicht allein dastehe. Jedem Tierchen sein Pläsirchen – auch den Dinosauriern!
Wie aus dem Zusammenhang klar hervorgehen dürfte, meinte ich mit „Störenfrieden“ nicht die Archivnutzerinnen und -nutzer, sondern die (aus Ihrer Sicht letztendlich entbehrlichen) „Tierchen“, denen diese ganze Bloggerei suspekt ist.
Sie haben offensichtlich jeden einzelnen der Beiträge zur Blogparade nicht verstanden und darüber hinaus keine Ahnung von dem Auftrag, den Archive erfüllen. Es geht um ein Miteinander und Füreinander, auch mit und für Dinosaurier. Jedoch ohne Personen, die sich lieber in Problemen suhlen, statt gemeinsam Lösungen zu finden.
Nebenbei: Es gibt derzeit ja nicht einmal Arbeitsräume, in denen digitales Archivgut oder digital und analog vorhandene Findmittel mit Kind genutzt werden können. Eine verstärkte Digitalisierung von Archivgut zur Nutzung vom heimischen Arbeitsplatz wäre eine zusätzliche Unterstützung. Wie sie forschenden Müttern und Vätern das Verantwortungsbewusstsein für den Erhalt von Originalen absprechen ist außerdem äußerst fragwürdig.
siwiarchiv erreichte folgende Korrektur der oben genannten PDF-Datei „Lehrer3345″:
“ …[Reinhard] Lüster war nie VS-Lehrer in Birlenbach (….), er war bis zum Ausscheiden 1938 Leiter der „Wilhelm- und Augusta-Schule“, im Volksmund „Flurschule“, die in der Weidenauer Flurstraße war und später zur Bismarckschule wurde. Diese Schule besuchte auch das „Euthanasie“-Opfer Lina Althaus. Inge Frank war bis zum Wechsel ins Lyz dort ebenfalls Schülerin, s. Foto S. 22, Familie Frank aus Weidenau (K. Dietermann).
Eine tolle Geschichte. „Neue Formate zur Vermittlung fern alter Vorurteile“. Oder: „Für diverse Vorurteile wird die Luft dünn.“ Das schlägt ein. Damit kann man für Furore sorgen und neue Wege der Kunstvermittlung asphaltieren. Hehre Ziele, die in dieser Wortwahl aber nur stereotype Klischees bedienen und die implizieren: Archive sind staubtrockene, spröde, altbackene „Aufbewahrungskästen“. Nur Museen dürfen nach dieser Lesart also Verve versprühen, den kulturellen Dialog fördern, Fachinformationen vermitteln oder „Formate für viele Zielgruppen“ anbieten – möglichst „[…] in unverkrampfter, freier Atmosphäre“. Frau Drews meint, nicht ganz zu Unrecht natürlich, ein Museum solle auch ein sozialer Ort sein. Allerdings: Sind Archive keine sozialen Orte? Eine eindimensionale Sichtweise, die angesichts der vielfältigen Herausforderungen, denen sich Archive zu stellen haben, Befremden hervorruft. Ja, auch Archive sind im 21. Jahrhundert angekommen, verbarrikadieren sich nicht in einem imaginären Elfenbeinturm (sind also keine „elitären Häuser“) und sind längst multifunktionale Dienstleister. Für Historiker, für Genealogen, für kooperierende Kulturinstitute, für Anfragen aus der Verwaltung und Politik, für Studierende und Schulklassen. Für alle Bürgerinnen und Bürger, für alle Besucherinnen und Besucher, die sich mit Fragen der regionalen und lokalen Geschichte beschäftigen und das ganze Spektrum individueller Interessen und Fragestellungen mitbringen. Wahrlich, ein Standardrezept dafür gibt es nicht, das hat augenscheinlich auch die Volontärin des Museums für Gegenwartskunst erkannt. Individuell werden auch in Archiven im Rahmen persönlicher Gespräche gewünschte Informationen zur Verfügung gestellt, Betrachtungsweisen ausgetauscht und Lösungsvorschläge unterbreitet. Als ob das ein Alleinstellungsmerkmal für Museen wäre! Man gestatte mir den Hinweis auf das Stadtarchiv Siegen, das als anerkannter „Bildungspartner NRW“ zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Schulen fördert, damit Kinder und Jugendliche – ganz unabhängig von ihrer sozialen Herkunft und kulturellen Prägung – von dem außerschulischen Lernort „Archiv“ profitieren können. Archivpädagogische Maßnahmen, Workshops und Seminare unterstreichen die generationsübergreifende, soziale Komponente des „Aufbewahrungskastens“. Dann die Veranstaltung des „Siegener Forums“, in dem Vorträge und Themen (übrigens auch zu kunstgeschichtlichen Aspekten) angeboten und zur Diskussion gestellt werden. Je nach thematischem Schwerpunkt werden sogar Personen angesprochen und zum Meinungsaustausch eingeladen, die bislang eher selten ein Archiv aufgesucht haben. Die Organisation und Realisierung von Ausstellungsprojekten. Das gemeinsam mit der Geschichtswerkstatt Siegen im Jahr 2016 erfolgreich im Siegerlandmuseum im Oberen Schloss konzipierte Projekt „Siegen an der ‚Heimatfront‘ 1914-1918: Weltkriegsalltag in der Provinz“ mit begleitendem Rahmenprogramm für Schülerinnen und Schüler, mit einem didaktischen Konzept, das alle Altersgruppen berücksichtigen sollte. Man lese und staune: auch Archive kauen keine Interpretationen vor, stellen sich bohrenden Fragen und verschließen nicht die Augen vor der gesellschaftlichen Entwicklung, ja sind in gewisser Hinsicht ja sogar ein Abbild des Wandels!
Übrigens steht das Stadtarchiv Siegen auch bei Fragen wie etwa zum Rubenspreis der Stadt Siegen zur Verfügung, nicht nur dem Museum für Gegenwartskunst und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dafür sind sie dann gut genug – die tristen „Aufbewahrungskästen“.
Es ist wahrscheinlich das Fachwerkhaus , daß vor ca. 20 Jahren in Hilchenbach nur als Gebälk versetzt werden mußte, um so für die Verbreiterung der B 508 Platz zu schaffen.
Leider kann ich aus terminlichen Gründen nichts Weiteres mitteilen. Aber evt. kann das Stadtarchiv Hilchenbach da weiterhelfen …… Übrigens, die Aufnahme stammt aus dem Jahr 1954.
Ganz sicher Niederdresselndorf. Das Foto ist etwas größer abgebildet in
„Niederdresselndorf – Geschichte eines Dorfes“ . Herausgegeben vom Heimatverein Niederdresselndorf 2004.
Das Haus stand in Eiserfeld und wurde abgebrochen.
Es stand an der Eisentalstraße / Wilhelmstraße.
Das Haus sollte als Krankenhaus genutzt werden, wurde es aber wohl nie, da sein baulicher Zustand zu schlecht war.
(Quelle: Eiserfeld, Im grünen Kranz der Berge, Herausgegeben im Auftrag des Eiserfelder Heimatvereins 1992)
Ohne den Hinweis von Landvogt88 hätte ich das Haus nicht identifizieren können.
Die Antwort von Torsten ist korrekt. Heute wird das Gelände an der Eiserntalstraße / Ecke Wilhelmstraße als Parkplatz neben der Metzgerei Hennche (Stammhaus) genutzt bzw. liegt gegenüber der Bäckerei Cronrath.
Der vortragende Referent ist Herr Bernd Brandemann.
Er ist der Vorsitzende eines Arbeitskreises für Stadt- und Baugeschichte Freudenbergs im veranstaltenden Verein
4fachwerk e.V. dem Träger des Mittendrin-Museums im historischen Stadtkern Freudenberg.
Außer diesem Verein ist der Verein Frids e.V. durch eine besondere Stadtführung von Jugendlichen für Kinder und Jugendliche (Eltern und Omas incl.) in die Gesamtmaßnahme einbezogen. Dazu wird auf die
Berichterstattung des WDR FS Siegen verwiesen.
Mit freundlichen Grüßen aus der
Fachwerkstadt Freudenberg
I.A.
Detlef Köppen
Stadtarchivar
Die Fotos mit Willy Brandt wurden gegenüber der Einmündung der L 718 (Friedrichshütte) in die Bundesstraße 62 gemacht. Aus Richtung L 718 in Richtung B 62 gesehen rechts, befand sich damals das „Hotel Fasanerie“ (ehem. Inhaber: Stähler), dessen Hauptgebäude bzw. ein damaliger Neubau mit Flachdach im Hintergrund der Fotos rechts zu sehen sind. Die Straßenschilder, vor denen Herr Brandt steht, waren damals im Vordergrund eines kleinen ehemaligen Steinbruchs montiert. Das Hotel war in dieser Zeit eines der besten in Wittgenstein. Ich kann mich an einen Besuch des Bundespräsidenten Lübke erinnern, der dort ebenfalls bewirtet wurde. Insofern ist es sehr wahrscheinlich, dass auch Willy Brandt im dortigen Hotel mit seinem „Tross“ eingekehrt ist. Ich kann gerne in den nächsten Tagen einmal dort vorbeifahren und den aktuellen Blickwinkel „einfangen“.
Es war tatsächlich die Ecke, wo die Straße von Banfe kommend auf die B62 führt. Damals hieß das angesprochene Hotel „Hotel Fasanerie“, war die erste Adresse im Ort, nicht zuletzt wegen der 2-3 Tennisplätze, auf dem die Honorigen der Stadt spielten. Ich erinnere mich, dass im Vorfeld der Durchfahrt von Willy Brandt, seine Ankunft im Radio oder in der Zeitung angekündigt wurde. Ich wohnte damals auf der Amalienhütte in Niederlaasphe. Ich lugte an diesem Tag mit meiner Oma und Kissen unter den Ellenbogen aus dem Fenster in der 1.Etage. Wir sahen, wie er mit einem rabenschwarzen Wagen auf der B62 an unserem Haus vorbeifuhr. Leider habe ich ihn nicht auf dem Marktplatz (?) sprechen hören, da meine Eltern eher dem Gegenkandidaten, Kurt Georg Kiesinger zugeneigt waren. Den musste ich anhören dürfen…
Vielen Dank für die Erinnerung! Quasi als Trost folgt nun der Bericht der Westfalenpost vom 22. August 1969 über den Besuch Brandts in Laasphe:
„Urlaubsgebräunt stand gestern nachmittag Bundesaußenminister Willy Brandt auf dem Podium des Wilhelmplatzes in Laasphe. Tausend mögen es gewesen sein, die aus Laasphe und mit Omnibussen aus dem ganzen Wittgensteiner Land hergekommen waren und zum ersten Male einen sozialdemokratischen Parteivorsitzenden in Wittgenstein erleben konnten. Landrat Möhl hieß ihn mit einem Gastgeschenk willkommen, ebenso der Siegerländer Landrat und Bundestagsabgeordnete Hermann Schmidt.
Willy Brandt sagte seinen Zuhörern, was die SPD veranlasst habe, mit der CDU/CSU eine Koalition einzugehen. Er sprach auch davon, dass es hier vor vier Jahren dem heimischen Bundestagsabgeordneten, Prinz Botho, gelungen war, einen Direktsieg gegen den sozialdemokratischen Kandidaten zu erringen, und er meinte, das Wahlergebnis müsse diesmal umgekehrt laufen.
Nach dem Konzept des SPD-Vorsitzenden, das er in Laasphe während seiner halbstündigen Ansprache kurz ausbreitete, gehe es der SPD um folgende Wahlentscheidungen:
Ob die Wirtschaft stabil bleiben und Arbeitsplätze erhalten werden könnten.
Ob die notwendigen Reformen in Wirtschaft, Forschung, Verkehrswesen und Städtebau rasch durchgeführt werden könnten.
Ob unsere Jugend bessere und ausreichende Bildungsmöglichkeiten eröffnet werden könnten.
Ob der Staat für mehr Gerechtigkeit sorgen könne, beispielsweise durch eine Steuerreform und in der Vermögenspolitik.
Ob es mehr Demokratie bei uns geben könne.
Ob die Freundschaft zu den Nachbarvölkern und die Zusammenarbeit mit allen Staaten rasch weiter ausgeweitet werden könne.
Zum letzten Punkt machte der Außenminister auch einen Rechtfertigungsversuch gegenüber den Angriffen, die gegen die drei Moskaureisenden der SPD ausgerechnet zum Jahrestag der tragischen Geschehnisse in der Tschechoslowakei erhoben worden sind. Jede Gelegenheit, so meinte Willy Brandt, müsse willkommen und jeder Termin recht sein, wenn es darum geh, Spannungen abzubauen und in Moskau deutsche Interessen zu vertreten.
Nach der Ansprache, die nur ein einziges Mal von Beifall unterbrochen worden war, führ Willy Brandt und mit ihm eine größere Bonner Presseeskorte weiter nach Koblenz.“
Die "Willy-Brandt-Kreuzung" 49 Jahre später – vielen Dank an die beiden Fotografen! Am Baum, wo einst der Wegweiser stand, könnte man jetzt eigentlich eine große Tafel mit dem Foto aufstellen … pic.twitter.com/0Z3z0B3HHt
Sehr schöne Bilder, aber ich glaube nicht, dass das zweite Bild in Erndtebrück aufgenommen wurde. Ich kenne das Alte Rathaus und da passt das Bild überhaupt nicht.
Hallo, ich bin es noch mal.
Mein Vater, Gregor Leipelt, war damals dabei. Das zweite Foto wurde auf der Treppe des „Westfälischen Hofes“ in Erndtebrück aufgenommen. Das Gasthaus existiert heute noch.
Promotion an der Universität Berlin 1880. Ein Digitalisat der 39seitigen Dissertation „Experimente über die Chinin-Wirkung insbesondere auf das gesunde menschliche Gehörorgan“ ist unter
digital.bib-bvb.de/publish/content/41/4562995.html
zu finden, darin auf der letzten Seite auch ein kurzer Lebenslauf mit Angaben zu Schulbildung und Studium.
Im Fürstlichen Archiv Berleburg liegt als Regest vor (Sign. Ber.Uk-2891):
„Befundbericht des Medizinalrates Dr. Guder in Laasphe über die Leiche seiner Durchlaucht, des Hochseligen Fürsten Albrecht II. zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg“.
Ein Nekrolog lässt sich ermitteln in: Münchener Medizinische Wochenschrift 73 (1926), S. 576-577 (anscheinend nicht digitalisiert, könnte man über Fernleihe bestellen).
Als Kreisphysikus müsste Paul Guder etliche Spuren in der Überlieferung des Wittgensteiner Landratsamtes hinterlassen haben (Mikrofilme davon, wenn ich mich nicht irre, im Stadtarchiv Berleburg).
Vielen Dank für die Hinweise! Da kann man ja jetzt weiterrecherchieren.
Ich habe mir die Dreistigkeit erlaubt, den Lebenslauf aus der Dissertation hier einzustellen:
Literatur zu Martin Schulz:
1) Kirsten Schwarz: Martin Schulz – ein Maler des Lichts, in Siegerland Bd. 89 Heft 1 (2012), S. 67 – 91
2) Siegerländer Heimtakalender 1970, S. 70
3) Vereins der ehemaligen Schüler des Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium (Hrsg.): 75 Jahre Höhere Schule in Weidenau. Festschrift zur 75-Jahr-Feier des Fürst Johann-Moritz-Gymnasiums Siegen-Weidenau, Siegen 1989, S. 2949, 59, 218, 219, 221, 224, 257
4) Nachrichtenblatt des Vereins der ehemaligen Schüler des Fürst-Johann-Moritz-Gymnasiums Hüttental II/1972, S. 10f
Nachtrag (gestern vergessen):
Die Universität Marburg selbst gibt für die Verleihung der Ehrensenatorenwürde das Datum 10.02.1923 an (nicht 1925). Die Ehrung erfolgte „als Anerkennung für die Zuweisung von wertvollem Sektionsmaterial und von Kranken mit seltenen Krankheitsbildern sowie für die Überlassung von wissenschaftlichen Werken an die Bibliothek“.
(www.uni-marburg.de/de/universitaet/profil/geschichte/ehrensenator-innen)
Es ist also denkbar, dass sich in der medizinhistorischen Sammlung der Uni Marburg (www.uni-marburg.de/fb20/museum-anatomicum) noch präpariertes Sektionsmaterial aus dem einstigen Besitz Guders befindet. Sollte Herr Bald Freude an solchen Konserven haben, wäre das vielleicht interessant.
Sehr geehrter Herr Kunzmann,
herzlichen Dank für ihre fundierten Hinweise, denen ich teilweise bereits nachgehen konnte. Nach Einsichtnahme in die Dissertation des Dr. Guder konnte ich eben den Nachruf in der Münchener Medizinischen Wochenschrift antiquarisch ermitteln, da mir eine Fernleihe zu aufwändig erschien. Insofern kann ich ihn jetzt auch digital zur Verfügung stellen:
„Paul Guder
Es erscheint mir nicht unbescheiden, wenn einmal an dieser Stelle auch über einen der tüchtigsten Aerzte aus der Zahl der praktischen Aerzte ein Nachruf veröffentlicht wird, wie es sonst nur bei hervorragenden Männern der Wissenschaft üblich ist. – Ein solcher, sich über das Niveau erhebender und hervorragender Mensch und Arzt war Paul Guder.
Paul Guder, der am 7. Dezember 1925 im 71. Lebensjahre starb, war, im Jahre 1881 approbiert, nach erfolgreicher Assistentenzeit, wo er Schüler von Flechsig und Binswanger war, an verschiedenen Heilanstalten tätig und ließ sich dann in Laasphe in Westfalen als praktischer Arzt nieder, wo er im folgenden Jahre zum Königl. Preußischen Kreisarzt für den Kreis Wittgenstein ernannt wurde. Sein ärztliches Arbeitsfeld war ein sehr umfangreiches und vielseitiges. Neben seiner großen allgemeinärztlichen Praxis, die ihn bis in die oft sehr weit entlegenen und schwer erreichbaren Dörfer des gebirgigen Wittgensteiner Landes (Sauerland) führte und an sein geburtshilfliches und chirurgisches Können und an seine diagnostische Begabung oft große Anforderungen stellte, hatte er einige Jahre später durch seine kassenärztliche Tätigkeit und durch sein Amt als Bahnarzt ein weiteres Gebiet, hier besonders für seine sozialen Bestrebungen, hinzugewonnen. Die Bevölkerung des Kreises Wittgenstein und der Stadt Laasphe hatte für ihre Bedürfnisse in Guder, dessen Arbeit von wirklich ärztlich humanem Geist durchdrungen war, einen verständnisvollen Berater. Er ließ seine dienstliche Stellung, seine wissenschaftlichen Bestrebungen und seine organisatorischen Fähigkeiten sich stets zum Nutzen der Bevölkerung auswirken, sei es in der Fürsorgetätigkeit, sei es für Schulen, sei es für die hygienischen Bedürfnisse der Gemeinden. In letzteren fehlte z.B. bei seinem Dienstantritt noch recht viel an hygienischen Einrichtungen: So sind auf seinen Antrag während seiner Dienstzeit allein 28 Wasserleitungen gebaut worden. Sein umfassendes Wissen, seine Kritik und seine Urteilskraft ließen ihn in der Verfolgung des einmal als richtig Erkannten nicht erlahmen; seine Erfahrung auf vielen Gebieten, seine stete wissenschaftliche Fortbildung machten ihn für Genossenschaften und Regierung zu einem anerkannten Gutachter.
Immer war Guder bemüht, sich wissenschaftlich weiterzubilden, er verblieb in Konnex mit der Wissenschaft; besonders pflegte er die Verbindung mit den Instituten und Kliniken der nahe gelegenen Universität Marburg. Diese Verbindung nutzte er zum Nutzen der Kranken. Guder war stets bemüht, seinen Kranken die Vorteile einer Krankenhausbehandlung zu verschaffen, und tat dies oft mit größter Energie und oft unter persönlichen Opfern. Er ließ Kranke aus den entlegensten Gebirgsdörfern in die Marburger Kliniken transportieren. Dieses Verhalten erkennt besonders rühmend der frühere hervorragende Direktor der chirurgischen Universitätsklinik in Marburg an. Herr Geheimrat Prof. Dr. Ernst Küster schreibt in seinem Buche: „Zwei Schlußjahre klinisch-chirurgischer Tätigkeit“ 1909 (Berlin, Aug. Hirschwald), als er auf S. 215 das weit ablehnendere Verhalten der Landbevölkerung gegen Operationen und die hierdurch veranlaßten Schwierigkeiten in der Behandlung verschleppter und zu spät operierter Fälle betont, daß gerade in der Ueberwindung solcher schwieriger Verhältnisse Guder eine nie erlahmende Energie, selbst unter persönlichen Opfern gezeigt habe, – Daß Guder die Ausführung von Operationen in seinem Hause und selbst in entlegenen Ortschaften, hier oft unter primitivsten Verhältnissen ermöglichte, ist bekannt: Die Aerzte der chirurgischen Klinik in Marburg waren ihm hierbei stets bereite Helfer. Ein ganz besonderes Verdienst hat sich Guder dadurch erworben, daß er den Kliniken der Universität Marburg Kranke zuwies und dem anatomischen und dem pathologischen Institut stets von seinen Sektionen reichliches Material zuschickte. Die Universität Marburg (Lahn) hat die großen Verdienste Guders um die Universität, um die medizinische Wissenschaft und die Kliniken dadurch anerkannt, daß sie ihn zum Ehrenbürger der Universität Marburg ernannte.
Guder hat sich verschiedentlich wissenschaftlich betätigt; er war früher Spezialist auf dem Gebiete der gerichtlichen Medizin. Sein im Jahre 1881 erschienenes Kompendium der gerichtlichen Medizin (Abels Medizin. Lehrbücher, Verlag Joh. Ambros.Barth, Leipzig) war früher ein viel gebrauchtes, durch seine klare Schreibweise und gute Dispostion ausgezeichnetes Buch. – Ein anderes von ihm bearbeitetes Gebiet betrifft den Zusammenhang zwischen Trauma und Tuberkulose (Vierteljschr. F. gerichtl. Med., 3. Folge VII, 1894). Die land- und forstwirtschaftlichen Unfälle im Kreise Wittgenstein hat er durch Franz Fischer 1901 in einer Dissertation zusammenstellen lassen. – Eine von Guder in Angriff genommene historische Darstellung auf dem Gebiete der Irrenanstalten ist leider nie zum Abschluß gekommen., obgleich er gerade auch anerkannter Fachmann durch seine irrenärztliche Tätigkeit war.
Guder stellte sich auch in den Dienst des ärztlichen Vereinswesens; er war für Zusammen-fassung und Zusammenschluß der Aerzte, um eine für den ganzen Stand nützliche Arbeitsgemeinschaft zu erzielen.
Die Hochhaltung kollegialer Gesinnung war einer seiner vornehmsten Bestrebungen. Infolgedessen war Guder eine weit über den Kreis seiner praktischen Tätigkeit nicht nur bei der Bevölkerung, sondern auch in großen Aerztekreisen bekannte und angesehene Persön-lichkeit. Er war Gründer und Vorsitzender des Aerztevereins des Kreises Wittgenstein und Ehrenmitglied des Marburger ärztlichen Vereins.
Guder war eine edle, in sich gefestigte, knorrige Persönlichkeit, unter deren rauher Außenschale sich eine Seele und ein anständiger Charakter dem Kundigen offenbarte. Eine solche Persönlichkeit wie Guder konnte sich abseits der Großstadt in einem uneingeschränkten Wirkungskreis voll entfalten. Mit Guder ist ein echter deutscher Mann dahingegangen, der auch in den schwersten Zeiten (im Kriege war er Leiter eines Vereinslazarettes) seiner Ueberzeugung treu blieb und sich mit seiner ganzen kräftigen Persönlichkeit für die Wiederaufrichtung des Volkes – hier durch stetiges Wirken und Werbearbeit beim einzelnen – einsetzte.
Paul Guder starb in Laasphe, nachdem er in der chirurgischen Universitätsklinik Marburg Heilung und Linderung seines Leidens vergeblich gesucht hatte. Er wurde unter großer Beteiligung der Bevölkerung, der Aerzteschaft, der Behörden, der Universität Marburg auf dem idyllischen Waldfriedhof bei Laasphe beigesetzt. Mit Guder ist einer der fleißigsten, pflichtgetreuesten Menschen und Aerzte dahingegangen.
Reinhardt – Leipzig“
Abdruck des Achenbach-Gedichtes „Der aale Vedderan“ in Karl Koch: Siegener Kriegsdenkbuch 1914 – 1919. Tagebuchblätter aus dem Weltkriege. Erstes Buch: Heldentum, Siegen 1919, S. 16-17
Bei dem „spannenden Exponat“, an dem sich die beiden Herren gerade ergötzen, handelt es sich um ein seinerzeit anscheinend in hoher Auflage unters Volk gebrachtes Porträt Hindenburgs „in Uniform mit Orden, Halbfigur / mit eigenhändiger Unterschrift und Vermerk ‚Möge unserm theuern Vaterlande der Geist von 1914 in hoffentlich langen Friedensjahren erhalten bleiben!'“ (https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction.action?detailid=v5148165)
Pfarrer Kuhlis Finger zeigt auf das Wort „Geist“, was wohl andeuten soll, dass man sich bei der Auswahl dieses Bildes durchaus etwas gedacht hat.
Das Ende dieser „Kundfahrt“ wurde auch in österreichischen Zeitungen wahrgenommen (Kleine Volkszeitung, 7.6.1939, Bregenzer/Vorarlberger Tagblatt, Freitag, den 9.6.1939). Frage mich, ob auch italienische Zeitungen berichtet haben ……
Das Geburtsjahr ist im o. g. Eintrag korrigiert.
Im Zusammenhang mit dem Siegener Synagogenbrand bin ich auf ein Zitat aus dem Aufsatz Kurt Schildes „NS-Verbrechen „vor der Haustür“ – Novemberpogrome 1938 Vergleich der juristischen Aufarbeitung 1948 in Felsberg und Siegen“, in: Jahrbuch der Juristischen Zeitgeschichte (2011), Band 12, Seiten 91-116 aufmerksam geworden. Im Wikipedia-Artikel zu Fissmer – https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Fissmer – heißt es: „…..Von der Siegener Staatsanwaltschaft wurde Fissmer 1948 zu dem Novemberpogrom 1938 befragt; gegen ihn selbst lagen dabei keine entsprechenden Beschuldigungen vor. Er sagte aus, dass er von der Aktion nicht in Kenntnis gesetzt worden sei und erst am Vormittag des 10. November von dem Brand der Synagoge Siegen erfahren habe. Danach habe er in seiner Funktion als „Polizeiverwalter der Stadt Siegen“ Polizei und Feuerwehr verständigt. Aus der Befragung ging nicht hervor, ob Fissmer selbst vor Ort war.“ Als Quelle wird S. 106 des Aufsatzes genannt.
Die regionalhistorische Forschungen (Klaus Dietermann, Kurt Schilde [Siegener Beiträge 2003], Ulrich F. Opfermann) terminiert den Brand der Synagoge auf den späten Vormittag (ca. 12:00) und geht von einer Zerstörung der Synagoge bis auf die Grundmauern aus s. a. https://de.wikipedia.org/wiki/Synagoge_Siegen .
Heute erschienen in der Print-Ausgabe der Siegener Zeitung zwei Leserbriefe, die sich gegen eine Umbenennung aussprechen: „Ideologisch motiviert“ und „Vollkommen absurd“
Mit diesen Leserbriefen hat eine Diskussion begonnen, die in ihren ersten Beiträgen an lokalpatriotischer Kleinkariertheit nicht zu übertreffen ist. Hauptvorwurf gegen den offenbar in Netphen beheimateten Siegerländer Bürger, der den Wunsch nach einer Umbenennung äußert: Er komme ja doch aus Netphen. Wie könne er sich da erdreisten usw. Ein dorfgemeinschaftlicher Appell soll die ortsfremden Überlegungen fernhalten.
Na, ohne hier groß auf Fissmer (so schrieb er selbst sich, mit doppeltem „s“. Wer die Quellen kennt, der weiß das) eingehen zu wollen. In Netphen war Andreas Vomfell ein Zeit- und Amtsgenosse von Alfred Fissmer. Vomfell war Mitglied des Zentrums und anders als Fissmer ein NS-Opponent und Verteidiger der Weimarer Verfassung. Bei ihm fanden 1933 Hausdurchsuchungen durch die SA inklusive Übergriff gegen die Tochter statt. Vomfell wurde von den Nazis aus seinem Amt vertrieben.
Gerade von Netphen also lässt sich zur Zeitgeschichte etwas dazulernen: Es ging auch anders. Auch in den 1920er/30er Jahren musste man im Siegerland nicht zum Nazi werden.
Heute erschien in der Printausgabe der Siegener Zeitung ein Leserbrief – „Fass ohne Boden“ – , der auf den o. g. Bezug nimmt und kritisch auf die Finanzierung des Projekt blickt, das die Namensdiskussion auslöste.
Liege ich sehr falsch mit der Annahme, es handele sich bei den Leserbriefen quasi um inoffizielle Stellungnahmen des Siegener Kriegervereins? (Ich weiß, der hat sich irgendwann mal umbenannt.) Dass die beiden Autoren (Ex-Pressereferent + Schützenkönig) sich fürsorglich vor ihren alten Vereinskameraden Fissmer stellen, ist menschlich nachvollziehbar und ein Ausdruck von Loyalität. Die abstrusen Inhalte zu kommentieren, wäre Energieverschwendung. Man muss Prioritäten setzen.
In einem der Leserbriefe wird als postnationalsozialistischer Unterstützer und Leumundszeuge von Fissmer ein Wilhelm Langenbach genannt, der 1954 Fissmer lobte, weil dieser als Bunkerbauer „die Zeichen der Zeit rechtzeitig verstanden habe“, sprich, erkannt habe, dass Hitler Krieg bedeutete. So sagten es allerdings bereits vor 1933 die NS-Gegner. Sie warnten damit vor der völkischen Machtergreifung durch die NSDAP und Bundesgenossen. Während von Fissmer, der sich ihnen insofern hätte anschließen können, in dieser Richtung kein Wort überliefert ist, wohl aber, dass er mit der Kriegsvorbereitung nach 1933 umgehend anfing: Garnison, Kasernen, Wehrmachtsdepot, Bunker für die Volksgemeinschaft und manches mehr.
Leumundszeuge Langenbach dürfte darin nichts Schlimmes gesehen haben. Zu den NS-Gegnern gehörte er ebenso wenig wie Fissmer. Der städtische Fürsorgesekretär war seit den 1920er Jahren Mitglied der Deutschvölkischen Freiheitspartei, einer engen Nachbarin der NSDAP, im Stahlhelm und in der Gesellschaft Deutsche Freiheit des Antisemiten Reinhold Wulle. Obwohl erst 1936 in die NSDAP aufgenommen – ein Ehrenzutritt während der allgemeinen Aufnahmesperre –, erhielt er den Titel „Alter Parteigenosse“, eine Auszeichnung.
Fissmer als Dienstherrn störte das nun nicht. Langenbach war nicht der einzige Verfassungsfeind in städtischen Diensten. Unter Fissmers Augen recherchierte Langenbach nach „Asozialen“, das waren für ihn gern Kombinationen aus den Vorstellungswelten „Zigeuner“ und „Kommunist“. Die von Langenbach erarbeitete umfangreiche kommentierte Liste ging anschließend an die Rassenhygienische Forschungsstelle in Berlin. Die listete einschlägige rassische Risikoträger für ihre spätere Deportation auf. Die der als „Zigeuner“ Verfolgten führte nach Auschwitz.
Langenbach war ein Gegner der Beseitigung von „Asozialen“ und „Zigeunern“ auf dem Weg ihrer Sterilisierung. Er vertrat eine anderes Konzept. Er gab zu bedenken, „daß, selbst wenn die weitere Fruchtbarkeit solcher asozialer Schädlinge eingedämmt würde, sie selbst nach wie vor am Leben bleiben und noch auf Jahrzehnte hinaus der Gesamtheit zur Last fallen.“ (Volk und Rassse. Illustrierte Monatsschrift für deutsches Volkstum, H. 1, 1939)
Spätestens 1949 leitete er übrigens das Wiedergutmachungsamt der Stadt Siegen und erhielt noch wieder später für seine Leistungen das Bundesverdienstkreuz.
Leserbrief der VVN-BdA Siegerland-Wittgenstein, erschienen in der SZ und der WP am 30.5.2018
Es ist sehr zu begrüßen, das sich der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Siegen mit der Namensgebung der öffentlichen Grünanlage in der Oberstadt befassen wird und sich mit der Person und der Vita von Alfred Fissmer auseinandersetzten muss. Leider geschieht dies nicht aus Eigeninitiative der gewählten Ratsmitglieder und ihrer Gremien, sondern wieder einmal bedurfte es des Anstoßes von „Außen“ um sich mit einem belasteten Namensgeber im öffentlichen Raum zu befassen.
Es ist sinnvoll, sich vor Augen zu führen, was ein Straßenname, oder die Benennung einer öffentlichen Anlage eigentlich bedeutet. Straßennamen sind immer Teil der Erinnerungskultur einer Gesellschaft und somit identitätsstiftend, dies gilt auch für die regionale Erinnerungskultur. Straßennamen nach Personen sollten also nur in den Kanon der Erinnerung aufgenommen werden, wenn die Integrität der Person geeignet ist, als Vorbild für nachfolgende Generationen zu dienen. Die Ehrung einer Person im öffentlichen Raum, zum Beispiel durch einen Straßennamen, ist eine der höchsten, die eine Gesellschaft vergeben kann.
Wie verhält es sich nun im Fall der Fissmer-Anlage?
Der Namensgeber Alfred Fissmer war nach bisherigem Kenntnisstand immer deutschnational gesinnt, von dieser Gesinnung bis zur Mitgliedschaft in der NSDAP war es nicht weit, was sein Aufnahmeantrag von 1933 belegt, durch den Aufnahmestopp konnte er erst 1937 Parteimitglied werden. Er tritt aber 1933 als förderndes Mitglied der verbrecherischen SS bei.
Es sind diese beiden Mitgliedschaften, die ihn für eine Ehrung im öffentliche Raum ausschließen, gleich aus welchem Grund sie erfolgten, gleich welche Verdienste er sich auf anderen Gebieten erworben haben mag.
Es sollten keine Straßen oder Plätze nach Mitgliedern der NSDAP oder ihrer Untergliederungen benannt werden! Sie gehören nicht in den Kanon der
öffentlichen Erinnerung unserer Stadt und Region.
Keine Ehrung von Mitgliedern der NSDAP im öffentlichen Raum!
Dieser Satz sollte eine allgemeingültige Handlungsmaxime sein.
Der Vorschlag, eine umfassende Biographie Fissmers durch MitarbeiterInnen des Stadtarchivs und der Universität Siegen erarbeiten zu lassen, um so eine Entscheidungsgrundlage zu erhalten ist ebenfalls zu begrüßen und diese Verfahrensweise sollte in Zukunft zum Standard der Universitätsstadt Siegen gehören und bestehende, nach Personen benannte Straßennamen, sollten entsprechend überprüft und gegebenenfalls umgewidmet werden. Ebenso sollte eine öffentliche Diskussion mit BürgerInnen und Organisationen angeregt werden.
Ton und Inhalt des Gesprächs scheinen sich zu versachlichen, daher an diesem Ort aus der historiografischen Perspektive einige Anmerkungen zum Fall Fissmer und zu den Jahren vor 1933.
Der damalige OB hat in einem postnationalsozialistischen Narrativ, das seit den ausgehenden 1940er Jahren in der Erlebnisgeneration aufkam, eine Rolle als exemplarischer Vertreter einer lokalen „deutschnational“ oder auch „national-konservativ eingestellten Elite“. Mit diesen Zuschreibungen veredelt kann er dann im Grunde seines Herzens nur ein Gegner der Nazis gewesen sein. Und seine Anhänger und Unterstützer mit ihm.
Es ist gut zu verstehen, dass ein Bedürfnis nach einer solchen Ausdeutung auch dieses Akteurs der regionalen NS-Geschichte nach den Massenverbrechen und nach dem Weltkrieg aufkam, nur passt sie nicht auf das, was die Quellen und die Literatur mitteilen.
Einen Beleg dafür, dass Fissmer je Mitglied der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) war, gibt es nicht. Die einzigen Parteien, für die eine Mitgliedschaft belegbar ist, sind NSDAP und CDU.
„Deutschnational“ oder „national-konservativ“ ließe sich auch ohne Mitgliedschaft im Sinne starker Affinitäten zu dieser Partei und ihrem Umfeld verstehen. Was hieße das dann?
Es würde auf die Nähe zu einer politischen Formation hinauslaufen, die im heutigen Kreis Siegen-Wittgenstein in der Kaiserzeit aus der antisemitischen „christlich-sozialen Bewegung“ des aufgrund seines radikalen Antisemitismus und seiner oft tumultuarischen Auftritte weithin berüchtigten protestantischen Predigers Adolf Stoecker (daher auch: „Stoecker-Bewegung) hervorging. 1918 schloss sie sich dem explizit antisemitischen Teil der neu gegründeten völkischen DNVP an.
Das besondere Merkmal des christlich-sozialen Antisemitismus war seine antikapitalistische Tönung („Enteignung jüdischer Warenhäuser“, ehrbarer kerndeutscher Kaufmann vs. jüdischen Wucherer usw.), deren Demagogie der Sozialdemokratie die Wähler abspenstig machen sollte. Die christlich-soziale Mischung ethnisierte die soziale Frage und führte fort von ihr. So machte es später auch die NSDAP. Es ist also nachzuvollziehen, wenn der Siegener Chefredakteur des christlich-sozialen Parteiblatts, das keinen Tag ohne Beiträge gegen die jüdische Minderheit erschien, 1934 darauf bestand, dass die „Stoecker-Bewegung“ ein „Vorläufer des Nationalsozialismus“ gewesen sei.
Im Siegerland fanden sich die völkischen Vertreter rassistischer Ideologie, einer Revision der Kriegsergebnisse, der Verherrlichung des Militärs, einer Abkehr von der verhassten Weimarer Verfassung usw. im „vaterländischen Lager“ zusammen. Dort waren dann DNVP, NSDAP, Kriegervereine, Antisemitischer Schutz- und Trutzbund (Selbstbezeichnung: „Siegerländer Hakenkreuzer“), SA, Stahlhelm, Kriegervereine, Bismarckjugend etc. pp. vereint am Werk, der demokratischen Republik den Garaus zu machen.
Das führte naturgemäß zu Konflikten mit deren Verteidigern. Das waren im großen und ganzen die damaligen Vorläufer der heutigen Mitteparteien und, ja, die KPD.
Drei Beispiele aus den Jahren vor der Machtübergabe:
• 1924 lud Fissmer einige Monate nach dem Hitler-Ludendorff-Putsch am 9. November 1923 zu einem städtischen „Deutschen Tag“ des völkischen Lagers mit Ludendorff als führender Figur nach Siegen, die der preußische Innenminister als verfassungsfeindlich verbot. Bereits verboten war die NSDAP, die den völkischen Festtag wesentlich organisierte (und deren Siegener Abgeordneten die Ratsfraktion der DNVP als Hospitant aufgenommen hatte).
• 1927 waren einerseits Fissmers Aktivitäten zum Reichstreffen der völkischen „Bismarckjugend“ und andererseits dessen Passivität im Vorfeld der jährlichen Verfassungsfeier ein öffentliches Thema. Die Stadträte von Zentrum, SPD, KPD und DDP werteten in einem gemeinsamen Antrag sein Verhalten als verfassungsfeindlich. Ohne große Auswirkungen, die Republikaner waren im Siegerland eine Minderheit.
• Seit den 1920er Jahren waren unter Fissmer ausgemachte Verfassungsfeinde im öffentlichen Dienst der Stadt anzutreffen, Mitglieder von NS-Organisationen oder ihrer allernächsten Nachbarn. Als im November 1932 der Gewerkschafter und Stadtverordnete Willi Kollmann von der SPD zur KPD wechselte, musste der den städtischen Dienst verlassen. Das war der Fissmersche deutschnationale Toleranzbogen.
Um an dieser Stelle zu schließen, Zuschreibungen wie „deutschnational“, „national-konservativ“ oder auch die Verschönerung „Elite“ sind nicht geeignet, aus dem Antidemokraten einen Demokraten zu machen. Der war Fissmer bei aller Leutseligkeit im Gespräch mit dem „Mann von der Straße“, die ihm ebenfalls nachgesagt wird, weder vor noch nach 1933.
Über die Ausschusssitzung berichten die Medien:
1) Siegener Zeitung, 1.6.2018 (Print): „Einstiger OB polarisiert. Wegen Bürgerantrag: Zu Alfred Fissmer bahnt sich Grandsatzdebatte an“. Zwei Zitate seien erlaubt:
– “ …. Alle HFA-Mitglieder waren sich einig, erst einmal Leben und Werken des einstigen Oberbürgermeisters ….von den Profis vom Stadtarchiv und Universität Siegen wissenschaftlich aufarbeiten zu lassen. ….“
-“ ……Zu Alfred Fissmer bahnt sich eine Grundsatzdebatte an, die auch andere belastete“ Namen von Straßen und Plätzen ausstrahlen könnte (Hindenburg, Bonatz, Stoecker usw.)“
2) Westfalenpost Siegen, 1.6.2018, Hendrik Schulz „Siegener Politik diskutiert über die Person Alfred Fißmers“: Link: https://www.wp.de/staedte/siegerland/siegener-politik-diskutiert-ueber-die-person-alfred-fissmers-id214454337.html
Literatur zum Thema:
– Robert Krämer: Mosquitia und die Kolonie Neu-Dortmund. Eine Vorstellung an die Kolonialfreunde und Auswanderer Dortmund 1896, Link zur PDF-Publikation der Broschüre: http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:hebis:30-1117686
– Gustav Meinecke: Siedelung in den Tropen. Eine Mahnung und Warnung. in: Koloniales Jahrbuch. Beiträge und Mitteilungen aus dem Gebiete der Kolonialwissenschaft und Kolonialpraxis, 11 Jg. Berlin 1899, S. 228 – 234
Genealogischer Fund:
19.9.1897 Helene Becker heiratete in Hilchenbach Wilhelm Feldmann aus Honduras.
In der heutigen Siegener Zeitung (Print) findet sich ein weiterer Leserbrief einer ehemaligen Sekretärin der Siegener Stadtverwaltung, die den OB persönlich erlebt hat, zum Thema: „Integrer Mann“.
Die Siegener Zeitung veröffentlicht heute einen Nachruf auf Helene Wildenberg, die u. a. seit 1939 als Sekretärin des Leiter der Schutzpolizei näheren Kontakt zu Fissmer hatte.
Das Blog dortmund-postkolonial gibt folgende Informationen:
“ …. Kolonie Neu-Dortmund in Honduras
Für ein paar Jahre geriet Honduras in den speziellen Dortmunder Blick. Der vom Postdienst freigestellte Dortmunder Lehrer Krämer warb für die Gründung der Kolonie „Neu-Dortmund“ am Tocomacho an der Miskitoküste Honduras. Eine erste Gruppe Dortmunder wanderte vor 1895 aus. 1896 kehrte Krämer zurück und beschrieb Honduras in einer Reihe von Veranstaltungen als eine Art “Schlaraffenland“. Weitere Dortmunder wanderten aus und bemerkten eine gewisse kognitive Dissonanz zwischen Phantasie und Realität. Krämer wurde 1898 zunächst in einem groß angelegten Prozeß mit ca. 50 Zeugen und unter Beteiligung von Gutachtern vor dem Dortmunder Amtsgericht wegen „Verleitung zur Auswanderung unter Vorspiegelung falscher Tatsachen“ verurteilt, allerdings im Jahre 1900 vor dem Landgericht Bochum wieder freigesprochen. 1907 taucht er im Reichstagswahlkampf als kolonialer Wahlredner auf Seiten der Nationalliberalen Partei wieder auf. ….“
Link: http://www.dortmund-postkolonial.de/?page_id=1061
Aufgrund einer Recherche des Wuppertaler Stadtarchivs konnte das vermutliche Sterbejahr von Wilhem Noss (1966 in Wermelskirchen) ermittelt werden. Leider wurde im zu untersuchenden Zeitraum 2 Personen mit dem Namen Karl Gräve ermittelt, so dass hier zu nächst nicht weiter geforscht werden kann.
Die Recherche des Archivs des Deutschen Archäologischen Institus verlief ergebnislos.
Vielen Dank an beide Kolleginnen!
Dr. Hellmuth Polakowsky berichtet in den „Mittheilungen der kaiserlich-königlichen Geographischen Gesellschaft in Wien“, Wien 1897, S. 548 – 552, über das „Kolonialisierungsvorhaben“, u. a. mit Hinweisen auf die Berichterstattung in der Dortmunder Presse – Link zur PDF via ANNO erstellt.
Guten Morgen aus Büschergrund,
gerade lese ich von der Lesung heute Abend und frage mich, ob die öffentlich ist. Da ich aktuell auch bei meinen eigenen Familienforschungen Verbindungen zur Familie Breitenbach nachgehe (genauer gesagt, einer Verbindung zu August Breitenbach (Walzengießerei Roland), dessen Haushälterin -meine Großtante- seine Cousine gewesen sein soll) , wäre das für mich sehr interessant.
Die Veranstaltung hat am 10. Januar 2014 stattgefunden. Die Veranstaltungen der familienkundlichen Arbeitsgemeinschaft des Siegerländer Heimat- und Geschichtsvereins sind öffentlich. Wegen Ihrer genealogischen Forschungen empfehle ich Ihnen mit de Gerhard Moisel, Haus der Kirche, Burgstr. 21, 57072 Siegen, Kontakt aufzunehmen. Moisel fungiert als Ansprechpartner der genannten Arbeitsgemeinschaft.
Heute erschien in der Siegener Zeitung ein Leserbrief zur Debatte: „NSDAP-Bürgermeister“, u. a. mit dem Vorschlag den.Platz nach dem Siegener Landrat Heinrich Otto zu benennen.
Heute erschien in der Siegener Zeitung (Print) der Artikel mit der m. E. unpassenden Schlagzeile“Offene Tür kommt zu den Akten. Stadtarchiv wird künftig nicht mehr den gewohnten Service leisten können. Nachfolger wird nur mit halber Stelle als Archivar arbeiten“.
>>Lesung „Hoffnung auf eine besseres Leben“<<
heißt es nicht "einem besseres Leben"… man kann sich ja an allem gewöhnen, sogar am Dativ… bitte korrigieren!
Ich war erstaunt, dass über einen der bekanntesten Forstmänner Wittgensteins noch nichts im Netz zu finden war. Bei den Recherchen zu Louis Reuß bin ich auf eine Irritation gestoßen, die bisher noch nicht zu beseitigen war: Wied berichtet, Reuß sei am 10.10.1812 geboren. Ein Urenkel von Reuß gibt 1982 das gleiche Geburtsdatum bei der Überreichung des Portraits an die Rentkammer an. Auf dem Denkmal ist jedoch das Geburtsjahr 1813 (!) in Bronze gegossen. Die Personalakte Reuß war im Archiv bisher nicht auffindbar. Leider führte auch die Suche über Archion noch nicht zur Auffindung des relevanten Taufbuches.
Die Sterburkunde Reuß´ könnte darüber Auskunft geben, sowie die Geburtsurkunde der Kinder oder die Heiratsurkunde der Eheleute Reuß….
Vielleicht findet sich auch hier etwas: Naumann, Gerhard: Forstgeschichte der ehemaligen Grafschaft Sayn-Wittgenstein-Hohenstein bis 1900. Mit einem Überblick über die Entwicklung im 20. Jahrhundert. Göttingen 1970.
Gerhard Naumanns Dissertation empfiehlt sich auf jeden Fall für die vertiefte Lektüre zur Wittgensteiner Forstgeschichte und geht natürlich auch auf Reuß ein. Um dessen Geburtsjahr zu verifizieren, müsste dann aber doch auf amtliche Dokumente zurückgegriffen werden; in solchen Zweifelsfällen ist Sekundärliteratur nicht beweiskräftig.
Über eine Digitalisierung der unveröffentlichten Denkschrift von 1868 könnten ja die Wittgensteiner Archivare einmal nachdenken (vielleicht mit Unterstützung des Kreisarchivars). Vorab kann zum gleichen Thema auf einen veröffentlichten Beitrag Reuß‘ „Aus der Correspondenz“ (1868) hingewiesen werden, in:
Aus dem Walde 2 (1869), S. 103-119.
books.google.de/books?id=07kCAAAAYAAJ
Diesen Briefauszug nahm Ludwig Jäger zum Anlass für seinen Artikel „Über den früheren Zustand der fürstl. Sayn-Wittgenstein-Hohensteinischen Waldungen …“ in:
Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung N.F. 46 (1870), S. 237-242.
books.google.de/books?id=sYZAAAAAcAAJ
Eine erste sehr knappe Erklärung Reuß‘ brachte das August-Heft der AFJZ (S. 328): „Herr Forstdirector Jäger in Laasphe hat sich im Juni-Hefte dieser Blätter über die Bewirthschaftung der fürstlich Wittgenstein’schen Forsten in einer Weise ausgelassen, die mich zu einer Entgegnung unabweislich verpflichtet. Dieselbe liegt druckfertig da. Angesichts der hereinbrechenden Katastrophe aber [dt.-frz. Krieg], und beherrscht von dem Eindrucke des furchtbar ernsten Moments halte ich es für angemessen, die Sache für jetzt ruhen zu lassen.“
In der Dezember-Ausgabe (S. 482) ging er in „Reuß contra Jäger“ dann etwas ausführlicher auf das Ärgernis ein und kündigte das Erscheinen seiner (inzwischen auf 40 Seiten angewachsenen) Verteidigungsschrift als Separat-Druck an (siehe Lit.-Verz. im Wikipedia-Eintrag).
Lesenswert ist auch die von Wilhelm Hartnack aus dem Nachlass veröffentlichte und interessant kommentierte „Bemerkenswerte Geburtstagsrede des Forstrats Reuß“ in:
Wittgenstein 26 (1962), S. 36-39
Eine informative Kurzbiographie des fachlich versierten aber menschlich wohl sehr problematischen Ludwig Jäger in:
Biographien bedeutender hessischer Forstleute, Wiesbaden 1990, S. 357-364.
(Kleine Anmerkung am Rande: Bei dem vom Administrator hier eingestellten Wikipedia-Artikel handelt es sich um eine „alte Version“, die durch eine geringfügig aktualisierte ersetzt worden ist.)
In der heutigen Siegener Zeitung (Print) erschien der Leserbrief „An Albert Speer gedacht“, der sich u. a. auch mit der Namensgebung der Fißmer-Anlage auseinanadersetzt.
Herzlichen Dank für die Hinweise der Herren Wolf und Kunzmann. Die Dissertation von G. Naumann werde ich im Hinblick auf Reuß gerne noch auswerten. Die „Geburtstagsrede“ von Reuß 1868 auf dem Friedrichshammer ist tatsächlich lesenswert und bringt, neben dem, was zwischen den Zeilen zu lesen ist, ja letztlich auf den Punkt, dass die Entwicklung eines Waldes immer ein Projekt über mehrere Generationen hin ist. Hinsichtlich der Irritation bezgl. des Geburtsjahres von Reuß läuft eine Anfrage im Gemeindebüro Harzgerode.
Während das „Wittgensteiner Kreisblatt“ in Berleburg die Einweihung des Denkmals am 12.Juli 1910 mit keiner Zeile erwähnt, schreibt die damals in Laasphe erscheinende „Wittgensteiner Zeitung“ in ihrer Ausgabe vom Samstag, 16.Juli 1910:
„Aus Laasphe und Umgegend.
Laasphe, 15. Juli. (Gedenkfeier für Oberforstrat Reuß)
Dem ehrenden Andenken eines um unser Fürstliches Haus hochverdienten Mannes galt eine würdige und seltene Feier, die am verflossenen Dienstag, in der Nähe von Schloß Wittgenstein, auf der sog. Alteburg, im herrlichen Waldesgrün unter dem Schatten mächtiger Buchen und umflossen vom hellsten Sonnenschein vor sich ging. In dankbarer Anerkennung der bleibenden Verdienste des in den Jahren 1857 bis 1872 hier wirkenden Oberforstrats Louis Reuß hatten Se. Durchlaucht Fürst Ludwig in hochherziger Weise beschlossen, dem Verstorbenen ein bleibendes Denkmal durch Aufstellen eines würdigen Gedenksteines zu errichten. In Gegenwart Sr. Durchlaucht des Fürsten, Ihrer Durchlaucht der Fürstin, sowie des ganzen Fürstlichen Hauses, ferner zweier als Gäste geladenen Söhne und einer Tochter und Enkelin des zu Ehrenden, sowie der höheren Verwaltungsbeamten und des Forstpersonals wie zahlreicher Zuschauer fand am genannten Tage nachmittags 1 ½ Uhr die weihevolle Feier statt. Nachdem zu Beginn derselben Se. Durchlaucht der Erbprinz in einer kurzen Ansprache das weitausschauende Wirken und die unvergänglichen Verdienste des Oberforstrats Reuß betont und den Denkstein der Fürstlichen Verwaltung übergeben hatte, fiel die Hülle und die Marburger Jägerkapelle intonierte das Lied „Wer hat dich du schöner Wald“, während Se. Durchlaucht der Erbprinz einen Eichenkranz am Sockel niederlegte. Den Blicken der Zuschauer präsentierte sich nun der in seiner Schlichtheit edel wirkende Gedenkstein. In die nach Osten gerichtete polierte Vorderseite eines mächtigen Syenitblocks ist das in Bronze gegossene wohlgetroffene Relief-Brustbild des Oberforstrats Reuß, umrahmt von einem Eichenkranz, eingelassen. Darunter stehen die Worte: „Oberforstrat Louis Reuß 1857-1872.“ Der Gesamteindruck ist höchst wirkungsvoll, die Ausführung von künstlerischer Vollendung und das Ganze dem grünen Waldrahmen vorzüglich angepaßt. – Nachdem die Musik geendet, trat Herr Kammerdirektor Dr. Mertens vor, übernahm das Denkmal als Vertreter der Fürstlichen Verwaltung und legte ebenfalls einen Kranz nieder. Seine Ansprache endete mit einem begeistert aufgenommenen Hoch auf Se. Durchlaucht den Fürsten und das Fürstliche Haus. Hierauf hielt Herr Forstrat Rühm eine längere Rede, in welcher er das segensreiche Wirken des Oberforstrats Reuß hervorhob. Nachdem die Musik nochmals gespielt hatte, auch noch ein dritter Kranz, gestiftet von einem in Oesterreich lebenden dritten Sohn des Verewigten, Herrn Oberforstrat Dr. Herm. Reuß, der leider nicht anwesend sein konnte, am Denkmal niedergelegt worden war, war die eindrucksvolle Feier zu Ende. Nach der Einweihungsfeier fand Hoftafel für die geladenen Gäste und die höheren Fürstlichen Beamten statt, zu der die Jägerkapelle die Tafelmusik stellte, während sich die Forstbeamten zum Festessen im Kurhaus versammelten und hier noch manche Stunde fröhlich vereint blieben.“
Wie in Zeitschrift „Siegerland“, Bd. 91/Heft 1, 2014, S. 164-166 von mir beschrieben, liegt im LWL -Freilichtmuseum seit 1968 auch noch das Haus Fuchs aus Weidenau, (ehem ) Untere Friedrichstr. 7. und harrt dort auf den Wiederaufbau.
Hof Stöcker aus Burgholdinghausen ist mit Foto u.a. auch beschrieben von Stefan Baumeier in “ Westfälische Bauernhäuser-Vor Bagger und Raupe gerettet-„. Westfalen Verlag 1983- Seite 228. Foto des Hauses kann dem Archivar zur Verfügung gestellt werden, wenn er es nicht irgendwo anders finden kann.
1.
Mit Antritt der Regierung Hitler aus NSDAP, DNVP und Stahlhelm begannen 1933 in Siegen im “Braunen Haus”, der früheren Alten Försterei, die systematischen Folterungen von politischen Gegnern durch SA und SS. Die Opfer wurden im Anschluss vor die Türe gesetzt und schleppten sich durch die Stadt nach Hause. Es handelte sich um öffentlich wahrnehmbare und wahrgenommene Vorgänge. “Es reden”, wie der katholische Pfarrer Wilhelm Ochse von der Mariengemeinde in einer schriftlichen Stellungnahme an Alfred Fissmer feststellte, “schon die Kinder über diese Dinge.“
Was waren „diese Dinge“? Dazu nur ein kurzer Auszug aus einer längeren Schilderung eines Zeitzeugen:
Der Siegener Elektriker Erich Schutz wurde von einem SA-Kommando ins Braune Haus verschleppt und dort mit Gummiknüppeln und Gewehrkolben schwer misshandelt. Die Gallenblase riss, sie musste später entfernt werden. Es wurden ihm schwere Darmverletzungen zugefügt. Der Siegener Arzt Dr. Walter Nöll verweigerte ebenso die Behandlung von Erich Schutz wie der Siegener SS-Arzt Dr. Ferdinand Pahl, der ihm statt Behandlung etwas Morphium gegen die Schmerzen gab. Pfarrer Ochse sorgte dann dafür, dass Schutz im katholischen Marienhospital aufgenommen wurde. Von dort konnte er erst mehr als ein halbes Jahr später entlassen werden. Bis 1938 blieb er arbeitsunfähig.
Die Polizei war zum Zeitpunkt der Ereignisse noch nicht zentralstaatlich, sondern kommunal, und in Siegen war Alfred Fissmer nicht nur Chef der Verwaltung, sondern auch der Polizei. In die Polizei eingegliedert waren seit Februar 1933 auch die SA und die SS als Teil der SA. Fissmer wusste von den Vorgängen im Braunen Haus. Er wusste, wen er förderte, als er 1933 Förderndes Mitglied der SS wurde.
Das oben zitierte Schreiben von Ochse an Fissmer war an den Polizeichef gerichtet. Ochse forderte Fissmer dazu auf, die Folterungen abzustellen. Fissmer schwieg. Später warf er Ochse vor, die NS-Bewegung verächtlich zu machen. Das war ein Straftatbestand des “Heimtückegesetzes”. Weil er es wiederholt verletzt habe, wurde Ochse 1935 festgenommen und von einem Sondergericht zu acht Monaten Gefängnis verurteilt.
2.
1933 wurde der bei der städtischen Sparkasse tätige Stadtinspektor Friedrich Vetter auf Fissmers Initiative nach dem NS-Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums zwangspensioniert. Vetter hatte nachdrücklich finanzielle Unregelmäßigkeiten gegenüber höheren Instanzen beklagt. Davon ließ er auch nach seiner Entlassung nicht ab und verbreitete seine Angaben in der städtischen Bevölkerung. Es folgten Hausdurchsuchungen, eine Verurteilung zu neun Monaten Gefängnis und eine weitere zu fünf Monaten und anschließender Internierung als „geisteskrank“ in der Heilanstalt Eickelborn, wo er ein Jahr und vier Monate verbrachte. Als die beiden entscheidenden Triebkräfte seiner Verfolgung betrachtete er den OB und den Gauinspektor Walter Heringlake, dessen umfangreicher Arisierungserfolg viele Städter nicht überraschte und später ein Überprüfungsverfahren durch die Partei auslöste.
3.
Nach Aussage des jüdischen Siegeners Hugo Herrmann wurden bereits am Vormittag des 9. November 1938 zahlreiche begüterte Männer aus der jüdischen Gemeinde, so auch er, festgenommen. Sie wurden in Siegen im Polizeigefängnis festgehalten, bevor sie nach dem Pogrom – in Siegen am Mittag des 10. November – in das KZ Sachsenhausen deportiert wurden, um ihren Familien ihre Immobilien und Geschäfte abzupressen. Die reichszentralen Pogrom-Aufforderungen zu diesem Zweck gegen die jüdische Minderheit ergingen in der Nacht des 9. November, und der Befehl des Gestapochefs Heinrich Müller “etwa 20-30.000” jüdische Männer festzunehmen, folgte ihnen erst in dieser Nacht um 23.55 h.
Mit anderen Worten, wenn die Angaben des Zeitzeugen stimmen, dann kann es sich bei der Siegener Aktion nur um einen vorzeitigen und für die Region untypischen lokalen Festnahmealleingang gehandelt haben. Das wäre insofern nichts grundsätzlich Ungewöhnliches, als untere NS-Behörden sich oft proaktiv und nach oben impulssetzend verhielten, so bei anderen Themen auch im heutigen Kreisgebiet. Auszugehen ist bei den Siegener Festnahmen, dass sie auf Fissmers persönliche Initiative oder doch jedenfalls nicht ohne Absprache der Siegener Polizei mit ihrem höchsten Vorgesetzten, auf keinen Fall aber an ihm vorbei erfolgten.
Was Hugo Herrmann angeht, so konnte er sich nach der KZ-Entlassung und dem Verlust des größten Teils seines Vermögens 1939 durch Flucht nach Palästina retten. Dass Fissmer als Fluchthelfer aufgetreten wäre, ist nicht bekannt und würde wenig zu ihm gepasst haben. Den billigen Erwerb des Grundstücks der ausgebrannten Synagoge von der jüdischen Gemeinde bewertete er “als eine wertvolle Ergänzung unseres Besitzes”.
Für die in der aktuellen Diskussion vorgetragene Aussage, Fissmer habe gelegentlich Menschen aus der jüdischen Minderheit unterstützt und sie geschützt, würde der Verifizierung, sprich konkreter Belege – Namen, Zeitpunkte, Anlässe –, bedürfen, um sie ernst nehmen zu können. Die gibt es bislang nicht. Fissmer selbst hat sich dazu nie geäußert, auch nicht in seinem Entnazifizierungsverfahren, als das “Untragbar” des ersten Durchgangs (Stadtausschuss) angesichts drohenden Pensionsverlusts solche Verweise dringlich gemacht hatte.
4.
Aussagen zu Hilfe für Verfolgte durch Nichtverfolgte finden sich immer wieder vor allem in den regionalen Entnazifizierungs- und Entschädigungsakten. Beide Quellenkategorien sind inzwischen in einem hohen Maß recherchiert und ausgewertet worden. Aussagen über angebliche oder nachgewiesene Unterstützungsleistungen durch Fissmer für aus politischen, rassischen, sozialen oder religiösen Motiven Verfolgte liegen dort bislang nicht vor, wohl aber Aussagen gegen ihn. Pauschale Behauptungen, wie sie in der politischen Diskussion seit dem Regimeende dennoch auftreten, führen nicht weiter.
Verifizierende Belege und die Einordnung von Vorgängen in die jeweiligen zeitlichen Kontexte:
Das sollte in allen Fragen gelten. Dass Fissmer ein “NS-Gegner” gewesen sei, der „die Nazis wie die Pest gehasst“ habe, wie man aus „vertraulichem“ Umgang mit ihm wisse, kann man behaupten, wie man alles behaupten kann. Allerdings ist es eine Behauptung ohne Basis, ohne Beweiskraft. Die würde sich an Handlungen festmachen lassen müssen und dazu wiederum genügen ein paar Sätze gegen einen obsolet gewordenen Nero-Befehl in der allerletzten Stunde vor dem großen Kollaps nicht, wie sie in einem Beitrag behauptet wurden.
Was reale NS-Gegner (und NS-Verfolgte) als solche ausweist, lässt sich an den Fällen Hugo Herrmann, Wilhelm Ochse, Erich Schutz, Friedrich Vetter oder Andreas Vomfell erkennen. Es ist schon erforderlich, in einem Spektrum der Verhaltensweisen und Entscheidungsoptionen klärende Unterscheidungen zu treffen und Abgrenzungen vorzunehmen, wenn das Wort vom “NS-Gegner” nicht eine Hülse diffusen Inhalts und ohne eine nachvollziehbare Aussage sein soll.
Ebenfalls nicht weiter, vielmehr zurück in die entlastenden Narrative der fünfziger Jahre führen völkisch inspirierte Vergemeinschaftungsversuche, die “den” Siegenern, Netphenern oder Siegerländern in pauschaler Vereinheitlichung kollektiv diese oder jene Sichtweise auf die regionalen NS-Akteure unterstellen und ihre Adressaten auf diesem Weg zu vereinnahmen suchen. Offenkundig gingen und gehen durch die Zeiten die Meinungen in der Siegener und Siegerländer Bevölkerung zur NS-Bewegung, zu deren Wegbereitern und zum etablierten NS-Regime sach-, interessen- und persönlichkeitsbezogen weit auseinander.
(Quellenangaben auf kurzem Weg: siehe die Verweise in den entsprechenden Artikeln der Personenverzeichnisse der VVN-BdA)
Da lag ich leider um 1 Jahr zu früh.
Wo oder wie kann ich denn hier ein Bild dieser Halle von 1937 einstellen?
… oder soll ich es in Facebook unter „Stadt Siegen in alten und neuen Bildern“ einstellen?
Dieses Foto von 1937 hat Manfred Knoche vor einiger Zeit aus einem Beitrag in facebook extrahiert.
Links unten erkennt man die Gebäude und ihre Lage.
Zusätzlich ein Bild zur Lage der Halle aus der Karte von 1939.
Vielen Dank für die beiden Ergänzungen!
Das denke ich auch. Zumindest war hier nach 1933 mindestens eines der großen Reitturniere, bei denen Wehrmachtsoffiziere in Uniform mitritten und die Kreisleitung Hof hielt. Josef Balogh hatte hier in verschiedenster Hinsicht mitorganisiert…
Im Eintrachtpark. Von der Stadt Siegen zwischen 1959 und 1961 erbaut. Die Johanneskirche wurde dafür im Herbst 1958 in den Stadtteil Achenbach verlegt.
Die Siegerlandhalle stand „Auf der Schemscheid“ und wurde wahrscheinlich zwischen 1933 und 1939 eröffnet.
Die Sportfreunde Siegen nutzten den Stadtplatz wohl von 1923-1957 als Spielstätte. Im 2. Weltkrieg wurde der Platz u.a. für Reitturniere genutzt.
Die Errichtung einer Reithalle/Sporthalle könnte auch im Zusammenhang mit der Machtübernahme durch die NSDAP im Jahre 1933 zu tun haben. Die Vereine wurden eingegliedert in deren Strukturen. Es galt Sport vor Politik. U.a wurde im Laufe der Jahre reichlich Geld in den Bau von Sportstätten und Hallen investiert.
Im Kurzkommentar der „Zeitspuren“-Bearbeiter zu dieser Karte heißt es:
„Auffallend ist die Nicht-Verzeichnung des Amtes Ferndorf, die für eine unzureichende Ortskenntnis des Zeichners spricht – möglicherweise handelte es sich um einen ungeprüften ‚Schnellschuss‘.“
Bevor womöglich die Aussage in das projektierte Monumentalwerk zur Kreisgeschichte übernommen und damit ihrerseits als „Schnellschuss“ konserviert wird, könnten die Autoren noch tiefer in die verwirrende Siegerländer Verwaltungsgeschichte eintauchen. Der Zeichner Friedrich Carl Padberg, spätestens seit 1823 als Kataster-Geometer bei der Arnsberger Regierung nachgewiesen, war vermutlich auch 1817 nicht bloß irgendein Hobby-Kartograph mit unzureichenden Ortskenntnissen. Wenn er ein „Amt Ferndorf“ nicht verzeichnete, könnte das schlichtweg daran gelegen haben, dass es ein solches (im Sinne von „Gerichtsbezirk“) 1817 nicht gegeben hatte. Das alte Amtsgericht Ferndorf-Krombach existierte zu dieser Zeit längst nicht mehr. (Dass der Volksmund den Begriff „Amt“ vielleicht synonym für die Bürgermeisterei Ferndorf benutzte, kann ja sein).
Bei der Karte handelt es sich sicherlich um keinen „Schnellschuss“, denn die Karte des Amtes Hilchenbach von 1815 (Henning, Wirtschaftsgeschichte des Hilchenbacher Raumes, S. 141) kennt eine ähnliche Einteilung. Dort reicht das Amt Hilchenbach auch von Lützel bis Osthelden in Ost-West-Ausrichtung. Vom Amt bzw. von der Bürgermeisterei Ferndorf keine Spur. Welche Verwaltungsreformen waren für die Zusammenlegung von Hilchenbach und Ferndorf zwischen 1813 und 1817 verantwortlich, als die Einteilung in „Bürgermeistereien“ erfolgte.
Auf der Grundlage der westfälischen „Landgemeinde-Ordnung“ (1841) wurde 1844 das Amt Ferndorf neu gebildet. Von 1815 an handelte es sich um die Bürgermeisterei Ferndorf im Amt Hilchenbach ….. Wenn ich Wikipedia richtig verstehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Amt_Ferndorf
Wilhelm Güthling, Der Kreis Siegen im Jahre 1817, in: Siegerland 44 (1967), S. 1-16: Als Anlage III bringt Güthling ein „Verzeichnis der zum Kreise Siegen gehörigen Städte und Ämter und der darin angestellten und fungierenden Behörden 1816, zusammengestellt aus Archivalien des Staatsarchivs Koblenz“. Genannt werden (neben dem Stadtbezirk Siegen) genau die 6 Ämter, die auch in Padbergs Karte ausgewiesen sind. Ferndorf findet man in Anlage II im Verzeichnis der 11 Bürgermeistereien.
Damit nicht erst ein falscher Eindruck entsteht: Es geht hier nicht um Spitzfindigkeiten von Zaungästen, mit denen das literarische Großprojekt miesgemacht werden soll. Lieber schon jetzt alles Auffällige ansprechen, als die beiden Bearbeiter (w/m) einfach später in die Messer der Rezensenten laufen zu lassen.
Frau Strautz und Herr Pfau wissen, dass ich ihnen auch ohne öffentliche Bauchpinselung gewogen bin und ihre Bemühungen für dieses durchaus problematische Auftragswerk keineswegs gering schätze. Gern spreche ich dem Administrator ein besonderes Lob für alles Lobenswerte bei Siwiarchiv aus :-) :-) :-)
Der „Zeitspuren-Bearbeiter“ dankt Peter Kunzmann für diesen wichtigen Hinweis und Bernd Plaum für seine ergänzenden Anmerkungen. Damit ist zugleich der von siwi-archiv dankenswerter Weise ermöglichte Meinungsaustausch über die „Ereignistafel“ eröffnet, die im Rahmen des Forschungs- und Buchprojekts „Zeitspuren in Siegerland und Wittgenstein. Das lange 19. Jahrhundert“ präsentiert wird. Zu diesem Meinungsaustausch sind sach- und fachkundige ebenso wie allgemein heimat- oder regionalgeschichtlich Interessierte herzlich eingeladen. Sachliche Unrichtigkeiten werden, wie in diesem Fall, möglichst zeitnah korrigiert. Friedrich Carl Padberg hat sich bei der Erstellung dieser Karte nicht an der zu dieser Zeit noch üblichen Verwaltungsgliederung nach Bürgermeistereibezirken, sondern an der 1817 geltenden Einteilung der Gerichtsbezirke orientiert. Wer würde behaupten wollen, dass diese Aufgabe einem „Hobby-Kartographen“ erteilt worden wäre? :-)
Woran sich Padberg auch immer orientiert haben mag, an den Gerichtsbezirken vielleicht doch nicht! So klagten die Einwohner Hilchenbachs 1815 darüber, dass das ehemalige Justizamt „in das unbedeutende Dorf Obernetphen“ verlegt worden war. Sie baten 1825 erneut, die Verlegung des Gerichts wieder rückgängig zu machen? (Vgl. dazu: Mahrenholz/Klein, Zur Geschichte des Amtsgerichts Hilchenbach, in: Recht im südlichen Westfalen, Siegen 1983, S. 138-19, hier: 145-146 ). Nach dieser Erkenntnis hätte Padberg die Grenzlinie zwischen Netphen und Hilchenbach weglassen können, was er aber nicht getan hat.
Anderersets: Bereits 1775 wurde das alte Gericht Ferndorf/Krombach nicht wieder neu errichtet, sondern zwischen den Justizämtern Freudenberg und Hilchenbach aufgeteilt (s. Weller, Das Gericht Ferndorf und Krombach, in: Ebd., S. 150-156). Danach wurde der ehemalige Gerichtsbezirk Ferndorf/Krombach von Hilchenbach aus betreut. Diesen Sachverhalt wiederum bildet Padberg ab, aber warum bezeichnet er die eingezeichneten Verwaltungsbezirke als „Amt“ und nicht als „Gerichtsbezirk“ wie es in anderen zeitgenössischen Karten durchaus vorkam?
Suchbegriffe in Google und Lemma in Wikipedia sagen uns nicht alles! Ein genauer Blick in das Original offenbart uns folgendes: Dort steht nämlich „J.Amt Hilchenbach“, was nichts anderes bedeutet als Justiz-Amt Hilchenbach. Das Gebiet des Justizamtes (=Gerichtsbezirk) ist nicht unbedingt identisch mit dem Amtsbezirk (=Verwaltungsbezirk). Es fand also schon eine sprachliche Unterscheidung statt.
1) Zum Quellenwert von google und Wikipedia muss hier nichts ausgeführt werden – außer dass dort Richtung ermittelt werden kann, in die die vertiefende Recherche gehen sollte.
2) Meine These ist ja, dass die Verwaltungsbezirke ab 1815ff Bürgermeistereien hießen – s. u. Güthling 1967 – , die Justizbezirke (Justiz-)Ämter. Padberg hat nun offensichtlich für die Beschriftung der Karte die Justizbezirke ausgewählt, evt. ohne dabei besonders akkurat gearbeitet zu haben. Belege für diese möglicherweise rasche Arbeit sind ja hier bereits genannt worden und führen eigentlich auch zu der Frage, warum die Karte überhaupt angefertigt wurde.
Auffällig ist, dass die Dörfer Beienbach und Grissenbach im Amt Netphen gar nicht eingezeichnet sind. Auch ist Wilgersdorf als Wilgersbach bezeichnet. M. E. alles durchaus ein Zeichen mangelnder Sorgfalt.
Und wieder muss ich den mir unbekannten Herrn Padberg in Schutz nehmen. Als guter Preuße (wenn er denn einer war) wird er wohl so sorgfältig, wie es ihm die gegebenen Voraussetzungen erlaubten, gearbeitet haben. Offensichtlich kannte er aber das Siegerland nicht persönlich, was aus fehlenden Dörfern und zahlreichen Falschschreibungen zu schließen ist. Welche Vorlage(n) er für seine Zeichnung benutzte und in welchem Zusammenhang diese entstand, wäre sicherlich interessant zu klären. Damit kann man sich ja einmal beschäftigen. Hier ging es zunächst nur um die „Ämter“, und da scheint er nichts falsch gemacht zu haben.
Es wird wohl Zeit sich Friedrich Carl Padberg genauer zu widmen. Beim googlen wird man zumindestens auf das Amtsblatt für den Regierungsbezirk Arnsberg aus dem Jahr 1823 verwiesen, dass belegt, das Padberg als „Obergeometer-Gehülfe für Arnsberg“ angestellt war.
Das hessische Archivinformationssystem weist folgende Angaben aus, die Friedrich Carl Padberg zu beziehen scheinen:
1) „Topograph beim Landesvermessungsgeschäft im Herzogtum Westfalen
08.11.1815 Geometer II. Klasse aus Arnsberg
08.11.1815 Patent
zuständig für Bereich Westfalen
Quelle: K. Rößling (Bibl. H 969/50)
Hess. Ghz.-Ztg. 1815, Nr. 148, S. 1448 “
Quelle: HStAD Bestand S 1 Nr. NACHWEIS1
2) „F. A. Padberg [?] wird Geometer in Arnsberg, 1811
Archivalie 1944 vernichtet “
Quelle: HStAD Bestand E 1 L Nr. NACHWEIS
3) “ Padberg, Friedrich
aus Küstelberg
bei Geometer Padberg
1815 Prüfung Geometer 1. Klasse (Herzogtum Westfalen) “
Quelle: HStAD Bestand G 31 P Nr. 818
Sehr schön für den Anfang! Erschwert wird die Recherche dadurch, dass im Westfälischen außer „unserem“ Friedrich Carl gleichzeitig auch ein Berufskollege Franz Anton tätig war. Die Nennung von „Geometer Padberg“ ist also nicht eindeutig. Bei Franz Anton P. handelt es sich möglicherweise um den am 18.2.1793 in Wenholthausen (heute Hochsauerlandkreis) Geborenen, gest. 13.6.1869 in Unna. Für Friedrich Carl wird in einem anderen Amtsblatt der Wohnort Bochum angegeben. Weitermachen!
Vielleicht findet sich ja ein Kartenliebhaber oder eine Kartenliebhaberin, die hier weiterrecherchiert ……
Die beiden Padbergs habe ich ja durchaus wahrgenommen und diese erschweren ein wenig die weitere Suche …..
Padberg hat aber auch sehr präzise gearbeitet: Er wusste z.B. das Sohlbach zum Gerichtsbezirk des Justizamts Siegen gehörte und nicht zum Justizamt Hilchenbach.
Um das „wilde Brainstorming“ zu einem vorläufigen Ende zu bringen, hier ein Zwischenergebnis: Was hat Padberg gezeichnet? Den neuen preußischen Kreis Siegen mit seinen historischen Bezügen: die beiden südlichen Ämter Burbach und Neunkirchen und, das hat offenbar für Verwirrung gesorgt, das ehemalige Fürstentum Siegen mit seinen vier Ämtern Hilchenbach, Freudenbgerg, Netphen und Siegen. Diese Ämter waren nicht nur Verwaltungsbezirke sondern zugleich auch Justizbezirke. Der Amtmann war Verwaltungschef und erstinstanzlicher Richter in einer Person. Die Trennung von Verwaltung und Justiz auch auf der untersten Ebene gehörte zu einer Hauptforderungen während der Märzrevolution 1848 und fand erst später ihre Vollendung. Padberg hat in den aktuellen Umriss „Kreis Siegen“ die alten Verwaltungsstrukturen (von vor 1800 und/ oder von 1813-1815) eingezeichnet
Welchen konkreten Auftrag Padberg veranlasst hat, die Karte zu zeichnen, kann ja noch erforscht werden.
Ein launiges und nachdenkliches Wortspiel zum Schluss: past is present, damals wie heute.
Nach der vorläufigen Beendigung des Brainstormings ist die andere noch offene und manche Gemüter bewegende Frage am besten dorthin zu verweisen, wo sie am ehesten beantwortet werden könnte.
Warum enthält die Karte so viele Fehler bei den Ortsnamen und unterschlägt manche Dörfer? Welche Vorlage(n) hat also Padberg (der ja selbst keine „Feldarbeit“ im Kreis Siegen leistete) kopiert und bearbeitet? Ein Vergleich mit den älteren Exponaten in der Kartensammlung des Siegener Stadtarchivs sollte doch unschwer zu einem Ergebnis führen, zumal der frühere Stadtarchivar Güthling sicherlich viel Material zu seinen Kartographie-Studien hinterlassen haben wird. (Hat er seinen Plan, die Padbergsche Karte nachzudrucken, eigentlich verwirklicht? Sind irgendwelche Ausarbeitungen von ihm dazu erhalten?) Die ursprüngliche Kartenaufnahme dürfte zu einer Zeit erfolgt sein, als der eingezeichnete Galgen bei Trupbach noch in Betrieb war. Bis wann wurden eigentlich im Siegerland Hinrichtungen öffentlich vollzogen?
Die Karte hat Güthling für den Siegerländer Heimatverein 1970 herausgegeben. Zwei Jahre zuvor erschien eine Karte des Fürstentums Siegen.
Zum Galgen: Der ist in der Padbergschen Karte schon weit nach Trupbach verschoben, denn eigentlich lag er noch auf der Siegener Gemarkung, oberhalb des Weges nach Trupbach, vgl. dazu die Fürstentumskarte, genutzt worden ist der Galgen wohl nie, vgl. meine Diss., S. 151. Dort auch eine grobe Einschätzung des Zeitraums für letzte Hinrichtungen im Fürstentum Siegen, die m.W. noch alle in Netphen stattfanden. Die eingezeichneten Galgen und ihr Einsatzzeitraum geben also keine hinreichenden Hinweise zur Datierung der ursprünglichen Kartenaufnahme. Ich gehe davon aus, dass sie zwischen 1815 und Anfang 1817 geschah und die abschließende Zeichnung durch Padberg, wie in der Karte eingetragen, im Juli des Jahres erfolgte. So, jetzt wäre auch dieses Detail geklärt. Die Geschichte der Kartographie und des Vermessungswesen, sowie ein systematischer Vergleich mit anderen zeitgenössischen Karten (hoffentlich ebenso fehlerhaft, aber mit Erklärungen für die zeichnerischen Ungenauigkeiten) dürfte vielleicht weiterhelfen, um die noch offenen Fragen zu beantworten.
Die Herausgabe der Karte durch den Siegerländer Heimatverein 1970 wurde durch eine kurze Ankündigung im „Siegerland“ begleitet; dort heißt es zur Karte, dass diese von“Westfalen beauftragt“ worden sei. Für den Kartenforscher bedeutet dies wohl eine Durchsicht der Bestände des Arnsberger Regierungspräsidenten, vllt. sogar des westfälischen Oberpräsidenten im Landesarchiv in Münster, um den Entstehungszusammenhang der Karte zu ermitteln.
Allerdings sollte man vorher im Bestand „Kreis Siegen, Landratsamt“ den Aktenband „Anfertigung eines Situationsplans vom Kreis Siegen“ (1816) auswerten; der Band kann im Stadtarchiv Siegen verfilmt eingesehen werden …..
Herrn Wolfs lobens- und dankenswerter Hinweis auf die Akte des Königlichen Landratsamtes Siegen Nr. 1 „Anfertigung eines Situationsplans vom Kreis Siegen (1816)“ verhilft zwar zu keinen weiteren Aufschlüssen über die von Friedrich Carl Padberg gezeichnete Kreis-Karte, aber dennoch zu interessanten Neuigkeiten und Fragen. Leider wird die Entdeckerfreude, wie so oft, durch das ganz unbefriedigende Ergebnis der Mikroverfilmung getrübt, wodurch die volle Ausschöpfung des Informationsgehaltes anhand dieses Ersatzmediums nicht möglich ist.
In der nur neunseitigen, anscheinend nicht ganz vollständigen Akte geht es um eine Karte des Kreises Siegen, die ziemlich genau ein Jahr vor der Padbergschen entstand. Auslöser war hier ein Rundschreiben der Regierung Koblenz vom 21. Juni 1816, in welchem die Kreiskommissare (die Vorgänger der Landräte) zur Ablieferung von Karten ihrer Kreise aufgefordert wurden. In Siegen wandte sich deshalb Kreiskommissar Wolfgang von Schenck Anfang Juli [vorliegender Entwurf undatiert] gleichlautend an den Amtsvorsteher Dilthey in Burbach und an den Rat Dunker in Neunkirchen:
„Von der Königlichen Regierung zu Coblenz habe ich den Auftrag erhalten, von dem mir anvertrauten Kreise sobald als thunlich einen vollständigen Situationsplan anfertigen zu lassen. Von dem hiesigen Fürstenthum ist derselbe bereits verfertiget. Es fehlet mir derselbe nun noch von dem Amte Burbach (Neunkirchen). Der Herr Landmesser Weiß von hier hat daher den Auftrag von mir erhalten den Situationsplan von dem Amte Burbach (Neunkirchen) ebenwohl anzufertigen. Derselbe wird sich in der Absicht dort einfinden. Ich ersuche daher den Herrn pp. [also Dilthey bzw. Dunker] denselben in der Vollziehung seines Auftrags möglichst zu unterstützen, und ihm insonderheit durch die dasigen Forstbedienten mit den nöthigen Notizen über die Kreis- und Gemeindegrenzen und sonstigen für ihn nöthigen Nachrichten an Hand gehen zu lassen.“
Die Aufforderung an Landmesser Thomas Weiß zu Brauersdorf (Amt Netphen), sich wegen Entgegennahme des Auftrages „künftigen Montag den 8. dieses [Monats] Vormittags bey mir einzufinden“, war am 6. Juli abgegangen.
Ein im Konzept vorliegendes Schreiben v. Schencks vom 20. November 1816 („abgesendet d. 22ten Nov.“) gibt Auskunft über die Erledigung des Auftrages:
„K[öniglicher] Regierung habe ich die Ehre gehabt mittelst meines unterth[äni]g[en] Berichtes vom 4ten Oktober d. J. das für Hochdieselbe bestimmte Exemplar des von H[errn] Landmesser Weiß verfertigten Situationsplanes von dem Kreise Siegen zu übersenden. H. Landmesser Weiß hat mir nunmehr auch das für die hiesige Kreis-Commissions-Registratur bestimmte Ex[em]p[lar] übergeben und damit zugleich die hier in dupl[icate] anliegende Gebühren-Rechnung überreicht.“
Fazit also: Im Sommer 1816 hatte Thomas Weiß eine Karte von Burbach/Neunkirchen angefertigt, die mit einer schon vorliegenden und vom Kreiskommissar für brauchbar befundenen Karte des übrigen Kreisgebiets vereinigt wurde. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass letztere zuvor auch schon von Weiß gezeichnet worden war, was sonst sicher explizit erwähnt worden wäre. Der Auftrag an den Brauersdorfer Geometer lautete, den von ihm selbst produzierten Burbacher/Neunkirchener Teil „demnächst mit der bereits von dem Fürstenthum Siegen existierenden Karte […] in ein Ganzes zu bringen“ (Notiz v. Schencks vom 1.8.1816). Ein Exemplar der Gesamtkarte ging Anfang Oktober 1816 nach Koblenz, ein zweites überließ Weiß im November der Siegener Kreisbehörde. Das erste Ex. könnte von der Regierung Koblenz nach dem Übergang des Kreises Siegen in den Regierungsbezirk Arnsberg zusammen mit den Akten dorthin abgegeben worden und somit später im Landesarchivs Münster gelandet sein, oder es verblieb an Ort und Stelle und gelangte (wenn es nicht verloren ging) ins Landesarchiv Koblenz. Das zweite Ex. hätte zusammen mit der alten landrätlichen Registratur, wenn alles rechtens gelaufen ist, auf jeden Fall seinen Weg nach Münster finden müssen. Ein Digitalisat dieser Weiß’schen (evtl. nicht namentlich signierten) Kreiskarte bietet anscheinend weder Münster noch Koblenz an, was aber nichts zu besagen hat. Es ist nicht auszuschließen, dass Recherchen vor Ort in den jeweiligen (noch) nicht digitalisierten Beständen Erfolg haben. Ein solcher ist den „Zeitspuren“-Autoren zu wünschen.
Aus dem Amtsblatt der Kgl. Regierung zu Koblenz (Nr. 44 vom 8.12.1816, S. 356) ist zu erfahren: „Der Landmesser Thomas Weiß zu Brauersdorf ist [am 29. Oktober d. J.] in dieser Eigenschaft für den hiesigen Regierungs-Bezirk bestätigt und verpflichtet worden“. Das dürfte dafür sprechen, dass man in Koblenz mit seiner kürzlich eingereichten Kartierungs-Arbeit zufrieden gewesen war.
Zur Würdigung Thomas Weiss‘ (1778-1861) siehe auch die Ausführungen Wilhelm Güthlings in: Geschichte des Netpherland, Netphen 1967, S. 275-277. Einige digitalisiert zugängliche Karten von seiner Hand aus dem Münsteraner Bestand sind mit Angabe der Autorschaft verzeichnet und somit über das Archivportal leicht auffindbar. Für Freunde des Siegener Tiergartens besonders attraktiv: Eine Serie von Aufnahmen des Domänenguts Charlottenthal 1818/19 (Karten-Nummern 5845 bis 5849 und 6426).
Da der Beruf des Geometers hier mit mehreren persönlichen Beispielen vorgestellt wurde, sei ein diesbezüglicher Blick in den Nachbarkreis Olpe erlaubt. Nach dem Übergang an Preußen, der im Falle des Kreises Siegen mit einer kurzzeitigen Zugehörigkeit zum Regierungsbezirk Koblenz in der Rheinprovinz und der endgültigen Zuordnung zu Arnsberg und der Provinz Westfalen verbunden war, begannen 1819 auch hier die Arbeiten am neuen, preußischen Grundkataster. Davon zu unterscheiden ist die im südwestfälischen Raum zwischen 1836 und 1842 durch das Militär und entsprechend ausgebildete Offiziere durchgeführte preußische Uraufnahme. Das Grundkataster bildete die Grundlage für spätere, nunmehr sehr genaue Kreiskarten. Im Kreis Olpe waren bis 1832 hauptsächlich drei Beamte mit diesen Vermessungsarbeiten beschäftigt, unter ihnen Gustav Stachelscheid aus Drolshagen. Er stammte aus der Familie des dortigen Bürgermeisters, der seinen drei Söhnen neben dem obligatorischen Besuch der Volksschule persönlich Privatunterricht erteilt hatte. Sein jüngerer Bruder Carl war später Amtmann in Drolshagen und in den Revolutionsmonaten 1848/49 Abgeordneter im Landtag in Berlin. Aus erhalten gebliebenen Unterlagen (Lebenslauf und Personalfragebogen) ist zu entnehmen, dass der ältere Bruder Gustav bei der Musterung fürs Militär wegen „Brustschwäche mit begleitendem Bluthusten als definitiv untauglich“ ausgemustert worden war. Er begann seine berufliche Laufbahn 1820 als „Kataster-Gehülfe“ und legte sein Feldmesser-Examen im April 1821 ab. Danach arbeitete er zunächst mehrere Monate als selbständiger Geometer, bis er 1822 von der Bezirksregierung Arnsberg als Kataster-Geometer fest angestellt wurde. Kurz vor Abschluss der Vermessungsarbeiten für das Grundkataster wurde er 1831 mit Nachvermessungsarbeiten im Kreis Siegen beauftragt. Nachdem das für seine Genauigkeit noch heute bewunderte preußische Grundkataster erstellt war, wechselte Gustav Stachelscheid im Mai 1837 erst auf die Stelle eines Steuerkalkulators im Kreis Meschede, bevor er als solcher dann ab dem September 1838 im Kreis Olpe tätig war. Der Berufswechsel lag nahe, da das Grundkataster bekanntlich die Basis der Grundsteuer-Erhebung bildete. (Vgl. zu diesem Beispiel Pfau, 200 Jahre Geschichte des Kreises Olpe, S. 34 f.)
Das Olper Beispiel weist auf den nicht auf ein Kreisgebiet beschränkt gebliebenen Einsatz von Vermessungsfachleuten und natürlich auf die Anfänge eines neuen Typus technischer Fachbeamten hin – auf deren Arbeitsergebnisse heutige Vermessungs- und Liegenschaftsbeamte nicht selten noch zurückgreifen (müssen).
Sobald das Thema der ersten Kreiskarten im Forschungsprojekt auf die Tagesordnung rückt, wollen wir die wertvollen Tipps und Anregungen von Peter Kunzmann, Bernd Plaum, Wilfried Lerchstein und Thomas Wolf gerne aufgreifen. Insbesondere die Hinweise auf Akten- und Literaturfunde werden dabei sehr hilfreich sein.
Nur noch ein letzter Gedanke kurz nach Toresschluss: Könnte es sich bei der Karte um eine Prüfungsarbeit gehandelt haben? Die Examinierung junger Feldmesser schloss zweifellos auch den Nachweis der Befähigung zum Kartenzeichnen ein. Ist nur so eine spontane Idee …
Prima! Noch besser, wenn aktiv mit historischen Inhalten gearbeitet. Gerade mein Windows10 Nokia stillgelegt, weil keine Apps mehr unterstützt. Jetzt Freude auf Archivschnitzeltest mit neuem Android #DOSENFISCHEREI #GEOCACHING #ARCHIV
Ich finde, Kommunen sollten sich ihre Archive mit angemessener Personalausstattung leisten. Es ist doch ein Armutszeugnis, wie eine wichtige Kommune des Kreises hier um Stunden feilscht.
Ich gebe Herrn Graf insofern recht, dass man ein Archiv, wenn man eins einrichtet, auch richtig ausstatten muss, insbesondere auch in Hinblick auf Digitalisierung und elektronische Langzeitarchivierung. Allerdings sollte man auch von den vielen kleinen Gemeinden in den ländlichen Kreisen wie z.B. Siegen-Wittgenstein, im Hochsauerlandkreis, aber z.B. auch im Oberbergischen Kreis, nicht zu viel erwarten. Hilchenbach hat laut Wikipedia gerade mal 15.000 Einwohner, die Finanzkreaft der Gemeinde ist also vermutlich eher übersichtlich (oder bringt die Siemag soviel Gewerbesteuer?). Vielleicht muss man in diesen Kreisen irgendwann doch mal über Kreiszentralarchive nachdenken. Das ist sicherlich für die lokale Forschung nicht optimal und entfernt das Archiv emotional und im Wortsinne interessierten Bürgerinnen und Bürgern, andererseits muss man sich auch fragen, ob ein kleines, u.U. schlecht untergebrachtes und nur mit ein paar Stunden von irgendeiner Verwaltungskraft ohne Fachausbildung betreutes Gemeindearchiv, das dann auch nur dementsprechende eingeschränkte Öffnungszeiten hat, wirklich besser ist als ein zentrales Archiv mit einer angemessenen personellen und finanziellen Ausstattung und einem vernünftigen Magazin.
Der Kommunalpolitik kann man nur den Besuch des Rheinischen Archivtages in Frechen empfehlen, der heute in die Endrunde geht. Der Servicegedanke beginnt im Kopf. Hier hat gestern ein berufstätiger Nutzer zahlreicher öffentlicher Archive geschildert, wo er sich in der Nutzung behindert fühlt und was er sich zukünftig für seine Archivbenutzung wünscht. Dazu gehören auf jeden Fall verlängerte Öffnungszeiten, und zwar möglichst an allen Tagen und bis in den frühen Abend hinein. Das wird man tatsächlich in Hilchenbach nicht leisten können. Ein Verbund im Sine eines Kreiszentralarchives wäre vielleicht tatsächlich die praktikabelste Lösung…
Liebe Frau Schmidt-Czaja, öffnet man damit nicht die Büchse der Pandora, indem man den klammen Kommunen einen Vorwand liefert, ihre Archive dicht zu machen? Die Stärke der ‚kleinen‘ Archive (Einmann-, Einefrau-Archive) liegt doch eben darin, dass diese ortsnah, die Archivare/innen resp. Archivverantwortlichen idR im Ort verwurzelt sind, mit der Geschichte ihrer Kommunen und mit ihren Verwaltungen bestens vertraut sind. Man muss nicht nur den beachtlichen Verzeichnungsstand in Hilchenbach heranziehen, um zu beurteilen, dass ein Kreiszentralarchiv (personelle Ausstattung?) zu solchen Leistungen kaum in der Lage ist. Kurzfristig mögen mehr Nutzer zu verlängerten Öffnungszeiten kommen, langfristig bleiben diese aus, wenn der Verzeichnungsstandard nicht mehr den Ansprüchen genügen kann. Sollte man nicht eher alle Kräfte bündeln, damit auch kleine Kommunen in die Lage versetzt werden, fachlich gut besetzte und eingerichtete Archive zu haben. Die Frage nach den Öffnungszeiten regelt sich dann von alleine …
Lieber Herr Burwitz, Sie haben sicher nicht ganz unrecht, allerdings muss es ja nicht zwangsläufig ein Kreiszentralarchiv sein. Denkbar wären ja auch „Archivehen“, in denen Gemeinden eine/n Archivar/in und ein Archiv gemeinsam finanzieren. Grundsätzlich gehe ich einfach davon aus, dass Kooperationen hier ein vermutlich nicht perfektes, aber doch besseres Gesamtergebnis erzielen, da man dabei Ressourcen bündeln kann, die sonst in der Breite verpuffen, ganz abgesehen davon, dass ausgebildete Fachkräfte in der Regel nicht nur 10h / Woche arbeiten wollen (man muss natürlich dafür sorgen, dass hier dann nicht zusätzlich versucht wird, Geld einzusparen, dann kann das Modell natürlich nicht funktionieren). Die Kräfte zu bündeln, wäre sicher schön nur…wessen Kräfte will man hier bündeln? Die Landgemeinden schaffen es ja teilweise schon kaum, die „klassischen“ archivischen Arbeitsfelder abzudecken, wie sollen hier Probleme wie die Digitale Langzeitarchivierung bewältigt werden, die noch weitergehende Kosten verursachen?
@alle: Zunächst vielen Dank für die bisherigen Beiträge – so macht siwiarchiv besonders Spaß!
Neben der klassischen, hier in die Diskussion eingebrachten Lösung der Probleme durch ein Kreiszentralarchiv Warendorfer oder Viersener Prägung, die bisher nicht die Linie des Kreisarchivs ist und auch noch nicht politisch diskutiert wurde, gäbe es noch die sich in Dormagen herauskristallisierende Lösung eines dezentralen Kreiszentralarchivs; dort wird das Archiv des Rhein-Kreises Neuss zukünftig das Archiv der Gemeinde Jüchen betreuen. Die Archivalien bleiben in Jüchen und werden dort von einer Mitarbeiter/in des Kreisarchivs betreut ……. Diese Lösung umgeht die umständlichen Fahrten der Nutzerinnen und Nutzer an den Ort des klassischen Zentralarchivs und stellt eine archivfachliche Bearbeitung des Archivgutes und der Betreuung der Nutzenden sicher. Finanziell wird die Gemeinde entlastet, allerdings fallen auf Kreisseite Kosten, die sicher nicht durch eine spezifizierte Kreisumlage abgefedert werden.
Nun genug der unterschiedlichsten Kooperationslösungen – s. dazu auch die 2. Arbeitskreissitzung des diesjährigen Westfälischen Archivtages in Greven: https://archivamt.hypotheses.org/6257. Denn der Kern des Problems – die fehlende Akzeptanz für die archivische Aufgabenerledigung bei Archivträgern – wird m. E. dadurch nur gelindert – und dies wäre schon positiv. Die Lösung der Probleme ist die Beantwortung der Frage: wie wird die Akzeptanz für Archive in der Gesellschaft erhöht? Denn nur mit einer erhöhten Akzeptanz wird eine archivfachliche Besetzung kleiner Kommunalarchive erreicht werden können; die Gründe, die für diese „Maximal“forderung sprechen, hat Kollege Burwitz formuliert. Archive – und in diesem das Stadtarchiv Hilchenbach – haben das Ihrige getan. Wir müssen also „Verbündete“ finden und diese aktivieren …..
Liebe Frau Dr. Schmidt-Czaja, Kollege Burwitz hat ja schon einmal die hier auch bei mir vorherrschenden „Bauchschmerzen“ bezüglich eines Kreiszentralarchivs dargelegt. Allerdings würde ich gerne auch auf den Aspekt der „Kundenwünsche“ eingehen. Richten sich diese nicht eigentlich an den Archivträger und nicht an die Archive? Fotografieren im Lesesaal, 100%-Digitalisierung, 24/7-Öffnung ….. Diese verständlichen Wünsche können wir Archive nicht ansatzweise, nicht einmal durch „praktikable“ Lösungen erfüllen. Wenn dies gewünscht wird, dann müssen Archive mit ihren Kunden kooperieren. Dann können eventuell alle Wünsche wahr werden: fachlichen Ansprüchen genügende, dezentrale Kommunalarchive mit umfangreichen Öffnungszeiten (Lesesaal wie digital) und hoher Digitalisierungsrate.
Ort, an dem ein paar Jahre später eine neue, eine emanzipatorische Pädagogik in die Praxis umgesetzt werden sollte. Zwei Sorten Innovation, die wohl nicht so gut zusammenpassten.
Zu Robert Krämer s. a. Eintrag im „Regionalen Personenlexikon zum Nationalsozialismus in den Altkreisen Siegen und Wittgenstein“, Aufruf: 24.7.2018
Dort auch Link zur Homepage des Schützenvereins Berleburg (mit Bild Krämers auf der Seite „Schützenkönige„) sowie Hinweis auf die Karteikarte zu Robert Krämer im Bundesarchiv Berlin, Bestand 3.100 (NSDAP-Zentralkartei).
Zu Karl Wilhem Jötten s. a. Seite „Karl Wilhelm Jötten“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 30. Dezember 2017, 08:28 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Karl_Wilhelm_J%C3%B6tten&oldid=172408952 (Abgerufen: 24. Juli 2018, 07:55 UTC)
Schön, dass es zu dieser Ausstellung im Siegerland-Museum kam – war eigentlich lange überfällig. Eine Komponente der oben angesprochenen unbürgerlichen Lebensweise, die sich selten um Konventionen geschert habe, war Walters politisches Interesse. Ein Beispiel: Nachdem am 11. September 1974 der Pinochet-CIA-Putsch in Chile mit den bekannten Folgen stattgefunden hatte und wir linken Studenten vom SHB an der Gesamthochschule Siegen das auf dem Titelbild unserer Zeitschrift thematisieren wollte, stellte er uns dazu ohne große Worte eine Zeichnung zur Verfügung. Sie würde sicher gut in diese Ausstellung gepasst haben, gehört aber wohl auch zu den untergegangenen Werken des Künstlers.
Ich nutze die Gelegenheit, auf einen weiteren Siegerländer bildenden Künstler aufmerksam zu machen, der in den 1920er Jahren international an ganz großen Ausstellungen teilnehmen durfte und im Siegerland bis heute vollständig unbekannt ist: Adolf Küthe.(http://widerspruchundwiderstandimnsinsiwi.blogsport.de/verzeichnis/biografische-skizzen/#kuethe). Auch auf ihn sollte der Blick der Siegerländer Ausstellungsmacher an den zwei Orten, die es dafür gibt, einmal fallen.
Zum politischen Engagement Helspers reichte U. Opfermann folgendes Bild nach:
Beitrag Helspers (re.) zu einer umfangreichen Malaktion Siegerländer bildender Künstler 1981 zur Rakenten und Marschflugkörperstationierung. Quelle: Privatbesitz
s. a. Manfred Zabel: Anwalt der Hungernden und Flüchtlinge. Früherer Landrat Fritz Fries erster Regierungspräsident nach 1945, in; Siegerland Band 68, Heft 3-4 / 1991, S. 84 – 86
Alles richtig!
Das Bild des Freibades Buschhütten stammt aus einer Sammlung des Kreisbaurats Kienzler. Die Bilder sind zwischen 1955 und 1959 entstanden. Das hier gezeigte Luftbild ist leider ohne Datum.
Die Badeanstalt wurde 1927 gebaut und 1949 renoviert (Quelle: Homepage des TVG Buschhütten.)
Es muss wohl ein Korrektur vorgenommen werden. Das Bild wurde vermutlich erst 1970 aufgenommen – als Beleg wird der Durchgang (mit Dusche) zur Liegewiese rechts zwischen den Schwimmbecken angeführt, der wohl zu dieser Zeit entstanden ist.
Ergänzende Informationen zum Dissertationsprojekt:
„An nicht wenigen Archivarskarrieren im 20. Jh. wird deutlich, dass die Entnazifizierung kaum Spuren in der deutschen Archivwissenschaft hinterließ. Obwohl Kontinuitäten nach 1945 keine Ausnahmen waren und bis in höchste Ämter führen konnten, entstand lange Zeit keine systematische historische Forschung zur Geschichte des Archivwesens (der institutionalisierten Archivlandschaft) oder der Archivwissenschaft (als wissenschaftlicher Disziplin) des „Dritten Reichs“. Von der Geschichtswissenschaft vernachlässigt und von Archivaren nur akzidentiell betrieben, kam es erst Mitte der 1990er Jahre zur Publikation von Pionierstudien, die seitdem um meist deskriptive Arbeiten zu isolierten Teilaspekten der NS-Archivgeschichte ergänzt wurden. Eine übergreifende Arbeit stellt hingegen ein Forschungsdesiderat dar. In der projektierten Dissertation soll dieses Defizit angegangen und disziplinhistorische Forschung geleistet werden, auch um durch Fachgeschichte zum besseren Verständnis der archivwissenschaftlichen Disziplin beizutragen. Der Untersuchungszeitraum (~1920-1950) ergibt sich in erster Linie dadurch, dass auch in diesem Kontext weder 1933 noch 1945 tiefgreifende Zäsuren darstellen. Unter Berücksichtigung einer Binnenperiodisierung des „Dritten Reichs“ sollen deshalb Entwicklungen aufgezeigt werden, welche die Archivwissenschaft maßgeblich beeinflussten. Spannungsfelder innerhalb des Archivwesens werden ebenso untersucht wie Kooperationen archivwissenschaftlicher Einrichtungen mit staatlichen und parastaatlichen Organisationen. Für letztere sind vielfältige Verflechtungen während des Zweiten Weltkriegs, die von Kooperation bis Partizipation reichten, offensichtliche Beispiele. Die Archivwissenschaft darf bei diesem Vorgehen allerdings nicht als monolithische Einheit verstanden werden. Stattdessen muss ihre personelle Zusammensetzung ebenso untersucht werden wie die Konstituierung fachinterner „Denkkollektive“, da hier eventuelle rassistisch-expansionistische Radikalisierungstendenzen ausgemacht werden können. Um diese Lücke in der Forschung zu schließen, wird ein spezifischer institutionsgeschichtlicher Ansatz gewählt, der sich durch prosopographische Untersuchungen ergänzen lässt. Statt den Blick ausschließlich auf organisatorische Strukturen und deren Entwicklung zu beschränken, sollen institutionelle Rahmenbedingungen vielmehr dahingehend betrachtet werden, welchen Einfluss deren Veränderungen auf die in diesen „Arbeits- und Kommunikationszusammenhängen“ ausgeübten Tätigkeiten hatten. Deshalb werden unter Institutionen nicht in erster Linie Behörden oder Organisationen verstanden, sondern auch wissenschaftliche Tagungen, Fachzeitschriften und Ausbildungswege. Wechselwirkungen innerhalb der Disziplin lassen sich damit ebenso erkennen wie zwischen den „Ressourcenensembles“ Wissenschaft und Politik. [Februar 2013]“
Link: http://www.wsu.geschichte.uni-freiburg.de/personen/Tobias-Winter
Bei den beiden Fotos handelt es sich um Aufnahmen der Breitenbachtalsperre bei Allenbach. Die Fotos zeigen das Umfeld der Staumauer noch recht frisch erbaut / noch im Bau befindlich. Daher schätze ich die Fotos auf ca. 1956 (Fertigstellung).
1) Die Frage ist korrekt beantwortet.
2) Leider ist das Aufnahmedatum noch nicht richtig. Aber eines der Bilder zeigt ein Gebäude, nach dem hier auf siwiarchiv schon einmal – vergeblich – gesucht wurde – im Adventskalender 2015.
Für die Gestaltung des Begleitprogramms suchen die Veranstalter Betroffene und/oder Angehörige, die vor dem interessierten Publikum von ihren Erfahrungen berichten.
Dies kann nicht ernstlich gemeint sein.
15 jährige Jugendliche (im Jahre 1945) wären heute 88 Jahre alt.
Solche Personen liegen heute meistens in Pflegeheimen.
Diese Maßnahme kommt rund 20 Jahre zu spät.
Es handelt sich um Teile des Ortes Krombach und die Anlagen der Krombacher Brauerei. Warum das Foto im Kontext der Sommerfreizeittipps erscheint? Der örtliche Verschönerungsverein gab 1929 eine 31 Seiten umfassende Broschüre unter dem Titel „Sommerfrische Krombach im Siegerland“ heraus und versuchte, den Ort als touristisches Ziel im nördlichen Siegerland zu etablieren. Im anschließenden Anzeigenteil spricht die Hasbrauerei den Erholungssuchenden direkt an: „Versuchen Sie Krombacher Pilsener Krombacher Spezial-Export. Sie werden sich von der vorzüglichen Güte und Bekömmlichkeit selbst überzeugen!“
Heute strömen die Besucher weniger wegen der Sommerfrische nach Krombach. Ziel von mittlerweile schätzungsweise 100.000 Besuchern jährlich ist die Braustube (Krombacher Erlebniswelt) der Brauerei – ein Sommerfreizeit-Geheimtipp!
Archivierende meist kleinerer Archive betreuen ja meist auch (Präsenz-)Bilbliotheken und beschäftigen sich ja auch mit „alten Büchern“.
Die Verehrung als Schutzpatron der Bibliothekare rührt – zumindestens laut Wikipedia – von der vermögensverwaltenden Tätigkeit Laurentius´ her. Dies ist ja heute immer noch einer der Hauptaufgaben der Bibliotheken, oder?
Ich glaube, Herr Bonin hatte zuletzt sein Architekturbüro in Siegen, Melanchthonstraße. Dort ist jetzt das Christofferhaus. Ein architektonisch beeindruckendes Haus!
Herr Bonin wohnte in der Melanchtonstr, früher Bergstr, und hatte sein Büro in Siegen Spandauer Str. im Allianzhaus. Sein Wohnhaus existiert noch. Es steht von unten kommend 2 Häuser vor dem Christofferhaus.
Walter Bonin hatte in Siegen an verschiedenen Stellen
seine Büros, unter anderem Bahnhofstraße, Fürst – Johann-Moritz Straße und auch an der Weidenauer Straße.
Habe im Architekturbüro Bonin meine Lehre gemacht.
Zur Erläuterung des Projekts s. WDR.de v. 13.8.2018: “ …. „Ich habe auch Leute in Siegen-Wittgenstein kennengelernt, deren Brüder oder Onkel verschwunden sind“, sagt Heiko Ullrich, Chefarzt für Psychiatrie im Kreisklinikum. „Man machte sich Gedanken darüber: Was ist da überhaupt passiert?“
Wer sich für die Linde unabhängig vom Kaiser interessiert, findet einen interessanten Bericht aus neuerer Zeit hier:
Alfred Becker u. Martin Sorg, Sanierung der Kaiserlinde auf dem Kindelsberg, in:
Siegerland 84 (2007), S. 75-83
Die Umbenennung der Hindenburgstraße ist eine gute Idee und ich hoffe, dass der Rat der Stadt Hilchenbach sich mit dem Thema erneut beschäftigen muss
und den Straßennamen einzieht.
Der Antrag zur Umbenennung ist direkt mit dem Vorschlag eines neuen Namens verbunden Paul-Benfer-Straße.
Wie viele Lehrer war auch Paul Benfer Mitglied der NSDAP, Mitgliedsnummer
5490101, die Aufnahme erfolgte am 1.5.1937. Bereits am 1.5.1933 wurde er Mitglied im NSLB.
Mit diesen beiden Mitgliedschaften ist er meiner Meinung nach nicht geeignet
eine Ehrung im öffentlichen Raum in Form eines Straßennamens zu bekommen. http://akteureundtaeterimnsinsiegenundwittgenstein.blogsport.de/a-bis-z/gesamtverzeichnis/#benfer3
Vielen Dank für den Hinweis: Hier noch der Link zu BBF/DIPF/Archiv, Gutachterstelle des BIL – Preußische Volksschullehrerkartei
Regierungsbezirk Arnsberg, GUT LEHRER (Personalunterlagen von Lehrkräften), 16717 (Paul Benfer)
Die PDF zum Urkundenbuch „Kaiserlinde auf dem Kindelsberg“ hat jetzt die gewünschte hohe Auflösung. Ich wünsche ein informatives und erfolgreiches Stöbern ;-)
Ich weiß natürlich nicht, zu welchem Anlass der frühere Landrat die Figur
„Schutzmann mit Blumenstrauß“ (eigene Bezeichnung) erhielt. Ich habe sie aus Anlass meines 25-jährigen Dienstjubiläums als Kriminalbeamter vom Personalrat der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein erhalten. Als man sie mir zum 40. Dienstjubiläum noch einmal überreichen wollte, habe ich höflich abgelehnt, weil ich die Erstvergabe nicht entwerten wollte. Zu den Jubiläen möchte ich noch folgende Anekdote nachreichen: Es war damals in der Behörde üblich, dass man sich sein Buchgeschenk im Wert von DM 20,- selbst aussuchte, es einpacken ließ und dann der Verwaltung zusandte, um es dann, quasi als Überraschung vom Oberkreisdirektor, später vom Landrat überreicht zu bekommen. Mein Buch kostete damals etwa DM 21,90. Natürlich wurden mir DM 20,- erstattet. Die Mehrkosten von DM 1,90 waren nach 25 Jahren offenbar untragbar. :-)
Ein Literaturhinweis zur Geschichte des Bades – via Facebook:
„Erinnerungen ans alte Hallenbad“, in: Mitteilungsblatt 13 der Ehemaligen u. Förderer des Löhrtor-Gymnasiums“, Januar 1967, S. 34 – 35
Wirklich schwierig. Der Herr Archivar könnte einen Tipp geben.
Ich tippe auf eine Schmiede im Altkreis Wittgenstein. Für einen Backes erscheint mir das Gebäude zu groß. Aber wer weiß….
Der quergestellte Stall-/Scheunenanbau links ist eher untypisch für das Siegerland. Daher meine Vermutung Wittgenstein. Das vermutete Schmiedegebäude scheint heute nicht mehr zu existieren. Kurz hatte ich Rinthe vermutet. Aber die dortige Schmiede sah anders aus.
U zoekt fotomateriaal uit “ der belgischen Besatzung aus dem Zeitraum 1942 – 2003 “ …???
Mag ik u erop wijzen dat er :
primo: in 1942 nog om voorhand liggende redenen nog geen bezetting kon zijn …
secundo : dat de “ Besatzung “ reeds in 1952 , ook om voor de hand liggende redenen werd opgeheven en er op dat ogenblik überhaupt geen “ Besatzung“ meer was…
tertio: vanaf 1952 waren de in de Bundesrepublik gelegerde buitenlandse troepen – dus ook de Belgische – daar gestationeerd in het kader van de Nato, waarvan de Bundesrepubliek een gewaardeerde partner was en nog steeds is.
leider verstehe ich nicht so gut Flämisch, daher schreibe ich in Deutsch und hoffe, dass Sie mich verstehen. Sie hatten gestern auf Siwiarchiv ein Kommentar gemacht. Die Besatzung bestand bis ca. 1950. Danach waren die Truppen als Verbündete der Nato in Deutschland – das ist absolut richtig.
Dennoch habe ich „Besatzung“ geschrieben, weil es so für viele verständlich ist. „Stationierung“ wäre wohl der bessere Begriff gewesen …
Ein paar weitere Informationen dazu:
Die damalige Amtsrealschule Eiserfeld wurde am 27. April 1953 als erste Realschule im heutigen Siegener Stadtgebiet eröffnet. Zunächst war die Amtsrealschule in der Wilhelmstraße zu finden. Bald jedoch war das dortige Schulgebäude zu klein.
So wurde die Schule am 27. Juni in die Straße „Am Hengsberg“ umgesiedelt. Außerdem bekam sie einen klangvolleren Namen: Schneider-Davids-Schule.
Von Beginn an fehlte es an Raum. 1957 gab es 6 Klassen mit jeweils 40 – 50 Schülern, aber weder Fachräume für Naturwissenschaften, Kunst, Musik und Werken noch eine Turnhalle.
Seit 1965 hatte die Schule regen Zulauf, so dass bald Raum- und Lehrermangel herrschten.
Im März 1963 wurde die Turnhalle errichtet.
Die Schule erhielt einen neuen Namen: Realschule der Stadt Eiserfeld.
Mitte der siebziger Jahre wurden acht provisorische Pavillons errichtet.
1977/78 wurden endlich naturwissenschaftliche Fachräume geschaffen.
1984 ließ der damalige Schulleiter Kroitzsch das unter der Turnhalle gelegene Lehrschwimmbecken zu einem Kunst- und Werkraum umbauen.
Dreizehn Jahre später wurden die Pavillons durch zwei große Container auf dem Schulhof ersetzt. Auch der Name wandelte sich noch einmal: Realschule am Hengsberg.
2003 wurde der Neubau fertiggestellt und eingeweiht, passend zum 50jährigen Jubiläum unserer Schule.
Am 30. Oktober 1951 wurde der Grundstein gelegt, da habe ich noch einen (tonlosen) Film von.
In den Folgejahren entstand der Anbau ganz links im Foto und im März 1963 wurde die Turnhalle errichtet, die hier im aktuellen Foto noch nicht zu sehen ist.
Allerdings erkennt man links die ersten Schachtarbeiten dazu, und deshalb korrigiere ich meine erste Schätzung zur Datierung des Fotos jetzt auf 1962/63.
Da bin ich jetzt ganz bei Ihnen! Die in unseren Unterlagen vorhandene Angabe „ca. 1959“ halte ich für nur noch schwer haltbar -angesichts der Baugeschichte.
Hallo, mein Vater war bei dem Belgischen Millitair in Siegen stationiert.
Er had noch viele Bilder und informationen ueber seine zeit dort.
Spaeter sind wir nach Soest gezogen. Er ist bis zur Rente beim Millitair geblieben.
Er ist 1929 geb. also er wird bald 90.
Wir versuchen alle informationen und bilder die er gesammelt hat zu ordnen und auf dvd ’s zu brennen.
Lieben Gruss
Vielen herzlichen Dank hierfür. Falls ich behilflich sein kann, lassen Sie mich dies bitte wissen. U.A. Werde ich bald in Soest sein. Ich könnte auch das Einscannen übernehmen. Freundliche Grüße aus Köln nach Soest
Hallo Herr Burion ,
Mein Vater und ich arbeiten schon lange an dieser DVD.
Er bekommt zwischendurch immer wieder neue informationen.
Wir wuerden uns sehr freuen Sie persoenlich kennenzulernen.
Geben Sie mir kurz vorher bescheid wenn Sie in Soest sind dann kann ich ein treffen organisieren.
Da kann ich noch etwas zu beitragen: Mein Vater war immer ein Technik-Freak, gab es etwas Neues, musste er es haben. So hatte er sich zur Fußball-WM 1954 einen Fernssher angeschafft. Es war ein Gerät von Graetz mit ~47 cm Bildschirm-Diagonale. Nach dem Einschalten dauerte es knapp 2 Minuten, bis die Röhren aufgeheizt waren und ein Bild kam. Das Problem war aber, einen Sender zu empfangen, in Siegen gab es noch keinen Umsetzer. Das ARD – Programm konnte von Siegen aus vom Sender Koblenz (Kanal 6) empfangen werden. In der Tallage brauchte man dazu eine hohe Antenne (bei uns 4 m mit abgespanntem Mast; der beim Sturm einmal sogar abgerissen wurde). Da das Signal aus Koblenz sehr schwach war, musste zusätzliich noch ein Röhrenverstärker vorgeschaltet werden. Von der WM 1954 (ich damals 5 Jahre alt) kann ich mich nur noch an das Endspiel erinnern. Unser Wohnzimmer war voll mit allen Verwandten und Bekannten. Soweit ich weiß, gab es damals in Siegen insgesamt nur ca. 6 TV-Geräte. Ich erinnere mich noch an das Funkhaus Schwunck in der Kölnerstr., die einen hatten und Elektro-Happe am Kölner Tor (heute Bäckerei Schneider), von denen mein Vater den Fernseher auch bekommen hatte und die eine gleich hohe Antenne hatten wie, wie wir. Das „normale“ Fernsehprogramm begann damals um 17:00 mit der Kinderstunde, für uns damals das Größte. Bis zum Abendprogramm um 20:00 war danach Sendepause. Aber allein das häufig ausgestrahlte Testbild anzuschauen, war schon sensationell. Später konnte man das 1. Programm vom Giersbergsender empfangen. Als um 1967 dann das 2. Programm vom Häusling-Umsetzer ausagestrahlt wurde, benötigte man eine zusätzliche UHF-Antenne, eine 2. Antennenleitung und für die alten TV-Geräte einen zusätzlichen UHF-Tuner, den man oben aufs Gerät stellte. Übrigens gab es Ende der 70er Jahre in Siegen noch die Möglichkeit 2 belgische Programme (flämisch und wallonisch) zu empfangen, vom Umsetzer auf dem Fischbacherberg. Der Sender war für die Angehörigen der belg. Streitkräfte eingerichtet worden und konnte nur mit einer zusätzlichen UHF-Antenne empfangen werden, welche allerdings vertikal ausgerichtet werden musste. – Es waren damals schon abenteurliche Fernsehzeiten, als es noch kein Kabel, keinen Satellit und kein IPTV gab.
Nachträge:
1) Zum Umfang der Zwangsarbeit bei Dango & Dienenthal s. Opfermann, Ulrich [Friedrich]: Heimat, Fremde. „Ausländereinsatz“ im Siegerland, 1939 bis 1945: wie er ablief und was ihm vorausging, Siegen 1991, S. 47 [weitere Erwähnungen der Firma im Text]
2) s. a. Eintrag „Anna Sahirna“, im Aktiven Gedenkbuch für die Opfer des Nationalsozialismus im Kreis Siegen-Wittgenstein, Link: http://aktives-gedenkbuch.de/index.php/Detail/Object/Show/object_id/809 (Aufruf 27.8.2018)
3) Einen anderen Aspekt der Firmengeschichte während des Nationalsozialismus – der ebenfalls nicht im Interview angesprochen wird – beleuchtet der Eintrag „Paul Eberhard Henrich“, in: „Widerspruch und Widerstand. Opposition gegen den Nationalsozialismus in den Altkreisen Siegen und Wittgenstein“ , Link: http://widerspruchundwiderstandimnsinsiwi.blogsport.de/verzeichnis/biografische-skizzen/#henrich3 (Aufruf: 27.8.2018)
Ihr Buchprojekt erstreckt sich auf die „10. Provinz“.
Dazu gehört dann auch das Tanklager Olpe, welches
am Grissemert bzw. in Büschergrund lag.
Post kommt!
Mit freundlichen Grüßen
I.A.
Detlef Köppen
Stadtarchivar
I.A.
Detlef Köppen
Stadtarchivar
Herrn Thomas Wolf
Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein
Postadresse: Koblenzer Str. 73, 57072 Siegen
Sehr geehrter Herr Wolf,
durch den Eintrag vom 29. Aug. 2018 um 10:12Uhr fühle ich mich durch solch unbelegten Anschuldigungen gegenüber meinem Vater in meiner freien Persönlichkeitsentfaltung und meinen Persönlichkeitsrechten angegriffen. Ich möchte, daß dieser Eintrag dauerhaft gelöscht wird.
Vielen Dank, auch für Ihre Information.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfram Vogt
Die Datenbank zur Dokumentarfilmgeschichte der Uni Hamburg gibt zwar keinen Hinweis zm Verbleib des Films, aber wenigstens weitere Informationen zum Film:
1) Kamera: Hans Wunsch
2) Inhalt + neue Literatur:
„Industrielles und kulturelles Aufblühen einer Stadt im Siegener Land.“ (Katalog der Kultur- und Dokumentarfilme aus der Bundesrepublik Deutschland 1954-1959, S. 132)
„Das Werden der Eisenstadt Weidenau im Siegerland aus dem ersten Anfängen heraus (alte Hammerwerke usw.) bis zur Stadtwerdung 1955.“ (Filmkatalog. Nachweisung der deutschsprachigen Lehr- und Aufklärungsfilme des Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesens und der Bautechnik, 1957, Film Nr. 24)
Siegfried Vogt beantragte am 18. Juni 1937 die Aufnahme in die NSDAP. Die Mitgliedschaft erfolgte rückwirkend zum 1. Mai 1937 – Mitgliedsnummer: 5817265 (Quelle: Bundesarchiv Berlin, NSDAP-Gaukartei | BArch R 9361-IX KARTEI / 46160521; Bundesarchiv Berlin, NSDAP-Zentralkartei | BArch R 9361-VIII KARTEI / 24281192).
Das im Bundesarchiv Berlin vorhandene Wehrstammblatt (Signatur: VBS 1009 ZA VI 0673 Blatt 35) vom 6. Oktober 1939 gibt weitere zusätzliche Informationen:
1) Otto Adolf Hermann lauteten die weiteren Vornamen Vogts
2) Seine Eltern waren Otto Carl Vogt, Kaufmann, und Margarete geb. Pape
3) Er besaß zwei Schwestern (1915 und 1922 geboren).
4) Der Geburtsname von Vogts Frau lautete Winckler.
5) Vogt besaß die Mittlere Reife.
6) Am 15. Mai 1936 trat er dem Nationalsozialistischem Kraftfahrkorps (NSKK) bei.
Das ist richtig,
jedoch kann ich mit diesem unkommentierten statement eigentlich nicht so recht etwas anfangen.
nur zur info:
Wann wer von dieser Generation und in welchem Umfang bei dem Regime „mitgemischt“ hat, kann ich nicht werten, da ich zu der Generation gehöre, von der der „begnadete Helmut Kohl“ von der „Gnade der späten Geburt“ sprach.
Ich weiß aus Gesprächen im Familien- und Freundeskreis meiner Eltern, daß eine Parteimitgliedschaft irgendwelcher Art, die Voraussetzung für die Vergabe des Hugo-Göpfert – Preises war und nachträglich an der Parteimitgliedschaft „gefeilt“ wurde, eine Empfehlung, mit entsprechendem Nachdruck.
Aus gewissen, Ihnen nicht unbekannten Gründen musste der eigentliche Blogeintrag mit weiteren Fakten angereichert werden. Die Fakten selbst bestreiten Sie ja selbst nicht und stellen als solche keinerlei „Vorwurf“ da.
Ich finde es toll, wenn alte Dinge erhalten und geschützt werden. Aber wie leider so oft, die Gräber der “ Reichen “ sind protzig, aus langlebigem Material und deshalb heute noch erhalten. Aber wo bleibt der “ arme Schlucker „, der kaum Geld für ein Begräbniss hat, geschweige denn für einen Grabstein. Da bleibt nix von übrig. Eines sollten wir dabei aber nicht vergessen……ohne die einfachen Arbeiter, die sich die “ Finger “ dreckig gemacht haben, für wenig Geld, ohne diese Menschen, würde es keinen “ Reichen “ geben. Denn……..wen sollten sie sonst ausbeuten ????? AUSNAHMEN bestätigen die Regel. Trotzdem ist der “ einfache Arbeiter “ nicht vergessen, denn……..er ist in unseren Herzen und Gedanken.
Man kann ihn als solchen bezeichnen: „Konzeption und Realisierung dieser Begegnungsstätte lagen in der Hand von Claus Kowallik, Anzhausen, dem Kulturberater der Gemeinde Wilnsdorf.“ (Einladung zur Museumseröffnung am 14. Mai 1993). Claus Kowallik ist am 23.03.2018 verstorben. Vielleicht kann die Museumsleiterin mehr zu seiner Person sagen.
Ich muss den Vorkommentator dringend korrigieren: nicht 1974, sondern 1973 fand der Putsch statt.
Und nicht ein Bild zeichnete Walter Helsper zum Thema, sondern gleich einen ganzen Zyklus. Der ging dann an die Chile-Solidarität. Es geht also fehl, ihn auf einen nur auf sich selbst bezogenen unpolitischen „Freak“ zu sehen. Zeitweise gehörte er auch einer Partei an. In der Nachfolge, ließe sich sagen, von Adolf Küthe. Also von jenem bildenden Künstler, der in seiner Heimat immer noch vollständig vergessen ist, obwohl er eine Bekanntheit repräsentiert, die über das Siegerlandmuseum sehr weit hinausgeht.
Liest sich alles etwas geheimnisvoll, soll es auch. Es gibt eben auch in diesem Landstrich noch einiges zu entdecken.
Die Mauer im Hintergrnd dürfte ein Teil der Stadtmauer sein, damit scheidet die Hindenburgbrücke aus. Auf der Mauer ist Schnee zu erkennen, damit scheidet auch die 700 Jahrfeier aus, den diese fand nicht im Winter statt. Aufgrund der Kleidung der Menschen würde ich die Aufnahme in die 50er Jahre datieren.
Vor der Mauer steht eine einzelne Person, vermutlich ein Redner. Auch eine Fahne ist erkennbar.
Das Foto wurde in Berleburg aufgenommen. Mit einem Kran wird der Bär aufgestellt und die Brücke ist die Bärenbrücke über die Odeborn.
Keine Ahnung, welches Jahr das war. Auf jedem Fall erst nach dem zweiten Weltkrieg.
Stefan Leipelt hat recht:
Das Bild zeigt die Einweihung der heutigen „Bärenbrücke“ über die Odeborn in Berleburg im Verlauf der Poststraße bei der Einweihung am 26.1.1955.
Der bronzene Bär des Künstlers Wolfgang Kreutter kam nach 1956 dazu.
Nachzulesen bei Heinz Strickhausen in „Wittgenstein“ August 2018, Seite 94 ff.
Das Schöne an solchen realistischen Gemälden aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg liegt darin, dass sie einen farbigen Kontrapunkt zur Schwarzweißfotografie bieten.
Es wäre interessant zu wissen, unter welchen Bedingungen die vom NS-Regime verfolgte und 1942 ermordete Jung-Danielewicz das Gemälde verkauft hat / verkaufen musste. Sie wurde im November 1942 nach Minsk deportiert. Aufgrund der zahlreichen Fälle von NS-Raubkunst, die in den vergangenen Jahren öffentlich wurden, sollte man bei Gemäldeverkäufen aus dieser Zeit immer besonders gut hinschauen.
Guter Hinweis Frau Perol -Schneider, aber beide schräg gegenüberliegende Villen neben und gegenüber dem Kaisergarten, haben zwar einen ähnlichen Baustil, aber es fehlen doch die gravierenden Bauteile (z.B. Dachkonstruktion, seitl. Rund- Erker), die man sicher bei evtl. Umbauten oder Nachkriegsrestaurierungen sicher nicht entfernt oder alles so abgeändert hätte. Es sei denn, Sie haben noch ein Foto von einem Haus „Am Kampen“, das heute gar nicht mehr existiert. Trotzdem vielen Dank !
Bei der Stadt Siegen gibt es eine Inventarisationsliste.
Diese wurde durch die LWL-Denkmalpflege erstellt.
Sie beinhaltet Objekte, die evtl. später ein Denkmal sein
könnten. Sie beinhalten eine Gebäudebeschreibung
anhand von Bauelementen. Dazu gibt es eine Alterseinschätzung.
Mit diesem Arbeitsinstrument, welches für Siegen erst ca. 1990
erstellt wurde, könnte der Standort eingegrenzt werden.
Siegen hat sich halt entwickelt.
Vielen Dank für den Hinweis! Dies würde allerdings 2 Dinge voraussetzen:
1) Das Gebäude stand 1990 noch.
2) Das Gebäude wurde damals (schon) als denkmalswürdig erachtet.
Einige Fragen.
– Wenn man schon die These von der angeblichen früheren „Prächtigkeit“ der Stadt Siegen mit einem Zitat untermauern möchte: Muss man dann als ersten und einzigen Bürgen ausgerechnet jemanden wie Fritz Mielert bemühen? (U.a. Autor des Machwerks „Bunte Bilder aus dem größten aller Kriege. Ernstes und Heiteres für das deutsche Volk“ 1915, folgerichtig später Funktionär der Reichsschrifttumskammer)
– Läßt sich aus den Lobpreisungen eines 1879 geborenen Schlesiers irgend etwas quellenmäßig Gesichertes über das frühere architektonische Bild Siegens ableiten? (Z.B. „blendend weiße“ Häusermassen im Mittelalter)
– Wie fügen sich in das des „hellsten Zujubelns werte“ Wunschbild die Schilderungen auswärtiger Augenzeugen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts ein, die es für nötig hielten, auf die Schmutzigkeit der Stadt zu jener Zeit hinzuweisen?
– Ist es nötig, die „meisten anderen Städte mit ähnlichem Schicksal“ (massiven Kriegszerstörungen) pauschal zu diskreditieren, um die angebliche „Erfolgsgeschichte“ der eigenen Stadt um so mehr herauszustreichen?
– Sind all die Durch- und Zugereisten, die Siegen als Ganzes (abgesehen von einzelnen ansehnlichen Vorzeigepunkten) ganz und gar nicht mit einem „nachhaltig schönen Stadtbild“ assoziieren, nun allesamt Banausen und Geschmacksverirrte, denen endlich mal die Augen geöffnet werden müssen?
– Wäre es nicht eine angemessenere Ausgangsbasis für die Arbeit an der zukünftigen „Stadtbildqualität“, die „Leistung des Wiederaufbaus“ in Siegen und an vielen anderen vergleichbaren Orten ganz nüchtern darin zu sehen, dass aus dem Ruinenfeld schnell eine für ihre Bürger wieder funktionierende Stadt erschaffen wurde, was unter den gegebenen Voraussetzungen und Dringlichkeiten keine ästhetische Prioritätensetzung erlaubt hatte?
In der geschlossenen Facebook-Gruppe „Stadt Siegen in alten und neuen Bildern“ wurde darauf hingewiesen, dass das Gebäude in der Kirchener Bahnhofhofstr. 14 in der Denkmalliste der Stadt Kirchen eingetragen ist: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Kulturdenkm%C3%A4ler_in_Kirchen_(Sieg) . Vielen Dank für den Hinweis!
Danke für den Hinweis! In der geschlossenen Facebook-Gruppe „Stadt Siegen in alten und neuen Bildern“ wurde bisher unterschiedlich Standorte diskutiert: Netphen-Deuz (wohl eher nicht), Siegen, Freudenberger Str. /Nähe Hermelsbacher Weg oder Siegen, Rosterberg …..
Die Villa Waldrich im Hohler Weg scheint nicht nur richtig zu sein, sondern sie ist es wirklich nicht !!! Die Archiv- Bezeichnung „Haus in Siegen“ muß bei diesem gesuchten Gebäude auch nicht unbedingt stimmen, wie bereits das Ergebnis beim Gebäude Nr. 1.01 gezeigt hat. Hier wurde z.B. von Frau Ursula Schleifenbaum der richtige Hinweis gegeben. Das gesuchte Haus befindet sich in Betzdorf-Kirchen, in der Bahnhofstr. 14 (Gelbe Villa).
Ja das stimmt ! Glückwunsch Herr Bohn. ! Wie sind Sie darauf gekommen ? Hätte ich bei meiner google – Suche aber auch finden müssen . Das ist nun schon der 2. Treffer durch diese Suchaktion. Vielen Dank !!!
ich intressiere mich sehr fuer baugeschichte–und das haus war mir schon einmal aufgefallen
ich selbst sammle alte aufnahmen von haeusern des siegerlandes—der zeit um 1910–meist aufgenommen von wanderfotographen—und meist stehen die bewohner davor—bisher hab ich ueber 100 orginale gesammelt ungefaher 10 habe ich auch noch nicht zuordnen koennen–ich kann ihnen gern mal beispiele mailen—
seit 1892 steht die germania an dieser stelle—
ich hoffe das die meisten personen im stadtrat geschichtsbewusst und vernuenftig abstimmen–und auch die denkmalbehoerde eine umstellung ablehnt
Eberhard Katz war der jüngere Bruder des ersten Ehemannes meiner Mutter, Helmut Katz (1919-1945). Er wurde 1954 mein Pate. Nachdem es mich beruflich ins Rheinland verschlug, habe ich ihn und seine Familie oft in Rösrath besucht. Es war mir eine Ehre, ihm zu seinem 90. Geburtstag, den er ja selbst nicht mehr feiern konnte, einen kleinen Artikel in der Wikipedia zu widmen. Da gehörte er schon längst hin.
Hinweis:
Der SHGV-Archivar hat damals dieses Foto Nr. 1.12 mit Wohnhaus Karl Hermann Klingspor, Siegen- Kirchweg 4 und dann verbessert mit Waldstr.13 A
gekennzeichnet. Alle Angaben sind aber falsch. Die heute noch vorhandene Villa Klingspor (Inh. Naxos-Werke) ehem. Waldstr. 13 A, heute > „Am Stadtwald “ steht neben der Verwaltungs- Fachschule am Fischbacherberg. Diese Haus 1.12 muß nach dem Blick auf den Dicken Turm (li.) in der ehemaligen Feldstr. (heute Ernst Bach Str. ) gestanden haben und auch einen ganz anderen Besitzer/Erbauer gehabt haben. Auf bisher gesichteten alten Postkartenansichten vom Fischbacherberg konnte ich diese Villa aber nicht mehr zu lokalisieren. Sie ist offenbar im Krieg zerstört worden . Es wäre ja schön, wenn es noch jemand gibt, der Fotos besitzt, wonach der ehemalige Standort noch genauer sichtbar gemacht werden könnte.
Liebe Frau Schleifenbaum, da waren Sie offenbar nur eine Minute zu spät dran, aber vielen Dank für Ihre emsige Mithilfe. Zu Ihrem erfolgreichen Tipp zum Foto 1.01 , wäre es sicher ganz interessant einmal zu wissen, wie Sie das Haus denn gefunden haben. Kannten Sie es evtl. über die Caritas ???
Da Peter Weller auch Betzdorfer Raum tätig war – habe ich bei Google – alte Häuser 1910 – Bilder eingegeben.
Es dauerte etwas – dann erschien dieses „Neue Bild“. Ich bin dann auch ziemlich hartnäckig. Macht Freude – diese Sucherei.
Ihr Hinweis ist gar nicht mal so falsch, denn Peter Weller hat in der ehemaligen Weidenauer Burgstr. ( heute Graf Luckner Str.) allein zwei weitere Privathäuser fotografiert. (Villa von Paul Breitenbach , Haus Nr. 16 u. Hebamme Heß , Nr. 20 ) Bei diesem Foto mit Hintergrund Kolonie-Siedlung, steht wohl das Haus in der Luckner Str. Nr. 23 in Verdacht, aber dem Gebäude fehlen doch einige gravierende Merkmale (z.B. die Gauben ). Aber selbst, wenn man das Foto spiegelbildlich betrachtet und der Erker auf der rechten Seite liegt, stimmt es kaum mit der Hintergrund-Siedlung überein. Aber besten Dank für Ihren Hinweis ! Werde ihn sicher im Blick behalten und evtl .einmal mit dem heutigen Besitzer sprechen, vielleicht hat man ja da in den letzten 100 Jahren so einiges umgebaut.
Das Gebäude befindet sich laut Thomas Bartolosch in Betzdorf, BismarckBahnhofstr. 28. Ich hatte Dr. Bartolosch angeschrieben, nachdem ein Gebäude in Kirchen identifiziert werden konnte. Fotografischen Beleg reiche ich morgen nach.
Heureka ! Das ist der 3. Treffer der Serie. Danke !
Aber bei „google earth“ wird die Bahnhofstr. Nr. 28 so nicht sichtbar, auch wenn leider nur die Dachansichten zu sehen sind. Entweder irrt sich google mit der Haus-Nr. oder Herr Dr. Bartolosch , was aber eigentlich recht unwahrscheinlich ist, da er doch selbst Betzdorfer ist.
das haus stand/steht in der ernstbachstrasse 18—nur das kellegeschoss ueberstand den weltkrieg—-ich sammle siegerlaender ansichtskarten und eine meiner karten zeigt die ernstbachstrasse und laesst auf die genaue lage schliessen —das haus im heimatschutzstil um1910 gebaut hatte auch auf der rueckseite zum talgrund hin einen doppelrisalit wie auf der strassenseite—ich kann ihnen gern die ansichtskarte mailen—lieb gruesse
lars Bohn
die aufanhmen von peter weller stammen ja vermutlich aus der zeit um 1935–
1928 damals unter der adresse feldstrasse 18 gehoerte das haus dem komerzienrath karl hentschel in kassel—einem mitglied der dort bekannten industriellenfamile—vermutlich durch zahlungsschwierigkeiten an diesen eigentuemer gelangt–zur miete wohnt dort 1928 der dipl ing.otto favorke
In der geschlossenen Facebook-Gruppe „Stadt Siegen in alten und neuen Bilder“ wurde folgender Standort vorgeschlagen: Siegen, Ecke Knopsstrasse / Oberlinstrasse.
Das Gebäude Knopsstr. 1 hat eine gewisse Ähnlichkeit, aber durch ein Foto von Peter Weller ( Archiv Nr. 1.15 ) mit Blick in die Knopsstr. ist links noch die Hausecke von Haus Nr. 1 zu sehen.
Es ist auf der Giebelseite kein Fachwerk vorhanden, sondern es ist das verschieferte Mansardendach schon damals so vorhanden gewesen , wie heute. Somit muß, auch nach meiner Rücksprache mit der heutigen Hausbewohnerin Frau Anke Finger, davon ausgegangen werden, daß es nicht das gesuchte Wohnhaus sein kann. Es hätte sonst sicher vieles gut gepaßt, zumal ja auch der Fotograf damals um ca. 1912 fast genau an der gleichen Stelle ein Foto von der Knopsstr. aufgenommen hat. Die Vermutung liegt somit nahe, daß es sich bei dem gesuchten Gebäude vielleicht auch um ein Haus im Betzdorfer Raum handeln kann, da ja bereits schon einige der gesuchten Gebäude dort aufgedeckt wurden, obwohl sie vom damaligen SHGV-Archivar fälschlicherweise als „Haus in Siegen“ gekennzeichnet wurden. Aufgefunden werden kann das wohl nur durch interessierte Einheimiische, da von dieser Region keine 3D-Satellittenaufnahmen bei google–earth vorliegen.
Günter Dick gibt hierzu folgende Rechercheergebnisse:
„Es ist hier nur zu vermuten, daß das Foto , wenn es denn wirklich in Weidenau gemacht wurde, das Haus Müller in der Ferndorfstr. 13 (ehem. Haus Nr. 45) in Schneppenkauten gewesen sein könnte..Das Türmchen ist heute hinter hohem Baumbewuchs verdeckt. Der Feldweg der parallel zur heutigen Weidenauer Str. verlief, wurde bei Anlage der Ferndorfstr. eingeebnet und das Gebäude in weiten Teilen schon vor 1910 umgebaut.:
> Traufe von Dach u. Turm auf gleiche Höhe, – Anbau auf der Nordseite entfernt, – Hauseingang auf Südseite zur Ferndorfstr. hin verlegt, – Ziegelfassade erhielt hellen Verputz , – Giebel auf der Ostseite erhielt oben eine Abflachung, – Für die Verlegung des Hauseinganges spricht, daß an der ehem. Stelle die Ziegelumrandung der Haustür erhalten blieb .
Eine Ansichtspostkarte von ca. 1910 zeigt aber das Haus schon in seiner heutigen Form., von zahlreichen Gebäuden umgeben. Das Gebäude und das Foto müßte dann u.U. schon um die Jahrhundertwende entstanden sein, wo die gesamte Umgebung noch unbebaut war.
Leider ist im Archiv des Siegener Bauamtes in Geisweid die alte Bauakte zur Ferndorfstr. 13 (45) nicht mehr aufzufinden, so daß auch der Erstbesitzer und Bauherr der Villa (noch) unbekannt bleibt. ( vermutlich waren es Personen aus der naheliegenden Fa. Schmidt + Melmer) – Der älteste Sohn des Firmengründers Karl Schmidt – Robert, erbaute eine ähnlich aussehende Villa in unmittelbarer Nachbarschaft in der Ferndorfstr. 32, – Abriß erfolgte ca. 1975 für Erweiterungsbau des FJM-Gymnasiums )
Nach den vorliegenden Erkenntnissen sind aber Zweifel an der Richtigkeit der Annahmen sicher nicht ganz von der Hand zu weisen.
Es ist nur schade, dass Peter Weller damals seine Kamera nicht etwas weiter nach links ausgerichtet hat, denn dann hätte man anhand der dann sichtbaren ehem. Oberen Friedrichstr. ( Weidenauer Str.) die Örtlichkeit heute besser lokalisieren können, aber das war ihm offensichtlich gar nicht wichtig, Hauptsache er hatte die „Architektur im Kasten.“.
„
Neben der Graf-Luckner Str. 23 wurde auch Siegen, Harkortstr. 5, in der der geschlossenen Facebookgruppe „Stadt Siegen in alten und neuen Bildern vorgeschlagen.
Zusammenstellung der bisherigen Ergebnisse:
1) Siegerländer Heimat- und Geschichtsverein, Archiv Peter Weller, Nr. 1.01: Kirchen, Bahnhofstraße 14
2) Siegerländer Heimat- und Geschichtsverein, Archiv Peter Weller, Nr. 1.02: [Siegen-Weidenau, Graf-Luckner Str. 23; Siegen, Harkortstr. 5]
3) Siegerländer Heimat- und Geschichtsverein, Archiv Peter Weller, Nr. 1.03: Betzdorf, Bismarckstr. 28
4) Siegerländer Heimat- und Geschichtsverein, Archiv Peter Weller, Nr. 1.08: Siegen, Tiergartenstr. 99
5) Siegerländer Heimat- und Geschichtsverein, Archiv Peter Weller, Nr. 1.12: Siegen, Ernst-Bach-Str. 18; Siegen, Am Stadtwald 11/13]
6) Siegerländer Heimat- und Geschichtsverein, Archiv Peter Weller, Nr. 2.03: [Siegen, Ecke Knopsstrasse / Oberlinstrasse]
7) Siegerländer Heimat- und Geschichtsverein, Archiv Peter Weller, Nr. 4.12
8) Siegerländer Heimat- und Geschichtsverein, Archiv Peter Weller, Nr. 4.18: Es ist hier nur zu vermuten, daß das Foto , wenn es denn wirklich in Weidenau gemacht wurde, das Haus Müller in der Ferndorfstr. 13 (ehem. Haus Nr. 45) in Schneppenkauten gewesen sein könnte..Das Türmchen ist heute hinter hohem Baumbewuchs verdeckt. Der Feldweg der parallel zur heutigen Weidenauer Str. verlief, wurde bei Anlage der Ferndorfstr. eingeebnet und das Gebäude in weiten Teilen schon vor 1910 umgebaut.:
> Traufe von Dach u. Turm auf gleiche Höhe, – Anbau auf der Nordseite entfernt, – Hauseingang auf Südseite zur Ferndorfstr. hin verlegt, – Ziegelfassade erhielt hellen Verputz , – Giebel auf der Ostseite erhielt oben eine Abflachung, – Für die Verlegung des Hauseinganges spricht, daß an der ehem. Stelle die Ziegelumrandung der Haustür erhalten blieb .
Eine Ansichtspostkarte von ca. 1910 zeigt aber das Haus schon in seiner heutigen Form., von zahlreichen Gebäuden umgeben. Das Gebäude und das Foto müßte dann u.U. schon um die Jahrhundertwende entstanden sein, wo die gesamte Umgebung noch unbebaut war.
Leider ist im Archiv des Siegener Bauamtes in Geisweid die alte Bauakte zur Ferndorfstr. 13 (45) nicht mehr aufzufinden, so daß auch der Erstbesitzer und Bauherr der Villa (noch) unbekannt bleibt. ( vermutlich waren es Personen aus der naheliegenden Fa. Schmidt + Melmer) – Der älteste Sohn des Firmengründers Karl Schmidt – Robert, erbaute eine ähnlich aussehende Villa in unmittelbarer Nachbarschaft in der Ferndorfstr. 32, – Abriß erfolgte ca. 1975 für Erweiterungsbau des FJM-Gymnasiums )
Nach den vorliegenden Erkenntnissen sind aber Zweifel an der Richtigkeit der Annahmen sicher nicht ganz von der Hand zu weisen.
Es ist nur schade, dass Peter Weller damals seine Kamera nicht etwas weiter nach links ausgerichtet hat, denn dann hätte man anhand der dann sichtbaren ehem. Oberen Friedrichstr. ( Weidenauer Str.) die Örtlichkeit heute besser lokalisieren können, aber das war ihm offensichtlich gar nicht wichtig, Hauptsache er hatte die „Architektur im Kasten.“.
Thomas Bartolosch schreibt dazu:
„Das Wohnhaus auf dem Weller-Bild-Nr. 1.02 habe ich inzwischen ebenfalls identifizieren können. Es handelt sich um eines von zwei Krupp’schen Wohnhäuser im Betzdorfer Stadtteil Hohenbetzdorf, und zwar in der Nähe des Schützenplatzes. Das Haus befindet sich an der Martin-Luther-Straße 28 (das andere hat die Nr. 26). Das Haus wurde, anders als das daneben stehende, gut erhaltene Krupp’sche Wohnhaus, im Zweiten Weltkrieg bombengeschädigt und nach dem Krieg in modifizierter Weise wieder aufgebaut, so dass man es kaum wieder erkennt, zumindest nicht auf den ersten Blick hin, vor allem wegen einer veränderten Dachform. Allerdings lassen sich fotografische Beleg finden. Ich füge Ihnen bei ein Foto von heute, in etwa vom gleichen Standort aus aufgenommen , außerdem ein Foto mit beiden Krupp’schen Gebäuden in schlechter Qualität (bei Regen aus dem Auto durch die Windschutzscheibe …): ..
Das nächste Foto zeigt das Gebäude wiederum von der Martin-Luther-Straße aus, allerdings mit anderer Draufsicht: .
Sie sehen das fragliche Gebäude von der Rückfront, leider nur aus einer Perspektive, weil ich sonst das entsprechende Grundstück bzw. den Garten des Hauses hätte betreten müssen, was ich nicht wollte. Man erkennt – zur Orientierung – vorne Teile der Rückfront des anderen, gut erhaltenen Krupp’schen Wohnhauses: .
Peter Weller hat die Rückfront oder -ansicht beider Häuser selbst fotografisch im Bild festgehalten, was mir eine Hilfe zur Identifizierung des einen Hauses war .
Diese Aufnahme ist erschienen in:
Das alte Betzdorf in Lichtbildern von Peter Weller. Im Auftrage der Stadt Betzdorf hrsg. v. Wilhelm Güthling, Betzdorf 1963 (aus Anlass der Verleihung der Stadtrechte an Betzdorf zehn Jahre zuvor).
Das kleine Heft ohne Seitenangaben zeigt zum Foto-Nr. 34 folgende Bildunterschrift: Betzdorf. Kruppsche Häuser in der Martin-Luther-Straße …. . Es gibt eine ganze Reihe von Zeichen, die das Haus als solches erkennen lassen, doch darauf in allen Einzelheiten eingehen zu wollen, würde eindeutig zu weit führen..“
Das erste und das dritte Foto müssten getauscht werden. Jedenfalls zeigt das dritte Foto das Krupp’sche Wohnhaus heute von dem Standort des Fotografen Peter Weller damals.
Nachdem ein privater Mailaustausch mir dazu Anlass gibt, komme ich noch wieder öffentlich auf Alfred Fissmer mit ein paar zusätzlichen Feststellungen zurück.
Die Annahme trat auf, dass die in Berlin in den vormaligen BDC-Beständen (Bundesarchiv Berlin, Best. 3.100 (NSDAP-Zentralkartei) befindlichen Unterlagen noch nicht ausgewertet seien. Das ist unzutreffend, es geschah bereits vor etwa zwei Jahrzehnten. Leider aber sind die Ergebnisse dieser Auswertung, die etwa Eingang in einen Bericht der Westfälischen Rundschau und in mein 2001 erschienenes Buch Siegerland und Wittgenstein im Nationalsozialismus. Personen, Daten, Literatur fanden, immer noch nicht recht in die öffentliche Überlieferung eingegangen.
Vor allem gilt das für Eintrittsgesuch von Fissmer in die Nazi-Partei kurz nach der Machtübergabe. Mit Datum vom 1.5.1933 wurde er unter der Mitgliedsnummer 3.128.057 in die Ortsgruppe Siegen-Altstadt aufgenommen. Das stieß in der Ortsgruppe nicht nur auf Zustimmung, die Meinungen waren gespalten und ein Teil der Ortsgruppe versuchte, die Sache rückgängig zu machen.
Fissmer war zwar – wiewohl bis dahin nach den bis heute geltenden Annahmen parteilos – in den Weimarer Jahren ein entschiedener und gegenüber der sozialdemokratisch geführten preußischen Regierung konfliktbereiter Parteigänger des verfassungsfeindlichen gegnerischen „vaterländischen Lagers“ gewesen, hatte aber in diesem parteiübergreifenden Rechtsbündnis mit DNVP, NSDAP, Kriegervereinen usw. die NSDAP nicht besonders bevorzugt. Darauf kamen Gegner, die er in dieser Partei hatte, zurück und bewirkten, dass mit Datum vom 26.10.1934 seine Mitgliedschaft widerrufen wurde. Die Gauleitung war auf seiner Seite gewesen. Erst 1937 nach Ablauf der 1933 (gegen „Märzgefallene“ gerichteten) vierjährigen Aufnahmesperre konnte auf einen erneuten Antrag hin aufgenommen werden. Neue Parteinummer: Nr. 5.889.595.
Es gab, wie sich denken lässt, auch in der Nazi-Partei Rivalitäten und unterschiedliche Interessen und Einschätzungen. Dass sie keine homogene Größe war, ist ja in der Zeitgeschichtsforschung unbestritten. Das war sie wie überall auch im Siegerland.
Immerhin aber war es Fissmer schon 1933 gelungen, in die Förderorganisation für die SS aufgenommen zu werden. Die Reichsorganisationsleitung gab der „FM-Organisation“, wie sie hieß, „für den Bestand der Schutzstaffel größte Bedeutung“. Sie dürfe in ihrer Arbeit durch keine andere Dienststelle gestört werden (1943).
Das nach dem Ende des Regimes aufgekommene Fissmer-Narrativ stellt seinen Protagonisten als langjährigen und verdienstvollen Amtsträger dar, der irgendwie unpolitisch-konservativ gewesen sei, also der politischen Mitte zuzuordnen, eine honorige lokale Größe, durch Jovialität auch populär („volkstümlich“).
Zeitzeugen mindestens seiner frühen Parteimitgliedschaft, die es gegeben haben müsste, weil es ja in der NS-Altstadtgruppe diesen Konflikt gab, meldeten sich zu keinem Zeitpunkt. Das muss nicht überraschen.
Was dann aber schon etwas überrascht, ist eine sehr viel jüngere Gedächtnislücke. Als 2005 eine viel beachtete Ausstellung „Kriegsende 1945 in Siegen“ im früheren Kaufhof-Gebäude stattfand, zu der ein Ausstellungsbuch („Kriegsende 1945 in Siegen. Dokumentation der Ausstellung“) erschien, fehlten sowohl in der Ausstellung als auch in dem Begleitbuch im Fissmer-Kapitel der frühe Eintritt in die NSDAP wie auch die SS-Fördermitgliedschaft.
Ich gehe davon aus, dass das Team, das Ausstellung und Buch verantwortete, seriös und gründlich in Archiven und Literatur recherchierte. Das heißt, dass es m. E. ist auszuschließen ist, dass die beiden hier in Rede stehenden Sachverhalte in diesem Kreis unbekannt waren, dass sie vielmehr bewusst verschwiegen wurden. Man könnte auch sagen, ersetzt wurden, nämlich durch einen angeblichen „ersten Machtkampf“ 1933 von Fissmer gegen die NSDAP. Den dieser gewonnen habe. Ob bzw. wie der einen politischen Inhalt gehabt haben könnte, dazu nichts. Unter den gegebenen Bedingungen. Von einem zweiten oder weiteren Machtkämpfen ist dann nicht weiter die Rede.
Fissmer sei „zeitweise“ NS-„skeptisch“ gewesen. Belege selbst zu einem solchen absoluten Minimum an Distanz fehlen. Gesichert lässt sich sagen, dass von Fissmer durch die Jahrzehnte (Weimar/NS-Regime/BRD) kein abwertendes Wort zur NSDAP, ihrer Politik und ihrer Anhängerschaft überliefert ist.
Mit anderen Worten, es wurde 2005 einmal mehr am Überleben jenes entlastenden Narrativs gebosselt, das m. E. exemplarisch für Gang und Form der „Bewältigung“ der Nazizeit steht und das in der „großen“ Historiografie inzwischen kräftig unter Druck geraten war.
Ich nutze die Gelegenheit auf einen von Fissmers Zeitgenossen, ebenfalls eine zeitgeschichtlich interessante Figur, zu verweisen, der dem freundlichen Fissmer-Narrativ viel Unterstützung zukommen ließ und bis heute von Fissmer-Unterstützern dafür in Anspruch genommen wird, den damaligen SPD-Regierungspräsidenten Carl Friedrich Fries, einen klassischen „Wanderer zwischen den Welten“(http://widerspruchundwiderstandimnsinsiwi.blogsport.de/verzeichnis/biografische-skizzen/#fries1, http://akteureundtaeterimnsinsiegenundwittgenstein.blogsport.de/a-bis-z/gesamtverzeichnis/#fries3).
Fissmer hatte seine Position ja selbst und sicherlich ohne Erklärungsnot auf den Punkt gebracht. Wörtlich bei der Feststunde anläßlich des 25. Dienstjubiläums als Bürgermeister im August 1944: „Ich bin ein getreuer Gefolgsmann des Führers“ (Mitschrift der Ansprache in seiner Personalakte, Stadtarchiv Siegen, D 525; veröffentlicht in Nationalzeitung 18.8.44). Aber sogar solche eindeutigen Bekundungen lassen sich natürlich, wenn es gewollt wird, schönreden und ins Gegenteil verkehren. Etwa so: „Im Herzen war er ein glühender NS-Gegner, mußte aber nach dem 20. Juli Loyalität heucheln, um von sich abzulenken und weiter im Geheimen das gehasste Regime bekämpfen zu können.“ Blödsinn, aber wie alle Verschwörungstheorien nicht zu widerlegen. Es ist nun mal so: Die Herren Fissmer, Flick usw. haben nach wie vor ihre treuen Fangemeinden, die sich in ihrer Anhänglichkeit durch Fakten und Argumente nicht beeindrucken lassen. C’est la vie (leider).
Zu Fritz Fries kann auf eine interessante Akte im Nachlass Bruno Jenners verwiesen werden (RWN 0110, Landesarchiv NRW/Abt. Rheinland), die neben Dokumenten zum „Disziplinarverfahren gegen den Regierungspräsidenten von Arnsberg, Fritz Fries“ auch solche zu seinem – milde ausgedrückt – etwas seltsamen Verhältnis zur Siegener Gestapo enthält.
Beratung der SPD Neunkirchen/Siegerland durch das Archiv der sozialen Demokratie wäre hier sicherlich angeraten. Andere Frage: Warum das Ganze nicht in Zusammenarbeit mit dem Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein planen und dort magazinieren und darüber sowohl Fachlichkeit als auch Benutzbarkeit gewährleisten? Die Ehrenamtler, Praktikanten und Studierenden, von denen die Rede ist, könnten dann die nötigen archivfachlichen Arbeiten unter Anleitung erledigen. So wäre allen Seiten bestens gedient.
Ich saß in Duisburg im Landesarchiv und las dort die Mitteilung von Peter Kunzmann, so dass Gelegenheit war, die Akte gleich mal kommen zu lassen (Danke für den Hinweis!).
Es handelt sich dabei um einen von zwei nicht so umfangreichen Bänden eines kleinen Nachlasses von Hans Bruno Jenner, 1945-46 Stellvertreter von Fries in Arnsberg (Regierungsvizepräsident), ab 1946 bis 1949 Ministerialdirektor im Innenministerium in Düsseldorf. Er hatte damals eine Akte „Fall Fries“ angelegt. Leider fehlen, wie sich zeigte, einige Seiten.
Fries stand mindestens seit Juni 1946 stark unter Druck. Gerüchte liefen im Siegerland um. Er war von anderen Sozialdemokraten beschuldigt worden, mit „Stimmungsberichten“ der Gestapo zugearbeitet zu haben. Dafür sei er mit Zigaretten und Fleisch- und Buttermarken entgolten worden. Mit dem für ihn zuständigen Gestapo-Beamten Bültmann habe er Geschenke ausgetauscht. Ausweislich seines Parteiabzeichens am Revers, das die Sprecher häufiger bzw. „täglich“ gesehen hätten, gingen sie von einer Mitgliedschaft von Fries in der NSDAP aus. Davon habe er auch geschäftlich Vorteile gehabt. Es gab weitere Hinweise und einige pikante Angaben, auf die ich nicht eingehen muss.
An Fries’ Seite jedenfalls stand Alfred Fissmer, der ihn mit einer umfangreichen Stellungnahme entlastete. Dabei bekundete Fissmer auch, „bei mir wurden alle Neuigkeiten [aus der regionalen NSDAP] abgeladen, genau wie alle Zwistigkeiten unter den Parteimitgliedern“.
Diese Selbstbeschreibung Fissmers vom August 1946 sollte eigentlich vollständig genügen zu beschreiben, wie man in seiner Partei das städtische Oberhaupt sah. Zu einem Partei-„Skeptiker“ wären diese Gesprächspartner kaum mit ihren Neuigkeiten und Zwistigkeiten gekommen.
Es sei denn ein Betrachter geht davon aus, dass die Nazis in ihrer Partei irgendwie und eigentlich nur eine Minderheit darstellten. Genau das aber ist der Inhalt jenes Entlastungsnarrativs, das nach kurzem Schreck seit der zweiten Hälfte der 1940er Jahre aufkam und bis heute entgegen allem besseren Wissen/aufgrund besseren Wissens schweigend gepflegt werden kann. Diese Vorstellungswelt ist es, die in dem gelegentlichn Wort vom „Fliegenschiss“ Ausdruck findet.
Als Arbeitsort u.a. auch für ein solches SIWI-Archiv wäre m.E. das derzeit dem Verfall preisgegebene, unter Denkmalschutz gestellte sog. „Hüttenmeisterhaus“ in Lohe-Kredenbach gut geeignet. Eine solche gemeinwohlorientierte Verwendung des 300 Jahre alten Fachwerkgebäudes (ehem .Arbeiter-Gemeinschaftshaus der ehem Loher Hütte) , könnte dann auch als Anlaß genommen werden, den bisher uneinsichtigen Privatbesitzer des Siegerländer Kulturerbes einem Enteignungsverfahren durch die Kommune Kreuztal und evtl. auch dem Land NRW zu unterziehen.
In der heutigen Print-Ausgabe der Westfälischen Rundschau findet sich im Bericht über Parteitag folgendes zur Errichtung des regionalen SPD-Archivs: “ …. Unter anderem nimmt die Versammlung einen Antrag des Gemeindeverbandes Neunblirchen an, zeitnah ein Archiv der SPD in Siegen-Wittgenstein anzulegen, imn dem zentral wichtige Dokumente gesammelt werden sollen.
Sie wisse selbst sehr genau, wie schwierig es sein könne, über Personen und Aktionen zu recherchieren, untersützt Traute Fries das Vorhaben und erinnert daran, dass sich der Verein „Geschichte der Arbeiterbewegung“ im Juni aufgelöst habe. Umso wichtiger sei die Einrichtungeiner solchen Sammelstelle ….“ Der Beschluss erfolgte laut Siegener Zeitung von Heute (Print) einstimmig.
Literatur zu Ludwig Heupel:
Das Wandgemälde von Ludwig Heupel im Sitzungssaal des Rathauses in Siegener Ztg. Jg 94, Nr 300 v. 22.12.1916.
Professor Ludwig Heupel-Siegen zum 60. Geburtstag in Siegener Ztg. Jg 102, Nr 142 v. 19.6.1924
Die wechselvolle Geschichte eines Bildes. Wie Ludwig Heupels „Eisenhammer“ in d. Siegener Rathaussaal kam in Siegener Ztg. Jg 115, Nr 142 v. 22.6.1937
Professor Ludwig Heupel, Siegen. Zum 75. Geburtstag d. Künstlers in Siegener Ztg. Jg 117, Nr 140 v. 19.6.1939.
Akademieprofessor Ludwig Heupel-Siegen 80 Jahre alt in Siegener Ztg. Jg 122, Nr 142 v. 20.6.1944
Ludwig Heupel-Siegen in Siegerland. Bd 30, 1953, S. 63-73.
Eine stetige Quelle des Glücksempfindens. Vor 100 Jahren wurde d. Maler Ludwig Heupel-Siegen geboren in Unser Heimatland. Jg 32, 1964, S. 90/91
Ludwig Heupel-Siegen 1864-1945. Ausstellung z. 100. Wiederkehr seines Geburtstages im Museum zu Siegen in Siegerland Bd 41, 1964, S. 31/32
„Malen galt dem Siegerländer als Spielerei“. Der berühmte Siegener Maler Ludwig Heupel wurde in der Höhstr. 17 geboren – in: Unser Heimatland. Jg 34, 1966, S. 77/78.
ja ,da kann ich mich noch erinnern , ausserdem wurde auch mal ein golfplatz in volkholz geplant ,es wurden viele sachen angeschoben aber nie verwirklicht.
Leserbrief zu den Einschätzungen von Kreisarchivar Thomas Wolf über das Jahr 1968 und die „68er“ Protestbewegung in
Siegen:“1968: Eine Chance, etwas zu ändern‘‘ in der WP/WR vom 11. Oktober:
Das ist eine erstaunliche Einschätzung, die Kreisarchivar Thomas Wolf über die Verhältnisse von 1968 in Siegen verbreitet hat. Siegen und eine ‘‘68er‘‘-Protestbewegung, von der man sich fragen muss: wo war diese vor 50 Jahren auszumachen? Wo gab es Szenen, die beim NPD-Landesparteitag am 16. November 1968 an „die große Protestkultur“ erinnerten? Wodurch kam diese von Wolf so bezeichnete „große Protestkultur“ zum Ausdruck? Dass eine überschaubare Zahl von Demonstranten Parteitagsdelegierte und den NPD-Vorsitzenden Adolf von Thadden am Zugang zur Siegerlandhalle behinderte und es dabei an den Absperrungen zu Rangeleien und Polizeieinsätzen kam?
Was hatte der vom Kreisarchivar bemühte „68er-Geist“ mit dem NPD-Landesparteitag zu tun? Was überhaupt mit dem „Tanz für die Jugend“? Wo kam das Siegerland „in einer Breite in Bewegung“, bei der „vielleicht nicht die große Revolution stattgefunden“ hat? Was war denn dann? Protest am Mädchen-Lyzeum um die Ablösung einer autoritären Schulleiterin, als sei das ein bundesweit bedeutsames Ereignis? Sollen mit solchen Vergleichen Ereignisse in einer Region historisch aufgewertet werden? In der Auseinandersetzung mit den ‘‘68ern‘‘ hat Jürgen Habermas die studentischen Proteste, ihre Ziele und Aktionen, die mancherorts in Schülerkreise hineinreichten, seinerzeit als „Scheinrevolution und ihre Kinder“ bezeichnet. In Siegen war das, was ‘‘68er“-Protest genannt werden könnte, selbst zu Zeiten der APO-Proteste gegen die Bonner Notstandsgesetze, im Mai ’68, nicht mal als ‚laues‘ Protest-Lüftchen auszumachen.
Bei der Europäischen Bewegung, deren Sprecher ich damals war, hatte bereits im Vorfeld des Parteitages nicht nur der Parteien- und Wahlforscher Hans-Dieter Klingemann die Ursachen für das Aufkommen der NPD thematisiert, die von 1966 bis 1968 in sieben Landtage eingezogen war. Von dem Sozialforscher wurde dies vor allem der ersten wirtschaftlichen Rezession der Nachkriegszeit zugeschrieben, auch der Großen Koalition, von 1966-1969, einer Konstellation, die die politischen Einstellungen beeinflusste. Interessiert hat sich für diese Bestimmungsgründe und wie damit umgegangen werden kann, bei den Protesten gegen den NPD-Parteitag kaum jemand vor Ort. Und: Der mit Antisemitismus gepaarte Rechtsextremismus war bei den ’68ern‘ kein bestimmendes Thema, eher ein „blinder Flecken“, wie es der Politologe Wolfgang Kraushaar, ein Kenner der 68er-Verhältnisse, in einer Beschreibung über die ’68er‘-Protestbewegung und die APO benannt hat.
Karl-Jürgen Reusch
Siegen/14. Nov. 2018
Anmerkung: Der Leserbrief musste wegen einer maximal möglichen Zeilen-Vorgabe in Lokalausgaben der Zeitungstitel Westfalenpost/Westfälische Rundschau gekürzt werden. Daher blieb im Leserbrief der Satz unberücksichtigt: „Zur Auseinandersetzung mit dem NPD-Landesparteitag gehörte auch die gewerkschaftliche Protest-Kundgebung auf dem Weidenauer Bismarckplatz mit IG-Metall-Vize Eugen Loderer, der sich mit markigen Sprüchen gegen die NPD verbreitete.“ Die DGB-Kundgebung gegen den NPD-Parteitag stand nicht in einem unmittelbaren und organisatorischen Zusammenhang mit „68er“-Protestaktionen. KJR
Es ist schon schlimm, wenn die SPD in Siegen-Wittgenstein einstimmig Beschlüsse fasst,von deren Umsetzung sie keine realistische Vorstellung hat.
Eine archivfachliche Beratung durch die Friedrich-Ebert-Stiftung (AdsD)
wäre wohl nötig. Alternativ käme das Kreisarchiv SI dafür in Betracht.
Wenn es ein Gemeindearchiv Neunkirchen gäbe, wäre dies der
natürliche Ansprechpartner.
Das Stadtarchiv Siegen hat bereits in den 1990er Jahren allen ‚großen‘ in der Stadt vertretenen Parteien das Angebot gemacht, Parteiarchive auf Depositalvertragsbasis einzurichten. Die Reaktion war gleich null, nämlich keine Antwort. Einziger mündlicher Kommentar eines Kommunalpolitikers (sinngemäß): „Wir lassen uns doch nicht in einem öffentlichen Archiv in die Karten schauen!“ Da ist der Tellerrand noch in ziemlicher Entfernung.
In der heutigen Print-Ausgabe der Siegener Zeitung erschien ein Leserbrief, der Hindenburg nicht als Steigbügelhalters Hitlers, sondern als dessen „beharrlichen Widersacher“ anspricht – Ergebnis einer Analyse des Verhaltens Hindenburgs zwischen Frühjahr 1932 und Frühjahr 1933.
In der heutigen Ausgabe der Siegener Zeitung findet sich ein Artikel zur Diskussion im Hilchenbacher Hauptausschuss über die Umbenennung der Hindenburgstraße. Wolfgang Ruth, einer der Antragssteller zur Umbennunng, äußert sein Unverständnis über die Entscheidung in einem Leserbrief in der heutigen Westfälischen Rundschau.
mit Interesse habe ich Ihre Artikel über die SiegerLänder Industrie im Netz gefunden. Speziell geht’s um die Siegener aktiengesellschaft sag in geisweid. Mein Großvater Karl Weber war dort viele Jahre in leitender Funktion beschäftigt. Für meine Ahnenforschung suche ich nachweiterem Material. Ich habe die Hoffnung, dass Sie mir über den beruflichen Werdegang meines Opas etwas Archivmaterial zukommen lassen könnten
Mit freundlichen Grüßen
Ralf Weber
Ich möchte diesen Kommentar nur zum Thema Mädchenrevolte kommentieren. Sie sagen: „Protest am Mädchen-Lyzeum um die Ablösung einer autoritären Schulleiterin, als sei das ein bundesweit bedeutsames Ereignis?“ und werten damit ein nicht nur für hunderte von Schülerinnen des Mädchengymnasiums (sic!) höchst wichtiges Ereignis ab, an dem sich rund 80 Prozent der Schülerinnen aktiv beteiligt haben, sondern Sie unterschätzen auch die Bedeutung dieses Streiks für die Entwicklung im Land. Die Ereignisse wurden bundesweit wahrgenommen, auch wenn die Lesart der damaligen Zeit diese war: Mädchen sind an sich unpolitisch und haben eigentlich keine wichtigen Themen, also werden die bösen Jungs sie wohl dazu verführt haben. Erstaunlich, dass Sie heute noch in diese Kerbe hauen! Eine autoritäre Direktorin abzulösen ist ein Meisterstück. Der Streik war eine vorbildliche Lektion in Sachen Demokratie, weil wir uns erstmals zusammengeschlossen und klar ausgedrückt haben, dann konsequent handelten. Wo sonst hat es das gegeben? Ich durfte vor zwei Jahren mit etlichen Zeitzeuginnen darüber sprechen. Wir alle zehren heute noch von dieser bundesweit einzigartigen Aktion.
Das frei online zugängliche erste Kapitel ist die Antrittsvorlesung von C.K. an der FH Potsdam. Nach der Lektüre kann ich es nicht erwarten, beim Buchhändler endlich mein persönliches Exemplar zu erhalten, um weiterlesen zu können.
Das Buch „Siegerländer Kultur, Wirtschaft, Gemeinwesen – Eine Chronik“ steht schon seit Jahren in meinem Bücherschrank. Der Zusammenhang mit dem Goldenen Buch des Kreises ist mir aber erst jetzt durch diesen Artikel in siwiarchiv bewusst geworden.
Wer das afas unterstützen möchte: Das afas bittet auf seiner Homepage – s. Eintrag – um Schreiben an die Fraktionsvorsitzenden im Landtag, die sich für den Erhalt aussprechen.
Nachdem die Siegener Zeitung den Leserbrief Wolfgang Ruth von Ende November (s.o.) veröffentlicht hatte, sind in der heutigen Print-Ausgabe der Siegener Zeitung 2 Leserbriefe zum Thema erschienen: “ ´Mythos´verwundert“ – eher Hindenburg-kritisch, und „Gescheitert“, die Beibehaltung des Straßennamens befürwortend …….
Weitere Reaktionen zur Situation des afas in Duisburg:
1) Das Uniarchiv Köln weist auf seiner Homepage auf die Problematik hin: https://www.portal.uni-koeln.de/aktuelles.html
2) Das Blog „Global Notes“ der des amerikanischen Archivverbandes SAA nennt die Notlage der Duisburger Kolleginnen zur Kenntnis: https://iaartsaa.wordpress.com/2018/12/09/weekly-news-roundup-december-8-2018/
3) Das Duisburger Blog „Amore e rabbia“ berichtet ebenfalls: http://helmut-loeven.de/2018/12/afas-meldet-gefahr-im-verzug/
4) Der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU e. V.) rief alle auf, sich für den Erhalt des archiv für alternatives schrifttum (afas e. V.) einzusetzen: http://www.infopartisan.net/BBU%20PM%20PDF%2009.12.2018%20afas%20mit%20Foto.pdf.
5) Die NRZ berichtet heute online zur Schließung: “ …. Die CDU-Fraktion erklärte indes auf Nachfrage der Redaktion, es solle am heutigen Dienstagvormittag fraktionsintern noch einmal über den Änderungsantrag beraten werden. Zu 90 Prozent könne davon ausgegangen werden, dass der Antrag zurückgenommen werde. Demnach besteht Hoffnung für das Afas. In der dritten und letzten Lesung am Mittwoch, 12. Dezember, werde der Landeshaushalt für 2019 dann endgültig in Düsseldorf beschlossen. …. Eine Sprecherin der FDP-Fraktion formulierte die Begründung für die Streichung der Gelder wie folgt: „Aus einem wirtschaftlichen Umgang heraus wollen wir die archivierungswürdigen Inhalte des Afas ins Landesarchiv umsiedeln.“ ….“
Patrick Bahners: „Spardiktat – nein danke! Das Duisburger Archiv des Protestes ist bedroht.“, FAZ, Feuilleton, 11.12.2018: “ …. Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft hatte im Haushaltsplan für 2019 für das AFAS 220 000 Euro vorgesehen. Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen kann sich zugutehalten, dass der Kulturetat von 46,7 auf 49,3 Millionen Euro steigt. Im Kulturausschuss blieb der Etatansatz unangetastet. Erst im Haushaltsausschuss schlugen Abgeordnete der Regierungsfraktionen CDU und FDP vor, die Unterstützung des AFAS zu beenden. Im Paket mit Änderungen anderer Ressortetats wurde der Antrag angenommen, mit den Stimmen der Opposition. …..“
CDU-FDP Antrag zur Finanzierung des afas im kommenden Jahr liegt vor – aus der Begründung: „Die Förderung des Landes für das Archiv für alternatives Schrifttum soll auch im kommenden Jahr letztmalig fortgeführt werden. Das Archiv wird damit in die Lage versetzt, die Planungen der kommenden Jahre so anzupassen, dass der Wegfall der freiwilligen Förderung des Landes kompensiert werden kann. Zusätzlich wird das federführende Ministerium damit beauftragt, ein Konzept zur Verlagerung von landeshistorisch bedeutsamen Archivgütern in beispielsweise das Landesarchiv NRW zu erarbeiten und dem Fördermittelempfänger die Verlagerung der Archivgüter anzubieten.“
Link: https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-4548.pdf
Nachtrag (18.12.2018):
“ …. Die Landesregierung will die Zuschüsse für ein besonderes Archiv in Duisburg nun wenigstens vorerst weiter zahlen. Das wurde am Mittwoch (12.12.2018) im Landtag beschlossen. Zuvor hatte es gegen Streichungspläne seitens des Landes zahlreiche Proteste gegeben. …. Weil es so etwas sonst nirgends gibt, schrieb sogar der Verband deutscher Archivare einen offenen Brief. Die Duisburger Einrichtung sei unverzichtbar. Wer die Gelder streiche, nehme seine Vernichtung in Kauf.
Der Protest hat allerdings nur einen Aufschub gebracht. „Die Förderung des Landes für das Archiv für alternatives Schrifttum soll auch im kommenden Jahr letztmalig fortgeführt werden“, heißt es in dem am Mittwoch beschlossenen Antrag von CDU und FDP. …..“
Quelle: WDR, NAchrichten Rheinland, 12.12.18
In einem Nachlass tauchte vor einigen Wochen eine handschriftliche Mitgliederliste des Kyffhäuserbundes Siegen auf. Die Liste umfasst die Jahre 1958,1959 und 1960. Sie enthält Namen und Vornamen der Mitglieder, Geburtsdatum und Adresse, das Eintrittsjahr in den Bund und ob das Mitglied eine Ehrung für langjährige Mitgliedschaft erhalten hat.
Die Liste ist alphabetisch geordnet. In dieser Liste ist auch Alfred Fissmer aufgeführt. Eintrittsjahr 1920, geehrt für 25jährige Mitgliedschaft.
Am 14.12.2018 erschienen zwei weitere Leserbriefe zum Thema: „Immense Schuld“ bezog sich auf den Leserbrief „Beharrlicher Widersacher“ vom 21.11.2018 und betont Hindenburgs Beteiligung an der „Dolchstoßlegende“; „Mensch seiner Zeit“ weist auf die Verdienste (?) Hindenburgs hin – “ … allem die Ostpreußen, waren ihm damals dankbar, dass er 1914 Ostpreußen vor der russischen Dampfwalze bewahrt hatte. ……“ – und weist – wie der Leserbrief „Gescheitert“ v. 10.12.2018 – auf ebenfalls andere Straßenbenennungen (Theodor Heuss, Konrad Adenauer, Thomas Dehler) hin, die ebenfalls zu kritisch zu sehen seien.
Warum werden in dem Zusammenhang immer wieder diejenigen Waldgenossen als angebliche Pfleger des Kulturerbes hervorgehoben, die den Wald zum Selbstbedienungsladen für billigen Brennstoff degradieren? Sofern keinen Sachzwängen (wie sie in verflossenen Jahrhunderten bestanden) Vorrang gewährt werden muss, ist eine für so mannigfache konstruktive Zwecke verwendbare Ressource wie das Holz zu kostbar, um sie einfach in Flammen aufgehen zu lassen – bloß damit ein paar durch ererbten Grundbesitz privilegierte Genossen sich am Luxus offener Kamine ergötzen können. Wälder zu verbrennen ist in der heutigen Zeit eine Form von Verschwendung und Raubbau, die weder etwas mit dem Konzept der historischen Haubergswirtschaft zu tun hat noch mit ökologischer Verantwortung oder dem, wofür gewöhnlich der irrlichternde Begriff „Nachhaltigkeit“ steht. Gegen kurzsichtigen Egoismus ist kein Kraut gewachsen; er ist nun einmal menschlich – die Gesellschaft muss dafür aber nicht auch noch Lob aussprechen oder solche Gesinnung gar zum lebenden Kulturerbe stilisieren. Das führt zu Geschichtsfälschung. Die traditionelle Haubergswirtschaft diente nicht vorrangig der Brennholzversorgung privater Haushalte, sondern der Ressourcensicherung für die regionalen Gewerbe und somit dem Gemeinwohl.
Entschuldigung, wenn Ihnen den Eintrag nicht gefällt. Aber ich fand, dass das Bild sehr gut zu diesem amerikanischen Weihnachtsklassiker passt. Ein deutsches Lied ist mir leider nicht eingefallen. Falls es Sie tröstet, der Baum stand im Siegerland und auch die Sängerin lebt seit geraumer im Siegerland.
Looking for records for Leopold Louis Linnemann and his sister Hermine and brothers August and Ernst. They immigrated to the U.S. via New Orleans in the late 1860’s. Would like to find out if the place where they were born or lived is still standing.
Perhaps meant: Leopold Louis Linnemann, born 1843 in Herford (at the edge of Westphalia quite opposite to Wittgenstein). Source: http://www.ancestry.com.
Many families from the so-called „Ravensberg area“, including the Linnemanns from Gohfeld (near Herford), took part in emigration and seem to have settled in Missouri (St. Louis County). See Michael Rosenkötter, From Westphalia into the World, Beckum 2nd ed. 2003 (Linnemann mentioned p. 71).
Further reading: http://www.european-migration.de/euromig/hf/migrat/emigrat/brause50.htm.
I recommend to contact the „Arbeitsgemeinschaft für Genealogie im Historischen Verein für die Grafschaft Ravensberg“, via http://www.hv-ravensberg.de/ag-genealogie.html
Es heißt in der Ankündigung, das Verfahren 1987-1991 in Siegen, sei „das einzige Verfahren vor einem deutschen Strafgericht“ gewesen, „das die Verfolgung und Vernichtung von Sinti und Roma durch das Naziregime“ behandelt habe.
Das ist unzutreffend. Um die Sache gründlich anzugehen:
Zu berücksichtigen wäre
● erstens, dass es zum einen alliierte Verfahren mit alliiertem Personal (Nürnberger Prozesse plus Nachfolgeprozesse) und zum anderen mit deutschem Personal in den verschiedenen Zonen (Spruchgerichtsverfahren) gab, was hier unbeachtet bleiben soll, und
● zweitens dass es zwei sehr unterschiedlich gebaute deutsche Staaten gab mit deutlich unterschiedlichem Umgang mit NS-Straftätern. In den deutschen NS-Prozessen (West) gab es insgesamt etwas mehr als 6.500 rechtskräftige Urteile und in den deutschen NS-Prozessen (Ost) 12.890 Urteile (bei sehr viel geringerer Bevölkerungszahl und geringerer Nazi-Dichte, erst recht aber geringerer Nazijuristen-Dichte pro Flächeneinheit).
Was nun Verfolgung und Vernichtung der europäischen Roma-Minderheit angeht, stand jedoch hier wie dort nur eine minimale Zahl von Angeklagten vor Gericht. In der BRD gab es zwei deutsche Verfahren, die beide mit einer Verurteilung endeten, und in der DDR, wenn ich die Literaturangaben richtig entschlüsselte, sechs deutsche Verfahren.
Offenbar wird in jedem Fall, dass es hier eine gewisse Gemeinsamkeit in diesen beiden Staaten gab. Der niederländische Fachwissenschaftler und Strafrechtler Christiaan F. Rüter erklärt sie als in der gesamtdeutschen Bevölkerung vorhandene „mangelnde Affinität zu den Opfern“. Anders als jüdische NS-Verfolgte oder politisch Verfolgte hatten Roma hier wie dort ein zeitlich durchlaufendes Exklusionsproblem.
Beide BRD-Prozesse fanden vor dem Landgericht in Siegen statt (nicht mitgezählt: ein Revisionsverfahren in Köln). Sie endeten beide mit Verurteilungen.
Über das zweite Verfahren wird Herr Mehrer berichten. Hier ein paar Worte zu dem ersten, das nun inzwischen vollständig dem Vergessen anheimzufallen droht, obwohl es umfangreich aufgearbeitet werden konnte, einiges dazu erschien und vorgetragen wurde.
Er ereignete sich 1948/49 (Revision 1950) und steht für die für die BRD so typische Schlussstrich-Mentalität dieser Jahre (wie der anschließenden Jahrzehnte). Es ging um die Deportation von 134 Berleburger Sinti-Nachfahren, mehrheitlich Kinder, nach Auschwitz-Birkenau, von denen acht der Deportierten überlebten.
Es müsse doch jetzt endlich einmal, forderte damals in der lokalen Prozessdiskussion das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Berleburg, „ein Schlussstrich unter die Vergangenheit gemacht“ werden. Eine Wittgensteiner Bürgerbewegung mit Ausläufern ins nördliche Siegerland forderte unterschiedslos Haftentlassung und Freispruch.
Diese Haltung teilte im Grunde auch das Gericht, denn in einem der Beschlüsse zur Amnestierung von Angeklagten hieß es – sprachlich schludrig, in der Sache aber klar – zu berücksichtigen sei, dass das gerade verabschiedete Straffreiheitsgesetz („Weihnachtsamnestie“) „hinter Jahre der Not, Sittenverwilderung und Rechtsverwirrung einen Schlussstein [so!] setzen wollte.“ Das sei ja die „staatspolitische Zielsetzung“. Sie „nötige“ dazu, das Straffreiheitsgesetz so auszulegen, dass „nicht die außergewöhnlichen Maßnahmen einer großzügigen Befriedigung [so!] und Versöhnung“ verwischt würden.
Wie bei den meisten regionalen NS-Prozessen war es nur durch Aktivitäten aus der Opfergruppe seit der Jahreswende 1945/46 (Anzeige jährt sich in diesen Tagen) überhaupt zu einem Prozess gekommen und nach ursprünglich 28 Tatverdächtigen blieben davon ganze sieben, von denen dann sechs verurteilt wurden. Die Strafen lagen mit einer Ausnahme zwischen sechs Monaten und anderthalb Jahren, also am unteren Rand des Strafrahmens. Drei Täter mussten die Strafe dank Amnestie erst gar nicht antreten, zwei Verbliebene sie nicht voll abbüßen (siehe oben, Amnestiebeschlüsse/Straffreiheitsgesetz u. a.). Die große Ausnahme war mit vier Jahren Haft der vormalige Landrat Otto Marloh als Haupttäter. Über etwas Untersuchungshaft hinaus saß aber auch er keinen Tag, da „krank“ und angeblich nicht haftfähig. Seine Gerichtskosten übernahm, nein, nicht die Kirche, sondern die Armenkasse. Marloh war ein in der Wolle gefärbter Obernazi. 1919 hatte er 29 Angehörige der republikanischen Volksmarinedivision erschießen lassen, als Geiseln. Und als das Naziregime in den letzten Zügen lag, noch den Befehl zu Erschießung eines US-Piloten gegeben. Die Tat von 1919 wurde reichsweit durch einen Prozess bekannt, der in allen Zeitungen gestanden hatte und mit einem Freispruch für Marloh endete. Einer der Beobachter im Gericht war Kurt Tucholsky gewesen. Über den Mordbefehl von 1945 konnte man sich die Region anhand der regionalen Presse informieren. Für den Täter ergab sich aus diesem allgemeinen Wissen nichts.
Urteil und Vollstreckung waren eine Absage der Strafverfolger an die Strafzwecke Schuldausgleich, Sühne und Vergeltung für begangenes Unrecht und damit typisch für die regionalen NS-Verfahren insgesamt.
Das erste der beiden Strafverfahren ist m. E. auch aufgrund dieser Kontexte schon eine Erinnerung wert.
Es ist dieses Verfahren, das m. W. tatsächlich auch einzigartig war, nämlich insofern es das einzige westdeutsche Verfahren war, in dem Täter vor Gericht standen und verurteilt wurden, weil sie lokal Betreiber einer Deportation nach Auschwitz waren.
Die Übernahme und Archivierung der Mindener Schulakten ist vorbildlich und deshalb sollte die Masterarbeit von Vinzenz Lübben im Kreis der Kommunalarchive eine breite Verbreitung finden. Es ist leider in velen Kommunen noch so, dass die Schulen ihre Überlieferung den Kommunalarchiven nicht anbieten und die Zehnjahrespflicht der Finanzbehörden mit der eigenen Aufbewahrungspflicht verwechseln.
Die vergleichende Studie des Berliner Historikers Joachim Petzold „In Deiner Brust sind Deines Schicksals Sterne? Mindener Gymnasiasten und Dresdner Oberschüler im ersten Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkrieg“, Potsdam 1998, hätte ohne die bemerkenswerte Überlieferung im Kommunalarchiv Minden-Lübbecke nicht geschrieben werden können. Die Wilhelm-Fraenger-Gesellschaft, deren Tochtergesellschaft gGFFDmbH Potsdam diese Studie in ihrer Schriftenreihe als Band 5 veröffentlichte, hat deshalb auch gerne den Druck der Arbeit von Vinzenz Lübben finanziell unterstützt. http://www.fraenger.net
Ich unterstütze die Petition ausdrücklich. Als ehemaliger Sowi-Lehrer weiß ich, dass nicht wirtschaftliches, sondern historisch-politisches Wissen bei vielen Schülern fehlt.
Auf der Suche nach Banfields Grabstätte in Bukarest konnte ich folgende Informationen erhalten (Ein Dank an Vlad Nastase von der Evangelischen Gemeinde Bukarest): Banfields Grab ist nicht mehr erhalten, da der alte evangelische Friedhof „am Ende des 19.Jahrhunderts“ aufgegeben werden musste. Alle Gebeine wurden in ein Massengrab auf dem neuen Friedhof überführt. Am 20. April 1912 hat der Neubestattungsgottesdienst stattgefunden. Allerdings hat sich der Eintrag Banfields im Sterbebuch der Gemeinde erhalten: Für den 12./24. November 1855 ist dort die Beisetzung vermerkt: „Ein englischer Obrist Namens Panfield“. Herr Wolf kann evt. den Scan hier hochladen.
Dazu auf kurzem Weg die hochakademische Information, dass es schon seit dem 1. Juli 1958 in – wie es heißt – „Deutschland“ – ein „Gleichberechtigungsgesetz“ gab und schon „zum 1. Juli 1977 eine umfassende Reform des Ehe- und Familienrechts vorgenommen (wird). In § 1356 steht unter Anderem: ‚Beide Ehegatten sind berechtigt, erwerbstätig zu sein.’ Folglich: „In Deutschland dürfen [nun] Ehefrauen eine Berufstätigkeit aufnehmen, ohne den Ehemann um Erlaubnis zu fragen“. (www.geschkult.fu-berlin.de)
Gut, „Deutschland“ ist die BRD, kann man sich ja denken. Und sonst?
Die DDR führte die Gleichberechtigung 1949 mit ihrer Gründung ein und gab ihr Verfassungsrang. Da hatte es sich mit der Nachfrage beim Ehemann. Wäre sie besser erst gar nicht gegründet worden, sondern „die Zone“ schon gleich der westlichen Wertegemeinschaft zugeführt worden, hätte es sich noch ein bisschen gezogen, für die Frauen, und die Männer hätten dazu etwas länger lachen können. ;-) Tscha.
Am 19. Januar 2019 erschien in der Print-Ausgabe der Siegener Zeitung der umfangreicher Bericht „Er nannte sich Éngel von Auschwitz´. Oberstaatsanwalt i. R. Klemens Mehrer referierte im Siegener Forum über den Prozess gegen den SS-Rottenführer Ernst-August König.“ über die Veranstaltung.
Die zentrale archivische Überlieferung zu diesem Prozess ist im Landesarchiv NRW zu erwarten:
1) In der Abteilung Rheinland in Duisburg befindet sich die Überlieferung (Ermittlungsakten) der zuständigen Staatsanwaltschaft Köln – Zentralstelle für NS-Massenverbrechen Gerichte (Rep. 0118, Rep. 0158, Rep. 0267, Rep. 0434).
2) In der Abteilung Westfalen in Münster befindet sich die Überlieferung des Landgerichtes Siegen (Signatur Q 352), dort sind die Prozessakten zu erwarten.
In den Beständen des Berliner Bundesarchivs befindet sich im Bestand „Generalstaatsanwalt der DDR“ (DP 3) unter der Nr. 2251 ein einschlägiger Aktenband aus dem Jahr 1985, der sich u. a. mit deutsch-deutscher Rechtshilfe für das Ermittlungsverfahren gegen Ernst-August König beschäftigt. Dies legt wiederum eine Überprüfung des Bestände der Stasiunterlagenbehörde nahe.
Stichprobenartige Überprüfungen ergaben auch erfolgversprechende Funde in den überregionalen (Print-)Medien. Eine genauere Überprüfung dürfte auch hier einiges zu Tage fördern.
Passend zur Petition:
„Offener Brief der historischen Seminare der WWU an Minister des Landes NRW
Das Historische Seminar, sowie das Seminar für Alte Geschichte und das Seminar für Didaktik der Geschichte haben einen offenen Brief an den Herrn Ministerprasidenten Armin Laschet, sowie an Frau Ministerin für Schule und Bildung Yvonne Gebauer gesendet, um im Zuge der Rückkehr zu G9 den Geschichtsunterricht mehr in den Fokus der schulischen Bildung zu rücken.
Insbesondere der Bezug zu aktuellen Themen wie Zuwanderung, der Reflexion kultureller Werte und der Rolle des Geschichtsunterrichts im Integrationsprozesses.
Den vollständigen Text finden Sie hier„.
Quelle: Westfälische Wilhelms-Universität Münster, 23.1.2019
Ganz interessant, wenngleich keine Überraschung, dass es keine oder nahezu keine Prozessberichterstattung durch die Siegener Zeitung gab, was ja, wie ich hörte, auch Herr Mehrer so feststellte. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat er jemand von der Zeitung darauf angesprochen, um von dort zu hören, das Thema interessiere die Leserschaft nicht, daher die Nichtberichterstattung. Das stand natürlich in einem scharfen Gegensatz zu den fortlaufenden Prozessberichten der legendären Gerichtsreporterin Maria Anspach von der Westfälischen Rundschau, die aufmerksam verfolgt wurden.
Nein, „keine Leserinteresse“ ist eine billige Ausrede und zutiefst unglaubwürdig. Es war halt eine der zahlreichen Entscheidungen derer, die das redaktionelle Wort in der Zeitung sprachen und dies selbstverständlich im Sinne ihrer politischen Grundauffassung zu Fragen der Zeitgeschichte und dem Umgang damit. Da stand man eben anderswo als die WR.
Der Blick zurück belegt ja, dass da was zu verbergen und aus der Diskussion zu halten war. In Weimar war nichts zur Verteidigung des Verfassungsstaats gekommen, lieber hatte man schon in den 1920er Jahren die Verteidigungsreden von Hitler nach dem Putschversuch am 9. November 1923 publziert. Und nach dem Machtübergang auf die Nazis und ihre deutschnationalen Bündnispartner hatte die die „Heimatzeitung“ sich bereits im Mai 1933 zum „Organ des nationalsozialistischen deutschen Staates und des unter Adolf Hitlers Führung erwachten Volkes“ ausgerufen.
Das waren ungünstige Voraussetzungen für ein Interesse an Aufarbeitung. Als die Verbrechen mit dem Ende des Regimes endeten und vor Gericht verhandelt wurden, gehörte die Zeitung folglich eher zu den Bremsern. Als 1951 etwa ein Gruppenführer einer Volkssturmeinheit in Siegen vor Gericht stand, der in seiner Kompanie den Beinamen „der Henker“ hatte, sich bei Erschießungen vordrängte, auch „öfter Russen erschossen“ hatte und sich nun für die geradezu sadistisch vollzogene Mordtat an dem Betriebsleiter Ignaz Bruck einer Weidenauer Grube zu verantworten hatte, da erklärte die SZ ihn zu einem „Verführten“, also zu einem NS-Opfer, und zu einem „Werkzeug verbrecherischer Kräfte“. Mit einem Urteil müsse „vor allem endlich ein endgültiger Schlußstrich unter die Geschehnisse jener unseligen Zeit“ gezogen werden.
Immer noch gegen den Strich ging der Zeitung dann wohl der König-Prozess drei, vier Jahrzehnte später. Er fand deshalb so spät statt, weil in Jahrzehnten viel versäumt wurde. Die Bremser waren lange erfolgreich gewesen.
Zwei Artikel in der Siegener Zeitung sind bekannt:
– Siegener Zeitung, 29. November 1990: „Verhaftung von König abgelehnt; Oberstaatsanwalt: Drei Morde und Beihilfe zum Mord an Sinti und Roma“
– Siegener Zeitung, 25. Januar 1991: „König bleibt auf freiem Fuß. Verteidiger kündigten Revision gegen lebenslage Haftstrafe für ehemaligen Auschwitz-Blockführer an“
Diese Funde lassen eine Anfrage an das Archiv der Siegener Zeitung angezeigt erscheinen.
Heute habe ich weitere Artikel der Siegener Zeitung zum Prozess erhalten – danke an HWK:
– [ane]: „Als Soldat von der Ostfront ins KZ. Zeuge sagte gestern im NS-Verfahren aus. Zum Ende des Krieges ins Strafbataillon“, 23.10.1987
– [ane]: „Konkrete Aussage im Siegener NS-Verfahren – Als Knd Konzentrationslager erlebt“, 2.12.1987
– „Zeuge verweigerte die Aussage. Tumulte am Rande des NS-Verfahrens gegen ehemaligen SS-Rottenführer König“, 16.12.1987
– „Ich habe gesehen, wie er die Frau erschossen hat“. Zeugenaussage im Siegener NS-Verfahren – Zweifel wegen Erinnerungslücken“, 14.1.1988
– „Direktor des Museums in Auschwitz“, 8.3.1988
– „Zeugin bat Gericht um Bestrafung des Angeklagten. Nach vierwöchiger Pause im NS-Verfahren Kammer vor neuer Verhandlungsrunde“, 13.4.1988
Das Fundstück ist in den Broschüren von Hartmut Prange „Simon Grünewald – Lehrer, Prediger und Kantor in Siegen“ aus dem Jahr 2012 sowie bei Klaus Dietermann „Jüdische Soldaten des Ersten Weltkriegs aus der Synagogengemeinde Siegen“ aus dem Jahr 2016 enthalten. Die Broschüren sind für eine Schutzgebühr von 3,00 Euro bei der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Siegerland e. V. oder beim Aktiven Museum Südwestfalen e. V. zu erhalten.
“ … Auch der VdA sieht die Notwendigkeit eines ausreichenden Unterrichts im Fach Geschichte und befürwortet deshalb ebenfalls die Forderung des Lehrerverbandes. ….“
Verband deutscher Archivarinnen und Archivare, 25.1.2019
Diese Ausgabe des Enkels von Jung-Stilling ist textlich nicht „sauber“!
.
Allein die von Gustav Adolf Benrath (1931-2014) besorgte Ausgabe, bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft in Darmstadt in drei Auflagen erschienen, enthält den unverdorbenen Original-Text und genügt in allem den Maßstäben,
die man von einem solchen Werk heute erwartet.
besitze über 30 Exponate des Malers.überwiegend bleistift Zeichnungen aber auch einige Ölbilder.wo kann ich sie veräußern ?
habe schon zwei werke in siegen haus siel verkaufen können .
mein name ist auch im buch -die Ärztin und der maler vermerkt-
zwei Bieler des Buches besitze ich. näheres nach einem eventuellen Interesse
Folgender Eintrag auf der Facebook-Seite des Hessischen Landesarchivs vom 14.2.2019 zeigt zwei weitere Akteure in der kommunalen Archivpolitik (und so ist dies ein weiterer leider nicht gekennzeichneter Beitrag zur Blogparade):
Bei der Auswertung von „Unterlagen und Veröffentlichungen aus der damaligen Zeit“ ist einiges übersehen worden: Hedwig Heinzerling war „im heutigen Kreisgebiet“ nicht „die einzige Politikerin, die in der Weimarer Zeit ein politisches Mandat innehatte“, zur ersten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 17. März 1919 schrieb die große Heimatzeitung: „Auch die Anwesenheit von drei Frauen gibt der Versammlung das charakteristische Gepräge der neuen Zeit.“ Neben Frau Heinzerling (DDP) zogen nämlich Anna Hellmann (Zentrum) und Emmy Braun (SPD) in das Stadtparlament ein. Im Februar 1920 folgte mit der Nachrückerin Agnes Ax (DNVP) gar eine vierte Frau. Frau Heinzerling vertrat die DDP nur in der ersten Legislaturperiode im Stadtrat, 1924 wurde sie nicht wiedergewählt, kam aber im Juni 1929 noch einmal für eine kurze Zeit bis zu den Novemberwahlen als Nachrückerin zum Zuge. Anna Hellmann, Ehefrau von Kreisphysikus Dr. Hellmann, wurde hingegen in allen Kommunalwahlen der Weimarer Zeit wiedergewählt und legte erst im September 1933 aus Protest gegen die Auflösung des Wohlfahrtsausschusses ihr Mandat nieder. Agnes Ax blieb bis 1929 im Stadtrat, Emmy Braun nur die erste Wahlperiode.
In der Biografie von Hedwig Heinzerling sollte nicht ihre wichtige Funktion als Referentin der Kriegsamtnebenstelle unterschlagen werden. Ebenso gilt sie als die eigentliche Gründerin und erste Leiterin der Volkshochschule 1948, damals eine Kooperation von Stadt und Kreis.
Gerhard Moisel in der Nachfolge von L. Irle und Dr.Roedig wird am 8 zum letzten Mal im Haus der Kirche einen Vortrag in der Ahnenkundlichen Versammlung des HV halten den Kreis, den Irle 1962 gegründet hat.
Dann ist Schluß, denn es hat sich kein Nachfolger dieses herausragenden Genealogen gefunden.
Dies ist bedauerlich. Vor dem Hintergrund des „Booms“ der Familienforschung stellt sich die Frage: löst sich die Arbeitsgemeinschaft auf? Oder brauchen die Vorträge „nur“ ein neues „Zuhause“?
Es scheint schlecht zu stehen um die Archivierung – und das heißt das amtliche Gedächtnis – in Netphen. Wenn es gut stünde, wäre klar, wovon man redet; das ist es aber offensichtlich nicht. Denn die Antworten wie die Fragen werfen neue Fragen auf. Ein Beispiel: Pkt. 4: „eine elektronische Akte, die als digitale Schriftgutverwaltung genutzt wird“ = gemeint ist vermutlich ein E-Akten-System, also: elektronische Aktenführung. Geantwortet wird, dass eine „digitale Auflistung aller Archivdokumente“ vorhanden ist. Unklar: Geht es hier um Registratur- oder Archivgut? Also um ein Registraturprogramm (für die Unterlagen der laufenden Verwaltung) oder ein Archivinformationssystem (für archivwürdig bewertete Unterlagen im Archiv). Wohl eher ersteres, denn im Folgenden geht es ja um „elektronische Akten in den Fachanwendungen“. Nun enthält aber das als Beispiel angeführte Personenstandsregister nun gerade keine Akten – es ist ja ein Register.
Worum geht es also überhaupt? Vermutung der Kommentatorin: Es gibt keine vollständige Aktenführung auf Papier mehr, sondern diverse elektronische Anwendungen, File-Ablagen, E-Mail-Accounts etc. Eine offizielle und strukturierte E-Akten-Anwendung gibt es aber auch nicht. Wenn vom „Archiv“ die Rede ist, ist ein (sehr kleiner Alt-)Bestand von Papier-Unterlagen gemeint, der in ein paar Schränken verwahrt wird. Ob ordnungsgemäße Aussonderung von Unterlagen der Verwaltung (Anbietung an das zuständige Archiv nach Ablauf der Ausbewahrungsfrist, Übernahme der als archivwürdig bewerteten Unterlagen als Archivgut in das Archiv) stattfindet, ist unklar – vermutlich wohl nicht. Und das dürfte für die papiernen wie für die digitalen Unterlagen gelten.
Bei der Archivierung geht es um das Gedächtnis und die Geschichte einer Kommune – bis zum Ende des 20. Jahrhunderts vor allem dokumentiert in Papier-Unterlagen, danach zunehmend digital. Letzteres nimmt weniger Platz weg, aber alle anderen Aspekte einer Archivierung sind komplizierter als bei Papierunterlagen. Wenn ein so unklares Verständnis von Archivierung besteht, wie es die Antworten zum Ausdruck bringen, sieht es schlecht aus für das Gedächtnis der Stadt.
Die meisten Archivblogs sind institutionell angebunden. Mit mehr privaten Blogs von Archivierenden ließe sich möglicherweise ein anderes Ergebnis erzielen. Ich kann verstehen, wenn Kolleg*innen nicht anfangen, auf den Plattformen ihrer Arbeitgebenden über Missstände zu schreiben, die sie vermutlich häufig selbst betreffen und ihre Vorgesetzten und/oder Trägereinrichtungen in Misskredit bringen – so wichtig und sinnvoll klare Worte und umfassende Informationen häufig auch wären, um z.B. die Öffentlichkeit für konkrete Probleme zu sensibilisieren.
Bei institutionellen Blogs erwarte ich auch keine investigative Aufdeckung von Missständen. Oft reicht die kommentarlose Dokumentation des politischen Diskurses, der in den Informationssystemen der jeweiligen politischen Gremien öffentlich ist.
Schließe mich Rebekka uneingeschränkt an. Es braucht mehr private Blogs und die kommentarlose Dokumentation politischen Diskurses bringt auch nur die wenigsten in Wallung. Wenn, dann müssen es zugespitzte Überschriften und klare Forderungen sein.
Wenn Archivierende bei institutionellen Blogs eine Konfrontation scheuen, dann ist dies nachvollziehbar. Aber wo sind denn die privaten Blogs? Scheuen Archivar*innen möglicherweise mwhrheitlich die Auseinandersetzung?
Mir fehlt schlichtweg die Zeit, mich mit einem eigenen Blog an entsprechenden Diskussionen zu beteiligen. Ich versuche zwar, so gut möglich, mich in entsprechenden Diskussionen zu Wort zu melden und scheue auch keine Konfrontation – aber als Dienstleister habe ich auch weniger Ängste, von irgendwem „auf den Deckel“ zu bekommen, wenn ich Kritik äußere. Ich kann ebenfalls verstehen, dass viele ArchivarInnen sich scheuen, öffentlich zu kritisieren – wobei auch ein nicht unerheblicher Teil des Fachkollegiums sich in Selbstmitleid aufgegeben zu haben scheint und lieber den Weg des geringsten Widerstandes gewählt hat. Schade drum – ich denke, dass wir mit einer stärkeren Lobby viel mehr erreichen könnten.
Sind also Scheu und mangelnde Ressourcen „Schuld“ daran, dass Archivar*innen keine Archivpolitik machen? Wenn dem so ist, dann müssen wir uns auch nicht über die ständig schwieriger werdenden Verhältnisse beschweren. Ich persönlich neige ja eher zu etwas (!) mutigeren Auftritten ….
Die notwendige „stärkere Lobby“ kann aber m. E. nicht nur aus der Archivwelt erwachsen. Hat jemand Ideen, wie wir auch hierzu unsere Nutzer*innen gewinnen können?
Ich meine, dass es eine nicht unerhebliche Zahl von Kolleg*innen gibt, die nach Feierabend sich einfach auch gerne anderen Themen widmen. Viel Engagement im VdA geschieht in der Arbeitszeit – die Gewerkschaften leiden auch unter sinkenden Mitgliedszahlen.
Der unarchivische Feierabend sei den Kolleg*innen ja von Herzen gegönnt. Selbst ich pflege das ein oder andere nicht archivische Hobby. Eintreten für begründete archivpolitische Ziele muss m. E. nicht die komplette Freizeit beanspruchen …… ;-)
In der Arbeit von Traute Fries zur Geschichte der Deutschen Friedensgesellschaft in Siegen findet sich auch ein regionaler Bezug zu einem der genannten Autoren, Axel Rudolph, der unter dem Pseudonym Hermann Freyberg publizierte:
“ …. Axel Rudolph – eine schillernde Persönlichkeit
Im Schreiben des Westdeutschen Landesverbandes vom 5. Dezember 1929 an Fries kündigte Sekretär Bangel nach Klärung organisatorischer Fragen zum Druck von Plakaten und Handzetteln einen Referenten an, dessen Leben von den Nazis am 30. Oktober 1944 gewaltsam beendet wurde.
„[…] Axel Rudolph kommt bereits heute nachmittag hier an und wird mit dem Zug an Siegen 13.51 am Sonnabend über Siegen nach Unnau weiterfahren. Da wir die Autobusverbindungen dort nicht genau kennen, haben wir Herrn Strunk in Unnau gebeten, uns recht schnell mitzuteilen, wie er am besten von Siegen nach Unnau kommt. […] Zu den Rudolph-Versammlungen wollen wir nicht grosse Büchersendungen mitgeben, da wir nicht an einen grossen Besuch glauben. Ausserdem bekommen ja alle Vertrauensleute heute unseren Bücherkatalog zugestellt, sodass Bestellungen erledigt werden können.
Vertraulich! Axel Rudolph ist ein sehr armer Teufel, der schon lange Zeit erwerbslos ist. Er lebt von dem Einkommen seiner Reden und seiner Zeitungsartikel. Das[s] das nicht zu viel ist, brauche ich Ihnen ja nicht mehr zu sagen. Ich wollte das den einzelnen Gruppen nicht mitteilen, da ich nicht wusste[,] welche Leute davon das richtig verstehen. Wenn Sie es für erforderlich halten, es noch einigen davon mitzuteilen, dann tun Sie es nach Ihrem Ermessen.
Mit besten Grüssen für heute – Bangel“
Axel Rudolph wurde am 26. Dezember 1893 in Köln-Nippes geboren. Er war das einzige Kind dänisch/schwedischer Eltern. Er war deutscher Staatsbürger und arbeitete bis zum Einsatz als Kriegsfreiwilliger in Belgien und Frankreich als Bergarbeiter im Ruhrgebiet. 1915 geriet er an der Ostfront in Gefangenschaft. Auf Vermittlung von Elsa Brändström kam er 1917 in ein dänisches Internierungslager. 1919 gehörte er kurze Zeit dem Freikorps Schleswig-Holstein an. Wegen Verstoßes gegen das dänische Ausländerrecht handelte er sich verschiedene Haftstrafen (1920/1921) in Dänemark ein. 1921 heiratete Rudolph die Dänin Maria Stenbæk, die er während der Internierung kennen gelernt hatte. Bis 1924 lebte das Paar in Köln. Während dieser Zeit will Rudolph intensiv für dänische Zeitungen geschrieben und wohl auch wieder als Hauer im Ruhrgebiet gearbeitet haben. 1924 zog das Paar nach Garmisch. Die erste Tochter wurde geboren. Später lebte die Familie in Norddeutschland. Rudolph betätigte sich journalistisch und schloss sich der DFG in Schleswig-Holstein an. Nach der Geburt der zweiten Tochter (1929) wurde die Ehe 1930 geschieden. Zwischen 1926 und 1930 geriet Rudolph wegen krimineller Handlungen, wie Schuldigbleiben kleiner und kleinster Geldbeträge, unerlaubtes Ordentragen und Urkundenfälschung, in die Mühlen der Justiz.
Anfang Dezember 1929 kam Rudolph dann nach Hagen und wurde auf Versammlungstour ins Siegerland geschickt. Im Tagebuch der DFG heißt es: „Zwei Jahre China. Bedeutet die gelbe Rasse eine Gefahr für Europa?“ Diese Formulierung ließ die Vermutung zu, als habe sich Rudolph zwei Jahre in China aufgehalten, was nicht der Fall war. Der Anzeigentext beschränkte sich dann bewusst auf die Fragestellung „Ist die gelbe Rasse eine Gefahr für Europa?“
…..
Rudolph war nur sehr kurze Zeit für die DFG in Hagen tätig, das geht aus der polizeilichen Vernehmung vom 21. Februar 1930 hervor, die im Zusammenhang mit Landesverratsvorwürfen gegen Heinz Kraschutzki erfolgte. Rudolph gab an, für Kraschutzki Kurierdienste geleistet zu haben, die nicht rein pazifistischer Natur gewesen seien, „sondern schon […] mit Landesverrat zu bezeichnen waren“. Mit der polizeilichen Vernehmung distanzierte sich Rudolf von der DFG. Die wirtschaftliche Situation Rudolphs änderte sich 1932 als er einen Filmideenwettbewerb gewann. Er veröffentlichte bis 1943 teils unter Pseudonymen mehr als 50 Werke der Trivialliteratur, wie Abenteurer- und Kriminalromane. Am Ende wurden ihm Briefe, in denen er seine regimekritische Haltung zum Ausdruck brachte, zum Verhängnis. Wegen Wehrkraftzersetzung wurde Rudolph zum Tode verurteilt und starb unter dem Fallbeil im Zuchthaus Brandenburg-Görden.
Auf Twitter wurde gestern gemeldet, dass die Erfassung durch den Verein für Computergenealogie erfolgreich abgeschlossen wurde. Alle Achtung, das ging ja schnell!
Danke für den Hinweis auf das Buch von Wilfried Reininghaus zu den ersten Kommunalwahlen in Westfalen und in Lippe nach dem Untergang des Kaiserrreichs.
Leider suggeriert der Begleit(Klappen-?)text, diese Wahlen hätten „die Dominanz der alten Eliten“ beendet. Das dürfte auch für Westfalen-Lippe nicht gelten.
Die Ansetzung dieser Wahlen durch die SPD-geführte Reichsregierung waren eins der Mittel gewesen, mit denen die Revolution vorzeitig, nämlich vor der „Entmachtung der alten Eliten“, beendet wurde. Ein anderes Mittel war der Einsatz rechtsextremistischer (hier ist das Wort absolut am Platz) Freiwilligen-Regimenter nach dem bekannten Befehl von SPD-Wehrminister Noske gewesen. In diesen Kontext gehört dann etwa die Massenerschießung von Angehörigen der Volksmarinedivision 1919 durch den späteren Wittgensteiner Landrat Otto Marloh (hauptverantwortlich für die Deportation der Wittgensteiner Sinti-Nachfahren nach Auschwitz).
Das Siegerland und Wittgenstein sind ein ausgezeichnetes Beispiel für die Kontinuität der Altstrukturen in Politik, Militär/Militärtraditionen, Verwaltung, Rechtsprechung und weiten anderen Bereichen der Gesellschaft.
Ich erinnere an die Kontinuität der antisemitischen, generell fremdenfeindlichen, militaristischen und extrem antilinken Christlich-Sozialen in der Gestalt der DNVP im Siegerland und in Wittgenstein nach dem Ende der kaiserlichen Herrlichkeit und an deren Radikalisierung und das Überwechseln ihrer Wähler und eines Teils ihrer Funktionsträger zur NSDAP seit Ende der 1920er Jahre.
Statt eines möglicherweise 1919 ins Haus stehenden Bürgerkriegs folgte ein zielgerichtet vorbereiteter Weltkrieg. Und es folgten die ebenso zielgerichtet vorgenommenen faschistischen Massenverbrechen.
Es bleibt m. E. bei den Schlussfolgerungen, zu denen eine Mehrzahl der Historiker in Betrachtung der „Eliten“kontinuität in den vergangenen Jahrzehnten kam. Dazu nur drei Stimmen:
Sebastian Haffner:
„Die deutsche Revolution von 1918 war eine sozialdemokratische Revolution, die von den sozialdemokratischen Führern niedergeschlagen wurde – ein Vorgang, der in der Weltgeschichte kaum seinesgleichen hat.“ (1969)
Reinhard Rürup:
„Das Selbstverständnis der Weimarer Republik und ihrer Träger gründete sich nicht auf die Revolution, sondern auf deren Überwindung. Nicht nur die bürgerlich-demokratischen Kräfte, sondern auch die Sozialdemokraten distanzierten sich sehr rasch und eindeutig von der Revolution.“ (1993)
Joachim Käppner:
„Totenklage auf alles, was in Deutschland hätte sein können und niemals sein durfte: Hätte die Ebert-SPD die Massenbewegung genutzt, statt sie zu fürchten, das alte Militär zum Teufel gejagt, statt sich mit ihm zu verbünden, wäre die Republik 1933 wahrscheinlich nicht untergegangen oder wenigstens nicht den Nazis in die Hände gefallen – so der Gedankengang Haffners, und seiner Logik kann man sich schwer verschließen.“ (2018)
Danke für die Vorab“besprechung“! Es handelt sich sowohl um die Anzeige auf der Seite des herausgegenenden Verlags (s. Quellenagabe), als auch um den Klappentext.
Übrigens: ein Blick in die Literaturliste zeigt, dass die angegebenen Werke zur Geschichte der Weimarer Republik wohl nicht herangezogen wurden.
Klingt also so, als wäre eine ausführliche Rezension eine gute Idee.
„Die Ansetzung der Wahlen“: missverständlich. Muss natürlich heißen „Die Ansetzung von Wahlen“, also zuallererst von Wahlen zu einer „Nationalversammlung“, die die inzwischen von den Arbeitern selbstorganisierten Strukturen vor allem in den Betrieben, die auch die Alteigentumsverhältnisse zugunsten einer Neuordung infrage stellten, entlegitimieren und beseitigen sollte. Da war dann der Kniff mit den Wahlen nicht ganz erfolgreich. Es gibt immer noch Betriebsräte.
Einfach auf „Doktorarbeit“ im obigen Text klicken.
Dann erfolgt die Weiterleitung nach Münster; dort dann auf die Titelseite klicken und das Lesen des Buches ist online möglich. Die Seite in Münster erlaubt auch ein PDF-Download.
Ernst Bernhardt Schmidt*16.4.1870 Eisern
als Sohn des gewerken Gast Wirt und Brauereibesitzer
Wilhelm Schm. Eisern
Ehe evangel. Rödgen3.11.1867
Johanna Stadermann von Eichen
Schon der Großvater Johanns Schm. war MassebläserGewerke und Bierbrauer
in Eisern
Der eigentliche Dissertations-Druck liefert weitere (nicht in der Verlagsveröffentlichung enthaltene) Informationen.
Abitur: Gymnasium Attendorn. Fortsetzung der in Leipzig begonnenen Studien an der Universität Berlin, wo er auch promoviert wurde (öffentliche Disputation 22.9.1894). Als einer der drei „Opponenten“ wird ein gewisser „Albert Irle, Dr. phil.“ genannt, vielleicht ein Vertreter der Siegerländer Irle-Dynastie.
Für alle, die es interessiert (mich nicht):
„1908, also genau in dem Jahr, in dem die deutsche Nationalmannschaft ihr erstes Länderspiel bestritt, gründete der Eiserner Sprachenforscher Dr. Bernhard Schmidt einen Fußballverein.“ (https://tuseisern.de//fussball.html).
Übrigens sollte die Tatsache, dass die ULB Münster ein Werk aus ihrem Bestand digitalisiert hat, nicht als Lektüreempfehlung oder Gütesiegel mißverstanden werden. Mehrere sachkundige Rezensenten hielten Schmidts Dissertation für ziemlichen Schrott. Eine der Besprechungen endete mit dem Satz „… Wir können nicht umhin, zum Schluss unser Bedauern darüber auszusprechen, dass der sonst so stattliche Katalog trefflicher Werke, durch den sich der Niemeyersche Verlag um die germanistische Wissenschaft verdient gemacht hat, um eine so wenig erfreuliche Leistung, wie die eben angezeigte, vermehrt worden ist.“ (Gustav Hinz in: Zeitschrift für deutsche Philologie 29 (1897), S. 269-271)
Vielen Dank für die Ergänzungen!
Die Promotionsakte Schmidts befindet sich wohl im Universitätsarchiv der Humboldt-Universität Berlin, Bestand Phil. Fak. Promotionen bis 1945, Nr. 324 ( Laufzeit: 22. September – 13. Dezember 1894)
Die Siegener Zeitung berichtete am 6.4. zur Personalsituation im Hilchenbacher Stadtarchiv:
„Das Hilchenbacher Stadtarchiv wird einen weiteren Rückschlag (sic!) verkraften müssen. ….. Pensionär Reinhard Gämlich, der seit den vergangenen Sommer noch mit einem Minijob aushilft, wird auch noch bis zum Ende des Jahres nicht ganz raus sein aus der Wilhelmsburg. Wie Fachbereichsleiter Hans-‚Jürgen Klein der SZ sagte, ist Gämlich seit April allerdings nicht mehr mit regelmäßigen Sprechzeiten zugegen – Ansprechpartner für die „Kundschaft“ ist nun der neue Archivar.“
Leider fand die Schwester Emilie Auguste Rübsamen (1848-1922), die gemeinsam mit Schwester Rosa, Bruder Ewald und Mutter Mathilde geb. Franz nach dem Tod des Vaters 1891 nach Berlin zog, in der Beschreibung keine Erwähnung. Die drei Geschwister waren ledig. Die Schwestern unterstützen ihren Bruder bei seinen Forschungen. Seine besondere Neigung galt den Pflanzenmissbildungen und der Gallmückenlehre. Das Interesse dafür hatte seine Mutter geweckt. 1900 veröffentlichte Rosa Rübsamen in Berlin ihr 100 Seiten starkes Gedichtbändchen, das sie der Schwester Emilie widmete. Nach dem Tod des Bruders zogen Rosa und Emilie am 1. September 1919 von Metternich zurück ins Siegerland. Dreiviertel Jahr wohnten sie in Geisweid in der Unteren Kaiserstraße. Am 18. Mai 1920 zogen sie nach Hillnhütten bei Dahlbruch. Emilie starb am 21. März 1922 im Alter von 73 Jahren, Rosa folgte am 22. Sept. 1922. Dr. Hans Kruse verfasste einen Nachruf auf Rosa. Er gedachte ihrer in den folgenden Jahren mit Veröffentlichungen ihrer Gedichte und Beiträge im „Siegerländer Heimatkalender“ und in den „Siegerland“-Heften. Dazu gehört auch ihre Betrachtung „Us minner Haardter Kinnerzitt“
Ich bedauere, dass die Fotos der Geschwister, die mir das Stadtarchiv für meinen Aufsatz über Ewald Rücksamen zur Verfügung stellte, in der Ausstellung nicht gezeigt werden. Mein Aufsatz erschien am 22. April 2017 in „Heimatland“ der „Siegener Zeitung“ und wurde im Jahrbuch „Unser Heimatland“ 2017 veröffentlicht. Ich füge Rosas Gedicht „Frehjorschmorge“ bei
Frehjorschmorge
(aus dem Nachlass von Rosa Rübsamen, 1853-1922,
„Siegerland“, 1. H., Januar-März 1927))
D’r Wald hät ho d‘ Morge
Net länger schloafe konn;
Et scheen äm en d‘ Ouje
D‘ helle Frehjorschsonn;
Sin groae Newelkappe,
De nemmt s’m schwinn vam Koapp,
O derem da e Heedche
Met Palmepoase op.
Se stickt sin brungne Kerrel
Met freschem, hellem Gree,
On weabt och gäle Flenkern
We Sonnefearem nee.
Se wärmt sin kale Feße
On wescht d’r Schnee d’va,
On derem Schoh va Sammet
Met wisse Blome a.
D’r Wald, dä läßt sech botze,
Weiß net, we äm geschitt;
Hä hät och zom Bedänke
Vor lutter Lost känn Zitt.
Doch we d’m Fenk sin Brutleed
Itz klengt vor sinne Ohrn,
Wird äm z‘ Mot, als wäre
Och Bririgam no worn.
Vielen Dank für die Ergänzungen!
Eigentlich sollte der Eintrag ja nur auf die Ausstellung im Siegerlandmuseum aufmerksam machen; in den Informationen zur Ausstellung wird Emilie nicht erwähnt.
Wenn wir aber schon dabei sind, die einschlägige Literatur zu ermitteln, so möchte ich noch folgende Fundstücke nennen:
Schaffnit, E(rnst): Professor Ewald Rübsaamen [Nachruf], in: Zeitschrift für angewandte Entomologie, April 1928, S. S. 210 – 217
Böttger, Hermann: Auf den Hütten. Orts- und Industriegeschichte der Gemeinde Weidenau (Sieg), Siegen 1949, S. 240 [Hinweis auf das Gedicht „Os Jong“ Rosa Rübsaamens, das die Kinderjahre Ewald Rübsaamens schildert]
Hallo, eine Frage, gibt es evtl. einen Stammtisch, aehnlich. wie Jahrgangstreffen der Schule, wo sich ehemalige Mitarbeiter treffen um ueber alte Zeiten zu reden? Sicher leben schon viele nicht mehr, aber ich war ca. von 65-70 dort beschaeftigt (Geisweid), damals Anfang 20, da koennten vielleicht noch ehemalige Kollegen leben.
Ich faende es schoen alte Zeiten aufleben zu lassen, ich habe mich dort wohlgefuehlt und war verbunden mit der Firma.Waere doch schoen, zu erfahren, was ist aus dem einen oder anderen geworden.
VGR.Moser
Danke für die interessante Mail. Ich bin nur erstaunt, dass man in Siegen nie von Ludwig von Siegen spricht. Er gilt als der Erfinder der „Manière Noire“, der sogenannten Schab- oder Schwarzkunst, Mezzotinto, eine Technik der Radierung. 3 seiner Originale konnte ich in der National-Bibliothek in Paris besichtigen.
Ludwig von Siegen ist in Köln geboren. In den einschlägigen biographischen Nachschlagewerken (Wikipedia, ADB) lässt sich kein Siegen-Bezug erkennen. Ob Werke in Siegerlandmuseum vorhanden sind, weiß ich nicht.
Aus den Unterlagen des Universitätsarchivs Leipzig geht hervor, dass Schmidt wohl im Sommersemester 1888 und im Wintersemester 1888/89 in Leipzig Philologie studiert hat. Für Sommersemester 1888 belegte Veranstaltungen zu Sophokles, Thukydides, Horaz und Livius sowie zur griechischen und lateinischen Grammatik (Quellen: UAL Rektor B 61, UAL Rep 01 16 07 C 50 Bd. 01, UAL Rektor M 38). Danke an das Universitätsarchiv Leipzig!
In den personengeschiuchtlichen Dokumentationen des Siegener Stadtarchivs fanden sich 2 kleine ergänzende Quellenhinweise zu Rosa Rübsaamen:
1) Siegener Zeitung, 23.9.1922, Nachruf des Siegerlandmuseums (Autor: Dr. Hans Kruse)
2) Siegerländer Heimatkalender 1923, Gedichtabdruck
„Siegerländer Mundartbuch aus Eisern
Anfang April 1895 widmete die Siegener Zeitung der als Doktorarbeit von Bernhard Schmidt aus Eisern (Brauerei Schmidt) erschienen Schrift …… eine lange Besprechung. Dr. Jakob Heinzerling in Siegen hatte bereits 1871 eine ähnliche Arbeit veröffentlicht, dabei jedoch im wesentlichen auf das in Siegen gesprochene „Platt“ aufgebaut, während Bernhard Schmidt seiner Schrift vor allem die Eiserner Mundart zugrunde legte. Die Arbeits Schmidts wurde anhand zahlreicher Beispiele sehr positiv beurteilt.“
aus: Müller, Adolf: Eisern. Auf Erz und Eisen. Pulsierendes Leben in einem alten Siegerländer Gruben- und Hüttendorf, Siegen 1966, S. 290.
Da keine weiteren Lösungsversuche eingegangen sind, erfolgt nun heute die Lösung des Karten-Rätsels. Waren die drei übrigen Rätsel wohl keine große Herausforderung, war dieses Rätsel schwer genug. Es handelt sich um folgende Karte des Forstamtes Hilchenbach:
Wegen einer Recherche wurde die Archivdatenbank des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz überprüfte, die zu Schepp zwei Akten auswirft:
1) Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz
Findbuch: I. HA Rep. 77
Bestand: Ministerium des Innern
Überschrift: 09.18 Personalakten – S (1840 – 1934)
Bestellsignatur: I. HA Rep. 77, Personalakten Nr. 2387
Titel: Schepp, Ernst, Regierungsrat im Oberpräsidium Münster
Laufzeit: 1885-1901, 1920
2) Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz
Findbuch: I. HA Rep. 125
Bestand: Ober-Examinationskommission bzw. Prüfungskommission für höhere Verwaltungsbeamte
Überschrift: 02.02.20 Einzelne Prüfungen, Sch
Bestellsignatur: I. HA Rep. 125, Nr. 4478
Titel: Schepp, Ernst, Regierungsreferendar, Köslin
Laufzeit: 1885
Registratur-/Altsignatur: III c Specialia Nr. 284
Unklar ist, ob der erste Akenband mit GstA Berlin Rep. 77 Nr. 4434 oder
DZA Merseburg (?), Rep 89 H II Westfalen Nr. 1 Vol. 84 identisch ist.
In der Datenbank der niedersächsischen Archive wurden folgende Akten ermittelt:
1) NLA Stade, Rep. 72/172 Neuhaus Amtsgericht Neuhaus/Oste (1852-1973), Nr. 1355, Aufnahme und Eröffnung des Testaments der Eheleute Schepp, Ernst Rudolf, Landrat, und Therese, geborene Weismann, Neuhaus, 1893 – 1927
2) NLA Stade, Rep. 180 C Regierungspräsident Stade 1885-1978, Kommunalaufsicht, Nr. 2790, Versetzung der Landräte des Landkreises Neuhaus, 1889 – 1933
Enthält: Friedrich Wilhelm von Loebell 1889/90; Ernst Schepp 1894; Otto Heidborn 1905; Georg Frhr. von Schröder 1917; Eugen Naumann 1918/19; Erich Knöpfler 1932/33
Vielen Dank für diesen Hinweis auf die im neuen Heft „Wittgenstein“ erscheinenden Artikel. Allerdings ist das Heft momentan noch im Druck und insofern auch noch nicht ausgeliefert.
Der Dokumentarfilm war 1000 Mal besser als dieser unsäglich schwülstige und kitschige Spielfilm Lotte am Bauhaus. Ich frage mich, warum immer Männer denken, sie könnten Filme über Frauen machen :-( – der Spielfilm war so klischeehaft, dass mir die Zähne weh taten.
1. Johann Adam Ginsberg, * 1660 in Neunkirchen-Salchendorf. Er heiratete Maria (Schneider?), Heirat 1687, * 1670 in Neunkirchen-Salchendorf.
Kinder:
2. i. Johann Peter Ginsberg * 20.11.1687.
3. ii. Johannes Peter Ginsberg * 12.01.1690.
4. iii. Johann Henrich Ginsberg * 25.03.1692.
iv. Anna Katharina Ginsberg, * 25.03.1695 in Neunkirchen-Salchendorf.
v. Johann Peter Ginsberg, * 05.09.1697 in Neunkirchen-Salchendorf.
vi. Agnes Katharina Ginsberg, * 19.09.1700 in Neunkirchen-Salchendorf.
5. vii. Johann Henrich Ginsberg * 07.01.1706.
5. Johann Henrich Ginsberg, * 07.01.1706 in Neunkirchen-Salchendorf. Er heiratete Petronella ten Nuyl, Heirat 06.06.1734 in Zutphen, * 1710 in Zutphen.
Kinder:
i. Jan Hendrik van Kinsbergen, * 01.05.1735 in Doesburg, † 22.05.1819 in Apeldoorn.
Danke für den Kommentar! Da Kurrentschriften heute nicht mehr gebräucklich sind, halte ich eine Aufnahme dieser Schrift in den Lehrplan der Schulen für problematisch. Zur Vermittlung von Schreibschriften s. a. http://www.siwiarchiv.de/ausstellung-50-jahre-schulausgangsschrift/
das hat mich sehr gefreut, dass Ihr wieder bei einer Museums-Blogparade dabei seid, dieses Mal bei #DHMDemokratie!
Archive und Demokratie faszinieren mich. Schon eine schwere Entscheidung festzulegen, was archivierungswürdig und was nicht ist. Wie demokratisch ist das tatsächlich? Welche Kriterien gibt es dazu?
Das Archiv als Kontrollinstanz für Politiker ist spannend, jedoch tangiert es diese vermutlich nicht mehr, wohl aber die Rückblende für andere.
Eigentlich sehr Schade, dass die Sütterlinschrift als eine Alternativschrift vor mehr als 40 Jahren aus dem Lehrplan ausgefallen ist. Besonders bei Schulkindern mit vererbter Disgraphie wäre Sütterlin (Kurrentschrift) die ideale Ersatzmöglichkeit gewesen. Ich hatte vor gut 15 Jahren die Möglichkeit gehabt, solchen Schulkindern in der Tschechischen Republik die Sütterlinschrift anzulernen, wodurch sich im Nachhinein bei den 13 Knaben und Mädchen die normale Schreibschrift wesentlich verbesserte. Vielleicht wäre dies ein Tipp für die Bildungsminister, um etwaige Bildungslücken bei den Erst- bis Vierklasslern zu beseitigen.
Was spricht dagegen, dass Großeltern, wenn sie Kurrentschriften noch beherrschen, diese Tradition an ihre Enkelkinder weitergeben? Bitte nicht immer alles der Schule aufbürden! Bildung und Erziehung sollten in der Familie beginnen. Traurig ist aber, dass historische Hilfswissenschaften (wie die Schriftkunde) kaum noch zum universitären Pflichtprogramm angehender Geschichtslehrer gehören.
Es gab einen Giesser Namens Bachert , der wohl in Siegen gelernt und geheiratet hatte.,wohl vor 1767 .Vielleicht kann eine Beleuchtung mit 1000 Watt Strahler und danach Aufnahme mit einer Wärmebildkamera helfen , Jede grössere Feuerwehr hat so ein Gerät ,die Inschrift besser zu lesen.
Herzlichen Dank für die Erwähnung des Artikels zu Ludwig Ferdinand zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg und vor allem vielen Dank für die umfangreiche Recherche zu weiteren Belegen seines Wirkens.
Bitte noch folgende Korrektur vornehmen: Der Artikel in der Wikipedia wurde ausgerechnet gestern Abend verschoben und befindet sich jetzt hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Ferdinand_zu_Sayn-Wittgenstein-Berleburg
MfG Dieter Bald
Habe aus dem Nachlass meiner Tante Kaffeegeschirr aus dem Hause Ida Hermann SIWI Porzellan erhalten. Wäre das etwas für Ihr Archiv ?
Nach meinen Recherchen ist sie als Jüdin wohl deportiert worden und hat einen Stolperstein in Siegen bekommen.
oder wer könnte Interesse haben ?
MfG Birgit Reuyß
Zuständig für die Ausstellungsgestaltung – also auch für das Zuckerwürfelmodell – war laut freundlicher Mitteilung des Mauritshuis die Firma OPERA, Amsterdam, Link:https://opera-amsterdam.nl/ .
Danke schön!
Bis nächstes Jahr!
Wir bleiben dann zwei Wochen in Ihrem schönen Land.So freundliche Menschen… so tolle Radwege…
es grüßt aus Hamburg:Martina.
Um Missverständnissen vorzubeugen, die Ausstellung, die sich u. a. mit Johann Moritz auseinandersetzen wird, findet ab dem 5.4. 2020 im Siegerlandmuseum statt in Siegen statt: http://www.siegerlandmuseum.de/?post_type=portfolio&p=4922 . Das Siegerland ist m. W. nicht für seine tollen Radwege bekannt.
Hallo Martina,
nur um einem möglichen Missverständnis vorzubeugen: Ich war nicht an der Ausstellung beteiligt sondern habe Sie mir auch nur als Besucher angeschaut.
Aber es freut mich natürlich, wenn Sie die Ausstellung ebenfalls als gelungen und interessant empfunden haben, nächstes Jahr wird es vermutlich auch noch eine Ausstellung mit Bezug zu Johann Moritz in Siegen geben.
Jurypreis an ein historisches Projekt:
„…. Jury entschied über Vergabe der Preise
Der Zukunftspreis ist ein Ehrenamtspreis, den der Kreis Siegen-Wittgenstein regelmäßig unter wechselnden Schwerpunktthemen vergibt. Über die Preisträger hatte im Vorfeld eine Jury entschieden, zu der Landrat Andreas Müller, die stellvertretenden Landrätinnen Jutta Capito und Waltraud Schäfer, Karl-Ludwig Bade, stellvertretender Landrat, Annette Scholl, Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft- und Regionalentwicklung sowie Thiemo Rosenthal, Leiter des Referates für IT, Digitalisierung und Bevölkerungsschutz des Kreises Siegen-Wittgenstein, Steffen Löhr, Amt für IT und Digitalisierung des Kreises Siegen-Wittgenstein und Univ. Prof. Dr. Hildegard Schröteler von-Brandt, Universität Siegen, Department Architektur, entschieden.
Silbererzbergwerk des 18. Jahrhunderts virtuell befahrbar machen
Teilnehmer der Delegation aus bei der Rückkehr im Siegerland
(Gebäude im Hintergrund, 19. / 20. Jh .errichtet)? Fw.-Kapelle
Der Bär könnte ein Geschenk aus Spandau sein.
Finde ich gut, und aber Der oder Die Vertreter/in aus meinem Ort hätte dochvorstellig werden können..
Sind bei den Arbeiten Flurnamen erschienen und deren Deutung? Falsche Bezeichnungen richtig gestellt worden
Gerade „auf der Wilte“ gab es noch im 18ten Jahrhundert keine genaue Grenzziehung der Fürstenthum Siegen gegenüber Burbach und dem Freien Grund, gewiß aber eingeflossen? bezws dem Schüler bekannt!
Zur Chronologie des Relaunchs s. a. die Ausführungen von Dr. Bettina Joergens (LAV NRW) in der Aktuelle Stunde des Westfälischen Archivtags 2019: “ …. Es ging um die völlige Erneuerung von archive.nrw.de. Momentan sei der Zwischenstand noch nicht so weit, wie erhofft.
Positiv sei es, dass die Migration der Bestände gut funktionieren würde. Die Softwarehersteller werden unterstützt, es sei geplant, dass jedes Archiv eine eigene Startseite erhält, die im Nachhinein beliebig bearbeitet werden könne.
Im Februar erhielten sie die letzte Lieferung, Probleme wäre, dass das System noch nicht fehlerfrei laufen würde – Content Management System funktioniert noch nicht, Recherchefunktion funktioniert noch nicht wie gewünscht
Eine Fehlerliste würde den Nutzern noch zugeschickt werden.
Zur Beendigung des Projekts wurde eine externe Projektmanagerin eingestellt und eine Prüfungsstelle, die die Bemühungen kritisch beobachten werden.
Es kann noch kein letzentliches Veröffentlichungsdatum genannt werden. ….“
Beide zeitlich Angaben sind ja nicht unkorrekt Allerdings hätte ich gerne ein konkretes Jahr, da der Ort ja nicht sonderlich herausfordernd war. Das Raten kann beginnen…….
Meiner Meinung nach stand die „alte Stadtkirche“ um 1845 an genau der selben Stelle wie heute (nur etwas kleiner), d.h. ebenso wie heute in der Schlossstraße.
Ich vermute, diese Kirche wurde nie gebaut. Die Vorgängerin der Berleburger Stadtkirche stand auf dem Goetheplatz und musste 1839 abgerissen werden. Der gezeigte Plan zeigt vermutlich einen Planentwurf für den gleichen Standort, der nie realisiert wurde. Erst 1859 entstand dann die jetzige Stadtkirche an der Schlossstraße
Dass es die Berleburger Stadtkirche (oder ein nicht realisierter Plan davon) war zunächst auch meine Vermutung. Sie trifft aber nicht zu. Es darf also weiter gerätselt werden! Die Kirche wurde gebaut, aber eben nicht in Bad Berleburg. Und noch ein Tipp: Es ist unklar, warum der Plan im Fürstlichen Archiv in Bad Berleburg vorhanden ist, oder anders: er wäre dort nicht zu erwarten gewesen.
Touché! Es handelt sich tatsächlich um die Evangelische Stadtkirche in Darmstadt, die 1843/44 ‚runderneuert‘ wurde (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Stadtkirche_Darmstadt). Wie und warum der Plan nach Bad Berleburg, in die Fürstliche Rentkammer und dadurch ins Archiv gelangte, ist unklar, aufgrund der familiären und nachbarschaftlichen Beziehungen der Fürsten zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg zu den Landgrafen von Hessen-Darmstadt bzw. zum Großherzogtum Hessen aber auch keine Riesenüberraschung.
Nachtrag: Sobald wieder Findbücher im NRW-Archivportal hochgeladen werden können, wird auch in der Verzeichnungseinheit des Onlinefindbuch die Anonymität der Kirche aufgehoben sein …
Ah, wunderbar!
Ich bin über die „Bessungerthorstrasse“ links oben im Plan darauf gekommen…da kommt man dann recht bald auf Darmstadt. Der Blick in den Wikipedia-Artikel hat es dann bestätigt.
Ein schönes Rätsel (habe meinem Chef dann direkt auch gebeichtet, dass das während der Arbeitszeit einfach gelöst werden musste… ;-) )
Grüße aus Duisburg!
Der Vollständigkeit halber hier auch der Artikel zur Darmstädter Stadtkirche aus dem Stadtlexikon Darmstadt: https://www.darmstadt-stadtlexikon.de/s/stadtkirche.html
Die Mention des Stadtarchivs auf Twitter war ja fast schon ein Wink mit dem Zaunpfahl ;)
Hallo und Guten Morgen,
dieses Bild müßte in Erndtebrück Anfang bis Mitte der 50er Jahre gemacht worden sein. Es zeigt entweder Wabrichstr. und die Gen. Häuser oder aber den Herrenseifen, mit Berlinerstr. und Blick auf den Steimel
Diese Geschichte beeindruckt mich tief . Auch wenn das Geschehen mehr als 75 Jahre zurück liegt, lässt es mich nicht los. Deshalb engagiere ich mich im Aktiven Museum Südwestfalen, damit das furchtbare Unrecht nicht vergessen wird.
Hallo, gibt es noch ein Foto von der Firma F. Meyer Siegen Weidenau neben der früheren Post. Da ist wohl jetzt ein Busbahnhof. Bei dieser Firma habe ich meine Büroaisbildung gemacht 1967?
Es empfiehlt sich eine Anfrage an das Stadtarchiv Siegen zu richten, das über eine ansehnliche Fotosammlung verfügt. Vielleicht ist auch die Facebook-Gruppe „Weidenau – gestern und heute“ hilfreich.
Bedaure, zumindest in den fotografischen Sammlungsbeständen des Stadtarchivs Siegen lässt sich keine Aufnahme des gesuchten Areals in Weidenau mit der Firma Meyer nachweisen.
In der Facebook-Gruppe „Unser Wittgenstein“ gingen bis jetzt folgende unrichtige Lösungsvorschläge ein: Neuastenberg, Bernshausen und Amtshausen/Leimstruth
Das Bild ziegt die Firma C. Koch in Berleburg (heutiger Rathausgarten)
Standort des Fotografen dürfte in etwa die heutige Tierarztpraxis Buttler sein.
Reste der Zaunanlage existieren noch vor der Jugendstilvilla Poststraße 44.
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich weiß nicht, ob es Sie interessiert.
Mein Opa, der Bergmann Albert Otto Leicht ist bei dem Bau eines Schachtes auf
der Grube ums Leben gekommen. Das muß Ende der 1920er Jahre passiert sein. Er ist dann im Krankenhaus zu Kirchen verstorben.
Mit frdl. Grüßen
Marlene Lange
Bitte wg. der sprachlichen Form noch mal gegenlesen lassen. Das bietet sich immer an, wenn eine Reinschrift ins Netz gestellt oder sonstwie vorgelegt werden soll.
Bitte Herrn Kloth nicht unnötig heroisieren. Er war kein Widerständler und wurde es auch durch die kurzzeitige Routinefestnahme nicht.
Ein paar ungeordnete Anmerkungen:
0) Vielen Dank für die Kritik!
1) siwiarchiv versteht sich primär nicht als wissenschaftliches Publikationsorgan. Dafür gibt es im Kreisgebiet 3 historische Zeitschriften.
2) Unter dem Autorennamen „Praktikum Kreisarchiv“ erscheinen in der Regel Einträge auf siwiarchiv, die von Praktikant*innen, Schüler*innen oder Student*innen verfasst werden. Ziel ist es, das Publizieren in einem Weblog kennen zu lernen. Eine der wichtigsten Vorgaben des Bloggens ist es, authentisch zu bleiben. Daher werden stilistische Unzulänglichkeiten bewusst in Kauf genommen.
3) Solche Einträge werten in der Regel die vor Ort einsehbaren Quellen und Literatur sowie die online verfügbaren Daten aus.
4) Die Kritik an der Einschätzung Kloths mag ja berechtigt sein – und sollte bei zukünftigen Darstellungen Kloths berücksichtigt werden – , aber sie kommt zu früh. Denn für den Eintrag konnten weder die vorhandene Personalakte noch die umfangreiche Überlieferung des Mädchengymnasiums ausgewertet werden. Zudem entfiel ein Blick in der Protokolle der Siegener Stadtverordnetenversammlungen aus zeitlichen Gründen.
5) Einträge auf siwiarchiv verstehen sich oft genug als Anregungen zum Weiterforschen – so auch in diesem Fall. Das ein oder andere Mal haben Einträge auf siwiarchiv bereits zu Korrekturen an anderer Stelle geführt – so auch in diesem Fall!
Die Darstellung geht von einem Zusammenhang zwischen dem gescheiterten Attentat am 20. Juli und der Verhaftung von Kloth aus („200 Hinrichtungen“). Die Annahme ist sicher naheliegend, aber doch unzutreffend. Es war eine Festnahme im Rahmen der „Aktion Gewitter“. Sie wurde als eine Präventivmaßnahme, die mit vermuteten Putschvorbereitungen nichts zu tun hatte, seit Juli vorbereitet und fand auf der Basis von veralteten Listen aus der Zeit der unmittelbaren Kriegsvorbereitung 1939 statt. Sie zielte vor allem auf linke und katholische vormalige Mandatsträger. Eine Minderheit von Tausenden wurde dann in KZs festgehalten. Sehr viele als harmlos aber umgehend wieder auf freien Fuß gesetzt. Zu diesen gehörte Kloth.
Das bekannte Personenlexikon der VVN zu „Widerspruch und Widerstand“ wäre in dieser Hinsicht mal zu korrigieren.
Den Entstehungshintergrund hatte ich mir schon so vorgestellt. Den merkt man dem Beitrag sehr an. Bei allem Autorenstolz, den das Publizieren hervorrufen kann, sollte der Autor interessiert sein, nicht mit sprachlichen Schnitzern ins Bild zu treten, daher mein Gegenlesevorschlag.
Und was den Kontext angeht, so ist das auch deshalb schade, weil siwiarchiv, wie alle Leser wissen, für ein wirklich gutes Niveau steht.
Ein solch sinnvolles Bildarchiv für den Kreis-Siegen-Wittgenstein , soll angeblich lt. Ausage von H. Thomas Wolf schon einmal hier betanden haben, es wurde aber u.a. aus Kostengründen wieder abgeschafft und auch nicht weiter verfolgt. Was im kleinen nicht gelingt wird auch auch auf Bundesebene scheitern, zumal es ja schon ein Bundesarchiv in Berlin u. Koblenz gibt .
Wie wäre es z.B. mit der Herrichtung u. Nutzung des Kredenbacher Hüttenmeisterhauses für ein derartiges „Kreis Bildarchiv“ , inkl. Digital-Foto Bestand mit möglichst einfachem PC-Zugang für das interessierte Publikum, ohne abschreckende Gebührenforderungen ???
Die Pressemitteilung wurde auch in einem Marburger Anzeigenblatt veröffentlicht. Ich hoffe, dass damit das Interessen von zumindest ein paar Leser*innen geweckt wurde. :-)
Armin Laschet, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen zum Haus der Landesgeschichte NRW, in einem Interview mit Christiane Hofmanns für die WELT am Sonntag, 14.7.2019:
“ …. WELT: Sie sprechen von 1700 Jahren jüdischer Geschichte in Nordrhein-Westfalen. Damals gab es das Bundesland noch gar nicht.
Laschet: Das neue Staatsgebilde Nordrhein-Westfalen wurde erst 1946 gegründet. Aber das Land, seine historischen Regionen, die Rheinprovinz, Westfalen und Lippe, haben eine bedeutend längere Geschichte. Jeder, der den Kölner Dom, Schloss Augustusburg oder Kloster Corvey anschaut, wer Musik von Beethoven oder Offenbach hört, wer Texte von Heinrich Heine, Friedrich Engels oder Annette von Droste-Hülshoff liest, weiß das. Ich finde es geradezu unentbehrlich, die geschichtlichen Wurzeln unseres Landes vor 1946 aufzuzeigen.
WELT: Wie wollen Sie in einer eher geschichtsvergessenen Zeit dieses Bewusstsein stärken?
Laschet: Insgesamt wollen wir das Geschichtsbewusstsein stärken. Für die Historie von Nordrhein-Westfalen wird es ein Haus der Landesgeschichte geben. Die Aufgabe dieses Museums soll sein, die Identität und das Selbstbewusstsein unseres Landes zu stärken. Wir müssen lernen, dass auch unser Land ein großes historisches Erbe hat.
WELT: Mit welchem Ziel?
Laschet: An der jüngeren Kulturgeschichte Nordrhein-Westfalens lässt sich etwa gut aufzeigen, dass die Künste auch zu einer Entwicklung zu einer liberalen Gesellschaft beitragen. Künstler wie Joseph Beuys, Pina Bausch und Karlheinz Stockhausen haben nicht nur die internationale Kultur geprägt, sondern auch Vorstellungen von Freiheit und Toleranz mitgestaltet.
….“
Link: https://www.welt.de/regionales/nrw/article196787547/Armin-Laschet-Wir-sollten-uns-nicht-verstecken.html
Wenn Karl Reuter im März 1943 nach Warstein verlegt worden ist, kann er dort nicht 2 Jahre vorher am 17.3.1941 ermordet worden sein. Welche Jahresangabe muss geändert werden?
Die Verleihungen standen wohl unter keinem guten Stern. Einer missverständlichen Pressemitteilung folgte dies: “ …. Ursprünglich sollte zudem noch der Stein von Bertha Levi ersetzt werden, der im Winter durch einen Schneepflug versehentlich zerstört worden war. Da es dabei allerdings eine Namensverwechslung gab, muss dieser Stein vom Künstler Gunter Demnig nun erst nochmal neu angefertigt werden. ….“ (Quelle: Radio Siegen, 1.8.2019, 13:45)
Es ist jedesmal für mich ergreifend, wenn ich auf einen Soldatenfriedhof komme. Auf dem Futa-Paß bin ich auch schon gewesen, bei Neapel ist auch einer und am Gardasee, dann am Hartmannsweiler Kopf, . Es muß unserer Jugend begreiflich gemacht werden, daß es nie wieder Krieg geben darf.
Eine Anfrage an das Bundesarchiv Berlin ergab folgendes Ergebnis. Dort liegt im Bestand Slg BDC eine Karteikarte des NSLB zu Josef Kloth vor.
Demnach ist Kloth am 1.8.1933 dem NSLB (Ortsgruppe Hammerhütte, Kreis Siegen-Stadt, Mitgliedsnr. 233.507) beigetreten.Zuvor war er im Deutschen Philologenverband organisert.Kloth wohnt zu diesem Zeitpunkt am Marburgertor 17 in Siegen.
Ferner geht aus der Karte hervor, dass Kloth Luftschutzobmann war.
Lipperheide-Erwähnungen in der „Bibliographie zu Kleidung und Mode“ (Prof. Dr. Jutta Beder, Universität Paderborn, redaktionell überarbeitete und korrigierte Fassung 2019):
– Nienholdt, Eva: Katalog der Lipperheideschen Kostümbibliothek. Berlin 1965 (2. neubearb. Aufl.).
– Pflug, H. (Hrsg.): Antike Helme. Sammlung Lipperheide und andere Bestände des Antikenmuseums Berlin. In: Monographien des Römisch‐Germanischen Zentralmuseums 14. Mainz 1988.
– Rasche, Adelheid: Frieda Lipperheide 1840 ‐ 1896. Ein Leben für Textilkunst und Mode im 19. Jahrhundert Potsdam 1999.
– Rasche, Adelheid (Hrsg.): Varieté und Revue. Der Kostümbildner und Kostümsammler William Budzinski 1875 ‐ 1950. (Ausstellungs‐ und Sammlungskatalog der Kunstbibliothek, Lipperheidesche Kostümbibliothek). Berlin 1999.
– Frühe Modefotographie. Pariser Ateliers in der Lipperheideschen Kostümbibliothek. (Begleitheft zur gleichnamigen Ausstellung in der Kunstbibliothek). 1994.
– Wagner, Gretel (Hrsg.): Mode in alten Photographien: eine Bildersammlung. (Aus dem Besitz des Lipperheideschen Kostümbibliothek in der Kunstbibliothek der Stiftung Preußischer Kulturbesitz). Berlin 1979.
– Rasche, Adelheid (Hrsg.): Die Kultur der Kleider. Zum hundertjährigen Bestehen der Lipperheideschen Kostümbibliothek. Berlin 1999.
– Mit dem Buche tantzen. Die tanzgeschichtlichen Bestände vom 15. bis zum 18. Jahrhundert in der Lipperheideschen Kostümbibliothek. 1989.
Für einen Berufsstand war die neue Ordnung keinSeegen!!!
Die güldene Jahnordnung,und der Kampf der Rödger und Wilnsdorfer Pfarrer gegen diese Einführrung, und (ihre) angedrohte Klage bei der Reichsritterschaft.
Aus über 80 Seiten bestehen Schreiben in Münster , Fstthm.Oranien- Nassau 1A Nr.68 von1775-1781
Es handelt sich um einen regen Briefverkehr von Landräthen und Räthen der Regierungen in Dillenburg und Siegen über die Nutzung eines kleinen Grundstücks , irgendwo im Grenzgebiet des Wildebaches,aber im Stammland der Wilnsdorfer Ritterschaft.
Acte, die Rödger und Wilnsdorfer Pfarr- Hauberge betreffend.
„Es ist mit Genehmigung Fürstlicher Landesregierung nun hieraus verfügt worden, daß die Hauberge im Siegenischen nach der durch den Erfahrung bewährt gefundenen Verordnung der Naßau Katzenellnbogischen Policey Ordnung durchgehends in 16 Jähne oder Haue eingetheilet werden sollten. Man hat auch solches sowohl in Ansehung der herrschaftlichen als privat Hauberge zur Ausführung zu bringen.
Es legen die Pastoren Emmelius Rödgen und Gänsler Wilnsdorf in Ansehung der Willnsdorfer Pfarr Hauberge aus diesem Grunde Wiederspruch (ein) weil solches der Pfarrey nachteilig sei. Und es nicht zu leugnen daß die jetzigen Pfarrer dabei einigen Verlust leiden können“
So heißt die Antwort der fürstl Rentkammer vom 7. März 1775.betreffend der Rödger und
Wilnsdorfer Waldgrundstücke die in der Gemarkung Wilnsdorf liegen , oder besser liegen sollten, denn ein noch immer dort währender Grenzstreit, der1597 begann und 1612 eigentlich Bereinigt werden sollte, war in dem Niederwald wo daß kleine , gemeinsame Pfarrgrundstück lag, nahe der Mittelwildener Mark, immer noch nicht endgültig geklärt.
.Da daß „Pfarrstück“ unmittelbar neben dem „Herrn- Stück“ lag, darf man davon ausgehen, daß beide Grundstücke gewiß einst dem Adel gehörten und zur einer Wirtschaftsfläche eines der vergangenen Höfe im die verstreut im Wildetal lagen.
„Hauberg- Rebellen“
Da der evangelische Pastor Victor Emmelius, der den vereinigten Kirchspielen Rödgen und Wilnsdorf vorstand und auf Rödgen wohnte, nannte man ihn deshalb „den Rödger“ Er war von 1770 bis 1798 der Prediger in der evangelischen Vereinigung.
Dieser Zusammenschluß war eine Verordnung des Landesherren gewesen und galt auch so für die catholische Christen die ihre Zusammenlegung Wilnsdorf –Rödgen nannten. Seit 1769 war Pfarrer Michael Gensler ihr Seelsorger und wohnte bis 1776 im Wilnsdorfer Pfarrhaus, und so wurde er und die Nachfolger “ der Wilnsdorfer“ genannt.
Es ist aber noch ein weiterer Prediger zu nennen:Der ehemalige Jesuit Antonius Schnack, welcher1777 der cathol Gemeinde vorsteht, aber schon1780 nach Rotzenhahn im Oberwesterwald versetzt wird; Anlaß war gewiß seine Äußerrung wegen dem 16 jährigen Haubergumtrieb, der nun auch auf dem gemeinsamen Pfarr grundstück schon längst eingeführt werden sollte.
Es handelte sich um ein abseits gelegenes Waldgrundstück ,welches die Seelsorger und ihre Vorgänger in deren Bearbeitung des Kornabaues als ihre zusätzliche Jährliche Einahmequelle sahen, verbunden mit ihrem doch kargen Lohn, der immer noch in Naturalien bestand.
Noch heute besteht mitten im Staatswald bei Niederdielfen ein„simultanes Wald-Stück“ in einem Hochwald.
In Steine gesetzt ist auch„der Pfarrwald in der Breiten-bach“, was der evangelischen Gemeinde alleine gehört; ein Zugangsweg fehlt hier noch heute ebenso, wie zuvor zu allen gemeinsamen Grundstücken beider Konfessionen.
An den consoliedirten Haubergen in Wilnsdorf hatten die beiden Kirchengemeinden ebenfalls einen festgelegten Anteil, der nach einem „Schlüssel“ aufgeteilt, entsprechende Gelder zugute kamen. In den Jahren 1790-1808 ist eine Akte von über 200 Seiten angelegt worden, die weiteren Aufschluß über diese Einahmen in Wilnsdorf gibt.
So auch die Streitigkeiten wegen der Pfarreinkünfte in den beiden Kirchengemeinden, aus den Jahren 1744-1761.
Jahnordnung für ein Waldfeld
Am 11.1.1775 erschienen die Ehrn Pastores Emmelius und Gänsler, Oberförsterrey Assistent
Klein, Förster Stein von Willnsdorf, Forstjäger Opperman zu Wilgersdorf, von Seiten der Gemeinde Willnsdorf Heimberger Schütz, Johannes Euteneuer und Johann Jost Fries.
Amtsvogt Hofmann von Burbach hatte einen Vorschlag verlesen, nachdem er die betroffenen
Geistlichen verhört hatte, daß Diese, die ihnen vorgeschlagene Einrichtung(Jahnordnung), für
Nachteilig ihr Grundstück hielten, und dieses Stück Feld privat für die Pfarrer gelassen worden sei, ohne sie in die eine Hauverordnung einzubeziehen, da dies nicht machbar wäre
„Die Forstbediensten erklärten hierauf, wie dieser Vorschlag allerdings der Pfarr zum Vorteil gereiche, und auch die Pfarr zu Burbach völlig dabei entschädigt würde, gestaltend dieselbe soviel von Wilnsdorf erhielte, als zur ihrer Entschädigung erforderlich seyn.“
Die Wilnsdorfer Comparenten(Bezeugenden)ließen sich vernehmen, wenn keine andere Einrichtung in den Haubergen getroffen werde,(Hauordnung) würde ihrer Gemarkung dadurch ein Unersätzlicher Schaden entstehen. Unterzeichnet hatte dies Mitteilung Amtmann Bude von Burbach.
Siegen, Burbach, Hachenburg
Wo lag dieses Pfarrgrundstück? In der sehr Gut angefertigten Flurkarte von Wilnsdorf,
ein Anhang im Buch Wilnsdorf von Franz Dango, kann man dies Gebiet versuchen einzuordnen, kennt man den 1776 angefertigten Riß von Ruben Will. Auch in den verschiedensten ausgetauschten Schreiben der Amtleute und Bürger geben Hinweis auf den Ort, vor allem aber ein Grenzgang.
Aber auch eine Acte wo steht: Amtsvogt Hoffman, soll sich mit den Einwohnern auf den Layen Hain begeben, oder: haben die (Mittelwildener) Pfarrdienstleute auf dem Layen Hayn nahe dem Wildebach……….
Oder in einer Mitteilung:“Kann Ruben Will das Stück am Baudenberg nicht hauen“.
Am 3.51776 erschienen Johann Ruben Will von Wilnsdorf und gab an:“Daß er mit 3 anderen Consorten ein Stück Hauberg auf dem Layen Hain ,dieseits des Wildbach, so zur Pfarr zum Rödgen gehörte gegen Abgabung jährlicher Zinse besäße. Der Johann Martin Schneider und
Hermann Reichmann von der mittelsten Wilde ,die andere Halbscheid dieses Waldstückes ,so an die Pfarre zu Willnsdorf zinßbar seyn.Jener Besitz hätte übrigens aber beyde Stücke dieseits des Wildbach gelegen, hingegen aber demnach dieses Teritorium zwischen Hachenburg, Dillenburg und Siegen bisherr strittig gewesen sayn.“
So ist die Lage des Simultanen Grundstückes beschrieben , über deren Nutzung eigentlich sich die derzeitigen Inhaber einig waren und„friedlich Vereinten“ Da daß ganze Waldgebiet aber dem Huderecht unterstand, und dieses über die dort nicht vermessene Landesgrenze hinaus galt, entstanden darum aus den Freiengründer und Burbacher Bewohner viele Klagen
„im Niemandsland“
Bisher war bekannt das dort 1761 gehakt worden ist und man Heidloff gesät hatte und dieses auf diesem Grundstück mehrere Jahre .1773 hatte dort schon wieder das Haubergs- Korn gestanden. Der Niederwald ist also 3-4 Jahre zu früh gehauen worden .
Man hatte immer per Los entschieden welches die evangelische oder katholische Seite werden sollte. Man wollte und konnte mit der Tradition der schon immer geschehenen Feldarbeit mitten im Wald nicht brechen, vor allem fehlte die Feldfrucht im Pastorenhaushalt.
1776 ist Pfarrer Gänsler aber schon nicht mehr in Dienst;er ist nun Seelsorger in Rennerod.
Grenzgrundstück
„1761 Erschienen wir Vorsteher aus dieser gemeinte Ober und Mittel Wilden Johannes Schnell und Johann Eberth Jung zur Mittel Wilden daß der Ruben Will von Wilnß Dorff
kläg:wegen der Erben der mittleren Wilde daß Stücke auf dem Layen Hayn daß“ Herrn Stück“ ist obig Her, über dem Pfarrstück, daß ich aber vor 2 Jahren gehauen,,,,,,,,,“
Um die Zusammenlegung des Pfarr Stück und des Herrnstück das den Wilnsdorfer Erben gehört ,zu einer Schaar, Hau, oder Jahn darum geht es eigentlich, und um eine ordentliche “Huthbarmachung und Einfriedung“ , im Gebiet des „Drei Länder Ecks“ , ein zukünftiger Viehtrieb dort würde die Landesgrenze überschreiten.
Foppen der Bediensteten
In einem ausführlichen Brief 1775 der „Mittel Wildener Pfarrzinsleute „an die fürstliche Landesregierung schildern sie ihren Streit mit ihrem Rödger Kollegen Ruben Will,aus Wilnsdorf mit den sie ja den evangelischen Glauben gemeinsam haben, um das „Herrn-und Pfarrstück“
In einem anderen Schreiben heißt es: Der RubenWill hätte gelästert solange die Wildener ihn zum Grundstück mal hier mal da herfahren ließen. Noch nicht mal eine Fuhrt war vorhanden,
sie Ihn(Will) keinen Tritt durch den Wiesengrund machen lassen, bald hier mal da nach ihrem Gefallen den(Wilnsdorfer) Erben und ihm zu gestatten, daß Land betreten.
Auch der Landrath Trainer aus Siegen wird eingeschaltet, der Ruben Will zu seinen Amtsitz nach Siegen einbestellt. Dieser bestätigt seine willkürliche Bearbeitung. Mal hatte er Wald stehen lassen, mal mit Heidloff nach erfolgten Hauen beflanzt, gerade welches Gebiet nach
Losentscheid er zugesprochen bekam.
Zu Will ist zu sagen daß er ein Modell anfertigte. Der ehemalige Wilgersdorfer Schulmeister und jetziger Schreinermeister hat die vorliegende Karte doch recht schön gezeichnet.
Und so heißt es in der Will´schen Beschreibung des Bergwaldes:“ Auf dem Layen Hain, daß Willnsdorfer Pfarrstück genannt wie auch den Wilnsdorfer Erben gehörende Herrenstück.“
Am 17.10.1776 bekommt der Heimberger Reinschmidt zu Unterwilden vom Amt Burbach ein Schreiben. Er soll auf Kosten der Erben des herrschaftlichen Waldes, Feldmesser Erdmann veranlassen einen Riß anzufertigen wo dieses „Zankgebiet“sich befindet.
Erbauung der Wilnsdorfer Pfarrscheune in Wilnsdorf
3 Jahre im Amt ist nun Jesuit Anthon Schnack, zeitlicher catholischer Pastor zu Wilnsdorf;er läßt in seiner kurzen Anwesenheit Zeit eine 2 stöckige Scheune neue errichten, die vorherige hatte er in einem erbärmlichen Zustand angetroffen.
Holz dafür ist im gemeinsamen Pfarrwald auf dem „Höh wäldchen“ genug vorhanden. Aber es ist in der kurzen Amtszeit Schnack´s dort, wie auch in den Rödger Wäldern mal zu einem argen„Verwandtenstreit“ gekommen , den er der Landes Regierrung schildert. Wie er entäuscht ist über den zuvor liebenswerten Pfarrkollegen . 1780 ist er nach Rotzenhahn versetzt worden, gewiß über ein Tun in der Pfarrstückangelegenheit, was den studierten Amtleuten nun so gar nicht paste.
Eintracht aber herrschte bei den amtierende Seelsorger mit dem „Pfarrberg“ und seiner jährlichen Nutzung. Barsche Briefe wurden Beiden zugestellt, und unter anderem empfohlen ,sich in eine besser zahlende Gemeinde nach ihrer abgelaufenden Amtzeit versetzen zu lassen, denn von einer Pfarrbesoldung aus dem Pfarrvermögen eines Hauberges ist den beteiligten Beamten bisher noch nichts bekannt geworden, sie kannten nur die Stolgebühren, weiteres zu ihrer Besoldung war ihnen völlig unbekannt.
Seelsorger mit Hochschulabschluß
Im Juli 1779 hat das fürstliche Cosistorium in Dillenburg mittgeteilt:
Den Schaden haben die dermaligen Prediger selbst zu Tragen wegen dem Pfarr-Hauberg, und dem damit verbundenem Herrenhauberg und eine Regelung für ihre Nachfolger zu treffen ,für daß gemeine Wohl.
Gerügt wird ihr Protestieren gegen eine Neue Jahnordnung im Streitgebiet.
.“Beide Prediger sind noch nicht im mahl im Stande auf Fragen eine Anworth zu geben“
Pagenstecher Dillenburg, hatte Unterzeichnet.
Gewiß erbost schreibt Anthon Schnack zeitl. Kathol. Pastor zu Willnsdorf und Rötgen am 12.4.1780 an die hochfürstliche Landes Regierung und so direkt an den Landesfürsten und beschwert sich über den Verlust der zeitlichen Pastoren am gemeinsamen Kirchengut. Er zweifelt die Zuständigkeit des fürstlichen Forstamt an, und verweist darauf, es seien einstige Ritterschaftlichen Güther,( der Herren von Wilnsdorf Eigentum gewesen) und man solle diese ihre hergebrachte Arbeitsweise dort so zu belassen, wie diese vorgefunden wurden, „da sie weder Holz noch Kohle verkaufen können, also keinen Kreutzer Geld (dort so erwirtschaften)“
Nun beginnt ein reges Schreiben der Ämter. „Wie Kühn und unbefugt der Schnack die gemein-same Einrichtung vertritt“ Es heißt daß der Rödger (Emmelius) an dem Unfug
“darin keinen Teil hat“, die Reichsritterschaft in Nachfolge und Zuständigkeit ehemaliger Adelsgüter, so auch wegen „daß Herrenstück“; anzurufen. „Man muß ihn in die Schranken des Respekt verweisen“!!!
Schnack wird im May nach Siegen zitiert und Entschuldigt sich dort und führt an“ das er geglaubt hat, für die Hauberge sei das zuständige Forstamt, nicht aber die fürstliche Rentkammer, die mit Genehmigung Fürstlicher Landesregierung ersucht werden müßte, in dieserPfarrberg Angelegenheit“
Von da an hört man nichts mehr von dem Jesuiten Pfarrer, den es in die beiden kleinen armen vereinigten catholische Kirchspiele hinter der Kalteiche“,verschlagen hatte“
„eineStunde lang, eine halbe Stunde breit“
Im May Anfang 1781 wird nun wieder ein reger Schriftverkehr begonnen wegen ,der 16 jährigen Jahnordnung „Bey der auf Siegenischen Hoheit gelegenen Haubergen in der Gemeinde Willnsdorf.“ Die Grenze wird angesprochen zwischen dem Fürstenthum Siegen und den gemeinschaftlichen Grund Seel und Burbach, auch die strittigen an der Wildebach und dem Höhenweg,der noch nicht berichtigt ist.Schon 1768 und 1769 hatte dort der Littfelder Bergmeister Jung begonnen, die herrschaftlichen Lehngüter dort an der streitigen Grenze zu vermessen, er aber wegen seines hohen Alters*1711+1786 solch eine Zeichnung nicht mehr zustande gebracht hatte,
und wegen der hohen Kosten “daran nichts verdient habe“
Es ging auch um die Gerichtsbarkeit dort im Niemandsland, oder Discrict:“In der Längen -aussmessung beträgt er1 ½ Stunden und in der größten Breite 1/2 Std „Wegen der großen Landmasse, ein Stück von ziemlichen Belang. Hier hat Oberwilden ein Theil, sowohl Mittelwilden nebst Mahlmühle und die strittigen Erblehngüter und die Hauberge zuWillnsdorf nebst gleichen Theils der Gemeinden Oberwilden und Wirgendorf, Pfarreyen zum Rödgen, Willnsdorf, Burbach und Neunkirchen, die allen Aufgeführten zustehen.
Scheppe Seite
Wegen, dem Wegebau hat die dortigen Haubergsgemeinschaft an der „Scheppen Seite“ auf dem Weg von Wilnsdorf nach Burbach gehend eine Heidenstock gepflanzt, der von der freyengründer Seite umgehauen wurde und den dort auch zwischen Wilnsdorf und Oberwilden Tod aufgefunden Mann sich bemächtigt, und in den Freyen Grund gebracht hat.
Die Mittelwildener Mahlmühlen Erben, deren Mühle unmittelbar dieseitig der streitige Berg -gegend liegt gibt der Siegener Rentei jährliche Pacht.6Malter Kornabgaben, auch jährlich für ein Mühlenschwein10 Fl.15 alb. Gehben müssen Die Gemeinschaftliche Landes Herrschaften Seel und Burbach aber nichts darüber berichtet werden. (Es war die Wilnsdorfer Bannmühle)
Jeder Pfeil der Jagd von einem Jäger in diesem Gebiet wird als Frevel gewertet, nur unser Förster Stein „darf sich hier bedienen“ So schreibt der Landrat Trainer in Siegen
Grenzbesichtigung
Eine vor Ort vorgenommene Besichtigung soll die strittige Landesgrenze näher bringen.
Siegenischer Grenzgang gegen den gemeinschaftlichen Grund Seel und Burbach
Gegen der alten Stellsteinkaute auf der sogenannten Dautenbach gegen Rinsdorf, von da langs
dem Hilchenbachs Berg und durch das Hilchenbachs Gründchen hinunter bis an die Landstraße,
von da unter der Mittelwildener Mahlmühle her bis an den Mühlengraben, von da langs dem Mühlengraben hinauf bis an Metzlers Rücken oder das sogenannte Hummelnest.
Gränzgang des gemeinschaftlichen Grunds Seel und Burbach gegen Nassau- Siegen
Von der Dautenbach langs den Höhenweg hinauf bis auf die Altenbach an die Landstraße, von da über die Nonfelder unter der Hickenfohr her, hier durch an die Struth, von da langs dem Gosenberg hinauf bis an die Struth, von da langs den Gosenberg hinauf bis an die Ecke des Kalteicher Wald, von da langs den Wald hinunter bis an die Waldwießen, von da bis an den Metzlers Rücken oder das Hummelnest.
Mitten im Wald war die Feldarbeit unerwünscht
Im letzten Schreiben der 87 Seiten füllenden Seiten ,datiert am15.May1781,steht was Nassau-Dillenburg an die Fürstliche Kammer in Siegen mitteilt, heißt es:“In der nun zimlich ruhig und still liegendem Streitsache ist noch keine gemeinschaftliche Commission ernannt worden“
Schon 1777 Hätten sich die Räthe Trainer, Siegen und Hoffmann Dillenburg wegen dem „Pfarrberg“ versucht, in Güte den Streit beizulegen. Nun wollte man den Spezialisten die Grenzfestlegung übergeben, und ein Zustande kommen Vereinbaren. Der Bergmeister Jung soll über den strittigen Ort einen Riß besorgen lassen und über den Erfolg berichten.
So endete der Bericht über, ein kleines, unbekanntes, unwegsames, strittiges Gebiet, wo in einem bestimmten Rhythmus seit seiner Schenkung des ersten Patronatsherren Jahre lang von den neuen Eigentümer durch Los geteilt ,Korn oder Hardloff jedes Jahr ausgesät wurde.
Umgewandelt nach einer amtlichen Verfügung in einen Niederwald sollte daß ehemalige Feld- Stück 1797erstmals geschlagen und wie in einem Hau die weitere Arbeitsweise nach der Jahnordnung fortgeführt werden.
Eckhardt Behrendt, Oberdielfen
Das soll quasi eigentlich keiner lesen oder? Heutzutage kann es eigentlich keinen anderen Grund mehr geben, sowas nicht online zu stellen. Es würde mich zwar interessieren aber nicht so sehr, dass ich es bestelle und Bäume dafür gefällt werden. Das Ding liegt ja digital vor, bevor es an die Druckerei geht.
HoHoHooooo … wie albern. Der Tenor des geläufigen Meinungsdiktats hat sich in den Phrasen um Sascha Maurer und unzählige weitere Denunziationen via Medien-Spektrum, einen weiteren Bärendienst erwiesen: Die Anzahl von „Blindlingen“, die gemäß der erwünschten Medienhörigkeit, jeden offerierten „Dünnschiss“ geruchs- und geschmacksfrei inhalieren, durchkauen und runterschlucken, ist längst dem Wunschdenken der vermeintlichen Meinungslenker beizuordnen. Das diese Tatsache zu den bittersten „Pillen“ der manipulierenden Tenöre gehört, dürfte sich bislang über den Tellerrand herum gesprochen haben.
der link zur wp hilft leider nicht weiter, wenn man kein wp-abonnent ist.
ausstellungszeitraum und ggf. eigene website des veranstalters wären hier besser.
Das Haus stand nahe am “ Kleffweiher“ in Burgholdinghausen, auf dem ich als Kind Schlittschuhlaufen konnte. Es war mir ein vertrauter Anblick, und ich bin froh, daß es jetzt einen Platz im Freilichtmuseum Detmold gefunden hat. Es ist für mich ein Stück Heimat.Zu Beginn der 50er Jahre durfte ich als Schuljunge meinen Vater, den letzten Schmiedemeister in Littfeld, begleiten, wenn im Nachbarhaus wieder mal Pferde beschlagen und den Kühen die Klauen geschnitten werden mußten. Ein Besuch bei Stöckers gehörte dazu.
Die Hamburger Landeszentrale für politische Bildung hat Lehrer*innenbiographien bereits veröffentlicht:
– Hans-Peter de Lorent: Täterprofile. Die Verantwortlichen im Hamburger Bildungswesen unterm Hakenkreuz. Band 1, Hamburg 2016, Download Täterprofile (6,8MB, 808 Seiten)
– Hans-Peter de Lorent: Täterprofile. Die Verantwortlichen im Hamburger Bildungswesen unterm Hakenkreuz und in der Zeit nach 1945. Band 2, Hamburg 2017, Download Täterprofile, Band 2 (13,6MB, 868 Seiten)
– Hans-Peter de Lorent: Täterprofile. Die Verantwortlichen im Hamburger Bildungswesen unterm Hakenkreuz und die Kontinuität bis in die Zeit nach 1945. Band 3, Hamburg 2019, Download Taeterprofile Band 3 (ca. 11 MB, 1024 Seiten)
Weitere regionale Litaratur:
Lehrer und Schule im Jahre 1933 : Dokumente, Kommentare / Klaus Klattenhoff, Friedrich Wißman
Oldenburg : Universität Oldenburg, Zentrum für pädagogische Berufspraxis, 1985
= Unter der Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus / Günter Heuzeroth ; Bd. 5
ISBN 3-8142-0134-5
Volksschullehrer und Nationalsozialismus : Oldenburgischer Landeslehrerverein und Nationalsozialistischer Lehrerbund in den Jahren der politischen und wirtschaftlichen Krise 1930 – 1933 / Hilke Günther-Arndt
Oldenburg : Holzberg, 1983
= Oldenburger Studien 24
ISBN 3-87358-180-9
Nationalsozialismus und Volksschule – Ostfriesland in der Umbruchphase des Jahres 1933 : schriftliche Hausarbeit für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen / Schweinsberg-Dette, Jutta
[Leer 1985]
Ein großes Kompliment für diese Brevier – vor allem die Geschichten aus meiner Heimat sind spannend und zugleich mit Humor bestückt, Gratulation für diese Mischung.
Wie würden Sie meinen Vorschlag „Veröffentlichung im Internet“ bewerten ??
Gerne von Ihnen zu hören.
Nach längerem Krankenhaus Aufenthalt mit Reha usw bin ich wieder da.
Es geht sich immer noch um meine Exponate bz. Bider von Jung – Dörfler.
Hast Du vielecht Interesse.
Habe so auf Facebook immer diese Überschrift gewählt was die Gemeinde angeht.
50 Jahre Gemeinde Wilnsdorf
Sonntag am 8.9.019 Tag der offenen Tür
Ehrlich, wer war schon im Inneren unser Kappelenschule,dem Einod Oberdielfens
1910 während den Schulferien eingebaut ist nun eine Blechdecke eingebaut wiorden, aber nicht iergendeine, nein, so etwas einmalieges muß man gesehen haben
Als der Heimatverein m Mai 1984 gegründete wurde sagte unser erstes Ehrenmitglied Gerhard Daub, bei der ersten Zusammenkunft im Schulraum, das über dem Heraklit eine Stuckdecke sich befindet. Dem nachgegangen sah ich Sie, fühlte und kam zu der Erkemnntniss .das dies Blech sein mußte. Jahre später konnte ich auch das Datum der Instalation erfahren. Bis Heute geht es weiter mit Forschung, wer der Hersteller war. In dieser Zeit nach 19hundert „fand die Blechpest “ ihren Einzug in Wand und Dachabdeckung der Häuser, die der gegründete Heimatverein des Siegerlandes hart bekämpfte, da so etwas nicht ins Landschaftsbild passte.
von 13Uhr bis 1700 ist sie zu besichtigen
Nun die Einladung mit Beschreibung der Gemeinde Wilnsdorf.
1821 erbaut. Eingeschossiges Gebäude in riegellosem Eichenfachwerk. Turm mit geschweiftem, achteckigem Helm. Früher Unterricht im anschließenden Raum, heute Tagungsraum. 1997 wurde eine Blechdecke mit kreisförmigen Mustern entdeckt, die vermutlich um 1924 eingebaut wurde. Diese wurde restauriert und ist heute wieder sichtbar.
Woher diese Daten stammen?
in der offiziellen Vorstellung der Gemeinde heißt es 1911 Decke und 1935 eine Heraklitdecke eingezogen und so konnte man die Decke nicht mehr sehen. Nun dor war der NSVKindergarten zu der zeit und Heraklit, den gab es nicht und in den 60iger Jahren wurde die Kapellenschule damit ausgestattet
4!!!! Familien!!!!fanden in den einem Raum nach 45 dort Platz, dementsprechend abgeteilt wurde auf die feine Decke wegen den Befestigungen keine Rücksicht genommen sowie nach dem Abhängen und befeszigen derHeraklitplatten.Ich habe neugierig kuz nach Gründung desHV mal eine vorsichtig abgenommen und gesehen das wunderbare Stuckwerk mit meinem Ergebniss :Ds muß Blech sein.Geforscht das datum der Installation kam ich auf Winterferien 1910. Forsche übriegens noch weiter und fand eine Darstellung über die Blechpest im Siegerland,Eine Geschichte die ich gerne hier mal an Bildern gerne aufzeigen würde.
Bild könnte enthalten: Einfamilienhaus, Himmel und im Freien
und erschrekt Gestern was noch in Wilnsdorf geschiehtZeitreisende in Arrestzelle – Wilnsdorfer Komödienstadl oder historisches Bewusstsein?
Am Tag des Denkmals sollen am 8.09.2019 im Arrestgebäude in Wilnsdorf „Verhaftungen“ durch die „Interessengemeinschaft Polizei in der Weimarer Republik“ authentisch dargestellt werden. Der Besucher kann sich von der Darstellergruppe „verhaften“ und „einbuchten“ lassen. Wer so etwas braucht um sich in diese Weimarer Zeit zurückversetzen zu lassen ok, dann sollte er aber auch wissen, dass im „Arrest“ ab 1933 andersdenkende inhaftiert und gepeinigt wurden.
Ferdinand Heupel wurde aufgrund seiner Haltung und Äußerungen gegenüber der NSDAP von SA- Männern am 30.06.1933in Wilnsdorf festgenommen und nach dem Verhör im Arresthaus inhaftiert.
Diese Aufnahmestammt vom 21.07.1933 (drei Wochen später!). Zahlreiche Blutergüsse sind noch zu erkennen. Nachdem die SA Ferdinand Heupel „verhört“ hatte, waren auf Grund der Verletzungen einige Finger steif geblieben, so dass er den Beruf des Schneidermeisters aufgeben musste.
Eckhardt Behrendt Ja , das tut dann Weh und ist für mich ein ganz Neuer Aspekt und gilt Anzuzeigen. Meine Überlieferrungen aus „dem Rest“ und der habe ich eigentlich viele , aber nie aufgeschrieben gingen immer harmlos aus.
Gefällt mir
· Antworten · 13 Std.
Eckhardt Behrendt
Eckhardt Behrendt Ob zu Spät, ich würde die Sache stoppen und ja, wünschen das da Verständniß besteht.Immer wieder kommt Neues zu Tage(lieber Bergmann) und oft muß Geschichte ergänzt werden, wie nun in diesem Fall.Übriegens, habe nie von ich weiß was. geäussert wenn ch…Mehr anzeigen
Gefällt mir
· Antworten · 13 Std.
Eckhardt Behrendt
Eckhardt Behrendt Habe gerade alles gelesen und die Aufführrungen wären Klamauk
Gefällt mir
· Antworten · 13 Std.
Eckhardt Behrendt
Eckhardt Behrendt Die Bürgermeisterin wäre gewiß dankbar wüsste sie etwasIst ja so als in „DerPlötze“ etwas ablief.
Gefällt mir
· Antworten · 13 Std.
Karl Heupel
Karl Heupel Am 11.09.2009 stand dies auf der Homepage der Gemeinde Wilnsdorf: „120 Jahre lang, zwischen 1839 und 1959, kamen kleine und große „Bösewichte“für kurze Zeit in den Genuss eines Aufenthaltes im „Räst“, bevor sie zu ihrer Aburteilung nach Siegen überstel…Mehr anzeigen
Gefällt mir
· Antworten · 12 Std.
Karl Heupel
Karl Heupel Auszug aus der Homepage Gemeinde Wilnsdorf 7.9.2019: „120 Jahre lang, zwischen 1839 und 1959, wurden große und kleine „Bösewichte“, aber auch Verfolgte des NS-Regimes und einmal sogar zwei britische Bomberpiloten, für kurze Zeit im „Räst“ untergebracht und anschließend der Staatsanwaltschaft in Siegen überstellt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg….“
Dank an Sie, Herr Müller, für den interessanten Nachtrag! Es ist immer erfreulich, wenn Themen in diesem Blog nicht als Eintagsfliegen verenden, sondern immer mal wieder, und sei es nach 5 Jahren, aufgegriffen werden. Auf die wissenschaftliche Untersuchung der (beneidenswerterweise???) in Ihrem Besitz befindlichen Mühle darf man gespannt sein. Sicher werden Sie das Publikum zu gegebener Zeit an den Ergebnissen teilhaben lassen. Frohes Schaffen! (Gibt es unter Müllern eigentlich auch einen Glück-Wunsch analog zu „Waidmannsheil“ oder „Glückauf“?)
Um der Wahrheit Genüge zu tun, sollte erwähnt werden, dass der Genannte lediglich von 2001 bis 2019 Stadtarchivar von Siegen war. Davor amtierte über drei Jahrzehnte der geschätzte Kollege Friedhelm Menk.
Zu Wilhelm Hartnack s. dessen Wikipedia-Eintrag als auch dessen Eintrag im regionalen Personenlexikon zum Nationalsozialismus in den Altkreisen Siegen und Wittgenstein . Danke für den Hinweis J.M.!
“Der labile Zustand der Weimarer Republik lässt zu, dass die Nationalsozialisten auch in unserer Region breite Zustimmung finden.”
Natürlich – höhere Gewalt sozusagen. Republikfeindliche Kräfte, die genau diese Labilität auch im Siegerland bewusst und über Jahre hinweg beförderten? Doch nicht bei uns. Man war ja anständig, nicht wahr?
Leute, so wird das nichts mit der Aufarbeitung.
Das Gebäude ist durch die Modernisierungsansprüche der wechselnden Bewohner durchgreifend verändert worden, so dass der Bauhaus-Charakter heute deutlich weniger erkennbar ist.
Stimmt! Allerdings wurde auch in der kommunalarchivischen Fachgruppensitzung auf die Vertauenswürdigkeit als „Markenkern“ (!) der Archive, gemeint war vor allem auf die Rechtmäßigkeit archivischen Handels, rekuriert. Dies bedeutet wohl, solange keine Urteile vorliegen, wird vorsichtig gehandelt werden (müssen). Dies müssen wir als offene Archive allerdings schleunigst unsere Nutzer*innen mitteilen, um nicht wieder in den Ruf zu kommen, alles wegzusperren.
Die Dokumentation erwähnt auf S. 113 auch Siegfried Honi, der am 5.5.1879 in Niedernetphen geboren wurde. Spätestens seit 1905 lebte er in Hausberge an der Porta (heute: Prota Westfalica) und übernahm dort die Metzgerei seines Schwiegervaters. Er starb am 7.4.1939 an den Folgen der schweren Misshandlungen in der Pogromnacht in Hannover.
Karl Born: Ich nehme nicht an, dass es sich hier um den Architekten handelt, würde das aber gerne bestätigt finden: Der Architekt Karl Born (1885 Weidenau – 1951 Frankfurt) entwarf 1919 ein sehr gut ausgestattes, größeres Wohnhaus an der Bismarckstraße 67 in Siegen. 1924 entstand nach seinen Entwürfen eine opulente Villa für einen Prokuristen. Für 1936 wird in „Archthek“, einer wissenschaftlichen Datenbank zur Bau- und Architekturgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts für den deutschsprachigen Raum, ein weiterer, aber ungenannter Bau erwähnt. 1937 folgt dann ein Bauauftrag für Siegen-Weidenau, Austr. 34 – 46, Blech- und Stanzwerk Bertram Müller. 1947 trat in sein Büro der Architekt Aloys Sonntag (1913 – 1979) ein, der 1948/1951 das Architekturbüro als selbstständiger Architekt übernahm, wie im „Blog der Archive im Kreis Siegen-Wittgenstein“ (siwiarchiv.de) nachgewiesen. Das Büro existiert noch heute.
Sehr geehrter Herr Hanke,
leider haben wir, wie oben erwähnt, bisher keine weiteren Informationen zur Person des Karl Born. Das Einwohnerbuch der Stadt Siegen und der Kreise Siegen und Altenkirchen von 1940 weist für den Bereich der Stadt Siegen
zwei mal den Namen Karl Born aus, hinzu kommt der von ihnen angeführte
Architekt in Weidenau in der Bruchstraße 9.
Welcher Karl Born zu den GründerInnen der VVN in Siegen gehörte bleibt vorläufig unbekannt.
Meine Frage wäre in Bezug auf den Architekten Karl Born, ob dieser Gegner oder Verfolgter des Nationalsozialismus war?
Sollten sie weitere Informationen zur Identifizierung bekommen, dann bitten wir um Benachrichtigung, neue Erkenntnisse unserer Seits werden wir hier
auf SiWiArchiv eintsellen.
Mit freundlichen Grüßen
Torsten Thomas, VVN-BdA Siegerland – Wittgenstein
Nachdem ich über im Laufe der Zeit entstandene Personenverzeichnisse zu Parteimitgliedschaften verfüge, schaute ich dort einmal rein, fand aber gerade auch in den Daten zu linken und linksliberalen Persönlichkeiten (Nachlass Popp, DFG-Kartei u. a.) einen Karl Born nicht vor. Aber wie sieht es aus mit Entschädigungsakten?
Bei einem Siegerländer Architekten und Angehörigen der bürgerlichen Mitte ist ja eher nicht von einem NS-Verfolgten auszugehen, vielmehr von einem Unterstützer. Vielleicht ergeben die Hinweise auf August und Marie Born ja Näheres, die das Regionale Lexikon der NS-Akteure und -Begleiter nennt.
M. E. müsste man nun wie folgt vorgehen:
1) Verifizierung des im Internet auffindbaren Geburtsdatum, 5.1.1885 in Weidenau, im Siegener Stadtarchiv
2) Überprüfung der personengeschichtlichen Dokumentationen des Stadtarchivs Siegen, ob dort nicht doch etwas zu Karl Born zu finden ist. Denn Irles Personenlexikon erwähnt den Architekten nicht.
3) Wie oben vorgeschlagen, Überprüfung der Entschädigungsakten im Landesarchiv NRW
4) Überprüfung der Unterlagen des ehem. Document Centers im Berliner Bundesarchiv
Für die beiden letzten Punkte wäre ein korrektes Geburtsdatum sehr hilfreich.
Anhand der im Stadtarchiv Siegen befindlichen Weidenauer Personenstandsregister (Geburten 1885) lässt sich zumindest festhalten, dass am 5. Januar 1885 ein August Wilhelm Karl Born (Sohn der Luise Born, geborene Stark, und des Ludwig Born aus Fickenhütten) zur Welt kam. Er verstarb nach einem Stempelvermerk am 10. Januar 1951 in Frankfurt am Main.
Nachtrag: Die Personalia-Sammlungen des Stadtarchivs Siegen (vorwiegend bestehend aus biografischen Presseberichten) verweisen leider auf keinen Karl Born.
Kleine Ergänzung: Im „Wohnungsbuch der Stadt Siegen, der Kreise Siegen und Altenkirchen“ aus dem Jahr 1925 findet sich Karl Born, Archititekt B.D.A. und vereid. Taxator, ebenfalls unter der Adresse Bruchstr. 9. Das Büro befand sich in der Wiesenstr. 8.
Die Lehrer der einklassigen Volksschule Ruckersfeld in der Zeit des Nationalsozialismus:
“ …. 1.10.1924 bis Dez. 1936 Georg Fischer aus Aue/Wittgenstein
1.1.1937 – 30.11.1966 Heinrich Mester aus Bochum-Langendreer …..“
Aus: Heinrich Mester: 900 Jahre Ruckersfeld, Ruckersfeld 1979, S.148
Für Freudenberg-Alchen gibt die Chronik folgende Lehrpersonen an:
“ … Wilhelm Ring 1906-1951
Theo Fischbach 1920-1937
Auguste Klappert ( Handarbeit) 1929 – 1961
Wihelm Wiemer 1937
Ernst Römer 1937-1938
Heinrich Sybre 1938
Paul Kramer 1938-1943
Hannemarie Schütz 1941-1955
Wilhelm Stahl 1945-1946 ….“
aus: Heimat und Verschönerungsverein Alchen e.V. (Hg.): 650 Jahre Alchen. Eine Dorfgeschichte, Freudenberg 1995, S. 163
Auch in Wittgenstein finden sich in den Dorfbüchern Agaben zu Leherinnen und Lehrern“ …..
Fritz Lockert , Hauptlehrer, 1916 – 1940
[? Canstein
Helmut Zindler]
Marianne Strohmann 1920-1938
….
Johannes Heinmöller 1924-1935
Alfred Bettermann 1935-1967
Lotte Sölter 1938-1939
Helmut Rosenkranz 1940
Friedrich Grimme 1941-1945
Ewald Kleine 1944
Waltraud Spies 1945
Friedrich Arndt 1945-1947 ….“
aus: Krämer, Fritz (Hg.): 750 Jahre GirkhausenBalve 1970, S. 62
Ausführlicher stellt der ehemalige Lehrer Otto Krasa die Lehrerinnen und Lehrer in seiner ortsgeschichtlichen Schrift vor:
“ ….. Robert Heide, geb. am 15.9 1876 in Flammersbach , Kr. Siegen , besuchte einige Jahre die Weisenbauschule in Siegen , danach die Präparandenanstalt und das Lehrerseminar in Dillenburg 1894-1897 .Als Lehrer zunächst in Quotshausen, Kr, Biedenkopf und Ibyn, Kr. Mörs , ab 1910 in Gosenbach , 1923 zum Konrektor und 1929 zum Rektor an hiesiger Schule ernannt . Nach seiner Pensionierung wurde er wieder bedingt durch den Lehremangel in den Schuldienst übernommen , wo er die Schulstelle des zum Heerdienst einberufenen Lehrers Berthold Fischer verwaltet . Robert Heide wurde ein Opfer der anfangs April 1945 um Gosenbach tobenden Kämpfe. In einem Zimmer an der Giebelseite der Lehrerdienstwohnung die er nach seiner Pensionierung weiterhin bezog schlug ein Granatspitter durchs Fenster, der ihm ein Bein abriß. Da kein sofortige Hilfe zur Stelle war, verblutete er und hatte somit ein tragisches Ende gefunden im Alter von 68 Jahren. Martha Meyer, geb. am 3.12.1894 in Wissen , Tochter des ev. Pfarrers Meyer daselbst. Nach bestandener Reifeprüfung am Oberlyzeum in Neuwied und der Lehramtsprüfung an der Semiraklasse daselbst zunächst tätig an der höheren Schule in Gosenbach , versetzt nach Hattingen an der Ruhr . Paul Hoffmann , geb. an 4.4.1899 in Gosenbach als Sohn des Grubenverwalters Jakob Hoffman besuch des Lehrerseminars in Gummersbach 1916-1918. Nach seiner Entlassung aus dem Militärdienst war er an hiesiger Schule tätig vom 24.4.1919 bis 31.8.1933 , am 1.9.1933 versetzt nach Niederndorf, Kr, Siegen, 1945 zum Hauptlehrer daselbst ernannt . Adolf Hasseberg, geb. am 8.1.1899 in Lippstadt , Besuch des Lehreseminars in Lüdenscheid 1917-1919 an hiesiger Schule tätig vom 1.10.1919-31.12.1922 am 1.1.1923 versetzt nach Dortmund. Nach erfolgreichem Hochschulstudium wurde er Leiter der Pädagogischen Hochschule nach Dortmund als Professor berufen. Karl Stüll, geb. am 23.8.1896 in Klafeld, Kr, Siegen. Besuch des Lehrerseminars in Gummersbach. Unterbrechung der Vorbereitungszeit durch den Kriegsdienst vom 8.11-1915-26.1.1919 . Abgangsprüfung von Seminar vom 26.2.-3.3.1920, erste Anstellung im Schuldienst in Menden , Kr, Iserlohn. Vom 1.1.1923-31.5.1932 an hiesiger Schule tätig, am 1.6.1932 versetzt nach Struthütten, Übertragung der dortigen Hauptlehrertelle , später Hauptlehrer in Langenau , Kr, Siegen. Otto Krasa, geb. am 25.6.1890 in Radziunz , Kr, Miltisch in Schlesien, als Sohn des Lehrers Karl Krasa daselbst , Besuch des Kgl. Lehrerseminars in Krotoschin ( Provinz Posen) 1908.-1911. Im Zuge der Überweisung von ev. Schulamtsbewerben nach dem Westen der Regierung in Arnsberg überwiesen, seit 16.10.1911 an hiesiger Schule tätig, 1914-1918 Kriegsdienst. Für die Monate August und September 1936 von der Regierung in Arnsberg beurlaubt, um in größerem Umfang als bisher das Aufsuchen und Kartieren der von ihm entdeckten vorgeschichtlichen und mittelalterlichen Hüttenplätze im Siegerland vorzunehmen. Am 1.10.1939 zum Hauptlehrer ernannt . Am 1.4.1955 trat er nach Erreichung der Altersgrenze in den Ruhestand. Am 10. Oktober 1957 wurde ihm für die Erforschung der alten Eisenverhüttung im Siegerland das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Berthold Fischer, geb. am 26.9.1896 in Fredeburg , Kr. Meschede , Besuch des Lehrehseminars in Hilchenbach 1913-1915, Herresdienst als Freiwilliger bei der Marine bis Nov. 1918 ab 25.1.1919 an hiesiger Schule tätig. Am 25.8.1939 zum Heeresdienst einberufen bei der Stabkomp . der Mar. Art. Ers. Abtlg. in Cuxhaven zuletzt befördert zum Ltn. d. M. Art. am 1.4.1945. Nach seiner Entlassung aus dem Heeressdienst wieder im Schuldienst hierselbst seit dem 27.8.1945, Ernennung zum Hauptlehrer am 1.7.1947, in den Ruhestand versetzt am 31.3.58 August Lütgert, geb. am 6.5.1910 in Krombach Kr. Siegen Reifprüfung an der Oberrealschule Weidenau 1929. Besuch der Pädagogischen Akademie in Dortmund 1931. Unterbrechung des Studiums wegen Krankheit. 1935 Ablegung der ersten Prüfung für das Lehramt an Volksschulen erste Lehrstelle an der einklassigen ev. Volksschule in Verserde, Kr. Altena vom 15. Mai.1935 bis zu, April 1936 hierauf Vertretungsstelle in Weidenau, vom 1. Sept.1936 bis Dez.1955 an hiesiger Schule tätig, versetzt nach Eisern, daselbst zum Konrektor ernannt. Else Houben, geb. am 5.2.1901 in Bochum des Lehrerinnensemirars daselbst 1918-1921 -30.10.1926 Telegraphendienst in Bochum. Eintritt in den Schuldienst am 31.10.1936 , zunächst 2 Monate an der Neustadtschule in Wattenscheid, vom 1.1.1927-31.3.1930 an der Pestalozischule in Lünen-Brambauer, vom 1.4.1930-30.11.1933 in Schwelm, vom 1.12.1933-31.8.1951 an hiesiger Schule tätig auf eigenen Wunsch versetzt nach Wattenscheid, daselbst zur Konrektorin ernannt. Wilhelm Kuhn, geb. am 5.5.1892 in Hilchenbach . Besuche der Präparandie und des Lehreseminars daselbst 1906-1912. Erste Lehrerstelle in Lippe bei Burbach Kr. Siegen 1.5.1912-23.10.1916, zweite Lehrerstelle in Oberheuslingen, Kr. Siegen, 21.10.16-3.5.1945, Kriegsdienst 6.4.1915-23.10.1916 und 11.9.1917 -11.11.1918. Seit 1.5.1948 an hiesiger Schule tätig. Versetzung in den Ruhestand am 1.4.1955.
…… Irmgard Siebel, geb. am 26.8.1927 in Siegen als Tochter des Kaufmanns Friedrich Siebel daselbst. Ausbildung Mittlere Reife , Frauenfachschule und Schulhelferlehrgang in Bayreuth , am 1.7.1944 Anstellung als Schulhelferin an der Obenstruhtschule in Siegen, von 1945-1947 an den Volksschulen in Buschhütten und Kreuztal. Besuch der Pädagogischen Akademie in Bonn 1948 -1950, Anstellung als Lehrerin auf der Lippe und Wahlbach Kr. Siegen von 1950-1954, ab Ostern 1954-31.3.1957 an hiesiger Volksschule tätig , versetzt nach Siegen am 1.4.1957. ….“
aus: Krasa, Otto: Chronik der Gemende Gosenbach, Hilchenbach 1964, S. 146 – 149
Oberdielfen. den12.10.019
„die Ruhestätte als Teil der Stadtgeschichte für die Bürgerinnen und Bürger zugänglicher und die Grabstätte zu einem musealen Ort zu machen.“
So verstehe ich es das dies nun was ganz Neues ist und zusätzliches zum Museum der Stadt Siegen, Oberes Schloß angeboten wird
Ein wenig traurig, nein eigentlich Böse der beiden Männer gegenüber, die die Führrungen jahrelang, bis zu ihrem Tode gerne und mit Herzblut übernopmmen haben.Zu bestimmten Zeiten wie ich mich erinerre.
Hermann Wunderlich der ein Eisenwaarengeschäft in der Kölnerstr. hatte schloß den, wenn ein Interressierter ich schreibe nun extra Ein, sich bei ihm vorstellte.Jahrelang nahm er dieses war, wie auch sein Nachfolger Herr Delphenthal vom Rosterberg .Beide Herren hatten detaliertes Wissen zu den Einzelund Gruppenführrungen
Die Sache ist dann eingeschlafen nach dem Tode des Letztgenannten.und war gewiß nicht in Ihrem Sinne. So ist dasscreibeb der Stadt an die Öffentlichkeit mit den Worten wie:
“ künftig einer breiteren Öffentlichkeit präsentiert werden“ ;Nur bei Stadtführungen und jährlich beim Tag des Offenen Denkmals seien Besichtigungen in der Vergangenheit möglich gewesen wenigstens für Mich befremdend
Eckhardt Behrendt ,Oberdielfen
Hochinteressant, vor allem die Bilder von den höheren Töchtern von 1906, die nicht ahnten, was ihnen bevorstand! Ich besuchte die Schule in den Nachkriegsjahren (2. Weltkrieg), als wir sie ein paar Jahre lang noch mit den heimatlosen Schülern des zerstörten Jungengymnasiums im Schichtunterricht teilen mussten. Direkt nach dem Krieg mussten auch die Mädchen zunächst mit der Kleinbahn nach Eiserfeld fahren, was mir erspart blieb.
Allerdings – ein Steinweg-Flügel war auch 1949 schon vorhanden oder hatte vielleicht auch den Krieg überlebt?
Vielen Dank für den Kommentar! Alle Berichte zur Geschichte des Lyzeums sind hier herzlich willkommen. Zum Steinweg-Flügel kann ich leider nicht viel sagen; aber ich werde mich einmal umhören.
Auch die Geschichtswerkstatt Siegen e.V. hat sich des fünfzigjährigen Jubiläums des Schülerinnen-Streiks am Siegener Mädchengymnasium angenommen: In der kommenden Ausgabe des Jahrbuchs „Siegener Beiträge“ (Erscheinungsdatum Ende November) versucht Christoph Bode, emeritierter Professor für Anglistik der LMU-München, „eine Rekonstruktion und Kontextualisierung jenes Streiks, den man durchaus – neben den Protesten gegen den NPD-Landesparteitag am 16. November 1968 – als das herausragende politische Ereignis der „1968er“-Zeit in Siegen betrachten kann, …“. Bode, zur Zeit des Schülerinnen-Streiks Schülersprecher am benachbarten Jungengymnasium, kann dabei auf authentisches Material zurückgreifen, Original-Flugblätter und vor allem seine eigenen Tagebuch-Aufzeichnungen des Oktobers 1969.
Am 12. Dezember 2019 wird der Autor um 18.30 Uhr im Stadtarchiv Siegen eine Lesung aus seinem umfangreichen Artikel halten.
Danke für den Publikations- und Veranstaltungshinweis! Die Geschichtswerkstatt Siegen hatte ja bereits vor vier Jahren auf die Bedeutung des Streiks hingewiesen: “ …. Beim Schülerinnenstreik im Oktober 1969 kamen Forderungen nach personeller Veränderung im Lehrerkollegium, Schaffung eines demokratischen Schulsystems und der Rücktritt der Oberstudiendirektorin auf. Einige Tage hilt der Streik Siegen in Atem, dann ging alles ganz schnell. Die Direktorin gab den Weg frei und nach kurzer Zeit war der Spuk vorbei. Ein einmaliger Vorgang in der deutschen Schullandschaft. ….“ (aus Gerhardus, Tobias: „Die zeitgemäße Ausbildung des weiblichen Geschlechts.“ Zur Geschichte des Siegener Mädchengymnasiums, Siegen 2015, S. 126). Um so begrüßenswerter ist es, dass sie am Thema weiterarbeitet.
2 Literaturhinweise zum Schülerinnenstreik:
1) Betrifft: Erziehung, Ausgabe 12, 1969, S. 9
2) Raimund Hellwig: „Hurra, Revolution“, in „Siegen, Dorf mit Krone. Geschichten und Anekdoten“, 2015 , Seite 24 – 27
Unglaublich. Ein Nazikünstler, der wie kaum ein anderer im Siegerland, auf das seine Bekanntheit sich beschränkte, für die enge Symbiose von „Heimat“bewegung und NS-Bewegung steht, wird drei, vier Generationen später wieder von heimat- und bildungsbegeisterten Bürgern gefeiert. Als sei nichts geschehen. Auch nichts an Aufarbeitung, ein Bildungsbeitrag, der nie ankam, inzwischen vergessen ist oder nun verworfen wird.
Mit Festreden, einen Tag vor dem Jahrestag der reichsweiten Ausschreitungen gegen die jüdische Minderheit und der Brandstiftung der Synagogen.
„Über die reizvolle Verwirklichung bestechender Einfälle hinaus zum Wesentlichen vorgedrungen ist auch Hermann Kuhmichel. … (Er) hat in seinem Porträt ‚Infanterist‘, dem er die Züge eines Westwallkameraden lieh, das Gesicht des deutschen Soldaten als Symbol des Kampf- und Siegeswillens der Nation gültig geprägt. Seine Fähigkeit zur Erspürung und Belichtung des Seelischen kommt ferner in dem scharf umrissenen ‚Kopf eines Offiziers‘ von jenem schalkhaften Zug umspielten anderen des verewigten Betreuers der Siegerländer Künstlerschaft Dr. Kruse zum Ausdruck. … In dem … bewegten figürlichen Motiv ‚Stukas!‘ ist dem Künstler die Symbolisierung der Schreckwirkung beim Einsatz dieser Waffe auf den Gegner gut gelungen.“ (Otto Heifer, Siegener Zeitung, 13.6.1942)
„… lenken sofort das Hauptaugenmerk die Werke des Bildhauers Hermann Kuhmichel auf sich. … Von ihm kann man am ehesten berichten, daß er feines Anpassungsvermögen an die aus dem Volke kommenden Wünsche besitzt, ohne sich auch nur im geringsten selbst dabei aufgeben zu müssen. … Die Geltung der Einzelseele, auf die sich die Kunst in früheren Jahren aufbaute – wobei allzuoft Verwechslungen von Seele und Intellekt vorgekommen sind – dankte sie ihre Haltlosigkeit, die völlige Abhängigkeit vom Unzulänglichen im Menschlichen.[Originalsyntax] Heute ist die tragende Kraft der Volksseele zum Durchbruch gekommen, jenes Unveränderlichen, Stetigen, Klaren und Starken, das dem schwankenden Individuum erst die seelischen Kräfte verleiht. Die Kräfte des Blutes, die in dieser Seele lebendig sind, müssen auch in der Kunst durch den Künstler sprechen. Was kümmert es uns, wenn in irgendeinem Werk ein gepeinigtes Herz aufschreit – wir hören es nicht. Aber wenn der Spiegel unseres geheimen Sehnens und unseres Seins uns vorgehalten wird, dann berührt das Bild, in das wir schauen uns mit mächtigem Leben. Wenn Kunst aus solchem Drange entsteht, dann ist sie an die Landschaft gebunden, dann können wir bei uns auch von Siegerländer Kunst sprechen. Und so sehen wir auch Hermann Kuhmichel als den Siegerländer Künstler. Das Bild des Menschen, das er schafft, ist ernst, stark, fromm, mit einem ganz nach innen gekehrten Blick, es ist dem Siegerländer Menschen zutiefst verwandt. … Daß Kuhmichel nicht an die Überlieferung in der thematischen Gestaltung gebunden ist, bewies er mit den Umschlagdeckeln für die beiden Ehrenbürgerbriefe der Stadt Siegen für Hindenburg und Adolf Hitler.“ (Otto Dinkela, Siegener Zeitung, 21.12.1934)
Na, da lässt sich der eine oder andere Gedanke zur Eröffnung oder für begleitende Gespräche als überzeitliche Wahrheit und Weisheit vielleicht noch nutzen?
Gemeinsam mit Reinhard Gämlich durfte ich 1984 ein zweimonatiges Praktikum im Stadtarchiv Iserlohn absolvieren, bevor wir den Kölner Kurs in Brauweiler besuchten und danach als Archivar in unseren Heimatstädten tätig wurden. Während Reinhard Gämlich bereits im wohlverdienten Ruhestand weilt werde ich diesen Schritt zum 01.03.2020 ebenfalls erledigen.
Herzlichen Glückwunsch lieber Reinhard zu Deiner verdienten Ehrung.
Ich bin erschrocken, wie anmaßend und gnadenlos Ulrich Opfermann über den vielseitigen Siegerländer Künstler Hermann Kuhmichel urteilt. Er verurteilt einen Mann, der niemandem geschadet oder etwas zu Leide getan hat. Kuhmichel hat den Ersten Weltkrieg mit gesundheitlichen Schäden überstanden und am Zweiten zunächst im Sanitätsdienst und 1944 an der Front in Frankreich teilgenommen. Sein Atelier wurde im Krieg zerstört. Er war im „Dritten Reich“ als freischaffender Künstler tätig, der eine Familie zu versorgen hatte. Wie hätte sich Ulrich Opfermann in der Nazidiktatur verhalten? Hätte er die Existenz seiner Familie aufs Spiel gesetzt? Hermann Kuhmichel war kein Anhänger der Nazis. Um einen Einblick in seine politische Einstellung zu erhalten, empfehle ich, die Ausführungen dazu im 2016 erschienenen Bildband von Frieder Henrich nachzulesen. Dr. Hans H. Hanke (LWL) schreibt in seiner Rezension: „Man kann Henrich in dieser nun gut belegten Position durchaus folgen – zumal Kuhmichel nicht der einzige Künstler war, dessen mentaler und künstlerischer Spagat zwischen NS-Gegnerschaft und NS-Aufträgen bewiesen ist. […] Da steht keine heldische, angriffslustige Figur, muskulös und statisch aufgerüstet, wie man es von Thorak, Breker, Meller und vielen anderen willfährigen NS-Größen der Kunst kennt.“ Im Übrigen wurden Kuhmichels Kunstwerke über die Region hinaus im ganzen Bundesgebiet geschätzt.
Lieber Herr Wolf,
vielen Dank für das Follow-up zu Ihrer anregenden Session auf dem ArchivCamp! Das erinnert mich daran, meine Ergebnisse zum Instagram-Workshop zu verschriftlichen.
Die Aussagen mancher Reaktionäre sind immer wieder erstaunlich:
Kuhichel war kein Anhänger der Nazis.
(Traute Fries)
Wlaimir Putin ist ein lupenreiner Demokrat.
( Gerhard Schröder)
Die Welt ist eine Scheibe.
Pabst Urban VIII
Dies kann man heute wissen.
Auszug aus den regionalen Persönlichkeitslexikon (Internet)
Kuhmichel, Hermann
* 4.3.1898 Eiserfeld, gest. 21.9.1965 Weidenau, bildender Künstler, nach Machtübergabe u. a. zahlreich ns- und kriegspropagandistische Beiträge, darunter Kassetten für Ehrenbürgerbriefe der Stadt Siegen für Hitler und Hindenburg, die Plastiken „Judas“ (1933), „Der Bonze“ (1934), „Die Familie“ (1934), Ausgestaltung des „Kameradschaftshauses“ der Fa. Schmidt & Melmer, Weidenau („Führerbüste“ neben Gründerporträts, kriegsmotivische Reliefs; 1938), „Infanterist“ (1942), „Offizier“ (1942), „Wehrmachtssoldat“, „Stukas!“ (1942), „Feldwebel Wrede“, gemeinsam mit Hans Achenbach durch den Kreispropagandal. Theobald Meiswinkel als einer der heimatlichen „Künstler“ gewertet, die „ihr Schöpfertum betont in den Dienst der Zeit gestellt“ hätten (1942), siehe auch die regionalen Kunstexperten Otto Heifer und Josef Zimmermann
„… lenken sofort das Hauptaugenmerk die Werke des Bildhauers Hermann Kuhmichel auf sich. Er ist in seinem Schaffen ungemein fruchtbar, … . Neben dem Rubensbrunnen der Stadt Siegen und dem demnächst zur Ausstellung gelangenden Kriegerdenkmal der Gemeinde Netphen entstand eine Reihe anderer Werke,. die von der ruhigen Fortentwicklung des in sich gefestigten Künstlers sprechen. Von ihm kann man am ehesten berichten, daß er feines Anpassungsvermögen an die aus dem Volke kommenden Wünsche besitzt, ohne sich auch nur im geringsten selbst dabei aufgeben zu müssen. … Die Geltung der Einzelseele, auf die sich die Kunst in früheren Jahren aufbaute – wobei allzuoft Verwechslungen von Seele und Intellekt vorgekommen sind – dankte sie ihre Haltlosigkeit, die völlige Abhängigkeit vom Unzulänglichen im Menschlichen.[Syntax so!] Heute ist die tragende Kraft der Volksseele zum Durchbruch gekommen, jenes Unveränderlichen, Stetigen, Klaren und Starken, das dem schwankenden Individuum erst die seelischen Kräfte verleiht. Die Kräfte des Blutes, die in dieser Seele lebendig sind, müssen auch in der Kunst durch den Künstler sprechen. Was kümmert es uns, wenn in irgendeinem Werk ein gepeinigtes Herz aufschreit – wir hören es nicht. Aber wenn der Spiegel unseres geheimen Sehnens und unseres Seins uns vorgehalten wird, dann berührt das Bild, in das wir schauen uns mit mächtigem Leben. Wenn Kunst aus solchem Drange entsteht, dann ist sie an die Landschaft gebunden, dann können wir bei uns auch von Siegerländer Kunst sprechen. Und so sehen wir auch Hermann Kuhmichel als den Siegerländer Künstler. Das Bild des Menschen, das er schafft, ist ernst, stark, fromm, mit einem ganz nach innen gekehrten Blick, es ist dem Siegerländer Menschen zutiefst verwandt. … Daß Kuhmichel nicht an die Überlieferung in der thematischen Gestaltung gebunden ist, bewies er mit den Umschlagdeckeln für die beiden Ehrenbürgerbriefe der Stadt Siegen für Hindenburg und Adolf Hitler.“ (Otto Dinkela, Siegener Zeitung, 21.12.1934)
„Über die reizvolle Verwirklichung bestechender Einfälle hinaus zum Wesentlichen vorgedrungen ist auch Hermann Kuhmichel. … (Er) hat in seinem Porträt ‚Infanterist‘, dem er die Züge eines Westwallkameraden lieh, das Gesicht des deutschen Soldaten als Symbol des Kampf- und Siegeswillens der Nation gültig geprägt. Seine Fähigkeit zur Erspürung und Belichtung des Seelischen kommt ferner in dem scharf umrissenen ‚Kopf eines Offiziers‘ von jenem schalkhaften Zug umspielten anderen des verewigten Betreuers der Siegerländer Künstlerschaft Dr. Kruse zum Ausdruck. … In dem … bewegten figürlichen Motiv ‚Stukas!‘ ist dem Künstler die Symbolisierung der Schreckwirkung beim Einsatz dieser Waffe auf den Gegner gut gelungen.“ (Otto Heifer, Siegener Zeitung, 13.6.1942)
„In den Kreis der Modernen gehört auch Hermann Kuhmichel mit seinen Holzschnitzereien von starker Kraft der Aussage (‚Juden an der Klagemauer‘, ‚Flüchtlinge‘ usw.) und seinen beiden Farbstickereien ‚Der Schatzgräber‘ und ‚Die große Sünderin‘, expressiven Kunstwerken eigener Art und Farbgebung.“ (1952)
Inwieweit die Kunstwerke Kuhmichels nationalsozialistisch sind, ist ein interessante Frage. Es sind Auftragsarbeiten für nationalsozialisitische Stellen ausgeführt und gezeigt worden. Aus welchen Gründen Kuhmichel diese Aufträge angenommen hat, darüber lässt sich trefflich diskutieren. Auf der einen Seite kann man eine Nähe Kuhmichels zum Nationalsozialismus vermuten, auf der anderen Seite wird man betonen, dass Kuhmichel ja auch seinen Lebensunterhalt bestreiten musste.
Auffallend bei Kuhmichel sind auch Werke, die militärische Themen zeigen. Hier ist die von Opfermann in die Diskussion gebrachte Schnittmenge zwischen dem in diesem Fall nationalsozialistischen Kunstverständnis und dem Kuhmichelschen Oeuvre recht hoch. Dies berichtigt zwar m. E. noch nicht dazu, Kuhmichel als Nationalsozialisten zu kennzeichnen. Aber ein Unbehagen gerade bei diesen militaristischen Werken bleibt bei mir.
In jeder Diktatur hängen die Künstler ihre Fahne in den Wind der jeweils mächtigen Auftragsgeber.
Zahlreiche Marx- bzw. Leninbüsten im Osten zeugen heute noch davon.
Es gibt jedoch kein Gesetz zur Verpflichtung als Künstler.
Man darf auch schlichtweg Arbeitnehmer sein.
Ich hatte ihn als „Nazikünstler“ bezeichnet. Dass er Kunst für Nazis, das Nazisystem und – bitte nicht vergessen – den Nazikrieg gemacht hat, scheint mir unbestreitbar zu sein. Dass er das für Geld gemacht hat auch. Ob und inwieweit er dabei selbst völkischen Überzeugungen anhing und die Nazis prima fand, ist ein bisschen schwierig zu beantworten, aber auch egalitarianism . Wie er künstlerischen Ausdruck in kantig-monumentalen unzweifelhaft militaristischen Wehrmachtsgestalten suchte, das spricht m. E. schon für mindestens eine große Offenheit und Bereitschaft, mit „künstlerischer“ Propaganda einen überall wahrnehmbaren Beitrag zu leisten. Und für seine Kompetenz, das NS-glaubwürdig hinzukriegen. Wie schon oben zu lesen, er hätte auch was anderes machen können, wenn er nur gewollt hätte. Wenn es auch weniger einträglich gewesen und weniger öffentliches Lob eingebracht hätte. Nein, es hat wenig Wert, diesen Herrn nach dem Modell von 1949 zu entnazifizieren und ihm einen Schein „innerlich kein Nazi“ auszuschreiben.
Was haben diese Feststellungen mit „gnadenlos“ zu tun? Das ist eine in der Sache gänzlich unberechtigte, eine unangemessene, maßlose Verurteilung. So artikuliert sich das Heimatsentiment? Na, danke.
Hat eigentlich, diese Frage noch zum Abschluss, K. jemals eine Scham, eine Reue, eine Distanzierung zu seiner Nazikunst artikuliert und sei es, dass er einfach nur erklärt hätte, es täte ihm leid, er habe ja doch nicht anders gekonnt, man möge ihn bitte verstehen? Ist mir bei meinen Untersuchungen zur ja hoch NS-belasteten regionalen Heimatszene bislang noch nie begegnet, aber vielleicht ist er die Ausnahme? Ich bin gespannt.
Die in dem von Detlef Koppen zitierten Artikel angegebenen Arbeiten von Kuhmichel nennen die beiden monumentalen Kasernenverschönerungen leider nicht, das sollte dort mal nachgetragen werden:
„Johann der Mittlere von Nassau“, 4,50 m, an der Graf-Johann-Kaserne auf dem Heidenberg (1936) und ein „Wächter aus Stein“, das heißt ein Wehrmachtssoldat unterer Ränge, 3 m, an der Herzog-Ferdinand-Kaserne auf dem Wellersberg (1936).
Natürlich ordnet sich der Kasernenbau vor allem anderen in die Vorbereitung eines Weltkriegs ein. Die Klügeren warnten schon lange: „Hitler bedeutet Krieg“. Leider waren sie – schon gar im Siegerland – eine eher kleine Minderheit. Kuhmichel in das damalige Meinungsspektrum einzuordnen fällt leicht. Zu leicht für eine heutige Darstellung, die vor allem aus dem besteht, was nicht gesagt wird, die nicht die politischen und die moralischen Implikationen seines Tuns anspricht, und die dennoch ja wohl überzeugen will. Das muss daneben gehen, wenn das Licht angemacht wird.
Die Grafen-Skulptur und mit ihr Kuhmichel wurden in der Parteizeitung der NSDAP 1936 so kommentiert:
„Der Soldat soll wissen, warum er Soldat ist, soll die Verbundenheit zur Heimat gewinnen und seine Bindungen an sie erkennen lernen. Dazu hilft die Kunst, die sie in mannigfacher Weise auf den heimatlichen Gedanken Gedanken und seine Verbindung mit dem Dienst des Soldaten abstimmen kann. Hier ist durch Hermann Kuhmichel … ein Standbild geschaffen, das die in Siegen dienenden Soldaten an … den Gründer Siegener Militärakademie erinnern soll, einen Mann, der durch sein Werk den Soldatenstand emporgehoben und ihm seine Ehre gegeben hat. Den Bürger erinnert das Denkmal an einen Schützer des Wohlstandes und Friedens.“ (SNZ, 26.8.1936)
Das ist eine aufschlussreiche Aussage zur Verschränkung der Heimat- mit der Militaristenszene dieser Jahre, die eine breite Schnittmenge reaktionärer Inhalte repsräsentierten, grau, braun und noch ein paar andere Tönungen.
Inzwischen konnte ja der durch Kasernenabriss gefährdete „Wächter“ von einer großen Heimatkoalition noch mal gerettet werden. Ausgerechnet dorthin setzte sie ihn, wo die Toten dieses verbrecherischen Krieges liegen. Dazu passt diese Freudenberger Ausstellung bestens.
Der oben zitierte Artikel geht auch nicht ein auf die deutschnationalen und NS-affinen sog. Kriegerdenkmäler, die Kuhmichel in mehrere Dörfer stellen durfte. Ihr allgemeiner Inhalt war nicht zuletzt die Erinnerung an die „Schmach von Versailles“ und der Appell zur Revision der Ergebnisse dieses Kriegs. Das bekannteste „Kriegerdenkmal“ lag in Netphen. Es gelangte „zu trauriger Berühmtheit“ (Klaus Dietermann) über die Grenzen des Gebirgskessels hinaus, weil es inhaltlich über das Übliche hinausging: „Netphen baut als erste Gemeinde Deutschlands ein gemeinsames Ehrenmal für die gefallenen Helden im feldgrauen und braunen Kleid … und Bildhauer Kuhmichel entledigte sich glänzend seiner gestellten Aufgabe.“ (SNZ, 17.1.1934) Motto des „Ehrenmals“: „Und ihr habt doch gesiegt.“
An dieser Stelle sei in Erinnerung gerufen, dass Klaus Dietermann 1985 eine Dokumentation zum Thema publizierte. Sie und ihr Inhalt (wie alles, was er publizierte: „Aufarbeitung der NS-Vergangenheit“) gerieten inzwischen offenbar in Vergessenheit. Der Mitte-Diskurs verschiebt sich nach rechts. So sieht’s doch aus, wenn man unter den Strich guckt.
Mir scheint, dass für Kuhmichel alle Quellen „auf den Tisch“ müssen. So fand bzw. findet in die Diskussion bisher keinen Einzug: Henrich, Frieder:
Mit Hermann Kuhmichel durch das Siegerland. Eine dokumentarische Zwischenbilanz über Leben und Werk des großen Künstlers, 2016 – Link zur Renzension von Hans Hanke: https://www.whb.nrw/367-download/Heimatpflege/2017/HiW_6_2017_RZ_INet.pdf .
Im Frühjahr 2008 stellte die Westfälische Rundschau ein Frühwerk des Künstlers vor: „Wat wärn de Hänn soe waich“ oder Haferflockensuppe mit Salz. Siegerländer Bildhauer Hermann Kuhmichel gestaltete 1931 das „Arbeitslosen-Häuschen“ in der Hitschelsbach mit einem Relief.“ Ein Hinweis darauf, dass m.W. ein erschöpfendes Werkverzeichnis bislang fehlt. Ein solches wäre wünschenswert, um das künstlerische Schaffen Kuhmichels differenziert bewerten zu können.
In der Datenbank der Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste fand sich ein Werk Hermann Kuhmichels – die Plastik „Meine Eltern“ – , das vom zuständigen Propagandaministerium im Rahmen der „Entartete Kunst“-Aktion 1937 oder 1938 von einem Wittener Museum nach Berlin geschafft wurde. Die Spur des Werkes verliert sich 1945 in Güstrow. Leider liess sich über diesen Vorgang nichts Weiteres ermitteln.
Das hier zitierte Online-Personenlexikon weist keine archivischen Quellen auf; hat man bisher nicht in den Archivien recherchiert (Bundesarchiv ?) Ich bin gespannt.
Die Diskussion war ja zu interessant, als dass der Kuhmichel-Artikel im Regionalen Lexikon der NS-Belastung (http://akteureundtaeterimnsinsiegenundwittgenstein.blogsport.de/a-bis-z/gesamtverzeichnis/) davon hätte unberührt bleiben können. Was nun die „entartet“-Behauptung angeht, erbrachte die Recherche in der Datenbank Proveana des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste, die die Arbeit der Koordinierungsstelle für Kulturverluste Magdeburg fortführt, also der einzige vorliegende ernsthafte Hinweis,
keinen Befund. Zwar tritt dort ein Bild des Malers Heinrich Pforr „Meine Eltern“ (http://www.lostart.de/DE/Verlust/257351) auf, nichts aber sonst, weder Kuhmichel noch ein weiteres Werk mit diesem Titel. Nun mag es natürlich sein, dass Künstler und Arbeit von der Vorgängereinrichtung aufgenommen waren, sie aber nach Überprüfung aus dem Datenbestand herausgenommen wurden. Weiß siwiarchiv mehr?
Kurznachtrag zu meinem Kommentar weiter oben: Mit „egalitarianism“ wollte ich mich nicht wichtig machen. Das hat mir ein Thesaurus da reingesetzt. Ich hatte einfach geschrieben: „Ob und inwieweit er … völkischen Überzeugungen anhing und die Nazis prima fand, ist … egal.“
Na ja, „Emil Nolde war Antisemit und glühender Nazi.“ (Die Welt, 4.5.2019) Er fiel in die Kategorie „entartete Kunst“, was ihn sehr schmerzte. Das eine muss das andere demnach nicht ausschließen. Was diese Einordnung – für ein einziges bislang bekanntes – Werk für Kuhmichel bedeutete, wissen wir nicht. Sagen lässt sich, dass dieses Urteil oder das Werk ein Ausrutscher gewesen sein müssen: entweder eines ziemlich einsamen NS-Dogmatikers, denn das wiederholte sich nicht, schon gar nicht dort, wo man ihn so gut kannte, oder von ihm, denn das passierte ihm bis 1945 bei kontinuierlich guter Auftragslage nicht wieder.
Und was ist bewiesen oder widerlegt mit dem „Arbeitslosen-Häuschen“? Oder mit der „Ausschauenden“ von nach dem NS-Ende, die nach den eher eckigen Formen nun mit fließenden aufwartete und gemessen an den drei oder mehr als vier Meter hohen Klötzen an den Kasernen nun Kleinformat hatte. Außer natürlich, dass anderes nicht mehr so in die Zeit gepasst hätte. Wie schon gesagt, ein Scham- oder Reuebekenntnis für sein NS-Engagement über mindestens zwölf Jahre ist bislang noch nicht bekannt. Auch die genannte Schrift und deren Rezension können dazu nichts mitteilen.
Eine kurze Auswertung von Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen, R 001/Personalakten Nr. 10547:
1) Studium:
Ostern 1910 – Ostern 1911 in Münster: Alte Sprachen
Ostern 1911 – Ostern 1912 in Aachen: Mathematik, Naturwissenschaften
2) Erster Weltkrieg:
– 5.3.1915 Unterschenkelschuss am Hartmannsweilerkopf (Linker Fuss bleibt steif)
– 27.1.1915 Gefreiter
– Einheiten:
22.8.1914 – 9.10,1914 Rekr. Dep. Inf. Reg. 25
9.10.1914 – 16.2.1916 6. Komp- Inf. Reg. 25
17.2.1916 – 30.4.1916 6. Komp. I. Ersatz-Bat. Inf. Reg. 25
ab 30.4.1916 dauernd kriegsunbrauchbar
– Feldzüge:
10.10.1914 – 14.11.1914 Champagne
17.11.1914 – 6.12.1914 Flandern
14.12.1914 – 5.3.1915 Vogesen
3) Familie
– verh. 10.8.1920 Elisabeth Holthausen (Eltern: Ludwig H., *30.8.1852 in Hinsbeck, Rektoratslehrer, Katharina geb. Glose)
– 4 Kinder: 3 Töchter, 1 Sohn (1942 gefallen)
4) Lehrertätigkeit
– auf Vorschlag des Kuratoriums des städtischen Lyzeums in Siegen zum Oberlehrer gewählt
– 4.9.1934 Diensteid auf Adolf Hitler
– Mai 1945: Komm. Leitung des Lyzeums (Wohnort: Siegen-Eiserfeld)
– Bei endgültiger Anstellung als Direktor erwähnt Kloth die Gefängnisstrafe
– 18.5.1948 Kultusminister schaltet sich auf parlamentarische Anfrage ein
-13.12.1949 Kabinettsbeschluss zur endgültigen Anstellung als Direktor
5) Politische Betätigung
– Fragebogen zum Gesetz v. 7.4.1933: Zentrum von 1919 bis zum 1.7.1933
– nach dem 1. Weltkrieg: Philologenverein
– NSLB (1.8.1933, 233507), NSV (1.4.1934, 121442), Reichsluftschutzbund (1.6.1933, 620)
– Bericht vom Juni 1933: „unverbesserlicher Zentrumsmann“, aktiv im Kath. Gesellenverein, Vertrieb von 100 Ex. „Christenkreuz und Hakenkreuz“
– 17.5.1939 Treuedienstehrenzeichen in Silber
– Bericht (OStR´in Schefer) v. 8.5.1943: „Eifer und Mühe“ bei der Altstoffsammlung
Online findet sich der Hinweis, dass Kuhmichel 1941 den ersten Rubenspreis der Stadt Siegen erhielt: https://wiki.zeitraum-siegen.de/ideen-traditionen/rubenspreis . Ein weiteres Indiz dafür, dass Biographie und Werk Kuhmichels noch nicht abschließend erforscht worden sind; denn sowohl das regionale Personenlexikon als auch die Wikipedia erwähnen diese Ehrung nicht.
Ein Diskussionsbeitrag von Dr. Ingrid Leopold:
Das Streitgespräch, veranlasst durch einen Kommentar zur Kuhmichelausstellung in Freudenberg, habe ich verfolgt und wollte mich eigentlich nicht einmischen, da mir diese Art von Polemik zuwider ist. Aber um dem Künstler gerecht zu werden sehe ich die Notwendigkeit, einiges zu korrigieren und klarzustellen.
In der Diskussion werden als Beweislast für die Einstellung Kuhmichels zum Nationalsozialismus ausschließlich Auszüge aus der öffentlichen Presse des Dritten Reiches angeführt, die sich durch entsprechenden Wortlaut und Pathos auszeichnen.
Aus der damaligen Interpretation der Kunstwerke werden Rückschlüsse auf den Menschen gezogen und Anschuldigungen ausgesprochen, ohne ausreichend recherchiert zu haben. Unter wissenschaftlicher Arbeit versteht man eine andere Vorgehensweise.
Es gibt handschriftliche Dokumente aus den Jahren 1941 bis Kriegsende in Form persönlicher Briefe von Hermann Kuhmichel an seinen Freund Alfred Henrich, der als Soldat im Russlandfeldzug eingesetzt war.
Sie geben die Betroffenheit und Verzweiflung des Künstlers über die damalige Situation wieder. Kriegsführung und das Schicksal der Soldaten bezeichnet er als „Ausweglosigkeit“ und „Schlamassel.“
Die Briefe sind im Besitz des Sohnes des Empfängers und bei Bedarf im Original jederzeit zugänglich.
Für den Künstler war sein Leben in der NS – Zeit stets eine Gratwanderung zwischen Anerkennung und Diffamierung, zumal er nicht Mitglied der NSDAP war.
Bereits 1935 drohte ihm ein Ausstellungs – und Schaffensverbot wegen sozial – kritischer und christlich – religiöser Motive in seinen Kunstwerken. Durch Fürsprache des Direktors des Siegerlandmuseums Dr. Hans Kruse konnte die Verfügung abgewendet werden.
Im Rahmen der Aktion „Entartete Kunst“ der Reichskulturkammer in Deutschen Museen wurden 1937 nicht nur eines als „Ausrutscher“, sondern drei Kuhmichel – Arbeiten beschlagnahmt: die Holzschnitte „Untersuchung“ und „ausgesperrt“, sowie die Holzskulptur „meine Eltern.“
Die Begründung lautete: „Hermann Kuhmichel verherrlicht in seinen Werken Kulte des Weltjudentums und vernachlässigt trotz nachdrücklicher Einlassungen örtlicher Parteimitglieder seine Pflicht, all sein Können in die Verewigung des arischen Menschen zu stellen.“
Hermann Kuhmichel war in zwei Weltkriegen als Soldat an der Front eingesetzt. Über 2 Jahre war er im Lazarett und 1945 in amerikanischer Gefangenschaft mit Entlassung in das zerbombte Siegen. Themen seines Kunstschaffens in der Nachkriegszeit waren Entbehrungen und menschliches Leid, Vertreibung und Flucht, Gefangenschaft und Tod.
Er war geprägt von tiefer Religiosität. In seinem künstlerischen Schaffen stand stets der Mensch im Mittelpunkt.
Als er 1965 starb fand man folgenden Kommentar in der Siegener Zeitung:
„Demut, Hingabe und Liebe waren die erregenden und tröstenden, die helfenden und heilenden Kräfte, die in ihm wirksam waren. Ein Wahrheitssucher, dessen bildende Hand mit einer für die Menschen der Gegenwart unfassbaren Geduld den Werkstoff formte.“
Über das NS-Propagandaministerium erreichte die Preußische Akademie der Künste im Juli 1933 eine Eingabe des Wuppertales NSDAP-Reichstagsabgeordneten Hermann Schroer zwecks Förderung des Bildhauers Hermann Kuhmichel in Siegen. Die Antwort der Akademie fiel wie folgt aus:
„Hermann Kuhmichels Werke, die mir in einer Photographie und schlechten Drucken vorliegen, interessieren zunächst durch ihren starken Ausdruck und die naive Einfachheit ihres Aufbaus. Bei näheren Zusehen muss man leider feststellen, dass seine Einfachheit und Monumentalität nicht aus geistiger Überlegeneheit, sondern aus dem Mangel an Formgefühl und Können geboren wurden. Wenn es ihm nicht gelingt diese seine Schwächenzu überwinden, wird er sich kaum aus der Gruppe jüngerer Bildhauer, die auf gleichen Wegen wandeln, herausheben. Um ein zuverlässiges, abschließendes Urteil über seine Möglichkeiten abzugeben, müsste man ihn länger beobachten.“
Quelle: Akademie der Künste, Berlin, Archiv, Sig. PrAdK 0941, Bl. 87 rv, Link
Bei dem oben genannten Karl Born, Mitgied der VVN Kreisgruppe Siegen,
handelt es sich um den 1906 in Siegen geborenen Karl Born.
Er war vor 1933 Mitglied der Zentrumspartei und stand in Opposition zur NS Diktatur. Er wurde mehrmals durch die Gestapo verhört und dabei Misshandelt.
Auch eine 6 monatige Haftstrafe in Einzelhaft musste er 1937/38 über sich ergehen lassen. Durch den Entzug der Eisen und Blechquote wurde seiner Schlosserei die Grundlage entzogen. Nach dem 20.7.1944 wurde er nochmals durch die Nazis kurzzeitig verhaftet.
Damit dürfte geklärt sein, dass es sich bei dem Karl Born in der VVN nicht um den gleichnamigen Architekten handelt.
Torsten Thomas, VVN-BdA Siegerland – Wittgenstein
Den einen ist Polemik „zuwider“, den anderen Personenkult. Das ist nun mal so und hat immerhin eine recht interessante Kontroverse provoziert.
Polemik ist oft ein Ergebnis von Verbitterung. Ich will hier nicht den Opfermann-Versteher raushängen lassen (das hat U.F.O. nicht nötig), aber es ist für mich gut nachvollziehbar, dass der Blick auf den deutschen Homo sapiens während der vergangenen ca. 75 Jahre oder allgemein den internationalen über die Jahrtausende seiner angeblichen Höherentwicklung hin genug Anlass für Kulturpessimismus gibt, was dann gelegentlich sehr rigoros und polemisch artikuliert wird. Für abgehärtete Zeitgenossenen ist das erträglich, oft erfrischend, jedenfalls allemal respektabler als unreflektierte Mythologisierungen. Es mag sein, dass gelegentlich mit Kanonen auf Spatzen (Kuhmichel, Wurmbach u.a.) geschossen wird, die einfach nur auffallend widerspruchsvolle und somit irritierende Personen waren und zum Streit zwischen Kritikern und Verehrern herausfordern. Problematisch für die Geschichtsschreibung ist es aber, wenn unberührt von allen sachlichen Argumenten mit den armen Spatzen zugleich auch den Geiern Absolution erteilt wird. Zum Beispiel voraussichtlich in den kommenden Wochen, wenn wieder einmal ein gewisser Nazi-Bürgermeister (wörtlich im August 1944: „Ich bin ein getreuer Gefolgsmann des Führers.“) als Siegener Lichtgestalt vergöttert wird, obwohl man es seit 1934 besser wissen könnte.
„Den einen ist Polemik ‚zuwider’, den anderen Personenkult.“ Ja, gewiss, dieser kühlen Feststellung ist nur zuzustimmen. Wenn ich von der Zuschreibung „gnadenlos“ einmal absehe, weil sie in eine andere Kategorie als die der Polemik einzuordnen wäre, finde ich zum meinem Glück weder das eine noch das andere in dieser kleinen Diskussion. Insofern sehe ich auch keinen Anlass, nach einem Widerspruch gegen die Hinweise weiter oben ins Verbittern zu fallen. Bin sehr froh, davon bislang verschont geblieben zu sein.
● Der Widerspruch gegen eine Überbewertung des Bildhauers
Kuhmichel,
● die Frage, wo im Spektrum von Opportunismus und Überzeugtheit
er mit seinen zahlreichen NS-Arbeiten einzuordnen wäre,
● die Erinnerung an die zahlreichen Belege seiner NS-Auftragstätigkeit
spätestens seit 1934,
● die Thematisierung des Schweigens (https://westfalen.museum-digital.de/index.php?t=objekt&oges=2225) sowohl der
Heimatbewegung wie auch von ihm selbst zu den NS-Jahren,
● des Schweigens auch über die große öffentliche Wertschätzung, die
ihm durch NS-Sprecher und NS-offizielle und -affine Medien wie die
SNZ und die SZ erfuhr (und die durch Wortlaut und Pathos ihre
Bedeutung nicht verlieren, ganz im Gegenteil),
● die Nachfrage nach einem Scham- und Reuebekenntnis von K.
● der Widerspruch gegen die Umdeutung von K. zu einem verfolgten
Künstler,
was hat das mit Polemik zu tun? Es sind Überlegungen und Fragen, die schon viele Male bei Staatskünstlern gestellt wurden, weshalb soll das hier „Polemik“ sein? Das sind doch Anmerkungen und Fragen, die unbedingt zu stellen sind, wenn man an einer Aufarbeitung der Nazi-Zeit auch im regionalen Raum interessiert ist? Da kann es doch nicht reichen, bei der einen oder anderen Gelegenheit im Jahresverlauf moralische Bekenntnisse vorzutragen? Es geht doch um Aufklärung?
Und noch ein kurzes PS in diesem Sinn:
An einer Stelle der Diskussion kamen Hinweise auf die von K. als „Schicksal der Soldaten“ beschriebenen Zustände „Ausweglosigkeit“ und „Schlamassel“, die er auf sie zukommen sah. Leider fehlt die Zeitangabe. Vielleicht lässt sie sich noch nachtragen? Wäre interessant. Bekanntlich gab es die Erwartung eines militärischen Fehlschlags nach ersten „Erfolgen“ für die NS-Wehrmacht, die Waffen-SS usw. im, wie es in Übernahme der damaligen Bezeichnung heißt, „Rußlandfeldzug“ schon bald für viele.
Und das im engsten Kreis zum Ausdruck zu bringen, war nichts, was jemand zum Systemgegner gemacht hätte (immer vorausgesetzt die private Überlieferung trügt nicht). Dass ein solcher Pessimismus sich auch aus der Kenntnis der Massenverbrechen speiste und nicht zuletzt Angsterwartungen entsprach – man hatte ein alliiertes Strafgericht zu fürchten -, ist schon vor Jahren quellengesättigt gründlich fachlich erarbeitet worden. Man sprach selten über die Massenverbrechen, kannte sie aber und die Führung nutzte die Angst vor Strafe, um zum Weitermachen zu motivieren. War erfolgreich, auch bei Schriftstellern, Künstlern und sonstigen Vertretern des Bildungsbürgertums als der frühen festen Basis der NSDAP und anderer völkischer Zusammenschlüsse, dem bei aller „Bodenständigkeit“ gewiss auch K. zuzurechnen ist.
Es heißt an einer anderen Stelle, der Leiter des Siegerlandmuseums habe sich bei Nazi-Instanzen für K. und gegen ein Berufsverbot eingesetzt. Mag sein oder auch nicht. Belege für diesen Vorgang gibt es, wenn ich richtig sehe, bislang keine. Dass aber der Museumsleiter auf etwaige Gegner von K. Einfluss hätte ausüben können oder Einfluss ausübte, ist plausibel, denn auch dieser Heimatakteur war wie K. oder noch darüber hinaus dem NS eng verbunden (http://akteureundtaeterimnsinsiegenundwittgenstein.blogsport.de/a-bis-z/gesamtverzeichnis/#kruse3).
„Heimat“ gilt als etwas besonders Schönes und Wertvolles. Aber man sollte sie m. E. nicht überzuckern. Die Heimatszene jedenfalls des 20. Jahrhunderts war auch im Siegerland ein Sumpf. Mindestens dafür steht auch Kuhmichel.
Zur Verleihung des „Rubenspreis“ 1941 ergaben Recherchen des Siegener Stadtarchivs: “ ….Die Stadt Siegen veranstaltete am 12. und 13. Juli 1941 eine Rubens-Gedenkfeier, die allerdings im zeitgenössischen Stil politisch gefärbt war. Es fand eine Ausstellung mit Werken von Rubens und anderen zeitgenössischen Künstlern im Siegerlandmuseum statt. Zudem empfing die Stadt Siegen eine Delegation aus Antwerpen, der auch drei Mitglieder des „flandrischen Kulturrats“ angehörten. Es handelte sich um einen Gegenbesuch, nachdem im Vorjahr eine Siegener Delegation zu einer Rubens-Gedenkveranstaltung nach Antwerpen gereist war.
Des Weiteren wurde vor dem Hintergrund des Rubens-Gedenkens eine mit 2.000 RM dotierte Rubens-Stiftung (an einer Stelle in den Akten auch als Rubenspreis bezeichnet) gestiftet. Die Mittel sollten alle zwei Jahre zum Ankauf von Werken der bildenden Kunst von Künstlern des westfälisch – rniederrheinisch – niederländisch-flämsichen Kulturkreises eingesetzt werden. 1941 wurde Hermann Kuhmichel als erster Künstler mit der Rubens-Stiftung bedacht. Er schuf nämlich eine Rubensbüste, die von der Stadt Siegen erworben wurde. ….“ Quellen: Siegener Zeitung vom 14.07.1941 und der Verwaltungsakten.
Übrigens, Kuhmichel hat sich selbst ebenfalls zum „Rubenspreis“ geäußert. Dazu werfe amn einen Blick in die hier bereits erwähnte Publikation Henrichs.
Das mehrfach erwähnte Buch von Frieder Henrich ist für die hier aufgeworfene Thematik eher unergiebig. Die abgedruckten Auszüge aus Kuhmichels Briefen (1941-44) nehmen nur ca. 3 Seiten ein. Zur konkreten Frage: Das Wort „Schlamassel“ benutzte er am 18.7.1941: „Meine Gedanken sind … bei Ihnen [Alfred Henrich an der Ostfront] und allen Freunden u. Bekannten, die in dem Schlamassel drinstecken.“ Dann am 13.6.1942: „So langsam ist uns hier klar geworden, was wirklich in Russland vor sich geht u. wie ungeheuer die Leistung der Front gewesen ist.“ Am 14.10.1944 aus Gotha von der Flak-Ausbildung: „Diese verspätete Rekrutenzeit geht auch vorüber, ich sehne mich nach frischer Luft u. nach einem einzigen anständigen Kerl, mit dem ein Wort zu reden ist. Das Verhängnis kettet mich nun schon fast ein Jahr an Menschen, mit denen mich nichts verbindet als die schlechte Luft, die ich mit ihnen teilen muß. Na, es wird mal wieder anders kommen.“ Frustration über den Kriegsverlauf und die persönlichen Beschwernisse: Sicher. Verzweiflung über den Krieg an sich oder pazifistische Gedanken würde ich in die sehr wenigen vorliegenden Dokumente dagegen nicht hineininterpretieren. Wie repräsentativ die sind, lässt sich natürlich ohne Kenntnis des „Privatarchivs Henrich“ und vielleicht noch anderer unveröffentlichter Sammlungen nicht sagen.
Zum Rubenspreis: „Inzwischen habe ich von der Stadt Siegen den sogenannten Rubenspreis bekommen. Samstag-Sonntag war hier eine ansehnliche Rubensfeier, die Antwerpener Militär- u. Civilverwaltung war hier u. mannhafte Flamen haben viel geredet. Ich kann mir denken, daß es der Stadtverwaltung große Überwindung gekostet hat, mich danach auszuzeichnen. Die Siegener Künstlerschaft fühlt sich, wie immer, zurückgesetzt und da ist auch nicht einer, der ein frdl. Wort an mich gerichtet hat, im Gegenteil, man hetzt u. verleumdet aufs Neue. Wäre ich doch nur aus diesem Kreis heraus!“ Zur Preisverleihung müsste sich eigentlich im Siegener Stadtarchiv Material finden lassen.
Auch bemerkenswert: „Mein Widersacher, der Oberbürgermeister, hat sich ein Loch in den Bauch geschossen u. wird mir fernerhin kein Leid mehr zufügen.“ (13.6.1942. Alfred Fissmer kehrte allerdings nach dem Suizidversuch und vorübergehender Beurlaubung in sein Amt zurück.) Wenn ausgerechnet Kuhmichel für die von seinem Widersacher so heiß geliebten Kasernen mit der „Kunst am Bau“ beauftragt worden war, wären natürlich die Hintergründe interessant. Vielleicht können die umfangreichen Kasernen-Bauakten im Stadtarchiv Hinweise darauf liefern. (OB Fissmer war von der Wehrmacht als Kommissar für die örtliche Aufrüstung eingesetzt worden, deshalb das viele militärbezogene Material im kommunalen Archivbestand. Das erklärt übrigens auch seine Aktivitäten außerhalb der Stadtgrenzen – v.a. in den Ämtern Weidenau und Freudenberg – zu denen er als Siegener OB nicht legitimiert gewesen wäre.)
Kleiner Nachtrag zum Rubenspreis: In der österreichischen Zeitschrift „Die Bühne“ Heft 16 (1941) S. 12, findet sich folgende Notiz zu den Rubensfeierlichkeiten in Siegen: „Aus Anlaß der Rubens-Feier der Geburtsstadt Geburtsstadt Siegen findet im Museum des Siegerlandes in Siegen eine Gedächtnisausstellung mit Rubens-Stichen, Handzeichnungen flämischer Künstler aus der Rubens-Zeit, Holzschnitten, Schabblättern und Dokumenten zum „Fall Rubens“ statt. In der ausliegenden Rubens-Literatur finden die Schriften des holländischen Archivars Bakhuizen van
den Brink, die die Erkenntnis, daß Siegen die Geburtsstadt Rubens ist, ans Licht gefördert haben, besondere Beachtung. Die eigene Sammlung von Rubens- Stichen konnte das Siegerländer Heimatmuseum durch wertvolle Neuanschaffungen bereichern. Weiter erwarb das Museum eine Rubens-Büste des Bildhauers Hermann Kuhmichel, von der die Lauchhammer-Werke einen Eisenguß angefertigt haben…..“
Nach dem Erscheinen der Broschüre „Kanonen und Kuhmchel“ wandte sich Julius Kuhmichel, der Sohn Hermann Kuhmichels, am 28.10.1985 an die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Siegerland. Der Brief enthält u.a. eine von Julius Kuhmichel erstellte Chronik der Jahre 1930 bis 1956, für diese hatte er Tagebuch(!)aufzeichnungen und Zeitzeugenberichte verwendet. Mit dieser Zusammenstellung wollte er die deutliche Kritik an Kuhmichels Wirken während der NS-Zeit entkräften. Das Schreiben befindet sich mittlerweile im Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein unter der Signatur 3.19. (Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Siegerland) Nr. 76 . Die Chronik kann nun hier eingesehen werden: Chronik
Dank an die CJZ für die Genehmigung!
Dank an das Stadtarchiv für die Zusammenstellung einiger interessanter Angaben zu dieser „Rubens-Gedenkfeier“.
Dort wird der „flandrische Kulturrat“ genannt, der 1941 zur Rubens-Ausstellung, zur Begründung einer Rubens-Stiftung/eines Rubens-Preises und zur Präsentation von Kuhmichels Rubens-Büste eingeladen und in Siegen vertreten war. Dazu ein paar Sätze.
Der, wie er hieß, „flämische Kulturrat“ war ein von den NS-Besatzern Belgiens geschaffenes „Lenkungsorgan“ für die „Verflamung bzw. Germanisierung“ Flanderns und bestand aus besatzungsfreundlichen Personen aus Kultur, Wirtschaft und Politik. Insofern wäre es interessant, einmal die Namen der drei Delegationsmitglieder zu erfahren. An der Spitze des Kulturrats stand der Dichter und Feingeist Cyriel Verschaeve, dessen Nachfolger im Jahr darauf Antoon Jacob wurde. Sie beide waren germanophile militante „flamingants“, also niederländisch-niederdeutsche Völkische. Wegen Kollaboration wurde Jacob, der 1944 Mitglied einer flämischen „Exilregierung“ in Norddeutschland war, nach dem Ende der Besatzung festgenommen und inhaftiert, während Verschaeve zum Tode verurteilt wurde. Er hat freilich nach Österreich fliehen können. Später wurde er zu einem Helden und Idol des Vlaamse Militanten Orde, der 1983 verboten wurde. Dieser Zusammenschluss ist besonders durch eine Serie vor wie nach dem Verbot begangener z. T. mörderischer Attentate auf Migranten und Linke bekannt.
Der Siegen-Besuch aus Flandern folgte einem Siegener Besuch zu einer „Rubens-Gedenkveranstaltung“ im Jahr zuvor in Antwerpen. Das dürfte die Verleihung des Rembrandt-Preises an Hendrik/Henry Luyten 1940 in Antwerpen aus Anlass des 300. Todestages von Peter Paul Rubens gewesen sein, getragen von der deutschen Militärverwaltung, der Hansischen Stiftung und DeVlag. Die Hansische Stiftung war eine Schöpfung des Propagandaministeriums, der Volksdeutschen Mittelstelle, von Hans Friedrich Blunck u. a. NS-Instanzen. 1941 ging der Preis an Raf Verhulst, „Dichter und Volkstumsaktivist“, der bereits im Ersten Weltkrieg als Kollaborateur zum Tode verurteilt worden war. Jede Preisvergabe, ob Rembrandt oder Rubens oder sonst wer, war an eine Genehmigung durch das Propagandaministerium gebunden.
„DeVlag“ war die Deutsch-Flämische Arbeitsgemeinschaft, gegründet von dem im Siegerland wohlbekannten NS-Kulturfunktionär Franz Petri (http://akteureundtaeterimnsinsiegenundwittgenstein.blogsport.de/verzeichnis/gesamtverzeichnis/#petri2), einem „Organisator der flämischen Kollaborationsbewegung“, dem das „germanisches Volkserbe in Wallonien und Nordfrankreich“ wichtig war und der gerne Belgien als „deutsche Westmark“ statt als „französische Ostmark“ gesehen hätte.
Nein, um Kuhmichel ging es jetzt nur am Rande, schon aber auch um das Beziehungsgeflecht, das existierte und in dem er, ob etwa am Rande oder anders positioniert, sich bewegte und das bei allen internen Differenzen, die es wie überall auch hier gab, durch und durch nazistisch war. Dass die internen Meinungsunterschiede nach dem NS-Ende genutzt werden konnten und fleißig genutzt wurden, sich zu einem NS-Gegner oder gar -Verfolgten zu machen, Biografien umzuarbeiten und zu glätten, soll nicht weiter erstaunen. Es war das Übliche und sicher in vielen Fällen erforderlich, um möglichst ungestört weitermachen zu können. Es ist schon bemerkenswert, wie wenig Eingeständnisse, etwas falsch gemacht zu haben, aus dieser ja flächendeckend dichten NS-Bevölkerung anschließend und über Jahrzehnte hinweg zu hören waren und wie hoch der Anteil der nun plötzlich als NS-Gegner Auftretenden war, die niemand vorher je in dieser Rolle gekannt hatte und die, wenn es sie gegeben hätte, tatsächlich das System hätten gefährden müssen. Wovon die Forschung nicht ausgeht, wenn sie von einer „Konsensdiktatur“ spricht.
(zum Nachlesen: Burkhard Dietz, Ulrich Tiedau, Helmut Gabel (Hrsg.), Griff nach dem Westen, Teilband II, Münster 2003)
„Die drei Delegationsmitglieder“ werden in einer kurzen Meldung über die Rubensfeier in der „Deutschen Zeitung in den Niederlanden“ (Nr. 32 v. 6.7.1941) genannt:
Robert van Roosbroeck, Oscar Dambre und Achiel Stubbe (Vornamen von mir nach ein bißchen Googelei ergänzt). Jeder war mit einem Vortrag angekündigt. (Das nur spontan und in Eile. Gründlichere Recherchen überlasse ich dem Rest der Menschheit. Wenigstens bei Roosbroeck dürfte es sich lohnen.)
Nun doch noch eine Ergänzung.
Das in New York erschienene Journal „News from Belgium“ druckte in seiner Ausgabe Nr. 19 vom 9.8.1941 (in engl. Übersetzung) einen Artikel aus der Kölnischen Zeitung vom 14.7.41 ab, in dem außer den drei oben genannten „Gelehrten“ noch andere Delegierte des „Rubens festival at Siegen“ aufgeführt wurden:
Leo Delwaide, Bürgermeister von Antwerpen; Jan Grauls, Gouverneur der Provinz Antwerpen; „certain military authorities of Belgium“, unter ihnen „Kriegsverwaltungschef Dr. Delius“. Bei letzterem handelte es sich um den in Siegen geborenen Walter D., Sohn des Siegener OB Anton D., Anfang der 1940er Jahre Stadtkommissar bei der deutschen Militärverwaltung in Antwerpen.
Leon Delwaide war der von den Besatzern eingesetzte OB von Antwerpen, ein Politiker einer katholisch-flämischer Partei, sowohl glaubensfester Katholik als auch zutiefst überzeugter Antisemit. Er wird in der belgischen Zeitgeschichtsschreibung für die Deportation von mehr als 3.000 jüdischen Antwerpenern mitverantwortlich gemacht. Es ist jener Delwaide, der nach den Aufzeichnungen des Sohns Kuhmichel 1936 in dessen Atelier besuchte. Dort dürfte er dann sowohl dessen christliche als auch dessen Nazi-Werke kennengelernt haben.
Es ist an dieser Stelle Anlass, auf die mit zahllosen Biografien belegbare Tatsache zu verweisen, dass Christlichkeit und Nazigläubigkeit sich überhaupt nicht ausschließen mussten. Bekanntlich war der heutige Kreis S/W auch deshalb eine Nazi- Hochburg, weil er eine protestantische Hochburg war. Delwaide aber zeigt an, dass schon bald auch die andere große Konfession angefressen war.
Nach dem NS-Ende wurde im Zuge der Entnazifizierung der Mythos aufgebaut, bürgerliche Christlichkeit habe gg. Nazitum geradezu immunisiert. Auch Kuhmichel bediente sich dieses Mythos. Wie zu sehen, entfaltet er immer noch einen Nutzen.
Literatur:
Werner Grebe: Die Obernau-Talsperre, in: Hermann Böttger: Geschichte des
Netpherlandes, Selbstverlag des Amtes Netphen, 1967, S. 463-465
Günter Klingbeil: Die Obernau-Talsperre,: in Die Wasserwirtschaft, 60. Jg.
6/1970, 6 S.
Bitte hier denName korrigieren:
Günter Klingebiel nicht Klingbeil.
Dipl.-Ing. Günter Klingebiel war von 1981 bis 1994 Geschäftsführer des Wasserverbandes Siegen-Wittgenstein
Im Bestand „Kreis Siegen, Landratsamt“ befinden sich unter der Nummer 2301 Anträge zur Verleihung des Ehrenkreuzes für Frontkämpfer im ersten Weltkriegs. Dort ist auch ein Antrag von Otto Krasa zu finden, der u. a. Aussagen über die Einsatzgebiete Krasas macht (z. B. von Januar 1915 bis April 1915 in den Karpaten) und über die militärischen Auszeichnungen: Eisernes Kreuz II. Klasse. 1935 hat Krasa das Ehrenkreuz erhalten
Im Bestand „Kreis Siegen, Landratsamt“ befinden sich unter der Nummer 2258 Anträge zur Verleihung des Ehrenkreuzes für Kriegsteilnehmer im ersten Weltkriegs. Antrag Kloths konnte dort nicht gefunden werden. Ob er einen Antrag auf Verleihung des Ehrenkreuzes für Frontkämpfer im ersten Weltkriegs gestellt hat, müsste noch überprüft werden (Nr. 2395).
Im Bestand „Kreis Siegen, Landratsamt“ befinden sich unter der Nummer 2258 Anträge zur Verleihung des Ehrenkreuzes für Kriegsteilnehmer im ersten Weltkriegs und unter der Nummer 2301 Anträge zur Verleihung des Ehrenkreuzes für Frontkämpfer im ersten Weltkriegs. Diese Ehrenkreuze wurden 1934 und 1935 verliehen. Anträge Kuhmichels liessen sich nicht ermitteln.
Franz Klemens Gieseking schreibt in seinem Artikel: „Westfälische Kunst der Gegenwart. Ein Nachwort zur Großen Westfälischen Kunstausstellung in Dortmund“ in „Heimat und Reich“ Jg. 1935, H. 11, S. 433-438 folgendes zu Kuhmichel: “ …. Überhaupt waren in dieser Ausstellung die Bildhauer zwar nicht zahlreich, aber leistungsmäßig ausgezeichnet und mit ausgeprägten Eigenarten vertreten. Von Hermann Kuhmichels gehaltvoller und überaus gekonnter Gruppenplastik „Liebespaar“ , einer der besten Arbeiten der ganzen Ausstellung, ……“ (zitiert nach: Walter Gödden (Hg.): Westfälische Literatur im Dritten Reich. Die Zeitschrift „Heimat und Reich“. Eine Dokumentation. Teil 1: 1934 – 1937, Bielefeld 2012, S, 198)
2. Diskussionsbeitrag von Dr. Ingrid Leopold:
„Dem Archivar möchte ich meinen Dank aussprechen für Veröffentlichung des Briefes, den Julius Kuhmichel im Oktober 1985 als Reaktion auf das Erscheinen der Broschüre „Kanonen und Kuhmichel“ an die Gesellschaft für christlich – jüdische Zusammenarbeit verschickte.
Die Chronik, bestehend aus Tagebuchaufzeichnungen und Zeitzeugenberichten aus den Jahren 1930 bis 1956, enthält Daten und Fakten aus dem Leben des Künstlers, die betroffen machen.
Hermann Kuhmichel war in der Nazizeit Repressalien und Bedrohungen ausgesetzt, die seine und die Existenz der Familie gefährdeten.
Kontakte zu „ Volksfeinden“ brachten ihn in große Schwierigkeiten.
Da war der Nachbar, ein „Kommunist“, dem er zur Hilfe kam, – der „britische Imperialist“, der einen Holzschnitt – Zyklus von ihm erworben hatte,
oder der bekannte „sowjetische Schriftsteller Maxim Gorki“, mit dem er seit einem gemeinsamen Aufenthalt in der Lungenheilstätte St. Blasien 1927 einen Briefwechsel pflegte.
Mit seinen Plastiken und Holzschnitten zu alttestamentarischen Themen verherrlichte er „das Weltjudentum.“
Angedrohte Strafmaßnahmen wie „Ausstellungs – und Schaffensverbot“ oder „Einsatz in einem Strafbataillon an der Ostfront“ konnten durch Einwirkung einflussreicher Freunde abgewendet werden. Sie rieten ihm, sich vorsichtig zu verhalten, und bei seinem künstlerischen Schaffen das Kunstverständnis der damaligen Zeit zu berücksichtigen und sich anzupassen.
So kamen die Monumentalplastiken bei der Ausgestaltung öffentlicher Bauten zustande.
Bei den Entnazifizierungsmaßnahmen nach dem Krieg wurde Hermann Kuhmichel im März 1948 als „Entlasteter“ eingestuft.
Im Oktober 1985 wurde er im Siegerland als „Nazi“ an den Pranger gestellt.
In der aktuellen Diskussion wird dem Künstler unter anderem vorgeworfen, er habe sich in der Nachkriegszeit nie für seine Mittäterschaft im Dritten Reich entschuldigt.
Ich frage: „Wofür sollte er sich entschuldigen?“
Aus meiner Sicht war es Aufgabe und Pflicht der Gegenpartei, – der Kritiker, -nach Kenntnisnahme der Chronik aus dem Leben Kuhmichels die Verleumdungen einzustellen und eine Entschuldigung auszusprechen. Bis heute ist nichts dergleichen erfolgt. „
Zwischen 1) Biographieforschung im engeren Sinne (Frau Fries, Frau Dr. Leopold u.a.) und 2) Rezeptionsforschung (hier v.a. U.F.O.) sollte sorgfältig unterschieden werden. Beide Ansätze verfolgen unterschiedliche Fragen, deren Vermengung leicht zu vermeidbaren Frustrationen führt.
1a) War H.K. Nationalsozialist? Nein.
2a) Wurde H.K. von den nationalsozialistischen Machthabern vereinnahmt? Ja.
1b) Warum hat er das zugelassen? Materielle Notlage, Sorge um seine Familie, als sozialer Außenseiter ein leichtes Opfer für Erpressung …
2b) Spricht ihn das von seiner Verantwortung als Künstler frei? Nein, denn für die Wahrnehmung von Kunst im öffentlichen Raum spielt die persönliche Tragik des Künstlers keine Rolle. Ob z.B. ein Kriegerdenkmal freiwillig von einem glühenden Militaristen oder im gleichen Stil unter Zwang von einem heimlichen Pazifisten geschaffen wurde, ist für die Betrachter gleichgültig; sie sehen darin ein „Vorbild“ des propagierten Zeitgeistes und werden davon ggf. in dessen Sinne beeinflusst.
1c) Wie stand H.K. nach 1945 zu seiner vorangegangenen Schaffensphase? Vielleicht wird sich das aus den Lebensdokumenten nie erschließen; vielleicht gab es im engsten privaten Kreis Bekundungen von Scham und Reue; vielleicht war es ihm einfach zu peinlich, öffentlich dazu Stellung zu nehmen; vielleicht war ihm die öffentliche Wahrnehmung seiner Person egal … — manches ist denkbar.
2c) Eignet sich der ambivalente H.K. nach 1945 als Vorbild? Sicher nicht — was aber zu der allgemeineren Frage führt, warum „prominente“ Menschen, die ebenso widerspruchsvoll sind wie jeder „Namenlsose“, überhaupt als Vorbilder in Anspruch genommen werden sollen. H.K. stand, wenn ich mich recht erinnere, vor einigen Jahren auf der Kandidatenliste für die Wahl des „größten Siegerländers aller Zeiten“ (oder der letzten 200 Jahre). Solche an den Heroenkult vergangener Epochen erinnernde Veranstaltungen scheinen mir wenig hilfreich für die Schärfung des historischen Blicks zu sein.
Danke für den Beitrag! Ein kleine Richtigstellung sei aber erlaubt: Hermann Kuhmichel stand nicht auf der Kandidatenliste der „20 Größten“ anlässlich des 200jährigen Jubiläums des Kreis Siegen-Wittgenstein.
Alles gut. Ich habe selber zur Vorsicht einmal nachgesehen. Es gab ja ein umfangreichere Liste, aus der die 20 Vorschläge ermittelt wurden. Übrigens wurde dieser längere Liste weiterbearbeitet, u.a. mit der Rubrik „Zwielicht“. Sie können sicher erraten, wer darin Platz gefunden hat. Ich meine berechtigterweise, wie die laufende Diskussion zeigt.
a) Kleiner Nachtrag zu dem belgischen Politiker Léon Delwaide, einem katholischen Glaubensbruder, dem nach dem Manuskript des Kuhmichel-Sohns der Künstler seinen Auftrag zu einer Rubens-Büste zu verdanken hatte und den er schon 1936 kennenlernte:
„We believe that Leon Delwaide carried the responsibility for the arrest, the deportation, and the death of more than 3.600 Jews from Antwerp. (Sylvain Brachfeld, A gift of life. The deportation and the rescue of the Jews in occupied Belgium (1940-1944), Jerusalem 2007, S. 31
Delwaide: „a blatant antisemite and xenophobe before the war and who became the mayor of Antwerp during the occupation (David Bankier, Israel Gutman (Hrsg.), Nazi Europe and the Final Solution, Jerusalem 2009, S. 486)
b) Ob Rubens-Büste, Ehrenbriefkassette, die verschiedenen Soldaten-/Offiziersdarstellungen oder später die Ausschauende oder „Das Wirtschaftswunder: Was K. mit „entarteter Kunst“ zu tun gehabt haben könnte, ist einfach unbegreiflich. Seine bislang öffentlich bekannten Kunstwerke sind ausnahmslos von einer derart biederen und für einen Künstler derart durchschnittlichen und unauffälligen, geradezu antimodernen Machart, dass auf diese Idee selbst der bösartigste völkische Kritiker unmöglich kommen kann. Wie sich das zusammenreimen könnte, ist absolut rätselhaft.
Habe beim aufräumen ein ca. 70 Jahre altes kleines Ölgemälde
ca 50 x 60 cm. gefunden. Es handelt sich um ein Ölgemälde auf Holzfaser-
platte. Meines Erachtens handelt es sich hier um spanische Tänzerinnen.
Ich bin kein Fachmann, trotzdem finde ich das Gemälde als typischen
Helsper. ( ist signiert)
Persönlich habe ich Walter sehr gut gekannt.
Da das Bild meiner Meinung nach schützenswert ist, wüsste ich gerne,
wie ich weiter verfahren soll. Ich bin gerne bereit, das Gemälde
in die richtige Hand ( evtl. Frau Jasper ) abzugeben.
Das erste hab ich mal hierhin rübergesetzt und es ergänzt, um die Lesefreundlichkeit und den Informationsgehalt zu verbessern. Mir ging es um die Frage, in welchem Milieu man sich bewegte, wenn man von flämischen oder deutschen völkischen Heimatenthusiasten umgeben war:
a) Nachtrag zu dem belgischen Politiker [Dr.] Léon Delwaide, einem katholischen Glaubensbruder, dem nach dem Manuskript des Kuhmichel-Sohns der Künstler seinen Auftrag zu einer Rubens-Büste zu verdanken hatte und den er schon 1936 kennenlernte:
“We believe that Leon Delwaide carried the responsibility for the arrest, the deportation, and the death of more than 3.600 Jews from Antwerp. (Sylvain Brachfeld, A gift of life. The deportation and the rescue of the Jews in occupied Belgium (1940-1944), Jerusalem 2007, S. 31
Delwaide: “a blatant antisemite and xenophobe before the war and who became the mayor of Antwerp during the occupation (David Bankier, Israel Gutman (Hrsg.), Nazi Europe and the Final Solution, Jerusalem 2009, S. 486)
b) Dr. Robert van Roosbroeck arbeitete seit 1933 bei der Zeitung und gehörte zu jenen Mitarbeitern der Tageszeitung De Schelde, die dort eine prodeutsche Positionierung durchsetzten. Er trat dem völkischen Vlaamsch Nationaal Verbond bei und nahm Teil an den Aktivitäten von DeVlag (s. o). Nach der NS-Besetzung wurde er Leiter des Amts für Erziehung von DeVlag. Wie schon im Ersten Weltkrieg kollaborierte er mit der Besaatzungsmacht. 1940 tratt er der Allgemeinen SS Flandern bei und wurde Leiter des Nederlandsche Kultuurraad. 1942 wurde er unter Delwaide Beigeordneter für das Unterrichtswesen in Groß-Antwerpen und erhielt eine Hochschullehrerstelle. 1944 flüchtete er nach Deutschland und wurde Mitglied einer dort befindlichen flämischen „Exil-Regierung“.
Nach dem NS-Ende tauchte er in Antwerpen unter. In Abwesenheit wurde er zum Tode verurteilt und verschwand in die Niederlande. Da die westliche Politik bewährte Antikommunisten gut brauchen konnte, konnte er sich ab 1954 frei bewegen, ab 1970 auch in Belgien und unter zahlreichen Pseudonymen weiterhin Flämisch-Völkisches publizieren. (Armand van Nimmen, Rob Van Roosbroeck en tijdgenoten, Gent 2014)
c) Die westfälische Zeitschrift „Heimat und Reich erschien zwischen 1934 und 1943. Schriftleiter war Josef Bergenthal, Parteigenosse und SA-Mitglied, etwas später auch Landesleiter der Reichsschrifttumskammer. Herausgeber war der Siegerländer Altnazi und Landeshauptmann Karl-Friedrich Kolbow (http://akteureundtaeterimnsinsiegenundwittgenstein.blogsport.de/verzeichnis/gesamtverzeichnis/#kolbow). Das abgebildete Inhaltsverzeichnis sagt genug. Es nennt die Prominenz der westfälischen Heimat- und Nazi-Literatur (Westfälische Literatur im „Dritten Reich“, Die Zeitschrift Heimat und Reich. Eine Dokumentation. Herausgegeben und bearbeitet von Walter Gödden (Veröffentlichungen der Literaturkommission für Westfalen, Bd. 51, Bielefeld 2012)
Im Anschluss an http://www.siwiarchiv.de/rubensfeiern-in-antwerpen-1940-und-siegen-1941/#more-21736
das Fazit gerne hier:
Die Heimatszene, in der Kuhmichel sich bewegte, arbeitete und erfolgreich war, war offen, nicht für „entartete Kunst“, sondern für völkisch-heimatliche, die den völkischen Zusammenhalt stärkte. In Westfalen, dem das Siegerland bekanntlich entgegen seiner Geschichte zugeschlagen wurde, wie in Flandern. Sie war bei Licht betrachtet allerdings ein Sumpf. Die umfangreiche öffentlich bekannte NS-Produktion von Kuhmichel, die nach Aussagen Jahrzehnte später angeblich das „Verhungern“ der Familie verhindern sollte, belegt das.
Hallo, zum Artikel über Dipl.Ing. Hermann Reuss: es befindet sich ein Gedichtband von ihm bei mir, von 1925. Bitte nehmen Sie Kontakt auf, mit freundlichem Gruß G. A.
Hallo Herr Opfermann, danke für den Hinweis. Wir haben wirklich umfassend recherchiert, viele weitere Quellen erschlossen und genutzt, aber Ihr Buch „Heimat-Fremde“ ist nach wie vor grundlegend- und im Programm und auf den Plakaten wird ihre Arbeit als Quelle und Inspiration genannt.
In der Ankündigung der Veranstaltung war es uns wichtig, das – wovon ich ausgehe- gemeinsame Anliegen ins Zentrum zu rücken. Wir hätten sonst auch noch weitere Namen nennen müssen, denen wir viel verdanken. Daher bitte ich Sie um Verständnis, dass wir eine Anleihe beim Titel Ihrer Monografie gemacht haben. Die Jugendlichen lesen nicht aus Büchern – sie haben sich aus den Materialien eigene Texte entwickelt, die ausdrücklich nicht dokumentarischen Anspruch erheben. Ich freue mich über einen Austausch!
Danke für die weiteren Informationen zur Veranstaltung! Wer die Auseinandersetzungen des „Jungen Theaters Siegen“ mit zeithistorischen Themen kennt, weiß deren Durchdringung des jeweiligen Themas zu schätzen.
Ich sag’s auch deshalb, weil es seit einiger Zeit immer wieder Anlässe gibt,sich zu fragen, was man da eigentlich die ganzen Jahrzehnte, die es inzwischen sind, gemacht hat.
Hallo Herr Opfermann, habe ihr Buch „Heimat Fremde“ gelesen. Was mich wundert ist, dass eine Aufarbeitung der Zwangsarbeit nach dem Krieg nie richtig stattgefunden hat. Wenn ein Bernhard Weiss, ein verurteilter Kriegsbrecher, Präsident der IHK Siegen für 20 Jahre war, und noch heute ein Platz in Dahlbruch nach ihm benannt ist. Dann kann man das nur durch Wegschauen erklären. Kann man Sie irgendwie kontaktieren?
Aber um kurz auch in der kleinen Öffentlichkeit, die sich hier vorfindet, auf die inhaltliche Seite Ihrer Frage einzugehen: Die Zahl der verurteilten und insbesondere der unverurteilt gebliebenen Menschheits- und Kriegsverbrecher in Westdeutschland ist Legion gewesen (Lesetip etwa nur einmal Norbert Freis „Vergangenheitspolitik“ von 1999). Die juristischen Weichen waren nach einer kurzen Schockphase so gestellt, dass die Herrschaften unbehelligt an die Schreibtische, um die es hier vor allem geht, wieder zurückkehren oder das Ruhegeld in Empfang nehmen konnten. Das sollte so sein, weil man bewährte Antikommunisten in leitender Funktion unbedingt brauchte. Dem Schweigen über deren Untaten entsprach das Schweigen der Schulen und weiter Teile der Medien über die Verbrechen in den Nazijahren. Wo und wie hätten Menschen sich schlau machen können, ohne in den schlimmen Verdacht zu kommen, „Parteigänger Ulbrichts“ zu sein, der existenzgefährend sein konnte?
Nur zwei konkrete Beispiele:
a) Die kleine mit schlichtesten Mitteln zusammengestellte Wanderausstellung „Ungesühnte Nazijustiz“ (1959-1952), die in den Niederlanden und Großbritannien ein großer Erfolg war und viel Lob erhielt, wurde hier als ein Werk von Anhängern „Pankows“ (= „Ostzone“) verrissen. Die SPD-Studenten, die sie erarbeitet hatten, wurden von ihrer Partei ausgeschlossen.
b) Der Film „Das Mädchen Rosemarie“ enthielt eine wenige Minuten andauernde Szene, in der mit vergangenheitspolitischem Bezug zur neuen Bundeswehr Mario Adorf und ein zweiter Schauspieler „Wir hamm‘ den Kanal noch immer nicht voll“ sangen. Die Szene musste entfernt werden.
c) Es gab einen Prozess zum „Zigeuner-Komplex“, sprich zu den Verbrechen an der Roma-Minderheit. Mehr als 70 Beschuldigte. Niemand wurde verurteilt. Es gab einen Angeklagten, den vormaligen Kripochef der Bundeshauptstadt Bonn. Er wurde wg. „Verhandlungsfähigkeit“ aus dem Verfahren entlassen. Der „fröhliche Rheinländer“, verantwortlich für eine große Zahl von Auschwitz-Einweisungen, hatte sich in diesen Zustand gesoffen. Alkoholabusus. Einer aus der Spitze der Bonner Gesellschaft.
Nein, „der“ Bevölkerung den Vorwurf machen zu wollen, sie sei der unmoralische Teil gewesen, sie sei nach wie vor eine Nazi-Bevölkerung geblieben, das finde ich völlig unangebracht. Die politische Führung organisierte die Unwissenheit ihres Wahlvolks, deren Verdummung durch Unterlassen von Information und durch die Verbreitung von Mythen. Dabei hatte sie eifrige Helfer in allen Führungsgruppen, keinesfalls nur in der Wirtschaft, wie man in Betrachtung des Bernhard Weiss vielleicht meinen könnte.
Ulrich Opfermann
HeimatFremde
„Ausländereinsatz“ im Siegerland, 1939 bis 1945:
wie er ablief und was ihm vorausging.
Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung Bd. III
Herausgegeben vom Förderverein „Geschichte der Arbeiterbewegung und der Gewerkschaften für den Kreis Siegen-Wittgenstein“ e.V.
Hell&Dunkel Verlag, Siegen 1991
ISBN 3-928347-00-4
Mit 5 Silbergroschen (oder doch Schokogroschen?) war diese Spendengala auch nicht ganz billig, oder? 30 preußische Silbergroschen = 1 Taler steht zumindest bei Wikipedia
Danke für den Hinweis! Im Wiki der Computergenealogen finden sich einige Hinweise zum konkreten Werte:
„… Einkommensbeispiele
Um 1850 Wochenlohn eines Baumwoll- und Leinenwebers: 2 Taler, 3 Silbergroschen
Um 1850 Tageslohn einer Strickerin oder Weißnäherin in Berlin: 4 Silbergroschen
….
Beispiele von Lebenshaltungskosten
Um 1850 Wochenkosten eines 5 Personenhaushaltes: 3 ½ Taler
Um 1850 mittlere Miete: 20 Groschen, 20 Pfennig
Um 1850 3 ½ Pfund Fleisch: 12 Groschen, 3 Pfennig
Um 1850 3 Schwarzbrote: 10 Groschen, 6 Pfennig
Um 1850 6 Becher Kartoffeln: 11 Groschen
Um 1850 1 ½ Pfund Butter: 9 Groschen
Um 1850 3/4 Pfund Kaffee: 5 Groschen
Um 1850 Drei Pfund Mehl: 3 Groschen 6 Pfennig
Um 1850 Heizkosten: 5 Groschen
Um 1850 2 Portionen Gemüse: 3 Groschen
Um 1850 Fett: 3 Groschen
Um 1850 Reis: 1 Groschen, 6 Pfennig
Um 1850 Milch: 2 Groschen, 6 Pfennig
Um 1850 Bier: 1 Groschen, 6 Pfennig
Um 1850 Seife: 2 Groschen
Um 1850 Schulgeld: 4 Groschen …“
Vielleicht war das ein besonderer Weihnachtsbaum von dem Gasthof oder der Baum, der in der Stadt aufgestellt war. Nach Weihnachten wurde er in seiner eigentlichen Funktion ja nicht mehr gebraucht, aber das Holz war ja noch von Nutzen!
Ich vermute einfach mal, dass die Angabe „Verlosung des Baumes“ hier irreführend ist. Die traditionsreichen Weihnachtsbaumverlosungen waren Veranstaltungen, bei denen rund um den Baum drapierte oder daran gehängte viele kleine Gaben (Spenden) verlost wurden. Bei so großen Gruppen, wie sie eine Gastwirtschaft fassen konnte, kam da schon einiges an Teilnahmegebühren „zum Besten der Armen“ zusammen. Den Baum selbst wird im vorliegenden Fall wahrscheinlich Gastwirt Wolschendorff beschafft und nach Weihnachten verheizt oder frierenden Nachbarn überlassen haben. Von den eher gut betuchten Gästen, die sich bei der Verlosung die Ehre gaben, war aber sicher keiner auf das bisschen Holz angewiesen.
Heute habe ich mir die Kuhmichel Ausstellung in Freudenberg angesehen.
Das vielfältige künstlerische Schaffen von Kuhmichel wird durch die verschiedenen Exponate eindrucksvoll dargestellt und hat mich schon beeindruckt. Über den künstlerischen Gehalt lässt sich diskutieren, die Wahrnehmung von Kunst bleibt etwas Individuelles.
Neben den Exponaten der Ausstellung gab es viele Bilder von Kuhmichels
Kunst im öffentlichen Raum z. B. der Skulpturen in der Wenscht.
Es fehlten allerdings die Fotos seiner militärischen Figuren oder der von ihm gestalteten Ehrenbriefkassette von 1933. Die kurze Darstellung der Zeit von 1933 – 1945 auf dem ausliegenden Flyer reicht nicht aus, um die Rolle Kuhmichels in dieser Zeit ausreichend dar zu stellen. Die Zeitungsartikel zur Rubenspreisverleihung von 1941 sind leider ohne Kommentierung bezw. einer Einordnung in den hist. Kontext ausgelegt. Das ist so zu wenig.
Kuhmichel mag dem NS vielleicht abgelehnt haben, arrangiert hat er sich aber mit ihm. Bestimmt hätte er seine Familie mit anderen künstlerischen Tätigkeiten über Wasser halten können aber er ging den Pakt mit dem Teufel ein und hat geliefert wie gewünscht! Genau dieses Mitläufertum hat dem Faschismus Halt gegeben und seine Macht gefestigt, besonders wenn es sich um bekannte (hier regional bekannte) Personen handelte. Dazu bedurfte es keiner innerlichen Akzeptanz des NS oder einer Parteimitgliedschaft.
Leider kommt dies alles in der Ausstellung nicht vor und hier kann ich nur aus dem ersten Beitrag von Dr. Opfermann zitieren „…wird drei, vier Generationen später wieder von heimat- und bildungsbegeisterten Bürgern gefeiert. Als sei nichts geschehen.“ Liebe AusstellungsmacherInnen in Freundenberg ich schätze ihre Arbeit sehr, die Ausstellungen zu Adolf Sänger und Karl Jung-Dörfler haben mir sehr gut gefallen, aber so wie in dieser Ausstellung zu Kuhmichel geht es einfach nicht!
1. Danke für den Bericht über den Ausstellungsbesuch und die konstruktive Kritik.
2. Ich muss allerdings anmerken, dass auch Saenger ein – um Ton der Kuhmichel-Kritiker zu sprechen – Nazi-Künstler war. Auch Saenger hat Aufträge für NS-Ministerien in Berlin ausgeführt – s. a. http://akteureundtaeterimnsinsiegenundwittgenstein.blogsport.de/a-bis-z/gesamtverzeichnis/2/#saenger. Nicht das hier ein falscher Eindruck entsteht.
Liebe Kinder aufgepasst!
Da schauen wir mal hier nach:
Seit wann beschert in Wittgenstein das „Christkind“ zu
Weihnachten die Kinder?
Zeitschrift Wittgenstein, Jg. 86 (1998), Bd. 62, Heft 4, S. 154
Interessanter Hinweis. Wenn die dort aufgeführte Information die gesuchte Antwort ist, müsste aber die Frage präzisiert werden: „Spätestens seit wann …“ ist der Weihnachtsbrauch in Wittgenstein quellenmäßig nachweisbar? Das Christkind könnte ja schon vor dem genannten Jahr aktiv gewesen sein (vielleicht sogar im oben vermuteten „16. Jh.“, bald nach der Reformation), ohne dokumentierte Spuren hinterlassen zu haben.
Hier geht es aber nicht um Spekulationen ….., sondern um den Zeitpunkt, wo die Bescherung durch das Christkind in Wittgenstein quellenmäßig in Archiven belegt ist. Schließlich ist siwiarchiv ein Archivblog ;-) .
Die Kritik an der Fragestellung ist berechtigt. Aber die Fragestellung wurde aber der Einfachheit halber übernommen.
Die oben erwähnte Publikation „Hauberge im Siegerland“ erschien in „Heimat und Reich“, Jg. 17, 1935 Heft 2, S. 57 – 60.
Zu Otto Arnold s. a. Karl Heinz Gramss: Mit Gespür das Siegerland durchstreift. Otto Arnold – Ein Fotopionier zwischen den Weltkriegen, in: Siegerland, Band 62 Heft 3-4 / 1985, S. 66ff
Wenn es nicht im 16. Jh. und auch das 19. und 20. Jh. ausgeschlossen ist, kann es sich um das 17. oder 18. Jh. handeln. Ich denke mal noch früher könnte es ausgeschlossen sein.
Explizit ausgeschlossen habe ich das 19. Jahrhundert ja noch nicht, aber aufgrund des Kommentars von Kollegen Kunzmann, ist Ihre diesbezügliche Annahme wohl korrekt. Somit bleiben noch 200 Jahre übrig!
Nach einigem Nachlesen komme ich zu folgendem Schluss. Martin Luther hat im 16. Jh. angefangen das es ein Christkind ist. Also wird das Christkind im Wittgensteiner Land wahrscheinlich im 17. Jahrhundert das erste Mal erwähnt bzw. dokumentiert. Wenn das so auch nicht stimmt weis ich auch nicht weiter.
@ Anke Ermert: Ihre Vermutung ist richtig. Leider gibt die hier bereits erwähnte Literatur eine konkrete Jahreszahl, so dass ich befürchtee, dass nun jemand anderes quasi den Elfmeter verwandelt.
Nun aber …
Damit der Ansporn nicht nachlässt macht die Geschichtswerkstatt Siegen aus dem kleinen Buchpreis einen „großen“ und lobt noch ein Jahrbuch „Siegener Beiträge“ für den „Gewinner“ aus. Die Auswahl kann frei aus den noch lieferbaren Bänden getroffen werden. Unter http://geschichtswerkstatt-siegen.de/ (Rubriken Aktuelles und Publikationen) finden sich alle Bände und über die Email-Adresse kann Kontakt mit der Geschichtswerkstatt aufgenommen werden.
Der Beleg ist bereits in den Kommenataren genannt worden. Dort heißt: „Man ist geneigt, das „Christkind“ als Gabenbringer dem weihnachtlichen Brauchtums-kreis der bürgerlichen Kultur des 19. Jahrhunderts zuzuordnen. Weit gefehlt! In der Geld-rechnung der Kellerei Wittgenstein des Jahres 1620, abgelegt durch den Kellner Joist Streithov (WA Akte R 4) lesen wir unter den Ausgaben:
„Den Bäckern: Den 24. t. Xbr. (Dez.) für Wecken, so das Christkindgen ausgeteilt, Johan-nes Hasselbach gegeben 0 – 12 – 0.“ (Das sind 12 Albus oder ein halber Gulden.)
Der Laaspher Bäcker Hasselbach backte also die Wecken, die das Christkind am Heilig-abend an die Laaspher Kinder verteilte. Der gütige Spender war Graf Ludwig d.J., der ein Vierteljahr zuvor aus kurpfälzischem Dienst in Simmern in die heimische Residenz zu-rückgekehrt war.“
Rezeption Otto Arnolds:
Ausstellungen:
1) Fotoausstellung „Otto Arnold. Fotografie 1927 -1938. Arbeitswelt und Landschaft des Siegerlandes, Siegen, Kreishaus, Koblenzer Str, 25.2. bis 23.3.1989
2) Fotoausstellung „Häute, Leim und Filz“ im LWL-Freilichtmuseum Hagen, Gelbgießerei, 16.7. zum 31.10.2017, Link: https://www.siwiarchiv.de/fotoausstellung-haeute-leim-und-filz/
Weil ich das Gefühl habe, dass diese Rätselrunde von leisen Missklängen begleitet war, hier noch ein paar Anmerkungen eines durch „Zurückhaltung“ aufgefallenen Beobachters.
1. Nicht jede(r) hat das Privileg, z.B. die Zeitschrift „Wittgenstein“ sofort in Reichweite zu haben. Literaturhinweisen kann also nicht immer ohne Aufwand (Bibliotheks-/Archivbesuche) gefolgt werden. Da bleibt es dann letztendlich doch beim Raten (weshalb es ja auch „Rätsel“ heißt). Rätsel, zu deren Lösung man auf Digitalisate zurückgreifen könnte, würden sich vielleicht noch größerer Beliebtheit erfreuen.
2. Die anfängliche Vermutung von Frau/Herrn (?) Sassmannshausen würde ich nicht einfach so als falsch abtun, sondern sehe darin eine ernstzunehmende Hypothese. Warum soll in dem reformations-freudigen Ländchen Wittgenstein nicht schon etliche Jahrzehnte vor 1620, also wirklich im 16. Jahrhundert, die Abkehr vom heiligen Nikolaus und Zuwendung zum „Christkind“ erfolgt sein? Der von Werner Wied 1998 erbrachte Nachweis war wohl eher ein Zufallsfund, den er im Archiv nicht weiter verfolgt hatte. „Erstmaligkeiten“ sind naturgemäß schwer zu verifizieren.
3. In der besinnlichen Adventszeit könnte man auch einmal das Schweigen der Quellen auf sich wirken lassen. Das meiste über die Vergangenheit werden wir niemals wissen, weil schlichtweg keine Informationen an die Nachwelt weitergegeben worden waren.
zu 2) ja, das war meine Vermutung. Ausgehend von Martin Luther und seiner ablehnenden Haltung zur Heiligenverehrung hat er in/seit den 1530er Jahren das „Christkind“ als Alternative zum Hl. Nikolaus gesehen… Interessant auch, dass Weihbischof Johannes Bonemilch -der akad./theologische Lehrer Luthers- in Laasphe geboren wurde.
@ Peter Kunzmann @ Andreas Saßmannshausen:
Es wird nicht bestritten, dass das Christkind nicht schon vorher in Wittgenstein beschert haben kann. Ob nun Vermutung oder wohlbegründete Hypothese – Fakt ist allerdings die Quellenlage, nach der sich erst 1620 ein schriftlicher Niederschlag für dieses Brauchtum findet.
Ferner war der Hinweis publiziert, auffindbar in einer Online-Bibliograhie und er wurde schließlich schon recht früh hier gepostet, so dass ein Blick in das Wittgenstein-Heft allen Teilnehmenden wie auch immer möglich gewesen wäre.
@Peter Kunzmann:
1) Entweder hartnäckig raten und etwas arbeiten – also ein bisschen was muss man für 2 Bücher schon tun.
2) Ja, Geschichte ist leider quellenbasiert. „Virtuelle“ Geschichte führt im besten Fall zu anderen oder gar besseren Fragen – allerdings in den seltesten Fällen wohl zu fundierten Ergebnissen.
In diesem Fall ist die aufgeworfene Frage: Warum gibt es keinen Quellenbeleg für die Bescherung durch das Christkind im Wittgensteiner Land, obwohl dies weit vor dem ersten Nachweis einer Bescherung durch das Christkind reformiert war? Doch dies ist eine andere Frage und muss von anderen beantwortet werden …..
Wird das „Siwi-Adventsrätsel“ der statistische Spitzenreiter dieses Jahres???
Literatur: Theoretisch schon klar, aber im praktischen Leben überlegt man es sich (besonders im Winter) doch, ob man nach Feierabend extra zur Bibliothek fährt, bloß um wegen so eines Rätsels etwas nachzuschlagen.
Online-Bibliographie „Wittgenstein“: Wer sie kennt, ist manchmal im Vorteil. Letzter Bearbeitungsstand: 4. Dezember. Also ein guter Anlass, wieder einmal darauf hinzuweisen. http://www.wittgensteiner-heimatverein.de/bibliografie.html
Das exakte Jahr hätte man dort auch nicht gefunden, aber die Eingrenzung auf die Zeit des Dreißigjährigen Krieges.
„Geschichte ist leider quellenbasiert“: Wieso „leider“? Und wird sie diesem Anspruch gerecht? Als bekennender Quellenfetischist ärgere ich mich eher permanent darüber, dass „Geschichte“ sehr oft jenseits aller Quellenbasis betrieben wird. Ich erinnere an den „Fall Reibekuchen“ vor 3 (?) Jahren. (Herr Burwitz wartet vermutlich immer noch auf Antwort vom Heimatbund.)
Noch älterer Quellenbeleg: Wer sagt denn, dass es keinen gibt? Der für 1620 wurde fast vier Jahrhunderte später entdeckt. Irgendwo in den weltlichen und kirchlichen Archiven Wittgensteins könnte irgendwann noch eine weitere Entdeckung gelingen. Oder auch nicht. Man weiß es eben nicht. Solche kleinen Funde können allerdings dazu ermutigen, beim Durchforsten alter Akten oder auch Zeitungen über den engen Horizont der eigentlich verfolgten Themen hinauszuschauen.
Und wer war nun der junge Mensch, der 1620 in Laasphe als „Christkind“ kostümiert die Wecken verteilte???
Auch ich habe ein Gemälde vom Matterhorn, signiert mit „S.R.Vogt“ und auf der Rückseite ist noch ein Schriftzug auf einen Papierstreifen aufgeklebt. Geschrieben mit einer Schreibmaschine steht hier:
„5485 S.R. Vogt: Matterhorn“
Es ist gerahmt, scheinbar noch im Originalrahmen, welcher allerdings beschädigt ist.
Größe ca. 30 cm x ca. 40 cm
Können sie mir näheres zu diesem Bild erzählen z. B. wann es entstand, ob es mehrfach vom Maler gefertigt wurde, ob er vor Ort war …
Ich bedanke mich für Ihre Bemühungen. Cornelia Hansche
Nach einem ersten Durchhören, halte ich den Beitrag im Großen und Ganzen für gelungen! Was gut deutlich wird, sind die unterschiedlichen Betätigungsfelder des Johann Moritz, zudem ist der Beitrag um ein ausgewogenes Bild bemüht. Der Sendungstitel „Tod des Feldmarschalls Johann Moritz von Nassau-Siegen“ hat mich zuerst zwar etwas befremdet, da das Militärische sehr in der Vordergrund gerückt wird, aber es im Beitrag hauptsächlich um seine Projekte als „Renaissance Mensch“ in Politik, Architektur und Gartenbau geht. Tatsächlich stand Johann Moritz die meiste Zeit seines Lebens in militärischen Diensten und es gibt kaum ein Bild von ihm, wo er nicht in Harnisch dargestellt ist.
Einige Fehler im Detail (z.B. Krönchenstiftung 1652 statt 1658, brasilianische Taufschale anstatt peruanische Schale) machen das Radiofeature nicht weniger hörenswert! Die Hintergrundgeschichte zur Taufschale kann man übrigens hier nochmal ausführlich nachlesen: https://wiki.zeitraum-siegen.de/ideen-traditionen/taufschale
Vielen Dank für den Kommentar! Johann Moritz ist ja in diesem Jahr wieder in das Blickfeld der historischen Betrachtung geraten. Ich fand die Betrachtung des populären Radioformats für hier erwähnenswert, da der Anlass so kurz vor den Feiertagen sicherlich dem ein oder der anderen entgangen ist.
Matthias Grass schrieb auf rp-online anlässlich des Todestages von Johann Moritz: “ ….. Die Niederländer kennen ihn als den „Brasilianer“. Doch gerade als Brasilianer fiel dunkler Schatten auf die in Kleve als Lichtgestalt verehrte barocke Figur des stattlichen Fürsten. Nassau handelte mit Sklaven, seine Büste wurde zeitweise aus dem Mauritshaus in den Haag verbannt. In Kleve steht sie noch. Museumsdirektor Harald Kunde ist eben kein Bilderstürmer und hat versprochen, die Geschichte des 1604 geborenen Fürsten aufzuarbeiten. ….“ Die Aufarbeitung ist wohl allgegenwärtig …..
Der Kuhmichel-Artikel im Regionalen Personenlexikon wurde inzwischen ergänzt (http://akteureundtaeterimnsinsiegenundwittgenstein.blogsport.de/verzeichnis/gesamtverzeichnis/#kuhmichel1). Das Regionale Personenlexikon ist kein Verzeichnis großer regionaler Persönlichkeiten, sondern eins zu Personen, die in der und für die NS-Bewegung, bei der und für die Machtübergabe und während der Geschichte des nachfolgenden Herrschaftssystems in der Region eine Rolle spielten. Es nennt viele personengebundene Daten, die im regionalen Nach-NS-Narrativ häufig fehlten und die z. T. immer noch nicht aufgenommen sind. Ich zitiere von dort:
„… ein hoch talentierter Künstler mit einer überaus vielfältigen Schaffenspalette. Von ihm entstanden Eisengussplatten und -skulpturen, Steinskulpturen und -reliefs, solche aus Holz und Metall, Wandputzbilder (Sgraffitos), Glasmalereien, Monotypien, Holzschnitte, Kohlezeichnungen oder sogar Wandteppiche …“ (Werbetext des Veranstalters, des 4Fachwerk-Mittendrin-Museums, für die Ausstellung [November/Dezember 2019]), das heißt: keine zeitlichen Verweise
„Sein erstes Siegerländer Atelier entsteht 1929 in einem stillgelegten Fabrikgebäude in der Siegener Flurenwende, das später den Krieg nicht übersteht. Den Neuanfang nach dem 2. Weltkrieg wagt Kuhmichel 1953 mit dem Umzug in ein eigenes Haus mit Atelier am Weidenauer Schneppenberg. … Die Ausstellung ermöglicht einen fundierten Überblick über die große Bandbreite seines Schaffens von monumental wirkenden Standbildern bis hin [zu] berührenden fadenfein ausgeführten Textilbildern.“ (Freudenberg online, Werbetext des Veranstalters, undat. [November/Dezember 2019])
Bei einer schnellen Recherche fand sich folgende regionale Literatur zur weiteren Forschung:
– Achenbach, Heinrich von: Aus des Siegerlandes Vergangeneheit, Bd. VI: 1560 – 1623, 1895 – 1898, S. 21f
– Gerber, Harry: Christof Corvin, in: Nassauische Lebensbilder. Bd 3, 1948, S.117-126.
– Graffmann, Heinrich: Christoph Corvin und sein Werk, in: 1050 Jahre Herborn. Herborn 1964. S. 68-75
– Holler, Siegfried: Christoph Corvin gründete die Hohe-Schule-Druckerei in Herborn. Herborn als traditionsreicher Druckort. in: „Hinterländer Anzeiger“ 159 (1998) Nr. 235 vom 30.8.1998, S. 22
– Knodt, Emil: Das Testament des Christophorus Corvinus, des ersten Buchdruckers der hohen Schule zu Herborn in: Bilder aus der Geschichte der Stadt Herborn. Herborn 1914, S. 110-115
– Schilling, Marlies: Die Piscatorbibel, in: Der Westerwald. Bd. 75 (1982), H. 4, S. 139-143
– Störkel, Rüdiger: Literatur in „Dill-Athen“ : Herborn und die Welt der Bücher 1585 – 1900, in: Mitteilungsblatt des Geschichtsvereins Herborn e.V., Bd. 55 (2007), H. 3/4, S. 118-160, Ill.
– Vitt, Hans Rudi: Christoph Corvinus, Siegens erster Buchdrucker. Zu seinem 4000. Geburtstag, in: Unser Heimatland, 1952, S. 38
Folgendes einschlägiges Archivgut fand sich:
– Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, HHStAW Bestand 1136 (Sammlung A (Kleinschriften zur nassauischen Orts- und Personengeschichte)) Nr. 110 [Vom Wirken des Universitätsbuchdruckers Christoph Corvin in Herborn, 1941 (Zeitungsausschnitt)]
– Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, HHStAW Bestand 95 (Hohe Schule Herborn) Nr. 1908, Buchdrucker Christoph Corvin und dessen Familie, 1615-1622
– Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, HStAD Bestand R 6 A (Bürgerliche Wappen) Nr. NACHWEIS ( Wappennachweis Corvin, (Rab), Herborn, s. a. Herborner Familienwappen, S. 1/ 2 (HfV))
– Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, HStAD Bestand O 64 (Materialsammlung Knodt) Nr. 940, Materialsammlung zum Wappen Corvin[us], Herborn, Usingen, Witzenhausen, [ca. 1914-1969]
Nach den frühen Drucken Corvins kann im „Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts (VD 16)“ gesucht werden.
Die Mappen mit der Korrespondenz zwischen Fritz und Adolf Busch und dem Verlag Breitkopf & Härtel gehören zu den Archivalien, die nach der Rückübertragung des (vor 1989 verstaatlichten) Bestandes an den Alt-Eigentümer Mitte der 1990er Jahre nach Wiesbaden, an den heutigen Verlagssitz von Breitkopf & Härtel, überführt wurden. Freundlicher Hinweis aus dem Sächsischen Staatsarchiv Leipzig.
Ich bin schon sehr erstaunt über die Energie, sich über die Neigung eines längst Verstorbenen Künstlers zum Faschismus auszutauschen.
Und würde mir wünschen, dass mit der gleichen Verve gegen heutige Hass schürende Mitbürger vorgegangen würde. Dafür ist aber leider schon wieder ein Maß an Zivilcourage erforderlich. Und nicht so billig zu haben.
Ich glaube im übrigen aus eigener Erfahrung niemandem, der behauptet, Auftragsarbeiten nicht entgegen genommen zu haben! Dafür steht mir zu sehr der opportunistische vorauseilende Gehorsam meiner Kollegen in einem hierarchischen Gefüge vor Augen
Es hat mich ebenfalls gewundert, dass die Kuhmichel-Diskussion hier bei der Ankündigung entstanden ist. Aber der Verve ist doch begrüßenswert. Denn Kuhmuchels Werk ist ja nicht Vergessen, sondern integraler Bestandteil aktueller Siegener Erinnerungskultur – Rubensbrunnen am Oberen Schloss, Ausschauende am Unteren Schloss, Wächter auf der Kreisgedenkstätte in Siegen-Gosenbach. So wird die vermeintlich akademische Diskussion m. E. sehr aktuell.
Ein bisschen Eergie ist tatsächlich erforderlich, um sich über das private Gespräch hinaus gegen den Mainstream artikulieren zu können. Die wenigsten von uns verfügen schließlich über einen nennenswerten öffentlichen Einfluss oder sind gar Eigner von Medien. Ich hatte anfang des Monats einen Leserbrief an die WR (mit der WP und anderen Medien Teil der „Funke-Gruppe“) geschrieben, der zur dort angesprochenen Kuhmichel-Kontroverse Stellung nahm. Leider erschien er nicht. Er ging so:
„Als Klaus Dietermann, der spätere Gründer der heutigen Siegener NS-Gedenkstätte 1985 mit seiner Schrift „Kasernen und Kuhmichel“ an den Künstler erinnerte, ging es ihm darum, eine Lücke im kollektiven Gedächtnis zu schließen. Die Nazis hatten Mitglieder, Unterstützer und Helfer wie überall so auch im Siegerland auch im christlichen Bildungsbürgertum gehabt. Nein, weder Dietermann noch irgend jemand sonst hat je behauptet, dass Kuhmichel selbst ein eingeschriebener Nazi gewesen sei. Ob das so war oder nicht, wie weit die Schnittmenge Kuhmichels mit nazistischen Überzeugungen etwa beim Abarbeiten der Nazi-Aufträge tatsächlich reichte, ist bis heute nicht hinreichend geklärt. Es ging einfach um die Tatsache von Kuhmichels Auftragskunst für das NS-System. Die war damals vielen unbekannt.
Die Freudenberger Ausstellung kehrt leider in ihren biografischen Verweisen explizit zu den Auslassungen der 1950er bis 1980er Jahre zurück. Sie revidiert den erreichten Kenntnisstand, vertritt einen regionalen Geschichtsrevisionismus. Anders als Dietermanns Schrift klärt sie nicht auf, sondern deckt zu. Dem schwierigen Bemühen des Siegerländer NS-Gedenkens arbeitet sie nicht zu, sondern entgegen. Das ist sehr bedauerlich.“
Der gestrige Vortrag von Frau Dr. Ingrid Leopold im 4Fachwerkmuseum Freudenberg straft das Gesagte von Herrn Opfermann Lügen.
Es wäre nach wie vor interessanter zu wissen, was man in der Gegenwart tun kann, um dem neu erwachten rechten Gedankengut die Stirn zu bieten, damit dies nicht zum „Mainstream“ werden kann.
Die Diskussion einer regionalen bzw. lokalen Person der Kunstgeschichte bzw. der Zeitgeschichte ist in unserem regionalarchivischen Weblog nicht ungewöhnlich. und liefert durchaus Ansätze, „um dem neu erwachten rechten Gedankengut die Stirn zu bieten“. Es geht hier wie dort um Differenzierung auf der Grundlage umfassender Fakten(recherche).
Es wird ja niemand davon abgehalten, das zu tun. Hier aber lautet aus Anlass dieser Ausstellung das Thema „Kuhmichel“. Wie von den Auststellungsmachern mit der NS-Vergangenheit Kuhmichels umgegangen wurde, ist oben nachzulesen. Sie selbst sind es die sprechen.
Siehe auch:
Lerchstein, Wilfried: „Lernen und Beten in der evangelischen Kapelle Grissenbach“, in: „Grissenbacher Lesebuch – 700 Jahre Dorfgeschichte(n)“, Herausgeber: Grissenbach Aktiv e.V., Netphen 2011, S. 145 – 147
Lerchstein, Wilfried: „Die neue Kapelle aus 1745 und der spätere Anbau einer Schule“, in: „Katholisches Glaubensleben in Deuz im Laufe der Jahrhunderte“, Herausgeber: Katholischer Kirchenverein „St. Matthias“ Deuz e.V., Netphen 2018, S. 16 – 17
Lerchstein, Wilfried: „Das Schulwesen in Walpersdorf“ und „Zur Geschichte der Walpersdorfer Kapellen“, in: „Lebendiges Walpersdorf – Geschichte und Geschichten aus dem oberen Siegtal“, Herausgeber: Heimatverein Walpersdorf e.V., Netphen 2019, S. 36 – 43 und S. 72 – 75
Vielen Dank für die Ergänzungen! In der Tat wurden vor allem die Ortschroniken noch nicht ausgewertet. Entsprechende Hinweise würden uns daher sehr freuen!
Da fehlen noch die Kapellenschulen in
– Plittershagen
– Mausbach
– Oberheuslingen
– Eisern
– Oberdielfen
– Littfeld
– Lindenberg.
Wenn auch frühere Kapelleschulen einbezogen werden sollten:
– Büschergrund
– Niederndorf
Bei der Recherche, die der Liste zunächst zugrunde lag, ging es sich um Standorte noch möglichst im Originalzustand erhaltener Bauten. Daher: danke für die Hinweise!
Ausgewertet wurden für die Liste die einschlägigen regionalen Bibliographien, so dass der ein oder andere Text fehlen kann. Gibt es zitierfähige Texte über Kapellenschulen im Freudenberger Stadtgebiet? Wenn ja, dann gerne hier ergänzen!
Ich empfehle eine Stern-Mail an die Städte und Gemeinden
als untere Denkmalbehörde. Dort sind den Denkmalakten meist die
ortsgeschichtlichen Grundlagen beigefügt.
Alternative
Abfrage der Klarissa-Datei bei der LWL-Denkmalpflege
Kann man machen. Aber dann würden die mittlerweile untergegangenen wohl nicht in der Literaturliste erscheinen ….
Übrigens zur Kapellenschule Büschergrund kann doch einfach auf Ising, Anne: Von der Kapellenschule zum Schulzentrum. Einige Kapitel Schulgeschichte aus Büschergrund, in: Heimat- und Verschönerungsverein Büschergrunde.V.(Hg.): Büschergrund. Ursprung Oberndorfs und Weiterentwicklung der Ortschaften Anstoß, Bockseifen, Büschen und Eichen, Siegen 2011, S. 306 – 317 verwiesen werden
Im Allgemeinen zu den Schulen im Kirchspiel Rödgen sei erwähnt das es eine Akte gibt, die über das Pfarr- und Schulhaus angelegt ist.Hier nun ist aber nicht eine Kirchspielschule mit einer dort angestellten Lehrperson gemeint, sondern es hat einen Raum im Pfarrhaus gegeben, wo der Seelsorger die Jugend unterrichtete.
Was die Zeit angeht ist eine Aussage die vor Gericht in dem Schulstreit der von den beiden „Dielfen“ in den Jahren1763-1768 geführt wurde:“1609 gab es eine Schule in Niederdielfen, aber da war noch kein Katholik im Ort“Das dort 1659 eine Glocke in der Kapelle hing, die in Köln gegossen wurde, belegt die Inschrift.
In Eisern hat laut dem evangel. Ehebuch in der dortigen Kappellenschule 1653 eine Trauung stattgefunden,so auch in Obersdorf. Ein Jahr später in Oberdielfen, und Rinsdorf, wenig später1656 in Niederdielfen. Eine Prestige im Religionsstreit für alle Glaubensgenossen der mit seiner Braut und der gesamten Familien“zu erscheinen hatte“. Im Gotteshaus selber wurden aber auch Ehen vollzogen und „mit Vermerk“ im evangelischen Pfarrhaus.
aus 2019 noch nicht in Heimatland veröffentlicht Kapelle Obersdorf und über in meinen Kroniken
1994 Oberdielfen umfangreich und 2011 Flammersbach
Wunderbar und traurig – schön, dass laut über solcherlei Fragen diskutiert wird, schade, dass solcherlei Fragen überhaupt diskutiert werden müssen. Natürlich sind wir neutral, natürlich gibt es einen internationalen ethischen Kodex für Archivarinnen und Archivare, verabschiedet vom ICA in Peking 1996 (den niemand kennt bzw. gern ignoriert-s.a.: https://www.ica.org/en/ica-code-ethics); natürlich ist in unserer Demokratie Staat und Kirche getrennt (*räusper*); natürlich…nicht immer.
In der Hoffnung, dass solcherlei Blogs die Köpfe und Herzen vieler Archivierender erreichen, wünsche ich viel Erfolg!
Verbreitet den Kodex & und seid so neutral wie es nur geht.
Vielen Dank für die schnelle Reaktion! Ja, der Code of ethics ist eine Richtschnur für die Arbeit. Allerdings lässt er da durchaus Spielraum, z. B. in Bewertungsfragen oder bei der Auswahlarchivierung, der Archivierenden Wahlmöglichkeiten gibt, beri denen man durchaus die Neutralität in Frage stellen könnte.
Ferner wird darin m. E. eher weniger die Rolle von Archiven bei der Öffentlichkeitsarbeit und der Archivpäadagogik diskutiert.
Neutralität ist wünschenswert und erforderlich in Archiven, das steht außer Frage. Da aber viele Archivare/Archivarinnen Historiker/Historikerinnen sind (was überhaupt nichts schlechtes ist! Bin ich selbst :-)), bewerten einige vielleicht leider doch nicht so neutral oder haben eine eher subjektive Betrachtungsweise bei Sichtung/Bewertung der Unterlagen.
Dennoch finde ich, dass Neutralität zur täglichen Archivarbeit zählt und freue mich auf weitere Kommentare über dieses wichtige Thema. :-)
Bewertungskriterien sind immer subjektiv. Es gibt m.E. nur zwei Wege, diese zu „objektivieren“, ohne je Objektivität oder Neutralität zu erreichen:
– Transparenz
– Beteiligung mehrer Personen(-gruppen).
Aber wie sollte eine Bewertungsentscheidung absolut neutral getroffen werden? Es wird anhand hoffentlich transparenter Kriterien eine Wertsetzung vorgenommen. Dadurch werden Auswertungsmöglichkeiten zwangsläufig eingeschränkt. Um im umfassenden Sinne neutral zu sein, müsste alles aufbewahrt werden.
Es geht vermutlich vielmehr um die Frage der politischen/wissenschaftlichen „Neutralität“ im Sinne von „sine ira et studio“. Dabei ist Transparenz m.E. ein Thema, das unbedingt in den Neutralitätskontext gehört. Generell beschäftigen wir uns zu selten mit dem, was Berufsethos konkret bedeutet. In Sonntagsreden hingegen kommt es dauernd vor…
Vielen Dank für den Kommentar! Dass Transparenz und Neutralität einander bedingen, ist richtig. Die Frage ist jedoch, ob bei aller Transparenz eine Bewertungsentscheidung neutral ist? Bei der Bewertung von Massenakten gibt es ja unterschiedliche Vorgehensweise (Überlerungs des Verwaltungshandelns, Statistische Auswahl oder Buchstabenauswahl). Ist es neutral, wenn ich mich bei der Buchstabenauswahl z. B. für die Buchstaben entscheide, die einen erhöhten Anteil von Nachnamen nichtdeutschen Ursprungs enthalten – selbst, wenn ich das Dokumentationsziel formuliere, Dokumentation von „Lebensgeschichten“ von Personen mit Migrationshintergrund ?
M.E. geht es im Beispielsfall nicht um Neutralität, sondern um „falsch“ und „richtig“. Da hilft Transparenz im Sinne von „Begründungsobjektivität“. Wenn ich ein Überlieferungsziel postuliere und einen Weg wähle, der dazu nicht passt, habe ich schlichtweg etwas falsch gemacht. Das lässt sich durch Transparenz objektiv überprüfen. Die Bewertungsentscheidung bleibt dennoch subjektiv.
Die Sache mit der scheinbaren Neutralität war ja auch bei der Bewertung nach Evidenz (Menne-Haritz) ein Thema. Es ist auch eine subjektive Wertsetzung, wenn man sagt, das Verwaltungshandeln müsse dokumentiert werden. Was auch immer das dann konkret bedeutet…
Wenn ich es recht sehe, dann ist bereits die Postulierung des Überleiferungsziel nicht neutral bzw. sublektiv, die Bewertungsentscheidungen sind es auch.
Kapellenschule Oberheuslingen
Stadtarchi Freudenberg
Bestand Amt Freudenberg
A 2113
evangelisches Schulgebäude in Oberheuslingen [1851-1908)
Stadtarchiv Freudenberg
Bestand Amt Freudenberg
B 2114
Schulbau in Oberheuslingen [1902-1922)
Stadtarchiv Freudenberg
Bestand Amt Freudenberg
C 364
Instandsetzung der Schule in Oberheuslingen [1928-1945]
Bestellsignatur: (Amt Freudenberg – Bestand C), C 364
Stadtarchiv Freudenberg
Bestand Amt Freudenberg
D 523
Schule in Oberheuslingen [1958-1968)
Enthält: Zeichnungen
Wer auch immer die Recherche in Auftrag gegeben hat – es wird doch!
Erst wenn wir erkennen, dass wir eben nicht neutral sind, dass wir alle internalisierte -Ismen in uns tragen, wenn wir unsere Arbeit und unser tägliches Handeln regelmäßig hinterfragen und uns unserer Vorurteile bewusst sind, können wir unserer Aufgabe und unserer Verantwortung als mit der Auswahl, Sicherung und Vorlage historischer Dokumente angemessen nachkommen.
Danke für dieses wichtige Thema, das hier in Deutschland ganz dringend mehr Öffentlichkeit braucht. Ich werde versuchen, mich an der Blogparade zu beteiligen, da mich das Thema auch privat seit einiger Zeit umtreibt. Sehr gut passt aber auch der Beitrag aus dem Stadtarchiv Darmstadt zur Geburtstagsblogparade 2018 zu diesem Thema, den ich hier gerne noch einmal verlinke: https://dablog.hypotheses.org/338
2 Ergänzungen zur Kapellenschule in Sassenhausen:
Johannes Burkardt: Die Kapelle in Sassenhausen: Freundlicher Wegweiser ins Herz des Wittgensteiner Landes. In: Bernd Geier (Hrsg.) Sassenhausen, Bad Laasphe 2001, S. 16 ff.
Bernd Geier: Sassenhausen (Kirchengemeinde Weidenhausen), in: Johannes Burkardt/Andreas Kroh/Ulf Lückel: Die Kirchen des Kirchenkreises Wittgenstein in Wort und Bild, Bad Berleburg 2001, S. 145 – 148
Weitere Literaturfunde:
– Siegerländer Heimatkalender 1999, [Bilder von Kapellenschulen im Kalendarium]
– „Schule und Schulkapelle“, in: Gerhard Horn/Gerhard Moisel/Wolfgang Schmidt: Seelbach. Bilder aus der Geschichte des Siegener Stadtteils, Siegen 1994, S. 203 – 224
– Heimatverein Salchendorf (Hg.): 700 Jahre Salchendorf im Freien Grund 1316 – 2016, Salchendorf 206, S. 98 – 101.
– Otto Krasa: Chronik der Gemeinde Gosenbach, Hilchenbach 1964, S. 139 – 152
– Heimatverein Helberhausen-Oberndorf (Hg.): 700 Jahre. Eine spannende Reise durch Helberhäuser Geschichte, Siegen 2018, S. 326ff
– Erich KS. 115 – lein: Ortschronik von Buschhütten, Langenau und Bottenbach, Bad Berleburg 2002, S. 115 – 121
Ich war schon dreimal am Futapass um das Grab meines Vaters zu besuchen.Mein Vater wurde am 5.10.1944 durch einen
Granateneinschlag im Settatal getötet. Leider bin so weit weg . Das letzte mal waren mein Bruder und ich 1916 am Friedhof
Der Friedhof ist sehr einfach aber übersichtlich gestaltet. Auch neue Grabtafeln wurden ergänzt.Grossen Dank an das Schwarze Kreuz für die Erhaltung und Pflege.
Johann Halmdienst aus Mürzzuschlag in Österreich
Ein gelungener Vortrag mit einem eloquenten Dozenten, der im Anschluss jede Frage umfassend und verständlich beantwortet. Ein wirklich spannender und informativer Abend über den „Entscheider“ Hindenburg.
Nicht nur die Öffentlichkeit hat keine Ahnung, wozu Archive da sind und was sie für eine Bedeutung für die Gesellschaft haben und was Archivar tun und leisten, sondern leider auch oft die vorgesetzten Dienststellen. Es gelingt den fühtrenden Archivaren ganz offensichtlich nicht, ihre Aufgaben und ihre Arbeit den Entscheidungsträgern in Politik, Verwaltung und Gesellschaft schlüssig zu vermitteln. Museen und Bibliotheken haben es da einfacher.
Auf der einen Seite muss ich Prof. Hempel zustimmen, ich muss aber auch widersprechen. Sicherlich haben es Museen und Bibliotheken leichter, was aber, und da kommen wir zum Widerspruch, nicht an den Kolleginnen und Kollegen liegt, deren Engagement in vielen Bereichen groß ist, was aber nicht honoriert wird.
Mit einem Ausstellungsstück im Museum kann z.B. ein Dezernent besser in der Presse dastehen, als mit einem schnöden Aktenband. Das ist leider Fakt und beruht auch auf eigenen Erfahrungen.
Die Archive sind leider in vielen Kommunen der „Rattenschwanz“ der Kulturbetriebe und werden immer noch als bloße Aktenbewahranstalt gesehen. Da helfen keine Führungen, „Aufklärungs-„Veranstaltungen und Vorträge. Ganz skurril wird es, wenn in Archiven Fachleute (Historiker) sitzen, diese Fachkräfte gerade bei historischen Projekten aber nicht abgerufen werden. Das ist bloße Ignoranz.
Natürlich sieht es nicht überall so düster aus, gerade in kleineren Kommunen haben Archive eine gute Chance, da sie dort enger mit dem Kulturbereich verbunden sind. Aber in größeren Städten haben es Archive, sofern es keine staatlichen Einrichtungen sind, sehr schwer, sich gegen die Konkurrenz der anderen Kultureinrichtungen durchzusetzen.
Das Bild, das jetzt in Tübingen herrscht, ist schon erschreckend. Die Stadt, Universitätsstadt mit reicher historischer Tradition, scheint sich dieser Tradition nicht bewusst zu sein oder ignoriert sie. Vlt. fiel auch schon der Satz: Für unsere Geschichte haben wir ja das Museum. Wie man dieses Missverhältnis aufbrechen kann, kann ich nicht beantworten. Dass wir in unseren Archiven auch Kulturgut aufbewahren, dass vlt. nicht so toll aussieht wie ein Rembrandt, aber doch für unser historisches Gedächtnis wichtig ist, das muss man, auch gerade vor den am Montag begangenen Gedenkveranstaltungen, immer wieder betonen.
Tatsächlich sehe ich hier noch einen anderen Aspekt. Archive sind eben nicht nur Kultureinrichtungen und Sammlungsort der Erinnerung einer Stadt. Sie sind auch Dienstleistungseinrichtungen für andere städtische Ämter und Dienststellen. Es geht hier nicht nur darum, wertvolle kulturelle Güter zu sichern, sondern auch, den Verwaltungsbetrieb am Laufen zu halten. Recherchen von Verwaltungsmitarbeitenden in Archiven beziehen sich häufig auf ganz aktuelle Belange. Es wird nach dem Grundriss eines Gebäudes gesucht, das nun umgebaut werden soll, für ein Bauvorhaben wird nach Informationen über Altlasten geforscht oder es stellt sich die Frage, wann eine bestimmte Entscheidung durch den Magistrat verabschiedet wurde, da ein vergleichbares Thema gerade wieder in der Diskussion präsent ist. Privatpersonen fragen nicht nur nach ihren Vorfahren, um Familiengeschichte zu betreiben, sondern auch um eine Staatsbürgerschaft nachzuweisen oder Rentenansprüche geltend machen zu können. Dahinter steckt wenig Recherche in Kulturgut, sondern ganz alltägliche Verwaltungsarbeit. Das wird hier sehr gerne außen vor gelassen und ein Archiv zu „soetwas wie einem Museum“ das „halt was mit Büchern macht“. Das kennt man, das hat man schon, das kann man ja abschaffen. Dabei ist es so viel mehr.
Dem kann ich auch zustimmen! Archive als Serviceeinrichtung ist ein ganz wichtiges Thema und muss in der Verwaltung auch bekannt gemacht werden, um den Stellenwert zu erhöhen. Dies gilt auch für die Öffentlichkeit. Die ketzerische Frage sei aber gestattet: Machen wir uns als Archive dann nicht auch wieder zum bloßen Aktenaufbewahrungsort irgendwo im Keller? Degradieren wir uns da nicht selber?
Sind wir denn nur „Aktenaufbewahrungsort“, wenn wir sachgerechte Lagerung, qualifizierte Recherche und Bereitstellung ermöglichen? Dann wären Bibliotheken auch nur „Bücheraufbewahrungsorte“. Und können wir nicht beides sein? Gedächtnis- und Kultureinrichtung und Dienstleister*innen für unsere Träger? Wir müssen uns ja zum Glück nicht entscheiden, sollten aber immer wieder überprüfen, welches Bild wir nach außen vermitteln und ob das wirklich unseren ganzen Aufgabenbereich abdeckt (auch wenn einige Bereiche vielleicht nicht ganz so „cool“ sind) ;)
Der Spagat ist schwierig, da stimme ich zu. Gerade bei den Bibliotheken ist es ja so, dass dort mittels gezielter Öffentlichkeitsarbeit dem Trend entgegengewirkt wird. Die Bibliothek als Aufenthaltsort nicht nur zum Ausleihen von Büchern bzw. als „Bücheraufbewahrungsort“.
Ich finde beide Bereiche wichtig und dränge auch immer darauf, dass wir uns unsere Fachkompetenz bewusst sind und auch gegenüber der Verwaltung darauf hinweisen. Leider ist das teilweise schwierig, da die Akzeptanz solange da ist, wie man keine Arbeit verursacht. Hier Stichwort: Schriftgutverwaltung/Behördenberatung. Recherchen werden oftmals als selbstverständlich angesehen und der Aufwand nicht bedacht. Hier ist gezielte Aufklärung notwendig, wir führen ja schließlich keine Wikipedia-Suche durch.
Und was die Frage nach der Serviceleistung „sachgerechte Lagerung“ betrifft: Das hängt davon ab, wie das Archiv ausgestattet sind. Bei uns laufen z.B. Wasserleitungen durchs Magazin und es müssen ständig Luftentfeuchter laufen….
Es gelingt uns nicht, unsere Aufgaben der Öffentlichkeit nachhaltig zu vermitteln. Den Palmer-Vorschlag werden viele als modern und sinnvoll bewerten. Teure Innenstadt meiden, dazu digitale Bereitstellung. Dagegen medial eine Gegenposition gewinnend zu vermitteln ist ziemlich schwierig.
Leider ja, es sei denn, den Kommunen fallen die Kosten irgendwann auf die Füße. Zu diskutieren wäre auch, ob man sowas einen Museum zumuten würde…
@ allen Mitdiskutierenden: Vielen Dank bis hierhin für die intensive Diskussion!
ich möchte gerne auf einen weiteren Aspekt archivischer Öffentlichkeitsarbeit hinweisen, den Thekla Kluttig via Twitter anmahnte:
Stattdessen sollten wir "Digitalisierung" viel mehr auf unsere Zuständigkeit für elektronische Unterlagen münzen, den Aufbau oder die Nutzung der notwendigen Infrastruktur und natürlich den Ausbau unserer Online-Archivinformationssystem und des @archivportal -D
.
Diesen Hinweis möchte ich um die Mitarbeit der Archive bei den e-Goverment-Bestrebungen der Träger (s. Landesarchiv NRW) und bei open-data-Projekten (s. Transparenzportal beim Staatsarchiv Hamburg) erweitern.
Der Hinweis auf das Thema Digitalisierung ist richtig und wichtig! Wir hatten das gerade heute morgen bei der Dienstbesprechung auf dem Programm. leider meinen viele Kommunen, dass man mittels Share Point-Produkten Digitalisierung spielend hinbekommt. Leider vergisst man dabei seine Pflicht der korrekten Aktenführung. Bei einer Fortbildung gestern kam dazu von einer leitenden Verwaltungsangestellten der Satz: Wer brauch denn noch Akten? Gerade hier liegt das das große Problem. Eine korrekte Aktenführung existiert in den meisten Fällen im analogen Bereich nicht, wie soll es dann im digitalen Bereich klappen? Wir haben mehrere „Aufklärungsaktionen“ gestartet, geben Fortbildungen zum Thema Schriftgutverwaltung (dies leider eher mit durchschnittlichem Erfolg was die Teilnehmerzahlen angeht), aber das Verständnis ist einfach nicht da. Und wenn die Verwaltungsspitze unsere Hinweise in der Allgemeinen Dienstanweisung zum Bereich korrekte Aktenführung mit dem Hinweis „dies ist allgemein bekannt“ markiert und streicht, was soll man da noch machen?
Schön, dass die Lücke am Anfang nun, nach längerer Wartezeit, von den Münsteranern wenigstens verkleinert wurde. Die Bayerische Staatsbibliothek konnte bislang nur Digitalisate ab 1821 anbieten, da sie die früheren Jahrgänge nicht im Bestand hat. Bleibt zu hoffen, dass auch die restlichen 17 Monate ab August 1816 bald noch ergänzt werden.
„Mit dem Schluß dieses Monats wird das Amtsblatt für die Provinz Westfalen aufhören, und von den verschiedenen Landes-Regierungen, in Münster, Minden und Arnsberg, vom ersten künftigen Monats anfangend, ein besonderes Amtsblatt für jeden Regierungs-Bezirk herausgegeben werden.“ (Amts-Blatt für die Provinz Westfalen, Nr. 56 vom 31. Juli 1816)
1969 wollte ich Hern Münker mit dem Auto von Barmenol mitnehmen
Herbergsvate Jupp Schöttler konnte ihm abringen, das ich den betagten Herrn zum Zug nach Finnentrop fuhr. Mein Weg führte ja über Hilchenbach,Nein!
Sven Panthöfer teilte via Email folgens Rechercheergebnis miit:
„Als Quelle dienen die Mitgliederlisten des VDI.
Den Einträgen im Mitgliederverzeichnis des VDI nach muss Schatzki 1891/92 nach Geisweid gekommen sein. Eine Tätigkeit in Schmallenberg wird nicht angegeben.
1885: Ingenieur in Düsseldorf (bis 1891 keinem BV zugeordnet)
1886: Ingenieur der Noell’schen Waggonfabrik Würzburg
1887: ebenso
1888: Ingenieur der Maschinenfabrik Bern, Bern
1889: Ingenieur bei Starke & Hoffmann, Hirschberg, Schlesien
1890: ebenso
1891: Ingenieur bei Belter & Schneevogel, Berlin (Mitglied im Berliner BV)
1892: Ing., Bureauchef der Siegener Verzinkerei, Geisweid (Berliner BV)
1893-1910 Siegener Verzinkerei und Mitglied im Siegener BV
„
Gesucht wird offenbar das konkrete Geburtsdatum für weitere Recherchen? Finden sich für diesen Kriegssterbefall in den Sterberegistern der Stadt Siegen keine Einträge? War Bause vielleicht verheiratet, sodass ein Heiratseintrag existiert?
Bei den hier vorgestellten Informationen handelt es sich primär um Onlinefunde. Die Suche in den Archivalien beginnt jetzt und die Ergebnisse werden als Kommentar hier ergänzt werden.
Im Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen liegen die Urkunden und Register des Notars von 1937-1942 vor. Ich weise ich vorsorglich darauf hin, dass für die Nutzung dieser Notariatsunterlagen eine Sondergenehmigung erforderlich ist.
Daneben konnte auch unter der Signatur R 001/Personalakten Nr. 0/I, 4881 (Altsignatur) eine Personalakte ermittelt werden, die den genannten Notar betreffen könnte. Ob dem so ist, muss im Rahmen einer Aktenrecherche ermittelt werden.
Ein gutes Vorhaben Herr Landrat und Vorsitzender des Heimatbundes Siegerland-Wittgenstein !
Es wird wohl hoffentlich dann auch einmal ein solch festgefahrener Fall , wie er beispielsweise beim sog. „Hüttenmeisterhaus“ in Kreuztal – Kredenbach vorliegt, zur Sprache kommen.
Hier ist weder die Kommune ( Untere Denkmalbehörde) noch der private Eigentümer bereit, den unaufhaltsamen Verfall des historisch wertvollen und ortsbildprägenden, denkmalgeschützten Fachwerkgebäudes aufzuhalten. Selbst das derzeit bestehende Denkmalschutzgesetz (DSchG.-NRW § 30 ) läßt durchaus die Enteignung eines uneinsichtigen Privatbesitzers zu, aber solange eine Kommune nicht auch von einem ihr übergeordneten Gesetzgeber (evtl. Obere Denkmalbehörde-NRW ) zur Übernahme, Instandsetzung und weiteren Instandhaltung *) eines sonst dem unweigerlichen Verfall preisgegebenen Denkmals gezwungen wird, braucht man sich nebenbei über das Verschwinden des regionalen Heimatbewußtseins im Siegerland nicht zu wundern. Auch der Erhalt historischer Gebäude trägt u.a. auch zur Förderung der doch hoffentlich auch heute noch wünschenswerten regionalen Identität und Wohlbefinden bei, vor allem dann, wenn dazu der Kommunalverwaltung eine möglichst gemeinschaftsfördernde, soziale Nutzungsmöglichkeit für das letztlich vom Steuerzahler renovierte Denkmalgebäude einfallen sollte.
Für solche Aufgaben scheinen aber die Dorfgemeinschaften (sofern überhaupt noch vorhanden ) oder zögerlich agierende „Heimatvereine„ letztlich überfordert zu sein. Aber sie könnten m.E. zumindest den Landesgesetzgeber zu einer entsprechenden Novellierung bzw. offenbar notwendigen Konkretisierung des DSchG-NRW veranlassen.
* ) > evtl. Enschädigsforderungen des Privatbesitzers werden natürlich hierbei den Instandsetzungs- und Erhaltungskosten dem derzeitigen Marktwert gegengerechnet !
Im alphabet. Namensverzeichnis des Standesamtes Siegen zu den Sterbefälle zwischen 1940 bis 1945 konnte kein entsprechender Eintrag zu Fritz Bause aufgefunden werden. Parallel wurden die hier befindlichen Adressbücher aus 1935, 1940 sowie 1952 auf etwaige Einträge überprüft. Die Recherche im Adressbuch aus 1935 und 1940 ergab einen Vermerk zu einem Fritz Bause, Kölner Straße 64 sowie Schnabelstraße 4. Im Adressbuch aus 1952 konnte kein Fritz Bause mehr nachgewiesen werden.
Anhand der o.g. Angaben zum Wohnort wurde abschließend noch die Siegener Straßenkartei durchgesehen. Dort konnte in der Schnabelstraße 4 ein Eintrag zu Fritz Bause, geboren am 11.11.1904 aufgefunden werden.
Vielen Dank! Der grundsätzliche Beitrag zur Bedeutung einer weitgehenden Transparenz der Archive zeigt, dass Archivar*innen nur so die Verlässlichkeit herstellen können, da sie eben nicht neutral sind.
Als altmodischer Archivbenutzer erlaube ich mir einen Einspruch. Ich erwarte nicht, dass das von mir in Anspruch genommene Archivpersonal seine Verlässlichkeit erst krampfhaft „herstellen“ muss, wenn ich zur Tür reinkomme, oder seine Neutralität auf mein Verlangen irgendwie nachweisen kann. Ich möchte Verläßlichkeit und Neutralität bei Menschen, die im Öffentlichen Dienst tätig sind, einfach stillschweigend voraussetzen können. Diese Menschen haben einmal durch Ablegen eines Gelöbnisses bzw. Eides zum Ausdruck gebracht, dass sie sich den ethischen Anforderungen des Dienstes für die Öffentlichkeit gewachsen fühlen und darüber keine Grundsatzdiskussionen führen müssen. Neutralität: Wenn man morgens den Archivkittel anzieht, legt man gleichzeitig für die nächsten acht Stunden die privaten Vorlieben, Abneigungen, Vorurteile usw. ab. Wer das wegen erfolgreicher Erziehung zur Egozentrik als schwer zu meisternde Herausforderung empfindet, würde in der sogenannten „freien“ Ellenbogen-Wirtschaft vielleicht eher seine Lebenserfüllung finden.
Das Dilemma der archivischen Bewertung ist objektiver Natur und lässt sich nicht lösen, da nun einmal Benutzer (wollen alles aufgehoben haben) und Archivträger (wollen Platz und Personal sparen) niemals unter einen Hut zu bekommen sind. „Transparenz“ auf Seiten der Archive ist gut und schön, hilft aber auch nicht viel weiter, weil Benutzer die Ergebnisse von Bewertungen in der Regel erst dann wahrnehmen, wenn die verantwortlich gewesenen Archivare gar nicht mehr für Stellungnahmen zur Verfügung stehen. Irgendwann werden Benutzer vielleicht naiv fragen, warum Archivarinnen und Archivare freiwillig unter Bergen überflüssiger Massenakten ersticken und immer noch am Tabu der Nachbewertung und -kassation festhalten. Die Antwort wird dann womöglich lauten: „Weil unsere Vorgänger sich etwas dabei gedacht haben.“ Haben sie das?
Das Unbehagen über die mangelnde bzw. nicht existente Beteiligung der Nutzer am Prozess der Überlieferungsbildung kann ich gut verstehen. Die Schweiz beschreitet derzeit ja andere Wege. Mal schauen, inwiefern dort das Angebot des Mitwirkens an Bewertungsentscheidungen angenommen und umgesetzt wird.
Was die Frage der Nachkassation anbelangt, bitte ich zu berücksichtigen, dass die Entscheidungen nicht objektiv sein können und immer zeitgebunden sind. Dies bedeutet, dass jede Nachkassation (= erneute Bewertungsentscheidung) genauso gut bzw. schlecht ist wie die vorherige. Denkt man den Nachkassationsgedanken zu Ende, dann würde man in arhythmischen Abständen immer wieder mit neuen Ideen und Perspektiven an die Bestände gehen (können) bis irgendwann (nach 100 Jahren?) vom Bestand nichts mehr übrig ist, denn jeder Bewertungsvorgang reduziert ja das Vorhandene und jede „Zeit“ hat ihre eigenen Forschungsströmungen, Wertvorstellungen etc.
…und Ihre Nachfrage, ob sich „unsere Vorgänger“ etwas dabei gedacht haben, wird durch die notwendige Transparenz der Bewertungsentscheidungen beantwortet. Sie ist halt das A und O…
Danke für die sachliche Antwort! Das mit der Nachkassation meinte ich auch nicht so, dass nun jede neue Archivarsgeneration die übernommenen Bestände neu bewerten soll. Bei den ausufernden Massenakten frage ich mich allerdings, ob man die anhand formaler Kriterien getroffene Auswahl von Samples überhaupt als „Bewertung“ bezeichnen kann. Diese würde m.E. darin bestehen, über den zukünftigen Wert solcher ausschließlich für statistische Zwecke nutzbarer Akten zu spekulieren. Man könnte also fragen: Sind aus diesen Akten überhaupt noch Informationen zu gewinnen, die nicht schon längst (bevor das Archiv ins Spiel kam) z.B. von den statistischen Ämtern erfasst worden sind und zur Nutzung dauerhaft vorgehalten werden? Ist die „quantitative Sozialforschung“, deren Vertreter sich momentan vielleicht noch für den Nabel der Welt halten, so zukunftsträchtig, dass ihr zuliebe Archive die Grenzen ihrer Kapazitäten überschreiten? Sorry, das führt zu weit vom Thema ab. Die Gefahr bei der Beteiligung Außenstehender besteht jedenfalls darin, dass sich dann am Ende doch nur wieder die am lautesten Schreienden durchsetzen. Archivbenutzer haben es oft schwer, Archivarinnen und Archivare aber nicht minder!
M.E. führt das nicht vom Thema ab, sondern sogar mitten hinein. Was gibt uns unser Berufsethos bezüglich der Überlieferungsbildung vor? Was sind die Kriterien für die Bewertung? Inwiefern sind wir als Archivare der „Gesellschaft“ rechenschaftspflichtig? Diese Diskussionen sind längst überfällig und müssen jenseits der Sonntagsredenbekenntnisse auch mit unseren „Kunden“ geführt werden.
Eine diesbezügliche Selbstverständigung wird vom VdA-Arbeitskreis Bewertung demnächst in Angriff genommen. Vielleicht sorgt das für die erhoffte Diskussionsgrundlage!? Spätestens dann ist es an uns, diese Dinge auch ernsthaft (!) zu diskutieren…
Ergänzend möchte ich anmerken, dass auch nach Samples ausgewählte Massenakten mehr zu bieten haben, als die Verwendbarkeit für rein statistische Auswertungen. Es finden sich hier auch exemplarische Beispiele verschiedener Lebenswirklichkeiten und darüber hinaus ein Einblick in die Arbeitsweise der abgebenden Ämter, z.B. auch bei Personalnotstand und Wechsel der zuständigen Mitarbeiter*innen. Das ist durchaus auch für andere Forschungsgebiete von Bedeutung.
Lieber Kollege Kunzmann, ich habe ein wenig den Eindruck, dass Sie in Ihren engagierten Kommentar Gleichbehandlung mit Neutralität verwechseln. Archivierende sind nicht neutral, selbst bei aller Transparenz nicht. Wie Sie richtig schreiben stehen die Archivierenden im öffentlich-rechtlichen Raum für die freiheitlich-demokratische Grundordnung (FDGO). Dies ist eine Position, die den Zugang zu Archivgut verwehrt! Gemeint sind die Ränder der Gesellschaft, die sich in kritischer Distanz zur FDGO befinden. Allerdings gehört genau jenes Archivgut unbedingt zur archivischen Pflichtaufgabe, der Dokumentation der Lebenswirklichkeiten im jeweiligen Sprengel.
Ich stimme Ihnen zu, auch bei der Frage der Ränder sind wir mitten in der Thematik „Berufsethos“. Vielleicht liege ich falsch, aber mir scheint dieses grundlegende Thema unterbelichtet zu sein. Es wäre verheerend, wenn der Eindruck entstünde, unsere Tätigkeit sei beliebig…
Lieber Herr Wolf, obwohl ich nicht die Absicht habe, bei dieser Diskussion mehr als ein Zaungast zu sein, muss ich jetzt noch zwei Erwiderungen loswerden. 1. Die Institution „Öffentlicher Dienst“ ist mehr als 200 Jahre alt. Das Ideal des zugrundeliegenden Berufsethos leitet sich aus allgemeinen Menschenrechten ab; es ist nicht erst von der FDGO kreiert worden. Wenn sich junge (?) Leute unter den relativ gemütlichen Rahmenbedingungen der FDGO jetzt als Erfinder eines solchen Ethos inszenieren wollen, spricht das nicht für ihren historischen Sinn. Damit brüskieren sie nebenbei auch all jene, die schon unter ungleich schwierigeren Bedingungen versucht hatten, dieses Ideal in ihrem Berufsalltag nicht ganz untergehen zu lassen. (Ich bin sicher, es gab sie.) 2. Wenn im Archivarslatein „Neutralität“ etwas anderes als Gleichbehandlung (von Archivbenutzern und Registraturbildnern) bedeutet, klären Sie mich (und die übrigen irritierten Leser) doch bitte auf. Danke.
Hallo Herr Kunzmann,
es gibt, auch in Deutschland, Menschen, die schlechte Erfahrungen mit öffentlichen Institutionen und ihren Vertreter*innen gemacht haben. Auch diese Menschen dürfen öffentliches Archivgut nutzen und die Aufbewahrung dieser Unterlagen durch öffentliche Einrichtungen/Ämter kann hierfür, aufgrund der gemachten Erfahrungen, eine Hürde darstellen. Das ist fatal, denn gerade Archivgut öffentlicher Träger kann dabei teilweise auch zur Rechtswahrung beitragen. Ich erinnere hier nur mal an die Opfer der Verfolgung nach §175 StGB, die inzwischen einen Anspruch auf Entschädigung haben, diesen aber nachweisen müssen. Auch hier kommen Archive ins Spiel, die aber von den Betroffenen als Teil des Systems betrachtet werden können, dessen Opfer sie geworden sind. Wenn wir unserer Verantwortung als Archivar*innen gerecht werden wollen, müssen wir diesem Misstrauen u.a. durch die angesprochene Transparenz entgegenwirken. Gleiches gilt z.B. auch für Opfer von Missbrauch in staatlichen Einrichtungen oder Personen, die rassistischer Diskriminierung durch öffentliche Bedienstete ausgesetzt waren. Verständnis und Entgegenkommen erleichtern diesen Menschen den Zugang zu Archivalien und begründen damit auch die Bedeutung von Archiven in einer Gesellschaft, zu der auch die genannten Menschen gehören.
Johann Georg Martin Fürchtegott Mollat
geb. 21.3.1863, Kassel
1880ff Jurastudium Leipzig, Göttingen, Strassburg, Marburg
1884 Promotion in Göttingen
1890er Privatgelehrter (Korrespondenz: Cassel?)
1896 Assistent Handelskammer Braunschweig
1897-1906 Syndicus der Handelskammer in Frankfurt/Oder
1906-1920 Gerichtsrat & Syndicus der Handelskammer Siegen,
Syndicus der Berg- und Hüttenmännischen Vereins zu Siegen
1910 – 1920 DVP-Stadtverordneter in Siegen
1920 Umzug nach Berlin Syndicus der Berliner Zweigstelle der Siegener Handelskammer
verstorben 07.08.1947
Publikationen Mollat
Lesebuch zur Dt. Staatswissenschaft von Kant bis Bluntschli, 1891
Quellenbuch der deutschen Politik in neunzehnten Jahrhundert, Leipzig 1892
Mitteilungen aus Leibniz ungedruckten Schriften, 1893
Krause, Karl Christian Friedrich Der Erdrechtsbund an sich selbst in seinem Verhältnisse zum Ganzen und zu allen Einzeltheilen des Menschheitslebens. Aus dem hs. Nachlasse des Verfassers herausgegeben Leipzig 1893
Reden und Redner des ersten deutschen Parlaments, Osterwieck 1895
Volkswirtschaftliches Quellenbuch, Osterwieck/H. 1913
Siegerländer Heimatbuch, Siegen 1914
Gesetz über die Handelskammern, Siegen 1914
Handbuch der Handelskammer zu Siegen, Siegen 1914
Krieg und Wirtschaftsleben, Siegen 1915
Einführung in das Gesetz über vorbereitende Maßnahmen zur Besteuerung der Kriegsgewinne vom 24. Dez. 1915, Siegen 1916
Einführung in das Kriegssteuergesetz vom 21. Juni 1916, Siegen 1917
Der Glaube an unsere Zukunft, Siegen 1917
Einführung in das Kriegsabgabegesetz vom 26. Juli 1918, Siegen 1918
Unsere nationalen Erzieher von Luther bis Bismarck- Osterwieck (Harz) 1923
Deutsche Meister. Lebenserinnerungen führender deutscher Männer aus der Zeit von Goethe bis Bismarck, 1927/1928
Hegel, Die Verfassung des Deutschen Reiches. Eine politische Flugschrift. Aus dem handschriftlichen Nachlasse des Verfassers in der Preußischen Staatsbibliothek neu hg. von Georg Mollat. Stuttgart 1935.
Von Goethes Mutter zu Cosima Wagner Stuttgart 1936
Literatur:
Irle, Lothar: Siegerländer Persönlichkeiten- und Geschlechter-Lexikon, Siegen 1974, S. 225
Bernert, Helmut: Johann Georg Martin Fürchtegott Mollat, in: Rheinisch-Westfälische Wirtschaftsbiographien Bd. 15, Rheinische und westfälische Handelskammersekretäre und -syndici vom 18.bis zum Anfang des 20.Jahrhunderts, Münster 1994,S.197–206
Quellen:
Bundesarchiv Berlin: R 9361-V/29272 (Sammlung Berlin Document Center (BDC): Personenbezogene Unterlagen der Reichskulturkammer (RKK))
Universitätsarchiv Göttingen, Jur. Prom. 9357 (Mollat, Johann Georg Martin Fürchtegott – Exegese von c. 3 X de consuet. 1,4 – Ref.: Mejer ), 8.1.1884
Niedersächsisches Landesarchiv Wolfenbüttel, 3 Z Nr. 20/276, 1 Artikel, Mollat Dr; wissenschaftlicher Hilfsarbeiter in Braunschweig , Braunschweigische Landeszeitung 23.07.1896 Nr.341
Niedersächsisches Landesarchiv Wolfenbüttel, 3 Z Nr. 20/277, 1 Artikel, Mollat, G.; ehemaliger Sekretär der Handelskammer in Braunschweig, Braunschweigische Anzeigen 25.10.1897 Nr.295
Netz:
Aktive Gedenkbuch für die Opfer des Nationalsozialismus im Kreis Siegen-Wittgenstein, Link: http://aktives-gedenkbuch.de/index.php/About/glossar#M (Aufruf: 6.3.2020)
Das Stadtarchiv Freudenberg ist derzeitig nur
ab dem 17. März 2020 nur noch
schriftlich, telefonisch und per Mail zu erreichen.
Mórer Platz 1,
02734 / 43-148, d.koeppen@freudenberg-stadt.de
Das Universitätsarchiv Siegen schließt ebenfalls ab morgen, 20.03.2020, bis mindestens 20.04.2020 (Option 03.05.2020) und ist dann nur noch per E-Mail erreichbar: archiv@ub.uni-siegen.de.
Kurze Anleitung, wie der Landmann und diejenige, so keinen Arzt erlangen können, bey herumgehender Ruhr und in denen Jahreszeiten, da solche gewöhnlich sich einzufinden pfleget, sich zu verhalten haben, für die Fürstl. Oranien Nassauische Lande entworfen. 1779 (32 S.).
Nöthige Belehrung bey der an vielen Orten grassierenden Ruhr,
in: Dillenburgische Intelligenz-Nachrichten 1781, Sp. 614-616.
Ein Blick in das verflossene Jahr 1781 bei Gelegenheit der hin und wieder verbreiteten Ruhr,
in: D.I.N. 1782, Sp. 81-90.
Beyträge zur Geschichte der Pest, die 1607 u. 1625 im Nassauischen geherrscht hat,
in: D.I.N. 1799, Sp. 593-597.
……. und manches mehr in den alten Intelligenz-Nachrichten.
Interessant wäre eine Dokumentation des Umgangs mit der Spanischen Grippe im Siegerland 1918/19. Läge die Siegener Zeitung digitalisiert vor, könnte man eine solche Presseschau jetzt sehr schön im „Home Office“ zusammenstellen. Was lehrt uns dies?
1) Danke für die Ergänzungen!
2) Ja, ich habe mich selbst etwas gewundert, dass zur Spanischen Grippe nichts vorlag.
3) Für Wittgenstein könnte ja nun geforscht werden s. http://www.siwiarchiv.de/zeit-punkt-nrw-zeitungen-aus-dem-altkreis-wittgenstein-online/
4) Digitalisierung im Kulturnereich wird ein intensivewres Thema – wäre eine schöne Lehre …..
Zu Punkt 3) Im Wittgensteiner Kreisblatt findet sich folgendes (Quelle: Auszug aus dem Wittgensteiner Kreisblatt 1914 – 1919 (PDF)
1918/55: Die“spanische Krankheit“ (Grippe) in Wittgenstein
1918/84,85,87: Verstärktes Auftreten von Grippe, Ratschläge
es ist mal lob und dank fällig für das stets interessante und manchmal augenzwinkernde rss-feed des kreisarchivs! das macht spass so. immer wieder bekomme ich anregungen zu ausflügen oder zur eigenen online-recherche.
Die Angaben sind korrekt. Das Bild war wegen der vorgenommenen Bearbeitungen bewusst nicht beschriftet worden und sollte lediglich als „Symbolbild“ dienen.
die erwähnte ausstellung war ein wichtiger schritt zur bewussthaltung des künstlers. der vortrag bei der führung durch die ausstellung ging durchaus ein auf die vorwürfe, Kuhmichel sei ein „nazikünstler“ gewesen. auch mit der liste oben sowie der broschüre „kunst im öffentlichen raum“ in siegen gibt es nun einen weiteren baustein, der vielleicht und hoffentlich irgendwann zu einem ausführlichen katalog führt.
Wehrmacht: Na ja, das ist das, was als „ruhige Kugel“ zu bezeichnen wäre. Eine Art informelle UK-Stellung, in der er in aller Ruhe an seinen Propagandawerken arbeiten konnte. Das hatte er sich verdient.
Die Promotionsakte ist im Archiv der Universität Marburg vorhanden. Signatur ist in der to-do-Liste am Ende dieses Eintragsd zu finden. Erstaunlicherweise findet sich in den Bilbiothekskatalogen die gedruckte Dissertation Dapprichs mit folgendem Titel: „Die „Autarkie“ des Aristoteles und der „totale Staat“, so dass hier tatsächlich Klärungsbedarf besteht.
@ Herr Garmeister,
Ist es wieder Seitenhieb, gegen das System, in denen Sie sich so benachteiligt fühlen ? Welches keine Rücksicht auf solche Menschen wie Sie nimmt ? In anderen grenzwertigen Kommentaren, von Ihnen im Netz, haben Sie doch schon Ihren Unmut über die Regierung und über das Handeln der Oberen bekundet.
Es sind immer die gleichen gescheiterten Existenzen, die über alles schimpfen und immer benachteiligt werden.
Der Staat ist an Ihren Versagen, nicht schuld. Das haben Sie selbst zu verantworten.
Weitere Ergänzungen:
– Schenck, Karl Albert [war übrigens der Siegener Kreisphysikus],
Versuche mit dem Hahnemann’schen Präservatif [Belladonna] gegen das Scharlachfieber [in Hilchenbach 1810]
in: Journal der practischen Heilkunde [hrsg. v. C. W. Hufeland],
34 (1812), 5. Stück, S. 119-126.
– Ders.,
Neue Bestätigung der Kraft der Belladonna, durch Schützung einer ganzen Stadt [Siegen] gegen Verbreitung des Scharlachfiebers,
in: Ebenda, 56 (1823), 4. Stück, S. 3-17.
Aber jetzt bitte keine Experimente mit Belladonna (Tollkirsche) gegen Corona unternehmen!
Danke für die Ergänzung! Ich habe den Eindruck, dass die regionalen Kreisphysici bzw. -ärzte zeitnah einer intensiveren Betrachtung unterzogen werden (sollten). Bernd Plaum arbeitet in seinem Beitrag zur „spanischen Grippe“ im Siegerland die Rolle des damaligen Kreisarztes Heinrich Hensgen heraus – s. https://geschichtswerkstatt-siegen.de/texte/ . Hensgen war, wenn meine ersten oberflächlichen Recherchen nicht trügen, ein „Desinfektions-Fachmann“. Personalakte im Geheimen Staatsarchiv Stiftung Preußischer Kulturbesitz und Promotionsunterlagen im Archiv der Universität Greifswald liegen vor.
1) s. a. Alma Kreuter: Deutschsprachige Neurologen und Psychiater. Ein biographisch-bibliographisches Lexikon von den Vorläufern bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts , München 1996, S. 490. Dort auch weitere noch nicht im Wikipedia-Eintrag ausgewiesene Veröffentlichungen Guders
2) Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, I. HA Rep. 76[I. HA Rep. 76 Kultusministerium, Ältere Medizinalregistratur, Personalakten und Personalunterlagen der älteren Medizinalregistratur, Buchstabe G (1850-1922)], VIII A Nr. 4401 Guder, Paul Martin Philipp; geb. in Modritz, 1880 – 1921
Die Reflektion im Fenster beschäftigt mich – etwas aus dem Technikmuseum in Freudenberg? Der zweite Hinweis könnte evtl. (besonders, wenn man sich das blau eingefärbte Foto ansieht) auch eine Abdeckung von einem Brunnen sein – ich hatte es erst für ein Wagenrad gehalten, aber eine Brunnenabdeckung würde auch Sinn machen. Lieben Gruß aus Burbach, Sven
@ alle: Vielen Dank für die zahlreichen Lösungsversuche! Ich bitte um Nachsicht, dass ich mir als Admin über die Feiertage ein wenig Blogferne gegönnt habe.
@ Tobias, Lena, Daniel: Gratulation zur richtigen Antwort!
Hier die Auflösung für alle:
Aus Bundesarchiv Berlin: R 9361-V/29272 (Sammlung Berlin Document Center (BDC): Personenbezogene Unterlagen der Reichskulturkammer (RKK)) geht nach Recherchen von Helmut Géwalt hervor,
1) dass Mollat in Siegen der Loge „Zu den drei eisernen Bergen“ angehörte. Er dürfte bis zur Auflösung der Logen im Herbst 1933 weiter Mitglied dieser Loge oder einer anderen Tochterloge der Mutterloge „Zu den drei Weltkugeln“ gewesen sein.
2) dass Mollat Sommer 1896 eine Landwehrübung gemacht und als Vizefeldwebel der Landwehr entlasssen worden ist
3) dass Mollat von 1871 bis 1880 das Kasseler Lyceum Fridericeanum besucht hat,
4) dass Mollat bei der Handelskammer in Frankfurt/oder 12 kaufmännische Fortbildungsschule gründete,
6) dass Mollat in Siegen Lehrer des Volksbildungsvereins, Mitglied des Kuratoriums des Realgymnasiums, des Lyzeums, der gewerblichen
Fortbildungsschule und der Stadtschuldeputation war,
7) dass Mollat bei der Wahl zur NAtionalversammlung im Januar 1919 als Kandidat der DVP antrat,
8) dass er August 1920 als geschäftsführendes Vorstandsmitglied des „Vereins deutscher Eichenloh-Sohlledergerber“ nach Berlin übersiedelte,
9) dass er in dieser Funktion bis 1923 – Auflösung des Vereins – arbeitete,
10) dass er bis 1930 als Leiter der Berliner Geschäftstelle der Handelskammer und des Berg- und Hüttenmännischen Vereins zu Siegen tätig war,
11) dass ihm am 8. Januar 1934 anlässlich des Goldenen Doktor-Jubiläums der Titel Dr.jur. durch die Rechts= und Staatswissenschaftliche
Fakultät zu Göttingen verliehen wurde.
Ferner weist Gewalt auf einen Brief Mollats im Nachlass Friedrich Meineckes hin (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, VI HA NL Meinecke, F. Nr. 29).
Bernert gibt in seinem Beitrag folgende hier noch nicht genannte Quellen an:
1) Kürschners Deutscher Gelehrtenkalender 1931, S. 1986-1987
2) Siegener Zeitung, 20./21.3. 1943
3) Verzeichnis der deutschen Handelskammerbeamten 1930, S. 213
4) Jahrbuch der deutschen Industrie- und Handelskammern 1925, Nr. 199
5) Jahrbuch der deutschen Industrie- und Handelskammern 1928, Nr. 80, S. 681
6) Jahrbuch der deutschen Industrie- und Handelskammern 1930, S. 32
7) Georg Wenzel. Deutscher Wirtschaftsführer. Lebensgänge deutscher Wirtschaftspersönlichkeiten; ein Nachschlagebuch über 13000 Wirtschaftspersönlichkeiten unserer Zeit, Hamburg 1929, Sp. 1526
Zudem erwähnt er noch folgende Publikationen Mollats:
– Die juristischen Prüfungen und der Vorbereitungsdienst zum Richteramte. Sammlung der in den deutschen Bundesstaaten geltenden Vorschriften. In fünf Abteilungen, Berlin 1886
– Rechtsphilosophisches aus Leibnizens ungedruckten Schriften, Leipzig 1895
-Geschichte der deutschen Staatswissenschaften von Kant bis Bluntschli, i. Abt. Lesebuch zur Geschichte der Staatswissenschaften, Kassel 1890
– Lesebuch zur Geschichte der Staatswissenschaften des Auslandes, Osterwieck 1891
– Lesebuch zur Geschichte der deutschen Staatswissenschaften von Engelbert von Volkersdorf bis Johannes Stephan Pütter, Tübingen 1891
– Volkswirtschaftliches Lesebuch für Kaufleute, Frankfurt/oder 1905
Bernert gibt noch folgende biographische Details:
1) Eltern: Johann Wilhelm Mollat, Metzgermeister und Stadtrat, Johanna Louise Wilhelmine AlbertineHenriette Credé [lt. Gewalt ist der Vater noch zu überprüfen]
2) Heirat 2.7.1898 in Kassel Julie Eleonore Auguste Berlit (*25.9.1876 in Kassel, +10.2.1959 in Frankfurt/Main)
3) 3 Kinder: 9.5.1899 Wilhelm (Assistent an der Handelskammer in Siegen, Ministerialrat in Bonn), 8.2.1901 Hellmuth (Kaufmann), 30.12.1902 Lore
4) Ostern 1869 höhere Bürgerschule, dananch Privatschule
5) Sterbeort: Ranis/Thür.
Heinz Stötzel verweist in seinem Beitrag „Lernen und beten an einem Ort. Kapellenschulen der Brauersdorf, Nauholz und Obernau“ (Siegener Zeitung, Heimatland v. 11. April 2020) auf folgende, archivischen Quellen:
1) Archiv der Stadt Netphen, Schulakte Brauersdorf-Nauholz 1841-1910, Register-Nr. 415
2) Archiv der ev. Kirchengemeinde Netphen, Schulakte Obernau
Wenn einem schon ein „Blick in die Bestände“ versprochen wird, dann ist es deprimierend, dass man als interessierter Betrachter mit Bildern in einer solch schlechten Bildqualität abgespeist wird. Es ist sehr wünschenswert, wenn hier umgehend sowohl rückwirkend als auch für die Zukunft deutlich nachgebessert wird.
Liebe Frau Schulz!
Mein Vater war Schüler des Fürst-Johann Gymnasiums, wo er 1952 sein Abitur gemacht hat und wahrscheinlich bei Ihrem Großvater Kunstunterricht hatte. Beim Aufräumen in meinem Elternhaus habe ich 2 Bilder Ihres Großvaters gefunden.
Wenn Sie möchten, können Sie mit mir Kontakt aufnehmen.
Hallo Frau Vollmer,
das ist ja sehr nett, danke, gerne können Sie mir die Bilder mal per Whats up schicken…
0170-8350263
dann schaue ich mir Sie mal an.
Wo wohnen Sie und lebt Ihr Vater noch ??
Ich lebe in München.
Mit freundlichen Grüßen
Heike Schulz
Guten Abend, ich schreibe sie an bezüglich der Dinge die in der Corona Zeit gemacht werden. Ich lade sie herzlich ein unsere Seite bei Facebook #SiegerlandStones zu besuchen.
Gerne Können sie auch in Kontakt mit uns treten 02734/439428.
Hierbei handelt es sich um Wandersteine die gemalt ausgelegt und gefunden werden. Dieses ist mit Facebook verknüpft so das die gemalten und gefundenen Steine gepostet werden. Analoges mit Digitalem verbinden. Bei Intresse gerne melden wie wir etwas für sie tun können, oder selber mal in der Gruppe eine Konservation starten.
Mit freundlichen Grüßen
Katja Bruland mit Sabrina Ohrendorf und Rebecca Schepp
Wenn es mal im Kreisarchiv nicht mehr so läuft, empfehle ich „The Royal Archives“. Da könnten Sie, lieber Jubilar, der Queen dann immer persönlich gratulieren (und sie Ihnen).
Das durchaus moderne Selbstbild des Archivs lässt sich dieser Stellenausschreibung entnehmen: https://theroyalhousehold.tal.net/vx/mobile-0/appcentre-1/brand-0/candidate/so/pm/1/pl/4/opp/1144-Archives-Manager
Nein, dahin wird wahrlich niemand „strafversetzt“! Leider ist die Bewerbungsfrist vor vier Jahren abgelaufen, aber vielleicht gibt es mal wieder eine Gelegenheit.
Hoffentlich erinnert man sich und schmükt sich nicht an den Wächter der Gruft und Seinem Nachfölger die immer wieder zu festen Zeiten fachkundige Führrungen machten! Wer waren diese Männer?Traurig den Wächter der Gruft und seinen Nachfolger nicht den Namen nach zu kennen!(Erinnerungsschild haben Beide , nein ist man Ihnen schuldig)
Also künftig wird an festen Zeiten us w, ist doch nichts Neues, nein, verschlafen hat Siegen,das Geschichtsbewußte,ja, eingeschlafen ist Alles was in den Hän -den des des des HV lag Keine Ruhmestat das Erwachen lassen unter der Führrung der oben angeführten Personen.
Es handelt sich hierbei um das Digitalisat des Exemplars aus der Königlichen Bibliothek Den Haag. Zwei weitere Digitalisate sind via Google Books im Volltext (PDF) zugänglich, nämlich von den Exemplaren der Bayerischen Staatsbibliothek und der British Library. Ich frage mich, warum große Bibliotheken ihre Scan-Vorhaben nicht abstimmen, um die mehrfache zeitaufwendige Bearbeitung gleicher Titel zu vermeiden. Das käme am Ende der Vielfalt zugute.
Eine ausführliche Biographie Kienzlers sollte auch folgendes berücksichtigen:
Bundesarchiv Berlin, R 2/117666 (Reichsfinanzministerium), Personalakte Herbert Kienzler, 4.6.1907in Eichen/Nidder, Regierungsbausrat Preuß. Staatsbauamt Teschen
Zum Schuleintrag vom 23. November 1918 in der Schulchronik Benfe:
Richtig ist, dass die Chronik 1898 im staatlichen Auftrag von Lehrer Hugo Gössing (aus Wambel bei Dortmund) begonnen wurde. Gössing war vom 1. April 1898 bis 31. März 1901 Lehrer der Dorfschule Benfe. Die erwähnte handschriftliche Eintragung dürfte von Lehrer Heinrich Blau (geb. 23.01.1893) aus Herne stammen, der mindestens seit Nov. 1917 als Ersatz für den gefallenen Vorgänger Karl Dürr aus Erndtebrück (+ 11.12.1917 Frankreich) in Benfe tätig war und offenbar bis 30. März 1919 blieb. Quelle: Dieter Bald: Die Geschichte der Dorfschule Benfe, in: Dorfbuch Benfe, Heimatverein Benfe e.V. (Hg), Erndtebrück 2015, S. 185-212.
PS: Dem Artikel ist eine Liste sämtlicher Dorfschullehrer in Benfe beigefügt.
Vielen Dank für die Präzisierung! Die Schulchronik selbst enthält biographischen Angaben aller Lehrer*innen der Benfer Volksschule. In der preußischen Volksschullehrerkartei findet sich eine Karte zu Hugo Gössing.
Lothar Irle bemerkt im „Siegerländer Persönlichkeiten- und Geschlechter-Lexikon“, Siegen 1974, S. 173, zu Kienzler: “ ….. 1972 im Ruhestand,. Mehrere Jahre als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Leiter von Kreisbauämtern im Regierungsbezirk Arnsberg tätig, gehörte dem Planungsausschuß des Deutschen Verbandes für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung an, eines der beide Mitglieder des Deutschen Landkreistages im Kuratorium des Oberprüfungsamtes für die höhere technischen Verwaltungsbeamten zu Frankfurt am Main. Siehe: SZ, 3.6.1971, 23.7.1971, 3.6.1972, 1.7.1972″
Weitere Literatur zu Scheiner:
Wolfram Erber: Edition deutzkultur, Alt-Deutz in Bildern der Maler Jakob und Wilhelm Scheiner, Ansichten von Köln-Deutz aus der Jahrhundertwende, Köln 2018
Wolfram Erber: Zeugen des Kölner Stadtwandels, Die Maler Jakob und Wilhelm Scheiner, in: Draußenseiter, Das Kölner Straßenmagazin, Nr. 187, Köln, April 2018
Ich freue mich, dass der Brief meiner Großmutter veröffentlicht wird. Sicher sind viele solcher Brief geschrieben und verschickt worden. Wir haben noch einen 2. vom 8. Mai von anderer Verwandschaft. Aber dieser gibt mir auch heute noch einen Blick auf das Aufatmen und Bangen an diesem besonderen Tag.
„Frieden ist geworden“, hat sie geschrieben, nun ja, der Krieg war beendet.
Frieden können wir Menschen noch immer nicht so gut.
Siegfried Vogt war von der 5. Klasse an, damals Sechsta, mein Kunstlehrer am Mädchengymnasium. Er hat während der Unterrichte seine persönliche Sichtweise auf die Welt zur Verfügung gestellt, zb den Unterschied von „Lieschen Müller zu Frau Dr. kaufen ein paar Scheiben Wurst beim Metzger“. Wie unterscheiden sie sich im Benehmen, was können wir beobachten? Oder er hat uns das „Sehen“ beigebracht, das man zum Zeichnen braucht: „wenn da das Bein und hier der Fuß und so die Perspektive, dann ist die Linie so… Sonst brechen wir ihr den Fuß.“
Er konnte Pferde von innen nach außen auf die Tafel zeichnen, frei Hand begonnen bei den Knochen und Gelenken, Muskeln aufgelelegt, Haut drüber …fertig.
Er war immer ganz bei der Kunst. Wenn Schülerinnen schwänzten hat er es nicht beachtet und mit denen gearbeitet, die da waren.
Es gibt viele kleine Situationen, an die ich mich erinnere. Und ja, er war auch Schüler von Otto Dix, zumindest beim Aktzeichnen, denn er berichtete von einer Begebenheit, als ein Aktmodell durch das lange Stehen ohnmächtig wurde. Die Studenten sprangen auf, um zu helfen, während Otto Dix rief: „lasst sie liegen, lasst sie liegen… Jetzt hat sie die richtige Farbe!“ wenn ich Dix-Bilder ansehe, möchte ich die Geschichte sofort glauben!
Ich fand diesen Kunstmaler, der keine Hochachtung zeigte vor Reglements in den 70ern ganz wunderbar. Ihn habe ich geachtet, da er irgendwie echt war und menschlich! Vor Krieg und Kriegsdienst hat er stets gewarnt. Er erzählte von seinen grausamen Erlebnissen… Einmal brachte er Zeichnungen und Skizzen aus der Gefangenschaft in Russland mit. Sie waren nicht schön, aber sehr berührend!
Er zeichnete immer, auch bei Konferenzen, notfalls auf dem Butterbrotpapier. Und er hatte die Idee, dass er sich mit dem, was er malt oder zeichnet innerlich verbinden muss, „…dann werde ich ganz die Jungfrau Maria“, sagte er, legte den Kopf zur Seite und lächelte sanft. Das sah echt und ulkig aus, wenn der alte Mann das tat.
Ich bin Kunst-Therapeutin geworden. Und das liegt auch an dem Unterricht von Siegfried Vogt.
ich war zutiefst bewegt, als ich die Zeilen las.
Schöner kann man unseren verstobenen Vater nicht würdigen.
Die Zeit in den Siegener Gymnasien zählte bestimmt zu seinen schönsten Zeiten, von denen er ja wirklich nicht viele erleben durfte, was ja für die ganze Generation galt.
Ich erinnere mich, wie oft er von „seinen Schülern“ und „seinen Schulen“ schwärmte.
Ich wünsche Ihnen für Ihre Tätigkeit alles Gute und genau solch liebe Schüler, wie Sie es einmal waren!
Wolfram Vogt
Folgender Satz bleibt unklar:
„Am 1. Juni 1817 kam der Kreis Siegen zum Regierungsbezirk Arnsberg der Provinz Westfalen, nachdem das Gebiet vorher kurz der Provinz Jülich-Kleve-Berg angegliedert worden war.“
Gehörte also der Kreis Siegen vor dem 1. Juni 1817 kurze Zeit zur Provinz Jülich-Kleve-Berg? Diese Aussage macht stutzig, wenn man dazu die Bekanntmachung Nr. 342 der Königlich-Preußischen Regierung zu Arnsberg liest und dort steht, dass „der Kreis Siegen von dem Regierungs-Departement Coblenz getrennt, mit dem Regierungs-Bezirke Arnsberg vereinigt“ werde. Die Eingliederung des Kreises Siegen wird mit dem 1. Juni 1817 angegeben.
Quelle: Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Arnsberg, Nr. 36 v. 18. Juni 1817, S. 341.
Danke für den Hinweis! Der Eintrag stellt eine Zusammenfassung des Forschungsstandes dar, der sich für die frühe Verwaltungsgeschichte des Kreises Siegen wohl auf Hans Kruse bezieht. Ich überprüfe es.
Zur archivrechtlichen Bewertung s. Thomas Henne, „Gleich- oder nachrangig? Die Auswertung von Archivgut als Aufgabe von Archiven – die gesetzlichen Vorgaben“, Archivwelt, 18/05/2020, https://archivwelt.hypotheses.org/2338.
Hans Kruse, Das Siegerland unter preußischer Herrschaft, S. 44:
„Wegen seiner [Siegens] früheren Zugehörigkeit zum Großherzogtum Berg hätte es nahe gelegen, es der Düsseldorfer Regierung, also dem 1816 gebildeten Oberpräsidialbezirk Jülich, Kleve und Berg zuzuweisen. Da seine Übergabe an Preußen aber einige Wochen später erfolgte, als die der Düsseldorf zugeteilten Gebiete und es territorial und geographisch mit den von Nassau abgetretenen Gebieten am Rhein und auf dem Westerwalde eng zusammenhing, war es natürlich, daß der neugebildete Kreis Siegen dem ehemals nassauischen, nun preußischen Regierungsbezirk Ehrenbreitstein angegliedert wurde, der zum Oberpräsidialbezirk des Großherzogtums Niederrhein mit dem Sitz des Oberpräsidiums in Koblenz gehörte.“
Das ist eindeutig, und ich sehe keinen Grund, Kruses Aussage anzuzweifeln. Statt „Jülich-Cleve-Berg“ müsste es in dem Zeitungsartikel also „Niederrhein“ heißen. (Die Provinzen NR und JCB wurden dann 1822 zur Rheinprovinz vereinigt.)
Vielen Dank für die Klarstellung!
Der Hinweis zur kurzen Zugehörigkeit zur Provinz Jülich-Kleve-Berg fusst laut Wikipedia auf: August Horn: Das Siegthal – von der Mündung des Flusses bis zur Quelle. Verlag von T. Habicht, Bonn 1854, s. Link zur Online-Ausgabe auf siwiarchiv. Im Kaptiel zur Geschichte des Siegerlandes finde ich jedoch auf die Schnelle keinen Beleg für die im Wikipedia-Eintrag gemachte Äußerung.
Wikipedia bzw. der Autor des Beitrags zur Kreisgeschichte hat kein Monopol auf diesen Lapsus: Als angeblicher Teil der Provinz Jülich-Cleve-Berg und dort dem Regierungsbezirk Düsseldorf zugeordnet erschien Siegen schon 200 Jahre früher in einem Werk des Erlanger Gelehrten (v.a. Anglisten) Johann Christian Fick (1763-1821): Geographisch-statistische Beschreibung aller Staaten und Nationen der Erde. Ein Handbuch für Jeden, nach den besten Hülfsquellen und den neuesten politischen Veränderungen bearbeitet, Erster Theil, Nürnberg bey Friedrich Campe 1817, S. 315 f.
Wie zuverlässig die Angaben in solchen einst beliebten ambitionierten Fleißarbeiten sind, bedarf sicher keiner Erörterung.
In einem Nachfolgewerk korrigierte Herr Fick zwar diesen Fehler, verspätete sich damit aber leider so sehr, dass wieder Unsinn herauskam: Das Lehrbuch der Geographie oder Beschreibung der Erde und ihrer Bewohner, 2. Auflage, Nürnberg 1825, S. 100 ordnete Siegen nun der Provinz Niederrhein zu, was ja schon beim Erscheinen der (mir nicht vorliegenden) 1. Auflage 1820 überholt war, abgesehen davon, dass es 1825 auch die Provinz Niederrhein gar nicht mehr gab.
Ficks Buch von 1817 hatte, seiner Angabe in der auf März 1817 datierten Vorrede zufolge, schon 2-3 Jahre früher erscheinen sollen, was jedoch wegen der aktuellen territorialen Umbrüche aufgeschoben wurde und dem Autor noch Gelegenheit zu mancherlei Änderungen des Manuskripts gab. Es ist also anzunehmen, dass 1815/16 tatsächlich Gerüchte im Umlauf waren, Siegen solle Jülich-Cleve-Berg zugeordnet werden, was er voreilig für bare Münze nahm. Für ihn in Franken war das Siegerland vermutlich zu abgelegen, als dass er über die dortigen Entwicklungen auf dem laufenden gewesen wäre.
Vielen Dank, lieber Herr Kunzmann, für diesen Hinweis auf die Bemerkungen von Fick. Das war damals scheinbar ein kaum noch zu durchschauendes hin und her schieben von Territorien und Zuständigkeiten.
(Fortsetzung vom 23.5.)
Zurückverfolgen lässt sich die „Jülich-Cleve-Berg-Theorie“ natürlich bis zu Friedrich Wilhelms III. noch aus Wien ergangener „Verordnung wegen verbesserter Einrichtung der Provinzial-Behörden“ vom 30. April 1815 (Gesetz-Sammlung für die Königlich Preußischen Staaten 1815, S.85-98). In der dort gegebenen Übersicht wurden „die von Nassau und Oranien erworbenen Länder“ (die allerdings noch gar nicht in Besitz genommen worden waren) der „Regierung im Herzogthum Berg zu Düsseldorf“ innerhalb der „Provinz Kleve Berg“ zugewiesen. In Anlehnung an die französische Verwaltungsstruktur (Großherzogtum Berg – Département Sieg – Arrondissement Siegen) wäre diese Zuordnung immerhin nachvollziehbar gewesen. Jedoch ist die Verordnung vom 30.4.1815 nie umgesetzt sondern bald fallengelassen worden. Die Einsetzung der neuen Provinzial- und Bezirksregierungen folgte dann wohl weitgehend einer Allerhöchsten Kabinettsordre vom 9. November des gleichen Jahres (in der Gesetz-Sammlung nicht veröffentlicht; vielleicht in einer der späteren Quelleneditionen zu finden). Aber schon im „Patent wegen Besitzergreifung der oranischen Erbländer“ vom 21. Juni 1815 (Gesetz-Sammlung 1815, S. 126-127) hieß es: „Wir vereinigen dieselben mit Unserm Großherzogthum am Nieder-Rheine“, also der zweiten im Entstehen begriffenen Rheinprovinz neben [Jülich-]Cleve-Berg.
Die beiden Provinzen mit ihren schließlich je drei Regierungsbezirken (ursprünglich waren nur je zwei vorgesehen) konstituierten sich am 22. April 1816, ein volles Jahr nach der königlichen Ankündigung. Vom ersten Tag an waren „die oranischen Länder, welche Preußen behält“ der „Regierung zu Coblenz“ im „Ober-Präsidial-Bezirk des Großherzogthums Niederrhein“ unterstellt. (Bekanntmachung in den neuen Amts-Blättern der betroffenen königlichen Regierungen, u.a. Koblenz, Nr. 1 vom 22.4.1815, S. 3 ff.). Eine vorherige wirksame Zuordnung des Siegerlandes (soweit es damals preußisch war) zur anderen Provinz lässt sich also ausschließen.
In der Interimszeit zwischen Juni 1815 („Besitzergreifung“) und Ende April 1816 kann Siegen nur der provisorischen Oberverwaltung des „General-Gouvernements des Nieder- und Mittelrheins“ unterstanden haben, da die Provinzialbehörden ja noch nicht handlungsfähig waren.
Im vorletzten Absatz muss es heißen:
(Bekanntmachung in den neuen Amts-Blättern der betroffenen königlichen Regierungen, u.a. Koblenz, Nr. 1 vom 22.4.1816, S. 3 ff.).
nicht 1815
Einen chronologischen Überblick bietet: Tim Odendahl, „Debatte um Kernaufgaben von Archivierenden streift auch Offene Archive“ im Blog Archive 2.0, 24.5.2020, Link: https://archive20.hypotheses.org/9201
Verstehe ich da etwas falsch ??? Diese Ausstellung fand doch schon 2018 statt. . Wird sie dieses Jahr vielleicht wiederholt ??? Das sollte m.E. hier etwas eindeutiger dargestellt werden, dass es sich bei diesem Beitrag nur um eine Erinnerung handeln soll.
Danke für den Hinweis! Sie haben recht. Ich meinte zwar eine entsprechende Pressenotiz gelesen zu haben, aber eine aktuelle Wiederholung wird nirgendwo angezeigt.
Nachtrag zur Literatur:
Mecking, Sabine: Erstklassige Verwaltungskarrieren bei zweitklassigen Voraussetzungen. Die städtische Funktionselite der westfälischen Gauhauptstadt Münster, in: Schmiechen-Ackermann, Detlef/Kaltenborn, Steffi: Stadtgeschichte in der NS-Zeit. Fallstudien aus Sachsen-Anhalt und vergleichende Perspektiven, Münster 2005, S. 66 – 78. Fissmer wird auf S. 71 erwähnt. Zitat zur Situation westfälischer Großstädte waährend des Nationalsozialismus: “ ….. Statistisch betrachtet wechselte in jeder größeren Stadt einmal der Amtsinhaber. ….“
Aus kirchenarchivischer Sicht würde ich noch ergänzen:
Roger P. Minert: Alte Kirchenbücher richtig lesen. Hand- und Übungsbuch für Familiengeschichtsforscher. Wuppertal 2004.
Aus linksrheinischer Sicht außerdem: Wolfgang Hans Stein: Französisches Verwaltungsschriftgut in Deutschland. Die Departementalverwaltungen in der Zeit der Französischen revolution und des Empire. Marburg 1996.(Anhang mit zahlreichen Faksimiles und Transkriptionen)
Das in der Liste genannte Werk von Heribert Sturm ist 1961 in überarbeiteter und erweiterter Form als selbständige Publikation erschienen. Heribert Sturm: Unsere Schrift. Einführung in die Entwicklung ihrer Stilformen. Neustadt an der Aisch 1961.
Möglicherweise hat der Kollege bei dem Link, der ins Nirwana führte, die letzten Stellen vergessen, und das tschechiche Buch „Klíč k novověké paleografii“ (Schlüssel zur modernen Paläographie) ist gemeint: https://books.google.de/books?id=eAQ5DAAAQBAj&PG
Franz Neugebauer, Fibel zum Erlernen des Schreibens und des Lesens deutscher Handschriften des 19. Und 20. Jahrhunderts, 1. Auflage Dresden 2015, Eigenverlag der Sütterlinstube Dresden.
Die FDP-Fraktion im Siegener Stadtrat unterstützt zurzeit ein Nachdenken über Fissmer – https://www.facebook.com/groups/372599270383625/ – , um ein möglichst komplettes Bild Fissmers zu erhalten , wird hier an dieser Stelle auch auf die Rolle Fissmer beim Schutz des Rheinischen Kulturgüter hingewiesen. NAch dem Erscheinen des Hollywood-Films“ Monuments men“ wurde dieser Aspekt der Stadtgeschichte ja näher beleuchtet, aber meiner Erinnerung nach trat dabei Fissmer nicht explizit in Erscheinung. „immerhin“ wird des Aspekt des Fissmer´schen Wirkens an exponierter Stelle – im Park am Oberen Schloss in Siegen – gedacht:
Zur Rolle Fissmers bei der Unterbringung der Kulturgüter gab zuletzt Auskunft: Josef Lambertz: Siegen und die Odyssee des Aachener Domschatzes im Zweiten Weltkrieg, in: Siegener Beiträge 16 (2011), S. 129-144. Die dort gemachten Aussagen stützen sich u. a. auf: Erich Stephany: Die Schicksaledes Aachener Domschatzes während des Kriegs 1939 – 1945, in: Wilhelm Neuß (Hg.): Krieg und Kunst im Erzbistum Köln und Bistum Aachen, Mönchengladbach 1948 [Stephany war als Aachener Domvikar mit der Verbringung des Domschatzes nach Siegen betraut]. Lambertz erwähnt ein zufälliges Treffen Fissmers mit dem rheinischen Landeskonservator Wolff-Metternich auf einer Zugfahrt, der Siegen als Bergungsort in die rheinischen Überlegungen gebracht habe. Daher scheint eine Auswertung der einschlägigen Bestände des LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum in Pulheim-Brauweiler in Hinblick auf die Rolle Fissmers angezeigt.
In diesem Zusammenhang warten einige Fragen noch auf gründlichere Erörterung durch die Biographen:
1. Der Hainer Stollen war als Schutzraum für Menschen, nicht für Gegenstände ausgebaut und dafür ausgewiesen worden. War die Zweckentfremdung zur Unterbringung der Kunstwerke, um die sich Fissmer aus eigenem Antrieb so eifrig bemüht hatte, legal? (Oder wäre sie es heute?)
2. Für die Kunstwerke wurde eine beträchtliche Fläche des Stollens in Beschlag genommen. (Die genaue Quadratmeter-Zahl habe ich vergessen, ist aber in der Literatur zu finden.) Diese Fläche hätte eine Anzahl von Menschen im dreistelligen Bereich aufnehmen können. Wie viele Schutzsuchende sind bei den Luftangriffen im Stadtzentrum ums Leben gekommen, weil sie am Hainer Stollen wegen dessen vorzeitiger Überfüllung abgewiesen wurden und so schnell keine anderen Räumlichkeiten mehr ansteuern konnten?
3. Hatte Fissmers Übereifer (um nicht zu sagen Sammelleidenschaft) womöglich verhindert, dass für die Unterbringung der Kunstwerke bessere Alternativen gesucht worden wären? Es ist ja überliefert, dass etliche Gegenstände durch die Aufbewahrung in dem dafür klimatisch völlig ungeeigneten Stollen beschädigt oder vernichtet wurden (z.B. Gemälde durch Schimmelbefall).
Überhaupt bieten Leben und Wirken Fissmers Anlass zu vielen Fragen. Manche werden sich wegen verschollener Quellen (z.B. der persönlichen Handakten von 1944/45) nicht mehr beantworten lassen, andere nach intensivem Aktenstudium aber sicher doch. Für Interessierte gäbe es viel zu tun … (Das sollten aber die Siegener Eingeborenen und nicht Zugezogene erledigen.)
Zwei weitere biographische „Baustellen“ + weitere Literatur:
1) Fissmer als „Autor“:
In der regionalen Bilbgraphie von H. R. Vitt ist nur ein Text Fissmers aufgeführt: „Die Entwicklung des städtischen Gemeinwesens in den letzten hundert Jahren“, in Siegener Zeitung v. 10. Januar 1923.
Ferner ist ein Geleitwort Fissmers in der von Hans Kruse herausgegebenen Festschrift „Siegen und das Siegerland 1224/1924“ (Siegen 1924) belegt.
2) Fissmers Rede anlässlich der 725-Jahr-Feier der Stadt Siegen am 1./2. Oktober 1949. Neben Fissmer haben wohl der amtierende Oberbürgermeister Ernst Bach, Regierungspräsident Fritz Fries und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Karl Arnold gesprochen – s. http://www.inside-siegen.de/onlinenews2.php?id=7307&s= . Ein Grußwort in der Festschrift der 725-Jahr-Feier ist ebenfalls vorhanden.
3) Gerhard Hufnagel: Interesse und Verantwortung. Die metallindustriellen Arbeitgeberverbände des Siegerlandes vom Kaiserreich bis zur Deutschen Diktatur, Siegen 200, S. 349, 391
“ …. Noch eine kleine Debatte: Die Linken forderten wortreich, das Germania-Denkmal aus der Fissmer-Anlage zu entfernen. und am Oberen Schlossbei den Kanonen unterzubringen. Dafür gab es keine weitere Untersützung, alle übrigen Fraktionenlehnten das Ansinnen rundweg ab.“ (Quelle: Siegener Zeitung, „Grüne Fissmer-Oase hat Zukunft“, 4.6.2020 [Print])
Die „Germania“ von Prof. Friedrich Reusch (1843-1906) steht für die „Deutschen Einigungskriege“, die Preußen zu verantworten hatte. Indirekt erinnert das Denkmal an den berühmten Roman „Die Waffen nieder!“ von Bertha von Suttner (1843-1914). Das furchtbare Geschehen dieser Kriege ist Inhalt des Romans. Das daraus entstandene Theaterstück wurde 1908 in Siegen uraufgeführt. Die Kosten trug Fabrikant Karl Ley (1858-1941), der bereits 1894, 15 Monate nach der Gründung der Deutschen Friedensgesellschaft durch Bertha von Suttner und Alfred Hermann Fried (1864-1921) in Berlin, die Ortsgruppe der DFG in Siegen gründete.
Das Denkmal und der Name des Platzes symbolisieren „die preußische Zeit“ Siegens.
Wenn man in die Zeitung schaut, muss man sich fragen, ob es wirklich noch sinnvoll ist, sich zu Fissmer um Aufklärung zu bemühen. Dort findet sich neuerdings die mit nichts belegte und belegbare Behauptung, Fissmer sei nach einem Ausschluss aus der Nazi-Partei nach einem Schwarzmarktprozess um das Hotel Kaisergarten dieser Partei wieder beigetreten. Wie kann man irgendwo beitreten, wenn keiner einen will? Nein, 1937 – das hat also mit dieser Schwarzserviergeschichte nichts zu tun – wurde nach jeweils vorausgegangenem Aufnahmeantrag und nach der Zustimmung durch die Parteioberen Fissmer ein zweites Mal aufgenommen. Den ersten Antrag hatte er vor dem Mai 1933 gestellt. Das gefiel dem Gau Westfalen-Süd, wenn auch nicht der Ortsgruppe Siegen-Altstadt. Die mochte ihn mehrheitlich nicht und meldete sich, nachträglich. Warum die Ortsgruppe etwas einzuwenden hatte, ist unbekannt. Politische Differenzen müssen es nicht gewesen sein. Fissmer fiel – wie viele Beitrittsaspiranten – daraufhin unter die von 33 bis 37 geltende allgemeine Beitrittsperre. Was ihn nicht hinderte, der Förderorganisation der SS beizutreten und großzügig über die systematische Misshandlung der Nazi-Gegner im Keller des Braunen Hauses hinwegzusehen, auf die Pfarrer Ochse ihn ansprach.
Nein, es ist wohl einfach so, dass die Fissmer-Mythen gezielt gepflegt und verbreitet wurden und immer noch werden und dass man sich gern öffentlich als ihr Freund zu erkennen gibt, weil sie tatsächlich immer noch ein geeignetes Mittel der Selbstdarstellung sind, sich nämlich als konservative Mitte und Heimatfreund ins Spiel zu bringen. Das schließt dann mit ein, dass man einen schwarzbraunen Politiker, der provokativ noch im Entnazifizierungsverfahren mit dem Hitler-Gruß auftrat, zu einer „national-konservativen“ Ortsgröße veredelt und alles infrage stellt, was diese Darstellung aufklärend infrage stellt.
Das ist leider eine Sorte von Beschäftigung mit der Zeitgeschichte, die nicht ernst genommen werden kann. Oberflächlich geklitterte Geschichte, keine Überraschung.
Wieder so steile Thesen ohne Grundlage und Belege. Der Schriftwechsel über die Wiederaufnahme liegt vor und wird demnächst veröffentlicht. Zitat aus dem Schreiben der Parteikanzlei vom 1.6.1943: Die Mitgliedschaft des Oberbürgermeisters Fissmer ist nach Mitteilung der Gauleitung Westfalen-Süd wiederhergestellt.“ Wie kann man historisch gegen etwas argumentieren, wenn man die Quellen nicht kennt?
Das ist leider eine Sorte von Beschäftigung mit der Zeitgeschichte, die nicht ernst genommen werden kann. Oberflächlich geklitterte Geschichte, keine Überraschung.
Bislang liegt gar nichts vor. Das unterscheidet diese Anmerkung und etwa auch die Beleglage bei dem Hugo-Herrmann-Zitat, das alternativ zu Klaus Dietermanns begründete Zitierung von Hugo Herrmann gesetzt war und sich von diesem bei aller Ähnlichkeit im Inhalt beträchtlich Unterschied, von dem, was hier unter Verweis auf die Literatur und Primärquellen (wie beim Regionalen Personenlexikon) anzutreffen ist. Bislang fehlen die Belege. Na, ich bin mal gespannt.
Im übrigen: Selbst wenn es sich bei dem oben Gesagten um Thesen handeln würde, so wären sie doch nicht „steil“, sondern passten vollständig ins Bild.
Auf kurzem Weg hier aber noch einmal die Belege für Fissmers zwei Anträge auf und Mitgliedschaften in der Nazipartei: Kartei der NSDAP-Mitgliedschaften im Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde.
Beleg für den „Deutschen Gruß“/Hitler-Gruß an den Entn. – Ausschuss: in der Ent. – Akte im Landesarchiv NRW, Abt. Rheinland in Duisburg. Bestand und Signatur jeweils im Regionalen Personenlexikon. Man kann sich Kopien auch schicken lassen.
Nein, es geht nicht um Thesen, sondern um gesicherte Sachverhalte.
Na dann schon jetzt mal die Zitierung: Das zitierte Dokument ist unter der Signatur Bundesarchiv Berlin, R 1501/142146 verzeichnet und enthält das Schreiben der Parteikanzlei an das Reichsinnenministerium.
Es ist insofern schwierig, die Zitierung auf die nun angegebene Quelle zu beziehen, als man leider nicht genau weiß, wo das Zitat beginnt, weil das Anführungszeichen fehlt. Ich setze jetzt mal eins, so wie es sein könnte und komme damit dann zu einer Mitteilung der Parteikanzlei vom 1.6.1943 an das Reichsinnenministerium, mit der eine gleichlautende(?) vorausgegangene Mitteilung der Gauleitung wiedergeben wird:
[„]Die Mitgliedschaft des Oberbürgermeisters Fissmer ist nach Mitteilung der Gauleitung Westfalen-Süd wiederhergestellt.“
Anzunehmen wäre, dass die Mitgleitschaft nach der Schwarzwarengeschichte um das Hotel und Restaurant Kaisergarten durch entweder einen Ausschluss oder eine Suspendierung beendet worden war. Nun wurde sie wiederhergestellt.
Was hatte das aber mit einer Einschätzung von F. als schwarzbraunem Protagonisten einer völkischen, rassistischen und kriegstreiberischen Politik zu tun? Was hat das mit seiner Gegnerschaft gegen den widerständigen Pfarrer Ochse und F.s Drohung mit dem „Heimtücke-Gesetz“ zu tun? Was mit seiner Rolle bei der Synagogenbrandstiftung oder dem Erwerb des Synagogengrundstücks durch die Stadt „als eine wertvolle Ergänzung unseres Besitzes“ (Fissmer)?
Einen „Fund“ wie diesen in diese Kontexte irgendwie auch nur grob einordnen zu können, scheint mir unmöglich.
F. hatte sich früh schon entschieden, der Nazipartei beizutreten und blieb ihr Mitglied bis 1945, bevor er dann im Anschluss in die CDU wechselte so wie andere in die FDP (Ernst Achenbach) oder in die SPD (etliche spätere Wittgensteiner Landräte z. B.).
So sieht das nun mal aus mit der westdeutschen Nach-NS-Geschichte, im ganzen Land und auch nun eben im Siegerland. Das festzustellen, hat nichts „Steiles“, sondern ist eine Binse.
Unbeantwortet blieb noch die Nachfrage nach der Quelle für die Hugo-Herrmann-Zitierung. Ich finde sie deshalb wichtig, weil sie in ihrem Inhalt im Widerspruch zu der Zitierung von Klaus Dietermann steht, der notierte, was Herrmann ihm sagte. Der Widerspruch bezieht sich auf den Tag der Inhaftierung. Wenn sie am 9. November 1938 am hellen Tag stattfand (wie Herrmann drei Mal sagte), muss F. sie wenn vielleicht auch nicht angeordnet, so doch mindestens unterstützt haben. Der frühe Zeitpunkt wäre insofern nicht ungewöhnlich, als es im benachbarten Hessen (und andernorts) mit den Ausschreitungen und Festnahmen schon am 8. November losging. Davon mag er wohl erfahren haben.
An anderer Stelle wurden die Vergabe des Bundesverdienstkreuzes an F. und die im Landesarchiv in Duisburg dazu vorfindlichen Unterlagen angesprochen. Ich bin ja hier nicht weit von dieser Fundstelle entfernt, muss aber sagen, mir reicht vollständig die Vergabe, muss nicht wissen, was dazu verzapft wurde. Es ist eine Ehrung von mutmaßlich vielen tausend, die in Westdeutschland an alte Nazis gingen, beantragt von irgendwelchen ortsprominenten Heimatfreunden mit ähnlichen Biografien und begründet mit irgendwelchen Ortsmythen, die bis heute hochgehalten werden. Heute von jüngeren Politikvertretern, die sich davon immer noch Applaus versprechen und denen es Wurst ist, ob diese Mythen belegbar sind oder nicht. Es geht um die Wirkung auf den Wähler. Dem können die Duisburger Unterlagen nichts hinzufügen. Zeitverschwendung.
Es genügt m. E., was auf dem Tisch liegt. Der Fall F. ist exemplarisch, zeitgeschichlich und rezeptionsgeschichtlich/“erinnerungskulturell“ und F. unter dem Strich und aufs Ganze bezogen ein kleines Licht. Einer der mit seinen reaktionären Auffassungen jeweils bestens in die Zeit passte. Als die Nazis das Siegerland zu einer ihrer Hochburgen machten durch deren aktive Tolerierung und „vaterländische“ Begleitung, dann durch aktive Unterstützung als ihr Vertreter und prominenter Sprecher und schließlich durch seine Ortsprominenz und durch sein Ich-bereue-nichts im anschließenden Kalten Krieg, der nach Typen wie ihm rief. Das waren dann Krieger, wie man sie brauchen könnte, nun natürlich in anderen Parteien.
2011 gab es nach dem Magazin Der Spiegel knapp eine Viertelmillion BVK-Träger, unter ihnen auch nicht wenige nichtdeutsche Empfänger wie etwa der letzte absolute Kaiser der Welt Haile Selassi oder der kubanische Diktator Fulgencio Battista. Maßgabe war „die persönliche Bindung der Tüchtigsten an den Staat“ und da konnte F. ja allerhand vorweisen, wenn auch nicht gerade in seinem Bezug zum Weimarer Verfassungsstaat, den er gemeinsam mit seinen „vaterländischen“ Kameraden tatkräftig kippen half.
Dem Großen BVK, das er nach obligatorischer Überprüfung übrigens durch auch den westdeutschen Verfassungsschutz erhielt, gingen daher das Kriegsverdienstkreuz 2. und dann 1. Klasse voraus, jeweils „mit Schwertern“. Das war auch schon wegen persönlicher Bindung der Tüchtigkeit an den Staat vergeben worden.
Ins Verhältnis ist die Vergabe des BVK zu den Zeitverhältnissen zu setzen. Da waren ja die Ex-Nazis in Politik, Gesellschaft und Beruf häufig noch aktiv anzutreffen. Auch als „Netzwerker“, wie es heut gern heißt. Von den nicht ganz 50.000 BVK-Empfängern des Jahres 1961 – täglich kamen 14 dazu – dürfte ein hoher Anteil aus der NSDAP gekommen sein.
Ein weitaus höherer Anteil als im Schnitt der westdeutschen Gesellschaft, hier geht es ja um Führungsqualitäten und -kontinuitäten.
Bis heute ist das alles, wie die Diskussion anzeigt, unzureichend bearbeitet und unzureichend angekommen. Die „Gnade der späten Geburt“ lässt unbefangen nach bewährten Mitteln symbolischer/demagogischer Politik greifen, und mit dazu gehört die freundliche Öffnung gegenüber der verstorbenen schwarzbraunen Altherrenschaft.
Der gegenwärtige Forschungsstand zu Fissmer lässt in der Tat nicht mehr bahnbrechend Neues erwarten. Aber für diejenigen, die Fissmers lebensrettenden Bunkerbau für öffentlich ehrenwert halten, ist „leider“ eine möglichst lückenlose Auswertung aller einschlägiger Quellen erforderlich, um sich nicht den Vorwurf der mangelnden Gründlichkeit gefallen zu lassen.
Einen Hinweis hat die aktuelle Diskussion noch einmal in Erinnerung gerufen, der so m.W. in den online verfügbaren biografischen Texten nicht vorhanden ist: Fissmer war Mitglied der Nordischen Gesellschaft, ein Mitgliedsmarke findet sich in den Fissmer-Erinnerungen.
Ja, sicher, gegen Gründlichkeit einer Recherche gibt es kein stichhaltiges Argument.
Was Fissmer angeht, ist er m. E. hinreichend ausrecherchiert, wiewohl mit der Zugehörigkeit zur völkischen Nordischen Gesellschaft noch wieder ein weiterer Tupfer das Bild ergänzt.
Was den Weg vom KVK zum BVK angeht, da finde ich, zeigt sich noch wieder ein bemerkenswerter Hinweis auf die die „Stunde Null“ überspringende Kontinuität vom NS- zum westdeutschen Nachfolgestaat. Geht man nur mal das Regionale Personenlexikon durch, das ja ein paar tausend Kurzbiografien versammelt, stellt man fest, dass Fissmer keine seltene Ausnahme war. Ich bin nur bis zum Buchstaben L gegangen. Es waren viele vormalige Nazis bis hin zu Alten Parteigenossen, die später BVK-würdig waren. Ich nenne hier nur exemplarisch Ernst Achenbach, Ernst Bald, Erich Böhne, Friedrich Flick, Konrad Kaletsch, Otto Krasa, Wilhelm Langenbach. Es fiel mir bei diesem Durchgang auf, dass diese BVK-Träger häufig Wirtschaftsbosse oder eng mit der Wirtschaft liiert waren und dass sie häufiger, als es diese kleine Partei erwarten ließ, in der FDP waren.
Hier öffnet sich für die regionale Geschichtsforschung noch wieder ein weites Feld, real- wie rezeptionsgeschichtlich. Lässt sich m. E. nur ohne parteimäßige Befangenheiten und nur in Freiheit von der Ressourcenfrage(!) bearbeiten. Dafür scheinen mir zur Zeit die Voraussetzungen nicht gegeben. Irgendwelche Debatten mit je anderthalb Sätzen in den als „soziale Medien“ betitelten Mitteilungsformen mögen ein Optimum an Aufmerksamkeit herbeiführen, sind in der Sache aber wenig geeignet. Sehr gut finde ich das Angebot der Kreisarchive, an geschichtliche Fragen heranzugehen. Auch zu Fissmer findet man hier nahezu alles, was man braucht, um zu einer Meinung kommen zu können. Hier wäre der Ort für eine ernsthafte Diskussion.
„Nahezu alles“: Mag sein, und das ist sicher eine ganze Menge. Was übrig bleibt und nur im überregionalen Rahmen (Berlin, Koblenz) recherchiert werden könnte, ist m. E. von nicht geringerer Brisanz. Vor allem zwei Fragen drängen sich auf:
1. Ging die Initiative zur Militarisierung Siegens 1934 (mit all ihren späteren Konsequenzen) von Fissmer aus oder war er „nur“ Erfüllungsgehilfe der Reichswehr? Dokumente zu seinen anfänglichen Geheimverhandlungen im Kriegsministerium sind meines Wissens bisher nicht bekannt (womöglich auch gar nicht mehr erhalten).
2. Sofern das Gerücht zutrifft, dass sich im Kulturbauamt im Hermelsbacher Weg eine V2-Leitstelle befunden hat: Welche Rolle spielte Fissmer dabei, dass dieselbe in Siegen und noch dazu in einem Städtischen Verwaltungsgebäude eingerichtet wurde? (Solche der SS unterstehenden Leitstelllen dienten der anfängllichen Funk-Fernsteuerung der V-Waffen nach ihrem Abschuss, u.a. auch der, die am 16.12.1944 im Zentrum Antwerpens einschlug.)
Danke für die Anregungen! War das Kulturbauamt nicht Kreissache? Also war dieses städtische Gebäude dann „nur“ vermietet?
Wenn auch noch nicht durch einen Kirchenbucheintrag oder Eintrag im Standesamt abgesichert, kann ich das mutmaßliche Sterbejahr von Pez beitragen: 1958. Pez war bekanntlich Dorfschullehrer in Herbertshausen. Er hat dort – vermutlich Ende der 1920er Jahre – neben der Schule eine Birke gepflanzt, die heute unter Denkmalschutz steht. Vor Jahrzehnten hat der dortige Schützenverein ein Holzschild an der Birke anbringen lassen: „Johannes Pez 1891 – 1958.“ Pez war nach Kriegsende wegen seiner NS-Belastung aus dem Schuldienst entlassen worden.
Herr Kunzmann liegt m. E. richtig. Ich habe dazu eine Notiz meines Vaters Wilhelm Fries, vermutlich von 1985, die er anlässlich der Erinnerung an die Garnisonswerdung der Stadt Siegen 1935 aufgeschrieben hat: „Bau der Kasernen in Siegen.
Die Baugenehmigung der ersten Kaserne in Siegen (1933) am Wellersberg geht auf das Jahr 1931/32 zurück. Mein Bruder Karl Fries (Anstreichermeister), der an den Kasernen gearbeitet hat, konnte dies auf den Zeichnungen feststellen. Wirtschaftlich war der Bau der Kasernen bei der damaligen großen Arbeitslosigkeit positiv. Wie später festgestellt werden konnte, hat sich der damalige Oberbürgermeister von Siegen, Alfred Fißmer, für den Standort Siegen sehr bemüht.
Bei dieser Gelegenheit denke ich an die Unterhaltung, die Wilhelm Steinbrück und ich Anfang der 30er Jahre mit dem damaligen (ehemaligen!) Ministerpräsidenten von Sachsen, Dr. Erich Zeigner, anlässlich von Vorträgen für die Friedensgesellschaft im Hotel Monopol in Siegen bis nachts 3 Uhr hatten. Zeigner gab uns damals einen Überblick über die geheime Organisation der deutschen Wehrmacht. Fritz Fries zog die Angabe von Dr. Zeigner sehr in Zweifel. Dr. Zeigner sprach damals in einer öffentlichen Versammlung für die DFG bei Langenbach in Siegen, Wilhelmstraße.“
Das Thema der Versammlung am 19. Mai 1931 lautete: „Kommen Hitler und Hugenberg an die Macht?“ Der Pressebericht der Sieg-Rheinischen Volkszeitung dazu ist in meinem Buch über die Deutsche Friedensgesellschaft im Bezirk Sieg-Lahn-Dill wiedergegeben.
Ob H. Bäumers Elaborat zur Kasernengeschichte „einschlägig“ ist, sei dahingestellt. Auf die historischen Hintergründe der Garnisonwerdung Siegens geht er kaum ein, schwelgt dafür ausgiebig in Erinnerungen an die Militärmusik, in deren Genuss die Siegener ab 1935 endlich kamen. Schwamm drüber.
Fissmer (wie auch seine Amtskollegen in anderen Garnisonstädten) hatte in den 1940er Jahren auf Bitten der Wehrmacht eine Geschichte der Garnison geschrieben (Manuskript im Stadtarchiv Siegen vorhanden). Demnach war die Belebung der lokalen und regionalen Wirtschaft ein angenehmer Nebeneffekt (den man m. E. nicht überbewerten sollte, da die Wehrmacht als Bauherr sicherlich ihre eigenen Kriterien für die Auftragsvergaben hatte); das Hauptmotiv war definitiv, so Fissmer, frühzeitig die Kriegsfähigkeit Deutschlands wieder herzustellen, ohne formal gegen die Auflagen des Versailler Vertrages zu verstoßen. Dafür bot sich die Stadt Siegen an: Verkehrsknotenpunkt, militärisch brauchbare Industrieeinrichtungen und vor allem: Nicht weit vom Rhein aber gerade noch außerhalb des entmilitarisierten 50-km-Korridors gelegen.
Neben der von Fissmer verfassten „Geschichte“ lassen auch seine vor dem Krieg und während desselben wiederholt aber vergeblich an die Wehrmachtsführung gerichteten Anträge auf Verlegung weiterer militärischer Einrichtungen keinen Zweifel an seinen Intentionen. Frei nach dem sogenannten US-Präsidenten: „Make Siegen and The Reich great again!“
Herrn Wolfs Frage zum Kulturbauamt ist wohl berechtigt. Über eine Einrichtung des Kreises hätte theoretisch der Landrat seine schützende Hand halten müssen. Wie es sich in diesem Fall verhielt, müssten weitere Recherchen ergeben. Erwähnenswert ist vielleicht, dass Alfred Fissmer seine Aufrüstungsaktivitäten außerhalb der kreisfreien Stadt Siegen nicht als Oberbürgermeister derselben verfolgte (das wäre Amtsmissbrauch gewesen), sondern dafür vom Wehrmachtsfiskus 1935 als Kommissar eingesetzt worden war. (Ernennungsurkunde im Stadtarchiv Siegen.) Mit weitreichenden Vollmachten ausgestattet, hatte er freie Hand, z.B. um ca. 400 ha Haubergsgelände in den Ämtern Weidenau und Freudenberg für den Truppenübungsplatz zu roden und die Trupbacher Haubergsgenossen zu enteignen, weil sie ihm ihr Land nicht verkaufen wollten. Konflikte mit den jeweils amtierenden Landräten, die sich gelegentlich vor vollendete Tatsachen gestellt sahen, waren vorprogrammiert.
Ein Archiv (lat. archivum ‚Aktenschrank‘; aus altgr. ἀρχεῖον archeíon ‚Amtsgebäude‘) ist eine Institution oder Organisationseinheit, in der Archivgut zeitlich unbegrenzt im Rahmen der Zuständigkeit des Archivs oder des jeweiligen Sammlungsschwerpunktes aufbewahrt, benutzbar gemacht und erhalten wird (Archivierung).
2013 hat der umstrittene Siegener Professor Jürgen Bellers Editionen „zurück zu den Akten“ vorgelegt: http://www.siwiarchiv.de/editionen-zuruck-zu-den-akten/ . Wie wohl die Auswahl(kriterien) und die unübersichtliche Zitierweise höchst prblematisch sind, widmet sich eine dieser Editionen der Arbeit Fissmers in den 20er Jahren.
Ein Archiv ist ein Ort, den die geschichtslos in den Tag hineinlebenden 99 Prozent der Menschheit nie betreten und an dem das restliche eine Prozent zu ergründen versucht, welche der beiden Parteien denn nun das Ziel der menschlichen Evolution war.
Das nenne ich mal Vergangenheitsbewältigung! Der Lehrer, ganz offensichtlich ein Anhänger des Nationalsozialismus wird nach 1945 durch amtliche Stellen
aus dem Schuldienst entlassen und die rührigen Dorfbewohner bringen später eine Erinnerungsplakette an einem von ihm gepflanzten Baum an.
Oh dü mei Wittjestä…
Ich nehme allerdings an, dass der Baum unter Naturschutz und nicht unter Denkmalsschutz steht.
@Peter Kunzmann, @Karin Walter, @Christine Wilhelms, @Martina Kämmerer, @Knoll, @Klaus Graf, @Edie-Marie W., @Karsten Kühnel, @Thomas Johann Bauer, @Agnieszka Kleemann
Vielen Dank für das Mitmachen!
Derzeit ist in der lokalen Diskussion die Feststellung zu hören, die Fissmer unterstellte kommunale Polizei sei in die Festnahmeaktion der jüdischen Männer im Kontext der Synagogenbrandstiftung im November 1938 nicht involviert gewesen, und zwar deshalb, weil die Polizei „nicht gewollt“ habe. Mit anderen Worten: weil Fissmer das nicht gewollt habe. Daraus leite sich eine positive Facette im „Gesamtbild“ von Fissmer ab.
Basis dieser Schlussfolgerung ist eine Zitierung von Hugo Hermann, einem der Festgenommenen. Leider ist nicht angegeben, woher sie genommen ist (und auch nicht angegeben, wo sie endet, denn im Fließtext fehlt das Abführungszeichen). Sie ähnelt der Zitierung Hugo Herrmanns durch Klaus Dietermann in dessen Broschüre „Die Siegener Synagoge“ (S. 4). Zu den Unterschieden gehört, dass bei Dietermann Hugo Herrmann die Festnahme dreimal in dem kurzen Text auf den 9. November legte, morgens, was heißen würde, dass es sich um eine Verhaftungsaktion viele Stunden vor der zentralen Anweisung in der Nacht vom 9. auf den 10. November und weit vor den reichsweit sich ereignenden Festnahmen gehandelt hätte. Das wiederum hieße, dass es eine lokale Initiative gewesen wäre und die könnte nicht am Oberbürgermeister vorbei gelaufen sein. Dafür wäre dann Fissmers Wort entscheidend gewesen.
Möglich ist natürlich auch, dass Hugo Herrmann trotz des dreimaligen Verweises auf den 9. November einem Irrtum unterlag. Er war als „Zeitzeuge“ gefragt, und auch Zeitzeugen können irren. Das weiß jeder etwas Ältere ohne nähere Erklärungen. Das besondere Maß an Glaubwürdigkeit, das dieser Quelle im allgemeinen Verständnis zugesprochen wird, ist grundsätzlich nicht gerechtfertigt, auch wenn man die Perspektive nicht auf den „Zeitzeugen als den Feind des Historikers“ zuspitzen muss. Distanz zur Quelle ist also auch hier angebracht.
Wäre der 10. November der Tag gewesen, an dem sich sowohl die Brandstiftung als auch die Festnahmen nach den zentralen Vorgaben ereignet hätten, wäre Folgendes zu berücksichtigen: Es wäre zwischen der Sicherheitspolizei, also Kripo und Gestapo, einerseits und der „grünen“ uniformierten Polizei, die Fissmer unterstand, andererseits zu unterscheiden. Die beiden hatte jeweils unterschiedliche Kompetenzbereiche. Die Verhaftungsaktion war Gestaposache und lag außerhalb der Entscheidungskompetenz von Fissmer. Die Kripo, die an der Brandstelle im Auftrag der Staatsanwaltschaft präsent war, ebenfalls. Aus dem Verhalten von Gestapo und Kripo lässt sich also zu Fissmer nichts ablesen. Kommunale Polizeikräfte schickte er los, um Plünderungen zu verhindern – es sollte von dem, was anschließend vom Reich requiriert werden sollte, nichts wegkommen –, was nicht ganz gelang. Es kam auch zu Plünderungen. Innerhalb der Brandstiftergruppe war mindestens mit dem SS-Mann Schmidt auch die Stadtverwaltung vertreten. Von Reaktionen darauf durch Fissmer ist nichts bekannt.
Die oben zitierte Schlussfolgerung zugunsten des OB geht demnach umfänglich in die Irre.
Zur Rolle Fissmers bei der Etablierung des Landgerichts Siegen s. Walter Irmer/Gerhard Schnautz: Siegens Kampf für sein Landgericht, in: Landgericht Siegen (Hg.): Recht im südlichen Westfalen. Festschrift zum 50jährigen Bestehen des Landgerichts Siegen, Siegen 1983, S. 13 – 19
Hugo Herrmann in seiner Rede am 9. November 1962 in der Geisweider Friesenhalle: „In Siegen geschah weiter nichts. Während man in fast allen Städten und Dörfern sich nicht damit begnügte, die Synagogen zu zerstören, plünderte man dort die Geschäfte und demolierte die Wohnungen der Juden.
Das haben die Siegener Juden dem damaligen Oberbürgermeister Fißmer zu verdanken. Derselbe soll erklärt haben, daß er an der Vernichtung der Synagoge und der Verhaftung der Juden nichts ändern könne. Aber für die Ruhe und Ordnung in der Stadt Siegen habe er zu sorgen. So kam es, daß in unserem Privathaus am Giersberg die ganze Nacht ein Kriminalbeamter gewacht hat. Wohl einmalig in Deutschland. Anderntags fand man in unmittelbarer Nähe Haufen von Flaschen und Steinen.“
Wilhelm Fries hat bezeugt, dass im Geschäft der Familie Frank in Weidenau weder geplündert noch irgendetwas zerstört wurde. SA-Männer haben den Eingang bewacht.
Empfehlenswert: Wolfgang Benz – Gewalt im November 1938 – Die „Reichskristallnacht“. Initial zum Holocaust, Bonn 2018, Sonderausgabe für die Bundeszentrale für politische Bildung
Darin wird beschrieben, dass neben Plünderung und Zerstörung Menschen brutal gequält und getötet wurden.
Hinzuzufügen wäre freilich, dass der wegen Teilnahme an der Synagogenbrandstiftung angeklagte und dann verurteilte Obersturm[bann?]führer der SS Walther Schleifenbaum im Verfahren 1947 erklärte, er habe in Siegen bei den „Ausschreitungen gegen die Juden im November 1938 … auch das zertrümmerte Schaufenster eines jüdischen Geschäftes gesehen.“ Das war eine Aussage, die nicht ent-, sondern belasten konnte.
Mir erzählte als Besucherin der Siegener NS-Gedenkstätte am 7. November 2010 eine ältere Dame (* 1931), ihren Namen lasse ich mal weg, die Kölner Straße in Siegen sei zumindest in einem Teilbereich am Pogromtag mit Scherben übersäht gewesen, wie sie gesehen habe. Gegenstände seien aus Läden auf die Straße geflogen.
Hugo Hermann bezog sich mit dem was er zu Fissmer vortrug und wofür die Siegener Bevölkerung diesem Dank schulde, wie er meinte, auf ein Hörensagen, auf eine umlaufende Entlastungsgeschichte. In der Fissmerschen Entnazifizierungsakte ist tatsächlich dazu Aussage zu finden: 1948 erklärte Fissmer, er habe im November 1938 „Doppelpatrouille mit Karabiner“ durch die Polizei angeordnet, um Plünderungen zu verhindern. Das war eine Aussage, die nicht be-, sondern entlastete. Wäre es so gewesen, was mit der Behauptung von Fissmer natürlich nicht bewiesen ist, würde er nur den Vorgaben von oben entsprochen haben, denn, wie schon gesagt, die Reichsführung hatte im Sinn, statt durch spontan ablaufende Plünderungen sich des Eigentums der jüdischen Minderheit systematisch in einem zentral organisierten geschlossenen Ausplünderungsverfahren anzueignen.
Dass die Siegener Bevölkerung vielleicht sogar stärker als die Bevölkerung anderer Städte der Versuchung zu plündern ausgesetzt war, dafür sprechen die Siegener Vorerfahrungen von 1921, die ja noch in guter Erinnerung gewesen sein werden. 1921 war es vor allem, aber nicht nur auf dem Siegberg im Zuge von Straßenunruhen zu umfangreichen Plünderungen zahlreicher Läden in jüdischer Inhaberschaft gekommen. Fissmer, der schon damals OB, wird das bewusst gewesen sein. Für die Annahme, dass es ihm um das Wohl der jüdischen Bevölkerung gegangen sein könnte, falls er wie von Herrmann behauptet Plünderungen zu unterbinden versucht haben sollte, dafür gibt es keine seriösen Belege.
Und noch einmal zu Hugo Herrmann und zu dessen Erklärung „So kam es, daß in unserem Privathaus am Giersberg die ganze Nacht ein Kriminalbeamter gewacht hat. Wohl einmalig in Deutschland.“ Ob einmalig, muss naturgemäß offen bleiben, die Kripo war auf Anruf gekommen, nachdem ein dicker Stein durch das Fenster des Kinderzimmers geflogen kam, das Steinwerfen hörte daraufhin auf, die Kripo ging wieder, das Steinwerfen wurde fortgesetzt, erneut Kripo (Klaus Dietermann, Die Siegenener Synagoge, S. 24). Wer die zentralstaatliche nichtkommunale Polizei geschickt hatte, ist unbekannt. Gesichert lässt sich sagen, dass nach dem NS-Ende dieser Vorgang ebenso wie die Legende von der Nicht-Plünderung dem Fissmer-Mythos hinzugefügt wurde.
Nein, die Zeitgeschichte hat sich in Siegen so ereignet wie an vielen anderen Orte, der NS-Bürgermeister verhielt sich so wie andere Bürgermeister an anderen Orte auch. Die Stadt war nicht die Ausnahme von der Regel. Was ist daran so schwer zu akzeptieren?
Und schließlich: nichts, von dem, was hier zu lesen ist mit Ausnahme der Angabe der älteren Dame ist neu. Was sich sagen lässt, ist, dass mühsam erarbeitetes gesichertes Wissen dabei ist, zugunsten der Mythen der 1950er bis 1970er Jahre revidiert zu werden. Das ist nach einer ähnlichen Diskussion im vergangenen Jahr erneut das Problem.
Ein Archiv ist der Ort, an dem ich die nächsten Jahre Arbeiten möchte, um digitale und analoge Unterlagen für die kommenden Generationen zu überliefern.
Einverstanden! Allerdings fehlt eine wissenschaftliche Biographie, die z. B. die im Stadtarchiv Siegen befindlichen Diensttagebücher Fissmers auswertet. Ein Ego-Zeugnis zwar, dass sicher präzise bearbeitet werden muss. Aber der Fund der Mitgliedschaft in der Nordischen Gesellschaft, rechtfertigt m.E. die Mühe, diese Auswertung dem bisherigen Kenntnisstand hinzuzufügen. Ob sich dadurch die Politik zu einer eindeutigen Entscheidung hinsichtlich der Fisser-Anlage hinreißen lässt oder gar die uneingeschränkten Fissmer-Befürworter eine kritischere Haltung einnehmen, ist für mich zweitrangig
Zu viele Aufschlüsse sollte man aber gerade von den persönlichen Handakten nicht erwarten. Darin hatte Fissmer eben allmögliches abgeheftet, womit er sich den lieben langen Tag lang beschäftigte. Naturgemäß finden sich da viele (im Rückblick) Banalitäten. Man gewinnt den Eindruck eines Oberbürgermeisters, der seine Augen im Dienst und nach Feierabend überall hatte, dem der gute äußere Eindruck „seiner“ Stadt wichtig war und der sich deshalb über so weltbewegende Mißstände echauffieren konnte wie z.B. Grasbüschel, die auf dem Rathausplatz zwischen den Pflastersteinen wuchsen. Und, wie oben erwähnt, fehlen in dieser Serie die Akten aus den letzten Kriegsjahren. (Warum?)
Von größerem Interesse könnte (den Titeln nach zu vermuten) im Stadtarchiv z.B. eine ganze Reihe von Akten zu Behandlung, Unterbringung und im kommunalen Bereich erfolgtem Arbeitseinsatz von Kriegsgefangenen und zivilen Zwangsarbeitern sein, deren Dienstherr der OB war. Wenn er so ein großer Menschenfreund war, wie die Legende behauptet, müsste sich das ja dann auch in solchen Dokumenten widerspiegeln. (Ich habe da meine Zweifel, aber als Gast in Siegen, der ich erst seit 22 Jahren bin, halte ich mich zurück.)
Wenn die Güte eines Arguments, wie vor wenigen Tagen zu erleben, in Wortmeldungen der Paralleldiskussion wortwörtlich danach abgewogen wurde, ob ein Sprecher innerhalb oder außerhalb des Gebirgskessels zu situieren ist, stößt man auf Qualitätskriterien mit Tradition. Die bringen, ließe sich sagen, in der Sache nichts, aber das stimmt nur halb, sie bringen filzigen Regionaltraditionen, die da eine Weile ein Problem hatten, verlorene Anerkennung. Die sind eben doch immer noch ein gutes Klebemittel.
Sagt jemand, der nicht ganz vier Jahrzehnte Aufenthalt nachweisen kann, was ja so viel nicht ist, und nach seiner Rückkehr an den Ausgangsort („außerhalb“) die Annahme bestätigt fand, dass es dort auch nicht anders zuging und zugeht. Es könnte etwas mit dem ganzen Land zu tun haben, dem „Innerhalb“ aller Gesprächsteilnehmer.
Ich frage mich gerade, ob die Diskussion zwei Ebenen hat ,die gerne miteinander verwoben werden? Eine (erinnerungs)politische Ebene, die hier wie überall in der Bundesrepublik traditionsbehaftet verläuft, und eine geschichtswissenschaftliche, wobei gerade die bis jetzt noch nicht bzw. wenig bekannten Kleinigkeiten nicht uninteressant ist. Der von Fissmer mit Argusaugen überwachtet Strassenzustand in Siegen, dessen Vorschlag zum Weihnachtsmarkt oder dessen Hartnäckigkeit bei der Ansiedlung des Landgerichts sind Mosaiksteine, die zusammengefügt eine präzisere Biographie ergeben werden, die nicht unbedingt Einfluss auf die erinnerungspolitische Diskussion haben wird.
Das trifft m. E. gut den sarkastischen Ton an Stellen der letzten zwei Beiträge (wenn ich nicht nur mich, sondern auch Peter Kunzmann richtig verstanden habe). Es ist natürlich richtig, noch wieder auf das Thema zu verweisen. Wenn wir dann dabei sind, noch wieder zu sammeln, nämlich Bearbeitungsdefizite, dann komme ich noch wieder auf das Regionale Personenlexikon zurück. Dort finden sich die folgenden Stichworte im Fissmer-Artikel zu Fissmers Rolle in der Weimarer Republik:
„ohne enge Parteibindung stets an der Seite des völkisch-nationalistischen Lagers (Selbstbezeichnung: „vaterländisches Lager“) von DNVP, NSDAP, Kriegervereinen, Antisemitischem Schutz- und Trutzbund (Selbstbezeichnung: „Siegerländer Hakenkreuzer“), Bismarckjugend usw., daher wiederholt Konflikte mit Oberbehörden wegen städtischer Toleranz für antirepublikanische Aktivitäten (so 1924 wegen Unterstützung der zunächst als verfassungsfeindlich verbotenen Großveranstaltung „Deutscher Tag“ mit führenden Beiträgen aus der verbotenen NSDAP), nie an der Seite von DDP, SPD, KPD oder des Zentrums in deren Kampf gegen die vereinte Rechte, daher deren gemeinsamer Protest gegen parteiliche und verfassungsfeindliche Politik und Praktiken des OB (1927), schon vor 1933 verbotswidrige Beschäftigung von stadtbekannten Vertretern der äußersten Völkischen im städtischen öffentlichen Dienst (z. B. Wilhelm Langenbach, Deutschvölkische Freiheitsbewegung, Albert Link, NSDAP, Theo Steinbrück, NSDAP) und Entlassung Linker (Willi Kollmann 1932 nach dessen Wechsel von der SPD zur KPD), F. zur Machtübernahme (1933): „Heute weht in [dem Regierungsbezirk] Arnsberg ein anderer Wind.“
Darunter dann Hinweise auf die Quellen. Der Weg ist also vorbereitet, dem gründlicher nachzugehen.
#EinArchivIst Kultureinrichtung für alle Bürgerinnen und Bürger, Dienstleister für die Verwaltung und Anbieter von Forschungsdaten. Archive sind unverzichtbare Akteure für die Wissensgesellschaften. Das Landesarchiv beteiligt sich deshalb am Konsortium @NFDI4memory. #IAW2020pic.twitter.com/EOTrbSu8ef
— Landesarchiv Baden-Württemberg (@LandesarchivBW) June 10, 2020
#EinArchivist immer auch das Spiegelbild einer Gesellschaft für den Umgang mit ihrer eigenen Geschichte. Offene Zugänge zu Archiven sind Zeichen einer guten Demokratie #offenearchive. Gute bauliche und personelle Rahmenbedingungen zeugen von der Wertschätzung des eigenen Trägers.
Ein Archiv ist das Gedächtnis einer Gesellschaft, ein Erinnerungsort, ein Speicher des Vergangenen, ein Schutz vor Vergesslichkeit und gegen das Vergessenmachen.
In der Print-Ausgabe der Siegener Zeitung vom 13.6.2020 finden sich zwei Leserbriefe („Eine PR-Aktion“ und „Scheinheiligkeit“), die sich mit dem FDP- Vorhaben der Umbenennung der Fissmer-Anlage ausinandersetzen.
Für mich ist es wichtig, dieser interessanten Diskussion noch zwei oder drei Dinge hinzuzufügen:
Das auf facebook veröffentlichte Zitat von Hugo Hermann ist dem Buch „Jüdisches Leben in Stadt und Land Siegen“ entnommen (ich unterstelle, dass sich die Frage darauf bezog, das war jetzt nicht so klar formuliert). Klaus Dietermann beruft sich bei der Wiedergabe auf die Tonbandprotokolle. Ich vertraue ihm in dieser Beziehung mehr als anderen, die hier vielleicht anderes lieber sehen würden. Es ist ein Zitat, das mit Einordnung in den Kontext von Nutzen sein kann. Es dient nicht zur Exkulpierung, sondern ist ein Ansatz zu weiteren Recherchen. Welche Zitierung der Kommentator meint, verrät er uns interessanterweise nicht.
Die Fundstelle aus dem Bundesarchiv wurde gewünscht, ich hab` sie geliefert, und nun ist es doch wieder nicht richtig, geschweige denn wichtig. Tatsache ist, dass die Fundstelle die Behauptung gegenstandslos macht (Bei der Gelegenheit: In des Kommentators Beiträgen gibt es viele Behauptungen, die nicht belegt sind.) Das Zitat gehört auch zur Biografie Fissmers dazu, weil es unter anderem zum Verhältnis Fissmers zum Gauleiter aussagekräftig ist.
Zweitens finden sich hier in dieser Gesamtdiskussion so viele Details, dass man vermuten darf, ein Gesamtbild könnte die Stadtforschung in Siegen – und nicht nur die Fissmer-Forschung – einen großen Schritt voranbringen. Ein solches Gesamtbild muss natürlich ergebnisoffen erforscht werden. Man darf aber nicht vom gewünschten Ergebnis her rückwärts ermitteln, um sich dann selber augenzwinkernd zu bestätigen.
Dankbar bin ich für die Hinweise von Peter Kunzmann auf die Aktivitäten Fissmers bei der Akquise zusätzlicher Militäreinrichtungen. Fissmer dürfte sich mit seiner Wirtschaftsförderungsstrategie in die Reihe anderer Garnisonsstadt-Oberbürgermeister würdig eingefügt haben (dazu sei auf die Geschichte der Bielefelder und Herforder Garnison verwiesen) Richtig ist auch, dass die Qualität der Handakten Fissmers ohne Kontext nicht wirklich gut nutzbar sind. Recht hat Herr Kunzmann natürlch auch mit seinen Verweisen auf das Bundesarchiv. Ergänzt werden müsste hier ein Hinweis auf die Qualität der Entnazifizierungsakte von Fissmer im Speziellen und die von Entnazifizierungsakten im Allgemeinen. Erhellend finde ich die ergänzenden Hinweise von Traute Fries zu Hugo Hermann und erlaube mir dazu den Hinweis, dass auch die Rolle Fissmers bei der Vermarktung der Villa Hermann auf dem Giersberg an General Hollidt (zum Einheitswert von, ich glaube 34000 RM) irgendwie aus der Betrachtung herausgefallen ist. Spannend fände ich es auch, einige der hier aufgeworfenen Fragen – etwa zur Entlassung und dem Schicksal des Sparkassenangestellten Friedrich Vetter in den Kontext zu stellen – dass nämlich die Situation der Siegener Sparkasse aufgrund eines bereits zehn Jahren schwelenden Skandals um ein allzu spekulatives Großinvestment nicht ganz einfach war und dass Fissmer damals vom NS-Gauleiter Wagner wegen seiner Rolle in der Sparkassen-Affäre als Oberbürgermeister als „nicht haltbar“ bezeichnet wurde und zum freiwilligen Rücktritt aufgefordert wurde. Kontext und Duktus spannend sein, wenn Fissmer zur Beschleunigung der Siegener Hochbunkerbauten zusätzliche Zwangsarbeiter forderte.
Damit sehe ich der Diskussion im Siegener Rat um die Umbenennung der Fissmer-Anlage sehr gespannt entgegen, wobei ich nicht mit historisch tiefgreifenden Erörterungen rechne. Ebenso gespannt bin ich darauf, ob es – ähnlich wie hier an manchen Stellen – den Versuch geben wird, die notwendige Diskussion auf Fissmer-Freunde und Fissmer-Gegner, auf gute Meinung oder schlechte Meinung zu reduzieren, wie das heute in den Seichtgebieten unserer Diskursgesellschaft Mode geworden ist. Genau das soll es nicht sein. Den Vorwurf der Geschichtsfälschung an Dieter Pfau und sein Team im Zusammenhang mit der Ausstellung im Krönchen-Center 2005 empfinde ich in diesem Kontext als zumindest grenzwertig.
Für mich persönlich nehme ich in Anspruch, dass ich eigentlich nur an dem interessiert bin, was wirklich war, und auch, dass die Stadt mit einem solchen Anstoß den Neueinstieg in eine neue Erinnerungskultur schaffen kann, nachdem bisher in der Tat Erinnerungen, Anekdoten und Mythen eine ziemlich große Rolle spielten. Ich muss auch niemanden verteidigen, vielleicht auch deshalb, weil ich die Fissmer-Frage eher historisch als politisch betrachte.
Tatsache ist: Es handelt sich um einen Bürgerantrag aus dem Jahr 2018, der im Rat diskutiert wird, und nicht um einen Anstoß der FDP-Fraktion. Die Zeitungsberichterstattung war insofern grob fehlerhaft.
Der unausgewiesenen Zitierung von Hugo Herrmann bei facebook stellte ich das Herrmann-Zitat bei Dietermann, Die Siegener Synagoge (1996, 2. Aufl.), S. 4, deshalb gegenüber, weil dieses sich von der facebook-Zitierung an einer ganzen Reihe von Stellen unterschied. Nun sind die Dinge ja geklärt. Ein Vergleich mit der jetzt vorgenommenen Fundstelle für facebook (Dietermann, Jüdisches Leben in Stadt und Land Siegen, 1998, S. 97) ergibt, dass tatsächlich beide Zitierungen Herrmanns durch Klaus Dietermann erstens an etlichen Stellen auseinandergehen und die erste auch sehr viel umfangreicher ist, und dass sie zweitens die Gemeinsamkeit aufweisen, dass der Zitierende beide Male erklärt, er zitiere Herrmann wortwörtlich. Daraus sollte hinreichend deutlich werden können, dass meine Nachfrage unvermeidlich war, solange die Quelle für die facebook-Zitierung fehlte.
Ein Punkt ist aber nicht zu übersehen, eine nun vorgenommene Veränderung durch den Einsteller. Er schreibt auf facebook:
„Der 10. November 1938 um 9:00 Uhr war das Geschäftshaus noch voller Leute, und ich wohnte damals mit meiner Familie oben im Geschäftshaus im obersten Stock, dem siebten. …“
Original:
„Um 9 Uhr war das Geschäftshaus noch voll Leute, und ich wohnte damals mit meiner Familie oben im Geschäftshaus im obersten Stock, im 7. …“
Die dietermannsche fette Überschrift („Der 10. November 1938“) für das Brandstiftungskapitel machte er zu einem Teil seines auch wegen anderer sichtbar werdender Veränderungen fragwürdigen „Zitats“. Ich enthalte mich jedes Versuchs einer Erklärung für diese Umarbeiten, komme aber an der Feststellung nicht vorbei, dass diese eine Einfügung eines Tattags von ganz besonderer Bedeutung ist, denn sie widerspricht Herrmann. Dieser platzierte in dreifacher Betonung die Verhaftungsaktion auf den 9. November und damit viele Stunden vor das Heydrich-Fernschreiben vom 10. November, 1.20 h, in allen Bezirken „insbesondere wohlhabende Juden“ festzunehmen und dazu Kontakt wegen Unterbringung mit den KZ-Leitungen aufzunehmen. Dietermann, dem der Pogrom-Kalender aus der Literatur bekannt gewesen sein wird, hatte keine Zweifel, dass es in Siegen so war, wie von Herrmann mitgeteilt: „Alle jüdischen Männer wurden an diesem Tag [9.11.] verhaftet und ins Rathaus gebracht.“ (Siegener Synagoge, S. 23)
Der Verweis auf den 10. November stellt das infrage, und das ist deshalb hervorzuheben, weil Siegen mit dem 9. November als Verhaftungstag eine Ausnahme darstellt, die nicht ohne mindestens einen wesentlichen Verantwortungsanteil des OB F. als lokalem Polizeichef für diese Verhaftungen erklärbar ist. Plausibel würde sie durch die lokalen Aktivitäten, wie sie sich im benachbarten Hessen, zahlreich in Nordhessen, aber auch andernorts, bereits am 7. und am 8. November ereignet hatten (ich habe in „Mit Scheibenklirren und Johlen“ ausführlich darauf hingewiesen).
Damit sind wir dann beim Kern des Themas. Wenn F. der Diskussion ausgesetzt ist, wenn er als Namengeber infrage gestellt ist, dann geht es dabei um seinen Anteil am Aufstieg, an der Etablierung und an der Sicherung/Erhaltung der Naziherrschaft, um seine Verantwortlichkeiten und um seine Integration in die Naziverhältnisse. Seine Mitgliedschaft in der NSDAP, die durch nichts bestreitbar ist, ist nur ein Ausdruck dafür. Seine Weigerung, sich jemals dazu selbstkritisch zu äußern, ein weiterer. Seine Praxis als NSDAP-OB in Fragen, die den verbrecherischen Charakter der NS-Politik berühren, das ist zu klären, nicht sein Sachbeitrag zur Ausstattung der kommunalen Schulen, zur Regelung der Müllabfuhr oder zum Straßenbau. Diese Form von Aufrechnung geht so daneben wie etwa der Autobahnbau, der wie erinnerlich gern von der Zeitzeugengeneration jahrzehntelang kompensatorisch für „die guten Seiten“ der Nazizeit angeführt wurde. Das ist inzwischen abgeklungen, sollte diese Form der Argumentation nun fürs Siegerland wieder aufgegriffen werden?
Gerade nicht. Ich wiederhole mich gerne. Es geht nicht darum, Fissmer zu exkulpieren, sondern ein historisch stimmiges Gesamtbild zu präsentieren, das die Stadtforschung insgesamt weiterbringen wird. Und wenn Fissmer am Ende fundiert als belastet, als Mittäter betrachtet werden kann (ich glaube auch, dass viele Indizien dafür sprechen), dann ist das so. Seine Nachkriegshaltung zu seiner Rolle in der NS-Zeit ist relevant. Seine Rolle als Leiter der Polizei in der Weimarer Republik gegenüber Nazis und Völkischen ist ebenso relevant. Genau das ist ja das Ziel historischer Forschung, dass man ein stimmiges Gesamtbild hat. Und genau da ist der alte Fissmer eben nicht auserforscht, Herr Peter Kunzmann hat auf die möglichen Quellenfunde in überregionalen Archiven bereits hingewiesen, Traute Fries auf die Nachkriegsbeiträge von Hugo Hermann zu Fissmer, die natürlich immer nur Ausgangspunkt für weitere Fragestellungen sein können. Und dass in der Siegener Erinnerungskultur manches von Mythen und Hörensagen überlagert wird – geschenkt. Das ist das tägliche Brot des Historikers, Licht hineinzubringen.
#einArchivist ein Ort der Beständigkeit, leider vergessen viele Menschen, die in Archiven arbeiten, dass dies Veränderung voraussetzt. #IAW2020#AnArchivels
#EinArchivIst … entgegen üblicher Selbstdarstellung nicht das Gedächtnis der Stadt X oder des Landes Y, sondern der Hort des Vergessenen und Verdrängten, das historische schlechte Gewissen einer Gesellschaft, die kellergewordene Leiche im Keller.— Langewand (@Langewand1) June 14, 2020
#EinArchivIst mit ausgebildeten Archivar*innen besser dran.— Karin Schwarz (@KarinSchwarzFHP) June 14, 2020
Eine biographische Auswertung von R 3001 Reichsjustizministerium 51012 (Bundesarchiv Berlin). Die Akte enthält zudem ein Lichtbild aus dem Jahr 1936:
Geburtsdatum, -ort: 11. November 1904 in Bocholt/Westfalen
Vater: Oberstudiendirektor; 1 Bruder, 1 Schwester
Religion: kath.
1921/1922 – 1924 Ferien“jobs“ während der Schul- und Semesterferien: Notstandsarbeiten beim Gartenbauamt Gladbeck, ungelernter Arbeiter beim städtischen Fuhrpark Gladbeck, Bauhilfsarbeiter auf der Zeche „Gergmannsglück“ bei der Firma B. Gladen, Buer, Bauhilfsarbeiter bei der „Bauindustrie-Genossenschaft“ Gladbeck
Sport: Leichtahtletik, Schlag-, Fußball-, Faustball.
Während der Semester 1923, 1923/24, 1924 Teilnahme an „inoffiziellen“ wehrsportlichen Übungen der studentischen Korporationen in Würzburg. Weitere Teilnahme an wehrsporetlichen Übungen während des Referendariats in Paderborn.
Während der Ruhrbesetzung eintägige Verhaftung und Versagung des Reiseausweises
Referendariatsexamen beim Oberlandesgericht Hamm: 14. – 16. Dezember 1926 nicht bestanden, 27. November/1. Dezember 1928 „ausreichend“, Anschließend Staatsanwaltschaft Essen, Amtsgericht Gladback, Landgericht Münster, Amtsgericht Münster, OLG Hamm, Rechtanwälte und Notare Funke und Bäcker, Paderborn
Assessorexamen: 2. Juli 1932 nicht bestanden, 17. Juli1933 „ausreichend“
20. September 1933 Rechtsanwalt in Siegen
1. April 1933 Eintritt in die SA, dem NSRB und der NSDAP (2 165 439)
24. April 1933 – 15.Mai 1933 Freiwilliger Arbeitsdienst im Lager Hornheide-Sudmühle bei Münster
Aug. 1935 Übernahmne der Praxis Dr. Hamann
28. Juli 1936 Heirat
27. Aug. 1936 Antrag auf Ernennung zum Notar: -abgelehnt
28. Mai 1937 2. Antrag auf Ernennung zum Notar: „Seit der Errichtung des Landgerichts und der Garnison in Siegen sowie dem Wiederaufblühen des Siegener Wirtschaftsleben sei in den Notariaten ein derartiger Aufschwung zu verzeichnen, dass für weitere Notarstellen Platz vorhanden sei, ….. Wiederholt habe er [Bause] Partei- und Volksgenossen an andere Notare verweisen müssen, so habe er eine erhebliche Anzahl von Notariatssachen, die ihm Arbeitsdienstmänner bezw. deren Väter übertragen wollten, ablehnen müssen. Die Zahl der ihm aus den Reihen der SA-Kameraden angetragenen Notariatsgeschäfte sei so gross, dass seine Nichternennung zum Notar für ihm finanziell besonders fühlbar sei. ….“
8. Juni 1937 Ernennung zum Notar
1938 (?) Geburt eines Kindes
Ab Kriegsbeginn 1939 Kriegsdienst:
– September 1940 Feldwebel und Offiziersanwärter beim III Infanterie-Regiment 181 in Frankreich
– zuletzt Oberleutnant und Schwadronführer
– Eisernes Kreuz II
15. September 1940 Antrag Bauses auf Zuweisung eines Notariats in den „zurückgegliederten, westlichen Reichsgebiet“ [Elsass/Lothringen] bzw. Rückkehr in den Staatsdienst nach Kriegsende
1. März.1943 „an den Folgen einer im Osten erlittenen Verwundung gestroben“
Zitat, datiert vom 28. Mai 1937, aus einer Personalakte des Siegener Rechtanwaltes und Notars Fritz Bause: “ …. Seit der Errichtung des Landgerichts und der Garnison in Siegen sowie dem Wiederaufblühen des Siegener Wirtschaftsleben sei in den Notariaten ein derartiger Aufschwung zu verzeichnen, dass für weitere Notarstellen Platz vorhanden sei, ….“
Link: http://www.siwiarchiv.de/fritz-bause-1943-beginn-einer-recherche/#comment-96012 .
Eine Frage an die Wirtschaftshistoriker: Waren Garnison und Landgericht nur teilweise verantwortlich für das Wiedererstarken der Siegener Wirtschaft?
Aufgrund der von Bause selbst gemachten Angaben (s.o.) wurde das Universitätsarchiv Würzburg angeschrieben. In der Studentenkartei lies sich Fritz Bause nachweisen: Bause studierte im Sommersemster 1923, Wintersemester 1923/24 und im Sommersemester 1924 Jura in Würzburg. Sein Abiturzeugnis des Gymnasiums in Bottrop stammte vom 12. März 1923. Ebenfalls auf der Karteikarte ist ein Bild Bauses, wohl aus dem Jahr 1923. Als Vater wurde der in Gladbeck wohnende und wirkende Studiendirektor Josef Bause notiert. Aus dem verlinkten Personalbogen des Vaters geht hervor, Bause insgesamt 3 Geschwister hatte, Der Vtaer war seit 1902 verheiratet und ist am 13. Juni 1929 verstorben.
Verwaltungsvorlage v. 15.6.2020 zur „Umbenennung der Fissmer-Anlage“ für die Sitzung des Rates der Stadt Siegen:
„Beschlussvorschlag:
Der Rat der Universitätsstadt Siegen stellt fest, dass die Grünanlage neben der Nikolaikirche weiterhin den Namen „Alfred FissmerAnlage“ trägt. Darüber hinaus beschließt der Rat, eine Informationstafel zur Person Alfred Fissmer analog bisheriger Hinweise (Acrylausführung) anzubringen. Darüber hinaus werden auf der Webseite https://unser-siegen.com weitergehende Informationen zur Verfügung gestellt.
Sachverhalt / Begründung:
Ausgelöst durch eine Bürgeranregung hat sich der Haupt-und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 30.05.2018 mit der Umbenennung der Alfred-Fissmer-Anlage befasst. In der Vorlage dazu (Nr. 1894/2018) wurde seitens der Verwaltung schon damals beschrieben, dass die Einordnung des ehemaligen Siegener Oberbürgermeisters difizil ist und unterschiedliche Blickwinkel betrachtet werden müssen. Damals wurde ausgeführt, dass über eine Ausstellung und die damit vorbereitenden Informationszusammenstellung möglicherweise weitere Erkenntnisse gewonnen werden können. Zunächst ist festzuhalten, dass aus unterschiedlichen Gründen die Ausstellung nicht umgesetzt worden ist.
Gleichwohl sind seitens der Verwaltung weitere Recherchen angestellt worden. Unter anderem wurden die Akten zum Schwarzschlächter-Prozess gesichtet wie auch Einblick in die angesprochene Entnazifizierungsakte genommen. Als Ergebnis vorweg kann festgestellt werden, dass auch hieraus und aus weiteren Quellen keine finale Beurteilung Fissmers in die eine wie die andere Richtung vorgenommen werden kann.
Das Stadtarchiv Siegen liefert in der Anlage eine biografische Skizze über die Person Alfred Fissmer. Wie schon in der Vorlage 1894/2018 ausgeführt, dürfte auch hier bei der Lektüre deutlich werden, dass das Thema Fissmer äußerst facettenreich ist. Insofern bietet auch das Biogramm im Detail keine Gewähr für Vollständigkeit, sondern es ist als ein Überblick zu verstehen. Nichtsdestotrotz dürften alle wesentlichen –insbesondere kritischen – Aspekte in der Vita des ehemaligen Oberbürgermeisters thematisiert sein.
Auf wertende Bemerkungen wurde verzichtet bzw. an diskutablen Stellen wurde versucht, auch gegenläufige Meinungen einfließen zu lassen. Das Biogramm stellt daher einen möglichst wertneutralen Abriss der Vita Fissmers dar. Insgesamt wird aber auch daran deutlich, dass eine Entscheidung „Für“ und „Wider“ abzuwägen ist.
Insofern wird noch einmal auf den Beitrag von Matthias Frese verwiesen, der ausführt, dass Straßennamen und Plätze eine Form von Geschichtspolitik darstellen. Sie würden den Erinnerungswunsch an die den Namen verleihenden Personen zu einem bestimmten Zeitpunkt abbilden. Von daher würden Straßenumbenennungen in die Erinnerungskultur eingreifen. Damit bestehe die Gefahr, dass einzelne Personen, Ort, Ereignisse aus dem Geschichtsbild einer Stadt getilgt und so kulturgeschichtliche und gesellschaftliche Zusammenhänge zerstört würden. Abhilfe könne hier eine transparente Aufklärungsarbeit leisten.
Im Rahmen dieser Aufklärungsarbeit und im Kontext der Ausführungen des Herrn Frese schlägt die Verwaltung vor, dass der Name beibehalten, in der Anlage mit einem Hinweisschild die Person Alfred Fissmer auf Basis des Biogramms beschrieben und weitere Informationen auf der Internetseite https://unser-siegen.de [sic!] veröffentlicht werden. Denkbar ist darüber hinaus, im Rahmen einer Veranstaltung die Person Alfred Fissmer zu betrachten.
Nachrichtlich sei noch darauf hingewiesen, dass die Umgestaltung der Alfred Fissmer Anlage gegenwärtig nicht mehr weiter verfolgt wird, so dass auch hierdurch die Anbringung der In-formationstafel möglich ist.“
Quelle: Ratsinformationssystem der Stadt Siegen
Ein Kommentar zu diesem Schlag ins Gesicht aller ernsthaften Historiker kann sich auf ein einziges Wort beschränken: „Peinlich.“ (Nämlich für die Stadt Siegen.) Und das soll nun auch mein letztes in dieser ganzen Angelegenheit sein.
Vorgelegt wurde, was in Auftrag gegeben wurde, ein Gesamtüberblick über die Vita, aber das ist nicht das, worum es geht.
Thema war, ist und bleiben F. s Integration in die Rechtsaktivitäten gegen die Weimarer Republik innerhalb des von Deutschnationalen und Nazis einträchtig formierten „Vaterländischen Lagers“ und, nachdem das Ziel erreicht war, dessen Integration in das Naziregime und nach 1945 der Umgang damit.
Dass er der Sohn eines bürgerlichen Industriellen war, dass er Jurist war usw., das ist in einer vertiefenden Beschäftigung mit seiner Entwicklung von Schwarz nach Braun sicher interessant, aber für die Platzbenennung nicht von Bedeutung.
Die städtische Schlussfolgerung „unbelastet“ geht über das Entscheidende hinweg, deckt es zu, klebt am Mythos der 1950er Jahre.
Und bedient sich bei der Weißwaschung ausgerechnet eines so windigen Sozialdemokraten wie dieses Fritz Fries, eines Vorläufers der späteren „Betonfraktion“, dem die eigene Partei den Stuhl vor die Tür setzte, weil er unerträglich geworden war.
Nein, diese seit Jahren laufende Diskussion wird mit dem Täfelchen, einem Armutszeugnis, nicht beendet werden können. Sie wird weitergehen. Gut so, denn die schwarzbraunen Beiträge zum Aufstieg der Nazis und zu den sich anschließenden Verbrechen des Regimes, das sie durchgedrückt hatten und von dem ja auch F. sich nie wieder distanzierte, bleiben so in der Diskussion. Das ist wichtiger als drei feierliche Sätze an einem Gedenktag.
In der heutigen Print-Ausgabe der Siegener Zeitung findet sich ein Leserbrief zur Umbenennung der Fissmer-Anlage mit der Überschrift „Angemessene Würdigung“.
Die Eintragung zu Netphen muss lauten: St. Martin (nicht: St. Marien). Am Martinstag 1895, also vor 125 Jahren, wurde die katholische Pfarrkirche St. Martin in Netphen vom Gemeindepfarrer Caspar Alexander Vollmer benediziert.
Wenn ich dem obigen Link folge, bin ich bald dort, wo der DFGViewer mir nur noch eine weiße Seite anzeigt. Mehrmalige Versuche Sterberegisterzweitschriften unter Burbach und Weidenau aufzurufen, führten zu diesem Ergebnis. Auch der Weg über LAV NRW, Abt. Ostwestfalen-Lippe, lässt mich ratlos zurück.
Hat beim Erstellen des Eintrages noch funktioniert…. Möglicherweise handelt es sich um ein Kapazitätsproblem. Ein Aufrufen über den Umweg der Findmittel ist leider nicht möglich, da dort die Findmittel nicht mit den Digitalisaten der Register verknüpft sind.
Es war ein gemeinsam besprochener Antrag von Grünen und FDP, dem der verbliebene Teil der Jamaika dann doch nicht mehr zustimmen konnte. Die vermeintliche Urheberschaft der Grünen ist also, sagen wir mal, eher vom Wunsche getrieben.Nicht so schlimm. Was aber bemerkenswerter ist: Auch in diesem Antrag ist – ebenso wenig wie in der Verwaltungsvorlage – überhaupt keine Rede mehr vom inzwischen zwei Jahre alten Bürgerantrag, der formal und tatsächlich noch nicht beschieden ist.
Die Urheberrechtsfrage mögen die Fraktionen unter sich klären. Tatsächlich interessant ist, dass, wenn der Antrag von 2018 noch nicht erledigt, dann muss doch da irgendetwas passieren. Man hat jetzt den Eindruck, dass die Angelegeneheit mit der Ratsentscheidung seinen Gang geht. Erlaubt die Geschäftsordnung des Rates ein solches Vorgehen? Wenn nein, dann müsste formal der alte Antrag als hinfällig beschlossen werden.
Disclaimer: Die vorliegende Version richtet sich an männliche Personen. Durchgehend sind männliche, teilweise auch weibliche Personen genannt. Die Veröffentlichung der Version, die sich auch durchgehend an Frauen richtet und an inter und nichtbinäre Personen und diese im Text erwähnt steht bisher noch aus.
(„Weiblich“ und „männlich“ schließt hier trans Frauen und trans Männer mit ein. Eine Unterscheidung zwischen cis und trans nimmt das PDF nicht vor.)
In der heutigen Print-Ausgabe findet sich ein Leserbrief, der eine Umbennung der Fissmer-Anlage als „[a]llenfalls peinlich“ bewertet. Der Brief enthält keine neuen Informationen, verweist aber auf die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes – ein Grund mehr, die m. W. noch nicht ausgewertete Ordensakte einzusehen.
Weil das Interesse daran so erfreulich groß war, ist die Broschüre "Archivisch für Anfänger" jetzt auch als pdf verfügbar. Und bei einer Neuauflage denken wir dann bestimmt auch an das *!https://t.co/MqPOfxxU4bhttps://t.co/cSsHv7PPfb
In der heutigen Print-Ausgabe findet sich ein Leserbrief, der das „[e]rhellende Biogramm (!)“, das der Verwaltungsvorlage – s.o. beigegeben war, lobt und die persönliche Wahrnehmung der Ratssitzung schildert.
In der vergangenen Woche (Montag o. Dienstag) erschien in der Westfälischen Rundschau der Leserbrief „Fissmer – eine neue Legende“, der u. a. unbelegte Rechtfertigungsversuche pro Fissmer kritisiert.
Das Geleitwort zur der von Paul Fickeler erstellten Publikation „Waldrich Siegen 1840-1955. Zur Geschichte der Stadt Siegen und des deutschen Werkzeugmaschinenbaues. Festschrift Dr.-Ing. E. H. Oskar Waldrich zum 75. Geburtstag“ (Siegen 1955) stammt von Alfred Fissmer, der als Oberbürgermeister i. R. und Ehrenbürger der Stadt Siegen unterzeichnet – und nicht als Mitglied des Aufsichtsrats, so dass man annehmen darf, dass Fissmer zu diesem Zeitpunkt noch nicht dem Aufsichtsrat angehörte.
Vielleicht ist ja der Titel des Alt-Oberbürgermeisters unter dem Geleitwort weihevoller gewesen als der des Aufsichtsrats, der ja gewissermaßen sein Heu im eigenen Stall frisst, wenn auch aus der ersten Klasse. Ich kann es gerade nicht belegen, aber irgendwo habe ich den Hinweis gelesen, dass er damals bereits Aufsichtsrat war.
Ich bin über die Nicht-Erwähnung des Aufsichsratstitel am Ende des Geleitwortes gestolpert. Alle bisherigen biografischen Darstellungen erwähnen leider nicht, wann Fissmer in den Aufsichtsrat eintrat. Daher ist jede Präzisierung willkommen.
In dem bereits mehrfach erwähnten Biogramm der Stadtverwaltung heißt es:
„….Darüber hinaus erfuhr das Museum im Oberen Schloss eine Neukonzeption und Modernisierung. …“ (S. 1) Differnzierter (?) schildert dies Martin Griepentrog in „Kunsthistorische Museen in Westfalen (1900 – 1950): Geschichtsbilder. , Kulturströmungen, Bildungskonzepte, Paderborn 1998, S. 107, 119, der dort die Neukonzeption des Museums als eine – weitere ?- Auseinandersetzung zwischen Fissmer und Hans Kruse darstellt.
Auflösung des Sommerrätsels 2020/1:
Es handelt sich um das Munitionsdepot der Belgier am Wellersberg. Das Gelände um das Depot (ca. 14 ha) wurde 1971 zum militärischen „Schutzbereich“ erklärt. Spätestens in diese Zeit fällt die heute noch vorhandene Umzäunung . Die Freigabe des Munitionsdepots erfolgte 1992. Seit 1998 wird das Areal vom „Gebrauchshundsportverein“ genutzt. Die Hunde werden wohl der Grund dafür sein, dass der vom Zahn der Zeit gezeichnete Zaun nicht schon längst entfernt worden ist.
Korrekt haben somit Manfred Heiler und giebeler geantwortet – herzlichen Glückwunsch dazu!
Morgen folgt der 2. Teil des Sommerrätsels und damit für alle eine weitere Chance richtige Antworten zu sammeln.
Zum Thema Aufarbeitung ungute Bezeichnungen öffentlicher Orte entnehme ich gerade einer anderen Tageszeitung eine Nachricht von jenseits des Gebirgskessels:
In Trier hat gerade der Stadtrat mit 29 zu 17 Stimmen bei vier Enthaltungen die Umbenennung der dortigen Hindenburgstraße beschlossen. Ein neuer Name ist erst noch in der Diskussion. Vordringlich war jedenfalls, dass der alte entfernt werden konnte.
Hindenburg war ja wohl ebenfalls einer dieser deutschnationalen/nationalkonservativen Ehrenmänner, die dafür sorgten, dass der Führer durch Kasernen-, Bunker- und Straßenbau die durch den Ahnenpass ausgewiesenen „Volksgenossen“ wieder in Lohn und Brot bringen könnte. Die erfreut selbstverständlich erfreut waren. Bis hin zu manchen ihrer Enkel.
Funde zum Kaisergartenskandal und Fissmer:
1) Samstag, den 13. Dezember 1941, trägt Karl Friedrich Kolbow folgendes in sein Tagebuch ein: “ …. In dem Kaisergartenskandal in Siegen (Uebertretungen der KRiegswirtschaftsverordnungen) seien sowohl Kreisleiter Burk wie auch Oberbürgermeister Fißmer persönlich so sehr verwickelt, daß seines Erachtens [Anm.: gemeint ist Paul Giesler] ihr Weg am Gefängnis nicht vorbeiführen würde, was für Fißmer´s lange Beamtenlaufbahn entsetzlich sei. Besonders Herrn Heringlake [Anm.: In der Abschrift findet sich „Herrn Heminglake“] würde es an den KRagen gehen. …..“
in: Dröge, Martin: Die Tagebücher Karl Friedrich Kolbows 1899 – 1945. Landeshauptmann der Provinz Westfalen, Paderborn 2009, S. 499
2) Am 13. Juni 1942 schreibt Hermann Kuhmichel an Alfred Henrich:
„…. Mein Widersacher, der Oberbürgermeister, hat sich ein Loch in den Bauch geschossen u. wird mir fernerhin kein Leid mehr zufügen. Ich hätte ihm trotz allem einen besseren Abgang gewünscht. …..“
in: Henrich, Frieder: Mit Hermann Kuhmichel durch das Siegerland. Eine dokumentarische Zwischenbilanz über Leben und Werk des großen Künstlers, Siegen 2016, S. 93
3) Auf der Homepage von Karl Heupel ein Pressebericht sowie eine Dokumentenpräsentation der Ausstellung „Justiz im Nationalsozialismus“ im Siegener Landgericht aus dem Jahr 2009. Die Präsentation enthält auch Angaben zum Verfahren gegen Fissmer.
Gerade die Dramatik des Selbstmordversuchs verdeutlicht quasi im Brennglas, dass unterschiedliche Sichtweisen auf ein und diesselbe Handlung möglich sind. War das Motiv das verletzte Ehrgefühl eines preußischen Beamten und Offiziers, schiere Existenzangst oder ein Schuldeingeständnis?
Neben tieferen Erkenntnissen zur Persönlichkeit Fissmersscheint eine Beschäftigung mit dem Kaisergartenskandal auch einen Blick auf das Zusammenwirken der NS-Funktioneliten mit den maßgeblichen Kreisen der Siegener Stadtgesellschaft zu erlauben.
Umso bedauerlicher ist es, dass die zentralen Unterlagen der Staatsanwaltschaft am Dortmunder Sondergericht nicht erhalten sind. So können nur die Auswertung der Presse und Zufallsfunde (s. o.) weiteres Licht in den Skandal bringen.
Die Vermutungen halte ich für durchaus richtig. Am Beispiel Kaisergarten-Skandal lässt sich vieles festmachen, wenn auch nicht alles. Allerdings erlaube ich mir die Feststellung, dass gerade zu diesem Komplex einiges an Aktenmaterial erhalten geblieben ist, so der Bericht des Dr. Jenner zum Prozess an das Reichsinnenministerium. Darüber werde ich in absehbarer Zeit veröffentlichen, um zur differenzierten Betrachtung beizutragen.
.
Da Hans Bruno Jenner ja hier bereits erwähnt wurde, erscheint es sinnvoll auf knappe biographische Hinweise zu verweisen: „Jenner, Hans J.“, in: Hessische Biografie <https://www.lagis-hessen.de/pnd/1025242211> (Stand: 27.2.2020).
Jenner war ferner Ehrensenator der Universität Marburg für „sein Eintreten in seinem Verwaltungskreis für die Universität und die Jubiläumsstiftung“. – s. https://www.uni-marburg.de/de/universitaet/profil/geschichte/ehrensenator-innen
Wird es sich bei der angekündigten Veröffentlichung um eine Auswertung der dreibändigen Personalakte Jenners (Bundesarchiv Berlin, R 1501/207672-7674) handeln?
Hans Jenner war sowohl bei Fissmer als auch einige Jahre später bei Fries, Fritz aktiv. Die Akte liegt in der Tat im Bundesarchiv, Teile davon auch in Duisburg. Es geht hier aber eher um Fissmer.
… und hierbei auch um die Revierstreitigkeiten zwischen den Siegener Nazihäuptelnbei denen eine Zuordnung Fissmers nur in groben Zügen möglich ist. So hat sich m. E, aus der anfänglichen Zweckpartnerschaft zwischen Fissmer und Paul Giesler schnell ein Streit entwickelt, wie er auch in den bei Dröge zitierten Passagen deutlich wird. Leider hält sich Kolbow in seinen Schilderungen ja etwas zurück. Als Insider dürfte er gut informiert gewesen sein.
Wobei Jenner sich ausweislich der Bestände wohl differenziert (!) aber mehrfach zugunsten von Fries äußert, dem damals von SPD-Funktionären aus der Region eine Mitgliedschaft in der NSDAP vorgeworfen wurde.
Ergänzung der Literaturliste zu Alfred Fissmer:
– Dudde, Matthias: Die besoldeten Mitglieder des Magistrats der Stadt Bochum 1856 bis 1918, in: Bochumer Zeitpunkte. Beiträge zur Stadtgeschichte, Heimatkunde und Denkmalpflege 27 (2011), S. 28ff, Link: https://www.kortumgesellschaft.de/tl_files/kortumgesellschaft/content/download-ocr/zeitpunkte/Zeitpunkte-27-2011OCR.pdf
– Deutsches Soldatenjahrbuch 35 (1985, S.52: „…. Hollidt meinte: „Der damalige Oberbürgermeister von Siegen, Fiß- mer, den ich hochgeachtet habe und mit dem mich Freundschaft verband, wollte wohl gern einen General in Siegen haben.“ …..“
Auf Jenner wies Peter Kunzmann bereits vor einiger Zeit hin. Jenner berichtet einiges zu Fries einem windigen Sozialdemokraten der regionalen Spitzenklasse, wie man anschließend weiß, und lieben Freund von Fissmer, siehe die Hinweise in „Widerspruch und Widerstand“ der VVN.
Was das „differenziert“ da jetzt soll, frage ich mich. Es ist einfach so, dass Jenner wiedergibt, was ihm so vorliegt. Dazu gehören mehrere Berichte, in denen Augenzeugen sagen, an Fries‘ Revers das Parteiabzeichen bemerkt zu haben. Das kann er sich einfach nur so angesteckt haben, um Eindruck zu machen, es kann ein echter Beleg sein, die Augenzeugen können sich geirrt haben (mehrere), wie auch immer. Jedenfalls wundert sich niemand über diese Möglichkeit. Jenner hält sich bei der Interpretation zurück. Weder differenziert noch undifferenziert. Das wäre jetzt ein Attribut zur Jenner-Darstellung, das in der Sache nichts, nur etwas für die heutige Performance der letzteren etwas bringen kann.
Ach ja, zur weiteren Bereicherung des Sachverhalts läßt sich hinzufügen, dass diese Beobachtung auch aus seiner Partei, der SPD, kam. Ob da nun jemand irrte, log oder wahr sprach, steht dahin. Sagen lässt sich, dass F. sich dort sehr unbeliebt, wenn nicht gar verhasst machte, wenn dergleichen öffentlich über ihn vorgetragen wurde. Einem nachweislichen Ex-Nazi, der den Entnazifizierungsausschuss mit dem Deutschen Gruß ansprach, dürften das Zeichen am Revers und der daraus resultierende Konflikt ganz gut gefallen haben. F., der gelernte Dreher, war ja ein Unterstützer von F., dem studierten OB und besseren Herrn, der so leutselig und humorig sein konnte, wie die Alten berichten. Und in der Sache mit dem Parteiabzeichen, da lag ja Humor.
Das sollte schon aus Differenzierungsgründen mal gesagt sein.
Weder sind die Fälle Fissmer und Fries aufgearbeitet noch scheint es von Seiten einiger Diskussionsteilnehmer ein Interesse daran zu geben, dass diese Themen differenziert aufgearbeitet werden, weil ja die Differenzierung ein Beitrag sei, den Mythos mit der Realität zu verbinden und alles zu exkulpieren. Es geht nicht um die heutige Performance, es geht auch nicht darum, aus dem alten Fissmer einen antifaschistischen Widerstandskämpfer und aus dem alten Fries einen Kryptonazi zu machen. Das ist einer historischen Betrachtung vorbehalten. Und wenn man sich die Zeugenaussagen genau ansieht, die in der Fries-Akte enthalten sind, dann kann man durchaus Parteikabale in der Beschuldigung vermuten, auch wenn Friesens Rolle im Dritten Reich hinterfragenswürdig ist. Hätte, hätte, Fahrradkette.
Die vereinfachenden Sichtweisen finden derzeit Platz auf der Leserbriefseite der Siegener Zeitung auch heute erschienen im Print drei Leserbriefe: „Siegener gerettet“, „Fissmer gebührt Ehre“ und „Verwendung der Gelder“. Alle votieren eindeutig für die Beibehaltung des Platznamens.
Ein Beleg für die das profunde Verfolgen der Diskussion gefällig? Aus „Siegener gerettet“: “ ….Dass der Rat beschlossen hat, den Platz in der Obberstadt nicht umzubenennen, ist sachlich richtig. Dennoch werden bestimmte Gruppierungen die Angelegeneheit nicht auf sich beruhen lassen – bis der Platz Karl-Marx-Platz oder vielleicht Rosa-Luxemburg-Platz heißt. Aber bald ist Kommunalwahl.“ Anm.: Der Schreiber stammt aus Kreuztal ……
Da ich etwas spät zur Auflösung komme, sind beide Antworten korrekt, wie dieses Bilde von Manfred Knoche vom 23.5.2014 belegt:
Damit führt Manfred Knoche mit 2 richtigen Lösungen an. Es folgen Manfred Heiler, giebeler und Reinhard Kämpfer mit je 1 richtigen Lösung. Also noch ist alles drin!
Diese Meldung darf nicht unkommentiert bleiben, bevor dem »sparsamen« Fissmer ein weiterer Mythenkranz geflochten wird. Was hier präsentiert wird, ist eine Zeitungsmeldung, nicht mehr und nicht weniger, die sehr stark einen Sachverhalt kürzt und so damals durch den deutschen Blätterwald rauschte. Doch um die darin enthaltenen Zahlen richtig würdigen zu kennen, ist es notwendig zu wissen, wie sich der städtische Haushalt zusammensetzte, durch welche Einnahmen und Ausgaben sowie außergewöhnlichen Verkäufen aus städtischem Vermögen sich die Überschüsse erzielen ließen (z.B. Hundesteuer hoch, Sozialleistungen kürzen). Diese Entwicklung über mehrere Jahre zu verfolgen, am besten noch im Vergleich mit anderen Städten, führt erst zu einer diskussionswürdigen Grundlage zu diesem Aspekt von Fissmers Berufsbiografie. Seinem Biografen bleibt diese aufwendige Forschung vorbehalten. Zum Aufrechnen gegen die NS-Vergangenheit Fissmers dienen die Ergebnisse jedoch nicht.
Ich entschuldige mich für die unkommentierte Präsentation des Zeitungsakrtikel. Aber: es zeigt wie die erinnerungspolitische Debatte geführt wird, ohne dass eine wissenschaftlichen Anforderungen genügende Biographie vorhanden ist. Die Fragen bzw. Hinweise zur Einordnung der Leistungen Fissmers lassen m. E. auch auf die NS-Zeit ausdehnen. Wir suchen also Kleinstädte mit ca. 30.000 Einwohnern, um Vergleiche ziehen zu können.
Noch einmal zurück in das Jahr1931 in der in Aachen erscheinenden Zeitung „Echo der Gegenwart“ erschien am 21. Januar 1931 folgender Artikel zu Fissmer Sparpolitik:
Es ist nicht zu erkennen, was da „differenziert“ wird und wie sowas dabei herauskommen könnte, wenn alles Mögliche an vor allem disparater Information auf einen bunten Haufen geworfen wird. Wie jeder andere Bürgermeister, Gemeindedirektor, Regierungspräsident usw. hat ja auch Fissmer nicht den ganzen Tag Beschwerden gegen den Pfarrer geschrieben, bei seinen Spezis über Schwierigkeiten bei seiner Parteiaufnahme geklagt, Juden ins Polizeigefängnis eingewiesen oder Aufträge zum Kasernen- und Bunkerbau ausgeschrieben, sprich ständig seine Partei- und Staatstreue unter Beweis zu stellen versucht.
Dass er sich auch um den Müll, die Ordnung in den Schulen, Bäckereien und auf dem Friedhof gekümmert hat, das aufzulisten ist aber verzichtbar und kein Ausdruck von „Differenzierung“. Es ist banal. Es nimmt dem ersten nichts, nicht das Geringste. Thema ist die NS-Belastung und die ist klar auf den Punkt zu bringen und nicht mit der Phrase vom „differenzieren“ wegzureden. Das ist unmöglich.
Denn die Belastung ist leicht nachzuweisen: Wenn etwas watschelt, quakt und flattert wie eine Ente und zudem die Bandarole von der Entenzählstelle am Bein trägt, dann ist es eine. Und kein Steinadler, wie die eine oder andere Amsel vielleicht meint.
Die Beschäftgung mit Fissmer hat ja nun mal leider mehrere Ebenen:
1) erinnerungspolitisch ging (geht ?) es um die Benennung eines Platzes,
2) der Forschungsstand zu Fissmer dürfte herzu hinreichned sein,
3) dennoch ist festzustellen, dass eine umfassende biographische Darstellung fehlt.
Heute erschien in der Print-Ausgabe der Siegener Zeitung ein Leserbrief unter der Überschrift „Bittere Kritik“, der sich mit der Umbenennungsdiskussion im Siegener Stadtrat beschäftigt.
Heute erschien in der Print-Ausgabe der Siegener Zeitung ein Leserbrief unter der Überschrift „Nicht hinnehmbar“, der sich mit der Umbenennungsdiskussion im Siegener Stadtrat beschäftigt.
Videokonferenz zum Thema „Neues Archivportal NRW“. Dabei wurde neues Equipment erfolgreich getestet. Ab Anfang August wird es erste Neuigkeiten von Landesarchiv NRW dazu geben. Man kann gespannt sein
Ein Quellenfund fur Heinrich Goedecke:
National Archives Kew, FO 1060 [ Control Office for Germany and Austria and Foreign Office: Control Commission for Germany (British Element), Legal Division, and UK High Commission, Legal Division: Correspondence, Case Files, and Court Registers ]/1649 , Heinrich Goedecke, 1945
Hier stimmt evtl. etwas nicht ganz; Fickeler kann wohl kaum sein Abitur schon mit 13 Jahren 1906 im Realgymnasium Siegen abgelegt haben, oder ??? Könnten sie das bitte einmal überprüfen ? Vermutlich war es 1910 / 11 ?
Herr Dick hat natürlich recht. 1906 war das Jahr, in dem Familie Fickeler (wieder) nach Siegen kam und Paul das Realgymnasium bezog. Sein Abitur legte er dort zu Ostern 1913 ab. Berufsziel: „Bergfach“.
„Behutsamkeit bei Fehlerkritik“ verdienen nicht nur Tote, sondern auch lebendige Menschen im zarten Jugendalter. Um einen solchen handelt es sich wahrscheinlich bei der Verfasserin/dem Verfasser dieses Praktikumsberichtes. Das alte Sprichwort „Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen“ sollte nicht in Vergessenheit geraten. Durch den ein wenig mißlungenen Versuch, die genannten Quellen zu referieren, geht die Welt nicht unter. Wer sich für die Biografie Paul Ficklers interessiert, findet leichten Zugang zu den originalen Texten (Kern-Terheyden übrigens in „Siegerland“ 1993). Sehr ergiebig sind diese allerdings auch nicht. Vielleicht kann sich mal ein Siegener (w/m) dazu durchringen, den Nachlass des Geografen Carl Troll in Bonn, der auch etliches Material zu Fickeler enthält, zu sichten.
Danke für die verständnisvolle und schnelle Korrektur! Das Wochenende war ein wenig low media ;-). Ein weiteres Dankeschön für den Hinweis auf den Nachlass Troll!
Neben einer Recherche im Universitätsarchiv in München finden sich Hinweise auch im Berliner Bundesarchiv:
– Bundesarchiv, BArch NS 15 (Der Beauftragte des Führers für die Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung der NSDAP) Nr. 200, Wissenschaftler, Privatgelehrte und Schriftsteller sowie deren Arbeiten. – Korrespondenz, Beurteilungen, Eingaben, Presseausschnitte , Bd. 10, (1931), 1935 -1943
enthält u.a.: Fickeler, Paul, Dr., Privatgelehrter (Bl. 226)
– Bundesarchiv, BArch NS 15/138, Auskunftsersuchen an einzelne Gauleitungen Bd. 5, (1933) 1935 – 1941, enthält u.a.: Fickeler, Paul, Dr., Privatgelehrter (Bl. 86)
– Bundesarchiv, BArch NS 15/28, Auskunftserteilung an das Deutsche Volksbildungswerk. – Einzelfälle (Tageskopien), Bd. 2, Jan. – Juni 1939, enthält u.a.: Fickeler, Paul, Dr., Privatgelehrter (Bl. 232)
– Bundesarchiv, BArch NS 15/158a, Auskunftserteilung und Auskunftsersuchen an das Amt Wissenschaft, Bd. 1, 1935-1940, enthält u.a.: Fickeler, Paul, Dr., Privatgelehrter (Bl. 76)
– Bundesarchiv, BArch NS 15/260, Auskunftserteilung und Auskunftsersuchen an das Außenpolitische Amt der NSDAP vornehmlich über als Vortragsredner vorgesehene Personen, 1935-1943 enthält u.a.: Fickeler, Paul, Dr., Privatgelehrter (Bl. 144)
– Bundesarchiv R 9361-II/233115 (Sammlung Berlin Document Center (BDC): Personenbezogene Unterlagen der NSDAP / Parteikorrespondenz), Fickeler, Paul, Dr. Dr. , *7.4.1893
Im Leibniz-Institut für Länderkunde in Leipzig befinden sich im Nachlass Otto Timmermann (Signatur: K 976) Unterlagen zur Anatolienreise von Paul Fickeler und Werner Leimbach 1934.
In der Universitätsbibliothek Heidelberg befinden sich unter der Signatur Heid. Hs. 4040 I einige Briefe von Fickeler, aber auch an Fickeler.
In der Münchner Stadtbibliothek / Monacensia befinden sich im Nachlass Hans Brandenburg (Signatur: HB B 75) weitere Briefe Fickeler.
Weitere Einzelbriefe lassen sich via Kalliope finden
Ich versuche zu lösen:
1.) Sprache : Esperanto
2.) Verfasser der Notiz: Richard Casimir Karl August Robert Konstantin Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (* 29. Oktober 1934 in Gießen; † 13. März 2017 in Bad Berleburg
3.) Verfasser der Glückwunsche: Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat (* 11. Juni 1934 in Talence im Département Gironde, Südfrankreich; † 13. Februar 2018 auf Schloss Fredensborg
Frage 1 ist richtig beantwortet! Die Fragen 2 und 3 leider nicht. Ein Freiexemplar steht Ihnen aber natürlich zu, wenn Sie wollen. Melden Sie sich gerne bei mir! (marcus.stumpf@lwl.org)
Frage 1 war ja schon vorher richtig beantwortet. Die Antwort auf Frage 2 ist korrekt! Auch Ihnen steht damit ein Freiexemplar zu!
Zur Frage 3: Die Lesung „Udo“ ist leider nicht richtig … Es darf also weiter gerätselt werden!
Frage 3: Udo Amelung Karl Friedrich Wilhelm Oleg Paul zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg
Bei Frage 1: In der Laudatio ist der 26.5. als Geburtstag genannt.
Dass das Geburtstagsdatum im Text fälschlich 26.5. lautet, war mir gar nicht aufgefallen. Danke für den Hinweis! Aber Fürst Richard hatte natürlich am 27.5. Geburtstag, wie er ja selbst unten notiert hat. Prinz Udo zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg ist zwar nicht der Verfasser gewesen, aber (Achtung: Tipp) die Richtung zur Familie Löwenstein-Wertheim-Freudenberg ist gar nicht so falsch …
Warm, aber noch nicht heiß! Die Spur führt zu einem Kind des Bruders von Fürst Ernst zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg, eines Geschwisters des oben bereits verdächtigten Prinzen Udo. Und noch etwas: Die richtige Lösung passt auch paläografisch!
Auch nah dran, aber noch nicht die Lösung … Noch ein paläografischer Hinweis: Der gesuchte Name steht wirklich da und es handelt sich auch nicht um eine Abkürzung. Man kann das Rätsel aber auch über weitere genealogische Recherchen bei der Familie Löwenstein-Wertheim-Freudenberg lösen.
Dor Vorschlag ‚Elisabeth‘ kommt der Lösung schon sehr nahe, kann aber nicht stimmen. Fürst Richard notierte ja: „Tischrede in Esperanto an meinem Geburtstag 27.5.19 meines Vetters, des Prinzen […]“. Der Prinz, Urheber des Textes, kann schwerlich Elisabeth geheißen haben, sondern hieß …?
Auflösung erfolgt ansonsten heute um 13:00 Uhr ;-)
Dann wird die richtige Lösung wohl der inzwischen wiederverheiratete Mann der schon 1883 verstorbenen Elisabeth sein: der Generalleutnant Otto Emil Karl Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (geb. am 23. November 1842 in Darmstadt; gest. am 9. Mai 1911). Damit macht auch die Ansprache des Jubilars als Veteran und Schwager Sinn (Schwager recht weitläufig definiert?); und eine humorvolle Tischrede in Esperanto passt zu seiner literarischen Tätigkeit.
„Otto“ ist in der Tat die einzig richtige Lesung. Fürst Richard schrieb das große und das kleine „o“ sehr schmal (darauf muss man erstmal kommen …).
Es bleibt aber ein Problem: Zu dem jetzt vorgeschlagenen Prinzen Otto hätte eine launige Tischrede in Esperanto zwar wirklich gepasst, aber er war ja nun leider schon 1911 verstorben, kann also 1919 keine Tischrede mehr gehalten haben …
In der Tat, der war es!
Otto Konstantin Prinz zu Sayn-Wittgenstein (1878-1955). War verheiratet mit der oben bereits erwähnten Elisabeth Prinzessin zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg (1890-1953). Prinz Otto war Fürst Richards Vetter zweiten Grades und zugleich sein Schwager, denn Fürst Richard war mit Madeleine (1885-1976), die ältere Schwester Elisabeths., verheiratet. Prinz Otto Konstantin war also auch Schwager von Prinz Udo und Prinzessin Ilka zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg (beide oben erwähnt). Dies allerdings nur bis 1923, weil in diesem Jahr die Ehe zwischen Prinz Otto und Prinzessin Elisabeth geschieden wurde. Prinz Otto war obendrein Neffe des ebenfalls oben vorgeschlagenen, 1911 verstorbenen, älteren Prinzen Otto.
Alles ziemlich verwickelt …
Aber Kompliment an alle Knobler und Knoblerinnen für das bewiesene Durchhaltevermögen!
Die Gewinner können sich gerne bei mir melden!
a) Zwischen den Haltestellen Hillnhütten und Stift-Keppel-Allenbach
b) Es handelt sich um die „Friedrichsruh“, die Grabstelle des Stiftsförsters Friedrich Vorländer. Dort steht: „Hier ruhet der Stifts-Oberförster Friedrich Vorlaender, geb. Allenbach am 3. April 1792, gest. Allenbach am 26. Februar 1869.“
Beide Antworten sind korrekt – herzlichen Glückwunsch!
Somit führt weiterhin Manfred Knoche mit 2 richtigen Lösungen an. Es folgen nun Sven Panthöfer, Manfred Heiler, giebeler und Reinhard Kämpfer mit je 1 richtigen Lösung. Es bleibt spannend!
Dr. Monika Schaupp, Wertheim, stellte freundlicherweise Literaturhinweise, die sie bei VHS-Paläographiekursen oder Workshops zur Familienforschung austeilt, zur Veröffentlichung hier zur Verfügung:
Paläographie / Schriftkunde
Paul Arnold Grun: Leseschlüssel zu unserer alten Schrift (Grundriß der Genealogie 5). Limburg 1984 (Reprint).
Harald Haarmann: Geschichte der Schrift. Von den Hieroglyphen bis heute (Beck’sche Reihe 4075). München 32009.
Elisabeth Noichl, Christa Schmeißer (Bearb.): Deutsche Schriftkunde der Neuzeit. Ein Übungsbuch mit Beispielen aus bayerischen Archiven. München 2007
Heribert Sturm: Unsere Schrift. Eine Einführung in die Schriftkunde. Neustadt/A. 1993 (Reprint).
Harald Süß: Deutsche Schreibschrift. Lesen und Schreiben lernen. München 2000.
Fritz Verdenhalven: Die deutsche Schrift. Ein Übungsbuch. Neustadt/A., 2. verb. Aufl. 1991.
Sütterlin (mit Buchstabenlisten zum 17.-19. Jh.): http://www.suetterlinschrift.de/Lese/Inhalt.htm; Sütterlin-Lern-Programm (SLP 2000) der Universität Saarbrücken: http://www.genealogy.net/slp/ (auch: http://www.aurnh.de/suetterlin.htm).
Abkürzungsverzeichnisse, Wörterbücher
Frank Ausbüttel: Abkürzungen aus Personalschriften des XVI. bis XVIII. Jahrhunderts (Marburger Personalschriften-Forschungen 18). Sigmaringen 1993
Christa Baufeld: Kleines frühneuhochdeutsches Wörterbuch. Lexik aus Dichtung und Fachliteratur des Frühneuhochdeutschen. Tübingen 1996
Frühneuhochdeutsches Wörterbuch (Mitte 14. bis Mitte 17. Jahrhundert), – https://fwb-online.de/
Adriano Cappelli: Lexicon Abbreviaturarum. Mailand 1993 (Reprint http://inkunabeln.ub.uni-koeln.de/vdibProduction/handapparat/nachs_w/cappelli/cappelli.html
Karl E. Demandt: Laterculus Notarum. Lateinisch-deutsche Interpretationshilfe für spät-mittelalterliche und frühneuzeitliche Archivalien. Mit 4 Tafeln spezieller Zahlenschreibungen des 14.-16. Jahrhunderts (Veröffentlichungen der Archivschule Marburg 7). Marburg 71998.
Otto Dornblüth: Wörterbuch der klinischen Kunstausdrücke für Studierende und Ärzte, Leipzig 1894, unveränderter fotomechanischer Nachdruck 1999. Vorwort vom November 1893.]
Otto Dornblüth: Klinisches Wörterbuch. Die Kunstausdrücke der Medizin. 13./14. vollkommen umgearb. Aufl. 1927.
– http://www.textlog.de/klinisches.html
Jacob und Wilhelm Grimm: Deutsches Wörterbuch. Erstausgabe 1854-1971. ND 1984.
– http://germazope.uni-trier.de/Projects/DWB
Paul Arnold Grun: Schlüssel zu alten und neuen Abkürzungen. Wörterbuch lateinischer und deutscher Abkürzungen des späten Mittelalters und der Neuzeit mit historischer und systematischer Einführung für Archivbenutzer, Studierende, Heimat- und Familienforscher u.a., Nachbildungen der Originale (Grundriß der Genealogie 6). Limburg/Lahn 1966 (Reprint).
Jörg Heinrich, Martin Klöpfer: Abkürzungen und Schriftbesonderheiten in der Frühen Neuzeit aus altwürttembergischen Quellen. Stuttgart 2003]
Reinhard Heydenreuter, Wolfgang Pledl, Konrad Ackermann: Vom Abbrändler zum Zentgraf. Wörterbuch zur Landesgeschichte und Heimatforschung in Bayern. München, 22009.
Rudolf Kunz: Wörterbuch für südhessische Heimat- und Familienforscher (Darmstädter Archivschriften). Darmstadt 1995.
Johann Georg Krünitz, Oekonomische Encyklopädie oder allgemeines System der Staats- Stadt- Haus- und Landwirthschaft, 242 Bände, 1773 bis 1858. [Eine der umfangreichsten Enzyklopädien des deutschen Sprachraums und der wichtigsten deutschsprachigen wis-senschaftsgeschichtlichen Quellen für die Zeit des Wandels zur Industriegesellschaft]
– http://kruenitz1.uni-trier.de
Hermann Metzke: Lexikon der historischen Krankheitsbezeichnungen. Neustadt/A. [1994].
Reinhard Riepl: Wörterbuch zur Familien- und Heimatforschung in Bayern und Österreich. Waldkraiburg, 2. verb. und erg. Aufl. 2004
Peter-Johannes Schuler: Historisches Abkürzungslexikon (Historische Grundwissen-schaften in Einzeldarstellungen 4), Stuttgart 2009.
Fritz Verdenhalven: Familienkundliches Wörterbuch. Neustadt/A. 31992
Johann Heinrich Zedler: Grosses vollständiges Universal-Lexikon aller Wissenschaften und Künste. Halle, Leipzig 1732-1754. ND Graz 1961-1964, – http://www.zedler-lexikon.de
Erhard Agricola: Aus dem Nachlaß bearb. und für den Druck vorbereitet von Wilhelm Braun, Wörterbuch des christlich geprägten Wortschatzes. Stuttgart 2003.
Friedrich Hauck, Gerhard Schwinge: Theologisches Fach- und Fremdwörterbuch: mit einem Verzeichnis von Abkürzungen aus Theologie und Kirche und einer Zusammen¬stellung lexikalischer Nachschlagewerke. Göttingen 2005
Archiv- und Aktenkunde
Friedrich Beck, Eckart Henning: Die archivalischen Quellen. Eine Einführung in ihre Benutzung. Weimar, 5. aktual. Aufl. 2012
Martin Burkhardt: Arbeiten im Archiv. Praktischer Leitfaden für Historiker u. andere Nutzer. Paderborn 2006
Hans Wilhelm Eckhardt, Gabriele Stüber, Thomas Trumpp: „Thun kund und zu wissen jedermänniglich“. Paläographie – Archivalische Textsorten – Aktenkunde (Landschafts-verband Rheinland – Archivberatungsstelle, Archivhefte 32). Köln 1999.
Forschen im Archiv – ein Kurzlehrgang. – https://internet.archivschule.uni-marburg.de/projekte/forschen/Index.html
Eckhart G. Franz: Einführung in die Archivkunde. Darmstadt, 7., aktual. Aufl. 2007.
Gebhard Mehring: Schrift und Schrifttum. Zur Einführung in archivalische Arbeiten auf dem Gebiet der Orts- und Landesgeschichte. Stuttgart 1931.
Bei Wikisource, Blättern durch gescannte Seiten und durch Textversion: http://de.wikisource.org/wiki/Schrift_und_Schrifttum:04
Mark Mersiowsky: Die Anfänge territorialer Rechnungslegung im deutschen Nordwesten. Spätmittelalterliche Rechnungen, Verwaltungspraxis, Hof und Territorium (Residenzen-forschung 9). Stuttgart 2000.
Südwestdeutsche Archivalienkunde: http://www.leo-bw.de/themenmodul/sudwestdeutsche-archivalienkunde. Erläuterungen dazu siehe ZWLG 78 (2019), S. 411-414.
Gabriele Stüber, Thomas Trumpp: Französisch im Archiv. Ein Leitfaden für Archivare und Historiker (Landschaftsverband Rheinland – Archivberatungsstelle, Archivhefte 23). Köln 1992.
Thomas Vogtherr: Urkundenlehre. Basiswissen (Hahnsche Historische Hilfswissenschaften 3). Hannover 2008.
Familienforschung (inkl. Auswanderung)
Ahnenforschung – Auf den Spuren der Vorfahren (inkl. CD-ROM). Ein Ratgeber für Anfän-ger und Fortgeschrittene, hg. vom Verein für Computergenealogie e.V., Reichelsheim (Wetterau) 2007.
Rolf Bidlingmaier: Verzeichnis der Kirchenbuchverkartungen und Ortsfamilienbücher in Baden-Württemberg. Stuttgart 2006
Computergenealogie. Magazin für Familienforschung, hg. vom Verein für Computergenealogie e.V. (erscheint vierteljährlich) [
Familienforschung. Ahnenforschung leichtgemacht. Computergenealogie für Jedermann. Offizielles Magazin des Vereins für Computergenealogie, 2019.
Stefan Lindtner: Von Königheim im Großherzogtum Baden in die Vereinigten Staaten von Amerika. Auswanderer aus Königheim im 19. Jahrhundert. Königheim 2011.
Claus Müller: Helmstadter Auswanderer nach Ungarn und Österreich, in: Blätter für frän-kische Familienkunde 32 (2009), S. 257-264.
Wolfgang Ribbe, Eckart Henning: Taschenbuch für Familiengeschichtsforschung, Neu-stadt/A. 1995
Friedrich R. Wollmershäuser: Emigrants and absentees from the Kingdom of Württemberg and surrounding regions / Auswanderer und Abwesende aus dem Königreich Württemberg und seinen Nach¬barregionen. Vol. 1: 1785-1815, Vol. 2: 1816-1835. Ubstadt-Weiher 2017
Friedrich R. Wollmershäuser: Emigrants from the Grandduchy of Baden before 1872; Vol. 2: The Odenwald and Bauland regions with the districts of Adelsheim, Boxberg, Buchen Eberbach, Gerlachsheim, Krautheim, Mosbach, Tauberbischofsheim, Walldürn and Wert-heim / Odenwald und Bauland mit den Amtsbezirken Adelsheim, Boxberg, Buchen, Eber-bach, Gerlachsheim, Krautheim, Mosbach, Tauberbischofsheim, Walldürn und Wertheim. Ubstadt-Weiher 2017. [
Sascha Ziegler (Hg.): Ahnenforschung. Schritt für Schritt zur eigenen Familienge¬schichte. Hannover 32012
weitere Hilfsmittel
Hubert Emmerig: Glossar zu Münztechnik und Münzverwaltung in Spätmittelalter und frü¬her Neuzeit. Zum frühneuhochdeutschen Wortschatz in ausgewählten Quellen (14. bis 17. Jahrhundert). Braunschweig 2006
Hermann Grotefend: Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit. Hannover 1991, – http://bilder.manuscripta-mediaevalia.de/gaeste//grotefend/grotefend.htm
Gabriele Hendges: Maße und Gewichte im Hochstift Würzburg vom 16. bis zum 19. Jh. München 1989.
Wolfgang von Hippel: Maß und Gewicht im Gebiet des Großherzogtums Baden am Ende des 18. Jahrhunderts (Südwestdeutsche Schriften 19). Mannheim 1996.
Niklot Klüßendorf: Münzkunde. Basiswissen (Hahnsche Historische Hilfswissenschaften 5). Hannover 2009
Dieter Lauer: Die Schatzungslisten der Jahre 1542, 1594, 1603, 1609, 1655 für den Ort Billingshausen im Main-Spessart-Kreis. Auswertungen, Erläuterungen und Aufzeichnun¬gen zum Bild eines fränkischen Dor¬fes und seiner Bewohner. Nürnberg 1987
Dieter Lauer: Tabellen mit Münz-Symbolen zu den Schatzungslisten der Jahre 1542, 1594, 1603, 1655 und den Cent-Protokollen von 1587 bis 1617 für den Ort Billingshau¬sen im Main- Spessart- Kreis. Nürnberg 1988
Henner R. Meding: Die Herstellung von Münzen. Von der Handarbeit im Mittelalter zu den modernen Fertigungsverfahren (Gesellschaft für Internationale Geldgeschichte). Frankfurt 2006. [
Tabellen zur Verwandlung der alten Maase und Gewichte des Großherzogthums Baden in die neuen allgemeinen Badischen. Karlsruhe 1812
Wolfgang Trapp: Kleines Handbuch der Münzkunde und des Geldwesens in Deutsch¬land. Stuttgart 1999. [Reclam gelbe Reihe]
Fritz Verdenhalven: Alte Meß- und Währungssysteme aus dem deutschen Sprachgebiet. Was Familien- und Lokalgeschichtsforscher suchen. Neustadt/Aisch 21993
Fritz Verdenhalven [Bearb.]: Kleiner historischer Städtenamen-Schlüssel für Deutschland und die ehemaligen deutschen Gebiete. Neustadt/A. 1970.
Besteht denn keine Möglichkeit, das Dokument zu bearbeiten und dabei die „Sprache der Täter:innen“ zu entfernen? Es ist 2020 absolut unangebracht, Menschen „Z*geuner“ zu nennen, egal in welchem Kontext. Wenn sie als Opfer nationalsozialistischer Gewaltherrschaft genannt sind, ist die Bezeichnung erst recht zu vermeiden.
Falls eine Bearbeitung nicht möglich ist, wäre zumindest eine Einordnung der verwendeten Begriffe bei der Bereitstellung hier angebracht.
Die Kritik an der fehlenden Einordnung ist brechtigt und ist der kurzfristigen, um nicht zu sagen, spontanen Veröffentlichung des Dokumentes geschuldet. Eine Bearbeitung des Dokumentes war nicht möglich.
Die publizierte Aufstellung geht allerdings – und dies war die Motivation – mit der Quellenauswertung teilweise über den bisherigen Stand des Aktiven Gedenkbuchrs für die Opfer des Nationalsozialismus im Kreis Siegen-Wittgenstein hinaus.
Zur regionalen Literatur:
– Opfermann, Ulrich F.: „Daß sie den Zigeuner-Habit ablegen“. Die Geschichte der „Zigeuner-Kolonien“ zwischen Wittgenstein und Westerwald, Frankfurt a. M. u. a. 1996, 2., ergänzte Aufl., Frankfurt a. M. u. a. 1997.
– Opfermann, Ulrich F.: Der „Mäckes“ – Zu Geschichte und Bedeutungswandel eines Schmähworts, in: Nassauische Annalen, Bd. 109, 1998, S. 363-386.
– Opfermann, Ulrich F.: Zigeunerverfolgung, Enteignung, Umverteilung. Das Beispiel der Wittgensteiner Kreisstadt Berleburg, in: Kenkmann, Alfons; Bernd-A. Rusinek (Hrsg.), Verfolgung und Verwaltung. Die wirtschaftliche Ausplünderung der Juden und die westfälischen Finanzbehörden, Münster 1999, S. 67-86.
– Opfermann, Ulrich F.: The registration of Gypsies in National Socialism. Responsibility in a German region, in: Romani Studies (continuing Journal of the Gypsy Lore Society), 5th Series, Vol. 11, No. 1 (2001), S. 25-52.
– Opfermann, Ulrich F.: Berleburg im Nationalsozialismus, in: Riedesel, Rikarde/Johannes Burkardt/Ulf Lückel (Hrsg.), Bad Berleburg – Die Stadtgeschichte, Bad Berleburg 2009, S. 215-246.
– Opfermann, Ulrich F.: „Schlussstein hinter Jahre der Sittenverwilderung und Rechtsverwirrung“. Der Berleburger Zigeuner-Prozess, in: Antiziganismuskritik, 2 (2010), H. 2, S. 16-34, siehe: http://www.antiziganismus.de/resources/2010_2_Antiziganismuskritik.pdf ; geringfügig abweichender Nachdruck in: Wittgenstein. Blätter des Wittgensteiner Heimatvereins e. V., 99 (2011), Bd. 75, H. 1, S. 27-37 (Teil 1); 99 (2011), Bd. 75, H. 3, S. 113-123 (Teil 2).
– Opfermann, Ulrich F.: Siegerland und Wittgenstein. „Etwa 85 v. H. besitzen eigene Häuschen“, in: Karola Fings; Ulrich Friedrich Opfermann (Hrsg.), Zigeunerverfolgung im Rheinland und in Westfalen. 1933-1945. Geschichte, Aufarbeitung und Erinnerung, Paderborn 2012, S. 233-255.
– Opfermann, Ulrich F.: Soest. „Mit deutscher Gründlichkeit und Gewissenhaftigkeit“, in: Karola Fings; Ulrich Friedrich Opfermann (Hrsg.), Zigeunerverfolgung im Rheinland und in Westfalen. 1933-1945. Geschichte, Aufarbeitung und Erinnerung, Paderborn 2012, S. 257-264.
– Opfermann, Ulrich F.: Genozid und Justiz. Schlussstrich als „staatspolitische Zielsetzung“, in: Karola Fings; Ulrich Friedrich Opfermann (Hrsg.), Zigeunerverfolgung im Rheinland und in Westfalen. 1933-1945. Geschichte, Aufarbeitung und Erinnerung, Paderborn 2012, S. 315-326.
– Opfermann, Ulrich F.: „Zigeuner“ auf der Heimatbühne. Eine Sauerländer Erfolgsautorin und ihr Hauptwerk, ders. mit Karola Fings (Hrsg.), Zigeunerverfolgung im Rheinland und in Westfalen. 1933-1945. Geschichte, Aufarbeitung und Erinnerung, S. 301-314; mit kleinen Änderungen auch in: Christine Koch-Mundartarchiv in Zusammenarbeit mit dem Kreisheimatbund Olpe (Hrsg.), Josefa Berens-Totenohl (1891-1969). Nationalsozialistische Erfolgsautorin aus dem Sauerland. Forschungsbeiträge von Peter Bürger, Reinhard Kiefer, Monika Löcken, Ortrun Niethammer, Ulrich Friedrich Opfermann und Friedrich Schroeder (daunlots. internetbeiträge des christine-koch-mundartarchivs am museum eslohe, nr. 70), Eslohe 2014, S. 69-84, siehe: http://www.sauerlandmundart.de/pdfs/daunlots%2070.pdf
– Opfermann, Ulrich F.: Sinti und Jenische. Ein Beitrag zur regionalen Minderheitengeschichte, in: Siegener Beiträge. Jahrbuch für regionale Geschichte, 20 (2015), S. 164-177.
– Opfermann, Ulrich F.: Restbestände des Romanes und des Jenischen in Wittgenstein und im Siegerland, in: Klaus Siewert, Geheimsprachen in Westfalen, …, in: Klaus Siewert (Hrsg.), Geheimsprachen in Westfalen, Bd. 3, Hamburg/Münster 2017, S. 221-254.
Weitere regionale Literatur zu „Jenische und Sinti“ findet sich unter der gleichnamoge Rubrik in der Bibliographie Wittgenstein (S. 43-48, Stand: 1.8.2020)
Richtig! Gratulation!
Querende Panzer – ist dies eine Vermutung oder ist dies auf Militärgeländen so? Wir waren uns unschlüssig über den Sinn des Schildes.
Weiterhin führt Manfred Knoche mit 2 richtigen Lösungen an. Es folgen nun Herbert Bäumer, Sven Panthöfer, Manfred Heiler, giebeler und Reinhard Kämpfer mit je 1 richtigen Lösung. Für Spannung bei der letzten Runde in der kommenden Woche ist also gesorgt.
Zum Hintergrund der Zusatzfrage: In unmittelbarer Nähe des Kreuzes befinden sich noch einige zerbröckelnde Beton-Konstruktionen, die man mit etwas Phantasie für Bahnschwellen und einen Prellbock halten könnte – wenn auch alles winzig dimensioniert ist. Der Gedanke drängt sich auf, dass hier irgendein schienengebundenes Transportmittel in Betrieb war. Wenn dem so wäre, könnte das Kreuz auch der Warnung vor diesem eher unscheinbaren Vehikel gedient haben. Panzer fuhren ja auf dem großen Gelände überall herum, so dass eigentlich an jeder Wegkreuzung ein Andreaskreuz hätte stehen müssen. Dann wären aber sicherlich mehr als nur dieses eine erhalten geblieben. Sachdienliche Hinweise sind hier jederzeit willkommen.
Der Baum steht auf der Trupbacher Heide. Besonders auffällig sind die in den Stamm eingelassenen Trittstufen. Und wenn mich nicht die Erinnerung trügt, dann steht der Baum auf der Gemarkungsgrenze.
@Raimund Hellwig: Es handelt sich in der Tat um die historische Grenzeichen zwischen Siegen und Freudenberg. QAuch die Steigeisen bzw. Stufen wurden richtig erkannt. Damit wurde die Frage zu 66 % gelöst.
@giebeler: Die Fichte ist richtig – damit haben Sie das Rätsel zu 33 % gelöst.
Somit ergibt sich folgender Endstand: 1) Manfred Knoche mit 2 richtigen Lösungen
2) giebeler mit 1,33 richtigen Lösungen
3) Herbert Bäumer, Sven Panthöfer, Manfred Heiler, und Reinhard Kämpfer mit je 1 richtigen Lösung
4) Raimund Hellwig mit 0,66 richtigen Lösungen.
Herzlichen Glückwunsch an Manfred Knoche!
Vielen Dank an Peter Kunzmann für das diesjährige Sommerrätsel!
Ein Hoch dem Verfasser, dem Korrektor und dem Kreisarchivar.
Diese wahrliche Geschichte treibt mich an, den deutschen Fußballbund und der FIFA in einem persönlichen Gespräch nahezulegen, die WM 2022 in Katar nicht auf den November / Dezember – das ist intensive Lernzeit in der VHS – sondern auf den Juli / August zu platzieren… da haben wir Sommerpause.
Anmerkungen zum letzten Rätsel:
Die markante Eiche hätte Maler wie Caspar David Friedrich inspiriert und wirkt zu recht als Blickfang, was aber nichts daran ändert, dass sie eigentlich verkrüppelt ist. Ihr Habitus wie auch die geringe Höhe (besonders deutlich im Vergleich mit der knapp 20 Meter hohen Fichte) lassen auf massiven Verbiss in frühen Jahren schließen – wahrscheinlich durch Rinder, da sie sicher am Rand eines beweideten Haubergs stand, wo sie wohl nie auf den Stock gesetzt worden war aber vielleicht der Samengewinnung diente. Möglicherweise waren ihre Wachstumsdefizite seinerzeit (ich schätze vor weniger als 200 Jahren) auch der Grund dafür, an dieser Stelle zwischen Siegener und Freudenberger Gebiet noch zusätzlich einen gewissermaßen „amtlichen“ Grenzbaum mit besserer Zukunftsperspektive, nämlich die solitäre Fichte, zu pflanzen. Die metallischen Steighilfen am Stamm der Eiche führten während der militärischen Nutzung des Geländes zu einer Beobachtungsplattform in ihrer Krone. Heute lassen dort oben erziehungsberechtigte Banausen gern ihren Nachwuchs herumklettern. Spätestens nach dem ersten Unfall wird der sehenswerte Baum, der sich ohnehin in einem nicht sehr gesunden Zustand zu befinden scheint (viel Totholz im Kronenbereich) vermutlich der Säge zum Opfer fallen. Das wäre schade.
Ein anderer Grenzbaum ganz in der Nähe ist die berühmtere „Hohle Eiche“. Wer sie kennt, wird sich freuen, dass sie trotz des Brandanschlages von Karfreitag 2017 immer noch sehr vital ist.
Einem Aufsatz von Uta Birkhölzer und Alfred Becker in „Siegerland“ 83 (2006), S. 111-123 ist zu entnehmen, dass vom Forstamt Siegen 2005 eine „Inventur der heutigen Grenzbäume im Siegerland“ initiiert worden war, um die in den Gemeinden „noch vorhandenen Grenzbäume zu erfassen, zu beschreiben und Besonderheiten wie z.B. Gefährdungsart und -grad festzuhalten“. Publiziert wurde anscheinend (im genannten Aufsatz) lediglich ein „erstes Ergebnis“, und zwar für den Forstbetriebsbezirk Holzklau. Es wäre schön, wenn die umwelthistorisch sicher interessanten Erhebungen der Siegerländer Öffentlichkeit irgendwann komplett zugänglich gemacht werden könnten (was natürlich die optimistische Erwartung voraussetzt, dass dieses Projekt überhaupt über erste Ansätze hinaus gediehen war).
Hallo ich finde das alles hoch interessant aber noch interessanter finde ich wir heißen auch Dirlmeier aus Memmingen .
Ich meine ja nur so fiele Dirlmeiers gibts ja auch nicht ♂️ viel Erfolg in der Zukunft und Gesundheit !.
Grüße Klaus Dirlmeier
Aufgrund dieses Ergebnisses bleibt der/dem an Archiven Interessierten wohl nichts anderes übrig als dieser Anregung zu folgen:
An alle Archivar*innen in NRW: In vier Wochen sind #Kommunalwahlen, die besonders für die #Kommunalarchive wichtig sind. Leider steht in den meisten #Wahlprogrammen nichts dazu. Vorschlag: Wir Archivar*innen fragen bei den Parteien vor Ort nach deren Ideen zu den Archiven nach.
Der zitierte markige Satz aus dem CDU-Wahlprogramm
„Archivarbeit ist auch kommunale Daseinsvorsorge“
verwendet zwar eine juristisch eher unpräzise, aber rhetorisch gut verwendbare Begrifflichkeit. Gegen die Forderung nach mehr „Daseinsvorsorge“ lässt sich schlecht argumentieren, erst recht nicht in Pandemiezeiten.
Vielen Dank für Ihren Kommentar und die Analyse des vorletzten Satzes des Zitates! Ich persönlich finde allerdings die konkreteren Aussagen interessanter – in Richtung citizen science bzw. crowd sourcing und in Richtung digitaler Langzeitarchiviverung.
Ein Auswertung von Corinna Nauck „Mit Bürgersinn und Bürgergeist. Kommunale Selbstverwaltung und Stadtentwicklung in der kreisfreien Stadt Siegen“ (St. Katharinen 1999):
• 21.02.1933: Nachdem die kommunalen Vertretungskörperschaften nach der Machtergreifung Hitlers am 08.02.1933 für aufgelöst erklärt wurden, beruft Fissmer die Stadtverordnetenversammlung nochmal ein und dankte den Kommunalpolitikern für ihre geleistete Arbeit
• Oktober 1933: Fissmer versucht erneut – unter Berufung auf die hohe Wohndichte im Stadtkreis -, mittels einer Eingabe an den Regierungspräsidenten in Arnsberg Eingemeindungspolitik einzuleiten – ein Teil des zur Gemeinde Achenbach gehörenden Heidenberges, wurde in den Stadtkreis eingegliedert; Heidenberg wurde erst 1935 im Zuge der Garnisonwerdung bebaut (Nauck, S. 91)
• 28.02.1934: zum letzten Mal traten die gewählten Vertreter der Stadt in einer Sitzung zusammen – Oberbürgermeister Fissmer betonte besonders, dass er gemäß dem Gemeindeverfassungsgesetz für die Verwaltung der Stadt „allein verantwortlich sei“ (Nauck, S. 70)
• er setzte seine Vorstellungen mithilfe der Verwaltung ohne vorherige Beratung im Stadtparlament durch (Nauck, S. 68)
• das Stadtoberhaupt musste sich nicht bemühen, die Gemeinderäte von Plänen und Vorhaben zu überzeugen- Kenntnis genügte (Nauck, S. 68)
• die meisten Wirkungsfelder der kommunalen Selbstverwaltung wurden nun zur Beratung an Ausschüsse übergeben, die Ergebnisse der Beratung dem Bürgermeister zur Entscheidung vorgelegt und entsprechende Vorlagen Gemeinderat meist nicht unterbreitet (Nauck, S. 69)
• 1937: Fissmer regt die Errichtung einer Theater- und Konzerthalle an (spätere „Siegerlandhalle“) (Nauck, S. 383)- spätere Aufnahme des Projekts- Fertigstellung: November 1960 (Nauck, S. 398)
• September 1939: Fissmer ordnet in seiner Eigenschaft als örtlicher Luftschutzleiter den Bau von öffentlichen Luftschutzräumen in der Nähe des Bahnhofs und im Bereich der Eintracht an (Nauck, S. 128)
• ab 1939: besondere Bemühungen um die „geistige Gesundheit“ der Bevölkerung und insbesondere der Soldaten: Fissmer beauftragt Gartenamt mit Verschönerung der Grünanlagen der Stadt (Nauck, S. 132-133)
• Januar 1940: Fissmer teilt mit, dass „… in allen Stadtteilen ausreichende öffentliche Luftschutzräume ausgebaut“ worden seien (Nauck, S. 128)
• 1940: aufgrund eines Führererlasses gibt Fissmer die Errichtung von Stollen zum Schutz der Bevölkerung in Auftrag- in der Nachkriegszeit will er Stollen mit stadtplanerischen Aktivitäten verbinden- Verkehrserleichterung etc. (Nauck, S. 130)
• 1941: Oberbürgermeister Fissmer regt Pläne zur Errichtung eines Aufmarschgeländes auf dem Gelände der „Eintracht“ vor (Nauck, S. 135)
• 1942: Fissmer setzt ein Ortsstatut von 1919 wieder in Kraft, da der Wohnungsfehlbestand in Siegen auf 1300 Wohnungen beziffert wurde (S. 126)
• ab 1942: Fissmer fordert Aufwertung des Gartenbestandes in Nutzungsbestand mit städtischer Förderung – zur Versorgung der Bevölkerung (Nauck, S. 134)
Im Katalog zur großen Siegener Ausstellung zur Nachkriegszeit in Siegen 2005 im ehemaligen Kaufhof findet sich auch ein eigener Abschnitt zu Alfred Fissmer. Vieles dort ist in der Zwischenzeit bekannt. Eines jedoch habe ich unlängst „wieder“entdeckt. Der Selbstmordversuch Fissmers im Mai 1942 wurde und wird bisher eher weniger thematisiert. In der Ausstellung fand sich ein Polizeibericht (Quelle: Stadtarchiv Siegen S 412), der den Hergang des Selbstmordversuches schildert. Der dort geschilderte Hergang ist bemerkenswert. Fissmer hatte demzufolge seinen leitenden Schutzpolizisten aus dessen Dienstzimmer geschickt und sich mit dessen Waffe versucht zu erschießen. Es stellen sich auch hier mehrere Fragen…….
Im Archiv des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe befindet sich im Nachlass der Franz Petri unter der Signatur 914/84 ein Aktenband, der Vorgänge aus dem unmittelbaren Tätigkeitsbereich der Militärverwaltung Belgien/Nordfrankreich vom 19. Juni 1941 – 17. Juli 1941, 9. August 1941 enthält. Für die Rubensfeierlichkeiten besonders interessant dürften folgende Schreiben sein:
– Vermerk von KVR Reese über eine Verfügung des MVCh zur Teilnahme an der Rubens-Feier der Stadt Siegen und derartigen Ausstellungen; o.O., 14.07.1941, (kult), S. 021
– KVR Reese an das Museum des Siegerlandes, Siegen: Absage einer Einladung zur Teilnahme an der Rubensfeier; o.O., 20.06.1941, (kult), S. 146
Ein Fund im Bundesarchiv Berlin:
R 3001{Reichsjustizministerium]/20342 Anpassung von Rechtsverhältnissen an veränderte wirtschaftliche Verhältnisse (1933) 1935-1939 (1943), enthält u.a.: Herabsetzung von Rentenbezügen bei Leibrenten.- Schriftwechsel mit dem Oberbürgermeister von Siegen, 1935
Wenn sich diese Intension bei der Novellierung des DSchG. NRW durchsetzt, dann wird in Zukunft so manches denkmalgeschützte Gebäude vernichtet werden.
Beispiel: Hüttenmeisterhaus in Kreuztal Kredenbach-Lohe.
Die Kommune Kreuztal / Untere Denkmalbehörde lehnt es bis heute strikt ab, in diesem speziellen Fall ein zulässiges Enteignungsverfahren nach §30 DSch NRW einzuleiten, weil man dann die rel. hohen Renovierungs- und späteren Erhaltungskosten nicht tragen möchte. Eine erstrebenswerte soziale, allgemeinwohlfördernde Nutzung des renovierten Gebäudes wurde leider bisher von den dort politisch Verantwortlichen nicht gefunden.
Der priv. Eigentümer kann aber das bereits über 300 Jahre alte , ortsteilbestimmende Fachwerkgebäude keinem wirtschaftlichen Nutzen zuführen, weil sich das einfach bei den hohen Renovierungskosten, trotz evtl. zu erwartenden Landes-Zuschüsse , einfach nicht rechnet . Und wenn der Eigentümer es nicht freiwillig der Kommune übereignen möchte, (gesetzlich wäre die Kommune dann zur Übernahme aber gezwungen !) ist der weitere Verfall des denkmalgeschützten Fachwerkhauses unausweichlich vorgegeben.
Wenn hier aber in der Novelle des DSchG NRW für derartige speziellen Fälle, keine entsprechenden gesetzlichen Vorgaben gemacht werden, die der Unteren Denkmalbehörde eine zwingend gebotenen Übernahme in kommunaler Hand vorgibt, bleibt das DSchG NRW auch weiterhin nur ein „papierner Tiger“ .
(die zu erwartenden Renovierungskosten aus Steuermitteln müssen den evtl. geforderten priv. Entschädigungsforderungen gegengerechnet werden. Der Kommune werden max. 10 Jahre für die Renovierung des Denkmals zugebilligt)
Den nachfolgenden Generationen bleibt ja immerhin im Falle z.B. des Kredenbacher Hüttenmeisterhauses, nach Abriß oder völligen Verfall des Denkmals, die helle Freude an einer Hallenblechwand oder einem erweiterten Parkplatz. (s.a. Fotos)
Ob die dann dafür auch Verständnis aufbringen werden ?
Das wäre ja aber auch nicht der erste Fall , wo man sich dann leider viel zu spät über die Vernichtung Siegerländer Kulturgutes aufregt.
Weiterer „Fund“ im Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Bestand
503 Innenministerium Nr. Nr. 4339 a, Wahrnehmung der Kommunalaufsicht bei Bau und Unterhaltung von Straßen und Wasserbauten, enthält: Gründung eines Lahnverbandes zur Errichtung einer Lahntalsperre bei Laasphe, 1955 – 1960.
Ferner müsste wohl die folgende Literatur ausgewertet werden:
„Neuerscheinung: Die Kabinettsprotokolle der Hessischen Landesregierung -Kabinett Stock (1947-1950)Die Kabinettsprotokolle gehören zu den wichtigsten und interessan-testen Quellen für die hessische Landespolitik in der Frühphase der jungen deutschen Demokratie. Nachdem 2008 der erste Teil der Kabi-nettsprotokolle der Regierung Stock für die Jahre 1947 und 1948 er-schienen ist, liegt nunmehr mit dem zweiten Teilband eine vollstän-dige, kommentierte Ausgabe der gesamten Regierungszeit des Kabi-netts Stock 1947 bis 1950 vor.Zu den teilweise schon aus Band 1 bekannten landespolitischen The-men der Schul-, Hochschul-, Kultur-, Justiz-, Sozial-und Wirtschaftspo-litik, der Reform der Kommunalverfassung und des Wahlrechts sowie des Abschlusses der Entnazifizierung kamen mit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes neue, von der Bundespolitik bestimmte Schwerpunkte hinzu. Hier zeigt sich, wie selbstbewusst, konstruktiv und kritisch die hessische Landesregierung auf der Grundlage der neuen verfassungsmäßigen Ordnung gegen-über der Regierung Adenauer eigene Positionen vertrat.Der zweite Teilband besitzt eine eigene ausführliche Einleitung, die den zeitgeschichtlichen Kontext beschreibt und in die Themenfelder einführt. Aussagekräftige Dokumente ergänzen die Protokolle, ein Sach-und Personenindex erschließt den Band.Sonderpreis der Historischen Kommission für Nassau für Band 1 (1947-1948) und Band 2 (1949-1950) zusammen: € 59,-.Bestelladresse: Historische Kommission für Nassau Mosbacher Straße 55 65187 Wiesbaden Tel.:0611/881-0 Fax: 0611/881-145, E-Mail: wiesbaden@hla.hessen.de, http://www.hiko-nassau.de “ (Quelle: Newsletter HessenArchiv aktuell08/2020)
Das Werk ist zurzeit im Entstehen begriffen – hier der Stand von gestern Nachmittag:
Man kan den Werdegang ja selbst vor Ort verfolgen oder im Netz auf der Hompegage des Festivals s. obigen Link zum Projekt.
Ist die Aussage „Ein umfassendes Archiv wäre ein teuerer Luxus“ denn grundsätzlich falsch? Wenn ja, bitte ich um Erläuterung. Ich frage, weil der Obdachlose, der dieser Tage, als ich frühmorgens in der Volksbankfiliale Geld abgehoben habe, dort in der Ecke lag, das sicher genauso sehen würde. Und mit ihm vermutlich alle anderen im Elend lebenden Erdenbürger. Nichts gegen Luxus, aber es sollte doch jeder/jedem klar sein, dass man ihn nur haben kann, wenn man anderen etwas wegnimmt. 86.000 Euro pro Jahr für einen studierten Archivar? Pflegeheime, Krankenhäuser, die Freiwillige Feuerwehr usw. hätten zweifellos auch Verwendung für das Geld, und das würde zu recht niemand für Luxus halten.
Versuchen Sie es lieber mit einem Kommentar, der nicht versucht, obdachlose Menschen gegen die qualifizierte Arbeit in einer Institution auszuspielen, die Pflichtaufgabe und elementarer Bestandteil einer demokratischen Gesellschaft ist. Die beiden Themen haben nämlich nichts miteinander zu tun, auch wenn man sich um beide sorgen muss.
Offenbar haben Sie den Artikel nicht vollständig zur Kenntnis genommen: das Nicht-Auffinden einer Bauakte, die in einem ordnungsgemäß geführten Archiv noch hätte aufgefunden werden können, hat alleine einen Schaden in sechsstelliger Höhe verursacht. Davon alleine hätte man das Archiv vermutlich schon ein paar Jahre finanzieren können, zukünftige, ähnlich teure Fälle könnten zudem vermieden werden.
Ein vernünftig geführtes Archiv ist eben kein unnötiger Luxus, sondern nicht umsonst eine rechtssichernde Pflichtaufgabe, die Kommunen zu erfüllen und zu finanzieren haben – davon profitieren dann irgendwann auch Feuerwehr und Pflegekräfte. Und inwiefern der Obdachlose jetzt darunter leidet, dass eine Kommune eine Pflichtaufgabe auch ausreichend finanziert, müssten Sie mir noch mal erklären, wenn es nicht nur reiner Whataboutism sein sollte.
Ein/e ausgebildete/r Archivar/in ist u.a. ein Spezialist für Verwaltungsschriftgut, der viele gesetzliche Regeln im Kopf haben muss, wenn es um die Aufbewahrung und Archivierung von amtlichem Schriftgut geht. Er/Sie muss in der Lage sein, zu entscheiden, welche Akten so aussagekräftig sind, dass man sie in die 5-10% der Akten aufnimmt, die dauerhaft, also für immer, aufbewahrt werden – mehr dürfen es auf keinen Fall sein, schließlich wollen Sie nicht jedes Jahr ein neues, fachgerechtes und teures Magazin bauen, damit die Räume nicht von neuem überquellen (das Magazin müssen Sie selbstverständlich aus fachlicher Sicht mitplanen, ansonsten hat in Ihrer Verwaltung ja niemand Ahnung von den notwendigen räumlichen und klimatischen Voraussetzungen). Trotzdem muss diese Entscheidung getroffen werden, für die man u.a. wissen muss, welche Unterlagen von wem geführt werden – ist der eine Ordner mit wichtigen Niederschriften jetzt das „Original“ oder sind es nur Kopien? War die Abteilung, aus der diese Akten kommen, federführend für den Vorgang oder nicht? Sind die Unterlagen bei der eigentlich federführenden Stelle noch vorhanden oder hat sie dort jemand vorzeitig entsorgt? Werden die Ordner mit Unterlagen zu Baumaßnahmen an der Kreisstraße jetzt noch gebraucht oder blockiere ich mir damit nur wertvollen Platz im Magazin? Wenn ich jetzt entscheide, dass die Akten nicht dauerhaft ins Archiv sollen, dürfen die dann jetzt schon entsorgt werden, damit der drängelnde Hauptabteilungsleiter mehr Platz in seinem Aktenkeller hat, oder gibt es gesetzliche Regelungen, nach denen die Akten noch 20 Jahre aufbewahrt werden müssen? Gleichzeitig müssen Sie diesen Hauptabteilungsleiter daran hindern, Akten einfach so zu schreddern und damit unersetzbare Unterlagen mit historischem Wert zu vernichten. Der/die Archivar/in muss wissen, warum Akten zwischen 1850 und 1950 vom Zerfall bedroht sind und was man dagegen tun kann, warum Papierfischchen, Metall und Plastik ein Problem sind, was die Vermerke auf preußischen Akten bedeuten, er/sie muss diese Akten (und noch viel ältere Schriftstücke aus zig Jahrhunderten) lesen und beurteilen können, er/sie muss in der Lage sein, diese Unterlagenin einer Spezialsoftware aussagekräftig zu inventarisieren („Verzeichnen“ und zu einem „Findbuch“ zusammenstellen), damit Sie, wenn Sie irgendwann mal etwas im Archiv suchen, auch etwas finden. Er/sie muss entscheiden, welche Unterlagen so wichtig sind, dass es sich lohnt, sie zu digitalisieren (denn alles kann man nicht digitalisieren), anschließend muss er/sie zumindest über soviel technischen Sachverstand verfügen, dass er/sie die Digitalisate auch ins Internet bekommt, bequem verknüpft mit den beschreibenden Informationen aus dem Findbuch und so aufbereitet, dass Sie die 200 Seiten eines Personenstandsregisters von 1820 (in dem Sie gerade ihre Vorfahren suchen) zuhause im Internetbrowser schön durchblättern können und nicht jedes Digitalisat einzeln ohne Zusammenhang anschauen müssen. Dabei muss er/sie natürlich u.a. das Urheberrechtsgesetz und die Datenschutzgesetze im Kopf haben, denn niemand möchte, dass seine Geburtsurkunde vor Ablauf der gesetzlichen Schutzfristen im Internet verfügbar ist. Wenn er/sie damit fertig ist, muss er/sie dem Bürgermeister Details zu einem Jubiläum heraussuchen (die nur zu finden sind, wenn frühere Generationen im Archiv vernünftig verzeichnet haben), u.U. den Geschichtsverein bespaßen (der sich auch vor allem dann freut, wenn er die historischen Bestände des Archivs auch nutzen kann und die nicht irgendwo im Heizungskeller in 40 Jahre alten Kartons gestapelt sind), seinen/ihren Job als Stadtchronist/in erfüllen (das gesellschaftliche Leben der Stadt soll ja auch dokumentiert werden), vielleicht noch schnell den Nachlass eines bedeutenden Bürgers sichern, den die Erben gerade verscheuern wollen und verschiedene Arten von Recherchen beantworten. Zu guter Letzt muss er/sie inzwischen auch ein tieferes Verständnis u.a. von elektronischer Aktenführung, Dokumentenmanagementsystem, eGovernment, Dateiformaten und deren Archivierbarkeit, der Haltbarkeit von Datenträgern (haben Sie schon mal versucht, mit Ihren 15 Jahre alten, selbstgebrannten CD-ROMs oder Ihren 20 Jahre alten Disketten zu arbeiten?), Datenaustauschschnittstellen zwischen verschiedenen aktenführenden Systemen und der elektronischen Langzeitarchivierung im Allgemeinen. Möglicherweise muss er/sie sogar maßgeblich an der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems mitarbeiten (weil sonst niemand mehr Ahnung von vernünftiger Aktenführung hat), AGs zur Verbesserung der Schriftgutverwaltung in der Verwaltung leiten (damit beim nächsten Mal die Bauakte nicht verschwindet), und so weiter, und so weiter. Von der historischen Bildungsarbeit mit Schulen, Vorträgen, Ausstellungen etc. fange ich gar nicht erst an. Wie Sie jetzt vielleicht sehen, benötigen Sie hier eine/n Spezialistin/en, der/die gut ausgebildet ist und der weiß, was er/sie tut und der genug Zeit für seine zahllosen Aufgaben hat. Ein modernes, fachgerechtes Archiv kann unmöglich mit einer Verwaltungskraft, die mit ein paar Stunden die Woche ins Archiv abgeordnet wird, geführt werden. Egal, wie sehr sich diese Kraft bemüht, sie wird die umfangreichen Anforderungen nicht erfüllen können und aufgrund von fachlicher Überforderung und Zeitmangel im Zweifel alles nur noch schlimmer machen. Spezialisten haben ihre Berechtigung und dürfen dafür auch entsprechend bezahlt werden (die 86.000 € sind übrigens nicht das Bruttogehalt, sondern die Arbeitgebergesamtkosten; das Bruttogehalt beträgt etwa die Hälfte). Sie gehen ja schließlich, wenn Sie Zahnprobleme haben, auch nicht zu Ihrem Nachbarn mit der Bohrmaschine, weil der billiger ist als der Zahnarzt.
… Und neben den vielen anspruchsvollen Tätigkeiten muss die Archivarin dann in ihrer Dienstzeit auch noch Deppen wie mich belehren. Wahrlich, ein hartes Schicksal.
Der Netphener Bürgermeister (den ich nicht kenne und dem ich nichts schulde) hat, wenn ich das richtig verstehe, sinngemäß gesagt:
1. Die Erledigung der archivischen Kernaufgaben ist in seiner Kommune gewährleistet. 2. Darüber hinausgehenden „teuren Luxus“ (nämlich eine wissenschaftliche [!] Leitung des kleinen Archivs) kann oder will man sich nicht leisten. Was daran verwerflich sein soll, sehe ich nicht. Sollten die in Netphen für das kommunale Archiv Zuständigen mangelnde Kompetenz an den Tag legen, müßte eben eine Lösung gefunden werden (was aber kein Thema des derzeitigen Kommunalwahlkampfes sein sollte). Sie durch einen Hochschulabsolventen zu ersetzen, wäre nicht die einzige und auch nicht zwangsläufig die beste Option. Allen nicht-akademischen Archivmitarbeitern (ob bezahlt oder ehrenamtlich) pauschal fehlende Professionalität zu unterstellen, ist dünkelhaft und beleidigend. Diese Personen leisten oft hervorragende und anerkannte Arbeit. Ob Hochschulabgänger (in dieser Sparte wohl meist Historiker, möglichst noch promoviert) diese in jedem Fall so viel besser machen würden, wage ich zu bezweifeln.
Übrigens: Da Sie mit dieser obskuren Bauakte argumentieren, verfügen Sie hoffentlich über Hintergrundinformationen , die mir und den meisten anderen Lesern fehlen. Ohne Kenntnis der näheren Umstände sollte man es nämlich lieber unterlassen, öffentlich zu suggerieren, das Verschwinden dieser Akte sei im Archiv von einem unfähigen bzw. schlampigen Mitarbeiter verschuldet worden.
Zum Thema „Luxus“ könnte man lange philosophieren, wenn es einen Sinn hätte. Jeder mitdenkende und nicht übermäßig selbstbezogene Mensch weiß aber auch so, was gemeint war. Wenn Sie noch ein anderes Beispiel haben wollen: Ich als historisch Interessierter finde Archive toll; noch toller hätte ich es aber gefunden, wenn meine schwer demente Mutter ihre letzten drei Lebensjahre nicht in einer Pflegeeinrichtung hätte verbringen müssen, die ihr wegen ungenügender Personalausstattung nur menschenunwürdiges Dahinvegetieren bieten konnte. Ich bin mir sicher, dass sich viele Archivbenutzer zugunsten einer sozial gerechteren Verteilung der beschränkten Ressourcen damit arrangieren könnten, dass sich Archive und andere kulturelle Einrichtungen beim Geldverschenken bescheiden hinten anstellen, solange sie ihre „Kernaufgaben“ jederzeit voll erfüllen können. Dass es aber auch genug verwöhnte Zeitgenossen gibt, die das niemals für sich akzeptieren würden, steht außer Zweifel.
Bitte lesen Sie auch den Kommentar von Frau Wolf und verkneifen Sie sich, die nächste Einrichtung der sozialen Daseinsfürsorge an Land zu ziehen, um zwei vollkommen unterschiedliche Bereiche gegeneinander auszuspielen.
Keine Pflegeeinrichtung wird personell besser ausgestattet, nur weil ein Archiv eine wissenschaftliche Kraft weniger beschäftigt. Wie Herr Schröter-Karin aufgezeigt hat, helfen Archive sogar dabei, Ressourcen einzusparen (die dann wiederum Geld sparen). Ihr Unmut ist hier fehl am Platz.
„Zwei vollkommen unterschiedliche Bereiche“, die, wie Sie oben schrieben, „nichts miteinander zu tun haben“ – klar, so kann man das sehen. Muss man aber nicht. Vielleicht fallen Ihre Scheuklappen mit fortschreitender Lebenserfahrung von selbst ab, und Sie erkennen irgendwann, dass es nur diese eine Gesellschaft mit eng verflochtenen Verantwortlichkeiten gibt. Und nein, mein Unmut über verwöhnte (wenn auch „politisch korrekte“) Wohlstandsbürger, die ihre jeweiligen Standesinteressen für den Nabel der Welt halten, ist keineswegs fehl am Platz.
Sehr geehrter Herr Kunzmann,
es ging mir nicht darum, Sie zu belehren, sondern deutlich zu machen, dass der Archivarsberuf heutzutage deutlich mehr ist als nur Akten zu stapeln. Das das offenbar falsch rübergekommen ist, tut mir sehr leid.
Es geht hier außerdem nicht darum, Verwaltungsbeschäftigten Schlamperei zu unterstellen. Vor Schlamperei würde auch eine Fachausbildung nicht schützen. Es geht darum, dass Verwaltungsbeschäftigte mit zu wenig Ressourcen eine Aufgabe erfüllen sollen, denen sie schlicht und ergreifend nicht gewachsen sind, u.a., weil sie nicht dafür ausgebildet sind. Wenn ich als ausgebildeter Archivar ins Ordnungsamt abgestellt würde und dort meinen Job dann mit der Hälfte der benötigten Stundenanzahl erledigen sollte, würde garantiert auch nichts Gutes dabei herauskommmen.
Das der Bürgermeister behauptet, es wäre alles in Butter, wundert mich nicht, aus meiner eigenen Erfahrung (ich bin als Archivar für sechs Kommunen zuständig) kann ich Ihnen aber versichern, dass das bei der Ausstattung des Archivs gar nicht stimmen kann.
Zudem handelt es sich bei einem/r ausgebildeten Archivar/in, der nach Tarifstufe 9b eingestellt wird, nicht um jemanden, der im Keller rumsitzt und sich in wissenschaftlichen Wolkenkuckucksheimen rumtreibt. Es handelt sich um Beschäftigte mit einem FH-Bachelor bzw. einer dreijährigen verwaltungsinternen Ausbildung zum Diplom-Archivar. Ich missachte im übrigen auch niemanden, der keine akademische Ausbildung hat, das archivische Berufsfeld erstreckt sich schließlich auch auf Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Archiv, die ebenfalls eine Ausbildung absolviert haben. FaMIs leisten hervorragende und unersetzbare Grundlagenarbeit, auch wenn sie halt nicht dafür ausgebildet werden, handschriftliche Texte aus dem 17. Jh. zu lesen. Ich bin im sogar der Meinung, dass man lieber einen Diplom-Archivar einstellen sollte, als einen promovierten Historiker ohne Archivausbildung. Ein guter Historiker ist schließlich noch lange kein guter Archivar. In Netphen ist aber eben gar keine ausgebildete Archivfachkraft am Werk, und das ist m.E. ein großes Problem, da die Aufgaben und Anforderungen im Archivarsberuf in den letzten 20 Jahren größer und nicht kleiner geworden sind.
Im Übrigen tut es mir leid, was Ihrer Mutter widerfahren ist, ich hoffe, das meinen Eltern so etwas erspart bleibt. Da das Personal in Pflegeeinrichtungen allerdings i.d.R. nicht durch Steuergelder finanziert wird, sehe ich nicht, was das mit einer Personalstelle der Stadt Netphen zu tun hat. Wenn Sie mir die Ergänzung gestatten, würde ich allerdings behaupten behaupten, dass Ihnen ein besser bezahlter Facharchivar hier mehr geholfen hätte, da durch dessen höheres Gehalt höhere Beiträge zur Pflegeversicherung geleistet werden könnten. Die Pflegeversicherung wiederum zahlt indirekt das Gehalt der Pflegerinnen und Pfleger in der Altenpflege.
Ach Herr Kunzmann, über unsere Arbeit erzählen wir gern, haben wir es doch oft mit Vorurteilen zu tun. Dafür können die meisten nicht mal was, da liegt eben noch viel Arbeit vor uns. Das ist kein hartes Schicksal, sondern Teil unserer Aufgaben. Ohne in die konkreten Verhältnisse vor Ort genauer eingeweiht zu sein, glauben Sie uns, haben wir eine zu unserem Leidwesen vermutlich ziemlich treffende Vorstellung davon, wie die Kernaufgaben, die der Bürgermeister hier erfüllt sieht, tatsächlich abgedeckt sind. Wie hier schon kommentiert wurde, geht das nicht gegen diejenigen, die tapfer versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Warum wir uns das vorstellen können? Weil wir das Ergebnis unterausgestatteter Archive mehr als einmal gesehen haben. Wir sind Kummer gewöhnt. Wenn Sie sich für die Arbeit der Archive tatsächlich interessieren, was schön wäre, wüssten Sie, dass wir alles andere als Geld verschenken. Und bei allem Verständnis für Ihre persönlichen Erfahrungen: Aufrechnen hat noch nie jemandem mehr gebracht. Das weiß jeder mitdenkende Mensch. Oh, und damit keine Missverständnisse aufkommen: „Ob Hochschulabgänger (in dieser Sparte wohl meist Historiker, möglichst noch promoviert) diese in jedem Fall so viel besser machen würden, wage ich zu bezweifeln.“ Mal abgesehen davon, dass wir tatsächlich wissen, was wir tun, geht es hier nicht um promovierte Historiker. Die angesprochenen Aufgaben und die Eingruppierung in E9 zielen auf ein Diplom oder BA in Archivwissenschaft ab. Wenn Sie sich wirklich für Archive interessieren, finden Sie z. B. hier: https://www.archivschule.de/ mehr Informationen.
Den Kommentaren von Frau Friedrich und Herrn Schröter-Karin ist kaum noch was hinzuzufügen. Sie sehen, Herr Kunzmann, es ist nicht das erste Mal, dass wir mit dem Vorwurf konfrontiert werden, Archive seien ein verzichtbarer Luxus. Einzelne Pflichtaufgaben einer Gemeinde – Kindergärten und Schwimmbäder werden da auch immer gern herangezogen, die Feuerwehr tatsächlich seltener – gegeneinander ausspielen zu wollen ist wenig hilfreich. Genauso wenig wie ein Bürgermeister, der meint, die archivischen Pflichtaufgaben könne man auch Ehrenamtlichen überlassen. Über die angemessene Verteilung der verfügbaren Mittel wird in jeder Kommune jedes Jahr in den Haushaltsanträgen verhandelt. Und ja, Archive sind, ohne pathetisch zu sein, unverzichtbar für eine Demokratie. Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns ist da ein Stichwort. Das gilt auch für die „kleinen“.
Zwei Fragen:
1) Verstehe ich Sie richtig, dass die Stadt Netphen, die archivischen Personalkosten besser in Pflegeheime und Krankenhäuser investieren sollte – wie wohl sie keine solche Einrichtung unterhält?
2) Ist Ihnen entgangen, dass die Stadt Netphen sich sehr wohl um ein fachgerechte Archivierung bei gleichzeitiger Kostenreduzierung bemüht – s. http://www.siwiarchiv.de/es-geht-weiter-mit-der-archivierung-in-netphen/ ?
In diesem Zusammenhang möchte ich an die Deutsche Schachmeisterschaft vom 10. bis 31.08.1947 in Weidenau erinnern. Einer der Initiatoren war der Oberstudienrat Hermann Meyer vom FJM-Gymnasium. Er war von 1946 bis 1948 Vorsitzender des Schachbezirks Siegerland und in den 50er Jahren Jugendleiter des Schachverbands Südwestfalen. Später richtete er am FJM-Gymnasium eine Arbeitsgemeinschaft „Schach“ ein, die alle daran teilnehmenden Schüler zu gefürchteten Spielgegnern machte. (Siegener Zeitung, 13. März 1986) Die Post gab Sonderstempel heraus.
als Abschluss, da ich mich dann aus der Diskussion zurückziehen werde: ich muss keine Besitzwahrung betreiben, ich habe inzwischen einen gut bezahlten Job.
Diesen Job habe ich im übrigen, weil ich erst ein Universitätsstudium absolviert und mich dann auf eigene Kosten (mittlerer 4-stelliger Betrag) in einem berufsbegleitenden Studium zum Archivar weitergebildet habe. Währenddessen habe ich zehn Jahre auf befristeten Stellen gesessen. Ja, es hat sich gelohnt, dafür habe ich aber auch hart genug gearbeitet.
Ich habe keine Ahnung, wie Sie einen Wohlstandsbürger definieren, offenbar gehören wir ja dazu, da Sie mit einiger Verachtung von Fachpersonal sprechen. Bitte denken Sie aber weiterhin daran: Sie möchten von ausgebildeten Polizisten geschützt werden, nicht von irgendwelchen Hilfssherrifs; Sie möchten, dass ein ausgebildeter Handwerker Ihr Haus baut und repariert und nicht der Kumpel vom Schwager vom Nachbarn, damit es nicht beim ersten Sturm auseinanderfällt; Sie möchten, dass ein ausgebildeter Zahnarzt Ihre Zähne bearbeitet und nicht irgendein Metzger mit einem Bohrer in der Hand, nur weil der billiger ist. Wenn Sie Geld und/oder Zeit in etwas investieren, erwarten auch Sie, dass da hinterher etwas bei rausspringt. Und wenn Ihre Kommune einen Beschluss zu Ihren Gunsten trifft, erwarten auch Sie, dass dieser Beschluss Bestand hat und nicht zehn Jahre später jemand behauptet, den Beschluss habe es nie gegeben und es nicht mehr nachweisbar ist, weil die Akten weg sind.
Auch, wenn Sie das gerade nicht sehen wollen, leisten Archive eine wichtige Arbeit (wenn man sie lässt), die keine Spielerei für irgendwelche Spinner ist, sondern eine gesetzlich festgelegte Pflichtaufgabe einer Kommune. Von dieser Arbeit, die aufgrund ihrer Anforderungen zwangsläufig von Fachpersonal erledigt werden muss, profitieren auch Sie.
Das Sie offenbar der Meinung sind, dass dieses Fachpersonal nicht entsprechend seiner Ausbildung bezahlt werden muss, finde ich überaus traurig.
@alle
1) siwiarchiv steht eigentlich für einen wertschätzenden Umgang. Unbegründete persönliche Angriffe werden hier zukünftig nicht mehr zugelassen.
2) Die Diskussion kann m. E. entlang folgender Fragen weitergeführt werden: Sind Archive gleich wichtig wie soziale Leistungen? Wenn ja, warum?
Sehr geehrter Herr Schröter-Karin,
Sie haben sehr viele Eulen nach Athen getragen und offene Türen eingerannt. Da meine Biographie hier nicht von Belang ist, lasse ich es dabei bewenden.
Wo ich angeblich „Verachtung für Fachpersonal“ geäußert haben soll, können Sie ja fairerweise noch nachtragen; ich sehe es nicht. Behauptet habe ich lediglich, dass ein kommunales Archiv wie das in Netphen („Stadt“ erst seit den Gebietsreformen der 1960er Jahre, eigentlich ein Konglomerat kleiner bis kleinster Landgemeinden) nicht unbedingt einen wissenschaftlichen Archivar benötigt, wenn in andern vergleichbaren oder größeren oder älteren Kommunen das Archiv von abgeordneten Sachbearbeitern oder umgeschulten Gymnasiallehrern oder FH-Absolventen über viele Jahre sehr professionell geleitet wird. Da könnte ich Hilchenbach, Freudenberg, bis vor ein paar Monaten Siegen und sicher noch etliche andere nennen. Anscheinend wurde in Netphen (genau weiss ich es nicht) von der SPD-Ratsfraktion die Maximalforderung erhoben, die dann vom parteilosen Bürgermeister als „Luxus“ in Frage gestellt wurde. Ich hoffe wie vermutlich auch Sie, dass am Ende ein sinnvoller Kompromiss zustande kommt, also: Ein bißchen kleinere, aber dennoch solide Brötchen backen.
Das derzeitige Wahlkampfgetön mit der Anspielung auf eine „nicht auffindbare Akte“ zu motivieren, halte ich für unseriös, wenn hier nicht eindeutige Indizien gegen den ehrenamtlichen Archivbetreuer vorgebracht werden können. Wenn es die von mir vermutete Person ist, handelt es sich nicht um irgendeinen heimatforschenden Kaninchenzüchter, sondern um einen pensionierten höheren Verwaltungsbeamten eben dieser Stadt Netphen, der wegen seiner früheren Dienstaufgaben sicherlich eine wichtige Bauakte erkannt und nicht weggeworfen hätte. Soviel abschließend dazu.
Ja, ich halte Sie und mich und alle anderen Einwohner dieses Landes, die mehr als ihre elementaren Lebensbedürfnisse befriedigen können, für Wohlstandsbürger. Und bevor Sie fragen: Ich habe dem Obdachlosen neulich keinen der eben aus dem Automaten gezogenen Scheine zugesteckt. Darum geht es auch überhaupt nicht. Mir gehen nur Hybris, Scheinheiligkeit und Selbstgerechtigkeit auf die Nerven. Davon sehe ich in den Verlautbarungen mancher Archivare (w/m) eine ganze Menge. Archivare können ebensowenig wie die Vertreter aller anderen Berufe diese kranke Menschheit mit einem Geheimrezept beglücken. Sie sind Rädchen im großen Getriebe, nicht unvergleichbar wichtiger als die übrigen Rädchen. Ein bißchen mehr Demut angesichts der existentiellen Probleme dieser Welt wäre angemessen.
1) Ich würde mich sehr über die Beantwortung meiner Fragen freuen.
2) Leider sind die Protokolle des Rechnungsprüfungsausschuss noch nicht öffentlich, so dass kein Beleg für die gemachten Aussagen zur „Aktenaffäre“ eingereicht werden kann.
Lieber Herr Wolf, inzwischen ist es ein wenig unübersichtlich geworden, aber Ihre Fragen waren ja wohl an mich gerichtet.
1.) Nein, Sie haben das nicht richtig verstanden. Ich habe nicht gefordert, dass die Stadt Netphen archivische Personalkosten in andere Bereiche investieren solle. Ich habe (mit zwei lediglich der Illustration dienenden Beispielen) daran erinnert, dass die den Archiven für ihre Arbeit zur Verfügung gestellten und nicht von ihnen selbst produzierten materiellen Werte auch anders verteilt werden könnten, wenn die Gesellschaft andere Prioritäten setzen würde. Archivare können keinen gesellschaftlichen Paradigmenwechsel anstoßen, aber ihnen sollte bei ihrem relativ hohen Bildungsstand bewußt sein, auf wessen Kosten sie (und viele andere, ich auch) letztendlich leben.
2.) Das ist mir nicht entgangen, und gerade das war der Aufhänger für meine eingangs gestellte Frage: Wenn der SPD-Stadtrat den Eindruck zu erwecken versucht, der Bürgermeister wolle das Netphener Archivwesen plattmachen, ist mir das suspekt. Wenn es zutrifft, dass das Bestehende vorerst sicher ist und sogar noch ausgebaut werden soll, wären unrealisierbare zusätzliche Forderungen durch den Stadtrat eher kontraproduktiv. „Alles oder nichts“ kann kein Grundsatz vernünftiger Realpolitik sein.
Sofern ich das richtig verstanden habe, unterscheidet die Stadt Netphen in ihren Erwägungen zwischen einem ausbaufähigen Archiv, das seinen Kernaufgaben voll gerecht wird, und einem (Zitat:) „umfassenden“ Archiv, in dem wohl zusätzlich noch wissenschaftliche Forschung betrieben wird. Letzteres wäre wegen der Personalausstattung deutlich teurer und unter den gegebenen Umständen – ich bleibe dabei – ein „Luxus“. So etwas ähnliches gab es in den 1950 Jahren in Siegen mit der vom Stadtarchivar geleiteten „Forschungsstelle Siegerland“, und sogar dort hatte ein so ambitioniertes Projekt nur kurzen Bestand. Die ganze ausufernde Diskussion beruht auf der Unterstellung, ich habe den Sinn eines gut ausgebauten Kommunalarchivs (erste Variante) geleugnet. Vielleicht erst mal sorgfältig lesen, was wirklich dasteht, bevor der „Shitstorm“ losgelassen wird?
Vielen Dank für die Antwort! Gestatten Sie mir noch Nachfragen?
– Wo genau findet sich der Beleg, dass an Stelle des wissenschaftlichen, höheren Archivdienstes gedacht ist? M.E. ist unter Berücksichtigung des Hinweises von Schröter-Karim eine Stelle des gehobenen Archivdienstes angedacht. Dies entspräche auch der Linie der landschaftlichen Archivpflege.
– Sie unterstellen einer Äußerung, die sich auf einen Bericht im Rechnungsprüfungsausschuss bezieht, aus dem Januar 2019 „Wahlkampfgetöse“. Welcher Wahlkampf war denn das?
Bitte mit Quellen belegen, da sind wir berufsbedingt penibel, wenn Sie „Hybris, Scheinheiligkeit und Selbstgerechtigkeit“ mancher (?) ArchivarInnen ins Feld führen. Wie schon gesagt: Archive sind wichtiger Bestandteil einer Demokratie und das sage ich nicht, weil ich mich oder unsere Arbeit wichtig tun möchte. Es geht um Nachweisbarkeit, Nachvollziehbarkeit, die Möglichkeit, Rechenschaft einzufordern. Es geht um Verantwortung. Und das über das Heute hinaus. Keine Gemeinschaft ist zu klein oder zu unbedeutend, um eine Geschichte zu haben. Von Maximalforderung habe ich übrigens im Bericht nichts entdecken können (was der Bürgermeister unter einem umfassenden Archiv versteht, entzieht sich meinem Verständnis). Im Gegenteil, die vorgeschlagene interkommunale Zusammenarbeit ist ein vernünftiger Weg gerade für solche Kommunen.
P. S.: Niemand wirft dem ehrenamtlichen Betreuer vor, die oder eine andere wichtige Akte vernichtet zu haben. Wenn ich da aus meiner Erfahrung sprechen darf: Die Aktenführung und -ordnung in den Verwaltungen werden oft mehr oder weniger stiefkindlich behandelt. Akten, die länger nicht mehr gebraucht werden oder geschlossen in der sogenannten Altregistratur liegen, haben es da besonders schwer. Sie verschwinden häufig, ohne dass es jemandes Absicht oder Versagen wäre. Die Strukturen müssen stimmen. Eine ehrenamtliche Betreuung kann beim besten Willen keine fachlich qualifizierte Aufgabenerfüllung ersetzen, gerade was Beratung und Übernahme angeht und gerade, wenn nicht nur im Archiv, sondern auch in der Registratur gespart wird.
Also ich finde, man sollte diese Lebensbereiche nicht gegeneinander ausspielen. Ich als Bürger finde, es gibt Berufsgruppen, an denen sollte nicht gespart werden. Dazu gehören Feuerwehr, Polizei und Gesundheitswesen. Und natürlich kann man auch hier und da auf der anderen Seite bei Archiven und Museen sparen, warum auch nicht? Es muss ja wirklich kein kostspieliges Luxusarchiv sein. Bedenklich wird es nur da, wo Kernaufgaben nicht mehr erfüllt werden können, weil zwar die Aufgaben immer mehr geworden sind (Personenstandsunterlagen, digitale Archivierung), aber die Ausstattung nicht parallel mitgewachsen ist. Ein Archiv sollte man halt auch nicht kaputtsparen.
Ob Archivarbeit tatsächlich Luxus ist? Nun solange es sich nur historische Ergebnisse archivischer Arbeit betrachtet werden, mag man dieser Einschätzung folgen – denn wer braucht schon Geschichte, wenn es darum geht, sich um einen Obdachlosen zu kümmern.
Allerdings leist(et)en Archive auch immer Arbeit, die mehr oder weniger vielen Bürger*innen nutz(t)en. Archive als rechtwahrende Institutionen wurden hier zwar aufgeführt – allerdings bislang noch ohne Beispiele.
Die Sicherung und Nutzung der Stasiunterlagen erlaubt in den neuen Bundesländern nicht nur die historische Dokumentation einer staatlichen Unrechtsbehörde, sondern auch vielen einzelnen Bürger*innen konkrete Hilfe bei der „Bewältigung“ der eigenen Lebensgeschichte.
Ebenfalls in den neuen Bundesländern ist die Rolle der Archive bei der Klärung der Eigentumsverhältnisse m. E. nie angemessen gewürdigt worden.
Gleiches gilt für die Rolle der Archive bei der Entschädigung der Zwangsarbeiter*innen. Soll ich noch die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in Kinderheimen erwähnen?
Beinahe Tagesgeschäft von Kommunalarchiven ist die Mitarbeit an der Erstellung von Altlastenkataster, die Ermittlung von Arbeitszeiten bei Rentenfragen, die Vorlage von Adoptionsakten, die Mitarbeit bei der Erbenermittlung bis hin zur Ermittlung von Schulabgangszeugnissen, weil diese irgendwann einmal verlorengingen. Die Liste mag gerne ergänzt werden.
Alle genannten Arbeiten könnhen von Ehrenamtlern angefangen ausgeübt werden; dies gilt aber auch für die genannten sozialen, gesundheitlichen oder pflegerischen Bereiche.
Dann erkläre ich es eben noch einmal. Es gibt eine ganz spezielle Frage von lokalem oder bestenfalls regionalem Interesse innerhalb des Kreises Siegen-Wittgenstein. Diese bewegt die Gemüter in der Gebietskörperschaft Netphen und wurde vom Moderator hier thematisiert: Benötigt Netphen ein funktionsfähiges Kommunalarchiv, wie es viele andere Kommunen dieser Größe und dieses Charakters, auch im Siegerland, haben? (Natürlich „ja“.) Oder benötigt Netphen, was anscheinend dem SPD-Stadtrat vorschwebt, ein Archiv mit darüber noch deutlich hinausgehenden Aufgaben, ein wissenschaftliches Archiv, womöglich mit Forschungsorientierung? Der Bürgermeister meint „nein“ und hält ein solches umfassenderes Archiv in Netphen für eine Nummer zu groß („Luxus“); ich habe gewagt, der gleichen Meinung zu sein.
Über diese Netphener Kontroverse hätte man daraufhin auf Siwiarchiv Gedanken austauschen können. Das ist nicht geschehen. Auch gut. Statt dessen brach von weit her, teils aus Hessen und Schwaben kommend, eine gewaltige Sturmflut allgemeiner archivpolitischer Traktate herein, die an der speziellen Frage „Gutes bezahlbares Archiv oder luxuriöses zu teures Archiv in Netphen?“ total verbeigehen und mich mit Zurechtweisungen über die elementaren Grundlagen des Archivwesens volltexten. Danke, brauche ich nicht, Thema verfehlt. Und Ende.
Sorry, ich hatte übersehen, dass Sie dieser Tage auf einen schon bald zwei Jahre alten Beitrag verlinkt hatten, den ich daraufhin fälschlich für eine aktuelle Stellungnahme aus Netphen hielt. Seitdem dürfte viel Wasser die Sieg heruntergeflossen sein. (Für Ortsfremde: Die Sieg-Quelle befindet sich im Netphener Archivsprengel.) Das offensichtliche Mißverständnis hätte sich auch sofort mit 1-2 Sätzen korrigieren lassen. Nun ja. C’est la vie.
Ob die regierungsinterne Abstimmung über den Entwurf des Archivgesetzes mit dem geplanten Kulturgesetzbuch Nordrhein-Westfalen in Zusammenhang steht. Ein Blick in die entsprechende Vorlage für die heutige Sitzung des Kulturausschusses des Landtages NRW ergibt Folgendes: “ …. 4. Transparente Rahmenbedingungen für Kunst und Kultur schaf-fen und sichern ….. o Die kulturellen Aspekte des Archivwesens und des Denkmalschutzes sollen angemessen berücksichtigt werden. …..“ (S. 2-3)
Laut Ausschussprotokoll erläuterte der parlamentarische Staatssekretär Klaus Kaiser zum Tagesordnungspunkt „Eckpunkte Kulturgesetzbuch Nordrhein-Westfalen“ folgendes zu Archiven: “ ….. Unter dem Titel „Kulturelle Einrichtungen und Handlungsfelder“ widme sich der vierte Teil den zentralen Elementen der kulturellen Infrastruktur, also den Archiven als den kulturellen Speicherorten, aber auch den Museen, Theatern und Orchestern. …. Der Landesregierung liege viel daran, bei den Vorarbeiten gut voranzukommen, um anschließend ausreichend Zeit für eine parlamentarische Begleitung und Beratung zu haben. Ziel sei eine Inkraftsetzung des Gesetzes zum 1. Januar 2022. Bei Nachfragen seitens der Fraktionen oder einzelner Abgeordneter leiste sein Haus gerne Hilfestellung. Über Fortschritte werde er im Ausschuss berichten. …..“ (S.11) Der SPD-Abgeordnete Andreas Bialas stellte u. a. folgende Frage: “ …. ob letztendlich auch bestehende Gesetze zusammengefasst oder einbezogen werden sollten, etwa im Hinblick auf das Kulturfördergesetz, das Archivgesetz, das Pflichtexemplargesetz, das Denkmalschutzgesetz, das Musikschulgesetz oder das Bibliotheksgesetz. Er erinnere in diesem Zusam-menhang auch an § 96 Bundesvertriebenengesetz, an bestimmte Bereiche der Hochschulgesetze, an Kunst am Bau und an den Denkmalschutz. Sicherlich könnten in dieser Hinsicht Schnittstellenprobleme mit anderen Ministerien und mit anderen Ausschüssen erwartet werden. ….Natürlich könne der Kulturbereich die Digitalisierung in Gesetze einfließen lassen, allerdings gebe es in einem anderen Ministerium, vor allem in dem von Herrn Professor Dr. Pinkwart, bereits zahlreiche Digitalisierungsstrategien. Schon mehrfach habe seine Fraktion die Frage gestellt, inwieweit das Kulturministerium sich in Sachen „Digitalisierung“ mit anderen Ressorts abstimme – etwa mit Blick auf schnelle Netze in Bibliotheken, Musikschulen, VHS-Archiven [sic!], Museen und auch Zoos. Neben dem MWIDE lägen die Zuständigkeiten in diesen Bereichen teilweise auch in der Verantwortung der Kommunen. …..“ (S. 12).
Zwei Fragen dazu:
1) Bedeuten die Aussagen des Staatssekretärs, dass das Archivgesetz erst 2022 novelliert wird?
2) Hat der Staatsekretär auf die Frage geantwortet, ob das Archivgesetz in das Kulturgesetzbuch miteinbezogen wird?
Auch hier die Anmerkung, dass ich die Bezeichnung „Kriegstote“ für hier ermordete und anders gewaltsam zu Tode gekommene ZwangsarbeiterInnen unpassend und verschleiernd finde.
Ich denke, dass auch nicht an „Luxusarchive“ gedacht wurde. Vielmehr ging es bei der Diskussion um die Erledigung der Kernaufgaben eines kleinen Stadtarchivs. Einerseits wurde der Eindruck suggeriert, dass dies nur durch eine wissenschaftliche Kraft erfolgen können, demgegenüber stand die Position, dass das Führen eines kleinen Stadtarchivs durchaus auch mit „Bordmitteln“ (z. B. fortgebildete Verwaltungskräfte) machbar ist – vor dem Hintergrund, dass die Aufgabe „Archiv“ bereits ein Luxus ist. Gerade dieser letzte Punkt sollte m. E. tatsächlich intensiv diskutiert werden. Denn der Stellenwert von Archiven in den Gefügen ihrer Träger ist ja i. d. R. nicht eben hoch, wenn finanzielle Verteilkämpfe oder gar wachsende finanzielle Probleme des Trägers hinzukommen, ist dann ein Archiv eine quantité négligeable?
Rezeption von Geschichte, erst recht der Zeitgeschichte, ist eben ein Feld der unterschiedlichen Interessen und des Konflikts. Einblick in die Akten und die Erzeugung von Verschlusssachen sind Mittel der geschichtspolitischen Auseinandersetzung. Immer wieder neu.
Eine Binsenweisheit – in jedem Fall für die Fachöffentlichkeit. Allerdings entbindet dies nicht von der Dokumentation aktueller Konflikte.
Zudem ist die deutliche Positionierung des Bundesarchivpräsidenten ebenso festhaltenswert.
Zur Barrierefreiheit in Hinblivk auf die Verwendung „leichter Sprache“ wurde m. W. erstmals 2012 auf Archivalia diskutiert.
Auch der wichtige und ebenfalls intensiv diskutierte Blogbeitrag zur gendergerechten Erschließung soll hier nicht unterschlagen werden.
Darüberhinausgehend dürfte es interessant sein zu ermitteln, ob sich Archiv(ierend)e in einer demokratischen Gesellschaft positionieren sollen, bspw. gegen Rassismus oder eben #Archivistsforfuture ……
Der Hinweis eines Nutzer verweist auch auf eine Tätgkeit Fickelers als Vortragsredner im Befehlsbereich des „Kom[man]d[ierenden]. Adm[irals] Fr[ankreich] im Herbst 1940. Unterlagen des Freiburger Militärarchivs (bundesarchiv) müssten daher daraufhin überprüft werden.
Am 21. August 2020 postete das LWL-Archivamt den Henweis auf Fortbildungsveranstaltungen zum Relaunch des NRW-Archivportals, der Ende September 2020 erfolgen soll.
Steuerlich gilt ja auch Schach im Gemeinnützigkeitsrecht als Sport. Man spricht auch vom Schachsport. Eigentlich müssten daher auch die Aufsätze etc. hierzu mit in die Liste aufgenommen werden (z.B. zur XIX. Schacholympiade in Siegen 1970).
Zur Schacholympiade einschlägig sind:
Keene, R.D. / Levy, D.N.L.: Siegen Chess Olympiad, Chess Ltd., Sutton Coldfield 1970.
Präsidium der XIX. Schach-Olympiade: XIX. Schach-Olympiade, Siegen 1970.
Mario Tal: Bruderküsse und Freudentränen: Eine Kulturgeschichte der Schach-Olympiaden, Köln 2008
Tischbierek, Raj: Sternstunden des Schachs. 30x Olympia. London 1927 – Manila 1992, Sportverlag Berlin 1993.
Erlaube mir darauf hinzuweisen, daß in der Überschrift zu Opfermanns Aufsatz zwei Fehler sind: 1. Weihe starb 1980 und nicht 1960 2. Er war Landrat bis 1945 und nicht nur bis 1944. Beides ergibt sich aus dem Aufsatz selbst, das Sterbedatum auch aus anderen Quellen.
1) Vielen Dank für den Hinweis! Die Überschrift wurde entsprechend geändert.
2) Bis wann Weihe nun genau Landrat war, wird sich wohl nur durch einen Blick in die Personalkaten in Münster ermitteln lassen.
2 Ergänzungen:
“ …. Der VdA-Vorsitzende Ralf Jacob ruft alle in der Verantwortung stehenden KollegInnen in antragsberechtigten Archiven dazu auf, die gebotene Chance für ihre Einrichtungen zu nutzen. ….“ s. VdA v. 12.10.2020, Link: https://www.vda.archiv.net/aktuelles/meldung/682.html.
„…. Wichtig ist dabei, dass die Mindestantragssumme 10.000 Euro beträgt, aber „eine Unterschreitung in begründeten Ausnahmefällen insbesondere für kleinere Einrichtungen zulässig“ ist (Förderbedingungen 6.2). „Die Einbringung von Eigenmitteln in der Höhe von 10 Prozent der Gesamtprojektsumme ist erforderlich, kann [aber] auch durch eingeworbene Drittmittel erfolgen.“ (ebd., 6.4)“, s. archivamtblog, 13.10.2020, Link: https://archivamt.hypotheses.org/14553
Dem Vorspruch zu dieser Art von Veranstaltung wird jeder vernünftige Mensch gern zustimmen, aber er wird sich fragen, was das, was dann folgt, damit zu tun hat. Was hat die Bekämpfung von Populismus, Antisemitismus und Rassismus mit einer Darstellung militärischer Operationen, des militärtechnischen Instrumentariums aus militärtaktischer und -strategischer Perspektive und der Beschreibung von Frontbewegungen zu tun? Das ist der Stoff, an dem üblicherweise Militärliebhaber sich hochziehen, wie sie weit abseits von Friedens- und Antirassismusinitiativen und – bewegungen ihr seltsames Steckenpferd pflegen.
Der Vorspruch, er liest sich leider wie eine vorsorglich abgegebene Entlastungserklärung gegen den zu erwartenden Vorwurf der vergangenheitspolitischen Blindheit, des Militarismus und des falschen Heroismus.
Viel Vergnügen bei dieser Art des „geschichtlichen Lernens“ an den Standorten der Geschütze, der Route der Panzer und in Betrachtung der Orte der MG-Nester der „12. Volksgrenadierdivision“, sprich der letzten zusammengekratzten Reste des NS-Militärs.
Weil heute heute ist – ich kann da meine Herkunft nicht verleugnenen – , hätte ich den ersten Teil der Antwort ohne Ortsangabe als Lösung gelten lassen. Aber so, muss ich leider auf die korrekte Ortsangabe bestehen.
Zur Biographie des Schulgründers s.:
Bundesarchiv
R 9361-V/14469 Sammlung Berlin Document Center (BDC): Personenbezogene Unterlagen der Reichskulturkammer (RKK), Bode, Adolf, Dr.Geburtsdatum: 13.10.1915
R 73/10353 Deutsche Forschungsgemeinschaft (Aktenzeichen Bo 1/04/1), Bode, Adolf, Dr., Geburtsdatum: 13.10.1915
Enthält : Forschungsstipendium für die Zeit vom 1.12.1942 bis zum 31.3.1943 für Untersuchungen über den amerikanischen Humanismus und das deutsche Geistesleben (Das Stipendium wurde von den Professoren Wolfgang Schmidt, Englisches Seminar der Universität Bonn und Friedrich Schönemann, geb. 30.5.1886, Amerika-Abteilung des Englischen Universitätsseminars Berlin, befürwortet.), Berlin, z.Zt. Luftgaukomando III/IV Stabskompanie, Berlin-Dahlem, Philosophie.- Stipendium, 09.12.1942; Verlängerung des Forschungsstipendiums für die Zeit vom 1.4.1943 bis zum 30.11.1943 für Untersuchungen über den amerikanischen Humanismus und das deutsche Geistesleben , Bonn, 1. Sprachmittler-Abteilung d. Lw., Philosophie.- Stipendium, 30.04.1943 ….
Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein, 2. 08.1.1 (Referat Kommunikation und Steuerung), A 182, Bundesverdienstkreuze, 29.12.1982 – 04.11.1983
Ein Blick in die Ordensakte des Kreisarchivs ist leider wenig ergiebig – sowohl in Hinblick auf die Schulgeschichte (lediglich Kopien einen Ausarbeitung Alfred Lücks zum 25jährigen Bestehen der Schule) noch in Hinblick auf die Biographie des Schulgründers.
Auf Anregung des Siegerländer Heimat- und Geschichtsverein erhielt Dr. Adolf Bode 1984 das Bundesverdienstkreuz am Bande. Aufgrund der Orientierung der Schule an den Bedürfnissen der regionalen Eisen- und Hüttenindustrie wurde auch seine kulturgeschichtliche Beschäftigung, insbseondere die Studienfahrten in ehemalige nassauische Gebiete, geehrt. Auch seine berufsständischen Aktivitäten – als Gründungsmitglied Aufbau des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen e. V. im Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer seit 1955 sowie als Leiter des Referates „Berufsausbildung“ im Landesverband von 1970 bis 1976 – finden in der Ordensbegründung Erwähnung.
s. a. „Siedhoff-Buscher, Alma“ aus der Datenbank der Forschungsstelle für Biografien ehemaliger Bauhaus-Angehöriger (BeBA). URL: https://bauhaus.community/gnd/120060663 (Abrufdatum: 17.11.2020)
Ich denke gern an die Englischkurse bei Dr. Bode und seiner Frau zurück. Besonders ist mir meine erste, selbst verdiente Gruppenreise 1963 mit ihnen nach London in Erinnerung geblieben. Es war eine gut organisierte, mit vielen Besichtigungen verbundene Studienfahrt. Der Besuch bei den Ford-Werken in London Dagenham mit damals 55.000 Mitarbeitern bleibt unvergesslich. Alle Teile der Fahrzeuge (Traktoren und Pkw) wurden dort hergestellt. Das war die Zeit vor der „Just-in-time-Produktion“. Herr Dr. Bode führte uns im Britischen Museum zum Wielandkästchen und Mr. Bonner von der Bibliothek zeigte die 1150 verfasste Vita Merlini mit der Erwähnung von Siegen. Der Siegerländer Heimatverein hat 1961 aus den „Siegerland“-Blättern einen Sonderdruck herausgegeben: „Das erste Arbeitsbild zur Vorgeschichte des Siegerlandes – Anmerkungen zu einem Kunstwerk Hermann Kuhmichels von Dr. phil. Adolf Bode“. Die Broschüre ziert ein Foto des großformatigen Stickbilds mit sechs Szenen aus der Wielandsage, das im Haus der Siegerländer Wirtschaft hängt. Erstaunlich gut hat sich die Leuchtkraft der Farben erhalten. Ich bin gespannt auf den Sonderband der „Siegener Beiträge“.
Via einer privaten Facebook-Gruppe kam der Hinweis, dass in der Zeit zwischen 1978 und 1983 ca. 15 weibliche Schülerinnen und ca. 4 männliche Schüler, die Schule beuschten. Neben den Fremdsprachen wurde auch Deutsch, Stenographie und Maschineschreiben vermittelt.
Die Zahl der SchülerInnen lag, auch in dem genannten kleinen Zeitraum, tatsächlich um ein Vielfaches höher. Wahrscheinlich ist hier lediglich 1 Klasse gemeint. Der Band enthält genauere Angaben.
Ich habe in der Zeit von 1975-1978 meine Ausbildung an der Sprachenschule Siegerland (Tagesschule) gemacht. Noch heute erinnere ich mich an diese Zeit gern zurück und bin unendlich Dr. Bode und seiner Frau dankbar. Die Ausbildung verlangte viel Einsatz -aber es hat sich gelohnt. Dr. Bode und seine Frau haben uns nicht nur die Sprache gelehrt sondern vieles mehr, was ich in meinem Berufsleben anwenden konnte. Auch später hatte ich noch Kontakt zu den Beiden. Sie haben und werden immer einen besonderen Platz in meinem Leben haben.
1) Ist das aufgrund der Verlagswerbung nicht etwas vorschnell?
2) Diskussionswürdig finde ich an der Werbung allerdings auch den Satz: “ …. Dennoch findet die Bedeutung der Gemeinschaftsbewegung in historischen Arbeiten zum Siegerland während des Nationalsozialismus bisher kaum Erwähnung. ….“ An weg mag dieser Sachverhalt liegen an der regionalen Zeitgeschichtsforschung oder an der Gemeinschaftsbewegung u. a. als Archivträger?
3) Ich denke, die Arbeit hat eine ausführliche Rezension verdient.
4) Schließlich hätte ich zu diesem Zweck eine hybride Publikation der Arbeit auf dem digitalen Punblikationsserver OPUS der Universität Siegen begrüßt.
Richtig muss es Güterschuppen heißen und nicht Güterlokschuppen. Der Lokschuppen befand sich nördlich vom Bahnhof, wo heute das Einkaufszentrum befindet.
Hallo Her Wolf, ist ein Blick aus dem alten Kreishaus auf den abgerissenen Seitenflügel, vielleicht den alten Sitzungssaal oberhalb des Seiteneingangs. Habe 1977 hier meine Lehre angefangen. Im Sitzungsdienst haben wir immer viel Spaß gehabt.
Ich wäre sicher überrascht gewesen, wenn mir die belgischen Streitkräfte ein Fotoalbum geschenkt hätten. Es hätte zwar sehr schön zu einem hier vorgestellten Projekt gepasst – aber leider waren es nicht die „Belgier“.
Ebenfalls hätte ich mich über ein Album der Bewohnerinnen und Bewohner des Hauptdurchgangslager am Wellersberg gefreut – aber die Bilder stammen auch nicht von dort.
Wenn ich richtig gegoogelt habe, dann ist der heute auf dem Fischbacherberg existierende Kleingartenverein zu jung. Auch ein eventuell früherer Verein war nicht der Urheber der Bilder. Schließlich gilt auch hier: ein solches Fotoalbum hätte ich selbstverständlich dem Siegener Stadtarchiv überlassen.
@Manfred Knoche
@Sven Panthöfer
Die korrekte Schulbezeichnung lautete „Mädchen-Berufs, Berufsfach- und Fachschulen Siegerland“ – soviel Zeit muss sein. Es handelte sich tatsächlich um den Schulgarten.
@alle
Aber was wurde dort angebaut? 2 Pflanzen sind mir bekannt, bei einer bin ich mir nur ziemlich sicher.
Auf Bild eins sind Tomaten, und Rahbarbar (nicht sicher aber eine andere Gartennutzpflanze mit so großen Blättern kenne ich nicht) zu sehen.
Bild zwei sieht nach Mais aus und das andere könnten aufgehängte Weizenähren sein zum trocknen?
Bei Bild eins habe ich auch die Tomaten erkannt und gedacht, dass diese auch rechts stünden – jedoch die Blätter der rechten Pflanze sind tatsächlich recht groß.
Das zweite Bild zeigt tatsächlich im Vordergrund Mais, Weizen ist es aber nicht.
Es ist scheint aber eine Pflanze die mit Getreide verwandt oder auch ist. Weizen ist es nicht, dann gibt es noch Gerste, Hafer, Roggen. Wenn das auch nicht zutrifft weis ich es nicht was es sein sollte.
Da im Netz schon vermutet wurde, dass das erste Bild links eine Tabakpflanze zeigt, will ich ergänzen, dass das Fotoalbum nur noch Tollkische und Ricinusgewächse explizit benennt.
Ja, das stimmt schon, würde ich als Rheinländer auch so sehen. Allerdings kann es durchaus ein wenig kälter sein – im Mai in Wittgensteiner Land. Auch das Grün der Bäume kann durchaus später sprießen.
Burkhard Schneider hat Recht, und der FotoGraf des 3. Bildes stand auf oder über der Straße „An der Höh“, von wo aus man die drei Häuser vorne rechts heute noch (fast) unverändert vorfindet!
Ich vermute, dass sich hier der Heimatverein Holzhausen in seiner Einschätzung des Standortes des Gasthof Frank irrt. Man vergleiche die auf der Postkarte (im Hintergrund rechts) abgebildete Kirchturmspitze und den Kirchturm der ev. Kirche in Holzhausen-Burbach: http://geo.hlipp.de/photo/39218
M. E. hat der Ort Holzhausen-Bad Laasphe niemals eine Kirche besessen! Deshalb muß der Gasthof Frank in Burbach-Holzhausen gestanden haben.
Hmmm! Die Lösung stimmt leider nicht mit den Erschließungsangaben der vom Hochbaumt an das Kreisarchiv abgegebenen Glasnegative, die dankenswerterweise von den Kolleginnen im Stadtarchiv Kreuztal digitalisisert wurden, überein. 2 der Bilder zeigen deutlich das Kreisaltenheim.
Beim obersten Bild bin ich mir allerdings nicht sicher, ob die Angaben, die hier vorliegen nicht doch stimmen, so dass das Rätsel in eine 2. Runde geht.
Hallo!
Ich denke auch, dass es sich um das ehem. Kreisaltenheim im Tiergarten Weidenau handelt.
Wenn man das Fabrikgebäude auf Bild 1 mit den anderen beiden Fotos sowie den Belegfotos von Herrn Knoche vergleicht, finde ich sieht man das recht deutlich. Der überspitzte Giebel der rechten Fabrikhalle und auch der schmale längliche Aufsatz auf dem linken Fabrikdach sprechen dafür. Ebenso der Blickwinkel auf das Altersheim.
Demnach müsste das Foto auf der gegenüberliegenden Seite der Ferndorf geschossen worden sein(Herrenfeldstraße).
Allerdings würde mich interessieren welche Angabe das Hochbauamt denn dazu gemacht hat und freue mich auf die endgültige Auflösung.
das erste bild wurde zur optischen hervorhebung des
gebäudes bearbeitet, der tiergarten im hintergrund wurde nahezu entfernt, um so die umrisse des planvorhabens zu verdeutlichen.
Einverstanden! Meine Irritation rührte daher, dass die Aufschrift auf dem Umschlag, mit dem die Glasnegative dem Kreisarchiv übergeben wurden lediglich die Lungenheilstätte Eiserfeld-Hengsbach erwähnen. Zudem zeigen einige der Negative auch Modelle für die Lungenheilstätte.
Zur Geschichte der Heilstätte s. diverse Einträge auf siwiarchiv: http://www.siwiarchiv.de/?s=Heilst%C3%A4tte+Hengsbach&submit=Suchen
Hier ein paar Daten zum Kreisaltersheim:
Am 2.10.1951 war die Grundsteinlegung durch Landrat Büttner.
Am 30.03.1952 konnte Richtfest gefeiert werden.
Später baute man links hinter dem Gebäude ein Schwesternheim, am 31.08.1952 konnte dort Richtfest gefeiert werden.
Habe jetzt mal im Internet nach den Blättern gesucht, und bin zu dem Schluss gekommen das auf Bild 1 links weder Tabak, Tollkirsche, Rizinus noch Artischocke abgebildet ist. Tabak hat spitz zulaufende Blätter und die sind relativ glatt, die Tollkirsche hat kleinere Blätter und beim Rizinus sind die Blätter eher sternförmig, Artischocke hat sehr stark gekräuselte Blätter, zumal ich nicht glaube das diese damals schon angebaut wurden.
Meiner Meinung nach ist auf Bild 1: Tomaten, links Rhabarber und in der Mitte eventuell noch der Hanf, aber nicht genau sagbar weil es nicht so gut erkennbar ist.
Bild 2: Mais und aufgehängter Hanf
Vielen Dank für die Hartnäckigkeit! Also Rharbarber habe ich ein wenig bodennäher in Erinnerung, aber ich bin da nicht so sattelfest. Beim zweiten Bild handelt es sich um zum Trocknen aufgehängten Flachs. Dies ist wenigstens sicher, denn so lautet die Bildunterschrift im Fotoalbum.
Rhabarber wird mit wachsendem Alter hoch und es wird ein schwerer Busch draus. Wenn man Glück hat und es kommt auf die Sorte an. Das ich Hanf geschrieben habe war ein versehen, ich meinte aber Flachs.
Hilchenbach, Wilhelmsburg (Stadtmuseum/-archiv). Zur Datierung könnte
a) die Verlegung des Haupteingangs vom Hauptgebäude in den Seitenflügel
b) die Entfernung der Mauer in der Bildmitte
herangezogen werden.
Genau! Dies wären Ansätze um eine Datierung vorzunehmen. Eventuell handelt es sich ja auch bei der Person um eine mehr oder weniger bekannte Persönlichkeit, so dass man anhand deren Lebensdaten eine ungefähren Zeitraum bestimmen kann.
Na gut! Ich habe eine Postkarte von 1957 gefunden, da waren die Bäume vor der Schule noch deutlich kleiner, demnach sollte das Foto Mitte der 60er gemacht worden sein …
Doch kein Rharbarber? Via E-Mail erhielt ich folgenden Hinweis: “ ….. Die Blattform deutet auf eine Brassica-Art hin. Ich vermute Brassica oleracea var. ramosa (Baumkohl, Strauchkohl, Ewiger Kohl, Tausendköpfiger Kohl) – eine alte und früher populäre Gemüsesorte, die mit der Zeit so üppig werden kann wie das abgebildete Gewächs. Auch die Mischkultur in Nachbarschaft mit Tomaten wird aus gärtnerischer Sicht empfohlen. …..“
Ob folgender, via E-Mail eigegangene Tipp zur Datierung hilft: “ …. Für die Ausstellungs-Datierung bietet natürlich das „S“ in Form der Sig-Rune (drittes Bild) einen Anhaltspunkt. ….“
Im Universitätsarchiv Göttingen befinden sich unter der Signatur Kur. 8412 Personalakten Banfields aus seiner Lektorentätigkeit (16.10.1828-25.05.1833).
Im Landeshauptarchiv Koblenz befindet sich im Bestand Bezirksregierung Koblenz folgen Sachakte under Nr.17665 „Anlage einer Kobalt-Aufbereitungsanstalt auf der Madersbacherhütte durch Thomas Banfield in Siegen (1846-1851).
Im Bayrischen Hauptstaatsarchiv München befindet sich im Bestand „Gesandtschaft London“ unter der Nr. 515 folgender Aktenband „Banfield, Thomas, vormals Bibliothekar des Königs Max II. von Bayern, Unterstützung seiner Hinterbliebenen.“ (1856).
Das Heft ist aktuell erhältlich bei: Bücher buy Eva in Hilchenbach, Mankel Muth in Kreuztal und Weidenau, Alpha in Siegen, Weinaug in Netphen und Braun in Neunkirchen. Unter Beachtung der Corona-Schutzmaßnahmen kann es auch bei Wilfried Lerchstein in Netphen-Grissenbach im Heideweg 6 an der Haustür abgeholt werden nach vorheriger Terminvereinbarung unter 02737/209527 oder lercwi@web.de .
Mit den Bemühungen um die Gestaltungssatzung in der Wenschtsiedlung und dem Programm „Stadtumbau West“ ab 2008 rückte das Wohnumfeld der Gartenstadt in den Fokus. Im Bezirksausschuss Siegen-Geisweid wurde 2014 von der SPD-Fraktion nach dem Spielplatz: „Teich mit drei Tieren“ unterhalb des Hauses Wenschtstraße 63 gefragt, wem die Anlage gehört, wer die Figuren schuf, ob sie denkmalwürdig seien. Der Stadtverwaltung war die städtische Anlage aufgrund ihrer versteckten Lage erst seit geraumer Zeit bekannt. Der LWL zeichnete Ende Mai 2015 den Spielplatz als Denkmal des Monats aus und nannte als Künstlerin Ruth Fay (1923-2008). Zu dieser Annahme hatte möglicherweise das Beton-Nilpferd von Ruth Fay geführt, das noch von ehemals zweien beim Kindergarten am Fischbacherberg übrig geblieben ist. Im vergangenen Jahr meldete sich die Landschaftsarchitektin Jutta Curtius, Nettetal, und stellte richtig, dass die Figuren Ente – Seehund – Schwein von dem Künstler Clemens Pasch (*1910 in Sevelen am Niederrhein, †1985 in Düsseldorf) geschaffen wurden. Er hatte mit den Figuren 1960 einen Wettbewerb einer Bonner Baugesellschaft gewonnen. Das Bonner Ensemble existiert nicht mehr, das in Dortmund ist erhalten geblieben.
Die Renovierung des Dr.-Dudziak-Parks wurde Ende vergangenen Jahres abgeschlossen.
Conze, Eckart/Frei, Norbert/Hayes, Peter/Zimmermann, Moshe: Das Amt und die Vergangenheit. Deutsche Dipomaten im Dritten Reich und in der Bundesrepublik, München 2010, S. 19, 234, 316, 356f, 360, 412, 474f, 576, 578, 612f. 654, 663, 671, 681, 683ff., 690
Gratulation! Die Antwort ist korrekt:
Das Relief wurde im Zusammenhang mit dem Nachlass Flosdorf übernommen. Unklar ist noch, in welchem Zusammenhang es entstanden ist (z.B. Siegerlandschau?)
War heute etwas zu spät auf dieses Rätsel gestossen.
Ich habe dieses Relief im Hause vom Herrn Flosdorf gezeigt bekommen, ich durfte 2 x dort mit ihm ein Interview führen. In seinem Wohnzimmer, in dem ein Flügel und eine riesengrosse Bücherwand stand, unterhielten wir uns über seine Tätigkeit und über das Leben in Siegen zu der Zeit.
Ebenso vom Balkon seines Bungalows durfte ich ins Tal hinunter Aufnahmen machen, eine Position für Fotografen, die von sowas träumen. Ohnehin ist die Steinstraße sehr gut für Fotoaufnahmen geeignet.
Habe ein Bild (Landschaft – tanzende Mädchen im Wald) ) gemalt von
Willi Schütz, in der Gefangenschaft 1952. Das Bild hat noch den einfachen Rahmen aus der Gefangenschaft.
Mein Vater (Hubert Henke), ein Freund und Mitgefangener im Lager Workuta brachte es 1955 bei seiner Heimkehr mit.
Mein Vater war zum Tode verurteilt und zu 25 Jahren begnadigt worden.
Das letzte mal wo sich die beiden trafen, nach meiner Erinnerung, war eine Ausstellung im Sauerland-Museum in Arnsberg.
1.7.1919 endgültig im Volksschuldienst angestellt, Brungerhausen (?)
Gebürtig was Warzenbach, hat die Tochter des Hegemeister Schenk geheiratet. In dessen Haus hat der eine zeitlang in Bungershausen gewohnt.
War bei den Warzenbächern, ich sage es mal so; Ach nicht gerade beliebt.
Ein Zufallsfund:
Alfred Fissmer, Standbild aus dem Film „Siegen wird Garnisonstadr. Einzug der Soldaten am 16.10.1935“ des Fotostudios H. Schmeck (KrA SIWI 4.1.5./104)
Darf ich Sie höflich darauf hinweisen, dass ich einen Nachruf auf Herrn
Professor Dr. Dr. h.c. mult. verfasst habe:
1. ,,Ein lauterer Geisteswissenschaftler mit weitem Horizont. Zum Tode von Artur Woll, eines geistig-politisch unabhängigen und unbestechlichen Gelehrten.“ Fakultät III der Universität Siegen;
2. Eine aufrechte Autorität mit weitem Horizont. Zum Tode von Artur Woll,
einem Meister wirtschafts- und sozialwissenschaftlichwr Analytik. In:
Querschnitt. Die Zeitung der Universität Siegen, Nr. 1/2020.
Freundlich grüßt Sie, sehr geehrte Damen und Herren, Bodo Gemper.
s. a. Gerhard Kötter, „Alfred Fissmer – Bürgermeister der Stadt Siegen von 1919 bis 1945 ….. Mitläufer … Mitwisser … Verwalter“, Link: https://gerhard-koetter.de/?p=18846 (Aufruf: 19.1.2021)
s. dazu auch Klaus Graf „Schließung der wissenschaftlichen Bibliotheken in Bayern vermutlich unverhältnismäßig“, Archivalia, 19.1.2021, Link: https://archivalia.hypotheses.org/129061 (Aufruf 20.1.2021)
In die Trägerschaft dieser coronabedingt leider notleidenden Veranstaltung sollten m. E. mindestens die Vereinigung der Verfolgten des NS-Regimes (VVN-BdA) und das Aktive Museum Südwestfalen (AMS) mit einbezogen sein, um die Reichweite und damit die öffentliche Aufmerksamkeit zu erhöhen. Es geht doch immer auch darum, durch Zusammenarbeit eine Wirksamkeit zu verbessern.
2011 erstellte das Kreisarchiv eine Materialsammlung zu Otto Marloh, die als PDF für die weitere biographische Forschung hier zur Verfügung gestellt wird
Interessant aus der Sicht eines NRW-Kreisarchivs ist das Gefälligkeitsgutachten zum Eigentum am Archivgut der preußischen Landratsämter. Denn es besteht ein grundsätzliches Interesse der inzwischen fast vollständig fachlich besetzten Kreisarchive an den Landratsamtsbeständen; dafür liegen allerdings keine rechtlichen Gründe vor, sondern die Kreisarchive verstehen sich hier vornehmlich als Sprachrohr ihrer Nutzenden. Wenn man 150km und mehr zum zuständigen Landesarchivs fahren muss, fördert dies nicht eine von allen gewünschte citizen science. Insofern hätte ich mir einen Beitrag zur Digitalisierungstrategie des Landesarchivs NRW für die preußischen Landratsamtsbestände gewünscht und für sinnvoller gehalten.
Allerdings einen juristischen Streitpunkt umgeht der Text aber beinahe charmant: “ …. Daneben hatte auch der Kreisausschuss Aufgaben der allgemeinen Landesverwaltung wahrzunehmen (§ 75 KreisO). Deswegen bestand und besteht staatliches Eigentum möglicherweise auch an den Akten der Kreisausschussregistratur. Darüber gibt es zurzeit aber keinen Streit, und dieser Punkt ist für die hier interessierende Fragestellung ohne Belang. ….“ (S. 310) Eben dies ist aus Kreisarchivsicht sehr wohl strittig und hätte daher ausführlich behandelt werden sollen!
Das Stadtarchiv Siegen, wo man die Broschüre sonst immer abholen konnte, ist ja z.Z. geschlossen. Falls das KrönchenCenter-Gebäude selbst zugänglich sein sollte, könnte man ja nach vorheriger Terminabsprache einen Abholtermin an der Eingangstür zum Stadtarchiv vereinbaren, ähnlich wie dies derzeit viele geschlossene Ladengeschäfte auch organisiert haben.
In der heutigen (!) Print-Ausgabe der Siegener Zeitung erschienen unterder Rubrik „Heimatland“ zwei Artikel Herbert Bäumers zu Alfred Fissmer. Während sich der Artikel „Der visionäre Bürgermeister“ der Urheberschaft Fissmers an der Idee eines Siegbergtunnels widmet, stellt der Artikel „Betonbauten gegen Bomben“ die Geschichte des Bunkerbaus in Siegen, Weidenau, Klafeld und Kaan-Marienborn dar. Ein weiterer Artkel zu r Bautechnik undAusstattung der Bunker ist angekündigt.
Vielleicht auch in diesem Forum: Schön, dass Ihnen der Artikel aufgefallen ist. Er ist Ergebnis einer mehr als halbjährigen Recherche in den Archiven. Außerordentlich hilfreich war die Online-Verfügbarkeit der meisten Jahrgänge des Kreisblatts bis Mitte 1933. Dazu standen mir etliche Beilagen der Wittgensteiner Zeitung bis 1944 zur Verfügung. Wenn auch die Pandemie die Einsichtnahme des Wittgensteiner Kreisblatts von 1939 bis 1945 bisher verhindert hat, so konnten doch inzwischen 152 Gedichte von Claudy gefunden werden. Daher wird im Frühjahr ein Gedichtband mit Anmerkungen zum Leben der Dichterin herausgegeben werden.
Ein bemerkenswerter Schritt nach vorne, der leider sehr lange auf sich hat warten lassen, nun aber wirklich mehr als ein kleiner Start ist. Besonders als nicht im Siegerland wohnender Historiker freue ich mich nun über den erleichterten Zugriff auf Archivalien und Drucksachen. Einen großen Dank an alle Beteiligten im Stadtarchiv Siegen! Ich bin schon sehr gespannt, wie es in den kommenden Jahren mit dem Ausbau des digitalen Angebotes weitergehen wird.
Adolf Wurmbach (1891-1968) hat intensiv an die Juden in Krombach und Littfeld erinnert. In seinem Elternhaus hatten sie zeitweise einen Betraum. In dem folgenden Gedicht „Schatten“ erinnert er an seinen Freund Raphael Meyer. Das Gedicht „Israelischer Waldfriedhof in Burgholdinghausen“ hatte verschiedene Versionen, die folgende ist meines Erachten die eindringlichste.
Schatten
Durch unser Dorf
Gehen die Schatten
Aus drei Judenhäusern.
Sie gehen mit gebundenen Händen
Und einem leuchtenden Stern
Auf der Brust.
Eine Rauchwolke
Schleppt ihnen nach,
Und Asche in der Luft.
Manchmal begegnen sie mir
In meinen Träumen
Einer von ihnen
War mein Freund,
Er hieß Raphael.
Durch unser Dorf
Gehen die Schatten
Aus drei Judenhäusern
Schatten –
Schatten –
Schuld.
Israelischer Waldfriedhof in Burgholdinghausen
Gräbermale
In Waldesdunkel.
Hebräerspruch:
Levi und Sara Meier.
Sie warten. –
Warten:
Wo bleiben unsere Kinder,
Die Enkel?
Wo?
Der Wind weiß es,
Der von Osten kommt,
Von Sobibor
Und Treblinka.
Und Gott
Weiß es.
In der kommenden Sitzung des Kulturausschusses der Stadt Siegen am 23.2.2021 soll folgender Tagesordnungspunkt verhandelt werden: „Informationstafel zur Beschilderung der Alfred-Fissmer-Anlage“- Der von der Verwaltung vorgeschlagene Beschlussvorschlag empfiehlt die Annahme dieses Hinweistextes.
Warum greift die Volt-Fraktion das Thema jetzt auf, obwohl bekannt ist, dass sich ein neuer Arbeitskreis mit den Straßennamen nach belasteten Persönlichkeiten befassen wird. Es geht nicht nur um Irle! Ganz besonders geht es auch um Adolf Stoecker. Da hat sich trotz wiederholter Versuche leider nichts getan. Bei Walter Krämer hat es von 1947 bis 2015 gedauert bis ein Platz nach ihm benannt wurde.
2008/2009 hat sich ein AK schon einmal intensiv mit der „Aufarbeitung der historischen Hintergründe von Straßennamen in Siegen“ befasst. Leider ohne sichtbares Ergebnis.
Neben den drei im Antrag genannten Straßennamen, die Frauen gewidmet wurden, habe ich weitere zwölf entdeckt. Der Barbaraweg ist nach der Schutzheiligen der Bergleute benannt. Sie ist aber auch gleichzeitig die Schutzgöttin der Artillerie. Der Weg erhielt den Namen im Zuge des Kasernenbaus 1936/37! Muss er jetzt umbenannt werden?
In der Tat geht es nicht nur um Irle, es ghet um den „Bergfrieder“, um Stoecker, Ernst Bach, Otto Krasa, natürlich auch Hindenburg und andere Straßennamen. Movens für den Antrag zu Irle waren zwei Dinge: 1. der „Arbeitskreis Straßennamen“ ist sicher der richtige Weg, um sich intensiv mit belasteten namenspaten zu beschäftigen, bei denen Verstrickungen noch nicht hinreichend erforscht sind und es (siehe Fissmer) Für und Wider gibt. Im Fall „Irle“ ist aber alles so klar, dass man den noch nicht einberufenen Arbeitskreis nicht unnötig mit einem zusätzlichen Fall belasten muss.Für diese Ehrung spricht nun tatsächlich rein gar nichts. 2. Der Antrag greift einen Bürgerantrag aus dem letzten Sommer aus (der bis heute (!) noch nicht im Haupt- und Finanzausschus diskutiert wurde), der die mangelnde Sichtbarkeit von Frauen im Siegener Stadtbild thematisiert. Dies bezogen auf Denkmäler, Straßennamen und Weiteres. mit Therese Giehse als Namenspatin wird also auch dieser wichtige Aspekt aufgegriffen.
Für Volt als antragstellende Fraktion kann ich sagen: in unseren Augen spricht nichts gegen eine schnelle Umbenennung gerade der Lothar-Irle-Straße. Demokratische Meriten hat Irle sich nicht erworben, bis zu seinem Tod sind schriftliche Äußerungen seinerseits nachweisbar, die ihn als unbelehrbaren Faschisten und Nationalsozialisten zeigen – ich bin jedenfalls sehr auf die potentiellen Argumente gegen eine Umbenennung gespannt.
Christiane Luke veröffentlichte in ihrer Artikelserie „Siegener Theatergeschichte“ am 2. und 3. April 2004 zwei Berichte in der Westfälischen Rundschau zum Engagement Therese Giehse in Siegen. Giehse kam als Ensemblemitglied des Westfälischen Landestheaters nach Siegen. Sie wirkte von Herbst 1920 bis Frühjahr 1921 an Aufführungen von 21 Theaterstücken mit.
Die Recherchen Lukes fussen u. a. dem Buch Monika Sperrs „Ich habe nichts zum Sagen (Berlin 1977) über Therese Giehse sowie auf Recherchen des Siegeners Stadtarchivs für das Deutsche Theatermuseum München.
„Das Werk Ludwig Balds hat eine herausragende Bedeutung, da es erstmals eine zusammenhängende territorialpolitische Entwicklung des Siegerlandes darstellte.“
Diesem Satz in dem Wikipedia Eintrag zu Ludwig bald kann ich zustimmen, den übrigen Text des Eintrags halt ich aber für unvollständig, sehr fraglich und zum Teil für Geschichtsklitterung!
Der Zweite Weltkrieg brach nicht so einfach aus, sondern war von langer Hand geplant und er begann auch nicht mit einem Feldzug gegen Polen sondern mit einem Überfall, der schon alle Grausamkeiten des folgenden Vernichtungskrieges zeigte.
Mit der Biographie von Ludwig Bald wird im Artikel sehr naiv umgegangen.
Ludwig Bald trat am 1.5.1933 der NSDAP bei. Er erhielt die Mitgliedsnummer 2265220. Er hat sich noch sehr beeilt Mitglied zu werden, bevor die Partei eine Aufnahmesperre erließ. Den Antrag dürfte er schon vorher gestellt haben.
Drei Monate später, am 1.7.1933 trat er dem NSLB bei. In der NSV war er ab dem 1.10.1933 Mitglied. Am 1.9.1934 trat er den beiden NS „Blut und Boden“
Organisationen VDA ( Verein für Deutschtum im Ausland) und BDO ( Bund Deutscher Osten) bei. Diese Mitgliedschaften dürften wohl deutlich zeigen wo Ludwig Bald politisch zu verorten war.
Diese Angaben sind sehr einfach durch eine Anfrage an das Bundesarchiv zu bekommen.
Quelle: NSDAP-Zentralkartei | BArch R 9361-VIII KARTEI / 610020
Es wäre schön, wenn der Wikipedia Artikel entsprechend ergänzt würde.
„…. Bereits 1932 hatte Fissmer angeregt, die Fürst-Bülow-Strasse umzubenennen. Anlass dieses Vorstosses waren die 1930 posthum erschienen Erinnerungen des ehemaligen Reichskanzlers Bernhard von Bülow, die sich kritisch mit der Staatsführung Kaiser Wilhelm II. auseinander setzten und im nationalen Lager für Entrüstung sorgten. …..“
Ab dem 31. März 1933 hieß die Straße dann Leo-Schlageter-Str. Fissmer nutzte die neue Machtkonstellation, um die Umbennung durchzusetzen und um die Verwaltung in einem guten Licht gegenüber den Nationalsozialisten erscheinen zu lassen. (Quelle: Christian Bald/Christian Franke/Marc Neumann: Feiern, Denkmäler und Strassennamen -Symbolische Politik im Siegerland in der Zeit des Nationalsozialismus, in: Armin Flender/Sebastian.Schmidt: Der Nationalsozialismus im Siegerland. Ein Quellenband zur Regionalgrschichte, Siegen 2000, S.40)
Auszug aus dem Regionalen Personenlexikon (Quellenhinweise Punkt für Punkt dort):
„ohne engere Parteibindung stets an der Seite des völkisch-nationalistischen Lagers (Selbstbezeichnung: „vaterländisches Lager“) von DNVP, NSDAP, Kriegervereinen, Antisemitischem Schutz- und Trutzbund (Selbstbezeichnung: „Siegerländer Hakenkreuzer“), Bismarckjugend usw., daher wiederholt Konflikte mit Oberbehörden wegen städtischer Toleranz für antirepublikanische Aktivitäten (so 1924 wegen Unterstützung der zunächst als verfassungsfeindlich verbotenen Großveranstaltung „Deutscher Tag“ mit führenden Beiträgen aus der verbotenen NSDAP), nie an der Seite von DDP, SPD, KPD oder des Zentrums in deren Kampf gegen die vereinte Rechte, daher deren gemeinsamer Protest gegen parteiliche und verfassungsfeindliche Politik und Praktiken des OB (1927), schon vor 1933 verbotswidrige Beschäftigung von stadtbekannten Vertretern der äußersten Völkischen im städtischen öffentlichen Dienst (z. B. Wilhelm Langenbach, Deutschvölkische Freiheitsbewegung, Albert Link, NSDAP, Theo Steinbrück, NSDAP) und zugleich Entlassung Linker (Willi Kollmann 1932 nach dessen Wechsel von der SPD zur KPD)“
Fissmer verstand sich immer als als völkischer Kämpfer innerhalb der als „Vaterländische Verbände firmierenden Zusammenschlüsse rechtsaußen, zu denen seit ihrer Gründung die NS-Organisationen als integrierter Teil gehörten. Im nachhinein zu versuchen, weltanschauliche Abgrenzungen vorzunehmen, ist müßig. In ihrem Weltbild, zu dem als feste Komponente ihr Antisemitismus und ihre „weiße“ Überheblichkeit gehörten, unterschieden sie sich nicht. So belegt es auch dieses neue Detail. Fissmer biederte sich nicht „den Nazis“ an und war dann dort ein Fremder. Er wurde mit seiner Entscheidung, der Nazipartei beizutreten, deren eingeschriebenes Mitglied und verwies auf diese Entscheidung und diese Eigenschaft jedesmal , wenn er sich mit seinem Parteiabzeichen und/oder mit dem Deutschen Gruß der Öffentlichkeit präsentierte. Er drängte ja darauf, mit dazu gehören zu dürfen. Das machte nicht jeder.
Ich bedanke mich ebenfalls für die Recherche und den Kommentar! Wenngleich ich Ihnen mit Ihrer Wertung nicht in allen Punkten zustimme:
Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass mir sämtliche Ergebnisse des Bundesarchiv, die man Ihnen bezüglich Ludwig Bald mitteilte, mir bisher vorenthalten wurden. Meine Anfrage habe ich bereits am 6. März 2020 beim Bundesarchiv in Berlin und Militärarchiv in Freiburg gestellt. Aus Berlin erhielt ich – nach zehn Monaten- aus der Personenkartei der Deutschen Dienstelle (WASt) am 20. Januar 2021 lediglich drei Verwendungsauskünfte: 1939: 3. Kompanie Infanterie-Regiment 346 (B563/79525), 1942: Stamm-Lager /Kriegsgefangenenlager I A, Stablack (B563/49656) und 1943: Stab Landesschützen-Bataillon 211 (B563/10018). Keinerlei Hinweise auf eine NS-Belastung. Damit waren die Recherchen des BA abgeschlossen. Ebenso wie bei Ihnen, jedoch mit anderem Ergebnis, das Ihnen ebenfalls neu sein dürfte. Nachdem ich heute Ihren Kommentar gelesen habe, habe ich die NS-Belastung von Ludwig Bald in dem kritisierten Artikel nachgetragen. So viel zum Vorwurf der Klitterung.
Zur Diskussion dieses Artikel auf der Facebook-Seite der Siegener Zeitung:
Soll Lothar Irle Namensgeber einer Siegener Straße bleiben? Mit dieser Frage soll sich ein Arbeitskreis beschäftigen. /mtGepostet von Siegener Zeitung am Dienstag, 23. Februar 2021
Soeben (23.2.2021) hat der Siegener Kulturausschuss mit den Stimmen von CDU und SPD den Text einer Acryltafel über Alfred Fissmer beschlossen. Einen Kurztext für die Tafel und einen für eine im Netz abrufbare Langfassung. Höchst bedauerlich, dass damit auch eine Reihe von Ungenauigkeiten und Fehlern mit beschlossen wurden, über die man vermutlich noch diskutieren wird. Über die Fehler gesprochen hat dagegen heute niemand. Ein zaghafter Versuch, im Arbeitskreis Straßennamen nochmals über die Texte zu sprechen, scheiterte am unerschütterlichen Glauben von CDU und SPD. Grüne, Volt und Linke stimmten gegen den Entwurf.
Fun Fact: Der Bürgerantrag aus dem Jahr 2018 ist nach wie vor nicht beschieden. Nachdem der Hauptausschuss die Thematik mit Hinweis auf Forschungen und eine Ausstellung eines Seminars der Uni hintangestellt hat, entschied der Rat in 2020:
Beschluss:
1. Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt, eine Informationstafel zu Alfred Fissmer analog bisheriger Hinweise (Acrylausführung) anzubringen.
2. Form und Inhalt der Informationstafel werden dem Fachausschuss vorher zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.
3. Darüber hinaus werden auf der Website https://unser-siegen.com weitergehende Informationen zur Verfügung gestellt. 4. Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt die Wiedereinsetzung eines Arbeitskreises, der sich mit den kritischen Namensgebungen von Straßen, Orten und Plätzen in unserer Stadt befasst und Leitlinien für eine Erinnerungskultur entwickelt und ggfs. Empfehlungen zu neuen Namensgebungen oder Informationstafeln zur kritischen Würdigung der Personen vorschlägt. Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 3 Enthaltungen
Zum Bürgerantrag kein Wort, auch wenn bis heute immer wieder suggeriert wird, die Fißmeranlage werde weiter durch Ratsentscheid Fißmeranlage heißen.
Fun Fact 2: Der Rat entschied in den sechziger Jahren, die Anlage Fißmer-Anlage zu benennen, obwohl der Oberbürgermeister Fissmer mit Doppel-s hieß.
Und hier der beschlossene Text in Kurz- und Langfassung zur geflissentlichen Betrachtung, verbunden mit dem Hinweis, dass man angesichts der Forschungslage Einzelheiten je nach Position begründet sehr unterschiedlich betrachten kann:
Alfred Fissmer (1878-1966) war von 1919 bis 1945 Bürgermeister und Oberbürgermeister der Stadt Siegen. In seiner Amtszeit machte er sich durch die nachhaltige Förderung Siegens verdient, darunter weitsichtige Maßnahmen zu Stadtplanung, Infrastruktur und Bauwesen sowie eine vorbildliche Finanzpolitik. Auf Initiative Fissmers wurde Siegen durch die Ansiedlung mehrerer Kasernen zum Militärstandort. Auch betrieb er ein umfangreiches Luftschutzprogramm zum Schutz der Zivilbevölkerung. In der NS-Zeit war Fissmer Mitglied verschiedener NS-Organisationen und trat 1937 in die NSDAP ein, ohne als bekennender Nationalsozialist aufzutreten. Gleichwohl setzte er sich für Verfolgte des NS-Regimes ein. Er arrangierte sich mit den Machthabern, wohl um sein Amt zu erhalten, und war somit als Oberbürgermeister für die Vorgänge in Siegen mitverantwortlich. Nach dem Zweiten Weltkrieg trat Fissmer in die neu gegründete CDU ein und blieb im öffentlichen Leben präsent. 1953 wurde er zum Ehrenbürger der Stadt Siegen ernannt und erhielt das Bundesverdienstkreuz verliehen.
In der heutigen Print-Ausgabe der Siegener Zeitung erschien der Artikel „Kurzinfo als Klitterung kritisiert“ zur Disussion im städtischen Kulturausschuss zur Fissmer-Anlage.
Der 4.Herr von links, ist mein Vater, Siegfried Förster, Bürgermeister von Siegen im Jahre 1974 bis 1978. Oberbürgermeister war Friedemann Kessler und Stellv. war Herr Ostholthoff.
Sehr geehrter Herr Wolf,
ich mache höflichst darauf aufmerksam, dass der Obersteiger Röhrig sicherlich künstlerisch hochbegabt, aber kein Kunstmaler war, sondern ein Kunstmeister. Ich bitte, den Eintrag entsprechend zu ändern. Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Andreas Bingener
Schriftleiter
Das Herausgreifen und Deuten einzelner Aspekte finde ich wirklich gelungen. Auch das Hervorheben fehlender Belege, die die Einordnung von Fißmer somit schwer machen.
Herr Hellwig hat sicherlich Recht, wenn er sagt, dass zu wenig diskutiert wurde, bevor man die Tafeltexte verfasst hat. Danke für den Gastbeitrag.
Geradezu typisch für den Umgang mit einem lokalen Protagonisten des NS Regimes, da fehlt eigentlich nur noch die Behauptung, Fissmer habe im März 1945 Hitlers Nero-Befehl in Siegen verhindert. Sein damaliges Amtshandeln und die an Gesetze und Verordnungen gebundene Aufgabenerfüllung wird herangezogen, um ihn als Person zu erhöhen und sein Handeln zu rechtfertigen. Eine typische Vorgehensweise in der frühen Nachkriegsgesellschaft, die in ihren Reihen immer „Helden“ suchte, um Identifikationsfiguren für die Vorstellung zu finden: es war damals doch nicht alles so schlimm. Offensichtlich ist man in Siegen auf diesem Stand stehen geblieben.
Ein Dankeschön an die treffende Bewertung durch den Kenner der Materie, den seit vielen Jahren zum Thema NS forschenden und publizierenden Hagener Zeitgeschichtler Ralf Blank, Mitglied der Historischen Kommission für Westfalen.
Es genügt nun einmal nicht, in linearer Fortführung die Mythen der 1950er Jahre immer wieder neu aufzuwärmen, um zu einem angemessenen Urteil über diesen Fissmer kommen zu können.
Um das noch wieder am Beispiel zu erläutern:
Raimund Hellwig bezieht sich in seinem Beitrag weiter oben auf den von CDU-SPD-AfD konsentierten Satz aus dem bekannten Fissmer-Narrativ: „Auch betrieb er [Fissmer] ein umfangreiches Luftschutzprogramm zum Schutz der Zivilbevölkerung.“
Es ist ein Kernsatz bei der Heraushebung als große Siegener Persönlichkeit, eine wesentliche Komponente der nun inzwischen über drei Generationen anhaltenden Verehrung. Die resultiert einzig aus der Überhöhung einiger Persönlichkeitsmerkmale dieses OB und kümmert sich um sonst nichts. Sie weiß ja alles schon von den primären, sekundären und inzwischen tertiären „Zeitzeugen“.
Nicht einmal wurde dabei auf die einzige umfangreichere Schrift verwiesen, die dazu angeführt werden könnte, die Arbeit von Joachim Stahl, Bunker und Stollen für den Luftschutz im Raum Siegen, Kreuztal 1980. Auch sie sieht den OB nicht anders, aber sie wagt schon einmal einen Blick über die Ränder des Gebirgskessels: Zwar – in der Zustimmung ganz der Sichtweise der Weimarer Rechten nach dem WK I wie auch ihrer Nachfolger nach dem WK II folgend – sieht sie den Krieg als berechtigten Revisionsversuch von Versailles, damit aber das Bunkerbauprogramm als eine Konsequenz aus der Gewissheit eines künftigen Kriegs. Das war nun keineswegs ein genialer Einfall von Fissmer, sondern eine Überzeugung überall im Reich. Die politische Linke warnte „Hitler bedeutet Krieg“, und die politische Rechte hoffte „denen zeigen wir es noch.“ Die zutreffende Schlussfolgerung von Raimund Hellwig: „Tatsache ist, dass das Deutsche Reich bereits vor der Machtübergabe das Thema Luftschutz pflegte.“
Das heißt:
Am 10. Oktober 1940 erging ein „Führerbefehl“ zu einem reichsweiten Bunkerbauprogramm, das örtlich von den Oberbürgermeistern umzusetzen war, was dann ab 1941 geschah. Dem waren an vielen Orten bereits lokale und wohl meist private oder kommunale kleinere Initiativen vorausgegangen, Schutzräume zu schaffen, was im Siegerland durch die allenthalben vorhandenen und inzwischen nicht mehr genutzten Stollen leicht möglich war. Dergleichen war weder dort noch in anderen Regionen ein großes Verdienst der Bürgermeister, sondern eine Reaktion auf die von oben betriebene Kriegsvorbereitung und eine Reaktion von unten auf diese Bestrebungen, während das eigentliche Programm, das Großprogramm, der Kriegsführung, der Sicherung der Ruhe an der Heimatfront und dem künftigen Durchhalten galten. Ebenfalls definitiv keine Initiative der Bürgermeister. Wären hier Bauherren zu nennen, wären es Adolf Hitler, Hermann Göring und die Kriegsführungsexperten um sie herum.
Das Großprogramm, in das die Bürgermeister einzusteigen hatten, stand vor zwei Schwierigkeiten: Es fehlten Arbeitskräfte, und es fehlten freie Grundstücke. Im Siegerland kamen die Arbeitskräfte für 12-Stunden-Schichten wie andernorts auch in hohen Anteilen aus den lokalen Ausländerlagern, und Grundstücke wurden ab 1941 vermehrt durch die Verfolgung und Vernichtung der jüdischen Minderheit frei, so auch in Siegen, wenn man mal an das Synagogengrundstück denkt.
Lokal wurde das Thema natürlich propagandistisch als Volksschutzprogramm dargeboten. Es ermöglichte vor Ort den NS-Bürgermeistern eine positive Selbstdarstellung: „Dem Oberbürgermeister als Sprecher der Bevölkerung“ übermittelten im November 1943 die NSDAP-Ortsgruppenleiter ihre Dankbarkeit für „seinen“ Bunkerbau. Mit der Bevölkerung, von der so nach 1945 die Rede war, war zuvor allerdings immer das „Volk“ in der völkischen Version gemeint gewesen. Anders als in anderen Staaten, in denen ebenfalls Bunker gebaut wurden, wurden im NS-Reich die Zugangsberechtigungen nach rassistischen Kriterien vergeben, also auf „Biodeutsche“ begrenzt. Sie bildeten die „Zivilbevölkerung“, die der OB erfolgreich geschützt habe, wie es über den Rassismus hinweggehend dann in späteren Jahren hieß.
Der Ort, an dem die oben zitierten Ortsgruppenleiter dem Oberbürgermeister ihren Dank aussprachen, der im Reich nach lokaler Einschätzung in unseren Jahren eine Spitzenposition beim Bunkerbau gehabt habe, weshalb es nur vergleichsweise wenige Luftkriegsopfer aus der „Zivilbevölkerung“ gegeben habe, war Mannheim (Jörg Schadt/Michael Caroli, Mannheim im Zweiten Weltkrieg, Mannheim 1993, S. 33f.), und der OB ein Carl/Karl Renninger (Fred L. Sepaintner, Badische Biographien, Stuttgart 2011, S. 326). Siegen und Mannheim werden nicht die einzigen Orte in Westdeutschland gewesen sein, deren Oberbürgermeister in dieser Weise und überall gleich unzutreffend gerühmt wurden.
Es liegt hier kein Anlass, Fissmer in irgendeiner Weise eine Medaille anzuheften und damit die Volksschutzpropaganda der Nazis weiter hochzuhalten.
@alle: Vielen Dank für die bisherigen Diskussionsbeiträge!
2 Anmerkungen:
1) Ein Kardinalproblem der Tafeltexte ist das Fehlen eines Quellen- und Literaturverzeichnisses. Nur damit kann eine stetige Auseinandersetzung mit Fissmer gewährleistet werden – wenn man dies durch die Beibehaltung des Namens so will.
2) Auch hier ein ceterum censeo: Mir wäre etwas mehr Geduld bei der Erforschung von Fissmers Biographie sehr lieb gewesen. Eine Recherche im Archivportal NRW lässt u. a. folgenden Fund zu: Im Stadtarchiv Siegen befindet sich folgender Aktenband Säuberung der Museen von „entarteter Kunst“ (Signatur Best. D / Stadtverwaltung Siegen, 1919-1945, Nr. Nr. 1253,
Laufzeit: 1937 – 1939) er enthält u. a. ein „Schreiben von OB Fissmer an Kruse betr. „entartete Kunst“ (!)“. In Anbetracht der auch noch nicht endgültig erforschten Rolle Fissmers bei der Evakuierung rheinischer Kunstschätze in den Hainer Stollen – hierauf wurde hier an anderer Stelle bereits verwiesen – zeigt dieser Hinweis, dass es sehr lohnenswert gewesen wäre, sich intensiver mit F. auseinander zu setzen, bevor man eine Tafel „durchpeitscht“..Übrigens: ein Quellenverzeichnis hätte diesen Punkt des Kommentars eventuell überflüssig gemacht.
Ein kurzer Nachtrag vielleicht noch zu den Feststellungen Raimund Hellwigs zu dem Übergang des Wohneigentums der jüdischen Familie Eduard Herrmann in „arische“ deutsche Hände nach der Vertreibung der Herrmanns:
Die Villa ging an den Standortkommandanten, den Berufsoffizier Karl Adolf Hollidt.
Zu Hollidt wäre zu sagen, dass er als vormaliger antidemokratischer Freikorpsoffizier, der in die Weimarer Reichswehr wechseln konnte, um anschließend in die NS-Wehrmacht einzutreten, für ein rechtes, ein völkisches Milieu steht, das im Siegerland den Ton angab und dessen Seilschaften Gesellschaft und Politik beherrschten. So nimmt es auch nicht Wunder, dass Hollidt 1948 im OKW-Prozess in Nürnberg wegen Kriegs- und Menschheitsverbrechen (konkret: wegen verbotwidriger Verwendung von Kriegsgefangenen und Verschleppung und Versklavung von Angehörigen der sowjetischen Zivilbevölkerung) verurteilt wurde.
Im Siegerland machte das nach Hollidts baldiger Amnestierung (im Zuge der Vorbereitung der westdeutschen Remilitarisierung) nicht viel. Bald war er Vorsitzender des Verbands der Heimkehrer, ein Presbyter seiner Glaubensgemeinschaft und hochgeachteter Gesellschaftsvertreter. Wie Fissmer. Das alte Milieu hatte sich vom Schock erholt, vitalisierte und rekonstruierte sich. Wiederaufbau. In diesen Kontext ordnet sich auch die bis heute lebendig gebliebene Mythenbildung zum vormaligen OB ein.
Heute findet sich in der Siegener Zeitung (Print) der Leserbrief „Straßennamen prüfen“, der die Verharmlosung Irles durch obigen Leserbrief benennt, darauf hinweist, dass der Leserbriefschreiber bei der Kommunalwahl 2020 für die AfD kandidierte und ein gewissenhaftes Untersuchen der Straßenamen forderte, an deren Ende eine Umbenennung oder eine erklärende Erweiterung des Straßennamenschildes stehen sollte.
Denkmal-Gruftenweg :
Für sächliche Forschungsarbeiten (WK1-Marinekorps Flandern/Seewehr-Batterie Augusta) möche ich vernehmen of die Nahme Hugo Kuylen (Lt.d.R Matrosenregiment-1) vermeldet is aud das Denkmal. Vielen Dank im Voraus, Paul (bcknokke@telenet.be)
In der Siegener Zeitung findet sich in der Print-Ausgabe vom 5. März 2021 der Leserbiref „Ignorieren hilft nicht“ ein Leserbrief von Marie-Luise Schwartz, Pine Ridge Reservation, South Dakota. Schwartz lebte von 2000 bis 2008 während ihres Lehramtsstudiums in der Lothar-Irle-Str. Sie schreibt u. a.: „…. Viel wichtiger ist dieTatsache, dass diese Art Umbenennungen und „cancel culture“ die Vergangenheit weder ändern noch auslöschen können, Sie sind meiner Meinung nach kein konstruktiver Umgang mit Geschichte. …. Es kostet Ehrlichkeit, Mut, Demut und Vergebung, sich seinen eigenen Fehlern als auch den Fehltritten ganzer Nationen zu stellen.“
Ich habe da viele Fragen:
1) Ist der Briefschreiberin der Werdegang Irles und dessen Gedankenwelt vor, während und nach (!) dem 2. Weltkrieg bekannt? Ich werde den Eindruck nicht los, dass auch hier die regionalhistorischen Arbeiten seit 1997 nicht bekannt sind ….
2) Ist es im Falle Irles vor dem Hintergrund der oben erwähnten Publikationen nicht vielmehr: „cancel unculture“?
3) Sorgen die beinahe endlosen Umbenennungsdebatten nicht für die gewünschte kritische und konstruktive Auseinandersetzung anstelle der tumben und plumpen Beibehaltungsvertreter?
Sehr löblich ist es dem Archiv der Jugendkulturen unter die Arme zu greifen! Auch finde ich die angebotenen Produkte frech und witzig, da werde ich bestimmt was bestellen.
Archive sollten sich nicht in die Lage versetzen parteilich oder gar parteiisch sein zu wollen. Der Werbeaufdruck „Archive sind nicht neutral“ drückt jedoch genau dies aus, was ich für äußerst problematisch halte. Denn hier wird der neutrale und objektive Blick auf die Geschichte in Zweifel gezogen. Politische Slogans schaden der Glaubwürdigkeit wissenschaftlicher Arbeit massiv. Wir sollten uns von agitativen Sprüchen und populistischen Haltungen scharf abgrenzen – so sehr die Idee der gesamten Aktion eine gute Öffentlichkeitsarbeit darstellt. Diesen Spruch jedenfalls hafte ich mir nicht an die Brust!
Und was wurde nun von siwiarchiv beigesteuert? Ich tippe auf „Archive. Geschichte suchen und finden“ im Layout des „Archivar“, denn da hat möglicherweise ein Wolf schwarz gesehen…
Da ein Vorschlag gewünscht ist: „Archive. Denn was heute niedergeschrieben ist kann morgen nicht angezweifelt werden“
Vielen Dank für den Kommentar und den Vorschlag!
„Archive sind nicht neutral“ ist in der Tat provokativ und wurde bereits im vergangenen Jahr intensiv, aber sicher noch nicht abschließend hier diskutiert: http://www.siwiarchiv.de/siwiarchiv-blogparade-archivesindnichtneutral/ .
Nein, der gewählte Slogan stammt nicht von hier.
Es ist schön, dass die Spendenaktion so viel Aufmerksamkeit bekommt. Dennoch muss ich darauf hinweisen, dass die hier als „populistisch“ betitelte Beurteilung von Archiven keine „agitative“ Sondermeinung ist. Archive können nicht neutral und nicht apolitisch sein. In ihre Sammlungstätigkeit, Personalwerbung und Vermittlungsarbeit fließen zwangsläufig auch die Vorstellungen, Sozialisierungen und Haltungen der archivierenden Personen mit ein. Gleiches gilt übrigens für wissenschaftliche Forschung, ganz gleich ob Geistes- oder Naturwissenschaften, selbst auch. Es gibt im englischsprachigen Raum bereits ausführlich Arbeiten zu diesem Thema. Das deutsche Archivwesen hat das in der Breite leider noch nicht aufgegriffen. Das Archiv der Jugendkulturen dagegen schließt sich der international diskutierten selbstkritischen Beurteilung von Archiven an: https://twitter.com/Jugendkulturen/status/1367168646687191040?s=20. Es lohnt sich, Informationen zu diesem Thema zu sammeln und sich mit der eigenen „Vorbelastung“ gegenüber potentiellen Nutzungsgruppen zu beschäftigen. Eine Plattform für Diskussionen und evtl auch Lernmöglichkeiten zu diesem Thema bietet übrigens eine anstehende Veranstaltung des Arbeitskreises „Offene Archive“ im VdA im April: https://archive20.hypotheses.org/10011.
Am 9.3. gab es in der Siegener Zeitung (Print) einen Leserbrief „Respektlos und arrogant“, der einerseits die deutliche Kritik an dem Tafeltext zu Fissmer zurückwies und andererseits auf die Vorgehensweise „Aufklären statt Umbenennen“ abhob. Sowohl dieser Leserbbrief als auch der oben erwähnte „Flüchtigkeitsfehler“ mit dem falschen Bürgermeistervornamen haben mir keine Ruhe gelassen, so dass ich das Biogramm Fissmers, dass die Verwaltung zur Sitzung des Rates am 24.6.2020 und die Langfassung zum Kulturausschuss am 23.2.2021 einmal verglichen habe. War ich doch davon ausgegangen, dass diese beiden Texte identisch sind. Bei der Synopse (PDF) wurden die Textpassagen der Langfassung, denen des Biogramm zugeordnet. Beide finden sich zum Nachkontrollieren im Ratsinformationsystem der Stadt Siegen – sehen Sie also selbst: PDF: Fissmer Synopse Biogramm vom 24.6.2020 (links), Langfassung vom 17.2.2021 (rechts).
Ob die Kritik an der Langfassung im Ausschuss nun besserwesserisch war, und, ob Sie mit dem Stadtarchivleiter den Richtigen traf, mögen Sie entscheiden. Denn interessant sind m. E. folgende Fragen:
Warum musste das Biogramm des Stadtarchivs eigentlich umgeschrieben werden?
Wer ist für die Redaktionierung der Langfassung verantwortlich?
Wie wertschätzend für die Arbeits des Stadtarchivs ist es, wenn ein ausführlicheres Biogramm nicht weiter gekürzt werden muss?
Ich wage einmal einen Blick in die Zukunft:
Im Rahmen des Gesetzgebungverfahrens zum Kulturgesetzbuch, das ja auf dem bereits vorhandenen Kulturfördergesetz NRW aufsetzen soll, wird es noch keine Zusammenführung mit dem Archivgesetz geben. Die Neufassung des Archivgesetzes wird offenbar erst zu einem späteren Zeitpunkt seitens der Exekutive wieder aufgegriffen werden……
Auf dem obigen Poster ist Johann Trollmann abgebildet. Im Artikel der Westfälischen Rundschau vom 27.07.2019 mit der Überschrift: Leid, Ausgrenzung und Verfolgung – Die Doku „Sinti und Roma. Eine deutsche Geschichte“ beleuchtet Vorurteile und Ressentiments, mit denen die beiden Volksgruppen seit jeher zu kämpfen haben, lautet die Bildunterschrift:
„Ein Star, der keiner sein durfte: Der Boxer Johann Trollmann im Jahr 1928.“
Ich war auch schon da mit meinem Vater,da war ich ungefähr 27 J. Er suchte damals auch seinen Vater ,aber durch einen Italienischen Freund der auf die siche gegangen ist, fand mein Vater heraus das sein Vater auf dem Friedhof Medicina/Bolongna (Erstbestattungsort) jetzt Fuda Pass liegt ,Block 5,Grab 73
Edith Langner war von 1969 bis 1979 als sachkundige Bürgerin in folgenden Ausschüssen des Kreises Siegen-(Wittgenstein) tätig: Ausgleichsausschuss (1969-79, Mitglied, Vertriebene), Kreis-VHS-Beirat (1975-79, stellv. Mitglied), Kreisvertriebenenbeirat (1969-74, stv. Mitglied)
Nachstehend ein paar Literatur- und Medienhinweise zur Biographie von Edith Langner Literatur:
Homolla, Erna: Die Kümmerin vom Fischbacherberg. Erinnerungen an die Landtagsabgeordnete Edith Langner, in: Durchblick 2 (2019), S. 44 – 45
Pfau, Dieter/Seidel, Hans Ulrich: Nachkriegszeit in Siegen1945 bis 1949. Flüchtlinge und Vertriebene zwischen Integration und Ablehnung, Siegen 2004, S. 190, 191
Schiemer, Hansgeorg: 40 Jahre CDU für Siegerland und Wittgenstein (Schriftenreihe des CDU-Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein e.V. Nr.6), Siegen 1986, S. 102 -103, 116
Siegerländer Heimatkalender 1968, Siegerländer Chronik [ für den 10.07.1966: In den Landtag gewählt: Hans Reinhardt (SPD), Hans-Georg Vitt (SPD) und Edith Langner (CDU). Anm: Nachtrag am 17.5.22]
Siegerländer Heimatkalender 1971, Siegerländer Chronik [für den 14. Juni 1970: Im Siegerland in den Landtag gewählt: Hans Reinhardt (SPD), Hans Georg Vitt (SPD) und Edith Langner (CDU). Anm: Nachtrag am 17.5.22]
Siegerländer Heimatkalender 1988, S. 35 Medien:
„Frau Stadtverordnete Langner wird 50 Jahre alt,“ in: Siegener Zeitung vom 23.1.1963
„Siegerländer CDU nominiert eine Frau“, in: Siegener Zeitung vom 31.1.1966
„Aus dem Hause: Raum 14: Oase im Landtag.“ in: Landtag intern, 1. Jahrgang, Ausgabe 4 vom 29.10.1970, S. 6, Link
„Vom Pfarrhaus in den Landtag“, in: Der Nordwestspiegel vom 18.11.1970
„Es begann mit dem Willen, den Nächsten zu helfen“, in: SiegenerZeitung vom 26.11.1970
„Ehrenbrief für Frau Langner“, in: Siegener Zeitung vom 28.1.1971
„Landesgrenze kein Nachteil für Schüler mehr.“ in: Landtag intern, 2. Jahrgang, Ausgabe 4 vom 11.02.1971, S. 9, Link
„Zur Person: Edith Langner.“ in: Landtag intern, 2. Jahrgang, Ausgabe 5 vom 18.02.1971, S. 11, Link
„Aus dem Hause: Dr. Lenz, Wilhelm: Nordrhein-Westfalens Landtagspräsidium erlebt Demokratie in Stockholm.“ in: Landtag intern, 2. Jahrgang, Ausgabe 15 vom 27.05.1971, S. 10, Link
„Plenarbericht: Abgeordnete fragen – Minister antworten. Fragestunde im Plenum“, in: Landtag intern, 2. Jahrgang, Ausgabe 17 vom 18.06.1971, S. 4-5, Link
„Spielkreise ersetzen fehlende Kindergartenplätze.“ in: Landtag intern, 2. Jahrgang, Ausgabe 21 vom 09.09.1971, S. 10, Link
„Parlamentarischer Untersuchungsausschuß hat sich konstituiert.“ in: Landtag intern, 2. Jahrgang, Ausgabe 27 vom 21.10.1971, S. 3, Link
„Ersatzlösungen für fehlende Kindergartenplätze.“ in: Landtag intern, 2. Jahrgang, Ausgabe 28 vom 28.10.1971, S. 12, Link
„Ausschussbericht. Petitionsausschuß: Kummerkasten des Bürgers.“ in: Landtag intern, 2. Jahrgang, Ausgabe 29 vom 11.11.1971, S. 8, Link
„Sorge um Pflichtstundenzahl der Pädagogen.“ in: Landtag intern, 2. Jahrgang, Ausgabe 30 vom 18.11.1971, S. 10, Link
„Ländergrenzen im Gebiet der Kreise Siegen und Wittgenstein.“ in: Landtag intern, 2. Jahrgang, Ausgabe 31 vom 25.11.1971, S. 8, Link
„Neuordnung der Ausbildungsvorschriften für medizinische Berufe.“ in: Landtag intern, 2. Jahrgang, Ausgabe 32 vom 02.12.1971, S. 11, Link
„Silberner Frauenhilfe-Kreuz für Edith Langner“, in: Siegener Zeitung vom 15.12.1971,
„Pflichtstunden für Lehrer.“ in: Landtag intern, 3. Jahrgang, Ausgabe 9 vom 16.03.1972, S. 13, Link
„Gästebuch.“ in: Landtag intern, 3. Jahrgang, Ausgabe 13 vom 04.05.1972, S. 14, Link
„Kindergärtnerinnen.“ in: Landtag intern, 3. Jahrgang, Ausgabe 15 vom 18.05.1972, S. 12, Link
„Kindergärtnerinnen.“ in: Landtag intern, 3. Jahrgang, Ausgabe 18 vom 15.06.1972, S. 13, Link
„Gästebuch.“ in: Landtag intern, 3. Jahrgang, Ausgabe 24 vom 27.10.1972, S. 15, Link
„Porträt der Woche: Edith Langner (CDU).“ in: Landtag intern, 3. Jahrgang, Ausgabe 29 vom 01.12.1972, S. 2 [Link s. o.]
„Zur Person: Geburtstage.“, in: Landtag intern, 4. Jahrgang, Ausgabe 2 vom 19.01.1973, S. 15, Link
„Verdienste im sozialen und politischen Bereich“, in: Siegener Zeitung vom 20.1.1973
„Verkehrsprobleme.“ in: Landtag intern, 4. Jahrgang, Ausgabe 7 vom 23.02.1973, S. 11, Link
„Großes Verdienstkreuz für Edith Langner“, in: Siegener Zeitung vom 20.9.1973
„Abgeordnete mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.“ in: Landtag intern, 4. Jahrgang, Ausgabe 21 vom 21.09.1973, S. 7, Link
„Überflußgesellschaft.“ in: Landtag intern, 4. Jahrgang, Ausgabe 28 vom 23.11.1973, S. 9, Link
„Junge Aussiedler in Förderschulinternaten.“ in: Landtag intern, 5. Jahrgang, Ausgabe 8 vom 15.03.1974, S. 13, Link
„Landtag: 143 Wahlmänner für die Bundesversammlung.“ in: Landtag intern, 5. Jahrgang, Ausgabe 10 vom 29.03.1974, S. 7, Link
„Katholischen Frauengemeinschaft aus Hüttental-Weidenau zu Besuch im Landtag.“ in: Landtag intern, 5. Jahrgang, Ausgabe 11 vom 06.04.1974, S. 16, Link
„Zu Besuch im Landtag.“ in: Landtag intern, 5. Jahrgang, Ausgabe 17 vom 14.06.1974, S. 16, Link
„Offiziere zu Besuch im Landtag.“ in: Landtag intern, 5. Jahrgang, Ausgabe 20 vom 13.07.1974, S. 16, Link
„Landespressekonferenz“. in: Landtag intern, 5. Jahrgang, Ausgabe 30 vom 29.11.1974, S. 16, Link
„Prüfungsordnung.“ in: Landtag intern, 6. Jahrgang, Ausgabe 6 vom 01.03.1975, S. 14, Link
„Das Parlament war ihr Schicksal. Ein Drittel der Parlamentarier kommt nicht wieder“, in: Landtag intern, 6. Jahrgang, Ausgabe 10 vom 23.04.1975, S. 5-6, Link
„E. Langner nahm Abschied von politischen Ämtern, in: Siegener Zeitung vom 17.1.1977
„Frau Pastor stand jahrzehntelang ihren Mann“, in: Siegener Zeitung vom 22.1.1983
„Edith Langner von schwerem Leiden erlöst“, in: Siegener Zeitung vom 9.12.1986
„Zur Person: Edith Langner (verstorben)“. in: Landtag intern, 17. Jahrgang, Ausgabe 20 vom 16.12.1986, S. 24, Link
„Edith-Langner-Anlage übergeben: Areal soll „Ruhe und Frieden“ beingen, in: Siegener Zeitung vom 8.10.1993
[Anm.: Die Verlinkungen auf die Fundstellen im „Landtag intern“ und die Verlinkunk auf den „Durchblick“ erfolgten am 18.5.2022]
Gestern auf dem Westfälischen Archivtag betont der Archivrechtler und Leiter des Rheinischen Archiv- und Fortbildungszentrums:
M.Steinert konstatiert dringenden Handlungsbedarf zur Novellierung des ArchivG NRW, um die fehlenden Regelungen zur EU-DSGVO zu ergänzen: Steigende Anzahl von Verwaltungen verweigert Abgabe personenbezogener Unterlagen an die Archive! #WAT21
“ …. Schon bei der vorgelagerten Überlieferungsbildung sei fraglich, ob rechtliche Bestimmungen, wie z.B. Vernichtungsbestimmungen der Übernahme von personenbezogenen Daten in den Archiven trotz der weitreichenden Anbietungspflicht entgegenstehe.
Aber auch bei unproblematischen Daten stelle sich die Frage, mit welcher Methodik wir diesen umfangreichen Quellentypus, der in Zukunft massenhaft auf die Archive zukäme, erschließen werden können.
Durch eine praktikable und zielführende Erschließungsmethodik erreiche man vielseitige Auswertungsmöglichkeiten.
Mit diesen und weiteren Fragen läutet Herr Schröder die erste Sektion des Westfälischen Archivtages 2021 ein und übergibt das Wort dem ersten Referenten Herrn Dr. Steinert aus dem LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum in Pulheim.
Sein Vortrag beschäftigt sich mit der Frage: „Übernahme von personenbezogenen Unterlagen in der Verwaltung in Zeiten der Datenschutz-Grundverordnung – Weitermachen wie bisher?“
Zu Beginn stellte der Redner fest, dass die nordrhein-westfälische Archivwelt immer noch auf ein novelliertes Archivgesetz warte, dass der Datenschutzgrundverordnung von 2016 Rechnung trägt. Im Moment stehe die DSGVO dem Archivgesetz NRW entgegen.
Der Redner benannte noch einmal die Unterscheidung, die die DSGVO bei Bestimmungen in Bezug auf personenbezogene Daten im Archiv macht.
Grundlegend untersage die DSGVO die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Art. 9 Absatz 1.
Jedoch räume die Verordnung ein, bei einem ausdrücklich im öffentlichen Interesse liegendem Archivzweck durch die Artikel 5 und 6 DSGVO auf die Erfordernisse zu verzichten (sog. Derogation).
Zu betonen sei, dass die DSGVO nur für lebende Personen gelte.
Neben dieser unmittelbaren Privilegierung der Archive gibt es auch eine Privilegierung der Archive durch Artikel 89 Absatz 3 DSGVO, die eine zentrale Bestimmung für die Archive sei.
Einzige Voraussetzung für diese Ausnahme sei die Anpassung der Archivgesetzte, die wiederum in NRW fehle.
Durch eine geringe Änderung des Archivgesetzes wäre diese Ausnahme möglich.
In den meisten Bundesländern ist eine solche dringende Novellierung des Archivgesetzes, die Voraussetzung der Derogation ist, bereits geschehen. In fünf Bundesländer unter denen auch NRW ist, stehe dies hingegen noch aus. 2018 habe es einen Gesetzesvorschlag für die Novellierung gegeben, der aber 2019 nach einer ergebnislosen Anhörung der Verbände im Sand verlaufen sei.
Herr Steinert nennt dies eine „schleppende Bearbeitung des Gesetzgebers“ und hofft deshalb, auf eine problemlose Übernahme der personenbezogenen Daten, die durch die kommende Novelle ermöglicht werden solle.
Diese Möglichkeit eröffnet der Redner durch die exemplarische Nennung der Bestimmungen die dies im Moment im Archivgesetz NRW verhinderten.
Neben einer minimalen Abänderung des §4 Absatz 2 Archivgesetz, der durch eine zwei Sätzestarke Nummer 3 des Gesetzeslautes derogierbar wäre, seien ebenfalls die Artikel 15,16,18 und 19-21 DSGVO derogierbar.
Eine solche Abänderung erspare sehr viel Arbeit und würde zudem eine klare rechtliche Grundlage bieten
Herr Steinert stellte fest, dass die Derogation unter datenschutzrechtlichen Aspekten „vollkommen unbedenklich [sei], da das Archivgesetz durch Schutzfristen die Einhaltung des Datenschutzes garantiert“.
Eine Wiederaufnahme der Frage, ob man weiter machen soll wie bisher, käme zu dem Schluss, dass wir es eigentlich nicht dürften, es aber trotzdem im Hinblick auf die noch ausstehende Novellierung tun müssten.
Herr Schroeder hielt abschließend fest, dass die jetzige Lage eine unbefriedigende sei und leitete in diesem Zuge zu der Auswertung der anfangs gestellten Umfragen ein. Die Frage, ob Dienststellen die Anbietung personenbezogener Daten verweigerten, konnten 27% der Teilnehmer bejahen, was zu angesichts dieser hohen Anzahl zu Verwunderung führte.
Herr Steinert griff diese Zahl auf schilderte, dass er dieses Problem zwar kenne, jedoch nicht in einem solchen Umfang, woraus sich ein noch größerer Handlungsbedarf des Gesetzgebers ergebe.
Das Problem sei also durch aus real und auch dringend. Eine Novellierung des Archivgesetzes sei somit dringend erforderlich und schon längst ausstehend, wie Herr Steinert abschließend zusammenfasste. ….“
Quelle: https://archivamt.hypotheses.org/14812
Eine gegenüber dem Vortrag aktualisierte Powerpoint-Präsentation verweist u.a. darauf, dass neben NRW nur noch Hamburg das Archivgesetz noch nicht an die EU-DSGVO angepasst hat. Die Präsentation ist inzwischen online: PP-Präsentation Steinert (PDF)
Innovativ findet sich nicht in der Presseerklärung, insofern wäre das konventionelle Vorgehen hier nicht zu kritisieren – was wäre denn ein modernes Vorgehen? Ein Stadt-Wiki vielleicht. Dies existiert allerdings schon: https://wiki.zeitraum-siegen.de/ . Ein citizen science bzw. oral history Projekt für die neueste Geschichte? Auch dies ist bereits vorhanden: https://unser-siegen.com/. Also was wäre Hochinnovativ?
Vergessen wurde hier zudem das studentische Portal Regioport Siegerland: https://www.regioport-siegerland.de/de/ . Bei dem Projekt zur Siegener Stadtgeschichte hätte man diese drei Angebote durchaus mit einbeziehen können. Als Vorbild und zur Weiterentwicklung hätte ja die Kooperation von siwiarchiv mit dem kreishistorischen Zeitspuren-Projekt gedient.
Dass siwiarchiv als weitere Plattform genutzt werden kann, bedarf keiner Erwähnung.
Video: Stephanie Kortyla (Sächsisches Staatsarchiv): “ Zur Archivierung von Daten aus Twitter mittels der twittereigenen Exportfunktion („Twitterarchiv“), ein Überblick über die Schnittstellenentwicklung 2018 bis 2021″, Vorstellung auf der Tagung des Arbeitskreises „Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen“ (AUdS) am 22. und 23.03.2021
Weitere Literatur:
– Pfau, Dieter: „Die Bevölkerung […] mit auf dem Wege der vollkommenen Verarmung“. Der freiwillige Arbeitsdienst im Siegerland (Dez. 1931 – Jan. 1933), in: Siegener Beiträge 3 (1998), S. 129 – 141
– Pfau, Dieter: Kriegerdenkmale, Volkstrauer und nationalsozialistische Sinnstiftung – Über die Transformation kultureller Traditionen im Siegerland 1929 – 1932, in: Siegener Beiträge 4 (1999), S. 101 – 116
– Schiemer, Hansgeorg: Volksbegewhren und Volksentscheide – Politische Willensbildung im Siegerland inder „Weimarer Zeit“, in: Siegener Beiträge 3 (1998), S. 119 – 128
– Schiemer, Hansgeorg: Vor 70 Jahren: Volksbegehren und Volksentscheid gegen den Young-Plan 1929, in: Siegener Beiträge 4 (1999), S. 85-100.
Weitere Literatur:
Irle, Trutzhart : Auferstanden aus Ruinen – Zerstörung und Wiedergeburt der Stadt Siegen, Gummersbach 2005, S. 27 (Danke an W. L. für den Hinweis!)
Das Siegerland hat eine interessante Geschichte und viele Kunstschätze aufzuweisen. Es ist wichtig und notwendig, sie zu erhalten, und die Bürger und Bürgerinnen der Stadt auf diesen kulturellen Reichtum aufmerksam zu machen.
Weitere Literatur:
– Tschacher, Werner: „All this trouble for thoise damned old bones!“ Aachener Mythen um Karl den Großen zwischen Dekonstruktion, Transformation und Persistenz, in: Kéry, Lotte (Hg.): Eloquentia copiosus. Festschrift für Max Kerner zum 65. Geburtstag, Aachen 2006, S. 81 – 100, bes. S. 90-91
– Becker, Alfons: Über Denkmalpflege und Naturschutz in der Rheinprovinz in: Ruland, Josef (Hrsg.): Festschrift für Franz Graf Wolff Metternich. Neuss 1973, S. 50 – 70, bes. S. 62
– Renkhoff, Otto: Nassauische Biographie. Kurzbiograpjien aus 13 Jahrhunderten, Wiesbaden 1992, S. 193
– Klappert, Hans: Verbot für Brüsseler Tomaten und Apfelsinen. Protokoll der Erinnerungen von Oberbürgermeister Fissmer, in: „Siegerland“, Band 68, H. 3–4 (1991), S. 87 – 92
– Dietermann, Klaus: Kriegsbeginn – 1939 in Stadt und Kreis Siegen, Siegen 1988, S. 22–27
– Philippi, Detmar Alemannenalbum 1969 Zum 125. Stiftungsfest der Burschenschaft Alemannia zu Bonn, 1969, S. 50.
Weitere Literatur:
– Radermacher, Willy: Kyffhäuser- und Schützenkameradschaft Siegen e. V. 1870 – 1995. Dokumentation zum 125jährigen Bestehen, o. O. 1995, S. 103 (Bild)
Zwei „Bilder“ zur Familiengeschichte Fissmers:
a) Verlobung:
Quelle: Allgemeiner Anzeiger zum Militärischen Wochenblatt Nr. 87 vom 16. Juli 1908
b) Tochter und Enkel:
Quelle: Gothaisches genealogisches Taschenbuch der adeligen Häuser
zugleich Adelsmatrikel der deutschen Adelgenossenschaft. Teil B, Gotha
1942
Der Bildtitel lautet: „Gießpfannen-Gehänge für 100t Tragkraft“. Schnellster Löser ist somit Sven Panthöfer – Gratulation! Die Herstellerfirma und der Fotograf wurden jedoch nicht richtig gelöst. Heute besteht ja eine neue Chance.
Manfred Knoche stellte dankenswerterweise folgendes Bild zu verfügung das eine Roheisen-Kippe mit dem Gehänge in Aktion zeigt:
Lieber Herr Wolf, meinen Sie nicht, dass die Fragen nach Hersteller und Fotograf etwas über das Ziel hinausschießen? Da bleibt nur raten und das ist auf die Dauer etwas langweilig. Geben Sie doch wenigstens Hinweise.
Grüße S.P.
Ehrlich gesagt hatte ich erwartet, dass Firma und Fotograf recht schnell erraten werden …..
Mit Hinweisen bezüglich der Firma halte ich mich noch bis morgen zurück. Übirgens ist dieses Raten ja auch ein Ausdruck der starken mittelständischen Wirtschaft im Kreisgebiet.
Soviele Industriefotografen können wir nun auch nicht mehr haben, daher darf gerne weitergeraten werden.
Immer noch nicht! Was die Firma anbelangt, schauen Sie bitte auch in den nächsten Tagen ´rein. Ich denke da klärt sich etwas. Ich bin bei den Fotografen über die Findigkeit aller Mitratenden erstaunt. Wenn ich jedoch eine Sammlung Weller-Bilder erhalten hätte, dann wäre es allerdings durch die Medien gegangen. Weller ist immerhin eine Inspiration für Bernd und Hilla Becher gewesen.
Ein Tipp: Der abgebildete Gegenstand wird zur Herstellung eines Produkts verwendet, das Archiven wohlbekannt ist.
Beim ersten Anblick habe ich allerdings an die Waffenkammer von Agent K aus dem Film „Men in Black“ gedacht …..
Auch hier muss ich leider streng sein. Es ist kein Kompressor-Kessel und die gesuchte Firma ist ca. 75 Jahre älter als die Firma Lohenner. Schließlich bin ich ja auch nach einem Tipp zum Fotografen gefragt worden. Der Name findet sich hier im Blog im Zusammenhang mit visuellem Dokumentationsgut. Viel Glück heute!
Es ist kein Magnet. Aber vielleicht hilft ein Blick auf das erste Rätsel, um auf eine Idee zu kommen, wo dieses Teil zum Einsatz kommt. Firma und Fotograf sind leider falsch.
Da ich bei der Lösung der ersten Frage streng war, bin ich es hier auch – also nein, kein Dampf(druck)kessel. Die Firma ist leider falsch, aber ich habe den Eindruck, dass nun in der richtigen „Kategorie“ gesucht wird. Und schließlich zum Fotografen, es ist ja noch ein bisschen Zeit und zum Finden benötigt man auch etwas Zeit. Ich habe nicht grundlos visuelles Dokumentationsgut geschriben ….
1502 als Schmiede in Siegen gegründet, dominierte die Region über Jahrhunderte hinweg, stieg als Siegener Aktiengesellschaft (SAG) auf und heißt mittlerweile The Coatinc Company.
Die Bilder könnten von der Familie Dreßler sein, als Gründer heute ist es Herr Niederstein.
Ja. Gemeint war die Fa. Coatinc, aber quasi nur als Kunde der gesuchten Firma. Daher stammen die Bilder auch nicht aus dem Besitz der Familie Dresler/Niederstein.
Weder Fotograf noch Firma wurden richtig erraten. Danke für die Teilnahme! Es finden sich immer einmal wieder weitere Hinweise bei den nachfolgenden Rätseln. Da diese beiden Fragen und auch weitere Produkte der Firma noch nicht erraten wurden, lohnt sich das Mitmachen weiterhin!
3 Tipps:
Das gezeigte Werkstück wurde in der Landwirtschaft eingesetzt.
Die gesuchte Firma feierte 1936 ihr 100jähriges Bestehen.
Der Fotograf taucht im im Blog im zusammenhang mit dem Medium Film auf.
Es handelt sich in der Tat um das Rahmenteil eines sogenennaten Kuhlpflugs, der u. a. in Mooren etc. eingesetzt wurde. Auchdie Firma wurde nun endlich richtig erraten – daher doppelte Gratulation!
Gratulation! Die Antwort ist korrekt! Jetzt noch bis heute 24 Uhr weitere richtige Lösungen einsenden und es wird noch einmal spannend. Zum Fotografen noch ein Hinweis: Er findet sich hier im Zusammenhang mit einem Film über Weidenau. Bei den noch ungelösten Bildern hilft vielleicht die vergleichende Google-Bildersuche.
Zu Kanstein s.folgende Literatur:
Werther, Steffen: SS-Vision und Grenzland-Realität. Vom Umgang dänischer und „volksdeutscher” Nationalsozialisten in Sønderjylland mit der „großgermanischen“ Ideologie der SS, Stocklholm Studies in History 95, Stockholm 2012, s. 38, 66, 251, 254, 297
In der Kurzfassung des Fissmer-Anlage-Begleittexts heißt es im Anschluss an die seit Fissmers Verschwinden aus dem Amt vorgetragenen These, „auch betrieb er ein umfangreiches Luftschutzprogramm zum Schutz der Zivilbevölkerung.“ Damit erhält der Protagonist eine Lebensretter-Rolle, die dann mit seiner NS-Belastung verrechnet werden kann und die angesichts von Todesziffern, wie sie ohne Bunker anzusetzen wären, zu einem außerordentlich günstigen Saldo für den Belasteten führt.
Es ist aber zu sagen, dass diese These ein reiner Mythos ist, denn:
– Wenn bereits seit der Jahresmitte 1937 in Siegen mit dem Einbau von Luftschutzkellern in Neubauten begonnen wurde, war das keine lokale Initiative, die etwa von Fissmer ausgegangen wäre, sondern eine Folge ministerieller Verordnungen zum Luftschutz. Das Ministerium war das Reichsluftfahrtministerium unter dem Oberbefehlshaber der Luftwaffe Hermann Göring.
– Zwar druckte eine Siegener Druckerei die reichsweit verbindliche „Ortsanweisung für den Luftschutz der Zivilbevölkerung“, verlegte und verteilte sie aber nicht. Fissmer hatte damit nichts zu tun.
– Am 10.10.1940 trat mit Führerbefehl das „Führer-Sofortprogramm“ zum Bau von Luftschutzbunkern in Kraft. Für dessen Umsetzung war der Reichsminister für Bewaffnung und Munition Fritz Todt zuständig. Fissmer hatte mit der Entstehung dieses Befehls nichts zu tun.
– In der Besonderen Anlage 10 des Mobilmachungsplans der Luftwaffe war die Stadt Siegen als einer von 104 Luftschutzorten I. Ordnung aufgeführt. Es gibt keinerlei Quellenbelege dafür, dass das auf Aktivitäten von Fissmer zurückzuführen ist. Es ergaben sich daraus Handlungsanweisungen für die Polizei, die Feuerwehr, die Technische Nothilfe, das DRK usw. Fissmer als regionaler Luftschutzleiter war hier in jeder Hinsicht allein ein Ausführender. Was dazu quellenmäßig vorliegt, ist ein nicht zuzuordnendes Konzept zu einem Brief des Landrats Weihe an das Luftgaukommando VI in Münster vom 26.5.1943. Es spricht, wie es dann vollzogen wurde, die Ausgliederung „wegen Schwierigkeiten der Betreuung“ von Eiserfeld, Niederschelden, Buschhütten, Kreuztal, Dreistiefenbach, Dillnhütten, Dahlbruch, Hilchenbach, Eichen, Freudenberg, Salchendorf, Neunkirchen und Netphen aus dem Bereich des Luftschutzortes I. Ordnung, also eine Herunterstufung an. Bei dieser Ausgliederung sieht Joachim Stahl Fissmer am Werk, dem die genannten Orte zuviel gewesen seien. Handfeste Belege kann er aber auch dazu nicht vorweisen. Sicher lässt sich sagen, dass sich auch dazu – erstrangiger Schutz für Siegen, nachrangiger für die anderen -, was Fissmer angeht, überhaupt nichts Gesichertes sagen lässt.
Bei keinem dieser Vorgänge hatte der OB von Siegen mehr zu tun, als dass er sich an die Vorgaben zu halten hatte und schauen musste, dass andere sich daran hielten. Es gibt nicht den geringsten Ansatzpunkt, ihn zu einem Lebensretter zu machen. Diese Eigenschaft müsste, wenn das die Schlussfolgerung aus dem Bunkerbau sein soll, der NS-Spitze mit Hitler, Göring und Todt zugemessen werden. Die nun allerdings Bunker bauten, um Krieg gegen die Menschheit führen zu können. Fissmer in Siegen fiel im weiteren Verlauf zu, dass der Zwangsarbeitseinsatz effektiv war und dass in die fertigen Bunker nur reinkam, wer einen Ahnennachweis für seine „rassische“ Reinheit vorzulegen imstande war. Diese Praktiken retteten keine Leben.
Quellen: Joachim Stahl, Bunker und Stollen für den Luftschutz im Raum Siegen, Kreuztal 1980; Holger Happel, Bunker in Berlin. Zeugnisse des Zweiten Weltkriegs, Berlin 2015; Siegener Zeitung, 8.6.1937
In Lothar Irles „Siegerländer Persönlichkeiten und Geschlechter-Lexikon (Siegen 1974, S. 220) finden sich die Hinweise, dass Menk seit 1972 als Stadtarchivar fungierte und seit 1968 als Synodalarchivpfleger – leider ohne Quellenhinweis.
Manfred Knoche hat via folgender Email siwiarchiv zwei Bilder überlassen, einerseits die heutige Lage der Firma sowie ein Rätsel für den Archivaren:
„[N]ach dem ambitionierten Osterrätsel 2021 Marathon ist es trotz Lösung immer noch schwer zu den Gebrüdern Schuss Informationen zu finden.
Deshalb gefallen Ihnen vielleicht die beiden angehängten Bilder?
Wenn Sie jetzt noch das abgebildete Produkt und den Fotografen dieses Bildes erraten gibt es wie immer einen kleinen Preis :-)“
Meine Antwort lautete: „Dampfkessel, Vakuumbehälter, Rührwerksbehälter, ….. könnte es alles sein. Ich gebe ja zu, dass es schwierig war. Aber ich hatte gedacht, dass irgendjemand einen Bezug zur Firma Schuss gehabt hätte. Nun, gut, dem war wohl nicht so. Den Fotografen vermute ich einmal im privaten Umfeld.“ – Vielleicht kann mir ja jemand helfen?
Vielen Dank, lieber Herr Wolf, für die Gratulation. Das Rätsel hat die Rätselgemeinde schon sehr gefordert. War sehr herausfordernd und leider konnten die wenigsten Rätsel gelöst werden. So wie Herr Knoche nun Sie etwas in die Pflicht nimmt, würde ich Sie bitten noch etwas zum Fotokonvolut mitzuteilen. Wie kam es ins Kreisarchiv, aus welcher Zeit stammen die Aufnahmen und wer ist Foto Wolpert – im Siegerländer Umfeld habe ich diesen Namen bisher nicht gehört. Vielen herzlichen Dank für Ihre Arbeit und viele Grüße aus OWL. S.P.
2 annähnernd identische Ringalben mit den Produktfotografien der Firma Gebrüder Schuss kamen auf dem Weg der Schenkung in das Kreisarchiv. M. E. dienten sie zur Kundenakquise auf Messen oder durch Vertreter.
Eine Datierung ist leider nicht möglich – 1950er Jahre oder früher?
Fotografenmeister Hans Wolpert hatte seinerzeit Anfang der 1950er Jahre sein Studio in Weidenau in der Austr.(Gebäude Fa. Schleifenbaum + Steinmetz) .
Er war bekannt durch seine Industrie-Fotografien. Im April 1955 hat er auch einen 16 mm SW-Stummfilm (ca. 40 min,) über die Stadtwerdungsfeiern in Weidenau, inkl. Umzug der Weidenauer Industrie am 23.4., aufgenommen (s.a. Kreisarchiv). .
Bei diesem Industriefotoatelier begann 1951 auch der heute bekannte Prof. Detlev Orlopp (*1937) seine Lehre als Fotograf.
1. Verantwortlich für die Bombardierung Siegens waren nicht die Kasernen, sondern die Eisenbahnanlagen. Die Kaserne spielten in den alliierten ZielPlanungen keine Rolle. Das lässt sich alles anhand von alliierten Quellen einfach überprüfen.
2. Fissner war ganz gewiss nicht die treibende Kraft bei den Luftschutzmaßnahmen in Siegen, sondern das Luftschutz – Bauprogramm, dass im Oktober 1940 verabschiedet wurde. Dort und in den nachfolgenden Bauprogrammen war fast geschrieben, welchen Umfang der Luftschutz in Siegen besitzen durfte. Dafür gab es dann auch staatliche Zuwendungen und Zuweisungen. Ich meine aber, dass Fissner den Abriss der Synagoge forciert hatte, um dort einen Luftschutzbunker zu errichten. Wenn das ein Verdienst war – ?
Genau wegen dieser Ungenauigkeiten und fehlerhaften Formulierungen ist der Alternativentwurf entstanden. Im Übrigen gilt aber nach wie vor das, was Thomas Wolf an anderer Stelle geschrieben hat: Man hätte sich grundsätzlich mehr Zeit für diese Dinge nehmen müssen.
Die Fraktion Die Linke hat sich intensiv mit den in den letzten Wochen (z. T. noch einmal) veröffentlichten Beiträgen von kundigen Experten und Historikern zur Causa „Fissmer“ – auch ausdrücklich der Begründung der FDP-Fraktion zu deren Antrag – beschäftigt. Und als Konsequenz die eigene Beschlusslage einer Revision unterzogen. Sie nimmt ihre Unterstützung des gemeinsamen Textentwurfs der sechs Fraktionen zurück und enthält sich auch bei einer Abstimmung des FDP-Antrags.
Angesichts der deutlich gewordenen Diskrepanzen und Defizite in der Erforschung der Persönlichkeit und des Handelns Fissmers und der Schwierigkeit ihrer Bewertung erscheint es der LINKEN als angemessen, sinnvoll und notwendig, dass sich zunächst der Arbeitskreis „Aufarbeitung der historischen Hintergründe von Straßennamen in Siegen“ damit in der gebotenen Ruhe beschäftigt bevor ein endgültiger Tafeltext beschlossen werden kann.
Des weiteren wird auch die Beschäftigung mit dem Langtext in Erinnerung gerufen, insbesondere das immer noch fehlende Literatur- und Quellenverzeichnis, zu dem ein Entwurf auf SiWi-Archiv bereits veröffentlicht wurde.
Siegener Zeitung, 15.4.2021 berichtet zur gestrigen Ratssitzung leider nur im Print: „Tafeltext zu Fissmer endlich gebilligt. Breite Mehrheit im Rat für Kompromissformel. Trotzdem tauchen neue Zweifel auf.“ . „Geteasert“ wird mit folgendem Zitat: „Der Hl. Nikolaus war auch kein Demokrat, trotzdem ändert niemand die Bezeichnung Nikolaikirche gleich nebenan.“ (Martin Heilmann, Ratsglied der Grünen)
Zeitungen:
– Das Volk, „Bürgermeister Alfred Fissmer tritt sein Amt in Siegen an“, 19. August 1919
Siegener Nationalzeitung/Siegener Zeitung, „Siegen ist gestern Garnisonstadt geworden – Feierlicher Einmarsch des Infanterieregiments 57, 16. Oktober 1935
Siegener Nationalzeitung, „Richtfest für die Kasernengebäude auf dem Fischbacherberg in Siegen“, 11. September 1936
Es wäre auch möglich, den Namen zurück zu nehmen
und auf einer Tafel zu erklären, warum der Name zurück genommen wurde.
Wäre möglich…immer noch!
Dieser, aus meiner Sicht immer noch mögliche Schritt, ist ein Kompromiss mit den Menschen, die immer noch nicht verstehen wollen oder können, das ein „Fördermitglied der SS“ für eine Ehrung im öffentlichen Raum einer Stadt
vollkommen ungeeignet ist!
Literatur:
Sozial- und Versicherungsamt der Stadt Siegen (Hg.) „Vom Armenamt zum Sozialamt“ 100 Jahre Sozialamt der Stadt Siegen. Ein geschichtlicher Rückblick 1993, Siegen 1993
Hallo
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren!
Aus einem Nachlaß bekam ich ein Ölgemälde von Hermann Mannskopf.
56 x 77 cm plus 8 cm Rahmenbreite
Es stellt eine Landschaft dar, die wahrscheinlich im Siegener Umland zu finden ist. Gerne würde ich es an Interessierte weiter geben, nur habe ich keine Ahnung vom Wert des Bildes, noch woher ich seriöse Preisinformationen bekommen kann.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen
und danke Ihnen im Voraus.
„1. Es werden in kürzester Frist in ganz Deutschland Aktionen gegen Juden, insbesondere gegen deren Synagogen stattfinden. Sie sind nicht zu stören. Jedoch ist im Benehmen mit der Ordnungspolizei sicherzustellen, daß Plünderungen und sonstige besondere Ausschreitungen unterbunden werden können.
2. … (zu Archivmaterial in Synagogen)
3. Es ist vorzubereiten die Festnahme von etwa 20-30.000 Juden im Reiche. Es sind auszuwählen vor allem vermögende Juden. Nähere Anordnungen ergehen noch im Laufe dieser Nacht.“
…
(Geheimes Fernschreiben des Gestapa-Chefs Heinrich Müller an alle Gestapoleitstellen, 9.11.1938, 23.55 h)
„Geheim! Dringend!
… Für die Behandlung dieser Vorgänge ergehen die folgenden Anordnungen:
1. …
a) Es dürfen nur solche Maßnahmen getroffen werden, die keine Gefährdung deutschen Lebens oder Eigentums mit sich bringen (z. B. Synagogenbrände nur, wenn keine Brandgefahr für die Umgebung vorhanden ist).
b) Geschäfte und Wohnungen von Juden dürfen nur zerstört, nicht geplündert werden. Die Polizei ist angewiesen, die Durchführung dieser Anordnung zu überwachen und Plünderer festzunehmen.“
5. Sobald der Ablauf der Ereignisse dieser Nacht die Verwendung der eingesetzten Beamten hierfür zuläßt, sind in allen Bezirken so viele Juden – insbesondere wohlhabende – festzunehmen, als in den vorhandenen Hafträumen untergebracht werden können.“
(Blitz-Fernschreiben des Chefs der Sicherheitspolizei Reinhard Heydrich aus München an alle Stapoleitstellen und SD-Ober- und Unterabschnitte, 10.11.1938, 1.20 h)
„Funkspruch ssd Berlin Nr. 4 … [Chef der Ordnungspolizei, Kurt Daluege, 10.11.1938, 5.30 h]
…
2. Die Ordnungspolizei begleitet solche Demonstrationen und Aktionen nur mit schwachen Kräften in Zivil, um evtl. Plünderungen zu verhindern.
3. …
4. Zerstörte offene Läden, Wohnungen, Synagogen und Geschäfte von Juden sind zu versiegeln, zu bewachen, vor Plünderungen zu schützen.“
(zit. nach: Wolf-Arno Kropat, Kristallnacht in Hessen. Der Judenpogrom im November 1938 [Schriften der Kommission für die Geschichte der Juden in Hessen, Bd. 10], Wiesbaden 1988, S. 74-77, 189)
„Vielenorts entglitten die Aktionen der Straße der Kontrolle des Regimes. Göring geriet über die angerichteten Sachschäden außer sich. Mehrfach befahl Berlin im Laufe des Tages die Verhinderung von Plünderungen und die Verfolgung der Täter.“ (Anselm Faust, Die „Kristallnacht“ im Rheinland. Dokumente zum Judenpogrom im November 1938, [Veröffentlichungen der staatlichen Archive des Landes Nordrhein-Westfalen, Bd. 24], Düsseldorf 1987, S. 55)
Zu den angesprochenen Orten mit Plünderungen gehörte Laasphe. Plünderer wurden dort angezeigt und es kam zu Strafverfahren, wenngleich mit milden Strafen: Ulrich F. Opfermann, „Mit Scheibenklirren und Johlen“. Juden und Volksgemeinschaft im Siegerland und in Wittgenstein im 19. Und 20. Jahrhundert, Siegen 2009, S. 106)
Mindestens die unmittelbare Vorstufe der Plünderung ist auch für Siegen bezeugt: Das SS-Mitglied Walter Schleifenbaum, einer der später im Brandstifter-Prozess Verurteilten, erklärte in seinem Entnazifizierungsverfahren, in dem er ansonsten zum Thema ein generelles Nichtwissen behauptete, er haben beim den „Ausschreitungen gegen die Juden im November 1938 … auch das zertrümmerte Schaufenster eines jüdischen Geschäftes gesehen.“ (ebenda, S. 111; archivalische Quelle: LAV NRW, Abt. Rheinland, NW 1.112, Nr. 1.768)
So wurde es am 7.11.2010 im Gespräch in der Siegener NS-Gedenkstätte von der Zeitzeugin Hedwig Grimm (* 1931) bestätigt: Die Kölner Straße sei zumindest in einem Teilbereich am Pogromtag mit Scherben übersäht gewesen. Gegenstände seien aus Läden auf die Straße geflogen.
Fazit:
1. Wenn es zutrifft, wie der Zeitzeuge Hugo Herrmann behauptet und wie es inzwischen viele Male in die vorherrschende lokale Überlieferung eingegangen ist, dass nämlich die Verhaftung jüdischer Männer und deren Inhaftierung im Polizeigefängnis Siegen am 9. November 1938 geschah, dann kann es nur eine lokale Initiative ohne Rückendeckung von oben des Polizeichefs der Stadt, des OB Fissmer, gewesen sein. Das sollte es sein, was in den städtischen Texten werden kann.
2. Der Behauptung des Zeitzeugen Hugo Herrmann, der OB Fissmer habe die Initiative ergriffen, um Plünderungen zu verhindern, fehlt zunächst einmal jede Basis. Ganz unzutreffend ist die Behauptung, es sei Militär eingesetzt worden. Das war nirgendwo so. Weder bezieht sich der Sprecher Hugo Herrmann auf eine schriftliche noch auf eine mündliche Quelle, etwa ein Gespräch mit dem OB (das auch sehr unwahrscheinlich wäre). Das wurde Er trägt eine ungedeckte Überlegung vor. Die leider inzwischen viele Male in erweiterten Varianten als „bewiesen“ in die Überlieferung eingegangen ist.
Falls Fissmer in dieser Angelegenheit irgendetwas unternahm, ging es auf eine Anordnung von ganz oben zurück. Er hatte sich an die Vorgaben zu halten und zu schauen, dass andere sich daran hielten.
3. Der Fall liegt also exakt so, wie schon beim Bunkerbau. Das eine wie das andere und auch die Aussagen zu den Zerstörungen im Stadtzentrum sind als Pflichtbaustein in die vorherrschende Überlieferung eingegangen. Die dem entgegenstehenden und seit langem bekannten in der Literatur anzutreffenden Sachverhalte wären zwar auf kurzem Weg zugänglich, wurden und werden jedoch hartnäckig ignoriert. Es lässt der Eindruck sich nicht abwehren, dass sie für die stadtoffizielle Überlieferung nicht zugelassen sind, die es vorzieht, ihn als „deutschnational gesinnten Beamten“ darzustellen, der „eher den Parteien der politischen Mitte und des rechten Flügels zugetan war“ und „auch seit 1933 weiterhin als tatkräftiger Entscheider und Lenker der Siegener Kommunalpolitik“ aufgetreten (HP der Stadt Siegen) und also verehrungs-/erinnerungswürdig sei. Damit wird eine vergangenheitspolitisch unglaubwürdige durchlaufende „demokratische“ Kontinuität des OB von Weimar bis heute festgeschrieben, die ihn als herausragenden Namenspatron für den zentralen Platz der Stadt akzeptabel sein lässt.
Danke für die Klarstellungen, die sich u. a. auf die im Kreisarchiv vorhandenen 30min Video-Interview aus dem Jahr 1981 (Signatur: KrA 4.1.5./39) mit Hugo Herrmann gemachten Aussagen Herrmanns zur Pogromnacht 1938 beziehen! Eine entsprechend gekürzte Version des Videos ist hier einsehbar: https://youtu.be/BSWLjMkxAy8
Die Geschichte hinter der Siegener Neuen Zeitung und ihres Hauptschriftleiters Gärtner ist allerdings noch spannender, vor allem, da der stellvertretende Landrat als Investor fungierte… .
Zur Aufarbeitung und Dokumentation der bedeutsamen regionalen Industriegeschichte ist die Einrichtung eines Industriemuseums im Siegerland an einem historisch authentischen Ort unbedingt erstrebenswert. Es ist erfreulich, dass auf den Antrag der FDP Fraktion eine positive Reaktion des Kreisausschusses erfolgte mit Gründung einer Arbeitsgruppe „Industriemuseum“.
Den Aktiven und Beteiligten an der Maßnahme wünsche ich ein interessantes Betätigungsfeld, ein gutes Miteinander, Durchsetzungsvermögen und Erfolg.
wir hoffen, dass der neue Arbeitskreis des Kulturausschusses hier Vorarbeit leistet. Natürlich wäre die Ausgrabungsstelle Gerhardsseifen (Niederschelden) ein guter Standort. Aber auch das Technik Museum in Freudenberg oder die mittelalterliche Bergbausiedlung Altenberg (Hilchenbach) vorstellbar.
In der Siegener Zeitung erschien heute der Leserbrief „Vorarbeiten sind da“, der auf die eisengeschichtliche Ausstellung in Haus Pithan in Netphen verweist und zudem die Bedeutung des Stahlbaus im Siegerland betont, wie sie an einer Eisenbahnbrücke in Dreis-Tiefenbach zu erkennen sei. Die Brücke wurde im Siegerland hergestellt und 1905 inDienst genommen. Schließlich verweist der Leserbrief darauf, dass Industriegeschichte im Siegerland mit Mitteln des sanften Tourismus erfahrbar gemacht werden solle.
M. W. sind noch Exemplare der 1986 erschienenen beiden Bildbände noch im Buchhandel zu erwerben. Ob eine Neuaflage erfolgt oder gar eine aktuelle Auseinadersetzung mit dem Werk Arnolds, kann ich derzeit nicht absehen.
Ein neuer Versuch, diesmal von der FDP. Sie möchte im Siegerland einen weiteren Standort der LWL-Industriemuseen sehen, von denen sich, nach FDP-Aussage, acht im Ruhrgebiet „knubbeln“. Nur nebenbei: Meine geografischen Kenntnisse führen zu einem anderen Ergebnis!
Bemerkenswert und diskussionswürdig ist aber der Gedanke, „ein LWL-Industriemuseum zur frühindustriellen Geschichte“ in das Siegerland zu holen. Nach meinem Verständnis wäre das eine Einrichtung, die den Zeitraum – grob gesprochen – vor 1850 abdecken würde. Damit würde eine weitgehende Doppelung mit dem LWL-Museum Henrichshütte in Hattingen ausgeschlossen, die für die Zeit nach 1850, das Industriezeitalter, steht.
Einen geeigneten Standort für den FDP-Vorschlag zu finden, dürfte schwer werden. Ich halte ihn gar für unmöglich. Alle alten Hüttenstandorte sind plattgemacht, was wiederum Ausdruck fehlenden Geschichtsbewusstseins ist. Ein Ausweg bietet sich aber an, verlangt aber größere Anstrengungen aller Beteiligten, weil die Vernetzung der regional bereits vorhandenen Einrichtungen wie Historischer Hauberg Fellinghausen, Bergbaumuseum Sassenroth, Wendener Hütte usw. über Landesgrenzen von NRW hinaus erforderlich wäre. Unter einem gemeinsamen Motto, z.B. „nachhaltiges Wirtschaften“, könnten diese Standorte ihre inhaltlichen Schwerpunkte ausbilden und miteinander verbinden. Davon würden zudem alle Einrichtungen profitieren.
wir würden sogar viel früher ansetzen, die Region zwischen Wissen und Siegen ist schon in der Keltenzeit eng mit der Eisenerzverarbeitung verbunden. Hier würde ich ansetzen.
Lieber Herr Müller,
ich habe von vor 1850 geschrieben, das deckt doch alle interessanten Zeiträume davor ab, es bleibt nur die geschickte Integration aller potentiellen Standorte unter ein gemeinsames Thema.
Noch eine Nachfrage: Sind „maßgebliche Region“, größte bekannte Verhüttungsöfen und „eine der ältesten Industrieregionen“ oder das Fehlen eines LWL-Standortes im südlichen Südwestfalen hinreichende Gründe für ein Museum?
Der oben verlinkte Text auf der Homepage des Siegen-Wittgensteiner Kreisverbandes der FDP findet sich nun auch auf der Facebook-Seite der FDP-FW-Fraktion im Landschaftsverband Westfalen-Lippe:
Etwas despektierlich gegenüber den anderen Berufen.
Zwar habe ich als Bibliothekar keine so breite Palette an Sachen zu erschließen, obwohl die immernoch von Büchern aller Art über Karten bis zu Switch-Spielen oder Nähmaschinen reicht, aber im Grunde ist meine Aufgabe die Gleiche.
Ich erschließe ein Medium und versuche es so in Zusammenhang zu setzen, dass es nicht nur leicht gefunden werden kann, sondern auch, dass die Kunden leicht weitere Medien zu dem Thema oder von dem Autor uvm. finden können.
Ich sehe da keinen so gravierenden Unterschied, dass man sich so äußern müsste.
Offensichtlich hat sich das ein Archivar*in ausgedacht und umgesetzt, ohne links und rechts zu sehen oder gar mal einen Bibliothekar oder Museologen zu Rate zu ziehen.
Ich finde es schade, dass wir uns in der gemeinsamen Branche so wenig interdisziplinär austauschen.
Leicht vereinfacht?
Als Bibliothekarin, die sich jahrelang mit Sacherschließung und inhaltlicher Erschließung grauer Literatur sowie Fachartikeln usw. auseinandergesetzt hat, würde ich Herrn Beer zustimmen und von einer sehr starken Vereinfachung in oben zu sehender Darstellung sprechen. Die Idee mit dem Video finde ich gut, die Umsetzung aber nicht so glücklich.
MfG, Almuth Fröhlich
In der Westfäischen Rundschau erschien heute der Artikel „Grossprojekt: Vorstoss für LWL-Museum zur Industriegeschichte im Siegerland“ – leider nur Print. Der Artikel gibt im wesentlich den Antrag der FDP wieder. Er verweist allerdings auch auf die Diskussion im Kreisausschuss, wenn es um die Frage der Unterbringung eines solchen Museums geht.
Guten Tag Frau Voss-Shabanzadeh,
mein Vater hat einige „Klassiker“ auf Anfrage von Interessenten
kopiert, in der Zeit in Dresden, auch während des Studiums.
Das gehörte in der Kunst-Aka Dresden zur Ausbildung.
In der „Freudenberger Zeit“ allerdings nicht so oft.
Es freut mich, daß Sie noch eine Kopie des Tizian Gemäldes Ihr Eigen nennen.
Beratungsverlauf im Kreisausschuss,
„Beratungsverlauf:
Landrat Müller führt gemäß der Vorlage und der dazu ergangenen Ergänzung aus.
KT-Mitgl. Müller ergänzt, dass er das Thema bereits mit dem Kreisarchivar diskutiert habe. Dieser sehe das Problem eines möglichen Wegfalls von Förderungen in kleinen Museumsprojekten, wenn ein LWL-Museum entstünde. Aus anderen Bereichen sei ihm aber bekannt, so KT-Mitgl. Müller, dass Museen auch bei Ergänzung durch ein LWL-Museum weiterhin unterstützt würden. Er sei sich bewusst, dass im Falle eines LWL-Museums der LWL das Sagen habe. Mit Gerhardseifen, mit Freudenberg und dem Altenberg,zwischen Kreuztal und Hilchenbach,gäbe es Potenzial für das Thema. Er spreche sich für einen heutigen Startschuss aus, um das Thema weiter im Fachausschuss diskutieren zu können. Eine dann zu gründende Arbeitsgruppe könne vielleicht im kommenden Jahr bereits erste Ergebnisse liefern.
KT-Mitgl. Sittler stimmt den Aussagen von KT-Mitgl. Müller zu. Er ergänzt, dass es auch Gründe gebe, warum in anderen Regionen mehr gemacht werde. Die Hauptfragen, was soll wie und wo dokumentiert und gezeigt werden, sollten im Arbeitskreis besprochen werden. Dies müsse zusammen mit dem LWL abgestimmt werden. Die bisherigen Versuche seien gescheitert, daher spreche er sich für eine Befassung im Kulturausschuss sowie einer Arbeitsgruppe aus.
Auch KT-Mitgl. Droege signalisiert seine Zustimmung. Der Wirtschaftsraum „Siegerland“ im Drei-Länder-Eck sei die Wiege der Industrie in NRW, nicht das Ruhrgebiet. Zudem gebe es im LWL einen Diskurs darüber, ob zentrale Museumseinrichtungen oder das Konzept dezentraler Stätten verfolgt werden solle. Der Kreis habe viele interessante dezentral Punkte, unter Anderem z. B. auch die Laténeöfen, weshalb es für die Region und für den LWL ein wichtiges Konzept darstelle, welches diskutiert werden müsse. Das dezentrale Erbe stehe oft alleine ohne Verbindung da. Diese Stätten sollten verknüpft werden undkönnten überregional besser vermarktet werden sowiebesser zur Geltung kommen.
KT-Mitgl. Helmkampf erklärt, dass dem Gremium in Münster auch bereits ein Antrag vorgelegt worden sei. Es müsse nun aufgepasst werden, dass es keine „Kollision“ gebe. Er spricht sich ebenfalls für den Antrag der FDP-Fraktion aus. Zwar werde solch ein Thema nicht in Kürze abgewickelt, dennoch sei es von Wichtigkeit für die Region.
KT-Mitgl. Müller ergänzt dazu, dass die Anträge im Vorfeld abgestimmt worden seien.“
Quelle: Kreis Siegern-Wittgenstein, Kreistagsinformationsystem, Kreisausschuss, Öffentliche Niederschrift der Sitzung vom 30.4.2021, S. 7
Hallo, habe im Nachlass meiner Oma ein Gemälde von S.R. Vogt gefunden.
Auf der Rückseite steht „Matterhorn „. Bin hier auf diese Seite gestoßen. Wäre interessant näheres zu erfahren. Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Schöne Grüße aus der Rhön
D. Fuchs
Es handelt sich wohl nicht um den hier vorgestellten Siegfried Vogt, de in der Regel nicht mit S.R. Vogt signiert hat. Ein Blick in kunsthistorische Lexoka – angefangen mit dem Thieme/Becker – sollte Klarheit verschaffen, welcher Künstler in Frage kommt.
Guten Tag. Ich recherchieren die Auswanderung einer 7 koepfigen Familie im Jahr 1881, von Brandoberndorf nach Amerika. Leider konnte ich auf eine Frage bisher keine Antwort finden : wie reiste die Familie nach Hamburg? Wie lange dauerte diese Reise und gibt es Anhaltspunkte zu den Kosten?
Ich wuerde mich sehr freuen., wenn sie mir weiter helfen könnten.
Herzlichen Dank im voraus und mit freundlichen Grüßen
Karin Guterding
Guten Tag Frau Guterding,
die Literatur zur Auswanderung, speziell zur Auswanderung aus Hessen, ist mittlerweile schon sehr umfangreich. Dort finden Sie etliche Aufsätze und Bücher, die Ihnen weiterhelfen und Einblicke vermitteln, wie die erste Phase der Auswanderung zwischen Heimatort und Hamburg verlief. Ob dort auch Angaben zu Brandoberndorf gemacht werden, müssen Sie dann noch ermitteln. Folgen Sie zunächst diesem Link: https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/gsearch/sn/hebis?q=Auswanderung&submit=LAGIS-Suche.
Ich versuche es nochmal ;-)
Gegenstand: Es handelt sich um eine Förderschnecke.
Hersteller: Karl Adolf Welsch Apparatebau GmbH
Jahr des Fotos: 1961 (Neugündung des Unternehmens in Eiserfeld)
Ergänzung:
„Flender & Co“, 1910 in „Eiserfeld bei Siegen“ gegründet, spätere Marke „Siegperle“
Umzug in ein größeres Fertigungsgebäude 1918, aus dieser Zeit könnte das Foto auch stammen.
Ich hatte auch die Firma Heinzerling (Fördertechnik) im Blick, die haben früher auch so etwas gebaut.
Die Frage ist schon sehr nahe an der „Millionenfrage“ dran…….
Die gesuchte Firma lag eindeutig einer Nachbarkommune der heutigen Stadt Siegen und ist jünger als die in der Antwort angegebenen Jahreszahlen.
Generell gilt ohne Fleiß kein Preis …..
Sorry, ich denke eine Partei möchte sich hier in Erinnerung rufen und ohne konkrete Pläne und Finanzierungszusagen Aufmerksamkeit „erzeugen“. Fordern und kritisieren (wie in den vergangenen Wochen) geht ja immer, hauptsache Öffentlichkeit. Pläne für ein Museum lagen z.B. beim Reinhold-Forster-Stollen bereits vor. Die Umsetzung konnte bis heute aus verschiedenen Gründen nicht realisiert werden. Leider. Glück Auf P.S. „FDP: Die Verwaltung wird beauftragt, Möglichkeiten eines weiteren Standorts der LWL-Industriemuseen mit Blick auf die kulturhistorische Bedeutung der Eisenverhüttung in der Region des Siegerlandes zu prüfen. Die Verwaltung wird im Kreis Siegen-Wittgenstein nach möglichen Kooperationspartnern suchen, mit denen sich eine erweiterte Darstellung der Industriegeschichte Westfalens umsetzten ließe.“ … Wahlkampf!
Danke für den Kommentar! Wann waren die Pläne um den Reinhold-Forster-Erbstollen akut? Mir bekannt sind Ideen aus dem Jahr 1984 zur Nutzung des Alten Brauhauses in Siegen und Diskussion um das Jahr 2000.
Die Betrebungen der FDP-Kreistagsfraktion sind ja recht anerkennenswert, jedoch stellt sich hier die Frage, warum die „Polit-Aktivisten“ sich bisher denn niemals um dieses schon jahrzehntealte Thema gekümmert haben. Ist denn niemandem bisher aufgefallen, dass es keinen authentisch historischen Ort innerhalb des Siegerlandes mehr gibt, wo noch irgendein Original Zeugnis der alten Montan-Industriekultur erhalten geblieben ist. Einen geeigneten verkehrsgünstigen historischen Ort für den erforderlichen Neubau, oder Ausbau eines Siegerländer-Industriemuseums kann man vielleicht ja u.U. noch finden (s.a. div. Vorschläge i.d. Literatur), aber man wird vom LWL oder der NRW-Landesregierung sicher keinerlei finanzielle Unterstützung erwarten können, wenn sich nicht zuvor die Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Siegen einig wird, um gemeinsam einen bestgeeigneten Ort für ein derartiges Industriemuseum als Außenstelle des Siegerlandmuseums im Siegerland (und nicht ausschließlich in der Stadt Siegen) zu finden.
Die Latenezeitlichen Ausgrabungen in Niederschelden- Gerhardseifen liegen dafür wohl verkehrsmäßig etwas zu ungünstig.
Die Bestrebungen der Stadt Siegen den Burgstraßenbunker für eine Erweiterung des Siegerlandmuseums (Abt. Siegerländer Montan-Industriekultur) für über 16 Mio Euro mit Landes-Steuermitteln erst einmal publikumsbegehbar zu machen, ohne auch nur einen einzigen historischen örtlichen Bezug zum Thema und auch nebenbei ohne die erforderlich günstige Verkehrsanbindung bieten zu können, sollte doch zumindest Herrn Landrat Müller und eigentlich auch der FDP-Kreitagsfraktion bekannt sein.
Es wäre eigentlich recht schade, wenn sich diese begrüßenswerte Aktivität mehr oder weniger nur als eine Wahl-Werbung der Kreistags-FDP herausstellen sollte.
Danke für den Kommentar! Die Skepsis mag angebracht sein, nicht bezüglich der regionalen Bedingungen, sondern auch bezüglich der Einbettung eines solchen Projektes in die LWL-Museumsstrategie.
Weitere Funde:
– Bundesarchiv Berlin, R 1501[Reichsministerium des Innern] Nr. 8204, enthält: Aufhebung der Abordnung des Oberlandrats von Rumohr zum Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete, 1942
– Bundesarchiv Ludwigsburg, B 162 [Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen] Nr. 26009, Anzeige der VVN gg. den Präsidenten des Bundesverwaltungsamtes, K. von Rumohr, wg. mutmaßlicher Beteiligung an der Deportation der jüdischen Bevölkerung als Oberlandrat in Mährisch-Ostrau im Jahre 1939, 1964 – 1966
– Bundesarchiv Koblenz, N 1086 [Nachlass Hermann Louis Brill] Nr. 45, Korrespondenz Buchstaben A – F, 1955, enthält u. a..: Bundesausgleichsstelle beim Bundesministerium des Innern, Schriftwechsel mit Ministerialrat von Rumohr
– Bundesarchiv Berlin, R 9361-II [Sammlung Document Center] Nr. 862970
– Bundesarchiv Berlin, VBS 1027 (R 6)/ZD I 3597 [Personalakte 1941 – 1942]
– Kreisarchiv Märkischer Kreis, F 2670, Landrat Karl von Rumohr, sw-Foto
Literatur:
– Bundesverwaltungsamt (Hg.): 50 Jahre BVA, Köln 2010, S. 18-19, Link
– Herrmann A. L. Degener, Walter Habel: Wer ist wer? Band 13. Schmidt-Römhild, 1958, S. 1075.
– Palm, Stefanie/Stange, Irina: Vergangenheiten und Prägungen des Personals des Bundesinnenministeriums, in: Bösch, Frank/Wirsching, Andreas (Hrsg.): Hüter der Ordnung. Die Innenministerien in Bonn und Ost-Berlin nach dem Nationalsozialismus (= Veröffentlichungen zur Geschichte der deutschen Innenministerien nach 1945, Bd. 1), Göttingen 2018, S. 122-181
– Stockhorst, Erich : Fünftausend Köpfe: Wer war was im Dritten Reich? Blick + Bild Verlag, 1967, S. 354.
Literatur:
– Dröge, Martin: Die Tagebücher Karl Friedrich Kolbows (1899 – 1945). Nationalsozialist der ersten Stunde und Landeshauptmann der Provinz Westfalen, Paderborn 2009, S. 513
Archivalien:
– Institut für Zeitgeschichte–Archiv MA 246 [Besetzte Gebiete Ost]/ 1, 1937-1945, enthält u.a.: Ernennung Oberlandrat Rumohr zum Abwehrbeauftragten für das Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete (mit Rundschreiben vom 06. Januar 1942), 205-206, 339
– Kreisarchiv des Märkischen Kreises, LA Is A / Landratsamt Iserlohn Bestand A, Nr. 263, Besetzung der Landratsstelle, 1912 – 1938, enth. u.a.: Antrittsschreiben des stellvertretenden Landrats von Rumohr,1935
Bei der Abbildung des Artikels von Gamann ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Anstatt die Seite 178 als weitere Kopie mit einzubinden, folgt eigentümlicherweise die Seite 176, auf der aber das Museum im Oberen Schloss thematisiert wird. Das lässt sich sicherlich leicht beheben und aktualisieren.
Ich habe ja hier bereits auf den Fissmers Beteiligung am Kulturgutschutz hingewiesen. Vielleicht lohnt auch hier noch eine weitere Forschung, denn neben den rheinischen und westfälischen Kulturgüter war im Hainer Stollen auch Kulturgut aus Metz untergebracht. Eine Provenienzforschung ist m.E. angezeigt. Denn dann könnte es wieder ein sowohl als auch geben: Fissmer der mittelbare Kulturgutschützer und der mittelbar Beteiligte am NS-Kunstraub. (Einstiegsliteratur (!): Robert M. Edsel/Bret Witter: Monuments men. Die Jagd nach Hitlers Raubkunst, St. Pölten 2013)
Herr Lohrum mein Name ist Sigi Gomez und ich werde am 21.7
60 Jahren inGEISWEID. Meine Frage: Sind Sie der Meinung dass ich auch habe mein Beitrag geleistet zur der Erhaltung der Stahlwerk Südwestfalen?
Auszug aus der Niederschrift der LWL-Kulturausschusssitzung vom 9.6.2021:
“ ….. Herr Arens (FDP) erläutert, dass es ein Defizit gebe, was den Inhalt in Bezug auf die Industriegeschichte im Siegerland angehe. Zudem sei der LWL dort bisher nur schwach vertreten. Herr Stilkenbäumer (CDU) begrüßt den Antrag der FDP. Das Siegerland falle hinter der Förderung anderer Regionen zurück. Da in der Region aber auch noch andere Aspekte beleuchtet werden müssten, solle der Beschlussvorschlag angepasst werden. Frau Dr. Rüschoff-Parzinger (LWL) weist darauf hin, dass ein kulturpolitisches Konzept erarbeitet worden sei, in dem auch festgestellt wurde, dass Südwestfalen weniger repräsentiert sei. Sie halte es also für sinnvoll den gesamten Bereich zu beleuchten. Die Errichtung eines weiteren Standorts des LWL-Industriemuseums, die die FDP-FW-Fraktion in ihrem Antrag gewünscht habe, könne als Beispiel mit in den Antrag aufgenommen werden. Frau Hegerfeld-Reckert (SPD) macht den Vorschlag, dass die Anträge zukünftig digital über die Beamer angezeigt werden. Frau Rüschoff-Parzinger hält dies für sinnvoll.
Nach eingehender Diskussion einigt sich der Kulturausschuss auf einen Kompromiss zwischen dem Vorschlag von Herrn Stilkenbäumer und dem Antrag der FDP-FW-Fraktion und empfiehlt dem Landschaftsausschuss einstimmig folgenden Beschluss:
„Die Verwaltung wird auf Grundlage des kulturpolitischen Konzeptes beauftragt, dem Kulturausschuss einen Bericht über die kulturelle Infrastruktur in Südwestfalen zu geben und zu prüfen, ob Möglichkeiten zur Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen dem LWL und den schon vorhandenen kulturbedeutsamen Infrastrukturen in Südwestfalen bestehen. Unter anderem soll die Möglichkeit eines weiteren Standortes der LWL-Industriemuseen mit Blick auf die kulturhistorische Bedeutung der Eisenverhüttung in der Region des Siegerlandes geprüft werden.“
Quelle: LWL, Sitzungsdienst
Zur politischen Situation in Brilon um 1930 s.: „Ganz besonders schwierig gestaltete sich für die Nationalsozialisten der Aufbau der Partei im Kreis Brilon. Die Gauchronik berichtet, dass es in diesem Kreis bis ins Jahr 1930 nicht möglich gewesen sei, irgendeine nationalsozialistische Organisation aufzuziehen. Die Bevölkerung sei zu 100 Prozent in den katholischen Einrichtungen und in der kirchlichen Gewerkschaft organisiert gewesen. Von Arnsberg aus angesetzte Versammlung seien völlig ergebnislos verlaufen. Erst durch die Weltwirtschaftskrise und die damit verbundenen sozialen Auswirkungen auf die Bevölkerung gewann die NSDAP im Kreis Brilon allmählich an Boden.
Zentrum der politischen Agitation entwickelte sich nicht die Kreisstadt Brilon, sondern die Stadt Olsberg“. in: Schulte-Hobein, Jürgen: Zwischen Demokratie und Diktatur – der Aufstieg des Nationalsozialismus in der Kreisverwaltungen des Hochsauerlandes. In: Der Landrat: Werden. Wachsen.
Wirken. Vom Wandel der Zeit – Kreisverwaltung im Hochsauerland von 1817 bis 2007, Arnsberg 2007, S. 178f. Danke an das Archiv des Hochsauerlandkreises für das Zitat!
Es gibt noch auszuwertende Berichte über die Produktion und Verteilung von Flugblätter durch Mitglieder der katholischen Kirchengemeinde St. Marien auch über die erwähnten „Christenkreuz und Hakenkreuz“- Exemplare hinaus, auch über konspirative Treffen von katholischen Lehrern in der Gaststätte auf der Eremitage. Zusammen mit der besonderen Rolle von Pfarrer Ochse dürfte der Führungskreis der Gemeinde unter besonderer Beobachtung gestanden haben, um dann bei der erwähnten Aktion Gewitter arrestiert zu werden. Es wäre sehr spannend, die Rolle der Kirchengemeinde und der ehemaligen Zentrumsmitglieder – auch im Hinblick auf die später entstehende CDU – nochmals genauer unter die Lupe zu nehmen. Ich vermute, auch ohne das Etikett Widerstand übermäßig zu strapazieren, könnte es hier interessante Ergebnisse geben.
Laut E-Mail des Stadtarchivs Ostrava v. 21.7.2021 erscheint Rumohr nicht in der dort vorhandenen deutschen bzw. tschechischen Zeitungen. Lediglich im Findbuchwort des Bestandes „Oberlandrat Mährisch-Ostrau“ wird Rumohr erwähnt; demzufolge trat er Mai 1939 seine Stelle der an. Der erwähnte Bestand befindet sich im Provinzialarchiv in Opava – es wurde bereits angeschrieben.
Vielen Dank für den Eintrag. Ich hatte das Thema „Ehrung von Gerhard Stötzel in seinem Geburtsort Grissenbach“ ja in einem Leserbrief angesprochen, der am 26. Juli 2021 in der Siegener Zeitung veröffentlicht worden ist. Der Dorfplatz neben der katholischen St. Elisabeth-Kapelle hat ja bisher noch keinen Namen. Da bietet sich ein Gerhard-Stötzel-Platz ja geradezu an. Ich bin sehr gespannt, wie sich die sonst ja leider heillos zerstrittenen Netphener Kommunalpolitiker*Innen in dieser Angelegenheit positionieren werden.
Ich finde es hervorragend, dass diesem verdienten Siegerländer endlich die ihm gebührende Ehre (hoffentlich) zuteil wird.
Es wäre zu überlegen, ob und wie weitere Würdigungen im Siegerland erfolgen können.
Die Kölnische Zeitung ist von 1803 bis 1945 online im Volltext recherchierbar – https://zeitpunkt.nrw/ulbbn/periodical/titleinfo/9715711. Eine erste Recherche zu Fissmer ergab einige Treffer – u.a. auch diesen vom 21.8.1944:
s. a. diesen Hinweis des Siegener Stadtarchivs aus dem Jahr 2013: „Bereits 1936 wandte sich die Stadt Siegen auf Anregung eines in Hamburg lebenden Heinrich Irle an die Hapag in Hamburg und den Norddeutschen Lloyd in Bremen mit der Bitte eines ihrer Schiffe auf den Namen „Siegerland“ zu taufen. Zitat aus der Antwort des Norddeutschen Lloyd an den Herrn Oberbürgermeister: „Daß auch die Stadt Siegen und das Siegerland den Wunsch besitzt, den Namen ihres Landes durch ein deutsches Schiff vertreten zu sehen, ist begreiflich, zumal dieser Name, wie Sie selbst sagen, noch wenig bekannt ist. Aber gerade aus diesem Grund dürfte der Name ‚Siegerland‘ bei der Einstellung der Welt zu unserem deutschen Vaterlande im Auslande ganz anders ausgelegt und ihm eine Bedeutung gegeben werden, die keinesfalls erwünscht sein kann. Sie werden daher auch verstehen, wenn wir aus diesem Grunde Ihrer Bitte … nicht entsprechen können.“ (Quelle: Stadtarchiv Siegen, Best. Stadt Siegen D 313)“, Link: http://www.siwiarchiv.de/taufe-schiff-siegerland-1/
Zur Causa Stadtarchiv München gibt es eine neu Entwicklung s. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-stadtarchiv-streit-chef-1.5370533 . Zitat: „…. Der langjährige Chef des Archivs, Michael Stephan, hätte zwar lieber auch die Geschichts- und Erinnerungsarbeit auf Dauer in seiner früheren Behörde gesehen, doch mit dem jetzt erzielten Ergebnis sieht er das Schlimmste abgewendet. Lieber „ein schlechter Kompromiss“ als gar keiner, sagte er. ….“ [Anm.: Hervorhebung durch archivar]
Das ist natürlich ein alter Trainingsdiskus, anlässlich der Olympischen Spiele …..
Bitte keine Rückfragen des Archivars, wem der denn gehört haben könnte, und wer das Foto gemacht hat.
Danke für Ihre Nachricht. Ich habe Ihren Text der Familie und unseren Freunden weitergeleitet und immer ein positives feedback erhalten.
Ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfüllung in Ihrer Tätigkeit.
Wolfram Vogt
Mit einer Email v. 4.8. verweist das Landesarchiv Opava auf folgende Literatur:
– Naudé, Horst: Erlebnisse und Erkenntnisse. Als politischer Beamter im Protektorat Böhmen und Mähren 1939-1945, München 1975, S. 28, 109, 138
– Kokošková, Zdeňka/Pažout, Jaroslav/Sedláková Monika: Úřady oberlandrátů v systému okupační správy Protektorátu Čechy a Morava a jejich představitelé, Dolní Břežany 2020, S. 133 – 135 [Biogramm Rumohrs mit Bild und Quellenangaben]
– Link zum Bestand „Oberlandrat Mährisch Ostrau“ im Landesarchiv Opava: https://digi.archives.cz/da/permalink?xid=66b2f14a85958f4b0ff6e8ae1ca6c2be
… Wie Herr Vogt dazu kam, in die NSDAP einzutreten? Das wage ich nicht zu beurteilen, ob er einen Weg daran vorbei hätte wählen können. Das waren nur wenige, die sich da schon entgegen stellten.
In den 70er Jahren war er mein Lehrer. Er war einer der wenigen, die über die NS-Zeit und den Krieg sprachen. Er warnte vor den Anfängen, der Aufrüstung und dem Kriegsdienst, und zwar klar und deutlich und sehr persönlich.
Er erzählte davon, wie der Krieg die Menschen und die Menschlichkeit ruiniert.
Vielleicht eine späte Erkenntnis, zu spät für die eigene Biographie… aber gut für die nächste Generation.
Nochmals bedanke ich mich für Ihre Erinnerungen an Siegfried Vogt! Erlauben Sie mir eine Nachfrage: können Sie sich erinnern, ob Vogt sich auch Ihnen gegenüber über seine Zugehörigkeit zur NSDAP geäußert hat?
Ausnahmsweise (siehe oben) kein Kommentarspam, sondern schonungslose Kritik. Die Liste ist schon deshalb unbrauchbar, weil eine für eine Fernleihbestellung essentielle Angabe fehlt, nämlich das zur Nummer gehörige Jahr.
„Der Henner-und-Frieder-Comic am Siegufer zieht um. Das Kunstwerk des Jugendkulturvereins „Jugend mal anders“ erhält an der Universität Siegen ein neues Zuhause. ….“ s. Universität Siegen, Pressemitteilung, 6.8.2021, Link: https://www.uni-siegen.de/start/news/oeffentlichkeit/951084.html
Mit seiner Email v. 4.8. verweist das Landesarchiv Opava auf Unterlagen im Tschechischen Nationalarchiv in Prag zu Karl von Rumohr:
– NA, NSDAP sign. 123-530/4 kart 4
– NA, URP sign. 114-2/43 kart. 7 and
– NA URP-ST sign. 109-4/347 kart. 30.
Die Hefte 1 bis 4 erschienen 1977.
Die Hefte 5 und 6 erschienen 1978.
Die Hefte 7 bis 9 erschienen 1979.
Die Hefte 10 und 11 erschienen 1980.
Die Hefte 12 bis 14 erschienen 1981.
Die Hefte 15 und 16 erschienen 1982.
Die Hefte 17 und 18 erschienen 1983.
Die Hefte 19 und 20 erschienen 1984.
Die Hefte 21 und 22 erschienen 1985.
Die Hefte 23 und 24 erschienen 1986.
Die Hefte 25 und 26 erschienen 1987.
Die Hefte 27 und 28 erschienen 1988.
Die Hefte 29 und 30 erschienen 1989.
Auch das „Orts-Gesetz über die Benutzung der Wasserleitung des aus den Gemeinden Krombach, Eichen und Stendenbach bestehenden Zweckverbandes vom den 1. September 1910 ist in der Zwischenzeit von der ULB Münster online gestellt worden: https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6:1-423864
s. a.
Heisener, Kornelia: Carmen Klein, in: Auf den Spuren der Siegenerinnen / Hg. vom Frauenrat der Univ.-Gesamthochschule Siegen. – Siegen, 1996. – S. 75-76
Siegener Zeitung, Jahrgang 99, Nr. 210, 08.09.1921, „Siegerländer Heimatkunst. September-Ausstellung des Siegerländer Heimatvereins. Fritz Kraus – Deuz, ElisabethSchneider – Weidenau, Carmen Klein – Siegen, Zarita Heupel – Siegen“
Siegener Zeitung Jahrgang 105 Nr. 65, 18.03.1927, „Kunstausstellung im Hause der Gesellschaft Erholung Siegen, Obergraben 3.“ [u.a., Hans Achenbach, Hanna Achenbach-Jungemann, Carmen Klein, Loty Caubet-Mehler]
Siegener Zeitung, Jahrgang 97, Nr. 303, 29.12.1919 [Radierungen zweier Künstlerinnen. Carmen Klein, unter anderen die St. Michaelskirche in Siegen ….]
Noch ein Hinweis zur Jacob-Nolde-Straße:
Sie befindet sich leider nicht mehr dort, wo sie einmal war. Die Ratsvertreter der Stadt Berleburg hatten 1916 aus Dankbarkeit die damalige und heutige Poststraße in „Jacob-Nolde-Str.“ umbenannt. (Wittgensteiner Kreisblatt vom 26.08.1916). Im Mai 1937 hielt sich Hans Nolde, Sohn des Stifters zu einem Besuch in Berleburg auf. Damals gab es noch die Straße, die seinem Vater gewidmet worden war (National-Zeitung vom 14. Mai 1937). Diese Ehrung Jacob Noldes in Berleburg währte zunächst nur 22 Jahre und sieben Monate. In der Stadtverordnetensitzung vom 9. Januar 1939 sah sich das Ratsmitglied Dr. Nölke veranlasst, einem der damals führenden NS-Politiker ein lokales Geburtstaggeschenk zu bereiten. Er stellte einen Antrag auf Umbenennung der Jacob-Nolde-Straße, der in gleicher Sitzung stattgegeben wurde. Am 12. Januar 1939, dem Geburtstag Görings, erhielt die Straße den Namen Hermann-Göring-Straße (NZ vom 12. Januar 1939); nach Kriegsende 1945 wurde das Straßenschild dieses Kriegsverbrechers auch in Berleburg wieder entfernt. Den Namen Jacob Nolde verlagerte man allerdings in eine Seitenstraße…offenbar nach Kriegsende.
Zum Sohn Dr. Albrecht Czimatis:
Czimatis, Albrecht (Adolf Heinrich Peter) *18. April 1897 Kattowitz (Oberschlesien), †22. Dezember 1984 Freiburg; ab 1915 Kriegsteilnehmer, später Reichswehr: Leutnant, Oberleutnant, Hauptmann; Dipl.-Ing.; Diss.: „Rohstoffprobleme der deutschen Aluminium-Industrie im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Entwicklung“ (Dresden-Lockwitz 1930: Welzel, 126 S.);
Ref./Korref.: Gehrig / E. Müller; Dr.-Diplom der TH Dresden
vom 10. Jan. 1930, Dr.-Ing.; militärische Laufbahn: zwischen 1931
und 1934 Batteriechef, 1935 zum Major befördert, im Januar 1939
zum Reichsministerium für Wirtschaft kommandiert, Leiter der
Reichsstelle für Wirtschaftsausbau; im 2. WK: Oberstleutnant,
Oberst, zuletzt Divisionskommandeur, mehrfach ausgezeichnet,
Februar 1943 sowjetische Gefangenschaft; nach dem 2. WK hohe
Position in der Industrie der BRD; Schrift: Czimatis, Albrecht:
Energiewirtschaft als Grundlage der Kriegswirtschaft. Schriften
125 zur kriegswirtschaftlichen Forschung und Schulung, 1936 Ham-
burg (Hanseatische Verlagsgesellschaft)
Quellen: J 1930; SLUB – Dissertation; Alumnidatei; http://www.50-infanterie-
division.de/Personen/Czimatis-Albrecht.htm; Nr. 15267, hinten innen lose inliegende Blätter
Das Land NRW hat in 75 Jahren viel geleistet und eine Einheit verschiedener Landesteile zustande gebracht, ohne die traditionellen Unterschiede zu vermischen. Rheinische Lebensfreude und westfälische Eindeutigkeit haben zu einer hervorragenden Einheit gefunden. Es gibt heute wirklich etwas zu feiern!
Herzliche Glückwünsche NRW
Folgende Unterlagen im Berliner Bundesarchiv gilt es noch auszuerten:
R 9361-III/122546 (Sammlung Berlin Document Center (BDC): Personenbezogene Unterlagen der SS und SA)
In der Roosevelt Library in New York werden u. a. die John Franklin Cartes fils in Germany Nazi Party members – https://www.bsb-muenchen.de/mikro/lit200.pdf- aufbewahrt. Sie enthalten auch unter folgender Signatur Reel 8 (Listof Key Nazi´s Cont) Frame 0937 A2 Seiten über Fiszmer, (?) Siegen.
Leider sind in dieser Akte präzise zwei Informationen über Fissmer aufgelistet. 1. Oberbürgermeister, 2. unter „political history, affiliations“ den Hinweis „not“. Die Materialsammlung aus der Roosevelt-Collection ist auch insgesamt etwas dünn, insbesondere bei den weniger toptauglichen Top-Nazis. Erwähnt ist übrigens bei erster Durchsicht auch der Leipziger Oberbürgermeister Goerdeler. Auch zu Paul Giesler findet sich in dessen Akte fast nur öffentlich zugängliches Material, mit Ausnahme des Hinweises auf seine Maßnahmen gegen die protestierenden Münchener Studenten.
Bei der unlängst erfolgten Experten-Anhörung zum Kulturgesetzbuch wurde deutliche Kritik am Entwurf geübt:
„…. Was sind Ihre Erwartungen an ein Kulturgesetzbuch?
Vor allem sollte es ein maßstabsgerechtes Bild zeichnen. Wenn es um die Kultur in NRW geht, kommt man an den Landschaftsverbänden und Kommunen nicht vorbei, schon aufgrund der föderalen Rechtsgrundlage. ….
Die Draufsicht auf eine starke, weil kompetente Kulturlandschaft mit den vielen Verbänden, Organisationen, Vereinen aber auch Ehrenamtlichen, hätte dem Gesamtbild gutgetan und letztlich dem Gesetz ein deutliches Profil in Würdigung bestehender Leistungen verliehen. “ (Quelle: LVR-Kulturdezernentin Milena Karabaic in der Pressemitteilung des LVR v. 27.8.2021, Link: https://www.lvr.de/de/nav_main/derlvr/presse_1/pressemeldungen/press_report_290117.jsp)
„…. Städtetag, Gemeindebund und die beiden Landschaftsverbände Westfalen und Rheinland sind zudem sehr unzufrieden: Das Gesetz ergehe sich in Beschreibungen, regele aber fast nichts und erfülle auch nicht den systematischen Anspruch an ein Gesetzbuch – zum Beispiel, weil der Denkmalschutz, das Archivgesetz und das Kunsthochschulgesetz nicht drin stehen. ….“ (Quelle: Peter Grabowski, „Darum geht es beim neuen Kultur-Gesetzbuch“, wdr.de, 26.8.2021, Link: https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/kultur-gesetzbuch-anhoerung-landtag-100.html)
@VoltDeutschland Mir ist persönlich – und natürlich auch als Volt-Mitglied – daran gelegen, dass wir uns mit Archivthemen auch politisch auseinandersetzen und Herr Wolf eine Antwort bekommt. Herr Wolf, ich bitte noch um etwas Geduld, ihr Tweet soll nicht vergebens sein. https://t.co/8oYec8efS5
Die Verantwortlichen wollen natürlich löschen. Die Gründe liegen auf der Hand. Wenn man das Disaster schon nicht ungeschehen machen kann, dann muss man doch wenigstens die Belege beseitigen …
Alternativ hätte die Überschrift lauten können: „Recycling statt Verbrennung“. Der meistbietende Interessent wollte nicht aktenkundige Daten kaufen, sondern 11 Zentner Altpapier zur Wiederverwertung – ökologisch allemal besser, als dieses in den Öfen des Gerichtsgebäudes zu verheizen. Und viel anders läuft das heute auch nicht, außer dass kassierte Akten zunächst von zertifizierten Vernichtungsfirmen abgeholt werden, die das geschredderte Papier dann verkaufen.
„1856 + Altpapierrecycling“ ist eine bemerkenswerte Kombination: Nur ein Jahr später kam in den USA das angeblich erste industriell gefertigte Toilettenpapier auf den Markt. Sicherlich war die Zeit reif für diese segensreiche Erfindung. Wurde vielleicht auch schon im Siegerland damit experimentiert? Ein interessantes regionalgeschichtliches Forschungsthema!
Traurige Bilanz, danke für diese Zusammenstellung. Auffällig sind jedenfalls die Grünen. Wissen die denn nicht, welche Art von diktatorisch generiertem Schriftgut die Stasi-Unterlagenbehörde millionenfach verwahrt? Was Dokumentation, Analyse, Interpretation und öffentliche Diskussion von Rechtsextremismus und dessen Netzwerken angeht, böte sich aus Sicht der Grünen vermutlich auch eine Kooperation mit der Amadeu-Antonio-Stiftung an, die das seit vielen Jahren – mit Steuergeldern befördert – systematisch und durchaus erfolgreich macht. Eine NGO, die quasi hoheitliche und investigative Aufgaben übernommen hat. Deren Chefin könnte den Grünen allerdings auch erklären, durch wen und durch welche Unrechsthandlungen die Stasi-Akten, die jetzt in jenem von den Grünen als Vergleich bemühten Archiv lagern, im Wesentlichen zustande kamen. Sie war selbst knapp zehn Jahre IM
sehr geehrte Damen und Herren !
ich interesseire mich für die Stelle als Bundesfreiwilligendienst im Stadtarchiv. Ab 1.10.2021 ist die Stelle noch zu besetzen .
mit freundlichem Gruß
Ein Zufallsfund zum kulturellen Leben in Siegen während Fissmers Amtszeit: “ … Bereits 1927 signalisierte das damalige Kultusministerium Beihilfe zur Errichtung eines Denkmals, doch die Bemühungen der Stadt Siegen den Rubensbrunnen fertigzustellen wurden erst 1930 auf Drängen Berlins in Angriff genommen.
Daraufhin wurde ein Wettbewerb um die künstlerische Gestaltung des Brunnes ausgerufen. Die beiden favorisierten Kontrahenten waren der Düsseldorfer Bildhauer Johannes Knubel und der Eiserfelder Künstler Hermann Kuhmichel. Beide legten der Stadt verschiedene Entwürfe vor. Knubel wollte einen Obelisken errichten lassen, der Lukas mit einem Ochsen als Heiligen der Malergilde und darunter ein Relief von Rubens darstellen sollte. Diese Idee wurde jedoch aus diversen Gründen abgelehnt. …“ (Quelle: Rohde, Simon: Der Rubensbrunnen im Schlosspark des Oberen Schlosses, Link: https://www.regioport-siegerland.de/de/siegen/der-rubensbrunnen-im-schlosspark-des-oberen-schlosses.html)
Es gäbe genug zu tun:
– Harmonisierung des Archivrechts mit dem Urheberrecht, mit den Datenschutzregelungen, mit Informationszugangsregelungen,
– dauerhafte Sicherung der Bestandserhaltung analoger und digitaler Archivalien,
– rechtzeitige Einbindung der Archive in den eGoverment-Prozess
– wohin gehören die dienstlichen Anteile von Politikernachlässen? …
Die Wittgensteiner Bibliographie gibt aktuell (Stand 25.8.2021) folgende Literatur zu Althusius:
– Althusius, Johannes Politik, 3. Auflage Herborn 1614, Übersetzt von Heinrich Janssen, Herausgegeben, überarbeitet und eingeleitet von Dieter Wyduckel, Berlin 2003, 449 Seiten
– Burkardt, Johannes Wer war Johannes Althusius?, FS JAG, S. 207-212
– Dunkelmann, Jürgen Die Althusius-Grabtafel in Goddelsheim Geschichtsblätter für Waldeck, Bd. 96, 2008, S. 73-81 [Betr. Bruder von Johannes Althusius]
– Friedrich, C. Johannes Althusius – seine Lehre von der Politik, FS JAG, S. 32-36
– Gierke, Julius von Berleburg in der Grafschaft Wittgenstein, die Heimat des Johannes Althusius In: Festschrift für Gottfried Hugelmann zum 80. Geburtstag am 26. September 1959, Aalen 1959, Seiten 151-157
– Hollenstein, Helmut Die „Politica“ des Johannes Althusius: Eine Vision und ihre Voraussetzungen, FS JAG, S. 21-31
– Hollenstein, Helmut Johannes Althusius – Ein Historienspiel, Bad Berleburg 2008
– Hollenstein, Helmut Althusius und Comenius im Vergleich Zusammenfassung eines Vortrages beim Symposium „Jurisprudenz, politische Theorie und politische Theologie“, anlässlich 400 Jahre „Politica“ des Joh. Althusius, Herborn 11.-14.6.2003, Mitt. Blätter des Geschichtsvereins Herborn e.V. Jg. 51, Nr. 3/4, Oktober 2003, S. 147-148
– Hollenstein, Helmut Schule und Erziehung bei Althusius, Calvin und Comenius in ihrer Bedeutung für die Gemeinschaftsbildung, Beiträge zur Politischen Wissenschaft Bd. 131, 2004, S. 7-22
– Höting, Ingeborg Johannes Althusius, In: Die Professoren der Steinfurter Hohen Schule, Steinfurt 1991, Steinfurter Schriften 21, S. 20-26
– Homrighausen, Ernst/Homrighausen, Klaus Johannes Althusius DBDie S. 673-675
– Menk, Gerhard Die Hohe Schule Herborn im 16. und 17. Jahrhundert, In: 400 Jahre Arnoldinum 1588-1988 (Schriftenreihe des Kreisheimatbundes Steinfurt 6), Greven 1988, S. 22-30 [u.a. über Graf Ludwig den Älteren vSzW und Johannes Althusius)
– Menk, Gerhard Paul Crocius – ein calvinistischer Pfarrer im konfessionellen Zeitalter, In: Breul-Kunkel, W. u. Vogel, L. Rezeption und Reform. Festschrift für Hans Schneider zu seinem 60. Geburtstag (Quellen und Studien zur hessischen Kirchengeschichte 5), S. 71-96 [Betr. auch. Johannes Althusius]
– Menk, Gerhard Johannes Althusius und die Grafschaft Wittgenstein, Beiträge zur Westfälischen Kirchengeschichte Bd. 35, 2009, S. 9-39
– Neweling, Erich, Johannes Althusius, WHB II/S. 275-286
– Schlarmann, Hans Johannes Althusius, Diedenshausensis, DBWD, S. 345
– Strohm, Christoph Recht und Jurisprudenz im reformierten Protestantismus 1550-1650, In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 123, kanonistische Abteilung 92 (2006), Seiten 453-493
– Störkel, Rüdiger, Herborner Autoren aus der Blütezeit der Hohen Schule
• Johann Althusius, S. 132, In: Literatur im „Dill Athen“, Herborn und die Welt der Bücher 1585-1990, Mitteilungsblatt des Geschichtsverein Herborn e.V., Jahrgang LV, Oktober 2007, Nr. 3/4, S. 118-160
– Troßbach, Werner Johannes Althusius, Staatsphilosoph und Politiker, In: Von Soest – aus Westfalen, Paderborn 1986, Seiten 217-234
– Warnecke, H. J. Althusius und Burgsteinfurt, In: Politische Theorie des Johannes Althusius (Hgg.) Dahm, Krawietz, Wyduckel, Berlin 1988, S. 147-160
– Wyduckel, Dieter Althusius, Johannes, In: Die Deutsche Literatur – Biographisches und bibliographisches Lexikon Reihe II, Bd. 2, S. 345-356
– Wyduckel, Dieter Johannes Althusius (1563-1638) Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (HRG) 2. Aufl. Bd.
1, Spalte 196 – 199
Die Wittgensteiner Bibliographie gibt aktuell (Stand 25.8.2021) folgende Literatur zu Kiel:
– NN: Friedrich Kiels Stellung in der Musikgeschichte und Charakterisierung seiner künstlerischen Eigenart an Hand seiner vier Hauptwerke, DschW. 1927/H. 4/S. 129-132
– NN: Gedächtnisrede des Hofpredigers Emil Frommel [Betr. Fr. Kiel], DschW. 1927/H. 4/S. 132-134
– NN: Zum Gedenken an Friedrich Kiel, in: Wittgenstein, Jg. 84 (1996), Bd. 60, Heft 3, S. 87
– N. N.: Friedrich-Kiel-Gesellschaft gegründet, Wittgenstein, Jg. 67 (1979), Bd. 43, Heft 3, S. 123-124
– Bauer, Eberhard: Friedrich Kiel, 1821-1885, Wittgenstein, Jg. 59 (1971), Bd. 35, Heft 2/3, S. 42
– Büchner, Susanne Kiel, Friedrich In: Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG) 2. neu bearbeitete Ausgabe, (Hg.) Ludwig Fischer , Personenteil 10, Ke-Ler, Kassel/Weimar, Spalte 74-79
– Hartnack, Karl Friedrich Kiel, DschW. 1927/H. 4/S. 128-129
– Marburger, Otto Friedrich Kiel 1821 – 1885. Worte des Gedenkens zum 125. Todestag an seinen Geburtsort Puderbach, Wittgenstein, Jg. 98 (2010), Bd. 74, Heft 4, S. 154-157
– Pfeil, Peter: Briefe des Komponisten Friedrich Kiel, Wittgenstein, Jg. 59 (1971), Bd. 35, Heft 2/3, S. 43-59
– Pfeil, Peter: Friedrich Kiels Erinnerungen an Berleburg, Wittgenstein, Jg. 53 (1965), Bd. 29, Heft 1, S. 50-52
– Pfeil, Peter: Die Handschriften des Komponisten Friedrich Kiel in der Stadt- und Landesbibliothek Dortmund, Wittgenstein, Jg. 51 (1963), Bd. 27, Heft 1,2, S. 7-12
– Pfeil, Peter: Friedrich Kiel, WHB II/S. 286-289
– Pfeil, Peter: Friedrich-Kiel-Gesellschaft e.V., Wittgenstein, Jg. 67 (1979), Bd. 43, Heft 3, S. 123; Wittgenstein, Jg. 68 (1980), Bd. 44, Heft 3, S. 105-106 Wittgenstein, Jg. 70 (1982), Bd. 46, Heft 1, S. 31-32 [Die Friedrich-Kiel-Gesellschaft gibt jährlich „Mitteilungen“ heraus]
– Pfeil, Peter: Friedrich Kiel 1821 -1885, DBP, S. 390-398
– Pfeil, Peter (Hg.): Friedrich Kiel-Studien Bd. 1, Köln 1993, 257 Seiten; Bd. 2, Köln 1997, 112 Seiten; Bd. 3, Köln 1999, 216 Seiten
– Pfeil, Peter/Friedrich-Kiel-Forschungen, Bd. 1 Schenk, Dietmar (Hgg.) Sinzig 2008, 190 Seiten
– Schneider, Willi: Irrtümer in Friedrich Kiels Selbstbiografie, Wittgenstein, Jg. 63 (1975), Bd. 39, Heft 3, S. 162-164
– Schuppener, Ulrich: Ein Komponist aus dem Wittgensteiner Land. Zum 100. Todestag von Friedrich Kiel, Wittgenstein, Jg. 73 (1985), Bd. 49, Heft 4, S. 135-141
– Schuppener, Ulrich: Ein Komponist aus dem Wittgensteiner Land. Zum 100. Todestag von Friedrich Kiel (1821-1885), In: Zeitschrift Siegerland, Bd. 62, 1985, S. 71-76
– Schuppener, Ulrich: Komponist, Virtuose und Musikpädagoge. Friedrich Kiel vor 175 Jahren in Puderbach geboren., In: Zeitschrift Siegerland, Bd. 73, 1996, S. 67-69
– Wallendorf, Claudia: Hörbare Spielfreude. Das Klavierwerk Vol. 1 bis 3 [3 CD] Rez., in: Wittgenstein, Jg. 92 (2004), Bd. 68, Heft 1, S. 41-42
– Zimmermann, Helga: Friedrich Kiels Wirken als Kompositionslehrer, Wittgenstein, Jg. 84 (1996), Bd. 60, Heft 3, S. 88-96
„Die Bechers 2.0. – unterwegs mit Thomas Kellner“. WDR 5 Scala – aktuelle Kultur. 13.10.2021. 10:29 Min.: „Mit ihren Fotos von Fachwerkhäusern im Siegener Land starteten Bernd und Hilla Becher eine internationale Karriere. Über 50 Jahre später begab sich Thomas Kellner auf die Spuren der Bechers. Jörg Mayer begleitete den Architekturfotografen bei einem Rundgang durch Siegen.“: Radio-Beitrag
Vielen Dank für die interessanten Lösungsvorschläge! Leider sind alle noch ein wenig weit von der Lösung entfernt. Aber vielleicht hilft ein Blick auf den Twitter-Account von siwiarchiv weiter:
Leider immer noch nicht richtig! Aber die Antworten werden nun etwas archivischer. Im Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein befinden sich jedenfalls mehrere hundert Stück davon……
Im Portal findet sich das Aachener „Echo der Gegenwart“, das durch eine Volltexterkennung jetzt im Volltext durchsuchbar ist, hier: https://zeitpunkt.nrw/ulbbn/periodical/titleinfo/4371932
Der Suchschlitz befindet sich rechts oberhalb des Vorschaubildes.
Liebe Menschheit in Siegen und in Deutschland! Sie bitte zu, dass Du genau ins Wirtschaftssystem passt! Ansonsten werde bitte erst gar nicht geboren! Wir brauchen in Zukunft nur noch Menschen, die hier ins Wirtschaftssystem passen! Das ist die neue Zukunft in Deutschland! Wo sind wir nur hingekommen?
Sie haben ja recht, dass dies sehr ähnlich ist. Aber gesucht war eben eine DVD-Hülle, die nun einmal rechteckig ist, während CD-Hüllen in der Regel fast quadratisch sind.
CD-Hülle ist falsch, aber DVD-Hülle ist richtig.
Seltsam.
In meinen Augen ist das quasi das Gleiche und man könnte die Antwort von Michael Johne gelten lassen.
Das verspricht (endlich mal wieder) eine spannende, wenn nicht gar nervenaufreibende Diskussion zu werden! Frage an den geschätzten Administrator und Quizz-Master: Wäre die DVD-Hülle anhand des Bildes eindeutig identifizierbar gewesen, oder hätte eben auch ein Foto des analogen CD-Hüllen-Details zu diesem Ergebnis geführt? Das läßt sich ja im Experiment unter identischen Aufnahmebedingungen leicht herausfinden. Einfach mal ausprobieren und den Vergleich hier präsentieren.
Übrigens fehlt bisher die endgültige Auflösung des Adventsrätsels 3/2020. Bitte abschließend noch die linke Pflanze in Bild 1 benennen.
Das ist ganz offensichtlich kein Vergleichsbild in dem Sinne, wie ich es meinte („identische Aufnahmebedingungen“, also gleiche Kameraposition und -einstellungen mit dem jeweils vergleichbaren Ausschnitt einer DVD- und einer CD-Hülle). Na gut, anders gefragt: Anhand welcher Indizien hätte denn beim Rätselbild die Lösung „CD“ zugunsten „DVD“ ausgeschlossen werden sollen? Die von Ihnen gestellte Frage „Worum handelt es sich?“ (= „Was hat Herr Wolf fotografiert?“) war ja genaugenommen nicht zielführend, weil allenfalls von Hellsehern zu beantworten. Um es mal frei nach Magritte zu sagen: „C’est ne pas une pochette de DVD/CD“, vielmehr nur ein Bild davon. Und Bilder lassen sich nun einmal so arrangieren, dass man sie „Vor-Bildern“ nicht mehr eindeutig zuordnen kann.
Lieber Herr Wolf, Ihr Engagement auf Siwiarchiv und die generelle Idee der Rätsel in allen Ehren, aber: Dieses Rätsel ist unglücklich gestellt und aufgelöst worden. Michael Johne hätte meiner Meinung nach die Zuerkennung der Lösung verdient. Für die Zukunft schlage ich vor, dass wieder historische Aufnahmen verwendet werden. Das Kreisarchiv verfügt doch sicher über zahlreiche unbekannte Fotos, deren Motive es zu erraten gilt. Damit würden die vielen Denkanstrengungen der Teilnehmenden auch einem sinnvolleren Ziel zugeführt als Makroaufnahmen von Kunststoff-Massenartikeln zu erraten.
Mag sein, dass dies nicht optimal war. Vielleicht hätte ich das Rätsel großzügiger bspw. wie folgt auflösen können:
„Ja! es handelt sich um eine CD!
Hier der Bildbeweis: “
M. E. gehört die präzise Beschreibung von Archivgut zu den Aufgaben der Archivierenden.
Das kommende Rätsel wird allerdings kein Archivgut zu Inhalt haben. Vielleicht später noch einmal …..
Wer in Rätseln nur Glücksspiele sieht, soll die nächsten Lottozahlen zu erraten versuchen. In einem intellektuell herausfordernden Blog wie Siwiarchiv erwartet man dagegen eher „Rätsel“ im engeren (gewissermaßen kriminalistischen) Sinne, nämlich etwas, das sich durch die Aktivität des Ratenden (Betrachten des Bildes und Interpretieren der darin gefundenen Informationen) lösen läßt. Im vorliegenden Fall erlaubten die Bildinformationen nur eine weitgehende Annäherung an das gemeinte Objekt. Das wohl bestmögliche Ergebnis hätte gelautet: „Hülle eines scheibenförmigen digitalen Speichermediums“. Mit dem weiteren Schritt in Richtung Konkretisierung (CD oder DVD oder was sonst noch alles ins Laufwerk passen würde) hätte man die Grenzen des „kriminalistischen“ Rätsels verlassen und wäre in die Domäne des Würfelns und Münzenwerfens geraten. Der Vergleich mit „präziser Beschreibung von Archivgut“ hinkt gewaltig (mit Verlaub, lieber Herr Wolf): Selbstverständlich werden an dem zu beschreibenden Archivgut vorher keine Manipulationen oder Verfremdungen vorgenommen, um die armen Archivierenden vor Rätsel zu stellen. Nebenbei bemerkt, illustriert unser kleiner Disput sehr schön das allgemeine Dilemma menschlicher Erkenntnistätigkeit. Meistens sind wir auf Bilder angewiesen, weil die Realien entweder schon verschwunden oder uns in der Gegenwart nicht zugänglich sind. Und was wir aus den vielen Bildern machen, ist letztlich wieder nur ein Bild (z.B. „Geschichtsbild“), niemals eine Wiederbelebung von etwas Objektivem. – Nun aber genug der Altersweisheit!
Aktueller Stand der Petition:
22.673 Unterstützende, davon 12.344 in Nordrhein-Westfalen, d. h. 43% des erforderlichen Quorums von 29.000 Unterschriften sind erreicht. Aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein haben bisher 135 Personen unterzeichnet …..
Diese Erinnerungen an die Schulzeit am Mädchengymnasium in Siegen sind für mich sehr interessant, denn ich habe bis zum Abitur eine Mädchenschule in Fulda besucht, die von Nonnen, – den „Englischen Fräuleins“, – geleitet wurde,- u nter ähnlichen, aber noch wesentlich strengeren Bedingungen als in Siegen. Auch dort gab es (nach der „Mittleren Reife“) die Aufteilung in einen naturwissenschaftlichen und einen Hausfrauenzweig mit sogenanntem „Pudding – Abi“, das allerdings den Zugang zu allen Studiengängen ermöglichte.
Vielen Dank für die persönliche Ergänzung! In der Tat steht eine pädagogikgeschichtliche Aufarbeitung der LYZ-Geschichte noch aus. Sie wäre aufgrund der vorhandenen Unterlagen mindestens für die Zeit als staatliche Schule nicht nur möglich, sondern wohl auch ergiebig.
Ein Mann, der gar keine Ahnung, über die Zeit der Belgier in Siegen hat. Bekommt Informationen, die auch noch Fehlerhaft sind, aber ein Vortrag über die Belgier in Siegen halten. Mfg Olivier Lagneau
2 Fragen seien gestattet:
1) Ist es nicht normal, dass Historiker:innen über eine Vergangenheit schreiben, die sie selber nicht mehr erlebt haben? Erleichtert dies nicht die alte geschichtswissenschaftliche Forderung, dass Geschichte „sine ira et studio“ betrieben werden sollte?
2) Welche falsche Informationen sind denn gemeint?
Zur Person des Vortragenden ist auf die Pressemitteilung zu verweisen. Er hat sich mit dem Thema beschäftigt!
In der heutigen Print-Ausgabe der Siegener Zeitung findet sich folgender Artikel „Stadtbad am Löhrtor – Kenner warnt vor voreiligem Abriss. Das Bauhaus und sein kleiner Bruder“ von Jan Schäfer.
Im Universitätsarchiv der TU Darmstadt befindet sich die Diplomprüfungsakte von Walter Bonin (UA Darmstadt 115 Nr. 33-23). Die Akte enthält unter anderem sein Zeugnis über die Diplom-Hauptprüfung und einen Abriss des Lebens- und Bildungsganges.
Zwei Funde im Iserlohner Kreisblatt:
1) 27.5.1936 – Zur Errichtung eines Ehrenmals für die Gefallenen des ersten Weltkriegs. Der Artikel wirft die Frage auf,warum es dem seit 1919 amtierenden Bürgermeister der Stadt Siegen nicht gelungen ist, bis zu diesem Zeitpunkt, eine solche Erinnerungsstätte zu schaffen:
2) 27.5.1942 – zur Kaisergarten-Affäre:
In Opfermanns Personenlexikon finden sich 3 Hinweise auf Atikel zu Fissmer in der Siegerländer Nationalzeitung. 2 sind in der Zwischenzeit online einsehbar:
16. April 1938:
22. Mai 1942:
Ist mir wichtig, das zu betonen: Das Regionale Personenlexikon, das nicht nur ein biografischen Lexikon zur NS-Belastung darstellt, sondern eine Menge mehr an Information enthält, ist nicht „mein“ Lexikon, sondern eins der VVN-BdA Siegerland-Wittgenstein. Sie ist es, die sich damit historiografisch verdient gemacht hat.
Guten Morgen,
da es sich um die gelbe Villa im Dreslers Park in Kreuztal handelt, vermiute ich mal, dass die Initalien auf den Hausherrn Wilhem Dresler weisen und tippe auf W.D….da ich erst seit 2,5 Jahren im Siegerland lebe, bin ich gespannt, ob ich das heutige Rätsel als Düsseldorfer Mädje lösen kann.
Ich wünsche einen beschwingten 1. Advent.
Viele Grüße, Petra
Ich möchte meine zu 50 % richtige Lösung auf 100 % vervollständigen.
Die beiden Intitialen lauten W.D. und H.D. und weisen auf die Erbauer und Wilhelm und Henriette Dresler hin, die die gelbe Villa bewohnten.
Liebe Grüße und danke für das tolle Rätsel rund um die Geschichte der Fabrikantenfamilie Dresler,
Petra
Dann bliebe bei H.D. nur noch der Verweis auf den einzigen Sohn des Ehepaares Wilhelm und Henriette Dresler…Heinrich Dresler.
Ansosnten bleibt mir noch die Option des HH als Abkürzung der Initialen für Henriette (Ehefaru) und Heinrich (Sohn)..wenn es jetzt nich stimmt, begnüge ich mit 75 % :-)!
Ich finde es übrigens großartig, dass das Kulturgut dank des Denkmalschutzes und der Archivierung aller Informationen rund um die Zeitgeschichte noch heute in der Stadt so lebendig ist und erhalten wurde..Lichterleuchten, Trauungen, Tourismus.
In den Kommentaren findet sich schonder gesuchte Buchstabe ….. Sie sind ja vollkommen auf den richtigen Weg.
W.D.und H.S = Wilhelm Dresler und Heinrich Sohn
oder
W.D. und S.H. = Wilhelm Dresler und Sohn Heinrich
…in freudiger Erwartung:-)))
Sie denken zu patriachalisch ;-)
Ich tippe auf FWD, die gelbe Villa wurde für Wilhelm Dresler erbaut, dessen vollständiger Name Friedrich Wilhelm Dresler war.
Zwar handelt es sich tatsächlich um Friedrich Wilhelm Dresler, aber als Initialen sind dort nur W.D. zu erkennen, so dass es bei der 50%igen Lösung zunächst einmal bleibt.
Herzlichen Glückwunsch auch aus dem Stadtarchiv Kreuztal! :-)
Wir haben festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, die Geburtsnamen der Ehefrauen zu ermitteln, weil der in den Veröffentlichungen häufig unterschlagen wird.
Danke für dieses schöne Bild und Rätsel! Stimmt, einfaches googlen war da nicht zielführend. Man musste schon schon den vollen Namen Dreslers und den Vornamen seiner Frau eingeben. Dann wurde man auf eine genealogische Seite gelenkt, die man aber ebenfalls präzise durchsuchen musste. Ich habe den Eindruck, dass fast alle Dresler Friedrich Wilhelm als Vornamen trugen ;-)
Vielen Dank, ich freue mich natürlich auch. Aber ohne die Vorarbeit von Frau Hanstein wäre ich wahrscheinlich nie zur Lösung der letzten „25%“ gekommen.
Bei mir entstand tatsächlich auch der Eindruck, dass die Familie Dresler bei den Männervornamen so ihre Favoriten hatte :)
Gemeinsam sind wir stark! Einer für Alle, alle für Einen:-)
Ich besuchte in der Zeit von 1974 – 1976 die Tagesschule der Sprachenschule Siegerland. Diese Zeit ist mir in sehr guter Erinnerung geblieben, besonders der Unterricht bei Herrn Dr. Bode – das war schon ganz speziell!
Inzwischen bin ich im Ruhestand, bin aber nach wie vor der Sprache/Sprachen und der Literatur treu geblieben.
Vielleicht erinnert sich noch jemand an mich, so dass wir in Kontakt treten könnten?
Die Dissertation von Ley ist 1906 leider unvollständig abgedruckt worden. Es fehlten die im Inhaltsverzeichnis genannten Kapitel XI-XIII. 1909 erschienen dann Leys Dissertation und die von Hans Kruse zur Holzköhlerei und Loherei in einem Sammelband unter dem Titel „Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte des Siegerlandes“, herausgegeben von dem bekannten Münsteraner Staatsarchivdirektor und Historiker Friedrich Philippi. P. formulierte in der Einleitung die Hoffnung, die begonnene Schriftenreihe mit einer Arbeit zur Haubergswirtschaft und zum Wiesenbau fortsetzen zu können. Doch es blieb bei diesem einen erschienenen Band, der ebenfalls in Münster digitalisiert wurde: https://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/urn/urn:nbn:de:hbz:6:1-421337
Wegen der erhöhten Brandgefahr in Archivmagazinen müssten sich deren Türen wahrscheinlich in Fluchtrichtung, also nach außen öffnen lassen. Soweit die Theorie …
… aber es ist vielleicht gar kein offizieller „Archivraum“, sondern eine von den Ämtern in Konkurrenz zum zuständigen Kreisarchiv angelegte Sammlung? Die Beschriftung deutet jedenfalls darauf hin.
Als Ergänzung nun ide gestern im Laufe des Tages online gestellte, vollständige Pressemitteilung zur Veranstaltung:
„Siegener Bündnis für Demokratie gestaltet Ge(h)Denken in Zeiten der Pandemie
Am 16.12.2021 gedenken die Siegener Bürgerinnen und Bürger zum 77. Mal der Bombardierung ihrer Stadt im Jahr 1944. Über 50.000 Bomben wurden abgeworfen, Siegen versank in Schutt und Asche. Hunderte Menschen starben im Bombenhagel.
Die Veranstaltungen des Gedenktages, die seit 2008 vom Siegener Bündnis für Demokratie mitgestaltet und koordiniert werden, sind auch in diesem Jahr unter dem Vorzeichen der Pandemie und den damit verbundenen Schutz- und Hygienemaßnahmen geplant. Das Siegener Bündnis besteht aus einer Vielzahl von Kirchen, Gewerkschaften, Parteien, Jugendverbänden und weiteren gesellschaftlichen Gruppen und wendet sich dagegen, dass rechtsextreme Gruppierungen versuchen, den Gedenktag für ihre Ideologien zu mißbrauchen.
In diesem Jahr bestehen verschiedene Möglichkeiten am Ge(h)denken teilzunehmen:
Wie in allen Jahren erinnert das stadtweite Läuten der Kirchenglocken um kurz vor 15.00 Uhr an den verheerenden Luftangriff am 16. Dezember 1944. Anschließend findet das „Stille Gedenken“ der Stadt Siegen mit der offiziellen Kranzniederlegung durch den Bürgermeister an der „Gedenkstätte für die Opfer des Krieges und der Gewalt“ im Dicken Turm des Unteren Schlosses. Hier gilt die 3G-Regel.
Im Verlauf des Nachmittages von 15:30 – 17:30 Uhr sind interessierte Bürgerinnen und Bürger in das Aktive Museum Südweastfalen eingeladen. Dabei werden erste Konzeptideen der neuen
Dauerausstellung sowie besondere Quellen zur juristischen Aufarbeitung der Verbrechen im Holocaust unter dem Motto „Aufbruch im Museum“ gezeigt. Der Zutritt ist für maximal 10 Personen zeitgleich und der Einhaltung der 3G-Regel möglich.
Ebenfalls von 15:30 – 17:00 Uhr sind das Aktionsbündnis Friedensbewegung Südwestfalen und „Siegen gegen Rechts“ mit einem Informations- und Diskussionsstand auf der Siegbrücke. „Nie wieder Fachismus – Nie wieder Krieg!“ präsent.
Um 18:00 Uhr findet der traditionelle Ökumenische Gottesdienst zum Gedenken an die Zerstörung Siegens in der Nikolaikirche statt. Es gilt die 3G-Regel und der Eingang ist wegen der Kontrolle vom Parkplatz Pfarrstraße aus.
Zwei weitere Veranstaltungen flankieren das Gedenken:
Bereits am 14.12.2021 präsentiert um 19:30 Uhr das Junge Theater Siegen Max Frisch „Biedermann und die Brandstifter“ reloaded – Warnung vor der Zerstörung der Demokratie“ im Kleinen Theater des Medien- und Kulturhauses Lyz. „In Max Frischs Stück „Biedermann und die Brandstifter“ erleben wir einen reichen Hausherren und seine Frau, welche – trotz zunehmend offensichtlicher Gefahr durch in ihr Haus eingetretene Brandstifter*innen – krampfhaft versuchen, eine bürgerliche Fassade aufrecht zu erhalten. Gewürzt wird dies durch einen Chor, der auch nur warnend berichtet, aber nicht eingreift. Ähnlichkeiten und Parallelen zu aktuellen Entwicklungen rund um die aktuellen Gefahren für unsere Demokratie sind nicht zufällig. Der Einlass giltn nur mit 2G und nur nach Voranmeldung jungestheatersiegen@gmail.com.
Den Abschluss soll am 18.12.2021 ein „Konzert gegen Rechts“ im Musikclub Vortex. Beim Konzert spielen NTBC – Trap & For Heads Down – Punkrock aus Siegen. Es steht noch nicht fest, ob das Konzert mit oder ohne Publikum durchgeführt wird. Weitere Infos folgen.
Ingo Degenhardt (DGB) und Andree Schmidt (Stadt Siegen) rufen stellvertretend für das Siegener Bündnis für Demokratie alle Bürgerinnen und Bürger unter Einhaltung der Schutzregelungen zur Teilnahme an den Veranstaltungen dieses wichtigen Gedenktages auf!“
Quelle: https://suedwestfalen.dgb.de/presse/++co++e1e7c0a0-5c12-11ec-9bcd-001a4a160123
Literatur:
Anspach, Maria: Dr. Josef Mengeles „Probetierchen“ – ein Blockführer des „Zigeunerlagers“ Auschwitz-Birkenau vor Gericht, in: Tribüne , H 26 (1987),102, S. 132 – 139
Arnold Roßberg: Die Aufarbeitung des NS-Völkermordes an den Sinti und Roma – Ermittlungsverfahren gegen die Täter und Anmerkungen zu dem Prozess beim Landgericht Siegen über das sog. „Zigeunerlager“ Auschwitz-Birkenau, in: Schonung für die Mörder? Die justizielle Behandlung der NS-Völkermordverbrechen und ihre Bedeutung für die Gesellschaft und die Rechtskultur in Deutschland. Das Beispiel der Sinti und Roma, Heidelberg 2015, S. 94–113
Folgende Zeitungsartikel fehlen noch in der obigen Aufstellung:
– Westfälische Rundschau, [August ?] 1987 [MA: Maria Anspach]: Viele Terminverschiebungen im NS-Prozeß durch kranke Zeugen. Josef J: Häftlingskleidung nur unter Dampf – nie gewaschen“
– Westfälische Rundschau, 27.8.1987: „Es geht um lebenslänglich“
– Westfälische Rundschau, 2.9.1987: Nebenkläger im Siegener NS-Prozess fordern: Auslandsreisen für alle Gerichtspersonen“
– Frankfurter Rundschau, 10.9.1987: Ingrid Müller-Münch (Köln): Beklemmender Streit um historische und juristische Wahrheit. Das Siegener Landgericht verhandelt gegen einen ehemaligen Blockführer im Zigeunerlager Auschwitz-Birkenau
– Westfälische Rundschau, 2.11.1987: Erneut Augenzeugenschilderung: „Ich sah, wie König mit dem Ochsenziemer Onkel Oskar erschlug“
– Westfälische Rundschau, 11.11.1987 Folgen von Auschwitz für Zeugin. Gestern untersucht: Unfähig auszusagen
– Westfälische Rundschau, 15.12.1987 [MA: Maria Anspach]: An Liquidierung des Zigeunerlagers beteiligt?
– Westfälische Rundschau, 16.12.1987 [MA: Maria Anspach]: Gerichtssaal brechend voll für stummen Zeugen: Der Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Broad – Muß er trotzdem aussagen?
– Westfälische Rundschau, [1988?] [MA: Maria Anspach]: Nach Prozeßpause USA-Flug. Widersprüchliches in Vernehmungen der Schwestern Königs
– Westfälische Rundschau, 13.01.1988 [MA: Maria Anspach]: Ehemaliger SS-Richter als Zeuge vor Gericht: „Bis 1944 nichts von Vernichtung gewußt“
– Westfälische Rundschau, 14.01.1988 [MA: Maria Anspach]: Erinnerung für Zeugen of „unendlich schwer. König im Fall Schenk belastewt und entlastet
– Westfälische Rundschau, 20.01.1988 [MA: Maria Anspach]: Aussagen aus dem Nürnberger Prozeß verlesen – Ex-Richter wollte SS reiwaschen: Häftlinge alle wohlgenährt und braungebrannt“
– Westfälische Rundschau, 02.02.1988 [MA: Maria Anspach]: Nachtragsanklage gegen König? Vier neue Zeugen mit dem Vorwurf „Tödliche Prügel
– Westfälische Rundschau, 10.02.1988: In Brake: Zeugenaussage belastete König schwer
– Westfälische Rundschau, 01.03.1988: Haftverschonung für NAziv-Verbrecher
– Westfälische Rundschau, 02.03.1988 [MA: Maria Anspach]: 40 Jahre sind viel zu kurz – um zu vergessen: Erinnerung an den Tod der Mutter ließ Zeugin fast zusammenbrechen
– Westfälische Rundschau, 05.03.1988: Zeitzeugen aus Polen im Prozeß: Der Direktor vom Auschwitzmuseum informiert Gericht
– Westfälische Rundschau, 25.04.1988: Schicksalsberichte inmitten froher Festlichkeit. Ehrenwart in Führerhauptquartier – Dann abgeholt und sterilisiert
– Westfälische Rundschau, 25.04.1988: NS-Prozeß: Schwurgerichtskammer wieder auf Reisen – Angeklagter König erneut schwer belastet. Nach Tritten blieb Schwangere auf der Lagerstraße liegen
– Westfälische Rundschau, 25.04.1988: Maria Anspach: Sintitreffen in Mülheim vor dem Hintergrund von Siegenens NS-Prozeß. Nach den Aussagen vor Gericht Aufarbeitung von Erfahrungen
Die Nationalzeitung – https://zeitpunkt.nrw/ulbms/periodical/zoom/8806465 – berichtet in ihrer Ausgabe vom 23.2.1940 ausführlicher über das Unglück. Die dort igen Ortsangaben geben Hinweise , wo genau sich der Unglücksherd befand (Kirchweg 42). Wenn sich die Nummerierung nicht geändert hat, dann befand Explosionsort auf dem Gelände des heutigen Landgerichtsgebäudes.
Die Doku erwähnt Julius Gonsenhäuser, wohnhaft in Berleburg.
Julius G. war verheiratet mit Irma Gonsenhäuser geb. Arensberg und wohnte in Warstein, Hauptstraße 33. Heirat am 6.4.1897 in Warstein.
Gonsenhäuser, Julius (Kaufmann) * 1895 in Berleburg Kreis Wittgenstein
verhaftet nach der Reichspogromnacht – ermordet am 20.12.1938 in Buchenwald.
Seine Urne wurde auf dem jüdischen Friedhof in Warstein beigesetzt.
Gonsenhäuser geb. Arensberg, Irma * 1898 in Warstein
im September 1939 nach Köln verzogen. Deportation ab Düsseldorf am 10. November 1941, nach Minsk, Ghetto
Sie soll 1941/42 im Ghetto von Minsk in Weißrussland umgekommen sein.
Das vom Kreisarchiv hier beigesteuerte Beispielfoto (Protestaktion von Angehörigen der Hüttentaler Bauschule und evtl. der anderen Siegener Fachschulen im Juni 1968, als sie sich offiziell noch nicht einmal „Studenten“ nennen durften) könnte den Eindruck erwecken, es würden auch Bilder aus der Zeit vor 1972 gesucht. Ich wage zu bezweifeln, dass die Pressestelle die Vorgeschichte illustrieren möchte, zumal die Zahl von lediglich für eine Ausgabe des Uni-Journals ausgewählten Fotos letztendlich sehr begrenzt bleiben wird. Eifriger Aktionismus und anschließende herbe Enttäuschung bei vielen unberücksichtigt bleibenden Einsendern sind vorhersehbar. Wie durchdacht dieser Aufruf der Pressestelle ist, habe ich nicht zu beurteilen.
Aus meiner aktiven Zeit erinnere ich mich daran, dass im Archiv der Uni Siegen eine bereits recht umfangreiche Fotosammlung zu vielen Aspekten der Uni-Geschichte zusammengetragen worden ist, aus der die Herausgeber des geplanten „Querschnitt“-Heftes schon jetzt erfolgreich schöpfen könnten. Dieses Bildarchiv stetig auszubauen, ist ein permanentes Anliegen jenseits der hin und wieder zelebrierten Jubelfeiern. Studierende, Alumni und alle anderen jetzigen und früheren Angehörigen der Universität (und ihrer Vorgängereinrichtungen), die durch Übergabe von kleinen oder großen Fotosammlungen etwas zur Dokumentation der Hochschulgeschichte beitragen wollen, sind meiner unmaßgeblichen Einschätzung nach im Archiv stets willkommen.
Eventuell im Buchhandel? Ansonsten hat die Firma mundus.tv eine USB-Stick-Zusammenstellung von Siegerland-Filmen im Angebot. Schließlich ist der Film auch noch auf Facebook sichtbar: https://fb.watch/atqDEAs_32/
ich kann Frau Woods leider nicht helfen, war vom 27.05.1978 bis 21.02.1980
auf der MS Siegerland unsere Fahrt ging von Rotterdam nach Portugal nach Schweden und zurück nach Rotterdam.
Eine tolle Zeit :) Hat noch jemand Bilder von der MS Siegerland ?????
Literatur:
– Andreas Eichmüller: Die Strafverfolgung von NS-Verbrechen durch west-deutsche Justizbehörden seit 1945. Eine Zahlenbilanz, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, Jg. 56 (2008) Heft 4, S 621 – 640
– Bundesministerium für Inneres, Bau und Heimat: Perspektivwechsel.
Nachholende Gerechtigkeit. Partizipation. Bericht der Unabhängigen Kommission Antiziganismus, Berlin 2021, Link: https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/PDF/UKA/Bericht_UKA_Perspektivwechsel_Nachholende_Gerechtigkeit_Partizipation.pdf
– Opfermann, Ulrich F.: Zum Umgang der deutschen Justiz mit an der Roma-Minderheit begangenen NS-Verbrechen nach 1945. Das Sammelverfahren
zum „Zigeunerkomplex“ (1958–1970). Expertise für die Unabhängige Kommission Antiziganismus: Unveröffentlichte Fassung, 2020.
– Opfermann, Ulrich F.: „Genozid und Justiz. Schlussstrich als ‚staatspolitische Zielsetzung‘“, In: Zigeunerverfolgung im Rheinland und in Westfalen 1933–1945. Geschichte, Aufarbeitung und Erinnerung, herausgegeben von Karola Fings und Ulrich F. Opfermann, 233–255. Paderborn 2012
Auch ich Brigitte Schuss möchte einen kleinen Beitrag senden:von 1974bis1976 war ich in der Tagesschule für Englisch und ich musste meine Diplomarbeit inEnglisch über Charles Dickens verfassen….auch war unsere Studienreise nach London ein Erlebnis…zumal Dr.Bode unsere Gruppe mit einen hocherhobenem Stock mit Wimpel!!!!In Schach hielt…man wusste immer wo er sich befand….einfach sensationell….lieben Gruss Brigitte Schuss…..
In der in Siegen von 1986 bis 1993 erschienenen Zeitschrift „der TIPP“ sind folgende Artikel nachweisbar:
– [thostra]: „Bis jetzt wurde hier nur gelogen“. 40 Jahre nach Auschwitz: NS-Prozeß in Siegen, der Tipp 7/8 (1987), S. 6 – 7
– [Raimund Hellwig]: Täter in Auschwitz – Ein Verfahren schreitet voran. Mord im KZ: Der Prozeß gegen Ernst Augsut König (Teil I), der Tipp,4 (1988), S. 10 – 12
– [U.O]: Nur Kavaliersdelikte? NS-Verbrechen und die heutige Justiz, der Tipp,4 (1988), S. 12
Anmerkung: Der zweite Teil des Berichtes von Raimund Hellwig wurde für das Heft 5/88 angekündigt. Die genauen Angaben müssen noch nachgetragen werden.
Weitere Quelle zur Fritz Müller:
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, I. HA Rep. 84a [Justizministerium], Nr. 54083 Strafverfahren gegen den Nationalsozialisten Friedrich Wilhelm Müller in Obersdorf, Kreis Siegen, wegen Vergehen gegen das Republikschutzgesetz in einer Rede in einer Versammlung der NSDAP in Langenbach bei Neuwied
Eltern haben 1988 in einem großen Schulkampf die erste Gesamtschule in Siegen erkämpft.
Oberkreisdirektor Karl- Heinz Forster hat sie dabei unterstützt. Durch Ersatzvornahme über das OVG- Münster hat er es geschafft, das Anmeldeverfahren in einem Siegener Schulgebäude zu ermöglichen. Zuvor hatte die Stadt Siegen (Beigeordneter Koch) den Beauftragten des Regierungsbezirks Arnsberg, Jörg Raguse (späterer Schulleiter), der das Anmeldeverfahren durchführen wollte, des Gebäudes zu verweisen. Bürgermeister war Hans Reinhardt SPD, der im Nachgang die SPD verließ und die UWG gründete
Nachdem die erforderlichen 112 Anmeldungen zusammen waren, konnte die Schule durch Ratsbeschluss mit den Stimmen von Grünen, SPD und FDP im Sommer 1988 ihren Betrieb aufnehmen. Eine 2. Gesamtschule folgte ein Jahr später. Heute gibt es drei Integrierte Gesamtschulen in Siegen. Ein Erfolgsmodell.
Danke an Karl-Heinz Forster.!
Moin Moin :-)
ich weis nicht ob Sie mir helfen können. Ich bin gebürtig vom WW, heute 62 Jahre Hier und da erzählt man von früher. So auch gestern. Thema die Siegtalbrücke.
Ich meine mich zu erinnern, dass es damals beim Bau 1964 – 1970 irgendwann einen Arbeitsunfall gegeben hat und ein bauarbeiter in den frischen Beton eines Brückenpfeilers gefallen ist und nicht gerettet werden konnt. Ist das Wahrheit oder eine zusammengesponnene Kindererinnerung?
Freue mich auf Ihre Rückantwort.
Mit freundlichen Grüßen
Gisela Karst
Leider habe ich mich noch nicht intensiv mit der Baugeschichte der Brücke auseinandergesetzt. Daher empfehle ich eine Anfrage an die Heimatgruppe Niederschelden, die diese Ausstellung ausgerichtet hat. Vielleicht weiß man dort mehr. Wenn nicht, dann muss wohl eine Auswertung der lokalen Presse im Siegener Stadtarchiv erfolgen, die u. U. über diesen Arbeitsunfall berichtet hat.
In der Siegener Zeitung erschien am 7. Januar 1985 der auch heute noch lesenwerte Artikel „Von Illusionen, Utopien und Realitäten im Städtebau. Erinnerungen, Gedanken und Vorschläge des Siegener Architekten Dipl. Ing. Walter Bonin“ – Danke für den Hinweis an HWG!
Heute erschienen in der Siegener Zeitung – leider nur im Print – der Artikel „Die Unliebsamen. Namensgeber für Siegener Straßen fallen in Ungnade. Acht historische Persönlichkeiten, acht Vorwürfe der Nähe zu den Nazis.“ von Irene Hermann Sobotka zur Arbeit des Arbeitskreises und der dazugehörige Kommentar der Autorin mit der Überschrift „Schilderstürmer“.
Nicht unerwartet erschienen heute in der Siegener Zeitung 2 Leserbriefe zu den beabsichtigten Straßenumbennungen. „Linke Ideologie“ unterstellt dem Arbeitskreis ebensolche und weist daraufhin, dass auch Martin Luther antisemitisch gewesen sei. Eine Umbennung dieser Siegener Straße aber nicht vorgesehen sei. Zudem wünscht der Schreiber, dass die Gesamtlebensleistung aus ihrer Zeit heraus gewürdigt werden sollte. So sollen bspw. die enormen Wahlerfolge Adolf Stoeckers berücksichtigt werden. Der 2. Leserbrief „Ersatz wäre denkbar“ begrüßt die Umbennung der Hindenburgstraße, verweist auf die unterschiedlichen Schreibweisen Stö-Stoeckers und widmet sich – off topic- der Kunst Hermann Kuhmichels im öffentlichen Raum, die aus der NS-Zeit stammt (Rubens-Brunnen am Oberen Schloss.) Hierfür schlägt einen Ersatz vor.
Heute sind es 4 Leserbriefe in der Siegener Zeitung zum Thema:
– „Personen herabgesetzt“ bedankt sich für den Kommentar und unterstellt dem Vorsitzenden des Arbeitkreis, dies getan zu haben, nicht ohne daraufhin zu weisen, dass auch er sich ja eventuell für seine Äußerungen zu verantworten habe.
– „Nur nach rechts“ bedankt sich für den Kommentar und bemängelt die politische Einseitigekeit bei der Auswahl der Personen.
– „Deckungsgleich“ bedankt sich für den Kommentar, weist allerdings auf eine dortige Verwechslung hin (Jacob Heinrich Schmick – Jacob Henrich) und warnt vor „unhistorischen Eifer“ bei Straßenumbenennungen.
– „Tätersuche beenden“ ist verwundert über ein „Sendungsbewusstsein“, das „nach etwa 80 Jahren“, die „deutsche Geschichte neu schreiben“ will und verweist darauf, dass die Mitgliedschaft in einer nationalsozialistischen kein Kriterium zur Bewertung einer Lebensleistung sein solle.
Gestern erschienen in der Siegener Zeitung 5 Leserbriefe zum Thema:
– „Geschichte bewahren“ fordert die vom Arbeitskreis angekündigt Transparenz ein und kündigt eine aktive Beteiligung der Zivilgesellschaft an. Das angekündigte Servicepaket für den von evt. Umbenennungen Betroffenen wird begrüßt. Straßennamen seien „Teil der Erinnerungs- und Lernkultur“, so daß die Erfahrungen mit ergänzenden und erklärenden Schildern genutzt werden sollen.
– „Unfair bewertet“ sieht der Leserbriefschreiber den Reichspräsident Hindenburg, da die nach ihm benannte Straße umbenannt werden soll. (“ … trotz dem hat er sich 1925 und 1930 als Reichspräsident die Verfassung und Republik geschützt ….“). Entgegen der Einschätzung des Arbeitskreises, die lediglich eine Erläuterung bei der Graf-Luckner-Straße vorsieht, fordert der Leserbrief eine Umbenennung („Graf Luckner war eine der vielen Personen, mit denen man in der Weimarer Republik der männlichen Jugend den Weltkrieg als Abenteuer verkaufte. Wie es wirklich war, kann man bei Remarque nachlesen.“)
– Anstelle Plätze und Straßen nach Personen zu benennen empfiehlt ein weiterer Leserbrief „Durchnummerieren“.
– „Welch ein Irrsinn“ sei die „plötzlich“e Prüfung und ggf. Umbenennung von Straßennamen, „weil irgendwer in den 1930er Jahren womöglich mal Adolf Hitler Guten Tag gesagt hat.“
– „Besser aufklären“ als umbenennen fordert ein weiterer Leserbrief.
„…Deutungen und Erzählungenverraten…“ Ich spendiere eine _ hier; auch der Geschichtswerkstatt.
Ich denke aber nicht, dass dieser Lapsus dazu geführt hat, dass die in der Thematik engagierte Heimatzeitung den entsprechenden Textabschnitt nicht wiedergegeben hat.
Vielen Dank für den Kommentar! Der Fehler wurde korrigiert. Um das Engagement der „Heimatzeitung“ bewerten zu können, wird, der erwähnte Artikel hier noch nachgereicht werden. In der Tat war die Geschichtswerkstatt Siegen hier schneller. Dies hatte , sagen wir einmal, technische und private Gründe …..
In der frisch erschienen Broschüre „Das Leben des Hugo Herrmann. Letzter Repräsentant der ehemaligen jüdischen Gemeinde in Siegen“ von Traute Fries findet sichauf S. 32 der Hinweis, dass Heinrich Böll am 15.11.1961 im Siegener Mädchengymnasium gesprochen hat.
Das NRW-Zeitungsportal liefert mit zunehmend durch Texterkennung erschlossenen Zeitungstiteln immer weitere Funde zu Lothar Irle:
1) Bochumer Anzeiger, 20.6.1934:
Vor dem NSLB im Kreis Wattenscheid hält Lothar Irle am 20.6.1934 vor der Kreisversammlung einen Vortrag zum Thema „Familienkunde“.
2) Bochumer Anzeiger, 12.12.1938:
In der Gauarbeitsgemeinschaft für deutsche Volkskunde übernimmt Lothar Irle die Arbeitsgemeinschaft „Wissenschaftliche Volkskunde“.
Heute erschienen im Print weitere Leserbriefe zum Thema:
– In „Erhebliche Kosten“ schlägt der Leserbriefschreiber vor, die belasteten Straßennamen beizubehalten und die Schilder mit einem kleinen Schild mit QR-Code zu versehen, um die Kosten einer Umbenennung zu sparen.
– Der Leserbrief „Fragwürdige „Belege““ nimmt lediglich Bezug auf einen Leserbrief vom 10.2., der einen Ersatz für den Rubens-Brunnen Hermann Kuhmichels anregte. Er verweist auf die problematische Quellenlage bei der Erforschung von Biographien während der NS-Zeit, die eine gründliche Quellenkritik erfordert.
„„Archiv für alternatives Schrifttum“ Größte private Sammlung linker Schriften sieht sich in Existenz gefährdet – Afas in Duisburg kritisiert Politik. Das Archiv für alternatives Schrifttum in Duisburg sieht sich in seiner Existenz gefährdet.“ Deutschlandfunk, Nachrichten v. 11.2.2022, via Archivalia v. 15.2.22
Präzisierung durch das afas am 21.2.2022:
„Am 11. Februar sendete der Deutschlandfunk ein Interview mit Jürgen Bacia über das afas und seine aktuelle Finanzierungssituation. Wir freuen uns über den Bericht, die anschließenden Artikel in den Online- und Printmedien und die Diskussion in den sozialen Netzwerken. Aufgrund der notwendigerweise gekürzten Form des Radio-Interviews kann es zu Missverständnissen kommen, die einiger Anmerkungen bedürfen:
– Jürgen Bacia ist nicht hauptverantwortlicher Leiter des afas, sondern Teil des Leitungsteams
– Das afas erhält den überwiegenden Teil seiner Förderungen über Projektmittel des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW
– Die afas-Sammlung umfasst das gesamte Spektrum der Neuen Sozialen Bewegungen
– Das afas ist nicht das größte Archiv Deutschlands (sondern das größte Freie Archiv)“
Zu Irle s. a. SGV-Bezirk Siegerland (Hg.): 100 Jahre Kindelsbergturm. Festschrift zum Jubiläum am 17. Mai 2007, Christi Himmelfahrt, Siegen 2007, S. 51 58
Nur eine Lappalie:
Nachdem die von der Siegener Zeitung (Anm. 83) gelegte Spur zur „National Geographic Society“ in die Irre geführt hat (Warum hätte er dort auch Mitglied sein sollen?), schlage ich vor, es einmal bei der „National Genealogical Society“ (https://www.ngsgenealogy.org) zu versuchen.
Nach der Veröffentlichung des Artikels in Wikipedia erhielt ich den Anruf eines Nachkommens des Amtmannes Vollmer, der Vollmers Exemplar der Festordnung zum 24. September 1911 zur Verfügung stellte. Der Scan des historischen Dokuments ist bereits in den Artikel eingepflegt. Auf der Rückseite der Einladung findet sich ein Schreiben Vollmers zur Reichstagswahl (1912?).
Lieber Herr Lohrum,
in meinem im Dezember bei Hnetrich / Hentrich erschinenen Buch „Eine Waschmaschine in Haifa“ geht es um 14 Briefe aus der Nahkriegszeit. Besagte Waschmaschine soll, so in einem der Briefe, 1936 aus Siegen gekommen sein. Sie wurde durch die Familie Katz von Schenklengsfeld mit nach Palästina genommen.
Vielleicht können Sie mir helfen. Ich suche den Hersteller und von da aus würde ich einen Katalog suchen. Manchmal hat man ja Glück.
Mit freundlichen Grüßen, Marion Welsch
Der Beitrag „Aus dem Leben eines tatkräftigen Stadtbaurates. Johannes Scheppigvon 1902 bis 1937 auf verantwortungsvollem Osten in Siegen“, Unser Heimatland 1983, S. 65 – 69, enthät auf S. 69 auch Hinweise zu Fissmer:
„….. Nach dem Kriegsende 1919/1920 trat Oberbürgermeister Anton Delius in den Ruhestand. An seiner Stelle zog Herr Alfred Fissmer in die Chefetage des Rathauses ein.
Von dem Verkauf des E[lektrizitäs]-W[erks]. und des Gaswerks hatte ich schon erzählt. Als letztes Objekt gelang es dem neuen Stadtoberhaupt, Das Oberlyzeum an den Mann, d. h. an den preußischen Staat zu bringen, der allerdings den Umbau des Gebäudes verlangte. Diese schöne Aufgabe fiel mir zu.
Größere Schwierigkeiten entstanden Herrn Spiegelberg als Bauleiter und mir als Chef beim Bau des neuen Krankenhauses am Kohlbett, weil selbstverständliche Einrichtungen, im Krankenhausbau unabdingbare Bestandteile, z. B. Doppeltüren in den Zimmern der Privatstationen und anderes mehr als zu teuer, dem branchenfremden Rotstift des Oberbürgermeisters zum Opfer fielen.
Eine weiter schöne, wenn auch kleine Aufgabe war die Umgestaltung des Leimbacher Weihers zum Freibad. Dieses Bauvorhaben wurde vom Magistrat beschlossen und begonnen, als Herr Fissmer in Urlaub war. …..
Gegen Ende meiner Dienstzeit fiel mir noch eine nicht große aber reizvolle Aufgabe zu. Siegen, als wirtschaftlicher Mittelpunkt von Südwestfalen, hatte endlich das ihm zukommende Landgericht erhalten. Da die Stadt die Kosten für den Umbau des als Sitz vorgesehenen Unteren Schlosses tragen musste, und ich die Verhandlungen mit dem Ministerialrat aus Berlin geführt hatte, schlug dieser mich als mit der MAterie vertrauter Bauleiter . ….“
Für das Siegerland sind die Opfer des Zwangsarbeitseinsatzes aus den besetzten Gebieten der Sowjetunion durch Namenslisten gut dokumentiert. Diese Listen hatten die Firmen nach dem NS-Ende für die Flüchtlingsorganisation der UNO zu erstellen. Sie zeigen einen sehr hohen Anteil von Arbeitskräften aus dem Donbass, also den Bergbaugebieten im Osten der Ukraine mit einer Bevölkerung, die sich in hohem Maße nicht als „ukrainisch“, sondern als „russisch“ betrachtet (was damals unwesentlich war, man war die sog. „Nationalitäten“ übergreifend Sowjetbürger. Es wäre in der Sache verfehlt, hier dem ukrainischen Neo-Nationalismus und Neo-Ultranationalismus Folge zu leisten und die nichtüberlebenden Opfer nun nachträglich und aus einer politischen Opportunität heraus zu nationalisieren.
Die Zahl der Toten dürfte, wie auch diese Listen anzeigen, deutlich über dem liegen, was das AMS-Gedenkbuch ausweist. Da ich über Listenkopien verfüge, hatte ich seinerzeit begonnen, sie systematisch für Eintragungen in das Gedenkbuch durchzugehen, kam aber leider nicht weit, weil mir der Schreibzugang zum Gedenkbuch gesperrt wurde. Die Erklärung dafür liegt nicht in vergangenheitspolitischen Kontroversen, sondern in einem formalen Detail. Man konnte sich nicht einigen, ob bei Datumsangaben bei nur einer Tages- oder Monatsangabe zusätzlich eine Null zu setzen war. Das erinnerte mich an bürokratische Praktiken und widersprach dem Duden, ich lehnte das also ab. Allerdings ist schon anzumerken, dass die komplette Übernahme der bekannten Fälle der die Zwangsarbeit nicht Überlebenden die Zahlenrelation zwischen den verschiedenen Opfergruppen erheblich verändern würde, möglicherweise auch was die Hauptgruppen der Betroffenheit angeht.
„Das Volk“ war bis auf ein paar Jahr nach der Machtübergabe keine Wochen-, sondern ein Tageszeitung. Sie hatte ein klares politisches Profil, denn sie war immer das Organ der sog. „Stoecker-Bewegung“, sprich der antisemitischen Christlich-Sozialen innerhalb des deutschnational-konservativen Meinungsspektrums. Das sollte, wie ich meine, durchaus in einem solchen Hinweis einen Platz haben. Dass die Einstellung des Blatts „infolge des Zweiten Weltkriegs“ geschah, ist eine unbelegte Vermutung. Kriegsereignisse waren 1941 an der Heimatfront noch nicht zu konstatieren. Die Gründe liegen im Dunkel. Plausibel wäre, dass Ressourcen eingespart werden konnten, nachdem mit der „Siegener Zeitung“ und der „National-Zeitung“ bereits zwei Blätter mit Nazi-Inhalt im Einvernehmen ihrer beider Verlage im Siegerland existierten und ein drittes Propagandaorgan überflüssig war, zumal viele der vormaligen Leser sich inzwischen in die NS-Organisationen eingegliedert hatte.
Um die Feststellung, dass „Das Volk“ einen aggressiv antisemitischen Kurs vertrat, zu veranschaulichen der Einfachheit halber einige Beispiele aus den Beiträgen des Stammautors Jakob Henrich („Bergfrieder“, Straßennamenstifter). Ich entnahm sie meinem Buch „Mit Scheibenklirren und Johlen“. Juden und Volksgemeinschaft, Siegen 2009, S. 58. Die Belegstellen sind den dortigen Fußnoten zu entnehmen:
„Seine Eltern hätten ihm, klagte er [= Jakob Henrich], einen „verworfenen Namen angehängt“. Der sei der Namensstifter „jener Erzvater der Juden“, der „geschäftelte wie ein Handelsmann“, wie es in der abwertenden Anspielung vom „wahren Jakob“ zum Ausdruck komme. Henrich schrieb als „Bergfrieder“ eine wöchentliche heimatschwärmerische politische Kolumne in Das Volk, nie ohne antisemitische Akzente. Für Henrich war eine Tagung der Nationalsozialisten „vom 15.-17. Ernting d. J.“ 1925 ein Lichtblick, weil sie alkohol- und nikotinfrei abgehalten worden sei. „Denn“ – er zitierte zustimmend die Begründung – „für Ahasver (den ewigen Juden!) sind die Rauch- und Rauschgifte nur Mittel zum Zweck, um die feinsten Nerven und den Willen der Wirtsvölker zu töten und die Betäubung ganz zu fesseln.“ Er ruhte nicht, das „verderbliche Treiben des jüdischen und verjudeten Linksertums“ anzuprangern, wandte sich gegen den Einfluss der „jüdisch vergifteten“ Arbeiterbewegung oder gegen die „Ueberfremdung deutschen Besitzes und deutschen Geistes und Blutes“ – selbstredend vornehmlich durch jüdischen übermächtigen Einfluss.“
Danke für die Präzisierung! Ich hatte lediglich die späteren Jahrgänge aufgerufen. Mir scheint die Geschichte des Blattes durchaus näher betrachtenswert, denn die ersten Jahrgänge erschienen nicht nur als Tageszeitung, sondern auch noch in Berlin. Später übernahm der Hagener Verleger Otto Rippel das Blatt und die Zeitung erschien in Siegen.
Zu Jakob Henrich s. a. https://www.siwiarchiv.de/heute-vor-160-jahren-jakob-henrich-geboren/
Ja, die Zeitung war seit Anbeginn das Zentralorgan dieser „Christlich-Sozialen“, die ja in den von ihnen vertretenen völkischen Inhalten über den Antisemitismus weit hinaus und auch als „Bewegung“, als die sie sich betrachteten, als Vorläufer der NS-Bewegung einzuordnen wären.
Wenig bekannt, aber bemerkenswert: Schon in den 1920er Jahren forderten sie „Konzentrationslager“ für „Ostjuden“. So in „Das Volk“ nachzulesen.
Rippel gehörte nach 1945 übrigens zu den Gründern der CDU.
Ich habe einmal das regionale Personenlexikon nach der Mitgliedschaft Christlich-Sozialen Volksdienst (bzw. EVD) durchsucht. Das Ergebnis lautet: Ernst Bach, Friedrich Barth, Otto Beckmann, Karl Bender, Hermann Böcking, Jakob Böcking, Karl Böcking, Karl Breitenbach, Robert Eliseit, Paul Fay, Wilhelm Fischbach II, Alfred Flender, Robert Flender, Rudolf Flender, Rudolf Flender, Rudolf Gädeke, Walter Heide, Friedrich Wilhelm Heider sen, Jakob Henrich, Alexander Hirschfeld, Oskar Höfer, Karl Hofmann, Otto Klein, Otto Marx, Bernhard Meuser, Albert Münker, Friedrich „Fritz“ Münker, Walter Nehm, Friedrich Ohrndorf, Artur Reiffenrath, Hermann Reuter, Otto Rippel, Friedrich Wilhelm Roth, Ewald Sahm, Heinrich Schäfer, Paul Schmidt, Wilhelm Schütz, (Theodor Siebel), Wilhelm Spies, Theodor „Theo“ Steinbrück, Gustav Strackbein, Albert Vogel, Ernst Weißelberg. Lehrer Fabrikanten, Geistliche, Verwaltungsbeamte, Medienvertreter, …. – eine interessante Gruppe. Daher ist die Online-Verfügbarkeit der Zeitung „Das Volk“ so wichtig.
Die Soldarität wird zwangsläufig an ihre Grenzen stoßen. Das ist auch die Meinung führender Ministerpräsidenten in der BRD. Wo nichts mehr ist, kann auch nichts mehr verteilt werden. Verdoppelung des Militärhaushaltes? Wo soll das Geld herkommen? Flüchtlingshilfe? Woher soll der Wohnraum kommen? Woher die Hartz-IV-Hilfen? Teuerung? Benzin? Senkung der Wohnkosten für Arme? All das sind Faktoren, die indirekt die Archive treffen werden. Denn überall schwebt das Damklesschwert der steigenden Kosten. Hilfszusagen sind ja recht und schön. Wie wollen deutsche Archivare und Archivarinnen aber konkret helfen, wenn die eigenen Mittel schwinden? Schon mal auf die Zapfsäulen geblickt? Auch Archive müssen heizen, auch archive benutzen Transportwagen, auch Archive müssen Gebäudestrukturen erhalten.
Keiner hat je behauptet, dass Solidarität zum Nulltarif erfolgt. Solidarität heißt immer sich einzuschränken, um den anderen zu helfen. Wie können Archive helfen ? Z. B. Raum zur Verfügung stellen, falls Archivgut geflüchtet wird, Lieferung von Restaurierungsmaterial, Notfallboxen etc. ….. oder so s. https://www.sucho.org/.
Zudem sind die Wünsche der ukrainischen Kolleg:innen an die Archive andere: Ausschluss der russischen Verttreter:innen aus den Gremien des Internationalen Archivrates (ICA), worüber übrigens heute entschieden werden soll, sowie Unterstützung des Wunsches der Ukraine zum Beitritt in die EU.
Letztlich schlägt die große Stunde archivischer Solidarität wohl erst im Friedensfall, wenn es sich um die Wiederherstellung zerstörter Archive handelt – da haben wir ja in Deutschland inzwischen traurigerweise genug Expertise (Flutkatastrophen an Elbe und Ahr, Stadtarchiv Köln). Allerdings ist m. W. halbwegs verlässlich erst ein Archiv in Charkiv betroffen. Ein weitere Archivzerstörung (Chernihiv) konnte noch nicht bestätitgt werden – https://archaeologik.blogspot.com/2022/03/propagandakrieg-im-kleinen-die.html .
Vermutlich Spam: [Träumereien. Bei den steigenden Preisen wird in Zukunft jedes Archiv froh sein, wenn es den nötigsten Service zur Verfügung stellen kann. Ich bin ganz klar gegen jede Hilfe. 2035 wird der große Schnitt kommen. Dann gehen die geburtenstarken 68er Jahrgänge in Rente. D.h. dass alle öffentlichen Ausgaben wesentlich erhöht werden müssen, da signifikant weniger produktive Steuerzahler zur Verfügung stehen. Mit anderen Worten: Jede Hilfe, die man jetzt gewährt, wird später fehlen, Massenarmut zu bekämpfen. Für Archive wird nicht mehr viel Geld da sein. Das sind keine Schauermärchen, sondern knallharte Kallkulationen, die überaus realistisch sind. Es ist in diesem Staat nur auf wenig Ebenen wirklich vorgesorgt worden. Deutsche Archive werden sich in Zukunft selbst beim Klopapier einschränken müssen. Die derzeitige ökonomische Lage ist absolut bedenklich und keineswegs Resultat der Coronakrise und des Ukrainekonflikts. Sie liegt in Fehlentscheidungen der EZB-Notenbank begründet. Bitte: Man kann das komisches Geschwurbel abtun, doch sollte man stets bedenken, dass die derzeitigen Preissteigerungen schon jetzt extrem gravierende Folgen für viele Lebensbereiche haben. Heizöl: Plus 76,5 Prozent, Benzin: Plus 28,4 Prozent. Diese Preise werden weitergegeben. Ich glaube nicht, dass man sich auf Dauer „einschränken“ kann. Hier wird über Luxusprobleme gesprochen. Wie begegnen die Archive dem Problem der Inflation? Mir stehen die Haare zu Berge, wenn ich sehe, was für ökonomische Fehlentscheidungen in diesem Land getroffen werden!]
Suche für ein Ahnenforschungsprojekt nähere Angaben über einen Emil Pfeil, geboren am 4. März 1886 in Langenau/Buschhütten, soll in Marburg aufgewachsen sein (keine Meldedaten vorhanden) und migrierte 1912 in die USA
Sehr geehrter Herr Pfeil, ich gehe davon aus, dass sich wegen des Geburtsortes bereits an das zuständige Stadtarchiv Kreuztal gewendet haben. Vielleicht ist dort auch der Wegzug nach Marburg in Melderegistern nachweisbar. Wegen Emigration in die USA, kann vielleicht das zuständige Staatsarchiv in Marburg weiterhelfen.
Herr Heinz Pfeil ist, wie aus seiner Anfrage geschlossen werden kann, ein Freund knapper Worte. Das ist grundsätzlich lobenswert, obwohl es sich in manchen Fällen (nämlich wenn man etwas von jemandem will) mit den Geboten der Höflichkeit schwer vereinbaren lässt.
Ein Zeitungsartikel von Heinz Pfeil (https://www.myheimat.de/marburg/kultur/wer-hat-meine-kindheit-gestohlen-d3149159.html) enthüllt den Umfang seiner bisherigen erfolgreichen Recherchen. Es wäre rücksichtsvoll gegenüber den Empfängern dieser Anfrage gewesen, darauf hinzuweisen, was bereits bekannt ist (z.B. die auf https://mineralien.lima-city.de/familiengruppe/f202.htm gezeigte Kreuztaler Geburtsurkunde oder die auf https://www.alaskahistory.org/biographies/pfeil-emil-h zu findende recht ausführliche Biographie Emil Pfeils und seiner Ehefrau Muriel) und welches konkrete Zeitfenster (nämlich zwischen dem Umzug nach Marburg und der Auswanderung) überhaupt nur noch von Interesse ist. Unser Kreisarchivar hätte heute morgen um 6:55 Uhr sicher Sinnvolleres mit seiner Zeit anfangen können, als sich Gedanken über eine so wenig ernstzunehmende Anfrage zu machen.
Heute erschien in der Siegener Zeitung folgender Artikel zum Verlauf der Kreiskulturausschusssitzung:
„Industriegeschichte europaweit bedeutend
Das Nein aus Münster war eindeutig: Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe wird kein eigenes Industriemuseum im Kreis Siegen-Wittgenstein einrichten. Im Kreiskulturausschuss stieß die Ablehnung vor allem bei der FDP-Fraktion, die die Idee eines solchen Museums auf den Tisch gebracht hatte, auf wenig Begeisterung.
FDP-Sprecher Guido Müller fand die Haltung des LWL „beschämend“ und wunderte sich über die „Entspanntheit“, mit der sowohl Ausschussvorsitzender Hermann Josef Droege (CDU) als auch Landrat Andreas Müller (SPD) auf die Ablehnung reagierten.
Guido Müller fand, dass man beim LWL die Bedeutung Siegen-Wittgensteins für die Industriegeschichte ganz Europas nicht verstanden habe. Die Röstöfen der Grube Storch &Schöneberg in Gosenbach, die vom LWL als ein bedeutendes Zeugnis angesehen wurden, „sind weder attraktiv für Besucher noch werden wir jemals Gelegeneheit haben, auf diesem Grundstück etwas einzurichten“, schimpfte der Liberale.
Der Landrat sah sich nicht als Adressat für die Schelte: „Das muss man in der Landschaftsversammlung formulieren.“. Hermann Josef Droege blieb entspannt: „Das kann man alles bedauern, aber man muss sich fragen, ob man sich weiter verkämpfen will.“ Droege plädierte dafür, die Idee eines virtuellen Museums zu verfolgen.“
Den u.a. Kommentar hatte ich bereits am 5.5.2021 der FDP- Kreistagsfraktion, Siegen-Wittgenstein auf ihrer facebook-Seite übermittelt, er blieb aber bisher recht gut versteckt unkommentiert.
Zum Bunkerprojekt bleibt noch nachträglich anzumerken, dass bei der „derzeitigen Krisenlage“ (Zeitwende !) die Vernichtung von „Schutzräumen“ doch recht unverantwortlich erscheinen.
hier mein fb-Kommentar vom 5.5.´21 zur FDP-Aktivität:
Die Betrebungen der FDP-Kreistagsfraktion sind ja recht anerkennenswert, jedoch stellt sich hier die Frage, warum die „Polit-Aktivisten“ sich bisher denn niemals um dieses schon jahrzehntealte Thema gekümmert haben. Ist denn niemandem bisher aufgefallen, dass es keinen authentisch historischen Ort innerhalb des Siegerlandes mehr gibt, wo noch irgendein Original Zeugnis der alten Montan-Industriekultur erhalten geblieben ist. Einen geeigneten verkehrsgünstigen historischen Ort für den erforderlichen Neubau, oder Ausbau eines Siegerländer-Industriemuseums kann man vielleicht ja u.U. noch finden (s.a. div. Vorschläge i.d. Literatur), aber man wird vom LWL oder der NRW-Landesregierung sicher keinerlei finanzielle Unterstützung erwarten können, wenn sich nicht zuvor die Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Siegen einig wird, um gemeinsam einen bestgeeigneten Ort für ein derartiges Industriemuseum als Außenstelle des Siegerlandmuseums im Siegerland (und nicht ausschließlich in der Stadt Siegen) zu finden.
Die latenezeitlichen Ausgrabungen in Niederschelden- Gerhardseifen liegen aber dafür wohl verkehrsmäßig etwas zu ungünstig.
Die Bestrebungen der Stadt Siegen den Burgstraßenbunker für eine Erweiterung des Siegerlandmuseums (Abt. Siegerländer Montan-Industriekultur) für über 16 Mio Euro mit Landes-Steuermitteln erst einmal publikumsbegehbar zu machen, ohne auch nur einen einzigen historischen örtlichen Bezug zum Thema und auch nebenbei ohne die erforderlich günstige Verkehrserschließung für Massenbesucher, die ein solches Museum bieten muss, sollte doch zumindest Herrn Landrat Müller und eigentlich auch der FDP-Kreitagsfraktion bekannt sein.
Es wäre eigentlich recht schade, wenn sich diese begrüßenswerte Aktivität mehr oder weniger nur als eine Wahl-Werbung der Kreistags-FDP herausstellen sollte.
Hallo Herr Dick, habe Ihre Anfrage gerade durch Zufall erhalten. Gerne nehme ich dazu Stellung. Würde morgen, wenn ich wieder Zugriff auf einen Laptop statt Handy habe eine Antwort geben.
Literatur zur Zwangsarbeit im Altkreis Wittgenstein:
– Achinger, Gerda Kyrillische Texte auf einer Wand der ehemaligen Arrestzelle in Arfeld, Wittgenstein, Jg. 65 (2001), Bd. 89, Heft 2, S. 51-55
– Achinger, Gerda Eine „Sonderbehandlung“ bei Arfeld. Die Hinrichtung des polnischen Zivilarbeiters Jan Zybóra, Wittgenstein, Jg. 98 (2010), Bd. 74, Heft 2, S. 45-68
– Dickel, Lars-Peter Zwangsarbeit im Landkreis Wittgenstein 1940 bis 1945
Gießen 2004, 220 Seiten, Magisterarbeit
– Kohlberger, Zwangsarbeiter in Niederlaasphe
Hans-Armin,Dorfbuch Niederlaasphe 1307-2007. Niederlaasphe 2007, S. 127-128
– Lange, Karl-Otto Kindheitserinnerungen, In: Begegnungen mit ehemaligen Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen im Wittgenstein. Dokumentation eines Projektes, (Hgg.) Arbeitskreis für Toleranz und Zivilcourage Bad Berleburg, Eitorf 2010, Seiten 57-60
– Prange, Hartmut Kriegsgräber russischer und polnischer Zwangsarbeiter auf dem Friedhof „Am Sengelsberg“ in Bad Berleburg, Wittgenstein, Jg. 95 (2007), Bd. 71, Heft 3, S. 88-96
– Prange, Hartmut Zwangsarbeiter bei der Fürstlichen Verwaltung in Berleburg
Wittgenstein, Jg. 98 (2010), Bd. 74, Heft 4, S. 142-150
– Schneider, Peter Im 20. Jahrhundert, Die wackere Gemeinde Schameder, Schmallenberg 2020, S. 282-295
[1. Weltkrieg, Spanische Grippe, Nationalsozialismus, Flugtag,
Flugplatz, 2. Weltkrieg, Zwangsarbeiter
So, am PC lässt sich doch komfortabler schreiben. Sie haben recht, Herr Dick, dass viele bauliche Zeitzeugen nicht mehr existieren. Die verfallenen Gruben wurde aus Bequemlichkeit und Sicherheit in den 70er und 80er Jahren einfach abgetragen. Ich selbst war als Kind im Leimbaahtal unterwegs und sowohl die Arbeitersiedlung als auch die Grube Ameise waren für uns Abenteuerspielplätze und gerne zu erwandernde Ziele. Schaut man heute in Orte wie Gosenbach, glaubt man kaum, dass hier mal einst eine der größten Gruben Deutschlands stand. Die Kritik der FDP an den LWL richtet sich auch darauf. Der LWL hat nicht erkannt, dass hier im Siegerland das industrielle Herz Europas (und damit der alten Welt) geschlagen hat und in einigen Bereichen noch immer noch schlägt. Ich bin Prof. Schawacht, ehemaliger Museumsdirektor im Siegerland Museum, sehr dankbar für die vor allem von ihm initiierte Ausstellung zur Wirtschaftsgeschichte im Oberen Schloss. Seit den 90er Jahren ist die aber nicht einmal neu angepackt worden. Und ich stimme Ihnen Herr Dick zu, dass eigentlich an echten historischen Orten diese Geschichte erlebbar gemacht werden muss. Deshalb will sich der Kulturausschuss des Kreises jetzt dem Thema virtuell nähern. Ich hoffe, dass die bestehenden Ziele (Altenberg, Gerhardseifen etc.) dabei live erfahren werden können. Ich würde darüber hinaus gerne die Geschichte entlang der Eisenstraße historisch erlebbar machen. Der Kreis wird eine Arbeitsgruppe einrichten, der ich mich als studierter Historiker gerne anschließen werden. Ob Stadt und Kreis an einem Strang ziehen werden? Keine Ahnung, das bleibt abzuwarten. Aber eine „Plattenausstellung“ in einem Museumssaal wird dem Thema alleine sicher nicht gerecht.
Der damals 29-jährige Regierungsassessor und „Landrathsamtsverweser“ Karl Thielen war nicht nur dienstlich in Berleburg. Sein Eintrag im Heiratsregister der ev. Stadtkirche weist auf sein Aufgebot und die Heirat am 24. September 1861 am Dienstort seines Schwiegervaters in Arnsberg hin. Zudem wurde Thielens erstes Kind, die Tochter Emma, 1862 in Berleburg geboren.
Die Rolle der SIEMAG und die von Bernhard Weiss wird im folgenden Buch beleuchtet, es geht sogar auf die Zeit davor ein, einschließlich des 1. Weltkrieges:
Heimat-Fremde. „Ausländereinsatz“ im Siegerland 1939-1945, wie er ablief und was ihm vorausging Opfermann, Ulrich – 1991
Bernhard Weiss war ja auch mit dem Thema „Ukraine“ gut vertraut. Er steht für das Interesse der deutschen Wirtschaft am zu erobernden Raum im Osten. In Teil 1 seiner Zeit als Führer der SIEMAG, also vor seinem Nürnberger Verfahren als Menschheits- und Kriegsverbrecher, gelang es ihm, in Dnjpropetowsk ein großes Unternehmen der Schwerindustrie für seine Familie an Land zu ziehen. Verlor es aber alsbald wieder. Die Rote Armee machte den Weiss einen Strich durch die Rechnung. Wie gewonnen, so damals zerronnen.
(eine Facette von Zwangsarbeit – die SIEMAG setzte zahlreich hier wie dort die so schön billigen ukrainischen und russischen Zwangsarbeiter*innen ein – daher in meinem Buch zum Thema nachzulesen)
Ich hab ihr Buch gelesen, es ist im Stadtarchiv von Siegen verfügbar. Es waren auch Fakten aus ihrem Buch, die ich der IHK vorgetragen habe. Im Rat der Stadt Hilchenbach ist man hingegen noch nicht so weit, sich zu einer Namenänderung vom Bernhard Weiss Platz und Straße im Stadtteil Dahlbruch durchzuringen. Nachgewiesen sind auch verhungerte Kinder im Lager der Siemag Eiserfeld. Herr Opfermann könnte Sie mir bitte eine Email schreiben. Ich hätte da noch ein paar Fragen: ch.kiendl@gmx.de
Hi,
My name is Oranit Hager. Herbert Prager was my grandfather. Max Prager was his father. We would like to renew the contract between the family and Bad Lassphe.
Thank you,
Oranit
Wenn ich es richtig sehe erschien heute der este Leserbrief „Totalitär“ – als solches wird die Umbenennung charakterisiert – in der Siegener Zeitung zum Thema.
Heute erschienen zwei weitere, die Umbenennung ablehnende Leserbriefe in der Siegener Zeitung: „Wer will sich profilieren?“ und „Wichtiger Arbeitgeber“
Zu Bernhard Weiss s. a.
– Kim Christian Priemel: Flick. Eine Konzerngeschichte vom Kaiserreich bis zur Bundesrepublik, Göttingen 2007
– Norbert Frei/Ralf Ahrens/Jürgen Osterloh/Tim Schantzky: Flick. Der Konzern, die Famile, die Macht, München 2009
– Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Siegerland (Hrsg.): Konrag Kaletsch, der Flick-Konzern und das Siegerland, Siegen 1987
Herr Wolf vergaß zu erwähnen (oder musste er sich hierbei zum Stillschweigen verpflichten?), dass nicht nur die Umbenennung der FJM-Straße (sowie selbstverständlich auch des Gymnasiums) erfolgen wird, sondern gleichzeitig die Entfernung des „Krönchens“ von der Nikolaikirche. Dieses war bekanntlich ein Geschenk des bösen Fürsten an die Stadt Siegen gewesen, dessen öffentliche Zurschaustellung längst nicht mehr politisch korrekt ist.
Heute erschienen 3 weitere Leserbriefe in der Siegener Zeitung, die sich kritisch zur Umbenennung äußern: „Säuberungsagenda“, „Unfassbare Aktion“ und „Eindeutig belogen“.
Reaktionen:
1) Radiobeitrag “ Neues Denkmalschutzgesetz – und jetzt?“, WDR 3 Mosaik. 07.04.2022. 05:37 Min: “ „Das Denkmal ist zu schützen“ hieß es 42 Jahre lang einleitend im Denkmalschutzgesetz von NRW. Jetzt steht da, es sei zu „nutzen“. Steffen Skudelny von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz beklagt ein rücksichtsloses Durchdrücken des Gesetzes und will retten, was zu retten ist.“
2) Novellierung Denkmalschutzgesetz NRW: Ministerin Ina Scharrenbach (CDU) mit der Brechstange gegen allen Fachverstand via Archivalia v. 6.4.2022
Ein Fund zum Thema im Bundesarchiv Berlin:
R 3001 Reichsjustizministerium/22124, Realgemeinden und gemeinschaftliche Nutzungsrechte, 1936.
Enthält : „Altsohlstättenrecht und Deuzer Konvention“. Ein Beitrag zur ungeschriebenen Geschichte des Sohlstättenrechts im Siegerland von H. J. Schäfer, Weidenau, 1936
Nach dem Erscheinen der Broschüre „Kanonen und Kuhmchel“ wandte sich Julius Kuhmichel, der Sohn Hermann Kuhmichels, am 28.10.1985 an die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Siegerland. Der Brief enthält u.a. eine von Julius Kuhmichel erstellte Chronik der Jahre 1930 bis 1956, für diese hatte er Tagebuch(!)aufzeichnungen und Zeitzeugenberichte verwendet. Mit dieser Zusammenstellung wollte er die deutliche Kritik an Kuhmichels Wirken während der NS-Zeit entkräften. Das Schreiben befindet sich mittlerweile im Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein unter der Signatur 3.19. (Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Siegerland) Nr. 76 . Sie enthält auch folgenden hier interessanten Passus (S. 3-4): “
…. Mitte 1935: Ein Dr. Hinrichs (oder Heinrichs) erwirkte den Beschluss der Reichskulturkammer, das künslerische Werk von H[ermann] K[uhmichel] mit dem Verdikt „entartete Kunst“ zu belegen und ihm Ausstellungs- und Schaffensverbot zu erteilen. In der Begründung, anlässlich des Spruchkammer-Verfahrens 1948 verlesen, hieß es u.a. „verherrlicht in seinen Werke Kulte des Weltjudentumsund vernachlässigt trotz nachdrücklicher Einlassungen örtlicher Parteimitglieder seine Pflicht, „all sein Können in die Verewigung des arischen Menschen zu stellen.“ Sein des NS-Anstoßes waren Plastiken und Holzschnitte, die H[ermann] K[uhmichel] in den Schaufenstern Siegener Geschäftsleute ausgestellt hatte. Daruntern waren die zwischen 1928 und 1935 entstandenen Skulpturen „Loths Weib“, „Opferung Isaaks“, „Kain und Abel“, „Moses und die Zehn Gebote“, „Die Leiden des Hiobs“ und „Der Pharisäer“. Der Kulturkammer-Beschluss konnte aufgehoben werden dank der Fürsprache von Männern, in deren Besitz sich gerade solche verfemten Kunstwerke befanden: Oberbürgermeister Fissmer, NSKK-Führer Johannes Helmer, Arbeiter-Dichter Heinrich Lersch und der von Göring so geschätzte, halbjüdische Geigen-Virtuose Professor Beinhauer – sie allehatte bei H[ermann] K[uhmichel] „entartete Kunst“ erworben resp. sich schenken lassen.
OB Fissmer, beraten von General Hollidt, ließ H[ermann] K[uhmichel] wissen, die Aufhebung des Kulturkammer-Beschlusses sei das Ergebnis eines Kompromisses: H[ermann] K[uhmichel] verzichtet darauf, Kunstwerke anzufertigen und auszustellen, die das Weltjudentum verherrlichen, und beteiligt sich fortan an der künstlerischen Ausgestalttung öffentlicher Bauten. ….“
Beispiel: Hüttenmeisterhaus in Kreuztal Kredenbach-Lohe.
Die Kommune Kreuztal / Untere Denkmalbehörde lehnt es bis heute strikt ab, in diesem speziellen Fall ein zulässiges Enteignungsverfahren nach §30 DSch NRW einzuleiten, weil man dann die rel. hohen Renovierungs- und späteren Erhaltungskosten nicht tragen möchte. Eine erstrebenswerte soziale, allgemeinwohlfördernde Nutzung des renovierten Gebäudes wurde leider bisher von den dort politisch Verantwortlichen nicht gefunden.
Der priv. Eigentümer kann aber das bereits über 300 Jahre alte , ortsteilbestimmende Fachwerkgebäude keinem wirtschaftlichen Nutzen zuführen, weil sich das einfach bei den hohen Renovierungskosten, trotz evtl. zu erwartenden Landes-Zuschüsse , einfach nicht rechnet . Und wenn der Eigentümer es nicht freiwillig der Kommune übereignen möchte, (gesetzlich wäre die Kommune dann zur Übernahme aber gezwungen !) ist der weitere Verfall des denkmalgeschützten Fachwerkhauses unausweichlich vorgegeben.
Wenn hier aber in der Novelle des DSchG NRW für derartige speziellen Fälle, keine entsprechenden gesetzlichen Vorgaben gemacht werden, die der Unteren Denkmalbehörde eine zwingend gebotenen Übernahme in kommunaler Hand vorgibt, bleibt das DSchG NRW auch weiterhin nur ein „papierner Tiger“ .
(die zu erwartenden Renovierungskosten aus Steuermitteln müssen den evtl. geforderten priv. Entschädigungsforderungen gegengerechnet werden. Der Kommune werden max. 10 Jahre für die Renovierung des Denkmals zugebilligt)
Den nachfolgenden Generationen bleibt ja immerhin im Falle z.B. des Kredenbacher Hüttenmeisterhauses, nach Abriß oder völligen Verfall des Denkmals, die helle Freude an einer Hallenblechwand oder einem erweiterten Parkplatz. (s.a. Fotos)
Ob die dann dafür auch Verständnis aufbringen werden ?
Das wäre ja aber auch nicht der erste Fall , wo man sich dann leider viel zu spät über die Vernichtung Siegerländer Kulturgutes aufregt.
Danke für den Lösungsversuch, der uns an den 100. Todestags von Wilherlm Scheiner erinnert hat ! Es ist nicht Scheiner, der ausweichlich seines Wikipedia-Eintrags weder Lehrer noch Schriftstler bzw. Journalist war.
Der Tipp sieht nicht nur gut aus, er ist vollkommen richtig – Gratulation! Was hat denn Luise Koppen verraten?
Erste Informationenzu Koppen enthalten der Wikipedia-Eintrag, das Lexikon Westfälischer Autorinnen und Autoren und das Biogramm im Portal „Westfälische Geschichte“. Die Lippische Landesbibliothek hat einige Werke Koppens online verfügbar gemacht.
Wie ich darauf kam, ist eine etwas längere Geschichte, die mit Klimamodellen (Köppen und Geiger) und einer gescheiterten Buchrecherche während des Studiums zu tun hat:)
In der Ausgabe des „Heimatlandes“ der Siegener Zeitung vom 19. März 2022 legt Herbert Bäumer einen ersten Artikel zur Geschichte des Truppenübungsplatzes in Siegen-Trupbach vor.
“ …. Aber bei der Herrichtung hakte es. Es ging nicht schnell genug. Statt der vereinbarten 400 Mann waren nur 180 Mann im Einsatz. Oberbürgermeister Fissmer wurde am 21. April 1935 in einem Schreiben an die Arbeitsgauleitung Westfalen-Süd (Dortmund) deutlich: „In den letzten Wochen waren ca. 180 Mann mit 15 Rodeböcken beschäftigt. Wenn nicht in allernächster Zeit Mannschaft und Rodeböcke erheblich vermehrt werden, ist die Fertigstellung der Arbeiten zu den vorgeschriebenen Terminen (1. Oktober 1935 und 1. April 1936) unmöglich.“ Es musste schnell gehen, denn die ersten Soldaten sollten, wie oben geschrieben, bereits am 16. Oktober 1935 eintreffen!
Fissmer fährt fort „Es unterliegt keinem Zweifel, dass Ihnen und uns die größten Schwierigkeiten entstehen werden, wenn die Truppe hier ohne oder mit ungenügendem Übungsplatz zur Ausbildung der Mannschaft schreiten muss. Wie schwer das im vaterländischen Interesse zu verurteilen wär, brauche ich Ihnen nicht hervorzuheben, sehren wir doch im Arbeitsdienst eine Vorschule der Wehrmacht.“
Das fruchtete. …..
Noch bevor die Wehrmacht den Truppenübungsplatzin Besitz nahm, meldete sich Oberbürgermeister Fissmer am 5. Februar 1936 mit einem Schreiben bei Amtsbürgermeister Hirschfeld (Amt Weidenau) zu Wort. …. Er habe,so Fissmer, sich zunächst für eine Anpachtung der Flächen eingesetzt, sei aber damit gescheitert. Fissmer erteilt dann seinem „Sehr geehrten Herrn Kollegen“ Ratschläge. Es müsse, so schreibt er, „Aufgabe der maßgebenden Stellen sein, dafür zu sorgen, dass sich das Geld, welches sich über Trupbach ergießt, auch für die Zukunft gewinnbringend angelegt wird.“ Einsetzen wollte er sich, so der OB, dass die Trupacher in erster Linie die Weidegerechtsame (Weiderecht) für den großen Truppenübungsplatz erhalten. Allerdings, so rät er, nur für Ziegen und Schafe, da er von einem Sachverständigen erfahren habe, dass „wegen der Geringfügigkeit des Bodens“ eine Kuhhaltung nicht in Frage käme.
Seine Sorgen um die Nebenerwerbslandwirte, die ihren Betrieb auf Grund des Verlustes einstellen würden, münden in den Vorschlag, diese sollten „das Geld für den Ausbau der Scheunen zu Wohnungen verwenden. Damit würde bestimmt der hier in Siegen und im Siegerland herrschenden großen Wohnungsnot eine Rente für ewige Zeiten aus dem vergrößerten Hausbesitz gesichert sein.“ Die Sachverständigen seien sich einig, so führt er aus, „…. dass der Hauberg in Trupbach einer der schlechtesten im ganzen Siegerland und Sauerland ist. Fissmer schließt den Brief mit einer Hoffnung: „Wenn heute das Geld in Trupbach vernünftig angelegt wird, wenn heute endlich die Trupbacher sich ihrer bevorzugten Stellung als Vorort und Ausflugsgemeinde der Stadt Siegen bewusst werden und sich entsprechend umstellen, wird ihre Lage schlagartig sich bessern.“ Ein Antwort von Amtsbürgermeister Hirschfeld war nicht zu finden. …. Enteignung ging weiter ….
Überaus bemerkenswert: Am 27. Januar 1937 schaltet sich Fismmer ein. Er schreibt in einem Brief an die Rechtsanwälte, dass in Wahlbach (Nationalzeitung 18. Januar 1937) bei einem freiwilligen Landverkauf Preise gezahlt worden seien, „die ganz wesentlich untern den von den Sachverständigen für Trupbach vorgeschlagenen Entschädigungen liegen.“ Dort seien, so schreibt Fissmer, je nach Lage nur 1 bis 3,70 RM pro Ruten gezahlt worden. ….“
Möglicherweise war Fissmer anfangs, als er das Militär nach Siegen lockte, nicht bewußt, wie groß der Flächenbedarf für dessen Übungsplatz sein würde. Die Stadt Siegen war damit überfordert. Fissmer löste das Problem, indem er der Wehrmacht kurzerhand ein Gelände jenseits der Stadtgrenzen, also außerhalb seines Zuständigkeitsbereiches als OB, anbot. Dieses erstreckte sich über Gebiet der Ämter Weidenau (Trupbach, Birlenbach, Langenholdinghausen) und Freudenberg (Alchen, Niederholzklau). Zu irgendwelchen vorherigen Absprachen darüber mit den betroffenen Kreisangehörigen (Landrat, Amtsbürgermeister, Gemeindevorsteher) sah er sich nicht veranlasst. Nachträglichen Widerstand brauchte er dann als von der Wehrmacht offiziell eingesetzter Bevollmächtigter für den Ausbau des Militärstandortes nicht zu befürchten. Diese Machtposition legitimierte ihn auch, stellvertretend für die Wehrmacht das Enteignungsverfahren gegen die Trupbacher Haubergsbesitzer (es waren knapp 100) einzuleiten. Diese waren ihm schon seit etlichen Jahren ein Dorn im Auge, weil sie sich seinen anscheinend sehr penetranten Bemühungen, ihre Haubergsflächen als Bauland dem Siegener Stadtgebiet zuzuschlagen, so hartnäckig widersetzt hatten.
Es sollte eigentlich ein Emoji mit einem Daumen nach oben zeigen, aber irgendwie werden sollte Zeichen von der Kommentarfunktion nicht korrekt ausgegeben.
vor 10-12 Jahren besuchte ich eine Ausstellung im Keramikmuseum Berlin: Paul Dresler/Töpferei Grootenburg … zusätzliche Info brachte dann der Siegerländer Heimatkalender 1951 und das Deutsche Geschlechterbuch Bd. 139 (2. Siegerl. Band) mit den Stammfolgen Dresler
Paul Dresler hat 1899 in Siegen sein Abitur bestanden (siehe hierzu: Dr. Hans Kruse: 1536 – 1936 Geschichte des höheren Schulwesens in Siegen – Festschrift zum 400jährigen Jubiläum des Realgymnasiums in Siegen, hier: Schülerverzeichnisse von 1580 – 1936, S. 71, Siegen 1936).
Danke für den Literaturhinweis! Daneben findet sich im Siegerländer Heimatkalender 1951 ein kurzer Nachruf auf Paul Dresler sowie online einige Angaben hier.
Karl Münnich hat den Vornamen in seinem Beitrag zu 150 Jahre Photografie im Siegerland mit Alfred angegeben (Zeitschrift Siegerland, Bd. 67 (1990), S. 21-30). So musste ich noch das Intelligenzblatt von beispielsweise 1859 durchsehen, um den korrekten Vornamen Albrecht herauszufinden.
Die Durchsicht der Münchener Matrikel auf Studierende mit Geburtsort Siegen und Studienfach Medizin – davon gab es Ende der 1910er/Anfang der 1920er Jahre nicht viele in München – ließ Werner (hier nicht Wilhelm) Kleb als möglichen Kandidaten erscheinen. Ich habe noch vier weitere mögliche Personen gefunden, aber Hinweise auf spätere Tätigkeiten finde ich bei allen vier Personen nicht. Die Greifswalder Studentenverzeichnisse sind scheinbar nicht online. Alles in Allem: Keine leichte Fragestellung, lieber Herr Wolf.
Danke für die Rückmeldung! Sie haben recht, es ist nicht einfach;. Der von Ihnen beschrittene Weg könnte durchaus zum Ziel führen. Die Greifswalder Studierendenverzeichnisse sind, soweit ich es sehe, nicht online. Die Bestände des Universitätsarchivs Greifswald sind allerdings online recherchierbar.
Können Sie Herrn Panthöfers Voraussetzung wenigstens bestätigen, dass die Studienzeit des Gesuchten in das Zeitfenster „Ende der 1910er/Anfang der 1920er Jahre“ fiel? Da die Volltextsuche in den Greifswalder Verzeichnissen (online verfügbar ab WS 1922/23) nicht funktioniert, wäre hier mit der Durchsicht enormer Zeitaufwand verbunden.
Ich habe doch schon geschrieben, dass der Ansatz erfolgversprechend ist – aber mühsam! Ob es noch einen anderen Ansatz gibt…..
Ich korrigiere mich: Es sind auch Greifswalder Verzeichnisse vor 1922/23 zugänglich (wegen der variablen Titel ist alles ein wenig unübersichtlich). Das hilft aber auch nicht weiter. Und es ist nicht gesund, stundenlang am Bildschirm auf endlose Listen zu starren. Da muss es doch einen eleganteren Weg geben …
Wenn Herr Wolf solche Rätsel stellt, versuchen wir mal die Schwarm-Intelligenz des Netzes zu nutzen:
In den Münchener Matrikeln habe ich lediglich
Artur Wagner
Hermann Geisecker
Ferdinande Nückel
Karl Bertina
mit Geburtsort Siegen und dem Studienfach Medizin ausfindig machen können. Die schnelle Durchsicht der Greifswalder Matrikeln hat leider keine Treffer ergeben. Ich bin nun erst einmal raus mit dem Versuch zu lösen. Muss ja noch arbeiten und mich um meine Familie kümmern.
Bevor der Schwarm die 4 Namen überprüft werden, sei ein Hinweis gestattet. Bei dieser Methode kommt es auf den Untersuchungszeitraum an. Noch einmal: alle Hinweise können weiterhelfen.
Auf den „Untersuchungszeitraum“ zielte meine abgeschmetterte Frage. Allmählich macht dieses Rätsel keinen Spaß mehr. Sorry. Habe jetzt zu viele Stunden meines Lebens damit verschwendet :-(
Gratulation: diese Antwort ist korrekt! Zu Franziska Radke empfehlen sich folgende Links:
– Schlagwort: Franziska Radke, in: „Dorsten untern Hakenkreuz“
– Radke, Franziska, in: Dorsten-Lexikon
– Eintrag in der spanischen Wikipedia
– Zusammenstellungen zu Lehrer:innen in Siegen-Wittgenstein 1933 – 1945 auf siwiarchiv
Übrigens: Vielleicht hilft diese richtige Antwort auch bei der Lösung des noch ungelösten 4. Rätsels. Denn – dies nennt man wohl Web 2.0-Paradox – die fünfte Ausgabe war vor der vierten Ausgabe des Rätsels realisiert …..
Zu prüfen wären noch:
– Universitätsarchiv Greifswald, K 742 , Mittlere Universitätsbeamt, 1935 – 1936, enthält u.a.: Bewerbungen: Reinhold Liebetanz, dabei: Lebenslauf
– Stadtarchiv Düsseldorf 1-1-1 / Übernahmen 2000 -2030, Nr. 1-1-1-5751.0000,,Verdienstorden der BRD; Geehrte und Begründungen, 1971 – 1973
– MBl 1956, S. 593, Beförderung zum Regierungsrat bei der Bezirksregierung Düsseldorf
– MBL NW 1958, S. 2553, Ruhestand
– „Die Angeglichenen“ in: DER SPIEGEL 44/1959 v. 27.10.1959: “ …. Ehe nämlich Innenminister Biernat Schritte gegen die 27 Inkriminierten unternahm, trug er einem Beamten seines besonderen Vertrauens, dem Regierungsrat Liebetanz, auf, mit Hilfe von Entnazifizierungsakten und Berlins alliierter Dokumentenzentrale die politische Vergangenheit aller von der ÖTV attackierten Beamten noch einmal zu durchleuchten.
Anfang Mai 1957 legte Inquisitor Liebetanz dem sozialdemokratischen Innenminister seine Dossiers vor. Zu dem Hauptvorwurf der ÖTV, leitende Kriminalbeamte Nordrhein-Westfalens hätten hohe SS-Dienstgrade bekleidet und SS -Dienst verrichtet, stellte Liebetanz fest: »Diese Hauptbeschuldigung entbehrt jeglicher Grundlage. Es sind keine Anhaltspunkte vorhanden, die die Annahme rechtfertigen, daß die beschuldigten Beamten in der SS und im SD aktiv tätig gewesen sind. Bei den SS-Rängen handelt es sich… um die dienstgradmäßige Angleichung an die SS.« ….“
– Stefan Noethen: Alte Kamerade und neue Kollegen. Polizei in Nordrhein-Westfalen 1945 – 1953, Essen 2003, s. 492
Immerhin gab es einen gebürtigen Netphener (Walter Stein), der 1922/23 in Greifswald und 1924/25 in München als Student der Zahnmedizin eingeschrieben war. Aber wir suchen ja leider einen Siegener.
Ich hoffe, dass die Chance genutzt wird und das Museumskonzept zur Identitätsfindung und Erinnerungskultur beiträgt. Das Siegerland ist Industrieregion. Auch mit den Schattenseiten während des 3. Reiches. Wir müssen raus aus der Heimatmuseums-Denke zwischen Backesfest und Hauberg
Es handelt sich um Ella Buch, Hausärztin Konrad Adenauers. Weitere Informationen und Literaturangaben hier: https://geschichte.charite.de/aeik/biografie.php?ID=AEIK01161 („Ärztinnen im Kaiserrreich“)
Bei weiteren Recherchen zu beachten: Nach ihrer Heirat führte sie den Doppelnamen Bebber-Buch.
Den Preis stelle ich gern als Spende zur Verfügung.
Nebenbei hat die Suche ergeben, dass Else Lixfeld (siehe Siwiarchiv 8. März 2020) ein Semester (WS 1928/29) in München studiert hatte (danach wahrscheinlich in Kiel, evtl. mit Zwischenstationen). Die schon genannte Ferdinande Nückel studierte als schon 35jährige ab 1917 Philosophie und nahm nach ihrer Promotion (über „Hauptmann und Nietzsche“) 1928 noch ein Medizinstudium auf. Vor 1914 tauchen gebürtige Siegener in München nur sehr sporadisch auf; ab 1930 wurde die Herkunft in den Verzeichnissen nicht mehr angeführt. Zwischen 1914 und 1929 lassen sich an der LMU 55 Siegener (teilweise mit seit der Geburt gewechselten Wohnorten) nachweisen. Zu Greifswald kann ich nichts sagen, weil ich mich wegen Faulheit auf Stichproben beschränkt habe – rein zufällig mit Erfolg.
Ein visueller Eindruck:
Dr. Jens Aspelmeier (Aktiven Museum Südwestfalen e.V., Vorstandsmitglied ) bei der Kurzinformationen über Adolf Stoecker, „dessen“ Straße umbenannt werden soll.
Gibt es wirklich Änderungswünsche durch die Anwohner einer Straße oder geht es nur um ein Forschungsprojekt der Uni Siegen um Geld zu generieren? Wie wäre es mit einer „braunen“ Zusatztafel mit Hinweisen auf den benannten Menschen (mit positiven und negativen Einschätzungen) im geschichtlichen Kontext mit einem QR_Code? So gäbe es auch bei Bedarf eine Diskussion in Verbindung mit der Namensgebung. „Opa warum hängt da ein „braunes“ Schild“ unter dem Straßennamen?“, wäre ein erster Schritt zu einer längst überfälligen Erinnerungskultur. Glück Auf. Karl Heupel
Danke für den Kommentar! Der Arbeitskreis resultiert, wenn ich es recht sehe, aus 2 Quellen:
1) einem Bürger:innenantrag zur Erhöhung der Sichtbarkeit von Frauen im Siegener Stadtbild, der auch explizit Straßennamen mit einbezog, und
2) dem Antrag einer politischen Partei, die Lothar-Irle-Str. in Therese-Giehse-Str. umzubenennen.
Ich persönlich habe ein Problem mit den Erklärschildern unter den Straßennamen, da ich bis lang glaube, dass Strassennamen(sverzeichnisse) weder einen musealen Charakter haben, noch ein geschichtsdidaktisch höchst geeignetes Material zur Erinnerungskultur sind. Außerdem ist die Formulierung der Erklärschilder, seien sie kurz oder lang, schwierig, wie dies im Falle des Textes für die Alfred-Fissmer-Anlage in der Siegener Oberstadt dokumentiert ist. Strassennamen dienen primär zur Auffindung von Immobilien und werden – problematischer weise – zur Ehrung von Persönlichkeiten verwendet.
Ihre generationsübergreifende Version der Erinnerungskultur finde ich charmant. Ich habe da lediglich ein praktisches Problem: im Straßenverkehrszeichenwald weist die braune Farbe in der Regel auf positive konnotierte Sehenswürdigkeiten hin.
Bin auf dieses Beispiel aus Karlsruhe gestoßen. Ein Workshop für Jugendliche zu Straßennamen und den Umgang mit problematischen Namen.
Das wäre sicherlich auch interessant für Siegen-Wittgenstein. Zusammen mit dem VVN-BdA, AMS, Archiven, dem Stadt- und Kreisjugendring etc.
Die vor einem Vierteljahr hier vorgestellte „Bibliographie zur Siegener Stadtgeschichte“ verzeichnet eine 1972 erschienene Festschrift „50 Jahre Westfälischer Blindenverein, Bezirksgruppe Siegen e.V.“
Kurze Informationen zur Siegener Gruppe finden sich auch in verschiedenen historischen Dokumenten des Dachverbandes, siehe https://www.bsvw.org/historischedokumente.html. Mehreren dort einsehbaren Festschriften zufolge war „Frau Landrat Goedecke“ in den 1920er Jahren ein geschätztes (sehendes) Mitglied des Vorstandes. Dagegen werden weder ihr Mann noch der Oberbürgermeister erwähnt. Ich verstehe deren Nennung in der Hilchenbacher Zeitung lediglich so, dass sie dem (privaten) Aufruf der Siegener Blinden kraft ihrer Ämter, aber nicht notwendigerweise als Vereinsmitglieder, Nachdruck verleihen wollten.
In den genannten digitalen Unterlagen des Dachverbandes findet sich die Bezeichnung „Protekorat“ für das Engagement des Landrates und Fissmers. Würden wir heute wohl „Schirmherrschaft“ nennen? Treibende Kraft war die Landratsgattin, die dem Vorstand des Ortsvereins seit Gründung angehört hatte.
Ich habe den Direktkandidat:innen meines Wahlkreises diese Fragen via E-Mail gestellt. Geantwortet haben die CDU, FDP, AfD, Volt und die Partei. Sachliche Antworten habe ich nicht bekommen. Die Reaktionen waren eine Mischung aus Überraschung und Neugier. Auch ich selbst war überrascht, dass sich mit einem Kandidaten ein 30min Videoanruf ergab..
Es wird wohl immer ein Rätsel bleiben, warum die Universitätsleitung zwecks Illustration ihres Festbandes in so hohem Maße auf die Fotosammlung eines kommerziellen regionalen Presseunternehmens und keinesfalls auf die archivierte hauseigene zurückgreifen wollte. Der enge Schulterschluss zwischen Universität Siegen und Siegener Zeitung macht vielleicht nicht jeden glücklich, dem etwas an der politischen Unabhängigkeit von Hochschulen gelegen ist.
Danke für den Kommentar! Könnte man eigentlich auch nicht grundsätzlicher fragen, warum nur einen Bildband zum 50.? Die Archivalien zur Gründungsgeschichte unterliegen ja eigentlich keinen Fristen mehr, so dass einer fundierten Gründungsgeschichte nichts im Wege gestanden hätte – gerne hinreichend bebildert.
Herbert Bäumer widmete auf der Heimatland-Seite (Print) der Siegener Zeitung am vergangenen Samstag (14.5.) einen ausführlichen Artikel Edith Langner; bedauerlicherweise verzichtete die Siegener Zeitung auf Quellenangaben. Die zuständige Redakteurin stellte den lesenswerten Beitrag in Zusammenhang mit den aktuellen Straßennamendiskussionen in der Stadt Siegen.
Zu Edith Langner seien noch folgende Quellen im Archiv der Konrad-Adenauer-Stiftung präsentiert – Wahlkampfplakate für die Landtagswahlen 1966 und 1970:
Herbert Bäumers Artikel „In vieler Hinsicht eine Pionierin. Edith Langner war nicht nur in Siegen engagiert“ weist auch 2 Episoden auf:
1) “ …. Am 5. Juni 1953 stand der Fischbacherberg im Blickpunkt des Interesses der Öffentlichkeit. Die Siegener Zeitung berichtete, dass die Vermessungsarbeiten auf dem Fischbacherberg ohne Wissen der Stadtverwaltung durchgeführt worden seien. Diese Vermessungsarbeiten gaben in der Öffentlichkeit Veranlassung zur Annahme, dass neuerlich belgische Truppen, nämlich der Brigardestab, von Gummersbach nach Siegen verlegt werden sollten. Und diese Soldaten brauchten dann auch Wohnraum ….. Diese Arbeiten, so die SZ, sollten am 30. Mai eingestellt worden sein. Bei den Arbeiten habe es sich „um selbstherrliches Vorgehen untergeordneter Organe gehandelt“, wiegelte Stadtverwaltung in der SZ ab. Letztendlich handelte es sich aber um Vorarbeiten für den Bau der Nato-Zähne, der Querriegel davor und der Häuser für die belgischen Soldaten.
Die Debatte in der Stadtverordnetenversammlung wurde durch eine Anfrage von Edith Langner angestoßen, die sich am Ende zufrieden zeigte: „Wir können unsere Gärten wieder bebauen, und dafür danken wir“, führte sie aus. Die lagen nämlich inden vermessenen Gebieten. ….“
2) “ … Zum wiederholten Male: ärgerte sie sich über die Berichterstattung in der Lokalpresse, weil dort im Zusammenhang von Ratsbeschlüssen immer von „Ratsherren“ und „Stadtvätern“ die Rede war. Kurzerhand klebte sie sich einen Schnurrbart an, schlüpfte in Männerkleidung und erschien so in einer Ratssitzung, um gegen diesen unhaltbaren Zustand zu protestieren. Das beindruckte! ….“
Am kommenden Mittwoch, 25.05.2022, tagt um 17:00 Uhr im Rathaus Siegen-Geisweid, Großer Sitzungssaal, der Kulturausschuss der Stadt Siegen. U. a. wird dort der Abschlussbericht des Arbeitskreises „Aufarbeitung der historischen Hintergründe von Straßennamen“ (VL 881/2022) Thema sein. Bedauerlicherweise ist die Vorlage noch nicht online.
Im Siegener Stadtarchiv gilt es folgende Archivalien einzusehen:
– Best. E (Stadtverwaltung Siegen, 1945-1974) Nr. 82, Bildung der Ausschüsse, Sitzungen der Ausschüsse, Bd. 3., 1947-1953
enthält u. a. Fragebogen zu Entnazifizierung für Edith Langner (Adresse: Haig-Kaserne, Block C)
– Best. 384 (Nachlass Friedrich Neus) Nr. 3, Fotoalbum mit Aufnahmen zu offiziellen Anlässen, 1964 – 1979
enthält u. a.: 70. Geburtstag i. Bauhof mit Stadtdirektor Ramfort, Bürgermeister Vitt, Minister des Landes Langner, Stadtrat Reinhardt; Oberkreisdirektor Forster und Langhans, Obm. Althaus und Stadtdirektor Mohn
Im Landesarchiv NRW, Abteilung Rheinland, in Duisburg gilt es folgende Akten einzusehen:
– NW 0498 (Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie Organisation 1), Nr. 56, Regionale Wirtschaftsförderung im Siegerland, 1969
Enthält: Beantwortung der Kleinen Anfrage der Abgeordneten Langner (CDU) zur Nutzung der Obernau-Sperre
-( Im Bestand NWO müsste eine Akte zur Verleihhung des Bundesverdienstkreuzes vorhanden sein. Anm. ergänzt am 18.5.)
„Langner fand 1945 als schlesische Pfarrers- und Kriegerwitwe mit zwei kleinen Söhnen in einem Siegener Kasernenzimmer für Jahre ihr Zuhause. Sie kam 1947 in Siegens Sozialausschuss, gehörte 18 Jahre dem Stadtrat an und von 1966 bis 1975 dem NRW-Landtag, war Kreisvorsitzende der CDU-Frauenvereinigung, im CDU-Kreisvorstand, im Kuratorium der DRK-Kinderklinik, Presbyter von 1960-1976, Gründerin der Frauenhilfe und eines gemischten Chors, dazu Orgelspielerin sowie im Vorstand und in der Offenen Sozialarbeit der Inneren Mission. Großes Verdienstkreuz, Stadt-Ehrensiegel und andere hohe Auszeichnungen.“ aus: Siegerländer Heimatkalender 1988, S. 35
leider ist das bis vor zwei Monaten noch zu Verfügung stehende Personenlexikon des nationalsozialismus nicht mehr abrufbar.
Eigenartig! Politisch so gewollt?
Sehr geehrte Frau Medenbach, wir mussten dies am Wochenende auch sehr überrascht festellen. Alle unsere drei Blogs sind down. Der Support ist nicht erreichbar, von einer Vorwarnung wissen wir nichts. Die Daten sind sicher und wir werden versuchen sobald wie möglich umzuziehen. Wir werden hier und an anderer Stelle darüber berichten. Viele Grüße!
Politisches Meinungsbild im Kulturausschuss:
– Alle Parteien für Erklärschildchen und Bürger:innenbeteiligung.
– CDU, AfD und GfS gegen Umbenennungen,
– SPD will nur Irle, Stoecker und Hindenburg umbernennen
– FDP, Grüne, Linke und Volt keine Änderung des Abschlussbericht.
Nächster Schritt ist die Bürger:innenbeteiligung.
Zur Straßenbennung in Düsseldorf gibt der Abschlussbericht des Beirats zur Überprüfung Düsseldorfer Straßen- und Platzbenennungen (Langfassung 2020), S. 312, an: “ …. Die „Hermann-Reuter-Straße“ wurde – anders als in der „Straßenbenennungsliste nach 1997“ angegeben – nicht nach dem ehemaligen Leiter der Stadt- und Landesbibliothek, sondern nach einem SPD-Lokalpolitiker benannt, der biographisch unverdächtig ist. ….“
Aus dem Abschlussbericht geht hervor, dass Reuter auch an folgende Straßenbenennungen in Düsseldorf angeregt hat:
16.12.1937: Leutweinstr. nach Theodor Gotthilf Leutwein, Lüderitzstr. nach Franz Adolf Eduard von Lüderitz; Petersstr. nach Carl Peters; Woermannstr. nach Adolph Woermann
19.5.1938: Schlieffenstr nach Alfred Graf von Schlieffen
März 1947: Münchhausenweg nach Börries Albrecht Conon August Heinrich Freiherr von Münchhausen
Zur Zeit wird auf facebook in der Gruppe „Nachdenken über Alfred Fissmer“ das Ergebnis der Arbeit einer kommunalen Kommission zum Umgang mit NS-belasteten Figuren der Stadtgeschichte durch Straßennamen statt. Dabei wird von Seiten der SPD auch Wurmbach angesprochen. Er sei nicht nur völlig unbelastet, sondern unbedingt zu würdigen. Tatsächlich ist er im angelaufenen Verfahren der Beerdigung der Kommissionsergebnisse eigentlich eine ausgesprochene Nebenfigur. Es lohnt sich, auf die heftigen Interventionsversuche der SPD zugunsten von Wurmbach einzugehen, weil er repräsentativ für dieses m. E. bildungs- und kleinbürgerliche Milieu ist, das auch im Siegerland – dort mit einer überdurchschnittlichen Unterstützung vor allem bekanntlich von protestantischer Seite die Nazis und ihre deutschnationalen Bündnispartner an die Macht brachte und nach dem Disaster 1945 an diesen Größen festhielt, ja, geradezu festklebte.
Wurmbach begrüßte die Terrordiktatur am 21.3.1933 mit den folgenden Worten (ich übernehme im Folgenden der Einfachheit halber meinen fb-Kommentar):
„Lasst Fahnen wehn von allen Dächern,
Verkünden uns das deutsche Jahr,
Und macht der Glocken Mund zu Sprechern
Der grossen Tat, die Sieger war.
War wie ein Sturm in deutschen Landen
Der Freiheit strahlender Beginn;
Ein ganzes Volk ist auferstanden,
Die Zeit hat einen neuen Sinn.
Den Weltkriegsbeginn, das große raum- und rassenpolitische Naziunternehmen, begrüßte er 1939 dann so:
„O Deutschland, reich an Liedern und Wälderpracht -/Doch steht dir auch die Sprache des Zornes an,/Damit du züchtigest den Frevler,/Der an den heiligen Frieden rühret./Mit ihren Leibern schirmen der Besten viel/Und heißem Herzen Marken und Heimstatt dir,/Damit sie leben oder sterben -/Segne der Himmel den Schwur! – für Deutschland.“
Um 1941 in dieser Weise nachzulegen:
„Fürs Vaterland sterbe/O heilige Saat,/Du höchstes Opfer,/Verklärender Tat/ … /Gefallen – o, Deutschland,/Für dich, für dich!“
1944 lief es dann nicht mehr so gut. Da mussten Durchhalteappelle her:
„Zum Beginn!
Der Tag geht auf so morgenklar,
Ruft ihm entgegen von den Zinnen:
Wir grüßen dich, du junges Jahr,
Zu neuem Kampf, zu neuer Fahr,
Zu neuem Wagen und Gewinnen!
Laß uns mit Großem dich beginnen!“
(mit Ausnahme des ersten Zitats jeweils der sog. „Siegerländer Heimat-Kalender“)
Ja, der Wurmbach war nach nationalistischen Anfängen im und nach dem Ersten Weltkrieg zeitweise ein idealistischer Pazifist und nach dem Zweiten Weltkrieg war er es dann wieder. Zwischendurch offenbar nicht. Ein klassischer Wendehals. Die Sprecherin der SPD verwies im Ausschuss auf einen Wikipedia-Artikel (wie dort immer ein Artikel zahlreicher, in aller Regel unbekannter Autoren, ich zählte 19), fand Wurmbach werde dort schlechtgemacht („verunglimpft“) und warf in demselben Atemzug dem von den Nazis umgebrachten bekannten Antifaschisten Walter Krämer ins Blaue hinein vor, für Tötungen von Häftlingen in Buchenwald verantwortlich gewesen zu sein. Ekelhafter geht es nicht. Und die Frage, was dieser Wurmbach auf einem Straßenschild zu suchen hat, die stellt sich m. E. nicht. Ihn zu verschweigen, wäre eine Freundlichkeit, die sich in Frage stellen lässt.
Zu allem Überfluss erreicht mich nun eine Einladung jenes „Heimat“-Blatts, das sich im Mai 1933 enthusiastisch zum „Organ des nationalsozialistischen deutschen Staates und des unter Adolf Hitlers Führung erwachten Volkes“ erklärt hatte, zu einem „Gespräch, von dem ich sehr hoffe, dass es zustande kommt“.
Die rechte Blatt-Richtung bestimmten schon seit den 1920er Jahren als Eigentümer ein Stahlhelm-Mitglied, das nach 1933 der SA und dann der Nazi-Partei beitrat, und ein bis 1933 im antisemitischen Jungdeutschen Orden, dann freischwebender Akteur. Bald leitete ein bekannter Nazi die Redaktion. Und dabei blieb es bis zum Ende der Diktatur. Der erste „Hauptschriftleiter“ nach dem alliierten Verbot der Familienzeitung kam dann wieder aus der NSDAP und diesmal auch aus der SS. Bis heute und damit über drei, vier Generationen gab es keine auch noch so milde und widersprüchliche vergangenheitspolitische Distanzierung dieses Blatts von seiner schändlichen Vergangenheit, vielmehr fährt sie bis heute einen politischen Kurs, der sich nur rechts einordnen lässt. Wie in den zwanziger Jahren ohne parteipolitische Enge, immer auch ein klares Stück über die Enge hinaus.
Mit denen ein Gespräch? Ja, gerne, sobald sie zeigen können, dass sie lernfähig sind. Das ist bislang nicht erkennbar.
Übrigens, auch die Gedenkstätten fehlen. Aber wenigstens will man sich erinnern: “ …. Das Hochwasser im letzten Juli hatte verheerende Folgen, die Erinnerung an die Opfer werden wir wachhalten. ….“ (S. 4), “ …. Wir bekennen uns zu einer aktiven Erinnerungskultur und unterstützen diese….“ (S. 9)
Nachdem unser Provider kürzlich den Dienst eingestellt hatte, waren unsere drei Blogs nun seit etwas mehr als einer Woche vom Netz. Damit wir bei einem neuen Dienstleister wieder online gehen konnten, waren etliche Anpassungen der Seiten notwendig. Aber nun ist es geschafft. Hier sind die Drei wieder In deutlich aufpoliertem Erscheinungsbild, wie wir finden. Wir hoffen es gefällt!
In der heutigen Print-Ausgabe der Siegener Zeitung erschienen drei Leserbriefe zum Abschlussbericht: „Luxusprobleme“, „Unsinnige Gedanken“ und „Grünes Problem“.
Zudem erschienen online hinter der Bezahlschranke zwei Artikel, die sich mit dem „Sonderfall“ Adolf Wurmbach befassen:
– „Fall Wurmbach offenbart Balanceakt. Ein Prozesse, bei dem man viel gelernt hat“ und
– „Traute Fries macht sich für Heimatdichter stark. „Für mich ist Adolf Wurmbach kein Nazi“.
Der Abschlussbericht des Arbeitskreises besagt zu zu Wurmbach folgendes, so dass die ausführliche Berichterstattung etwas verwundert: “ …. Als unbelastet oder nur minderschwer belastet wurden in die Kategorie C eingestuft:
Adolf‐Wurmbachstraße ….. In diesen Fällen besteht kein Handlungsbedarf. Die Straßennamen können beibehalten
werden und eine Kommentierung ist aus Sicht des Arbeitskreises nicht erforderlich. Im Falle von Adolf Wurmbach regt der Arbeitskreis an, diese für die Siegener Geschichte wichtige Persönlichkeit an einem geeigneten Ort in Geisweid besonders differenziert darzustellen. Als Präsentationsform könnte eine größere Texttafel in Frage kommen.. …“
Ergänzende Literatur:
Torzewski, Christiane: Heimat sammeln: Milieus, Politik und Praktiken im Archiv für westfälische Volkskunde (1951-1955), Münster 2021, S. 36, 45, 57, 189:
Wallies, Esther: Georg Nellius (1891-1952). National-konservative Strömungen in der Musik der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts am Beispiel eines Komponisten, Münster 1991, S. 214 [„Ein Ländchen bloß, ein Raum so klein“ (1943, Adolf Wurmbach), 219 [op 94 Wandlerlieder (1949) nach Gedichten von Adolf Wurmbach]
Im Landesarchiv NRW Abt. Westfalen in Münster gibt es eine Wiedergutmachungsakte zu Adolf Wurmbach, Signatur:
LA NRW Abt. Westfalen K 104 Regierung Arnsberg, Wiedergutmachung,
Nr. 59087;
Das Wurbach vor 1933 Mitglied der Deutschen Friedensgesellschaft
war, ist bekannt, laut der Selbstaussage in der Akte war er auch Mitglied im Republikanischen Lehrerbund.
Als Grund für seine Entlassung aus dem Lehramt 1934 gibt Wurmbach
seine Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Quäker an.
Auch gibt er an, das er ein Angebot der NSDAP zur Übernahme einer Arbeitsstelle in der Jugendfürsorge abgelehnt hat.
1942 wird er wieder im Schuldienst eingestellt, aber mit deutlich geringeren Bezügen als bei seiner Entlassung.
Ein allseits beglückender Kompromiss wäre es, lediglich den Vornamen zu ändern: Von der Umbenennung in „Emilie-Wurmbach-Straße“ würden sich die Fans ihres Ehemannes nicht gar zu sehr brüskiert fühlen, und in der Statistik könnte eine neue Quotenfrau ausgewiesen werden. Oder will jemand behaupten, die Emilie sei minder ehrenwert als ihr Adolf gewesen, weil sie diesen bekochte und ihm die Unterhosen wusch, während er „Dichter“ spielte? (Ihren Beruf als Lehrerin durfte sie ja auf Verlangen des teuren Gatten nicht länger ausüben.)
Und bei der Lothar-Irle-Straße könnte man den Vornamen einfach weglassen. Dann wäre sie eben nach der Irle-Brauerei benannt. Wohl bekomm’s!
Stellungnahme der CDU-Stadtratsfraktion auf deren Facebook-Seite nach der Sitzung des Haupt und Finanzausschusses der Siegen zum Thema:
„Wir als CDU-Fraktion sind gegen eine Umbenennung von Straßennamen.
Nicht nur muss die immense Belastung der betroffenen Anwohner und Betriebe verhindert werden, auch die historischen Hintergründe der historischen Personen sehen wir zum Teil durch den Arbeitskreis zur Neubenennung von Straßennamen wissenschaftlich nicht differenziert genug dargestellt. Statt die Straßen umzubenennen, fordern wir Hinweisschilder anzubringen, um über die Gründe der Ehrung, aber auch die Kritikpunkte zu den entsprechenden historischen Personen aufzuklären.
Zudem fordern wir eine Beteiligung/Befragung der betroffenen Menschen, die in den besagten Straßen leben und wohnen anstatt über ihre Köpfe hinweg zu entscheiden. „
Sehr geehrte Archivverwalter,
von meinem Vater Albert Münker
geb. am 10.1.1894 aus Dreis-Tiefenbach
gibt es vermutlich Unterlagen. Ich bin seine jüngste Tochter Dietlinde, inzwischen 83 Jahre alt. Ich möchte gerne diese erwähnten Unterlagen einsehen u würde mit einem Enkel zu Ihnen kommen.
Im voraus vielen Dank für Ihre Mühe
Mit freundlichen Grüßen
Dietlinde Hirth geb Münker
Robert-Koch-Str.5
54328 Konz richard.hirth@t-online.de
0650115288
Wie u wann wäre das möglich?
Die Signatur der Personalakte Wurmbachs im Landesarchiv in Münster lautet: LAV NRW W, R 001/Personalakten Nr. 724. Die bisherigen Ausarbeitungen zu Wurmbach lassen eine intensive Analyse der Akte nicht erkennen.
Heute erschien in der Siegener Zeitung der Artikel „Strassenschild auf die Schippe genommen. Diskussion um geehrte Nazis erhält humorvollen Beitrag.“ hinter der Bezahlschranke. Die nach dem antisemitischen Hofprediger Afolf Stöcker 1927 benannte Stöckerstrasse erhielt ein inoffizielle Zusatzschild, das auf den noch lebenden Werner Stöcker als Grund für die Benennung angibt. Werner Stöcker ist als hochdekorierter Ausdauersportler in Erscheinung getreten.
Heute im Print der Westfälischen Rundschau ein Artikel zum Thema: „Nazi-Namen für Straßen: Das sagt Siegens Bürgermeister Mues. „Da sind Namen dabei, die muss man nicht auf Straßenschildern lesen“, sagt der Bürgermeister – gibt aber auch zu bedenken: Wo wird die Grenze gezogen, wenn es um belastete Personen geht?“
Link zum aktuellen Blogeintrag „„Verschickungskinder“ als Archivnutzende. Anforderungen an und Auswirkungen auf das deutsche Archivwesen und seine Kundinnen und Kunden“: https://archivamt.hypotheses.org/16603
Nach meinem Kenntnisstand ist das Landesarchivgesetz NRW immer noch nicht auf die DSGVO angepasst worden. Ist das immer noch der Stand? Wenn ja, würde das Kulturgesetz diesen Makel ausmerzen?
Das Archivgesetz ist tatsächlich noch auf dem Stand vor der EU-DSGVO. Wenn ich es recht überblicke, wird dieser unhaltbare Zustand nicht durch die Eingliederung als eigenständiges Gesetz in das Kulturgesetzbuch – das eher die Förderung von Kultur regelt – aufgehoben. Zudem ist die NRW-Archivcommunity gegen eine Eingliederung in das Kulturgesetzbuch. Salopp formuliert sind Archive nicht nur Kultureinrichtungen, sondern auch Verwaltungseinrichtungen. Auch eine Nähe zu Informationsfreiheitsgesetzen mit ihren Friktionen findet so eher keine Lösung.
Vor einigen Jahren im Siegener Stadtarchiv: Ein älterer Hobby-Stammbaum-Forscher störte die archivische Arbeitsatmosphäre, indem er einem anderen Hobby-Genealogen („Genitalogen“, wie mein früherer Chef zu lästern pflegte) quer durch den Lesesaal zurief „Ich bin ja sehr von Lothar Irle beeinflusst …!“ Der für meinen Geschmack etwas großkotzig auftretende Herr, der sich sicherlich für einen einigermaßen repräsentativen Siegerländer hielt, dürfte eine klare Meinung zum Thema der Straßenumbenennungen gehabt haben.
In einer gegensätzlichen Meinungsäußerung heißt es nun: „Wir Nachgeborenen erheben uns moralisch und urteilen im Lichte heutiger Maßstäbe. Und werden dazu Schilder stürmen.“ Das könnte zum krönenden Abschluss der „Diskussionen“ erklärt werden, denn mit dem Verweis auf eigene moralische Überlegenheit lässt sich nur noch Klassenkampf betreiben, keine von gemeinschaftlichem Interesse (um nicht zu sagen von Neugier) getragene Erkenntnissuche. Man mag bedauern, dass die sich im Alleinbesitz „heutiger Maßstäbe“ glaubende Partei nichts Interessanteres aufzubieten hat. Fragbares und Fragwürdiges, dem die Stimmführer beider Lager bisher aus dem Wege gegangen sind, ließe sich ja durchaus noch entdecken und in echte Diskussionen einbringen. Ebenso bedauerlich ist, dass sich die Opponentenseite beharrlich der Einsicht verweigert, hier in mehr als ein bloß von wichtigtuerischen Querulanten erfundenes Scheinproblem hineingezogen worden zu sein. Wenn sich auch die meisten Siegener momentan wohl um existenziell Näherliegendes sorgen als um Straßennamen, so zeigt doch die weltweit zu beobachtende Infragestellung alter erinnerungskultureller Verbindlichkeiten, dass dem vielbeschworenen „Zeitgeist“ Besseres angemessen wäre, als sich ihm mit permanentem Herumeiern und zeitschindendem Taktieren entgegenzustellen. Daraus kann sich niemals ein Konsens für praktikable Entscheidungen ergeben (das Risiko einer teuren und aufwändigen Bevölkerungsbefragung als ergebnisoffenes Mittel „direkter Demokratie“ wird vermutlich keine der Parteien eingehen wollen). Vielleicht wird es ja irgendwann sogar die eine oder andere Alibi-Umbenennung geben (was den überführten Sexualstraftäter Luckner wegen fehlender NSDAP-Mitgliedschaft nach jetzigem Klassifikationsstand schon mal nicht treffen würde); mehr ist von Diskussionen nicht zu erwarten, wenn sie durch parteidisziplinäre Rücksichten und dem Schielen nach Wählergunst kontaminiert werden, und der Zank wird sich ad infinitum fortsetzen. Herr Hellwig hat ja recht: Eine den wie immer zu definierenden „heutigen Maßstäben“ gerecht werdende Erinnerungskultur „setzt Bürgerinnen und Bürger voraus, die geschichtlich interessiert und sensibel sind“. Wenn er jedoch fortfährt „und die schweigen derzeit“, muss man ihm in diesem gerade noch durchklingenden Optimismus nicht folgen: Vielleicht gibt es diese Bürgerinnen und Bürger, die er zum Reden bringen möchte, ja gar nicht. Der Mensch ist ein gegenwartsorientiertes und schon mit deutlichen Abstrichen zukunftsorientiertes Wesen. Aber wie hält er es (abgesehen von den paar Historikern und nostalgischen Lebensuntüchtigen) mit der Vergangenheit? Es ist ein anthropologisches Problem, dass sicherlich nicht die kommunalen Gremien der Stadt Siegen oder eine von ihnen eingesetzte Arbeitsgemeinschaft lösen werden. Den Resignierenden bleibt der Trost: „Jede Stadtbevölkerung hat die Erinnerungskultur, die sie verdient.“
Es ist trivial, „im Lichte heutiger Maßstäbe“ urteilen zu wollen, denn das beanspruchen ohnehin alle für sich: Die „Progressiven“ (im weitesten Sinne) sowieso, aber auch die „Konservativen“ (wieder im weitesten Sinne), wenn sie ihre heute angelegten Maßstäbe mehr oder weniger evolutionär aus den früheren ableiten. In einer Grundannahme stimmen die „linken Revoluzzer“ und „rechten Ewiggestrigen“ (wie die Kontrahenten sich ja gern gegenseitig diffamieren) anscheinend überein: Straßen, Plätze, Gebäude, Eisenbahnzüge usw. mit den Namen historischer Personen zu versehen, sei in diesem 21. Jahrhundert, wie schon im 19., ein unverzichtbares Instrument von „Erinnerungskultur“. Und eben dieses Axiom kann in Frage gestellt werden.
Straßenbenennungen im späteren 19. Jahrhundert dienten, wie das Aufstellen martialischer Denkmäler, der politischen Demonstration und Vergewisserung urbaner Einigkeit. Die auf Straßenschildern zur Schau gestellte Obrigkeits- und Vaterlandstreue waren weitgehend störungsfrei auslebbare mentale Realitäten. Zur politischen und militärischen „Heldenverehrung“ gesellte sich die spezifisch bildungsbürgerliche: Selbstverständlich gehörte eine Goethestraße ins Stadtbild, wo in den „guten Stuben“ die wohlfeile und hübsch gebundene Goethe-Gesamtausgabe zwecks Demonstration eigener Aufgeklärtheit museal präsentiert wurde. (Zum Lesen hatte man ja die Zeitung.) Dass gründerzeitlicher Helden- und Personenkult anderthalb Jahrhunderte später keinen unbedingten Konsens mehr finden, ist immerhin erfreulich. Fruchtbarer wäre es freilich gewesen, sich nach den Erfahrungen zweier Weltkriege frühzeitig zu einem Paradigmenwechsel durchringen zu können, anstatt eine hohle, billige Form sogenannter „Ehrung“ weiter zu hofieren.
Vermutlich die für den Haardter Berg in Weidenau vorgesehene Zukunft als Hochschulstandort war das Motiv dafür, die neu angelegten Straßen der seit den 1960er Jahren entstandenen Wohnsiedlung nicht idyllisch nach Blumen, Käfern oder Bäumen zu benennen, sondern nach historischen Personen aus dem kulturellen Bereich: Brüder Grimm, Novalis, Rilke, Bruckner, Schumann, Riemenschneider, Dürer usw. Auf Politiker verzichtete man. Den Architekten Paul Bonatz würde man heute eher nicht mehr wählen und Richard Wagner vielleicht auch nicht, aber insgesamt kann das Ensemble wohl kaum als anrüchig gelten. Dennoch die Frage: Worin besteht hier die „Ehrung“? Und warum gab man gerade den ausgesuchten Persönlichkeiten, von denen ja meines Wissens keine einzige irgendwelche Beziehungen zum Siegerland hatte, Vorrang vor den zahllosen anderen ehrenwerten, die in Frage gekommen wären? Wenn es schon sein sollte, warum dann nicht auf Vorbilder ein wenig abseits vom bildungsbürgerlichen Mainstream zurückgreifen? War es wieder nur die gleiche alte Intention: „Bewährten Helden“ ein Denkmal setzen – zum Beweis, dass man als erfolgreicher Schulabsolvent ihre Namen parat hatte, ohne sich auf ihr Erbe ernsthaft einlassen zu müssen? Was hat es mit Friedrich Hölderlins Leben und Werk zu tun, dass sein Name einer Straße am Haardter Berg aufgepfropft wurde? Ist den Benennungs-Fanatikern jemals der Gedanke gekommen, dass er (wie viele andere ungefragte Namenspatrone) sich eine solche plumpe postume Verewigung vielleicht aus guten Gründen verbeten hätte? Und was die „politische Korrektheit“ der heutigen Weltenretter angeht: Will man den türkischstämmigen Anwohnern der Hölderlinstraße zumuten, dass dieselbe den Namen eines Dichters trägt, der in den griechisch-türkischen Konflikten seiner Zeit ganz gewiss nicht mit den osmanischen Besatzern sympathisiert hatte? Also umbenennen? Natürlich nicht! Aber vielleicht jetzt endlich damit anfangen, die anachronistische Praxis von Objektbenennungen, welche ohnehin oft nur von kleinen Interessentengruppen lanciert werden, ein für allemal aufzugeben. Diese Angewohnheit war ein historisches Phänomen, das schon allein deshalb nicht in Vergessenheit geraten wird, weil seine Auswirkungen aus pragmatischen Gründen (abgesehen hoffentlich von ein paar Ausnahmen) nicht konsequent rückgängig zu machen sind. Man muss aber „im Lichte heutiger Maßstäbe“ nicht noch länger daran festhalten. Wie neulich schon ein Zeitungskommentator anregte: Es gibt noch ein riesiges Reservoir potentieller Namen aus der Tier- und Pflanzenwelt, aus dem man bei Um- oder Neubenennungen schöpfen könnte. Fangen wir doch einfach mit dem Abarbeiten der „Roten Listen“ an – immerhin hätte das dann auch einen gewissen ernsthaften Bezug zum Treiben der Menschheit.
Niemand wird jedoch so naiv sein zu glauben, dass eine solche Alternative in den diskussionsfreudigen Gremien jemals Anklang finden könnte. Schließlich gibt es genug gute Menschen, die sich für so ehrbar halten, dass sie der späteren Benennung einer Straße nach sich selbst wahrscheinlich nicht abgeneigt wären und, da dies voraussichtlich nie erfolgen wird, dann wenigstens den Namen einer/s der Ihren auf dem nächsten frei werdenden Schild lesen möchten. So fällt wenigstens noch ein schwacher Abglanz des Ruhmes auf sie. Logisch und taktisch klug wird dabei eher nicht argumentiert. Wie will man denn jemandem die Peinlichkeiten der Irle-Stoecker-Fissmer-Beweihräucherung bewusst machen, wenn man selbst bei der ersten sich bietenden Gelegenheit die Benennung eines vakanten Platzes in Weidenau nach einem mit Sicherheit wieder polarisierenden Kandidaten durchsetzt? Man hat damit nicht nur eine Person auf den Sockel gehoben, die in ihrer menschlichen Integrität sicherlich nachstrebenswert ist, sondern zugleich den Funktionär und Parlamentsabgeordneten einer Partei, die am Vorabend der NS-Diktatur nun wahrlich keine Ruhmesrolle in der deutschen Politik gespielt hatte (einschließlich antisemitischer Entgleisungen) und deren Kurs jeder in ihrer Hierarchie Aufgestiegene wenigstens „moralisch“ mit zu verantworten hatte. Es war ja schon zu lesen: Verdienste und Verfehlungen können und sollen nicht gegeneinander aufgerechnet werden. Das gilt dann aber für beide Lager. Doppelzüngigkeit ist es auch, wenn eine der Fraktionen mit der angeblich „immensen Belastung der betroffenen Anwohner und Betriebe“ durch Straßenumbenennungen Stimmung zu machen versucht, wo man sich doch sicher sein darf, dass ihr dieses dümmliche „Argument“ nicht mehr einfallen würde, stände etwa die Umbenennung der Kohlbettstraße in Helmut-Kohl-Straße zur Debatte.
Als nächstes sollen ja die Frauen zu ihrem Recht kommen; lange Listen sind schon im Umlauf. Zweifellos sind Frauen irgendwie die besseren Menschen. Dann aber auch irgendwie ganz normale. Es bleibt zu hoffen – da der Benennungs-Unfug nun einmal nicht enden wird – dass hier nicht wieder vorschnell Entscheidungen getroffen werden, die in drei, zehn oder fünfzig Jahren zu neuem Katzenjammer führen, wenn dann Historiker tiefer graben und das im Moment vielleicht glänzende Bild der Geehrten trüben. Männliche Dumpfbacken vom unverdienten Sockel zu stoßen, mag einen gewissen sportlichen Reiz haben; bei Frauen, wenn sie erst einmal dort hingestellt wurden, wäre es unritterlich. Das wollen wir doch nicht.
„Ehre nur, wem Ehre gebührt“, fordert Herr Hellwig ganz zu recht und von jedem unterschreibbar. Man könnte variieren: „Ehre allen, denen Ehre gebührt“ – aber bitte nicht durch oberflächliche Benennungszeremonien und Lippenbekenntnisse zum Ausdruck gebracht, sondern durch tätiges Anknüpfen an die als ehrenwert eingeschätzten Absichten und Leistungen jener Personen. Und, da Ehrwürdigkeit in keinem proportionalen Verhältnis zu Prominenz steht: „Gebührende Ehre den Namenlosen in gleichem Maße wie den Namhaften!“
„Auch im Koalitionsvertrag von CDU und Grünen in Schleswig-Holstein finden Archive marginale Erwähnung:
„Mit der Erweiterung des Landesarchivs sorgen wir für den dauerhaften Erhalt wertvoller Quellen.“ (S. 49, Z. 1663f)“
Am 30.6. erschien in der Siegener Zeitungein Artikel, der die 7 Personen vorstellt, deren Strassennamen umbenannt werden sollen. Vor Allem auf der Facebook-Seite der Zeitung wurde auch dieser Artikel intensiv kommentiert.
Am 1. Juli üpostete die Stadtratsfraktion der Grünen zum Thema auf Facebook u. a. Folgendes: “ …. Eine #Umbenennung sollte nun zeitnah erfolgen. Bedeutende Frauennamen aus Siegen könnten dafür einen guten und würdigen Ersatz bieten. Die Anwohner:innen der betroffenen Straßen sollten von den bürokratischen Folgen entlastet werden und sollten umfassend informiert werden. Das weitere Vorgehen wird in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 31.08. beraten. ….“
Am 3.7. postet die Volt-Wittgenstein auf Facebook ebenfalls zum Thema u. a.: “ …. Es gibt in der Politik aktuell keine Einigkeit über den Umgang mit den Straßennamen. Unter anderem die @cdufraktionsiegen möchte alle vom Arbeitskreis zur Umbenennung vorgeschlagenen Straßen in Kategorie B verschieben. Wenn man der Definition von „Kategorie B“ folgt, sind die Belastungen dieser Personen „weniger gravierend“, allerdings „kritisch zu kommentieren“. Diese Form der Geschichtsklitterung konterkariert den von allen Mitgliedern des Arbeitskreises (aus jeder Fraktion ein Mitglied) getragenen Abschlussbericht und befördert, dass Mitglieder des selben Arbeitskreises nun zum Teil bedroht und/oder beleidigt werden. ….“
Niederschrift der Beratung des Abschlussberichts im Kulturausschuss am 25.5.2022 ist online (S. 7 – 9):
“ …. Frau I. Schmidt teilt im Namen der CDU-Fraktion mit, man sei gegen jegliche Straßenumbenennung, um das Vergessen zu verhindern und an der Aufklärung teilzuhaben. Die in Kategorie A genannten Straßennamen sollen daher in Kategorie B verschoben werden. Man werde für den HFA beantragen, dass alle Straßen in der Stadt Siegen nach und nach mit einem Hinweisschild (Text oder auch QR-Code) versehen werden sollen.
Den Vorschlag der CDU, alle Straßen mit einem Hinweisschild zu versehen, bewerte man positiv, so Frau Schwarz. Allerdings spreche sich die SPD-Fraktion für die Umbenennung der „Lothar-Irle-Straße“, der „Stoeckerstraße“ und der „Hindenburgstraße“ aus.
Frau Fries gibt eine umfangreiche Rückschau zu dem Thema und geht insbesondere auf die Persönlichkeit Adolf Wurmbach ein.
Der Meinung der CDU-Fraktion schließe man sich vollumfänglich an, so Frau Bialowons-Sting. Man könne ein Stück Zeitgeschehen nicht durch das Umbenennen von Straßen auslöschen, sondern solle die Bürgerinnen und Bürger mit entsprechenden Hinweistafeln erinnern.
Herr Dietrich spricht sich im Namen der Volt-Fraktion für eine Umbenennung der Straßen aus. Es gebe genügend Organisationen und Bewegungen in Siegen, die dafür Sorge tragen, dass nicht vergessen werde. Er greift nochmals die von Frau Fries beleuchtete Wurmbach-Thematik auf. Wurmbach sei ein gutes Beispiel dafür, wie die Widersprüchlichkeit einer Person mittels eine großen Infotafel angemessen gewürdigt werden könne.
Die CDU-Fraktion schlage vor, die Liste potenzieller weiblicher Personen für Straßennamen (s. Abschlussbericht S. 7) um die Namen „Carmen Klein“ und „Edith Langer“ zu ergänzen, so Herr Dr. Zybill.
Seitens der SPD-Fraktion wird von Frau Schwarzer außerdem die Erweiterung dieser Liste umden Namen „Waldtraud Steinhauer“ gebeten. Herr Dr. Sturm weist aufgrund der Wortbeiträge seitens der CDU- sowie GfS-Fraktion darauf hin, dass laut einem Papier des Deutschen Städtetags aus 1980 mit einer Straßenbenennung explizit eine Ehrung und keine Mahnung verbunden sei.
Herr Hellwig stellt am Beispiel Karl Barich dar, dass es zu den Bewertungen des Arbeitskreises durchaus noch politischen Diskussionsbedarf geben könne. Diesem sowie dem Diskussionsbedarf in der Bürgerschaft solle man Raum geben und daher die Entscheidungen durch den HFA und Rat noch nicht in den Juni-Sitzungen treffen lassen. Er spricht sich außerdem
für ein Servicepaket für Bürgerinnen und Bürger aus, die von Straßenumbenennung betroffen seien.
Den Vorschlag, zunächst ein Echo aus der Bürgerschaft abzuwarten, befürwortet Frau Eger-Kahleis. Generell spricht sie sich eher gegen eine Straßenumbenennung und für Hinweisschilder aus, auf denen überwiegend das positive Wirken der Personen benannt werden solle.
Frau L. Schmidt gibt bekannt, die Grünen-Fraktion befürworte den Abschlussbericht des Arbeitskreises ausdrücklich sowie auch den Vorschlag, mehr Straßen nach Frauen zu benennen. Sie regt an, Bürgerversammlungen insbesondere für die von Umbenennung betroffenen
Bürgerinnen und Bürgern zu initiieren.
Frau A. Schneider fasst die Wortbeiträge zu den folgenden abstimmungswürdigen Vorschlägen zusammen:
– Vorschlag CDU, dass die Straßen in Kategorie A in Kategorie B übergesiedelt werden sollen
– Vorschlag SPD, dass nur drei Straßen umbenannt werden sollen
– Vorschlag CDU und SPD, dass drei weitere Frauennamen in die Liste der potentiellen Straßennamen aufgenommen werden sollen
– Vorschlag B‘90/Grüne, dass Bürgerbeteiligung stattfinden soll
Sie merkt außerdem an, dass der in der Vorlage aufgeführte Beschlussvorschlag auch eine Empfehlung über das weitere Vorgehen des Arbeitskreises seitens des KultA vorsehe.
Frau Gelling spricht sich für die Weiterarbeit des Arbeitskreises sowie die Verschiebung der Thematik im HFA und Rat aus, damit Zeit für ausführliche Bürgerbeteiligung bleibe.
Frau A. Schneider schlägt vor, den Ältestenrat in die Diskussion einzubinden, damit dieser diePunkte aus dem KultA nochmals aufgreifen, vermitteln und insbesondere die Empfehlung weitergeben könne, das Thema in HFA und Rat bis nach die Sommerpause zu vertagen.
Nach Diskussion darüber, in welcher Form der Kulturausschuss am besten die gewünschten Empfehlungen an die in der Beratungsfolge nachfolgenden Gremien weitergeben solle, einigt sich das Gremium auf folgenden Beschlussvorschlag, über den Frau Bialowons-Sting abstimmen lässt. Beschlussvorschlag:
Der Kulturausschuss empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss sowie dem Rat der Universitätsstadt Siegen, die Entscheidung über den Abschlussbericht des Arbeitskreises „Aufarbeitung der historischen Hintergründe von Straßennamen“ sowie das darin empfohlene weitere
Vorgehen zu vertagen, damit eine Bürgerbeteiligung stattfinden kann.
Der Kulturausschuss bittet den Ältestenrat darum, bei der Thematik als Vermittler zu fungieren. Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, eine Enthaltung (CDU) ….“
– Zusammenführen, was zusammengehört:
Die erste Mitgliederversammlung in Bad Sassendorf, Heft 6/22, S. 301-303 [Erich Moning, Wahl in den Finanzausschuss des Deutschen Landkreistages, 25. Juni 1947, S. 301]
Das Zitat stammt aus: G. F. Christian Wendelstadt: Der Kreis Siegen im Jahre 1817, herausgegeben von Wilhelm Güthling, Siegen 1962, S. 19. Ursprünglich war der Text unter dem Titel „Durchflug durch’s Fürstenthum Siegen“ 1817 in Dortmund erschienen.
Natürlich ist es älter. Ich hätte das Zitat dem Freiherrn Vincke beim Übergang Wittgensteins von Hessen-Darmstadt an Preußen zugeordnet. Er hatte ja damals Staatskanzler Fürst von Hardenberg über den Zustand der Grafschaften Bericht erstattet. Jedoch fand ich bisher in meinen Büchern keine wörtliche Übereinstimmung mit dem Zitat.
Vielen Dank für den Hinweis! Eigentlich wollte ich nur kurz einige Angaben zum dem im 1. Teil des diesjährigen Sommerrätsels – https://www.siwiarchiv.de/siwiarchiv-sommerraetsel-2022/ – auftauchenden Engels gegeben haben, aber eine erneute Beschäftigung scheint ja lohnenswert zu sein.
In der heutigen Print-Ausgabe der Siegner Zeitung erschienen 2 Leserbriefe: „Locker bleiben“ empfiehlt eine die Umbenennungen befürwortende Einsendung, demgegenüber empfindet der ablehnende Leserbrief die Umbenennungen als „Ersatzbeschäftigung“.
Im „Duell“ der regionalen, archivischen Ruheständler würde ich sagen: ein Treffer ins Schwarze – Gratulation! Das gesuchte Zitat befindet sich auf S. 18 dieser Publikation:
In der heutigen Print-Ausgabe der Siegner Zeitung erschienen 3 Leserbriefe (S 9; übrigens auf der gegenüberliegende Seite 8 erschien ein Beitrag zu Ehrung von Siegfried Betz):
„Nicht nur Mitläufer“ befürwortet die Umbenennungen, während „Krönchen entfernen“, auf die koloniale Vergangenheit Johann Moritz zu Nassau-Siegen anspielend, und „Geschehen lassen“ gegen Umbennenungen eintreten.
Dem ersten (?) Siegener Adressbuch zufolge gab es 1879 in der Stadt Siegen keinen Schreinermeister Jochum (bzw. die Witwe desselben). Also beide Elternteile schon verstorben? Auch kein anderer Sohn vorhanden, der die Werkstatt übernommen hätte? Zu korrigieren ist wohl die Angabe „Bis zu seinem 14. Lebensjahr war er als Sekretär an der Steuerkasse in Siegen tätig“. Vielleicht bloß ein Druckfehler; gemeint „24“? Taucht sein Name im Schülerverzeichnis von Kruses Realschul-Geschichte auf (wenn ja, mit welchem Abgangsjahr)? Lassen sich im Siegener Kreisblatt Anzeigen von frühen Auftritten Jochums als Amateur-Zauberer in seiner Heimatstadt finden? Fragen über Fragen …
Niederschrift der 9. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Rates der Stadt Siegen vom 08.06.2022, Seite 3 – 5, ist online:
„TOP 4. Abschlussbericht des Arbeitskreises „Aufarbeitung der historischen Hintergründevon Straßennamen“:
Herr Groß dankt dem Arbeitskreis für seine Arbeit. Es ist nun die Aufgabe des Rates zu beraten, welche Straßen zur Umbenennung in Betracht kommen und vor allem, wie eine Bürgerbeteiligung aussehen kann. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen kann sich vorstellen, alle in der Kategorie A aufgeführten Straßen umzubenennen.
Herr Schiltz schließt sich für die SPD-Fraktion dem Dank an. Die Überlegungen zur Umbenennung würden in der Öffentlichkeit und besonders bei den Anliegern der in Rede stehenden Straßen sehr kontrovers diskutiert. Per Definition stelle die Benennung von Straßen nach Persönlichkeiten eine Ehrung dieser dar. Daher kommen Personen mit einer antisemitischen oder nationalsozialistischen Geschichte per se nicht in Betracht.
Die SPD-Fraktion stellt daher den Antrag
– Umbenennung der Hindenburgstraße, Stoeckerstraße und Lothar-Irle-Straße
– Verschiebung der weiteren in Kategorie A aufgeführten Adolf-Wagner-Straße und Bergfrieder Straße in Kategorie B, da die vorliegenden Informationen über die Persönlichkeiten nicht ausreichen. Weiterer Erkenntnisse sollten abgewartet werden.
Bei den Herren Porsche und Diem handelt es sich um sehr ambivalente Personen, die ebenfalls unter die Kategorie B fallen sollten.
Den übrigen Empfehlungen des Arbeitskreises stimmt die SPD-Fraktion zu, wie auch dem Vorschlag, Bürgerversammlungen und Bürgerinformationen für die drei umzubenennenden Straßen durchzuführen.
Auch die CDU-Fraktion dankt dem Arbeitskreis für seine Arbeit, erklärt Herr Marc Klein, bewertet die Ergebnisse aber anders und möchte keine Umbenennungen vornehmen. Vielmehr wird beantragt, die in Kategorie A genannten Straßen nach Kategorie B zu überführen und mehr als bisher über die Personen aufzuklären. Die Straßen wurden erst 1975 im Zuge der kommunalen Neuordnung benannt, lange nach dem Ende des zweiten Weltkrieges. In der Zwischenzeit hatten diese Personen Auszeichnungen für andere Verdienste erhalten. Daneben ist die Belastung der potenziell Betroffenen bei einer Umbenennung zu bewerten. Diesbezüglich ist ein Service-Paket für Verwaltungsdienstleistungen nicht ausreichend, da ein weit höherer Aufwand betrieben werden müsste.
Die CDU-Fraktion beantragt zusammenfassend, keine Umbenennungen vorzunehmen und sukzessive in allen nach Personen benannten Straßen Schilder mit entsprechenden Erläuterungen zu ihrer Vita zu versehen.
Herr Henning Klein erklärt, dass sich die Fraktion Die Linke dem entgegen für eine umfassende Umbenennung ausspricht. Zu dem Einwand, der Aufwand sei zu groß, ist auf die Umbenennung der Wildrosenallee zu verweisen, die geräuschlos und ohne Bedenken vollzogen wurde. Er möchte des Weiteren die Anregung des Kulturausschusses aufgreifen, noch andere Fachleute einzubinden und keine eine parteipolitisch geprägte Mehrheitsentscheidung zu treffen.
Das Projekt war nach Einschätzung von Herrn Bertelmann sehr anspruchsvoll und vielschichtig. Ein Richtig oder Falsch gibt es seines Erachtens nicht. Die UWG-Fraktion hält es für zielführend, dem Vorschlag des Fachausschusses zu folgen, die Entscheidung zu vertagen und ist nicht bereit, an dieser Stelle über Festlegungen abzustimmen. Darüber hinaus stellt sich für ihn die Frage, wie für wen eine Bürgerbeteiligung erfolgen sollte und wie die Anlieger zu den Vorschlägen stehen.
Die FDP-Fraktion befürwortet den Vorschlag des Fachausschusses, so Herr Walter. In der Bevölkerung ist Unmut über die Diskussion festzustellen.
Die Volt-Fraktion steht hinter dem Vorschlag des Arbeitskreises erklärt Herr Wittenburg, kann sich aber auch den Argumenten für die Empfehlung des Fachausschusses anschließen. Herr Groß weist darauf hin, dass die Diskussion schon lange geführt wird und die Argumente gleichermaßen lange bekannt sind. Von einem Schnellschuss kann daher keine Rede sein. Bei einem generellen Nein hätte man den Aufwand nicht betreiben müssen. Eine Beratung im Ältestenrat hält er angesichts der vorgetragenen Positionen für schwierig.
Bürgermeister Mues wirft ein, Aufgabe des Arbeitskreises war die Hintergründe der Personen zu erkunden und Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Die Politik muss diesen nicht zwangsläufig folgen.
Herr Wittenburg stellt den Antrag, die Umbenennung der nach Hindenburg, Stoecker und Lothar-Irle benannten Straßen zu beschließen und alle weiteren einer erneuten Betrachtung zu unterziehen.
Herr Sondermann merkt an, dass er dem Vorschlag des Kulturausschusse hätte folgen können. Nach dem heutigen Verlauf der Diskussion lehnt die GfS-Fraktion eine Umbenennung ab. Der Arbeitskreis hat sehr gut und ergebnisoffen beraten, die GfS-Fraktion erachtet aber die Schlüsse daraus für nicht richtig. Der Nutzen einer Umbenennung geht nicht einher mit dem Aufwand und der Akzeptanz der Anlieger.
Herr Bertelmann hält eine Bürgerbeteiligung in der Form für wichtig, die betroffenen Anlieger zu befragen und die Beweggründe für die Diskussion und die Vorschläge zu erklären. Er möchte keine reine Information.
Herr Groß sieht dagegen eine Bürgerbeteiligung nicht in der Befragung der Anlieger, wo das Ergebnis seines Erachtens absehbar ist. Vielmehr sollte das Thema in die Stadtgesellschaft getragen und die Frage gestellt werden, ob die Namen von Personen, die im Faschismus eine bedeutende Rolle innenhatten, beibehalten werden sollen. Er würde in Anbetracht der Diskussion den Vorschlag der SPD-Fraktion befürworten.
Frau Shirley verweist auf die in Zusammenhang mit der Untersuchung der historischen Hintergründe von Straßennamen ebenfalls diskutierte Frage der Präsenz von Frauen in der Stadtöffentlichkeit. Sie hält es für unglücklich, die beiden Themen zu verquicken.
Herr Tigges berichtet über den Unmut vieler Bewohnerinnen und Bewohner Kaan-Marienborns, nicht gefragt zu werden. Er ist erstaunt, dass sich eine Mehrheit über die Empfehlung des Kulturausschusses hinwegsetzen würde.
Bürgermeister Mues fasst die Diskussion und zusammen. Zu überlegen ist, in welcher Form eine Bürgerbeteiligung erfolgen kann. Mit dieser Frage könnten sich der Ältestenrat bzw. die Fraktionsvorsitzenden und die Verwaltung befassen. Wenn dazu eine Lösung gefunden ist sollte man versuchen, das Thema wieder aufzugreifen.
Herr Schiltz ist bereit, vor diesem Hintergrund den Antrag der SPD-Fraktion zurück zu ziehen. Er möchte aber vermeiden, das Projekt ohne Entscheidung im Sande verlaufen zu lassen.
Herr Groß hält es für richtig, einen zeitlichen Horizont für eine Entscheidung festzulegen.
Herr Marc Klein stellt mit dem Hinweis auf eine Bürgerbeteiligung den Antrag der CDU-Fraktion zunächst zurück.
Auch Herr Wittenburg zieht seinen Antrag zurück.
=> Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses sprechen sich dafür aus, die Entscheidung über den Abschlussbericht des Arbeitskreises „Aufarbeitung der historischen Hintergründe von Straßennamen“ bis zum Herbst 2022 zu vertagen. Auf der Ebene der Fraktionsvorsitzenden wird zunächst besprochen, auf welche Weise eine Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger erfolgen soll.“
Und einmal mehr wird private Initiative und der private Einsatz von Menschen für die Kultur einer Region und für den Erhalt historischen Gutes und historischen Wissens durch Sparzwänge zunichtegemacht. Ist es denn wirklich gewollt, solche Initiativen von vorneherein zu unterbinden? Wer will sich noch persönlich mit Idee und Tat für eine öffentliche Sache einsetzen, wenn immer wieder mit dem finanziellen Zeigefinger argumentiert wird, statt selbst nach Lösungen zu suchen und in der Kommunikation mit den Machern und Schaffenden zu bleiben? Welche Signale sollen hier ausgesendet werden? Etwas so etwas wie: „Ja, mach etwas für unsere Kultur und unsere Region, die uns Besucher in die Gastronomie und in die Stadt bringen, aber erwarte von uns dafür weder Gegenleistungen noch Verbindlichkeit!“
Schade, dass die Stadtväter und Stadtmütter offenbar nicht über den Tellerrand der Kosten hinaussehen können. Verein und Vertreter aus Kultur und Stadtverwaltung sollten sich Zeit nehmen, um Konzepte zu überlegen, die einen Kompromiss in den Interessen darstellen können und das sollte nicht am Schreibtisch passieren, sondern in neutral moderierten, gemeinsamen Gesprächen.
Danke für den Kommentar! In der Zwischenzeit scheint sich hoffentlich eine regionale Lösung anzubahnen. Zumindestens gibt es laut Radio Siegen vom 13.7.2022 Gespräche zwischen dem Radiomuseum und dem Bunker Erich in Erndtebrück
Im Stadtarchiv Krefeld gibt es neben den genannten Unterlagen eine Personalakte (Signatur 60/1338) zu Dresler sowie ein Foto vom ihm aus dem Jahr 1949, eine Mappe in der Zeitungsausschnittsammlung (StAKR 46/1378) und natürlich noch ein paar Treffer in der Aktenüberlieferung des Kaiser-Wilhelm-Museums.
Zu historischen Straßenbenennungen in Siegen ist folgende Literatur einschlägig:
– Gerhard SCHOLL, Von der Pannengasse bis zur Basgonke. Streifzug durch Alt-Siegens Straßennamen, in: Unser Heimatland 1953, S. 55-56.
– Gerhard SCHOLL, Die Straßennamen der Stadt Siegen, in: Siegerland 31, Heft 1 (1954), S. 7-28.
– Siegens alte und neue Straßen vor 100 Jahren. Die ersten Straßenschilder im Ortsbild. Strenge Polizei-Ordnung für Siegener Bürger, in: Unser Heimatland 1967, S. 53-54.
– Neue Siegener Straßennamen vor 75 Jahren. Frühling 1895 gab es im „Krönchen“ rund 50 Neubezeichnungen, in: Unser Heimatland 1971, S. 2.
Ein weiterer Exkurs zu kurzfristigen Straßenumbenennungen auf Wunsch bzw. für Investoren sind übrigens:
„Zur Landeskrone in Wilnsdorf Wilden:
Die Straße wurde Ende der 1990er Jahre in Louis –Schuler-Straße umbenannt, weil das Unternehmen dort seinen Sitz hatte.
Als 2009 der Schuler Konzern den Standort schloss, wurde die Straße wieder umbenannt.
Die Wildrosenallee in Siegen Birlenbach wurde so benannt, weil der Investor wünschte, dass der alte negativ belastete Name Westhang weg sollte.“ (Danke für die Hinweise via E-Mail an TT)
Lieber Herr Wolf,
die Sommerferien in NRW sind Geschichte. Nun wird es aber einmal Zeit, die ungelösten Sommerrätsel aufzulösen.
Danke und schöne Grüße
Die Lösung lautet: Adolf Weiershausen: Die neuere historische, sprachliche und volkskundliche Erforschung des Kreises Wittgenstein, in Das Schöne Wittgenstein, Heft 2 (1928), S. 76.
Einwohnerbuch der Stadt Siegen und der Kreise Siegen und Altenkirchen 1940, S. 54: Otto Arnold, Rektor Effertsufer 6, Reichsbund Deutscher Amateuer Fotografen, Ortsgruppe Siegen
Nordrhein-Westfalen besitzt eine kreative und vielfältige Kulturlandschaft. Damit das so bleibt, erhöhen wir den Kulturetat um 50 %. Und wir unterstützen unsere Künstlerinnen und Künstler & unsere Einrichtungen, damit sie gut durch den Winter kommen. #Energie#Corona#ZukunftNRWpic.twitter.com/M7QGj3tEQ2
Quasi vorab veröffentlichte Bernd Plaum eine sachliche Kritik an der Arbeit des Arbeitskreises und am Abschlussbericht – https://geschichtswerkstatt-siegen.de/2022/02/11/umbenennung-von-strassennamen/#comment-101 – , der man sich nur anschließen kann.
Haben die Medien, die Wissenschaft oder die anderen Institutionen alles richtig gemacht? Sicher nicht und es ist zu hoffen, dass alle (!) Beteiligten hieraus für zukünftig sicher anstehende, erinnerungspolitische Diskussionen ihre Lehren ziehen.
Plaum hatte schon auf die selektive Literatur- und Quellenauswahl hingewiesen. Man kann möglicherweise nachvollziehen, dass ein Bericht eines politischen Arbeitskreises keine wissenschaftliche Abschlussarbeit ist. Allerdings wirkt es befremdlich, wenn einschlägige Literatur nicht erwähnt wird, die explizite Hinweise zum Untersuchungsgegenstand des Arbeitskreises enthält. Gerhard Scholl veröffentlichte 1954 die Miszelle „Die Straßennamen der Stadt Siegen“ (Siegerland, S. 7 – 28). Das Straßenverzeichnis, der Hauptbestandteil der Veröffentlichung, enthält einige interessante Aspekte:
– Die Benennung der Albert-Richartz-Straße erfolgte nach dem Mitinhaber der Siegener Firma Betrams kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Firma Betrams hat Zwangsarbeiter:innen eingesetzt.
– Die Haroldstraße trägt ihren Namen nach der Titelfigur Hermann Bellebaums „Harold der Zigeunerkönig“.
– Die Martin-Luther-Straße ist eine Umbenennung aus dem Jahr 1935; sie hieß vorher Obere Häuslingstraße.
– Die Saarbrücker Str. am Wellersberg soll 1935/36 an die Rückgliederung des Saarlandes in des nationalsozialistische Deutsche Reich erinnern.
Ich bin mir sicher, dass diese Hinweise im Arbeitskreis diskutiert und bewertet worden sind. Aber warum finden sie sich nicht im Abschlussbericht wieder?
Problematisch ist, wie schon Plaum für Graf Luckner gezeigt hat, ist die fehlende Begründung, warum jemand als unbelastet eingestuft wurde. Dies zeigt auch ein Blick auf den Entwurf eines Biogramms zu Dr. Hermann Böttger – man hätte sich auch für alle „unbelasten“-Eingetuften eine fundierte Begründung gewünscht: http://www.siwiarchiv.de/wp-content/uploads/2022/09/boettger.pdf
In der Aktuellen Strassennamen-Diskussion rückt auf Lothar Irle in den Fokus. Präzisierungen und Neufunde sind der Folge:
– Bernd Plaum verweist auf Irles Denunziation von Pastor Adolph Steinle in Netphen, die, wie andere auch, letztlich an die Staatspolizeistelle Dortmund gelangten, vgl. dazu Alexander Hesse, Völkische Seminaristen und deutschnationale Seminarlehrer? Die letzten Jahre des Lehrerseiminars Hilchenbach (1922-1925), in: Siegener Beiträge 4, 1999, S. 45-84, hier: S. 72, Fn. 14 (mit weiterführenden Angaben) – https://geschichtswerkstatt-siegen.de/2022/09/15/strassennamen/#comment-107
– „Wie gerade Pilze auf dem Mist sich wohlfühlten, war jene jüdische Literatur und Kunst, die den Nährboden bildete für jüdische Schweinereien.“ aus: Steffen Schwab: „Siegesparade setzt sichtbaren Schlusspunkt“, Westfälische Rundschau, 9.5.2015, s. a. Steffen Schwab:“Gipfeltreffen in Sachen Lothar Irle“, Westfälische Rundschau, 14.6.2013
Empfehlungen des Arbeitskreises „Straßennamen“ bei Bürgerinfo vorgestellt
Die historischen Hintergründe von Straßennamen in Siegen hat der interfraktionelle Arbeitskreis „Straßennamen“ in zehn Sitzungen aufgearbeitet. Die Ergebnisse wurden jetzt (Dienstag, 13. September) bei einem Bürgerinfoabend im Großen Saal der Bismarckhalle in Weidenau vorgestellt.
Bürgermeister Steffen Mues begrüßte die zahlreichen Bürgerinnen und Bürger und ordnete die intensive Auseinandersetzung der Arbeitskreis-Mitglieder mit der Geschichte ein: „Es geht hier nicht um ein paar Namensschilder aus Metall, sondern darum, womit wir uns als Stadt Siegen identifizieren.“
Die Empfehlungen des Arbeitskreises, in dem Mitglieder aller im Rat vertretenen Fraktionen vertreten sind, seien einstimmig gewesen. „Die Benennung einer Straße nach einer Person ist eine der höchsten Ehrungen, die eine Stadt einem Bürger oder einer Bürgerin gewähren kann“, so Mues. Ziel des politisch eingesetzten Arbeitskreises sei es, und damit auch Wunsch der Politik, auf Basis „unserer heutigen freiheitlich-demokratischen Werteordnung zu empfehlen, ob die Straßennennung aufgrund einer Belastung aus der NS-Zeit noch angemessen erscheint oder nicht“.
Vor der engagierten Diskussion mit der Bürgerschaft, darunter viele Anwohnerinnen und Anwohner, hatten die Organisatoren einen Info-Block mit Kurz-Vorträgen der beteiligten Fachleute vorangestellt. Ziel war es, das komplexe Thema „Straßenumbenennung“ aus verschiedenen Perspektiven zu erläutern. Vertreter des Arbeitskreises mit Raimund Hellwig (FDP) als Vorsitzendem, Martin Heilmann (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) und Erik Dietrich (Volt-Fraktion) stellten den Abschlussbericht im Detail vor. Sie erläuterten die biographischen Hintergründe der Namensträger, die aktiv in der NS-Zeit beteiligt waren. Der Arbeitskreis empfiehlt, sieben historisch belastete Straßen in Siegen umzubenennen.
Darauf lag auch der Fokus bei der Bewertung der Straßennamen durch den Arbeitskreis: auf in der NS-Zeit auffällig gewordene Personen sowie auch Wegbereiter des Nationalsozialismus seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Der Arbeitskreis gelangte zu einer Einteilung in drei Kategorien. Am Ende waren es 23 Personen, davon fielen sieben (Straßen-)namen in die Kategorie A „schwere Belastung, Umbenennung empfohlen“. Konkret handelt es sich um die Adolf-Wagner-Straße, die Bergfriederstraße, Diemstraße, Hindenburgstraße, Lothar-Irle-Straße, Porschestraße und Stöckerstraße.
Seitens der Verwaltung gab Stadtarchivar Dr. Patrick Sturm einen Überblick über die historische Entwicklung von Straßennamen („Jede Generation muss für sich aushandeln, welche Straßennamen ehrungswürdig sind“) und stellte beispielhaft Verfahren von Straßenumbenennungen in anderen Kommunen vor. Andreas Becher, Leiter der Abteilung Vermessung und Geoinformation, informierte, wie eine Straßenumbenennung in der Praxis vonstattengeht und den praktischen Ablauf. Ihre Rechtwirkung entfalte eine Straßenumbenennung nach der öffentlichen Bekanntmachung. Becher betonte außerdem, dass die Behörden wie Finanzamt oder Rentenversicherung von städtischer Seite über eine mögliche Namensänderung informiert würden.
In der gut gefüllten Bismarckhalle nutzten im Anschluss vor allem Anwohnerinnen und Anwohner der von einer Umbenennung möglicherweise betroffenen Straßen die Gelegenheit zur Diskussion. Die finale Entscheidung, ob die genannten Straßen umbenannt werden, trifft der Rat in seiner Sitzung am Mittwoch, 19. Oktober 2022.
Heute findet sich der Leserbrief „Lösungen nicht durchdacht“ in der Westfälischen Rundschau, der die Berichterstattung über die Bürgerbeteiligung zum Anlass nimmt, sich mit der vorgeschlagenen Umbenennung der Porschestr. zu beschäftigen.
Wie Sie richtig schreiben, die sind es auch nicht. Wenn ich Sie in meinen Beständen hätte, dann wären sie hier schon mit einem großen Beitrag vorgestellt worden.
Ich frabe mich ja, wie eine abgefahrene Bremsscheibe bzw. ein Foto davon, den Weg in das Kreisarchiv gefunden haben soll. Aber da ich „meine“ Bestände kenne, weiß ich, dass eigentlich nichts unmöglich ist. Aber: leider ist auch diese Antwort falsch.
Ev. Trauregister Siegen (Bd. 53 – 1843-1858)
1852/18
Carl Wilhelm Keller, Gold- und Silberarbeiter in Siegen
(v.a.H.: +06.09.1904)
34 J. (v.a.H.: *14.09.18), S. v. Buchbindermeister Joh. Friedr. Elias Keller
u. Johannette Wilhelmine geb. Steuber in Neuwied … (Rest unleserlich)
Helene Wilhelmine Blecher in Siegen
27 J. (v.a.H.: *02.10.25)
T.v. Johann Blecher, Siegen u. … (Textverlust)
oo am 12.10.1852 in Siegen
Es ist eine halbrunde Holzverzierung um einen Fenster- oder um einen Türrahmen. Zu sehen ist ein Bildausschnitt der links-oberen Rundung. Am rechten Rand sieht man den Beginn des eigentlichen Fenster- bzw. Türrahmens.
Ich hatte schon ein wenig Sorge, wenn Sie antworten, dass das Rätsel gelöst ist. Aber noch kann man weiterraten. Wiewohl ich gestehen muss, dass mir in diesem Jahr ein Wasserschlauch in diesem Sommer sehr geholfen hätte.
„Neuhaus, Dr. Karl, 22.7.1910 Holzhausen b. Gl., V. Förster; Abitur Dt. Oberschule Laassphe/Westf.,
Stud. Theologe u. oriental. Sprachen, 1. u. 2. theol. Ex., Prom. z. Licentiaten über e. hebräisch-griech.-sprachwiss. Thema, Pfarrverwalter in Langen, Bruch mit der Kirche, dann Stud.ass. in Offenbach, Arbeit an e. Diss. über d. Theorie des Volkstums in der mod. evangel. Literatur (b. Prof. Nelis); Studienrat.
– Gauredner, Kreishauptstellenlt., Lehrer an Gauführerschule der NSDAP Offenbach, Kreisschulungsredner, Weltanschauungsunterr. an der Meisterschule d. dt. Handwerks Offenbach; Reg.rat b. KdS Posen; 11.42 Stubaf. RSHA, Reg.rat RSHA IV.B.1 [SSO; RS]“
aus: Harten, Hans-Christian: Weltanschauliche Schulung der SS und der Polizei im Nationalsozialismus:Zusammenstellung personenbezogener Daten
2017, S. 318
Ausweislich der im Landesarchiv NRW, Abt. Rheinland, befindlichen Entnazifizierungsakte NW 1.127-1.066 (Lothar Irle):
– fol1v trat Irle Irle aus Kirche aus, weil er sich zu einzelnen Dogmen (z. B. Auferstehung des Fleisches) nicht bekannte,
– fol 2r gehörte Irle in Marburg der christlich-deutschen Verbindung Franconia (Schwarzburgbund) und der Frankfurt/Main der christlich-deutschen Verbindung Falkenstein (Schwarzburgbund) an,
– fol21v/fol. 22r äußert sich der Entlastungszeuge Hermann Böttger u. a. wie folgt: “ …. Sein Buch „Volkskundliche Fragen der Gegenwart“ ist mir nur flüchtig [sic!] bekannt und ich weiß auch, daß dort die eine oder andere Stelle so aufgefasst werden kann,als wenn er auf nat[ional]soz[ialistische] Erkenntnisse Rücksicht genommen hätte. Das mag damit zusammenhängen, daß er tatsächlich wegen der Veröffentlichung geglaubt hat geringere und unwesentliche Konzessionen zu machen. ….“
– fol 57 – fol 65 enthalten von Irle geführte Schriftwechsel des NSLB von Juni 1933 bis Jannuar 1934. Bemerkensswert ist ein Schreiben den NSLB-Ortsgruppenobmann Knappmann in Netphen-Brauersdorf vom 14.8.1933 (fol 63): “ … Nach einem Schreiben des Pg. Gilfert an den Pg. Koll. Münker soll dieser nationalgesonnen bekannte Kollegen als Nationalmiserabele bezeichnet haben. Fordern Sie ihn auf, dass er die Kollegen nennt, die als solche bezeichnet worden sind. Ferner hat Pg. Gilfert Zeugen für diese Aussagen zu nennen. ….“. In einem Schreiben an alle NSLB-Ortsgruppenmänner des Kreises Siegen vom 24.11.1933 (fol 64) heißt es dann “ … Falls eine Lehrkraft sich eine abfällige Bemerkung über einen Führer oder über eine nationalsozialistische Organisation erlaubt, ist mir sofort Meldung zu erstatten. Geschieht es nicht, so wird der zuständige Ortsgruppenobmann zur Verantwortung gezogen.“
– Die entlastenden Aussagen über Irle haben den Tenor, dass eine aktive Verfolgung, die auf Irle zurückgeführt werden kann, in den Einzelfällen nicht nachgewiesen werden kann. Irle scheint sich Kollegen gegenüber, die er gekannt und geschätzt hat, unabhängig von deren poltischen Meinung loyal verhalten zu haben, dies traf sowohl für sozialdemkratische Lehrer wie Hermann Engelbert, aber auch auf „Alte Kämpfer“ (Walther Balzer) zu.
Ein Fundstück in der „Freiheit“ vom 19. Februar 1929: Dort wird Heinrich Otto im Zusammenhang mit einem Ausschlussverfahren als Siegener Ortsgruppenvorsitzender des Verbandes für Freidenkertum und Feuerbestattung erwähnt.
Mehr zu Fissmer Fries in:
Zabel, Manfred: Die Heimatsprache der Begeisterung. Ausgewählte Reden und Schriften von Fritz Fries, Siegen 1990:
S. 7 (Vorwort Hilde Fiedler)
„Fritz Fries war vom 24. April bis zum 1. Juni 1945 Oberbürgermeister der Stadt Siegen. Seinem Einsatz war es zu verdanken, dass Alfred Fissmer von der britischen Militärregierung als Oberbürgermeister ab Juni 1945 eingesetzt wurde(?).“
S. 51-52 Fries Rede im Preußischen La dagegen in der 347. Sitzung am 9.10.1924 zur Veranstaltung der Deutschen Friedensgesellschaft mit dem frz. General Verraux: “ … Wir erwarten von der Leitung der Polizei, sowohl von der örtlichen Organen in Siegen, von dem Oberbürgermeister Fissmer, als auch vom Landrat Gödicke[!], dass die Versammlung unter allen Umständen stattfinden kann …..“!
S.72 Fries am 8.4.1933 (Verhaftung): „…. Allgemein erkläre ich noch, dass ich mich ie an verbotenen oder illegalen Handlubgen beteiligt habe , nie auch je dazu aufgefordert habe. Auch diese ist dem Oberbürgermeister Fissmer und all seinen nachgeordneten Beamten absolut bekannt. …“
S. 112 Fries Siegener Volkszeitung 18.12.1929: „…. „“Fissmer-Hindenburg-Fries“ ….“ (?)
S. 135 – 137 Fries (1961): Der Abschnitt „Oberbürgermeister Fissmer in Siegen“ gibt die Fries´sche Sicht auf dessen Verhältnis zu Fissmer ausführlich wieder: 1927/28 „Burgfrieden“
S. 142 Fries (1961): „…. Für die große „Gagfah“-Siedlung auf dem Rosterberg sollte Ende der 20er Jahre für eine größere Anleihe der Stadt Siegen die Bürgschaft übernehmen; dafür brauchte sie die Genehmigung des preußischen Innenministeriums. OB Fissmer bat mich dieselbe einzuholen. Von Berlin aus telefonierte ich mit dem Oberbürgermeister: „Wenn man eine Sicherheit verlange, was ich anbieten sollte?“ “ Bieten Sie den ganzen Stadtwald und die Aktien vom Elektrizitätswerk an.“
Herr Ministerialdirektor Dr. von Leyden gab mir die Genehmigung für die Stadt Siegen, betonte aber, dass das die erste Genehmigung dieser Art sei, die an eine Stadt erteilt würde. Per Telefon gab ich OB Fissmer die Cemehmigung bekannt, betonte aber, dass diese befristet sei; sofort antwortete A. Fissmer „aus seinem vornehmen Wortschatz „: „In zehn Jahren können die uns am A…. lecken.“ …..“
Das ist schön,wenn er sich mit dem Thema beschäftigt hat.Trotzdem sind da viele Fehler drin.Habe die Daten im Kopf gespeichert.
Er sollte mit Leuten sprechen die AHNUNG von haben.
Ich würde mir eine konstruktivere Kritik wünschen – sei es als ausführlichen Kommentar oder als einen eigenen Gastbeitrag. Nur so funktioniert historischer Erkenntnisgewinn in den sozialen Medien. Wenn dies nicht gewünscht ist, dann bin ich davon überzeugt, dass Dr. Henrich-Franken, der über die Uni Siegen zu erreichen ist. Einem Zeitzeugengespräch nicht abgeneigt ist.
Sie haben Freude. Das finde ich gut. Aber nun muss ich es leider auflösen:
Es ist ein Muster in der Butter /nach dem Schwamm-Drüber-Blues https://www.youtube.com/watch?v=mtGXaAvOLWI
Sie haben recht dieses Rätsel bereitet mir tatsächlich Freude und Sie sorgen ja auch mit Ihrer Antwort für weiteren Spaß – aber leider nicht für die richtige Lösung. Übrigens, ich muss gestehen, dass eine der bisherigen Antworten schon sehr in die richtige Richtung ging. Die Herbstferien in NRW dauern ja noch bis zum 16.10. (!), bis dahin wird wohl die richtige Lösung eintrudeln.
Literaturhinweis: Plaum, Bernd D.: Die Leiden des jungen Dr. K. an Siegen – Hans Kruse und Siegens Stadtentwicklung während der Hochindustiralisierung, in Siegener Beiträge 19 (2014) S. 112 – 119
Weiterer Literaturhinweis, der gesundheitliche Probleme Kruses andeutet:
Traute Fries/Hartmut Prange: „Hier geschieht niemanden Unrecht!“ Zur Geschichte von Dr. Artur und Else Sueßmann und der Familie ihrer Tichter Annemarie Meyer. Eine Dokumentation, Siegen 2010, S. 23.
Die Antwort mit dem keramischen Isolator hat mich noch auf eine Idee gebracht. Vielleicht ist es das Gewinde eine alten Zündkerze? Die hat allerdings auch eher nichts in einem Archiv zu suchen.
Ev. Traureg. Siegen (Bd. 48 1737-1776)
1741 (vorl. Eintrag)
dom. ante nov. an.
Johann Philipp Engels, Sebastian Engels Bürgers alhier ehel. Sohn.
Jungfer Anna Catharina, des Ehren… und WohlWeisen … Johann Jacob Daub StadtSchöffen hierselbst ehel. Tochter
copuliret den 29. Jan. (1742)
Carriere – führt nach Wittgenstein:
Ev. Taufreg. Berleburg
1731, den 4ten Martii
Ludwig Carriere, Goldschmidt alhier und Magdalena Eheleute lassen taufen eine junge Tochter, ist genandt Sophia …
*******
1732, den 21. Decembris
Ludwig Carriere, Goldschmidt alhier und Magdalena Eheleute lassen taufen einen Jungen Sohn, ist genandt Christian Ludwig
*******
Ev. Sterbereg. Berleburg
1733
den 28ten julii ist alhier in der Stille begraben worden und auch an den Blattern gestorben Ludwig Carriere Goldschmidts alhier Söhnlein, seines Alters 5 Monat alt.
(nach Angaben in der Wittgensteiner Familiendatei von J.K. Mehldau wurde Ludwig Carriere in Marburg wegen Falschmünzerei hingerichtet, siehe auch HStA Marburg: Peinlicher Prozess gegen den Goldschmied und Kolonisten Louis Carrière zu Todenhausen wegen Falschmünzerei, 1738 ff.)
Tolle Hinweise! Danke dafür!
In Hessen findet sich dazu konkret folgendes:
HStAD Bestand S 1 Nr. NACHWEIS1:
Personenname: Carrière, Paul Louis
Geburtsdatum: 21.08.1698, Geburtsort: Vevey
Sterbedatum: vor 1757
Biografische Angaben
verh. 19.07.1719 Greifenthal: Hugues, Magdelaine (1698-1757), franz. Glaubensflüchtling
1710 Goldschmiedelehrling in Kassel
1734 Goldschmied in Todenhausen
1738 in Rauschenberg
Die Prozessunterlagen finden sich unter den Signaturen:
HStAM, 260 Marburg, 544 – 546, 548
Heute erschien in der Siegener Zeitung der Leserbrief „Schild soll bleiben“, der sich für die Beibehaltung der Lothar-Irle-Str. ausspricht. Zu Lothar Irle finden sich einige Einträge hier im Blog.
Heute erschien als Antwort auf diesen Leserbrief folgender Leserbrief „Ewig gestrige Person“ in der Westfälischen Rundschau (Print), der zu Lothar Irle u.a. folgendes ausführt: “ …. Aufsatz „Der Brauerei- und Brennereibesitzer-Zweig Irle in Marienborn“, erschienen im August 1934 in Dortmund in der „Familienzeitung des Geschlechtes Irle“, Band 2 Heft 4, auf S. 33 – 40, …. Dieser Aufsatz wird eingeleitet mit den Sätzen: „Blut und Boden sind zwei der wichtigsten Schlachtrufe aus dem Kampf um den sozialistischen Staat auf völkischer Grundlage. In diesem Kampf hören wir weder den einen noch den anderen Begriff allein, beide gehören zusammen wie die Begriffe Nationalismus und Sozialismus, Führer und Gefolgschaft, Mutter und Kind. Wenn man eins von dem anderen trennt, entstehen Unnatur und Zerrüttung geregelter Verhältnisse.“ ….
Als Vorsitzender des SGV-Bezirksverbands Siegerland durfte Lothar Irle während der 650-Jahr-Feier …. Grissenbach im Juli 1961 die anschließend in der angesehenen Zeitschrift „Siegerland“ im Wortlaut veröffentlichte Festrede halten. Wenn er darin u.a. bedauerte, wie klein im Siegerland die den Volkstanz pflegenden Gruppen gegenüber denen seien, die ‚den Tänzen der Primitiven huldigen‘, so zeigt dies doch mehr als deutlich, wie er sein völkisches, ja weiterhin braunes Denken ungestört in die bundesrepublikanische Siegerländer Gegenwart transportieren konnte. ….“
Hans Kruse ist ja auch ein Namensgeber einer Straße, die in der aktuellen Diskussion eine Rolle spielt. Der Arbeitskreis des Stadtrates schlägt folgendes Erläuterungsschild vor:
“Dr. Hans Kruse (1882‐1941), Historiker und Archivar – bei der Straßenbenennung 1975 blieben sein völkischer Hintergrund und die offene Unterstützung des NS‐Regimes unberücksichtigt.”
Von daher ist es interessant zu sehen, zu welchem Ergebnis die aktuellste Forschung gelangt ist.
Dafür, dass er nicht in der NSDAP war, gibt es bislang keine Belege, aber starke Indizien, dafür, dass er es war. Man denke nur nur an den Fall Wurmbach und die damaligen taktischen Empfehlungen. Alles nachlesbar. Nachlesbar sind auch Kruses Vorworte in der Jahrespublikation des „Heimatvereins“. Die ließen in ihrer Eindeutigkeit für einen Nazileser nichts zu wünschen übrig.
Ich gehe davon, dass die Magisterarbeit – die leider nicht auf dem Dokumentenserver OPUS der Universität Siegen verfügbar ist – auch folgende Akten des Berliner Bundesarchivs zu Rate gezogen hat:
– R 9361-V/26169 (Sammlung Berlin Document Center (BDC): Personenbezogene Unterlagen der Reichskulturkammer (RKK)) Kruse, Hans, *22.4.1882
– NS 5-VI/17640 Bd. 132: Kr, 1941, 1946-1950, enthält u. a.: Kruse, Dr. Hans, Museumsdirektor, 1941 [ Ns 5-VI Deutsche Arbeitsfront/Zentralbüro, Arbeitswissenschaftliches Institut]
Porzellan-Isolator
Es gibt übrigens ein ganz tolles Isolatorenmuseum in
Lohr am Main, Gründer ist der leidenschaftliche Sammler Herrn Vormwald ..passt doch wunderbar zum Ortsteil Vormwald im Kreis Siegen-Wittgenstein.
Ein Zufallsfund:
“ …. Auf Grund der Verfügung des Herrn Regierungspräsidenten in Arnsberg wurden im abgelaufenen Jahre zwei Ausbildungslehrgänge für Milchhändler durchgeführt. Jeder Kursus umfaßte 72 Stunden und vermittelte den Teilnehmern die so unbedingt notwendigen biologischen, technischen und hygienischen Kenntnisse für den Milchvertrieb. Nicht minder wichtig waren die geschäftskundlichen Belehrungen. Als Lehrer waren tätig der Handelsoberlehrer Fischer, Tierarzt Dr. Henrichs, Kreisarzt Dr. Sueßmann und Nahrungsmittelchemiker Dr. Fuchs. Das neue Reichsmilchgesetz stellt mit Recht weitgehende Anforderungen an die Vertreter des Milchhandels, kommt es doch zum Vertrieb des wichtigsten Nahrungsmittels für Säuglinge, Kranke und Gesundean. An jedem Lehrgang nahmen 33 Personen teil, die sich am Schluß einer Prüfung unter dem Vorsitz des Berichtserstatter [Anm.: Schulleiter Karl Breitenbach] und im Beisein von Vertretern der Kommunalverwaltungen, sowie des Kreischemikers Schemm und des Verbandsgeschäftsführers Dr. Klutmann, Essen, unterzogen. Welchen Wert die Regierung diesen Lehrgängen beimißt, geht schon daraus hervor, daß die Genehmigung zum Milchhandel künftig nur mehr solchen Personen erteilt wird, die die persönliche und geschäftliche Eignung nachweisen. ….“ aus: Jahresbericht 1929/30 der Städtischen Berufs- und Fachschulen Siegen, S. 8-9
Ein weiterer Zufallsfund belegt Artur Sueßmann als medizinischen Sachverständigen in dem aufsehenerregenden Mordfall Angerstein, wie dieser Ausriss aus der Bergisachen Zeitung vom 9. Juli 1925 dokumentiert:
Nichts gegen Mr. Aldrin persönlich, aber es scheint mir nicht gerade feinfühlig zu sein, unter den gegebenen weltpolitischen Verhältnissen einen Platz ausgerechnet nach einem ehemaligen Berufs-Kampfpiloten zu benennen (der nebenbei noch einen Job auf dem Mond erledigte).
Die Nachkommenschaft der im frühen 18. Jahrhundert aus Trupbach ausgewanderten drei (?) Familien dürfte bis heute auf einige tausend Seelen angewachsen sein. Warum fiel die Wahl also gerade auf Mr. Aldrin und nicht auf einen anderen dieser vielen Menschen, worunter sich doch sicherlich eine Reihe verehrungswürdiger(er) Kandidaten hätte finden lassen? Man hätte in Trupbach natürlich auch ganz auf den anachronistischen Benennungs-Unfug verzichten können.
Aldrin entstammte der Trupbacher Familie Richter (amerikanisiert zu Rector). Wenn es zutrifft (wie u.a. auf https://homepages.rootsweb.com/~george/johnsgermnotes/trupbach.html nachzulesen ist), dass Richters Haus das einzige im Zweiten Weltkrieg bei einem Luftangriff, also quasi durch einen früheren Kollegen Aldrins, zerstörte Trupbacher Gebäude war, entbehrt die Benennung nicht einer gewissen Ironie.
Ich korrigiere meine Schätzung „einige tausend“. Es gibt ein Monumentalwerk von Laura Wayland-Smith Hatch, „Rectors remembered: The descendants of John Jacob Rector“, in dem „the lives of over 45,000 individuals“ als Nachfahren der emigrierten Trupbacher Familie Richter dokumentiert werden. Für die ebenfalls im 18. Jahrhundert nach Amerika ausgewanderten anderen Trupbacher Familien wird man ähnliche Fortpflanzungsraten ansetzen dürfen. Somit ist Buzz Aldrin einer von weit über 100.000 Amerikanern mit familiären Wurzeln im Siegerländer Trupbach. Schön für ihn.
Menschen, die sich aus (ihrer Meinung nach) guten Gründen nicht bei Facebook registrieren wollen, werden wieder einmal benachteiligt, indem ihnen der Zugang zu Informationen versperrt bleibt. C’est la vie.
Hätte zu gerne den Facebook-Post eingebettet. War mir aber nicht möglich. Daher paraphrasierend: Der Post stellt die Begründung der Platzbenennung in Verbindung mit der aktuellen Straßennamendiskussion in Siegen: “ ….´Wegen Vorfahren aus Trupbach. Da wird das „wertvolle Erbe der Urahnen“ gepflegt.´….“
Danke.
Nicht neu, aber in dem Zusammenhang einmal mehr erwähnenswert ist, dass z.B. Anna Jarvis, die Begründerin des (nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg noch weit von der späteren Kommerzialisierung entfernten) Muttertages, eine Nachfahrin der Trupbacher Auswanderer war. Und dann wäre da natürlich auch noch Brad Pitt …
Ein Zitat für die Motivation zur Erforschung der Leher:innenbiographien aus Zabel, Manfred: Die Heimatsprache der Begeisterung. Ausgewählte Reden und Schriften von Fritz Fries, Siegen 1990:
S.79 Rede Fries, 22.6.1945 in Arnsberg: „…. Unsere Nazilehrer haben in einer Weise an unserem Volk gesündigt, dass darunter noch zwei Generationen zu leiden haben werden. Sie haben durch ihren Unterricht das Nazigift eingeträufelt. Es wird lange dauern, bis das beseitigt ist. Leute bis zu 30 Jahren sind durch ihre Nazischulen gegangen. Diese jungen Menschen sind in falscher Auffassung aufgewachsen. So ist leider ein großes Schuldkonto bei unseren Lehrern festzustellen. Wenn deshalb eine Animosität gegen sie besteht, so haben die Lehrer das sich selbst zuzuschreiben. Man sah sie überall mit dem Hakenkreuz in Nazitätickeit. Diese Zeit hätten sie gegen den Krieg aufwenden sollen. Viele Lehrer haben in wüstesten Weise gegen die Religion gehetzt. ….“
“ …. Im Nachlass von Wilhelm Fries befindet sich eine Sammlung von Korrespondenz der NSDAP, Lehrern und dem Leiter der Oberschule, später Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium, Dr. Reinhard Becker. Es gab zum Verhalten des Schulleiters gegenüber Lehrern und Außenstehenden verschiedene Vorfälle und Anschuldigungen, die zur Schlichtung an die Parteileitung gelangten. In diesem Zusammenhang wandte sich Hermann Böttger mehrmals an den Parteigenossen Paul Giesler und bat um Vermittlung. Oberstudienrat Böttger wandte sich genauso nach dem Umbruch am 19. Jumi 1945 an den Regierungspräsidenten und setzte sich für die Wiedereinstellung von Dr. Becker, der das Gymnasium von 1937 an bis zum Kriegsende leitete, ein. So wie er Paul Giesler schilderte, dass Dr. B. „unbedingt Nationalsozialist, seit 1931 Parteigenosse ist und Freikorpskämpfer war“, beschreibt er dem Reg.-Präsidenten Fritz Fries, dass Dr. Becker menschlich gewesen sei „und seine ganze Weidenauer Zeit ist überhaupt voll von oft sehr scharfen Auseinandersetzungen mit der Siegener Parteileitung und örtlichen Parteifunktionäremn. ….“ aus: Fries, Traute: Wilhelm Fries aus Weidenau. Ein beispielhaftes Leben im 20. Jahrhudert. Eine biographische Skizze, Siegen 2007, S. 47
1. Wenn ich es richtig verstehe, befürwortet die Siegener CDU-Fraktion, einen überführten Sexualstraftäter (Graf Luckner) weiterhin durch eine Straßenbenennung zu ehren.
2. Wenn ich es richtig verstehe, würde die Siegener CDU-Fraktion theoretisch kein Problem damit haben, z.B. die 1945 erfolgte Umbenennung der Adolf-Hitler-Straße (heute Sandstraße) rückgängig zu machen, sofern nur eine über den Namenspatron hinreichend aufklärende Hinweistafel angebracht würde. Deren Schlußsatz: „Nach heutiger Sicht würde eine Würdigung dieser Person nicht mehr erfolgen“.
3. Ich bin mir absolut sicher, dass die Christlich-Demokratische Union deutschlandweit auch den einen oder anderen intelligenten und ehrenwerten Menschen zu ihren Mitgliedern zählt.
4. Brechreiz ist kein Thema für Siwiarchiv.
Danke für den Kommentar und Entschuldigung, dass Sie dadurch körperlich beeinträchtigt wurden! Erinnerungspolitische Themen – zumal, wenn sie, wie in diesem Fall ein Archiv der Region treffen (immerhin war der Leiter des Siegener Stadtarchivs quasi Geschäftsführer des Arbeitskreises, der den o.e. Abschlussbericht vorgelegt hat) – sind leider ein Thema für das Blog. Wo, wenn nicht hier?
Da haben Sie, lieber T.W., mich missverstanden. Selbstverständlich gehört das Thema in diesen Blog. Was m.E. nicht hineingehört, sind allzu weitschweifige Ausführungen über persönliche Befindlichkeiten – weshalb ich es heute Nacht auch bei der knappen Andeutung beließ, dass ich mich von der CDU-Fraktion verarscht fühle.
Aus dem Leserbrief „Ewig gestrige Person“ in der Westfälischen Rundschau vom 18.10.2022: “ …. Aufsatz „Der Brauerei- und Brennereibesitzer-Zweig Irle in Marienborn“, erschienen im August 1934 in Dortmund in der „Familienzeitung des Geschlechtes Irle“, Band 2 Heft 4, auf S. 33 – 40, …. Dieser Aufsatz wird eingeleitet mit den Sätzen: „Blut und Boden sind zwei der wichtigsten Schlachtrufe aus dem Kampf um den sozialistischen Staat auf völkischer Grundlage. In diesem Kampf hören wir weder den einen noch den anderen Begriff allein, beide gehören zusammen wie die Begriffe Nationalismus und Sozialismus, Führer und Gefolgschaft, Mutter und Kind. Wenn man eins von dem anderen trennt, entstehen Unnatur und Zerrüttung geregelter Verhältnisse.“ ….
Als Vorsitzender des SGV-Bezirksverbands Siegerland durfte Lothar Irle während der 650-Jahr-Feier …. Grissenbach im Juli 1961 die anschließend in der angesehenen Zeitschrift „Siegerland“ im Wortlaut veröffentlichte Festrede halten. Wenn er darin u.a. bedauerte, wie klein im Siegerland die den Volkstanz pflegenden Gruppen gegenüber denen seien, die ‚den Tänzen der Primitiven huldigen‘, ….“
Die Siegener Zeitung hat die Pressemitteilung bereits aufgegriffen. Der Artikel ist online und wird auf der Facebook-Seite der Zeitung bereits kommentiert:
Auch die Westfälische Rundschau berichtet dazu heute online und im Print.
Im Vorfeld der Sitzung des Siegener Stadtrats am 19.10.2022 hat mich ein in der SZ vom 13.10.2022 veröffentlichter, m.E. beschönigender und Falschinformationen enthaltender Leserbrief von Gisela Rauch veranlasst, hierauf in einem eigenen Leserbrief zu erwidern. Leider ist dieser bisher noch nicht in der SZ veröffentlicht worden, obwohl es dort seit meiner Einsendung bereits 2 Ausgaben mit Leserbriefen gegeben hat. Dankenswerterweise wurde mein Leserbrief heute in der WP / WR abgedruckt. Hoffentlich hat er noch Einfluss auf die Meinungsbildung bei den bisher noch schwankenden Siegener Politikern und Politikerinnen. Nachstehend der Wortlaut:
Zum Leserbrief „Schild soll bleiben“ in der SZ vom 13.10.2022
Mit Interesse verfolge ich die aktuellen Diskussionen zu den in Erwägung gezogenen Straßenumbenennungen in Siegen. Als ich noch in Siegen lebte, hatte die Straße, in der ich dort wohnte, in diesem Zeitraum drei verschiedene Namen, u.a. bedingt durch die kommunale Neugliederung. An ein Aufbegehren der davon betroffenen Anwohner hiergegen kann ich mich nicht erinnern.
Als Hobbyheimatforscher ist mir der Autor Lothar Irle kein Unbekannter. Zuletzt habe ich seinen Aufsatz „Der Brauerei- und Brennereibesitzer-Zweig Irle in Marienborn“, erschienen im August 1934 in Dortmund in der „Familienzeitung des Geschlechtes Irle“, Band 2 Heft 4, auf S. 33 – 40, gelesen. Dieser Aufsatz wird eingeleitet mit den Sätzen: „Blut und Boden sind zwei der wichtigsten Schlachtrufe aus dem Kampf um den sozialistischen Staat auf völkischer Grundlage. In diesem Kampf hören wir weder den einen noch den anderen Begriff allein, beide gehören zusammen wie die Begriffe Nationalismus und Sozialismus, Führer und Gefolgschaft, Mutter und Kind. Wenn man eins von dem anderen trennt, entstehen Unnatur und Zerrüttung geregelter Verhältnisse.“ Das Zitieren ähnlicher propagandistischer Entgleisungen dieses Akademikers möchte ich mir an dieser Stelle ersparen.
Als Dozent für Volkskunde an der Hochschule für Lehrerbildung Dortmund konnte der bekennende Antisemit Lothar Irle zahlreiche Lehrer und Lehrerinnen im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie indoktrinieren, die dann anschließend als Multiplikatoren vor den ihnen anvertrauten Schulklassen auftraten, um die deutsche Jugend ebenfalls in diesem Sinne zu infiltrieren und zu manipulieren.
Dass Lothar Irle nach dem Ende des Dritten Reichs „die wieder angebotene Lehrerstelle rigoros abgelehnt“ habe, wie die Leserbriefschreiberin anführt, deckt sich nach meinem Kenntnisstand übrigens nicht mit der Aktenlage, wonach Irle aufgrund seiner erheblichen NS-Belastung im Zuge der Entnazifizierung aus dem Schuldienst entlassen und nicht wieder eingestellt worden ist.
Als Vorsitzender des SGV-Bezirksverbands Siegerland durfte Lothar Irle während der 650-Jahr-Feier meines heutigen Wohnorts Grissenbach im Juli 1961 die anschließend in der angesehenen Zeitschrift „Siegerland“ im Wortlaut veröffentlichte Festrede halten. Wenn er darin u.a. bedauerte, wie klein im Siegerland die den Volkstanz pflegenden Gruppen gegenüber denen seien, die ‚den Tänzen der Primitiven huldigen‘, so zeigt dies doch mehr als deutlich, wie er sein völkisches, ja weiterhin braunes Denken ungestört in die bundesrepublikanische Siegerländer Gegenwart transportieren konnte.
Egal, welche „Verdienste“ um die Heimatkunde und Familienforschung im Siegerland man dem glühenden Nationalsozialisten Dr. Lothar Irle zuschreiben mag, der sich später nie öffentlich von seinen damaligen Überzeugungen distanziert oder diese bereut hat, seine Ehrung im öffentlichen Raum durch die in Siegen-Kaan nach ihm benannte „Lothar-Irle-Straße“ gehört zu Recht auf den Prüfstand und wird hoffentlich bald rückgängig gemacht.
Ich jedenfalls würde mich mit diesem Hintergrundwissen schämen, in einer Straße wohnen zu müssen, die nach einer solchen, bis an ihr Lebensende unbeirrbar ewig gestrigen Person benannt ist.
Da hat der Eintragende einmal die bisherigen Äußerungen mit der Ratszusammensetzung ins Verhältnis gesetzt. Ist natürlich nur eine Prognose bzw. Vermutung.
Ergänzender Antrag von Volt und SPD zur heutigen Sitzungen:
– Hindenburgstr. und Irle-Straße, Bergfriederstr. werden umbenannt
– Die nach Adolf Stoecker benannt Straße wird umgewidmet . Die neue Namenspatronin wird Helene Stöcker.
– Die die übrigen Straßen (Wagner, Porsche, Diem), die umbenannt werden sollten, werden in den Arbeitskreis zur weiteren Arbeit zurücküberwiesen.
– Die Graf-Luckner-Str. wird durch den Arbeitskreis wegen neuer Erkenntnisse erneut geprüft.
– Den übrigen Empfehlungen des Arbeitskreises wird gefolgt.
Link: https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz090/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZf2hrl5piAIfG50flRO9I5SSfYqI3Ta-4o5Yt-33r1FV/19.10.2022_Rat_Antrag_zu_VL_881_2022.pdf
Heute erschienen 2 Leserbriefe in der Siegener Zeitung (Print):
1) der bereits am 18.10. in der Westfälischen Rundschau erschienene Leserbrief zur Person Dr. Lothar Irle. In der SZ allerdings gekürzt.
2) der Leserbrief „Passender Fauxpas“, der eine Vornamensverwechslung eines Protagonisten in der Diskussion vermerkt. Ob es sich um die im Rahmen der Diskussion vorgeschlagene Benennung des „Hauses der Musik“ in Siegen nach Friedrich Deisenroth – „weit über die Region bekannten und beliebten Dirigenten und Komponisten“ – handelt, ist leider nicht erkennbar. Jedenfalls wurde dieser irrtümlich mit Hermann bezeichnet.
Deutlich zu spät ist heute, nachdem die Entscheidung im Siegener Stadtrat ja bereits gefallen ist, mein Leserbrief zur Lothar-Irle-Straße in Siegen-Kaan doch noch in der Siegener Zeitung in einer stark amputierten Kurzversion erschienen. Und mein letzter Satz wurde einfach mittendrin für beendet erklärt.
Ich empfehle allen Schulen im Kreis Siegen-Wittgenstein einen Besuch im Kreisklinikum Hadamar ( ca 60 km) und dem dortigen Archiv. Eine mögliche Aufgabe für die Schüler: „Informiere dich über einen Patienten (mit Bild!) und stelle uns seine Geschichte vor“. Digital und als Teil einer Wandzeitung für eine Ausstellung. (Vorher Absprachen mit dem Archiv, Bereitstellung von Material (Kopien), Kurzvortrag / Einführung in die Arbeit der Dokumentationsstelle, …) https://www.karl-heupel.de/medien/krieg_im_siegerland/toetungsanstalt_hadamar/index.html
Zur Geschichte der Loge befindet sich im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin unter der Bestandssignatur FM, 5.2. S 44 der Bestand „Johannisloge „Zu den drei eisernen Bergen“, Siegen“. Die legiglich mit einer Findkartei erschlossenen 90 (!) Verzeichnungseinheiten reichen von den 1820er Jahren bis zur Auflösung der Loge im Jahr 1935
Am vergangenen Donnerstag wurde im Vortrag über Dr. Hans Kruse, auf dessen ebenso intensive wie erfolglose Bemühungen hingewiesen, das Logenhaus in der Koblenzer Str. 5 in Siegen nach dessen Beschlagnahme durch die Nationalsozialisten als Erweiterung für das von ihm betreute Siegerlandmuseum zu erhalten. Allerdings geriet in diesem Zusammenhang Logeninventar in das Siegerlandmuseum. Unklar ist, so zumindestens die Referentin, ob alles zurückerstattet wurde.
Entschuldigung für die schlechte Bildqualität!
Heute erschien in der Siegener Zeitung der Leserbrief „Bitterer Beigeschmack“, der den unglücklichen Verlauf des Schachlottos anlässlich der Schacholympiade thematisiert.
Paulchen II., der Waschbär (das neue Maskottchen des Kreisarchivs), auf nächtlicher Futtersuche im Büro des Chefs.
(Paulchen I. war der Wisent – hat sich nach dem Scheitern des Auswilderungsprojektes in die Ewigen Jagdgründe verzogen.)
Das ist eine konstruktiviere Kritik,ihr könnt nur nicht die Wahrheit erfahren.
Wie es richtig verlaufen ist.Schrecklich sowas hauptsache die Leute bekommen was erzählt.
In der heutigen Siegener Zeitung erschienen die drei Leserbriefe „Wichtigere Dinge“, „Ziel erreicht“ und „Keine Kapazitäten frei“, die sich allesamt kritisch über die beschlossenen Umbenennungen äußern.
Bei einer zukünftigen Diskursanalyse scheint es interessant zu sein, woher die Autorinnen und Autoren der Leserberiefe und – sofern verlässlich ermittelbar – der Kommentare in den sozialen Medien (in diesem Fall, wenn ich es recht sehe überwiegend Facebook) stammen. Denn in der entscheidenen Sitzung des Stadtrates wurde auf genau dieses Meinungsbild abgehoben.
I am a distant relative of the second wife of heinrich von dornberg. Wanda kubale von dornberg was my great garnd aunt. Where can I find which museums have his work(s)?
Any information would be greatly appreciated. Thank you.
s. dazu
– Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden Bestand 407 ( Polizeipräsidium Frankfurt a.M.) Nr. 889, Kriminalpolizeiliche Sammlung zum Mordfall Angerstein in Haiger im Jahre 1924, 1924-1925, 1950 (enthält: Presseausschnitte, Tatortuntersuchung des Instituts für gerichtliche Chemie und Mikroskopie in Frankfurt am Main 1924)
– Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, I. HA Rep. 90 Annex L ( Handakten des Geh. Finanz- und Ministerialrats Franz Hermann Reschke (Sitzungsprotokolle)), Nr. 5,Sitzungen des Preußischen Staatsministeriums, Enthält: – [a] 28.10.1925: (1) Todesurteile gegen Angerstein und Krause
– Im Bildarchiv des Bundesarchivs finden sich drei Fotografien, die während des Prozesses im Juli 1925 entstanden sind (Zwei Aufnahmen Angerstein bei Verlassen des Gefänisses sowie eine Aufnahme des Landgerichts Limburg mit Schaulustigen): https://www.bild.bundesarchiv.de/dba/de/search/?query=122204379
– Klaus Günther: Wann hat eine Tat ihren Täter? Ein Beitrag zur Rechtslehre als Wissenschaft vom Menschen, in: Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik (2018), S. 389 – 393, Link (PDF)
– Hörspiel „Bestie Angerstein“ (SWR 2019): https://archive.org/details/bestie-angerstein
Zu Dörnberg s.:
– Boetticher, Friedrich von: Malerwerke des neunzehnten Jahrhunderts. Beitrag zur Kunstgeschichte. Erster Band: Aagaard – Heideck, Dresden 1891, S. 234:
– Noack, Friedrich : Dörnberg, Heinrich Frhr. von. In: Ulrich Thieme (Hrsg.): Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker. Band 9: Delaulne–Dubois. E. A. Seemann, Leipzig 1913, S. 371:
– Gradel, Oliver, Düsseldorfer Malerschule in Rechtenfleth. Heinrich von Dörnberg (1831-1905) und seine Gemälde für Hermann Allmers, in: Ausstellungskatalog „Mensch sein und den Menschen nützen. Hermann Allmers und seine Künstlerfreunde“, hrsg. v. Axel Behne und Oliver Gradel, (Kranichhaus-Schriften; 4), Otterndorf 2002, S. 33-65
Bierdeckel-Marketing (?) für eine erfolgreiche Veröffentlichungsreihe von Lothar Irle (5 Bde zwischen 1960 und 1974). 6 Bierdeckel scheint es gegeben zu haben:
Weiß jemand Näheres?
Da der Welttag des audiovisuellen Erbes bereits vorbei ist, bin ich urlaubsbedingt wohl schon zu spät, jedoch hört es sich für mich so an, als würden Formulare in einen einfachen Papierordner einsortiert.
– Ein Zeitzeugen-Bericht Herbert Bäumers zur belgischen Garnisonsstadt Siegen:
Herbert Bäumer ist u. a. Autor des Buches „Von der Wehrmacht zur belgischen Garnison. Der Militärstandort Siegen in Wort und Bild. Dokumentation aus Anlass des Abrisses der Kasernengebäude, Siegen 2001.
– Im Bericht der Zeitzeugin Anne Margarete Ising schildert sie ihre „Kindheitserinnerungen an Trupbach und die Belgier“.
– Hermann Schmid berichtet über den „Fischbacherberg – ein Quartier im Wandel“:
Weitere Medienberichte über Dr. Sueßmanns Wirken:
– Rheinisches Volksblatt, 29. März 1924:
– Sauerländisches Volksblatt, 12. September 1924:
– Bürener Zeitung, 19. Januar 1927:
– Central-Volksblatt für das gesamte Sauerland, 8. Oktober 1930:
s. a. Rassenhygiene in der Schule, Med.-Rat Sueßmann,
Siegen i. W., Zeitschrift für Medizinalbeamte,
Nr. 8. 15. April 1928. Dieser Hinweis verweist auf die erforderliche Durchsicht der medizinischen Fachliteratur auf Beiträge von Suessmann.
Heute erschienen 4 weitere Leserbriefe in der Siegener Zeitung, die sich kritisch zur Ratsentscheidung äußern: „Bürger nicht gefragt“, „Infotafel zur Aufklärung“ (Enkelin Dr. Lothar Irles), „Denn sie wissen nicht, was sie tun“ und „Geistig verarmt“.
Ev. Kirchenbücher Hilchenbach:
Beerdigungsregister 1948/55
SCHREY, Gerhard, Hilchenbach, Lehrer i.R. in Hilchenbach, Witwer
*21.05.1881 in Jüchen Kr. Grevenbroich
hinterl. 3 erw. Töchter, 2 Enkel
Gattin Emmy geb. Reifenrath verst. 06.05.1945
+11.11.1948, 21.40 h an Schlaganfall
begr. 15.11.
Trauregister 1911/8
SCHREY, Gerhard, Lehrer in Dreistiefenbach, ev., 30 J
S.v. Gerhard Schrey, Dreistiefenbach
Emmi Reifenrath, Hilchenbach, ev., 34 1/4 J
T.v. +Eduard Reifenrath, Gerbereibesitzer in Hilchenbach
oo am 18.04.1911 in Hilchenbach durch Pastor Vollpracht, Oberholzklau
(die Mutter von Emmi R. war Elis. Caroline geb. Vollpracht *04.12.1876 in Hilchenbach)
Hallo, mein Name ist Ellen Drews aus Neunkirchen-Zeppenfeld. Zufällig bin ich auf diesen Eintrag gestoßen und kann etwas dazu beitragen. Die Bande zwischen Hamburg-Neuenfelde und dem Siegerland sind zahlreich gewesen.
Kapitän Otto Albers hat Dora Kraemer aus Kreuztal geheiratet.
Ottos Schwester Irma Albers (meine Oma) hat Günter Kraemer (meinen Opa), den Bruder von Dora geheiratet. Meine Großeltern hatten sich in Kreuztal niedergelassen. Meine Mutter wurde aber noch in Hamburg-Neuenfelde geboren.
Gretel, eine weitere Schwester von Otto, hat auch ins Siegerland geheiratet (Familie Klostermann).
Ein paar wenige Fotos hätte ich auch noch, vom Schiff und von Otto Albers.
Attacke auf Rubens-Gemälde: Über 10.000 Euro Schaden am Rahmen
Bayrischer Rundfunk, 4.11.22:
Attacke auf Rubens-Gemälde: Über 10.000 Euro Schaden am Rahmen
Im August hatten Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ versucht, sich in der Alten Pinakothek am Rahmen des Bildes festzukleben, der dadurch beschädigt wurde. In Rom attackierten Aktivisten am Freitag unterdessen erneut ein Van-Gogh-Gemälde.
Von
BR24 Kultur
Nach Abschluss der Restaurierungsarbeiten am Rahmen des im August attackierten Rubens-Gemäldes „Der bethlehemitische Kindermord“ steht nun fest: Der Schaden liegt auf jeden Fall über 10.000 Euro.
Aktivisten von „Die letzte Generation“ hatten sich festgeklebt
Er bewege sich im niedrigen fünfstelligen Bereich, teilte die Pressestelle der Museen mit. Zwei Aktivisten der Bewegung „Die Letzte Generation“ hatten sich damals am Rahmen des Gemäldes festgeklebt. Die Aktivisten waren nach kurzer Zeit durch die Polizei vom Rahmen getrennt und vorübergehend festgenommen worden. Bei diesem Ablösen war der Rahmen beschädigt worden. Nachdem ihre Personalien festgestellt waren, wurden sie entlassen und wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung angezeigt.
Generaldirektor Maaz ohne Verständnis für Aktion
Bernhard Maaz, der Direktor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, sagte, einige Schäden am Rahmen aus dem 18. Jahrhundert seien geblieben, womit sich sein Wert mindere. Im Gespräch mit dem BR zeigte er für die Protestaktionen in Museen kein Verständnis: „Wir hatten uns natürlich schon darauf vorbereitet und hatten Lösungsmittel zur Hand. Außerdem waren die Aufsichten geschult. Aber in dem Moment, wo es konkret wird, ist es natürlich empörend. Man kann doch nicht Kulturzeugnisse von Menschheitsrang in Gefahr bringen, um die Natur aus der Gefahr zu bringen.“
Die Aktivisten von „Die letzte Generation“ argumentieren zumeist damit, dass derartige Gemälde schon bald ohnehin nichts mehr wert sein würden, wenn man sich aufgrund der Klimakrise ums Essen streiten müsse – und versuchen auf diesem strittigen Weg auf den Klimawandel aufmerksam zu machen.
Das Museum reagiere nun mit stärkeren Kontrollen, Taschen im Ausstellungsbereich seien nicht mehr erlaubt. Zudem würden Kunstwerke häufiger verglast. Die Aktivisten erhalten drei Jahre Hausverbot. Nach dem Abschluss des laufenden Strafverfahrens würden zivilrechtliche Schritte gegen die beiden Aktivisten eingeleitet. Man sei gehalten „die finanziellen Ansprüche des Freistaats geltend zu machen“.
Neue Erbsensuppen-Aktion in Rom
In Italien griffen unterdessen Klima-Aktivisten ein weiteres Kunstwerk an: Nach Angaben der Gruppe „Letzte Generation“ bewarfen vier Aktivisten das in Rom ausgestellte Gemälde „Der Sämann“ des niederländischen Malers Vincent Van Gogh mit Erbsensuppe. Italienischen Medienberichten zufolge war das Kunstwerk hinter Glas ausgestellt und blieb unbeschädigt. Die Aktivistengruppe erklärte, es handele sich um einen „verzweifelten und wissenschaftlich begründeten Aufschrei, der nicht als bloßer Vandalismus verstanden werden kann“. Es würden weitere „gewaltfreie direkte Aktionen“ unternommen, bis dem Klimawandel mehr Aufmerksamkeit geschenkt werde. Italiens Kulturminister Gennaro Sangiuliano bezeichnete die Attacke als „schändlichen Akt, der aufs Schärfste verurteilt werden muss“.
Am 9.11. (!) erschien in der Siegener Zeitung der Leserbrief „Zu viel Aufmerkssmkeit“, der sich hauptsächlich einer umstrittenen Kunstaktion widmet, um sich dann auch gegen die vom Stadtrat beschlossenen Umbenennungen auszusprechen.
Vielen Dank für die Links!
Auch die Pressemittelung des Museums zur Eröffnungsveranstaltung enthält keinen Hinweis auf das Schaffen des Ehepaars während des Nationalsozialismus:
„Hans und Hanna Achenbach-Ausstellung im 4Fachwerk-Museum eröffnet
Retrospektive auf das Werk eines Siegerländer Künstler-Ehepaars
Mit einer umfänglichen Werkschau erinnert das 4Fachwerk-Museum an das Künstler-Ehepaar Achenbach. Der Kuratorin der Ausstellung, Dr. Ingrid Leopold, ist es gelungen, eine große Exponate-Auswahl zusammen zu tragen, womit umfassend die künstlerische Vielfalt und das Können von Hans und Hanna Achenbach deutlich werden. Zeitzeugen sahen in ihnen einst die „profiliertesten Vertreter der Siegerländer Künstlerschaft“.
Die Besucher der Vernissage zeigten sich von dem schöpferischen Erbe beeindruckt, fasziniert, dass auch nach Jahren die Bilder nichts von ihrer Wirkung eingebüßt haben. Diese belegten eindrucksvoll, wie vielschichtig und tiefgründig gerade schlichte Darstellungsweisen sein können.
Ihren gemeinsamen Siegerländer Lebensweg begannen Hans und Hanna Achenbach in (Netphen-) Obernau. Ein wohl gesuchter und gefundener Sehnsuchtsort: „Ich liebe die stille Schönheit Deiner Heimat und ich würde gerne auf einem Dorf und in bäuerlicher Umgebung leben,“ zitiert in einem Bericht Erika Falkson aus einem von Hanna Achenbach in Gleiwitz verfassten Brief an eine Siegener Freundin. „Den Reichtum des einfachen Lebens hat Hans Achenbach an der Quelle aufgesucht,“ porträtiert Hans Löw ihren Ehemann 1953. Die Wahl der Umgebung, die Einsamkeit des Siegerländer Lebens, dürfte ein Wesensbekenntnis sein, heißt es bei ihm weiter.
Am 25. November 1920 hatten Hans Achenbach und Hanna Junemann in Düsseldorf-Eller geheiratet. Beide lernten sich während ihres dortigen Kunststudiums kennen. Zwei Jahre leben die Achenbachs bescheiden von ihrer künstlerischen Tätigkeit in Obernau. 1923 und 1924 werden ihre beiden Töchter (Karin 1923, Renate 1924) geboren. Ihr Zuhause wird Siegen. Sie wohnen im elterlichen Haus von Hans Achenbach, 1938 konnten sie in ihr eigenes Eigenheim in der Winschenbach einziehen.
Beide üben zugleich einen Lehrberuf aus: Sie unterrichten „künstlerisches Weben“ an der Siegener Auschule. Von 1933 bis 1937 leitet Hans Achenbach den Fachbereich Weben an der Berufsschule für Mädchen in Siegen.
„Der Start in den Berufsalltag als freischaffendes Künstlerpaar war anfänglich nicht leicht, aber anderes hatten sie nicht erwartet, – sie waren zufrieden und genügsam. Die persönlichen Ansprüche an ihr Leben waren bescheiden. Der erste größere Auftrag war die Gestaltung der Kirchenfenster in Dorlar bei Wetzlar,“ legte Dr. Ingrid Leopold in ihrer Ansprache zur Eröffnung dar.
Hanna Achenbach ((1892-1982, Maria Johanna Junemann) erblickt am 2. Dezember 1892 in Dortmund das Licht der Welt – als Tochter des Fabrikdirektors Johann Konrad Junemann und seiner Ehefrau Maria. Als 22-jährige nimmt sie 1914 ihr Studium an der Kunstgewerbeschule in Düsseldorf auf, das bis 1919 andauert. Hier lernt sie ihren Mitstudenten Hans Achenbach kennen und lieben.
Wilhelm Ludwig Hans Achenbach (1891-1972), so sein vollständiger Name, entstammt ebenfalls einer Fabrikantenfamilie. Sein Vater Caspar Gustav Achenbach (1858-1915) war Mitbegründer des „Ohler Eisenwerks Achenbach, Kölsche & Co. Er hatte Emilie Berta Schneider (1865-1944) geheiratet, Hans, geboren am 3. März 1891, ist ihr zweiter Sohn.
Ihren Siegerländer Wurzeln folgend, ziehen Hans Eltern im Jahr 1900 nach Siegen. Nach dem Besuch des hiesigen Realgymnasiums studiert Hans Achenbach an der Königlich-Preußischen Kunstakademie Düsseldorf, denen sich Ausbildungen an den Kunstgewerbeschulen Düsseldorf und Wuppertal anschließen. Im Jahr 1913 kehrt er zunächst nach Siegen zurück und begibt sich ein Jahr später nach München, um hier aktuelle Kunstentwicklungen mitzuerleben. Der I. Weltkrieg bestimmt dann Hans Achenbachs Biografie. Es heißt, er meldet sich 1915 freiwillig als Soldat und nimmt am Kriegsgeschehen bis 1918 teil. Nach seiner Heirat mit Hanna Junemann sind beide bald dem Siegerland fest verbunden.
Hans Achenbach engagiert sich früh beim 1922 gegründeten Arbeitskreis Siegerländer Künstler (ASK). Eine Zeitungsanzeige nennt Hans und Hanna Achenbach-Junemann als Ausstellende („Malerei und Graphik“) bei der „Weihnachtsausstellung des Siegerländer Kunstvereins“ in der „Gesellschaft Erholung“. In den Nachkriegsjahren sind beide dann über Jahrzehnte bei den ASK-Ausstellungen regelmäßig vertreten, Hans Achenbach bezeichnet die Presse als „Nestor der Siegerländer Künstlergemeinschaft“ „Er ist als Künstler konsequent seinen Weg gegangen,“ sagt sein Kollege Theo Meier-Lippe über ihn.
„Hans Achenbach beschäftigte sich mit fast allen Techniken der bildenden Kunst. Er war Maler, ebenso wie Zeichner und Grafiker, und beherrschte auch die Hinterglasmalerei,“ porträtiert ihn Dr. Ingrid Leopold. Die Betrachtung der Natur, von Landschaften und Tieren, das Beobachten des nahen Umfeldes der Menschen, ihre Arbeitsgewohnheiten im Jahresverlauf verbinden Hans und Hanna Achenbach, die jedoch zu jeweils ganz eigenständigen charakteristischen Ausdrucksformen finden. Löw zitiert aus einem Brief Achenbachs aus dem Jahr 1947: „Für mich ist das Märchen die Urform aller Kunst.“ Märchen und Mythen hätten seinen Bildern die Signatur gegeben. „Achenbach bleibt immer im Märchenhaften, im Lebendigen, von der Phantasie Beflügeltem,“ ist in einem Zeitungsbeitrag 1954zu lesen. Seine Werke seien „klar und kindlich, aber nicht kindisch.“ Ähnlich „wie trauliche Volksmärchen, feinfühlig ausgearbeitet, lebendig“ werden seine Monatsblätter in einem Zeitungsbericht 1952 beschrieben. Den Reichtum des einfachen Lebens habe Hans Achenbach an der Quelle aufgesucht.
Die Einfachheit ihrer Umgebung bestätigte Dr. Martin Grotepaß über seine Großeltern Achenbach am Eröffnungsabend: „Die Einrichtung war spartanisch, überall standen Bilder herum. An Zank und Streit kann ich mich nicht erinnern, aber an die Großherzigkeit und liebevolle Zuwendung von Oma und Opa, auch den Mitmenschen gegenüber.“ Bis heute erinnert er sich gerne an die sonntäglichen Besuche dort.
Hier dokumentiert sich die Seelenverwandtschaft des Künstlerehepaars. Denn: „Das einfache Leben in ihrem Umkreis regte sie zu vielen starken Bildern an,“ heißt es über Hanna Achenbach. „In ihren Portrait- und Genrebildern von Kindern und einfachen Menschen, Bäuerinnen und Marktfrauen, zeigt sie sich immer wieder als Heimatchronistin,“ schreibt Erika Falkson über sie. Ihre Bilder seinen dem Leben „abgelauscht“, ein Ergebnis intensiver Beobachtung. Hanna Achenbachs Credo: „Ich möchte das (meine Bilder) für alle verständlich sind. Man soll spüren, dass mich die Menschen und das Leben intensiv beschäftigt haben.“ Dr. Ingrid Leopold erinnert auch an Vorbilder: „Beeindruckt war Hanna Achenbach von dem Worpsweder Malerkreis, – insbesondere von Paula Modersohn-Becker. Beide Künstlerinnen gleichen sich in Sujet und Stil und sind Meisterinnen in der Wiedergabe von Alltagsmenschen und Kindern.“
Apropos Heimatchronist: Das vielfältige Siegerländer Leben verewigt Hans Achenbach ebenso auf zahlreichen Kalenderblättern, die in den Ausgaben des „Siegerländer Heimatkalenders“ erschienen sind. In einer bemerkenswerten Artikelfolge haben Alfred Becker, Kirsten Schwarz und Cornelia Becker(-Bartscherer) die Zeichnungen inhaltlich zu- und künstlerisch eingeordnet (SIEGERLAND 2008, 2009) und damit eine wichtige Retrospektive auf sein Werk vorgenommen. „Sein vielfältiges Werk wurde bestimmt von Naturverbundenheit, Tierliebe und der Faszination guter Geschichten,“ so ein Fazit von Kirsten Schwarz (SIEGERLAND 86, 2009).
„Hans Achenbach liebte und beobachtete Tiere. Er stellte sie dar in der Monotypie-Technik, – expressionistisch beeinflusst, – wobei die Anatomie auf den äußeren Umriss reduziert und abstrahiert war,“ so Dr. Ingrid Leopold in ihrer Erläuterung.
Die Ausstellung zeigt ebenso eine Reihe christlicher Motive. „Die christliche Ethik war ihnen sehr wichtig,“ berichtet dazu Dr. Martin Grotepaß über die Einstellung der Großeltern. Über das Zerwürfnis zwischen Katholiken und Protestanten hätten sie sich sehr geärgert.
Die Präsentation „Hans und Hanna Achenbach – ein Künstlerehepaar aus dem Siegerland“ wird bis zum 22. Januar 2023 im 4Fachwerk-Museum zu sehen sein. Der Eintritt beträgt drei Euro. Das Museum ist mittwochs, samstags und sonntags von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet. Sonderführungen können abgesprochen werden.“
Auch die Berichterstattung in der Siegener Zeitung vom 12.11.22 zur Ausstellung enthält keine Hinweise: http://www.siwiarchiv.de/wp-content/uploads/2022/11/SZ121122.pdf
Mir scheint die regionale Kunstgeschichte in der Zeit des Nationalsozialismus immer noch ein auf zu arbeitendes Thema zu sein. Meine knappe Beschäftigung mit Hermann Manskopf zeigt dies ebenso wie die Nicht-Beschäftigung der Arbeitsgemeinschaft der Siegerländer Künstler (ASK) in deren „Jubeljahr“. Der ausführliche Katalog bringt lediglich den Wiederabdruck eines älteren Beitrags von Jürgen Schawacht und lässt die zwischenzeitliche „Debatte“ von Kirsten Schwarz und Ulrich Opfermann unberücksichtigt. Wenn ich es recht sehe, war gerade das Ehepaar Achenbach der Nukleus der ASK in den 30er und 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts.
– Schlaglichter aus 75 Jahren Verbandsgeschichte, Heft 10/22, S. 51 – 525
– Der Landkreistag festigt sich: Die zweite Mitgliederversammlung in Bergisch Gladbach, Heft 11/22, S. 545 – 549 [mit Hinweisen zu OKD Moning und Landrat Josef Büttner]
Hallo, mein Name ist Horst Klostermann, ich bin der Sohn von Gretel Klostermann. Otto Albers war mein Patenonkel. Ich habe auf der Sietas
Werft gearbeitet, aber die Liebe hat mich auch ins Siegerland gebracht.
Literaturhinweis zu Johann Moritz:
MONTEIRO, Carolina. „Slavery at the Court of the ‚Humanist Prince‘ Reexamining Johan Maurits van Nassau-Siegen and his Role in Slavery, Slave Trade and Slave-smuggling in Dutch Brazil.“ Leiden: Journal of Early American History, 2020, pp. 3-32.
Auf der Seite des Wittgensteiner Heimatvereins kommt Andreas Krüger in seiner Buchvorstellung zu folgendem Fazit: “ …. Bald beschränkt sich in seinem lesenswerten und nachdenklichen Buch nicht auf die Todesanzeigen im Wittgensteiner Kreisblatt, er beschreibt dabei auch die Geschichte und Gestaltung der Zeitung, ihre Herausgabe und Drucker Matthey, Winckel sen., Winckel, jun. der Unternehmen bis zum Brand der Druckerei im Jahr 1976. Er schlägt den Bogen bis in die Gegenwart, zu den heutigen Todesanzeigen, den Veränderungen der Trauerkultur in den letzten Jahren, sei es hinsichtlich Form, Gestaltung und Inhalt von Todesanzeigen, dem Verzicht auf eine „Traueranschrift”, bis hin zum Wegfall des „Beerdigungskaffees”, oft verbunden mit der Formulierung „Wir gehen still auseinander”. Bald kritisiert nicht die Veränderungen, er stellt sie fest, er beschreibt sie.
Ein Buch, das einen großen Bogen schlägt aus dem „langen 19. Jahrhundert” bis in die Gegenwart, auch wenn der Titel in dieser Beziehung ein wenig täuscht. Hinsichtlich der historischen und biografischen Beschreibungen lesenswert, nachdenklich mit Blick auf die Entwicklungen der letzten Jahre.“
Lars Peter Dickel stellt auf der Homepage der Westfalenpost ebenfalls das Buch vor – leider hinter der Bezahlschranke.
Das Westfälische Autorenlexikon weist auf 2 Briefe Berlyns an L(o)uis Spohr, (Freudenberg 1855-1857) hin, die sich in der Hessischen Landesbibliothek in Kassel befinden. Vielleicht finden sich dort Hinweise zur Vertonung.
Von privater Seite erhielt ich via E-Mail noch folgende Informationen zur Familie Berlyn:
“ …. Nach meinen Unterlagen lebte Christian Berlyn in den Jahren 1787 bis 1857 (Namentliche Nachweisung der in Freudenberg ansässigen Medizinal-Personen 1843 – 1894). Interessant ist, dass sich von ihm z.B. in der „Zeitschrift für psychische Aerzte“, Erster Band, Leipzig 1818 ein Aufsatz „Einer langwierige psychische Erkrankung, durch psychische Mittel schnell geheilt“ findet. (S. 363)
Bekannt geworden ist mir ein Brief des Arztes Johann Claudius Renard (Professor in Mainz und hessischer Leibarzt 1778-1827) vom 19. XI. 1817 an den Arzt Franz Gerhard Wegeler in Koblenz, in dem er „Ew. H. Wohlgebohren ‚den jungen Arzt und Geburtshelfer Christian Berlin aus Uerdingen am Rhein zur Wiedereinstellung durch die K. Preuß. Regierung‘ empfiehlt.
In FiZ 1/1991 erwähnt ihn G. Thiemann (Aus den Aufzeichnungen der Kirchengemeinde Oberholzklau) im Zusammenhang mit einem Bericht, den Pfarrer Dißmann dem Presbyterium am 3. Februar 1839 schilderte: „…In Freudenberg gab es den ‚Bürgermeisterey-Armen-Arzt‘ Dr. Berliyn“.
Die Familie Berlyn – zumindest zuletzt sein Sohn – bewohnte ein markantes Bürgerhaus neben der katholischen Kirche an der Bahnhofstraße, in dem später das Hotel „Kölner Hof“ eingerichtet wurde. ….“
– Martin Klein, Hauptgeschäftsführer des Landkreistags Nordrhein-Westfalen: Eine Heimstatt für die Kreise: Die Standorte der Geschäftsstelle des Landkreistags in Düsseldorf, Heft 12/22, S. 597-601
Wann hat die Ratssitzung denn nun stattgefunden? Jahreschronik der Westfälischen Rundschau, v. 30.12.2022
„gegen“ Jahreschronik der Siegener Zeitung v. 30.12.2022
Hallo Siwarchiv.de
Das letzte Mal war ich vor 10 Jahren mit Ludwig Kirchhoff beschäftigt und auf dieser Seite. Durch Zufall sehe ich, daß sich damals ein paar Leute ebenso dafür interessierten und Fragen hatten. Ich habe das nicht gesehen. Kann man daran anknüpfen, nach so langer Zeit?
Vielen Dank für Ihr Interesse und gutes Neues Jahr.
Mit freundlichem Gruß Ihr Heinz Werner.
Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes:
B 82 (Rechtsabteilung, Staats- und Verwaltungsrecht)-REF. 502/V3/758 Staats- und verwaltungsrechtliche Einzelfälle
(1961) 1968 – 1971
enthält u. a.: – Schach-Olympiade in Siegen, v.a. Teilnahme Rhodesiens
B 94 (Wissenschaft, Hochschulen, Jugendfragen, Sport, Medizinalangelegenheiten: Förderung des Sports)-REF. 604/IV5/580
Internationale Sportveranstaltungen in Deutschland
1970 – 1971
Enthält u.a. : – Klärung der Teilnahme südafrikanischer Spieler an der Schach-Olympiade in Siegen, 1970
Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes:
RZ 501/60613
Geheime Verschlußsachen des Referats Kult Gen C / Kult K
Dez. 1938 – Aug. 1941, enthält u.a. – Absage eines Gastspiels von Wilhelm Furtwängler in Stockholm – „deutschfeindliche“ Betätigung des Generalmusikdirektors Fritz Busch
RAV 250-1[Gesandschaft Stockholm]/1293
[Künstlerische Propaganda -] Konzerte, Theatergastspiele usw., Band 13
Okt. 1938 – Mai 1939, enthält u.a.: – Haltung Fritz Buschs zur Verpflichtung dt. Künstler
Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes:
– P 11 (Personalfragebögen aus dem Jahr 1944) /1, Achenbach, Ernst, Dr. (9.4.1909 – 2.12.1991)
– P 1 (Personalakten Altes Amt) /11, 12, Achenbach, Ernst, Dr. (9.4.1909 – 2.12.1991)
– RZ 502/60825, Dienstbetrieb der Abteilung VI des Auswärtigen Amts: Verschiedenes, Juli 1938 – Aug. 1943, enthält u.a.: – Leitung des Referats Kult Pol U durch Gesandtschaftsrat Dr. Ernst Achenbach, Mai 1943;
– kommissarische Leitung des Referats Kult Spr durch Gesandtschaftsrat Dr. Ernst Achenbach, Juli 1943
– RZ 502/60845, Dienstbetrieb der Abteilung VI: Personalien, Aug. 1942 – Juli 1943, enthält u.a.: Gesandtschaftsrat Ernst Achenbach
– RAV 204-1(Botschaft Paris)/1713, Achenbach, Dr. Ernst; Gesandtschaftsrat, 1936-1944
– B 2-B STS (Büro Staatsekretäre)/84, Wiedervereinigung, (1954-1957) 1959 – 1962, enthält u.a.: – Vorschlag von MdB Achenbach zur Deutschland- und Berlin-Frage; 1962
– B 8-ZA (Protokollabteilung [Orden])/107068, Achenbach, Dr. Ernst, 1965 – 1975
– B 10-ABT. 2 ((politisches Abteilung)/2168, Kriegsverbrecherprozesse in Belgien u.a. gegen von Falkenhausen – Exposé des faits e cause Reeder déposé par la défense allemande du président Reeder von Prof. Dr. Fr. Grimm und Dr. E. Achenbach (Druckschrift), 1951
– B 20-REF. 200 (Europäische Wirtschaftsgemeinschaft)/IA2/1645, Kommission der EG; hier: Mitglieder; SB: Kandidatur Achenbach, 1965 – 1970
– B 118-REF. 117 (Politisches Archiv)/329, Benutzung durch amtseigene Stellen Enth. u.a.: Akten für die deutsch-niederländischen Ausgleichsverhandlungen -Veröffentlichung über MdB Ernst Achenbach, 1957-1961
– B 118-REF. 117 (Politisches Archiv)/141 Übernahme von Nachlässen und Aufzeichnungen Amtsangehöriger, A – Be, 1954-1965, Enthält u.a. : – Achenbach, Ernst
– B 150-AAPD/206, Dokumente für die Edition Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland
1.7.1970 – 11.7.1970, enthält u. a: 06.07. Vermerk des Staatssekretärs Frank für Bundesminister Scheel [ohne Az], offen
(handschriftl. Vermerk über Gespräch mit MdB Achenbach)2 Seiten, VS-Bd. 1066 (Ministerbüro)
– B 150-AAPD/216, Dokumente für die Edition Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland
1.11.1970 – 10.11.1970, enthält u.a.: 09.11. Vortragender Legationsrat I. Klasse Hofmann an die Handels- MB 3347/70 vs-v
vertretung in Warschau, DE Nr. 357; AA ab: 18.11 Uhr, Betr.: Mögl. nochmalige Reise von MdB Achenbach nach Warschau
– NL 274/(Nachlass Rudolf Schleier), 7, Materialsammlung (Korrespondenz, Abschriften, Zeitungsausschnitte, Notizen, Aufzeichnungen)
ohne Datum, enthält u.a.: Schreiben R. Schleier an Dr. Achenbach. 30.03.1949 Verhandlungstermin vom 10.05.49; Schreiben R. Schleier an Dr. Achenbach. 13.06.1949
– NL 274/9, Materialsammlung (Korrespondenz, Abschriften, Zeitungsausschnitte, Notizen, Aufzeichnungen)
ohne Datum, enthält u.a.: Erklärung betr. Dr. Achenbach 28.02.41
NL 274/16, Materialsammlung (Korrespondenz, Abschriften, Zeitungsausschnitte, Notizen, Aufzeichnungen)
ohne Datum, enthält u.a.: 1 Br. R. Schleier an Dr. Achenbach. 20.12.1958
-NL 274/33, Materialsammlung (Korrespondenz, Abschriften, Zeitungsausschnitte, Notizen, Aufzeichnungen), ohne Datum, Enthält u.a. : Verhör Schleiers zur Person Dr. Achenbach Zeittafel Frankreich (1949)
NL 274/34, Materialsammlung (Korrespondenz, Abschriften, Zeitungsausschnitte, Notizen, Aufzeichnungen), ohne Datum, Enthält u.a. : Schreiben Dr. Ernst Achenbachs an Schleier. 26.11.1957
– NL 274/35, Materialsammlung (Korrespondenz, Abschriften, Zeitungsausschnitte, Notizen, Aufzeichnungen), ohne Datum, Enthält u.a. : Korrespondenz Schleiers zugunsten von Abetz mit Dr. Ernst Achenbach 02.01.1952
– NL 274/43, Materialsammlung (Korrespondenz, Abschriften, Zeitungsausschnitte, Notizen, Aufzeichnungen), ohne Datum, Enthält u.a: Jaffré, Avocat à la cour, an E. Achenbach. 06.04.51, Dr. Achenbach an Schleier. 22.05.51, Schleier an Dr. Achenbach. 06.07.49-19.10.51, Schleier an Achenbach. 14.01.52
– NL 274/63, Materialsammlung (Korrespondenz, Abschriften, Zeitungsausschnitte, Notizen, Aufzeichnungen), ohne Datum, Enthält u.a. : Der Auftrag Paris (1940) Stellvertreter von Abetz, Zusammensetzung der nach Paris entsandten Delegation: Professor Dr. Friedr. Grimm, Dr. Friedr. Sieburg, Dr. Carl Epting (bis Kriegsbeginn Leiter d. Dienststelle des Deutsch. Akademischen Austauschdienstes Paris), Dr. Ernst Achenbach, Deutsch-französische Gesellschaft: Prof. Achim von Anim, Abetz, Prof. Dr. Grimm, Reichskriegsopferführer Hanns Oberlindober u. Schleier.
– NL 259 (Nachlass Heinz Günther Sasse, Geschichte des Auswärtigen Amtes)/166, Ernst Achenbach, Fritz Gebhard von Hahn, Karl Klingenfuß, Hans Limpert, Herbert Müller-Roschach, Henning Schlottmann, Franz von Sonnleithner, Eberhard von Thadden, ohne Datum
Enthält :
Abschriften, Notizen, Kopien, Aufzeichnungen, Zeitungsartikel
Ein interessanter Sammelbestand im Bundesarchiv für die Erarbeitung einer Biographie dürfte „AllProz 3“ (=Alliierte Prozesse. Handakten von Rechtsanwälten) sein. Unter der dem Gliederungspunkt 18 finden sich 85 Akten des Anwalts Walter Siemers zur Verteidigung von Bernhard Weiss.
„Schmick, Heinrich
Geboren den 27. August 1824 zu Unglinghausen bei Siegen, kommissarischer Lehrer an der Realschule zu
Siegen vom 1. Mai 1848 bis 1. Juni 1850, dann Rektor der höheren Stadtschule zu Kirchen vom 1. Juli 1850 bis 14. November 1851, darauf vom Sommer 1852 bis 1857 mit Unterricht und Studien in England und Frankreich beschäftigt. Von April 1857 bis Herbst 1857 Lehrer an der höheren Bürgerschule zu Bremen, von Herbst 1857 bis 1859 Lehrer an der Realschule zu Görlitz, von Herbst 1859 bis 1. Juni ej. wiederum Lehrer an der höheren Bürgerschule zu Bremen und von da ab zuerst 5. und gegenwärtig 3. Oberlehrer an der Realschule (Realgymnasium) zu Köln am Rhein. Unter dem 12. Februar 1874 wurde ihm der Professoren-Titel verliehen. Von ihm sind im Druck erschienen:
1) Mitteilungen aus dem englischen Schulleben. Köln 1868. 28 S. (Programm Köln Realgymnasium.)
2) Die Umsetzungen der Meere und die Eiszeiten, ihre Ursachen und Perioden. Köln, DuMont-Schauberg,
1869.
3) Thatsachen und Beobachtungen zur weiteren Begründung der neuen Theorie einer Umsetzung der Meere
etc. Görlitz, Remer 1871.
4) Die neue Theorie periodischer säcularer Schwankungen des Seespiegels etc. bestätigt durch geognostische und geologische Befunde. 2. Ausgabe. Leipzig, A. Georgi 1872.
5) Das Fluthphänomen und sein Zusammenhang mit den säcularen Schwankungen des Seespiegels. Leipzig, K.
Scholtze 1874.
6) Die Aralo-Kaspi-Niederung und ihre Befunde. Leipzig K. Scholtze 1874.
7) Die Gezeiten, ihre Folge- und Gefolge-Escheinungen. Leipzig, K. Scholtze 1876.
8) Der Mond als glänzender Beleg etc. Leipzig, K. Scholtze 1876.
9) Sonne und Mond als Bildner der Erdschale. Leipzig, A. Georgi 1878.
10) Ein Wissen für seinen Glauben. Köln, Lengfeld’sche Buchhandl. 1878.
11) Sonne und Mond als Motoren und Anordner der beweglichen Bestandteile der Erde, für die Schüler der
Oberklassen dargestellt. Köln 1879. 29 S. (Programm Köln Realgymnasium.)
Aus: Programm Köln Realgymnasium 1878“
aus: Kössler, Franz: Personenlexikon von Lehrern des 19. Jahrhunderts.
Berufsbiographien aus Schul-Jahresberichten und Schulprogrammen 1825 – 1918 mit Veröffentlichungsverzeichnissen, Band: Schaab – Scotti, Vorabdruck (Preprint), Stand: 18.12.2007, S. 166
Die Zeichnung entstand um 1850 und stammt von dem in Unglinghausen geborenen Prof. Jakob Heinrich Schmick. In seinem bekannten Gedichtband auf Seejerlänner Platt „Riimcher uss d’m Seelerland“ ist auch das Gedicht „D’r Seejerlänner Mäckes“ enthalten. Da der Gedichtband in zahlreichen Auflagen immer wieder veröffentlicht wurde, ist es möglich, dass diese Zeichnung zur Illustration diente. Ich besitze zwar eine Ausgabe (Nachdruck der Ausgabe von 1882 im Verlag die Wielandschmiede von H. Zimmermann) die auch Illustrationen enthält (Siegerländer Hirte, Bergmann, Hammerschmied), aber das obige Bild der Familie der sog. „Mäckeser“ ist in dieser Ausgabe nicht enthalten. Vielleicht hat Herr Ulrich Opfermann da genauere Kenntnisse.
Auf Seite 98 im Siegerländer Heimatkalender 1934 sind sowohl diese Zeichnung als auch das mundartliche Gedicht „D’r Seejerlänner Mäckes“ abgedruckt. Danach (Fußnote) wurde die Federzeichnung „Die Mäckesfamilie“ dem Skizzenbuch von Jacob Heinrich Schmick entnommen.
Der Hinweis auf das Skizzenbuch Schmicks findet sich auch hier: Ebbinghaus, Gundula/Ebbinghaus, Rolf: Jacob Heinrich Schmick: Der bekannteste Unlinghausener, in: Bürgerverein Unglinghausen e.V.: 675 Jahre Unglinghausen 1344 – 2019. Aus alter und neuer Zeit. Unglinghausen in Wort und Bild, o. O 2019, S. 651 – 662
Ulrich Friedrich Opfermann hat die Zeichnung auf Seite 162 seines Buchs „Daß sie den Zigeuner-Habit ablegen“ – Die Geschichte der „Zigeuner-Kolonien“ zwischen Wittgenstein und Westerwald, abgebildet. Das Buch erschien 1996 bei Peter Lang, Frankfurt als Band 17 – Studien zur Tsiganologie und Folkloristik, herausgegeben von Joachim S. Hohmann. Im Bild die Schrift: „Irdengeschirrhändler – Federzeichnung, Siegerland, Mitte 19. Jahrhundert“
Die Zeichnung findet sich bereits in:
– Ulrich Opfermann: HeimatFremde. „Ausländereinsatz“ im Siegerland, 1939 bis 1945: wie er ablief und was ihm vorausging. Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung Bd. III, Hrsg.: Förderverein „Geschichte der Arbeiterbewegung und der Gewerkschaften für den Kreis Siegen-Wittgenstein“ e.V., Verlag, Siegen 1991, S. 15 mit dem Verweis auf den Siegerländer Heimatkalender und der Bildunterschrift: „Siegerländer jenische Famile mit Hund, Esel und Kiepen“ und in:
– Opfermann, Ulrich F., Sinti und Jenische – Ein Beitrag zur regionalen Minderheitengeschichte, Siegener Beiträge 20, 2015, 166-179 [S. 168]
@ Allen, die hier und auf Facebook zur Lösung beigetragen haben: Vielen Dank!
Ich habe die Suchanfrage auch genutzt die biographischen Veröffentlichungen zu Schmick zusammen zu stellen. Sie folgen hier noch.
Aber wie immer: ist die eine Frage gelöst, stellt sich die nächste, wo liegt dieses Skizzenbuch Schmicks?
Aufstellung der regionalen biographischen Literatur zu Jacob Heinrich Schmick:
– Bensberg, Heinz: “Vamm Brandewing stiff, dt Kend vrgesse“. Erinnerungen an den Unlinghäuser Lehrersohn Jacob Heinrich Schmick, in: Siegerländer Heimatkalender, 2003, 79, S. 130
– Ebbinghaus, Gundula/Ebbinghaus, Rolf: Jacob Heinrich Schmick: Der bekannteste Unlinghausener, in: Bürgerverein Unglinghausen e.V.: 675 Jahre Unglinghausen 1344-2019. Aus alter und neuer Zeit. Unglinghausen in Wort und Bild, o. O 2019, S. 651 – 662
– Faust Wilhelm: Jakob Heinrich Schmick, in: Siegerland 25 (1943), S. 13 – 21
– Faust Wilhelm: Jakob Heinrich Schmick, ein Deuter Siegerländer Volkstums, in: Siegener Zeitung v. 15.12.1943
– Henrich, Jakob, Jakob Henrich Schmick als Denker, in: Siegerländer Heimatkalender 30 (1955), S. 156 – 157
– Irle, Lothar: Siegerländer Persönlichkeiten- und Geschlechter-Lexikon, Siegen 1974, S. 293
– Kruse, Hans: Dem Siegerländer Dichter Jakob Heinrich Schmick zum Gedächtnis, in: Sauerländ. Gebirgsbote 40, 1932, S. 122 [mit Abb.]
– Menn, Walter: Hermann Romberg und Jakob Heinrich Schmick, in: Siegerland 19 (1937), S. 7 – 10
– NN: Das Geburtshaus des ersten Dichters der Siegerländer Mundart, Prof. Dr. Jacob Heinrich Schmick, geb. am 27. August 1824 in Unglinghausen, in: Heimatland, Siegen, 1, 1926, S. 161 [anonym; mit Abb.] –
– NN: Weihe einer Gedenktafel am Hause von Jacob Heinrich Schmick in Unglinghausen, in: Siegerland 14, 1931, S. 22f. [anonym; mit Abb.]
– NN: Ehrung des ersten Dichters der Siegerländer Mundart, Prof. Dr. Jakob Heinrich Schmick, in: Siegener Ztg. vom 30.5.1932 [anonym] –
– NN: Dem Gedächtnis eines großen Heimatdichters. Zum 50. Todestag von Prof. Dr. Jakob Heinrich Schmick, in: Siegener Zeitung v. 18.3.1955
– Plitsch, Heinrich: Dem ersten Dichter der Siegerländer Mundart Professor Dr. Jakob Heinrich Schmick zur 100. Wiederkehr seines Geburtstages, in: Siegener Zeitung v. 4.9.1924 (Unterhaltungsbeilage)
– Stähler, Otto: Drei Siegerländer Dichter (J. H. Schmick, H. Romberg, G. Hartmann), in:Mollat, Georg: Siegerländer Heimatbuch, Siegen 1914 , S. 126 – 127
– Vitt, Hans Rudi: Freundschaft in der Fremde. Jakob Heinrich Schmick und Ferdinand Freiligrath in England, in: Siegerländer Heimatkalender 32 (1957), S. 60-61
– Vitt, Hans Rudi: Johann Heinrich Schmick (1800 – 1859) Dorfschullehrer in Unglinghausen .Zum 100. Todestag seines Sohnes Prof. Dr. Jacob Heinrich Schmick, gestorben am 19. März 1905 in Köln, in: Siegerland 82 (2005), S. 43 – 48
– Vitt, Peter: Prof.Dr. Jacob Heinrich Schmick aus Unglnghausen, Blick in das Netpherland 61 (2019), S. 23 – 36
– Weyer, Wilhem: „Die Riimcher uss d’m Seejerland“ von Jakob Heinrich Schmick, in: Siegen und das Siegerland 1924, S. 64-69
Ist das ursprünglich wirklich eine Siegerländer bzw. Westerwälder Milieustudie gewesen? Es wäre in der Tat hilfreich, wenn das Skizzenbuch gefunden werden könnte – nicht zuletzt um die Frage zu klären, in welchem Kontext die Zeichnung dort steht. Sollte sie zwischen Mitte 1852 und Ende 1856 entstanden sein, wäre es unwahrscheinlich, dass sie eine deutsche „Mäckes“-Familie zeigt. Motive wie das dargestellte hätte Schmick aber in Irland, wo er sich ab dem Frühjahr 1853 eine zeitlang in einer der ärmsten Gegenden der Insel aufhielt, leicht finden können. (Zu Schmicks irischer Episode wäre einiges zu sagen – vielleicht später einmal.)
Eine nicht uninteressante Bagatelle: Auch Karl Marx hatte (einige Jahre vor Schmick) als Externer in Jena promoviert. Könnte das Schmicks spätere Entscheidung für Jena beeinflusst haben? Die beiden Herren waren in London im Freundeskreis Ferdinand Freiligraths miteinander bekannt geworden.
Apropos Freiligrath: Ein paar Briefe desselben an Schmick befanden sich seinerzeit im Privatbesitz des Sohnes Otto und wurden 1924 von Hans Kruse veröffentlicht. Was zu der Frage nach dem Schicksal des sicherlich umfangreichen Nachlasses J. H. Schmicks führt.
Die oben eingestellte Bibliographie ist sehr fragmentarisch. Das lässt sich ändern (wenn auch nicht von heute auf morgen).
Ich denke, dass bis zum 27. August 2024 – 200. Geburttag Schmicks – genügend Zeit ist, sowohl zu ermitteln, welches Schicksal das Skizzenbuch ereilt hat .(Siegerländer Heimat- und Geschichtsverein, wäre eine Möglichkeit, Siegerlandmuseum vielleicht eine weitere ….), als auch die bisher zusammengestellten Quellen, Literatur etc. zu ergänzen.
Als einzige bibliothekarische Fachkraft in einer Museumsbibliothek mit kw Vermerk kann ich nur bestätigen, was ich im offenen Brief las. Die Bibliothek wurde Jahrzehnte von einer äußerst engagierten Ehrenamtlichen betreut, aber eine wissenschaftliche und fachlich korrekte Bearbeituzng des wertvollen Altbestandes war ihr nicht möglich. Ich habe 5 Jahre zum „Aufräumen“ und Erstellen eines korrekten Kataloges nach RID mit Verschlagwortung gebraucht, eine Systematik zu erstellen, hygienisch korrekte Maßnahmen einzuführen, Standards festzulegen usw, damit wir die Bibliothek jetzt der Öffentlichkeit zugänglich machen können. Wir sind sogar Mitglied im Arbeitskreis historischer Bücher des Landes NRW u.Rheinland-Pfalz geworden. Ich habe 20m schwerbeschädigter Bücher da stehen und 20m Bücher mit leichten Schäden schon fachgerecht repariert und habe kilometerweise Paketband von den Büchern entfernt, die die Bücher teilweise auch schädigten. Liebe Stadt Olpe, tun sie das ihrem Archiv bitte nicht an. Der Schaden kann kaum aufgefangen werden. Ich mache mir jetzt schon Sorgen, was in 10 Jahren passiert, wenn ich in Rente gehe. Und natürlich: Ehrenamt ist in der Kultur immens wichtig als helfende Hand, aber den Damen und Herren wissenschaftliche Arbeit aufzubürden wäre nicht fair, da sie das zu Ihrer und zur eigenen Zufriedenheit nur mit Ausbildung schaffen.
Mit freundlichen Grüßen
– In der Siegener Zeitung erschien heute im Print der Artikel „Axel Stracke: Pläne der Stadt Ausdruck mangelnder Wertschätzung für Stadtarchivar“ – online hinter der Bezahlschranke.
– Ein erster Leserbrief findet sich heute in der Westfalenpost mit folgendem Tenor: “ …. Jedoch ist es, und Belege gibt es viele, nicht unüblich, dass ein Museumsleiter auch die Funktion des Stadtarchivars in Personalunion wahrnimmt. Warum soll diesin unserer Kreisstadt, wenn es denn so umgesetzt wird, nicht funktionieren. Klar ist schlussendlich auch die Einsparung von Personalkosten.“
–
Stellungnahmen der Unterzeichnenden des Offenen Briefes:
Die folgenden Zitate aus den zustimmenden E-Mails dürfen mit
Namens- und Datumsnennung verwendet werden
7.1.23
Wenn das Stadtarchiv Olpe nicht fachkundig geleitet wird, nimmt das historisch-kulturelle Erbe Schaden, und das Geschichtsbewusstsein der Lebensgemeinschaft Stadt verdämmert im Nebel der historischen Ignoranz. Klaus Droste, Olpe (ehemaliger Leiter der VHS Olpe)
3.1.23
Ich habe in den letzten fast zwanzig Jahren, zunächst als Leiter der Akademie Biggesee und dann als Leiter der VHS des Kreises Olpe die Arbeit von Herrn Wermert als hauptberuflichem Stadtarchivar in hohem Maße schätzen gelernt. Höchst professionell und mit deutlich mehr als der notwendigen Akkuratesse hat Herr Wermert einen exzellenten Archivbestand aufgebaut und für die Stadt und ihre BürgerInnen gesichert. Mit Sachverstand, Esprit und stets bereitem Engagement hat er die Heimatarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen jederzeit unterstützt. Seine Planstelle einem wie immer motivierten Sparwillen zu opfern, ist ein Schlag ins Gesicht aller, die mit Engagement in und für die Heimat in Stadt, Land und Region unterwegs sind. Jochen Voß, Olpe (ehemaliger Leiter der VHS Olpe)
16.1.23
… … bin ich davon überzeugt, dass politische Bildung ihre Aufgaben immer auch aus der Geschichte ableiten muss und gesellschaftliche Wirklichkeit sich nur auf geschichtlichem Hintergrund erklärt und verstanden werden kann. Insofern sind Orte wie Museen, Gedenkstätten und natürlich auch Archive wie etwa das Stadtarchiv Olpe Orte der politischen Bildung, teils als Lernorte, die besucht werden können und müssen, teils als Lernorte, die historisches Wissen konservieren und zur Verfügung stellen.
Deshalb ist es mehr als unverständlich, dass einer solchen Institution wie dem Stadtarchiv Olpe seine Professionalität und damit die Basis zur Erfüllung seiner wichtigen Aufgabe … aus monetären Gründen entzogen werden soll. Nichts anderes ist die Streichung der hauptamtlichen Stelle des Stadtarchivars /der Stadtarchivarin. Udo Dittmann, Geschäftsführer und Leiter der „AKADEMIE BIGGESEE“, Attendorn-Neulisternohl
8.1.23
… ich schätze die Arbeit von Herrn Wermert sehr; eine Stadt wie Olpe braucht ein funktionierendes Stadtarchiv – es ist Zentrum lokaler Geschichtskultur.
Ich hoffe, der kw-Vermerk wird zurückgezogen. Prof. Dr. Werner Freitag, Gütersloh
16.1.23
… das ist ja eine ungeheuerliche Nachricht! Ich bin fassungslos, wie Kommunal-politiker eine solche Entscheidung der Verwaltung mittragen. Ein Archiv mit dieser überregionalen Bedeutung und historischen Beständen, die seines-gleichen suchen, nicht mehr personell mit einer archivischen Fachkraft zu besetzen, bedeutet, dass die Arbeit von Herrn Wermert mit Füßen getreten wird. Jürgen Kalitzki, Lennestadt (Stadtarchivar a.D.)
17.1.23
Die Dienste des Stadtarchivs Olpe haben wir in der Vergangenheit immer wieder in Anspruch nehmen dürfen und wir würden uns freuen, wenn dies auch in Zukunft so bliebe.
Die Streichung der Stadtarchivarsstelle käme einer Schließung des Stadtarchivs gleich und würde eine empfindliche Lücke für die historisch-wissenschaftliche Befassung mit der Region Südliches Sauerland bedeuten. Ein großer Verlust für uns in jedem Fall, denn der Kreis Olpe ist für uns ein wichtiger Ansprechpartner in der Region für Forschungen zur Darstellung von Baukultur und Alltagskultur im LWL-Freilichtmuseum Detmold. Wir sind auf einen professionellen Ansprechpartner gerade im Archiv angewiesen. Dr. Hubertus Michels, Detmold
3.1.23
… vielen Dank für Ihre Mail zu diesen mehr als unerfreulichen Plänen der Stadtverwaltung in Olpe!
Die Vorgänge in Olpe sind für mich unfassbar, zumal es sich bei dem Stadtarchiv Olpe um ein Kommunalarchiv handelt, das seit Jahrzehnten vorbildlich geleitet wird und eine hervorragende Arbeit leistet!
Gibt es denn politisch eine Mehrheit für den kw-Vermerk? Ich kann gar nicht fassen, dass eine Mehrheit im Rat für die Streichung der Stelle ist. Rico Quaschny, Iserlohn (Stadtarchivar)
7.1.23
Mit besten Grüßen aus der rheinischen Metropole und Millionenstadt Köln, wo zu meiner Freude niemand solche Kahlschläge im Sinn hat, weder im Historischen Archiv der Stadt Köln noch in den städtischen Museen und Bibliotheken, auch nicht in der Erzbischöflichen Diözesan- und Dombibliothek oder im Historischen Archiv der Erzdiözese Köln …, auch nicht in der Universität zu Köln, in ihrer Universitäts- und Stadtbibliothek und im Universitätsarchiv. Prof. Dr. Dr. Harm Klueting, Köln
2.1.23
Auch erscheint mir beim Lesen Ihres offenen Briefes (folgendes bedeutsam): den Entscheidern innerhalb der Verwaltung scheint der signifikante Unter-schied zwischen Archiv und Museum nicht klar zu sein. Das Museum kann anhand von Exponaten Teile der Geschichte „abbilden“ und „erzählen“. Der Inhalt, also die Geschichte als solches, insbesondere ab der frühen Neuzeit, liegt zu großen Teilen in den kommunalen Archiven. Was hilft es, einen Judenstern oder eine Uniform auszustellen, wenn wir nicht wissen, was es ist, wer es warum trug und was mit den Menschen hinter diesen Gegenständen geschah? Das Archiv erzählt uns die Geschichte zu den Exponaten. Hier bietet das Museum die Hardware und das Archiv die Software – das eine funktioniert meist nicht ohne das andere.
Veronika Hof-Freudenberg, Hilchenbach (Stadtarchivarin)
11.1.23
In den vergangenen Jahrzehnten, nicht zuletzt in den vergangenen Jahren, habe ich als Benutzer von Akten aus der Frühen Neuzeit mit sehr vielen Archiven (aller Art) zu tun gehabt. Die Verhältnisse sind sehr verschieden, gerade auch in den Stadtarchiven. So gibt es bestens funktionierende, gut ausgestattete Stadtarchive wie in Schwäbisch Hall. Hier gibt es einen kompetenten, rührigen wissenschaftlichen Archivar 100%, der die gesamte Ortsgeschichte und deren Verbreitung im Blick hat und entsprechend aktiv ist, und drei weitere Mitarbeiter je 100%, davon eine Diplomarchivarin. Es gibt aber auch missliche Zustände, so etwa in einer anderen ehemaligen Reichs¬stadt im Südwesten Deutschlands, wo eine städtische Verwaltungsangestellte, die keine näheren Kenntnisse hat, an einem Tag pro Woche ins Archiv abkommandiert wird und das Archiv für Benutzer vier Stunden geöffnet ist.
In Olpe sollte es natürlich wieder einen Archivar mit einer 100%-Anstellung geben. Am besten wäre wie bisher ein wissenschaftlicher Archivar. …
… Die bestehende weitere Mitarbeiterstelle im Stadtarchiv sollte von 33% auf wenigstens 50% aufgestockt werden. Prof. Dr. Thomas Gerhard Wilhelmi, Heidelberg
12.1.23
Das ist ja tatsächlich ein starkes Stück, dass das Stadtarchiv Olpe auf diese Art und Weise abgewickelt bzw. marginalisiert werden soll. Selbstverständlich unterzeichne ich den „Offenen Brief“ und hoffe, dass diese Initiative von Erfolg begleitet sein wird! Wilhelm Grabe, Paderborn (Kreis- und Stadtarchivar)
12.1.23
… … auch wir möchten uns zustimmend zu Ihrem offenen Brief äußern.
Es ist kaum zu verstehen, dass eine so wichtige Stelle ersatzlos gestrichen wird und damit vielen Interessierten der Zugang zur Geschichte der Stadt Olpe erschwert, wenn nicht gar unmöglich gemacht wird.
Es gibt nicht mehr viele Personen, die imstande sind, das verschriftlichte Material der vergangenen Jahrhunderte in heutige Schrift zu übertragen.
Bereits das Frakturlesen bereitet heutigen Studierenden große Schwierigkeiten. Wenn solche Institutionen wie städtische Archive mehr und mehr wegfallen, bedeutet dies für unsere Kultur einen nicht wiedergutzumachenden Schaden.
Deshalb sollte die Stelle eines Stadtarchivars in Olpe auch weiterhin hauptamtlich besetzt werden. Dr. Corinna Nauck, Museum Wilnsdorf
Dr. Andreas Bingener, Siegen, Historiker und Paläograph
13.1.23
… als Historikerin … und gleichzeitig als Assessorin des Archivdienstes bin ich immer wieder mehr als erstaunt, wie Kommunen meinen, Pflichtaufgaben einfach mal so wegsparen zu können – ohne Rücksicht auf unwiederbringliche Verluste – und die geleistete Arbeit von KollegInnen mit Füßen treten. Dr. Katrin Minner, Siegen
16.1.23
Ihre Ausführungen und den offenen Brief habe ich mit Bestürzung zur Kenntnis genommen. Die – hoffentlich nicht endgültige – Entscheidung, die Stelle der Olper Stadtarchivleitung zu streichen, ist nicht nur falsch, sondern sendet in auch für die Archivwelt schwierigen Zeiten ein verheerendes Signal nach außen. Dr. Knut Langewand, Warendorf (Kreisarchivar)
Aus einem Interview mit Prof. Sternberg,
abgedruckt in der Zeitschrift „Der Archivar“ 2015, S. 145ff.
Prof. Sternberg hat uns autorisiert, Zitate aus dem geführten Interview für unsere Initiative „Offener Brief“ zu verwenden:
Zunächst mal glaube ich, ist es ein Problem, dass alle Einrichtungen, die mit Sammeln, Bewahren und Schützen zu tun haben, einen schweren Stand dadurch haben, dass sie nicht mit großen Zahlen punkten können. Und eine Kulturpolitik, die mehr und mehr auf Event setzt und auf das große Ereignis, werden solche Tätigkeiten weniger bewertet.
… … …
Darin liegt ein Problem für die Archive, denn sie haben die Aufgabe, über lange Zeiträume hin nicht tagesaktuell zu bewahren und zu sammeln.
Das entbindet die Archive auf der anderen Seite nicht von einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit. Auch sie müssen in die Öffentlichkeit gehen, müssen deutlich machen, was sie tun, wofür sie da sind. Sie müssen die Wichtigkeit und den Reiz von Archiven vermitteln und verbreiten.
… … …
Für die Politik halte ich es für zentral, dass Archive als öffentliche Aufgabe ernst genommen werden, sowohl kommunal wie auf Landesebene. Eine Popularität bekamen die Archive nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs, eine traurige Öffentlichkeit, aber sie hat bewirkt, dass man die Archive auf einmal in den Blick nahm. Ansonsten bin ich der Meinung, dass es politisch wichtig ist, dass die Archive ruhig arbeiten können, dass sie eine auskömmliche Ausstattung bekommen, die natürlich immer wieder auszuhandeln ist.
… … …
… natürlich ist für ein Archiv nichts wichtiger als Kontinuität – das weiß jeder, der mal irgendwann ein abgebrochenes Abonnement einer Zeitschrift hat. Kontinuität der Rechtsprechung ist nur möglich durch immer wieder erneuerten Rückgriff – und Verständnis der Vergangenheit nur durch die Möglichkeit der Konfrontation mit den Quellen.
… … …
Die identitätsstiftende Rolle von Archiven – dazu gehört auch die nur scheinbar banale Arbeit von lokalen Hobbyhistorikern, ist gewichtig. (Der Philosoph) Hermann Lübbe spricht davon, dass es noch nie eine Zeit von so viel Geschichtsaufbereitung gegeben habe wie heute. Jede Freiwillige Feuerwehr, jeder Gesangsverein, jeder schreibt seine Geschichte. Zumeist sind das Geschichten, die nicht viel weiter als 100 Jahre zurückreichen. Heimatmuseen haben eine Konjunktur sondergleichen, man sollte das nicht unwichtig nehmen, sondern sagen, wir helfen euch dabei, dass das, was ihr da macht, über die Erinnerung an die Großmutterzeit hinausgeht und in einen größeren Kontext gestellt wird. Das ist eine wichtige Aufgabe der Archive und das machen diese auch sehr gut. Aufgabe der Politik ist es, Projekte, die in diese Richtung laufen, zu unterstützen.“
Auch die heutige Ausgabe des Sauerlandkuriers berichtet über den offenen Brief und (!) die Reaktion des Bürgermeisters und der „Grünen“:
“ … Auf Nachfrage des SauerlandKuriers hat sich Olpes Bürgermeister Peter Weber zu der Entscheidung geäußert. Zuerst betont er die „herausragende Leistung“ von Josef Wermert und es wäre nicht so, dass „seine Arbeit nicht geschätzt“ würde. Ganz im Gegenteil. Alleine die Bildbände der Olper Stadtgeschichte seien etwas ganz Besonderes für die Kreisstadt. Und ganz endgültig, ob die Stelle des Stadtarchivars gar nicht mehr besetzt wird, ist auch noch nicht klar. Der „kw-Vermerk“ steht erst einmal, wie es in der Sitzung im Dezember 2022 zur Besprechung des Haushalts 2023 besprochen wurde. Das bedeutet, dass erst einmal ohne die Stelle des Archivars für dieses Jahr geplant wird. Allerdings könnte die Stelle in der Sitzung zur Besprechung des Haushalts 2024 wieder in den Plan aufgenommen werden.
Dafür müssen jedoch noch andere Faktoren betrachtet werden. Zuerst einmal ist in der Olper Politik die Entscheidung gefallen, ein neues Museum zu planen. Der Leiter dafür ist seit Anfang Januar im Amt. Und mit diesem Museumsleiter soll sich auch der Blick ein wenig mehr auf das historisch und geschichtliche verschieben. Die Aufgaben des Museumsleiters werden anders, sind aber nicht völlig entfernt von denen des Stadtarchivars: „Josef Wermert betreut als Stadtarchivar auch die Museumssammlung der Stadt.“
„Der Aufgabenbereich wird sich ändern“, erklärt Bürgermeister Peter Weber im Gespräch. „Es werden erst einmal viele Gespräche laufen müssen. Welche Aufgaben des Stadtarchivars kann der neue Museumsleiter übernehmen und welche nicht? Welche Aufgaben aus dem Archiv brauchen wir später noch? Wir müssen erst einmal schauen, wie es sich in diesem Jahr entwickelt und auch mit dem neuen Museumsleiter reden.“ Es ist also nicht ausgeschlossen, dass jemand die Stelle von Josef Wermert weiterführen könnte, ob Vollzeit oder in Teilzeit.
Zaklina Marjanovic, Fraktionsvorsitzende der Olper Grünen zeigt sich auf Nachfrage des SauerlandKuriers betroffen. „Herrn Wermerts Tätigkeit ist unglaublich kostbar für die Stadt Olpe, für die Pflege und Dokumentation der Stadtgeschichte und somit auch für die Heimatverbundenheit. Ein Stadtarchiv ist somit auch prägend für die Identität Olpes. Allerdings ist nun ein Museumsleiter eigestellt, für ein Museum, dass es noch nicht gibt. Herr Wermert ist bis 2024 noch im Dienst, das Museum wird erst ein paar Jahre später entstehen. Ich stelle mir vor, dass ein Museumsleiter ohne Museum sicher auch viel zu planen hat, jedoch bestimmt auch die Kapazitäten hat, das Stadtarchiv, einen zukünftigen Teil des Museums, nachdem Herr Wermert seinen Ruhestand angetreten hat, mit zu betreuen.“
Die Grünen wollen die Veränderungen „eng begleiten“ und falls nötig sich auch für eine weitere Personalstelle einsetzen. Außerdem findet sie es wichtig, die Erfahrung und Meinung von Josef Wermert in diesem „besonderen Falle Gehör zu schenken“ und falls nötig die Entscheidung über die Streichung der Stelle zu überdenken.
Was antworteten die Olper Bundestags- und Landtagsabgeordneten auf folgenden Frage:
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die Stadt Olpe nicht wie geplant die Archivleitungsstelle streicht, wodurch eine wichtige fachliche Arbeit für die Stadt und die Öffentlichkeit wegfallen würde? Nezahat Baradari (SPD, Bundestag):
“ … vielen Dank für Ihre Frage und damit auch den Hinweis auf die Streichung der Archivleitungsstelle. Es wäre in der Tat sehr zum Bedauern, wenn die Archivarbeit für unsere Kreisstadt Olpe nicht fortgesetzt werden kann. Sehr gerne kann ich mich aber an den Olper Bürgermeister wenden und nach den Ursachen der geplanten Schließung erkundigen.
Ich bitte Sie jedoch, zu berücksichtigen, dass es mir nicht erlaubt ist, als Bundestagsabgeordnete mich direkt in Kreisangelegenheiten einzumischen oder gar auf schon gefallene Entscheidungen auf Kreisebene rückwirkend Einfluss zu nehmen.
Mit besten Grüßen …“, Link: https://www.abgeordnetenwatch.de/profile/nezahat-baradari/fragen-antworten/werden-sie-sich-dafuer-einsetzen-dass-die-stadt-olpe-nicht-wie-geplant-die-archivleitungsstelle-streicht? Florian Müller (CDU, Bundestag): “ …. vielen Dank für Ihre Nachricht.
Als Geschichte interessierter Mensch halte ich Museen und Archive für wichtige Einrichtungen.
Die Stellen- und Ausgabenplanung gehört im Zuge der kontinuierlichen und jährlichen Haushaltsplanung zum festen Bestandteil einer jeden Kommune und Kreises. Die entsprechende Planung obliegt in diesem Fall der Verwaltung und dem Rat der Kreisstadt Olpe.
Freundliche Grüße …“, Link: https://www.abgeordnetenwatch.de/profile/florian-mueller-0/fragen-antworten/werden-sie-sich-dafuer-einsetzen-dass-die-stadt-olpe-nicht-wie-geplant-die-archivleiterstelle-streicht? Christin-Marie Stamm (SPD, Landtag): “ …. hierzu möchte ich Ihnen gerne antworten und auch gleichzeitig unsere Meinung als SPD-Stadtratsfraktion darstellen:
Zuerst einmal möchten wir als SPD-Stadtratsfraktion der Kreisstadt Olpe festhalten, dass die Arbeit der Verfasser ein hohes Maß an Anerkennung verdient. Es ist ihnen gelungen, in sehr sachlicher und emotionsfreier Form gute und schlüssige Argumente für den Erhalt der Stelle des Archivars zu formulieren.
Für uns als SPD-Stadtratsfraktion hat die Wahrnehmung der Pflichtaufgabe „Stadtarchiv“ einen hohen Stellenwert, den wir eindeutig vor den Belangen eines freiwilligen Museums angesiedelt sehen. Das Stadtarchiv sichert – wie in dem Brief überzeugend dargestellt – die historische Identität unserer Stadt.
Der Archivar schafft auch die Basis für die in hohem Maß eingebrachte ehrenamtliche Tätigkeit zu unserer Stadtgeschichte. Ein hohes Gut, das wir nicht schmälern oder preisgeben dürfen! Daher ist die fachlich qualifizierte Betreuung des Archivs im Hauptamt unabdingbar.
Auf dem Hintergrund, dass wir als SPD-Stadtratsfraktion die Errichtung eines Museum in Olpe sehr fragwürdig sehen, haben wir uns von Anfang an dafür eingesetzt, dass ein Archivar beschäftigt wird, der im Rahmen seiner Tätigkeit allenfalls museale Ausstellungen organisiert. Der Schwerpunkt sollte klar auf der Archivarbeit liegen!
Der Argumentation der Verfasser und letztlich auch der Unterzeichner können und wollen wir uns nicht entziehen.
Die Neuauflage der politischen Diskussion über die Art der Fortsetzung des Archivs sowie die personelle Ausstattung halten wir für unabdingbar! ….“, Link: https://www.abgeordnetenwatch.de/profile/christin-marie-stamm/fragen-antworten/werden-sie-sich-dafuer-einsetzen-dass-die-stadt-olpe-nicht-wie-geplant-die-archivleiterstelle-streicht?
Danke an JH!
Toll !! Das hilft ein gutes Stück weiter beim Verständnis der unterschiedlichen Währungs- und Maßangaben im „Rechenbuch“, in dem mein 3-Ur-Großvater ab 1800 seine Ein- und Ausgaben erfasste.
Ja, zweifellos – andererseits ist das wieder ein hübsches Beispiel für die Verschwendung von Arbeitszeit und Speicherplatz. Das Buch war bereits von der Sächsischen Landesbibliothek Dresden digitalisiert worden. Und die Bayerische Staatsbibliothek tat dies gleich mit beiden ihrer Exemplare der 1. Auflage (1814). Wie viel mehr Titel könnten gescannt werden, wenn solche unnützen Doppelarbeiten vermieden würden! Haben Bibliotheken ein Problem mit ADHS?
Heute findet sich ein Eintrag im Archivblog augias.net zum Thema: https://www.augias.net/2023/01/27/9697/.
Folgender Leserbrief „Historisches Gedächtnis ausgelöscht“ von Dr. Stefan Schwenke, der sich deutlich für den Wegfall des kw-Verwermerks ausspricht, erschien heute in der Westfalenpost: “ Mit großem Erstaunen und Entsetzen habe ich mitbekommen, daß die Stadt Olpe plant, die Stelle des Stadtarchivars nach Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabers in 2024 nicht wiederzubesetzen. Dies geht zumindestens aus dem Stellenplan der Stadt hervor. Wie es aussieht, wird diese Stelle als entbehrlich angesehen, auch, um damit die Stelle eines Museumsleiters zu finanzieren, einer Einrichtung, die vor 2026 nicht zu realisieren ist. Interessant ist dabei, dass Museum und Archiv dabei wieder einmal in einem Topf geworfen werden. Aber Museum ist nicht gleich Archiv und Archiv nicht gleich Museum. Bäcker ist ja auch nicht gleich Metzger und umgekehrt. Hier zeigt sich wieder einmal die Ignoranz mancher Entscheidungsträger dem Archiv gegenüber.
Es ist vollkommen unverständlich, wie man mit einem Strich das historische Gedächtnis einer Stadt auslöscht. Und, das historische Gedächtnis ist nicht das noch zu planenende Museum, sondern das Stadtarchiv mit seinem reichen Quellenbestand, der weit ins Mittelalter zurückreicht.
Zu erwähnen sind auch die umfangreiche Bibliothek und die über 2000 Zeitungsbände, u.a. das Sauerländische Volksblatt ab 1840. Hinzu kommen noch umfangreiche Sammlungsbestände und Depositia von Privatpersonen, Vereinen und Verbänden! Ein wahrer Schaft an Material für alle Interessierten an der Stadtgeschichte Olpes, der vom bisherigen Stelleninhaber in mühevoller Arbeit zusammengetragen und bewahrt wurde. Auch dessen Leistungen werden mit einem Wisch beiseitegeschoben. Ohne diese historischen Grundlagen ist die Einrichtung eines Museums übrigens hinfällig.
Das Stadtarchiv Olpe verahrt und bewahrt darüber hinaus auch das städtische Verwaltungsschriftgut und schafft damit Rechtssicherheitfür die Verwaltung, indem die Nachprüfbarkeit von Verwaltungshandeln gesichert ist. Mit diesem Beschluss wird deshalb nicht nur gegen geltendes Archivrecht (Archivgesetz NRW) verstoßen, sondern auch gegen rechtsstaatliche Prinzipien der Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Verwaltungshandeln.
Man kann nur dringend an die Entscheidungsträger appelieren, ihren Entschluss nochmals zu überdenken und die hauptamtliche Stelle im Stadtarchiv nicht zu streichen.“
Es ist ja nicht nur #Olpe. Regelmäßig ist festzustellen, dass im politischen Raum wenig Kenntnis über Archive vorherrscht – trotz der Bemühungen der meist #OffenenArchive . Wie lässt sich dies ändern? Archivische Fortbildungen für Politiker:innen? Euere Vorschläge?
Stürme der Entrüstung sind ganz interessant; noch interessanter sind nüchterne Darlegungen der Vorgänge, die zur Empörung der Menschheit geführt haben. An solchen sachdienlichen Informationen mangelt es bisher ein wenig, sieht man von den oben eingerückten knappen Ausführungen des Olper Bürgermeisters ab. Diese lassen eigentlich nicht den Schluss zu, die Stadt Olpe habe die Absicht, ihr Stadtarchiv zu zerschlagen oder ihm durch eine fiese Personalentscheidung die Existenzgrundlage zu entziehen.
Wenn ich es richtig verstehe, kann oder möchte man sich in Olpe für das altbewährte Archiv und für das vermutlich von der Bevölkerung gewünschte neue Museum nicht zwei separate Leitungen leisten, sondern die beiden kulturellen Einrichtungen in Personalunion leiten lassen oder wenigstens einmal testen, ob sich das in den kommenden paar Jahren bewährt. Ungewöhnlich ist diese Konstellation durchaus nicht, schon gar nicht in einer so kleinen Stadt wie Olpe. Wie das funktioniert, hängt maßgeblich vom Stelleninhaber ab.
Der in Olpe als „Museumsleiter“ erkorene Mensch ist ebensowenig wissenschaftlicher Archivar wie Museumswissenschaftler. Gleichwohl darf Historikern, auch wie in diesem Fall einem auf Archäologie spezialisierten, dank ihrer akademischen Ausbildung zugemutet werden, sich kompetent in die Belange sowohl eines Museums als eines Archivs einzuarbeiten. Grundsätzlich spräche sicher nichts dagegen, in Olpe das Stadtarchiv und das Stadtmuseum zu einer Art „Zentrum für Stadtgeschichte und Erinnerungskulturen“ zusammenzufassen und (wie z.B. in der viel größeren Stadt Bonn) unter eine gemeinsame Leitung zu stellen. Schwebt den Olpern in ihrer 26.000-Seelen-Kommune so ein Zentrum vor? Dessen Dimensionen wären sicherlich nicht so gewaltig, dass der eine Leiter unter seinen Aufgaben zusammenbrechen müsste. Die momentan gebrauchte Bezeichnung „Museumsleiter“ sollte in dem Fall aber ganz schnell vergessen werden, um die Archivfraktion nicht zu brüskieren. Und bis hier beträfe das eben nur die Neuorganisation der Leitung. Unverzichtbar wäre selbstverständlich eine ausreichende Personalausstattung für die Tagesgeschäfte „unterhalb“ der Leitung. Davon war nun hier bis jetzt noch gar nicht die Rede: Wie viele der im Stellenplan pauschal aufgelisteten „Verwaltungsangestellten“ arbeiten denn eigentlich im Stadtarchiv? Wäre das Archiv, auch wenn es sich demnächst die wissenschaftliche Leitung mit dem Museum teilen müsste, im Bereich der nicht-wissenschaftlichen Aufgaben noch lebensfähig, oder müsste dann auf den Tarifebenen des ehemaligen „gehobenen“ und „mittleren“ Dienstes dringend nachgebessert werden? Es ist zu hoffen, dass im Olper Rathaus auch diese Frage im Zusammenhang mit dem „kw“-Vermerk für die Archiv-Leitung (der womöglich zu Missverständnissen über die Olper Archivpolitik Anlass gab) erörtert wurde.
Danke für den Kommentar! Der hier eingeforderten ausführlichen Begründung der Massnahme bzw. der Darstellung der zukünftigen Ausgestaltung von Archiv und Museum ist ausdrücklich zuzustimmen. Für mich ist das Fehlen ein Grund für die „Entrüstung“.
Stellungnahme des Dozenten für a. a. Archivrecht an der Archivschule Marburg, Prof. Dr. Thomas Henne – unter Verweis auf ArchivG NW § 10 Abs. 1 und Abs. 3: “ …. Es ist nicht ersichtlich, wie bei einer Stadt von der Größe von Olpe (knapp 25.000 Einwohner.innen) die „archivfachlichen Anforderungen“ gewahrt werden können, wenn über die zweite Alternative lediglich eine „Beratung“ einer Nicht-Archivar.in erfolgt.
Und wenn der Protest erfolgreich ist und eine neue, archivfachlich ausgebildete Stadtarchivar.in für Olpe gesucht wird: Der laufende 60. Fachhochschullehrgang an der Archivschule Marburg – Hochschule für Archivwissenschaft wird im März 2024 die Archivschule verlassen.“
Weitere Resonanzen:
Am 28.1. erschien ein ausführlicher Artikel in der Print-Ausgabe des Sauerlandkuriers, der auch die oben schon skizzierte Äußerung des Bürgermeisters enthält.
Die Westfalnenpost vom 28.1. enthilet eine folgende Glosse von Jörg Winkel:
„Der Pland der Stadt Olpe, künftig keinen Archivar mehr zu beschäftigen, sondern desse Aufgabenquasi nebenher vom Leiter des geplanten Museums miterledigen zu lassen, hat bei Heimatfreunden und hauptberuflichen Historikern für Aufsehen gesorgt. Der offene Brief, den der in Neuenkleusheim lebende Dr. Hans-Bodo Thieme und die frühere Vorsitzende des Kreisheimatbundes, Dr. Roswitha Kirsch-Stracke, geschrieben haben, geht in Heimatkreisenviral.
Dabei kann Thieme sich gut erinennern, wie sein erster Kontaktzum Stadtarchiv war: Im alten Rathaus, dort wo heute Eis gegessen und Ein-Euro-Artikel gekauft werden können, ging eine Mitarbeiterin mit ihm um das Rathaus herum, öffnete eine Kellertür und ließ ihn in einem feuchten Raum, in dem von Mäusen angefressenen Akten lagerten.
Die Unterlagen, die ihn interessierten, können er ruhig mitnehmen, hieß es damals, er solle sie aber doch bitte irgendwann zurückbringen. Kein Vergleich zu dem, was heute als Stadtarchiv vorgehalten wird. Hier werden Akten entsäuert und zukunftsicher eingelagert.
Was mich regelmäßig fasziniert, ist die Beständigkeit von Urkunden. Jahrhundertealte Papiere, die zum Teil heute noch juristische Bedeutung haben, zieht der Archivaraus dem Regal und liest die für den unkundigen Laien nicht zu entziffernde Schrift flüssig vor. Versuchen Sie mal, eine noch 1995 täglich verwendete Diskette, irgendwoim Stadtgebiet einzulesen. Selbst CGs oder DVDs finden in neuen PCs schon keinen Platz mehr.
Auf die verbleibenden Archivare dieser Welt kommen ganz neue Aufgaben zu.“
Ebenfalls in Westfalenpost-Ausgabe erschienen heute 2 Leserbriefe. Prof. Thomas Gerhard Wilhelmi aus Heidelberg schreibt u. a.: “ …. In Olpe, wo ich vor längerer Zeit mehrmals zu tun hatte, sollte es natürlich wieder ein Archivar mit einer 100-Prozent-Anstellung geben. Am besten wäre wie bisher ein wissenschaftlicher Archivar; aber notfalls muss man Kompromisse eingehen und kann auch einen Diplom-Archivaren nehmen. Die bestehende
weitere Mitarbeiterstelleim Stadtarchiv sollte von 33 Prozent auf wenigstens 50 Prozent aufgestockt werden.
Im Hinblick auf das Museum und das Archiv wären ja aufgrund weitsichtiger, langfristiger Planungen Kombinationen gut denkbar. An vielen Ortenhat, wie ich weiß, der Stadtarchivar auch mit dem Ortsmuseum zu tun, und dies ist oft sehr sinnvoll und funktioniert gut. So könnte es doch auch in Olpe sein. Allerdings ist es abwegig, Archiv und Museum einer einzigen Person in Obhut zu geben.“
Der zweite Leserbrief bezieht sich auf den am 25.1. erschienen Leserbrief (s.o.): “ …. da täuschen Sie sich leider. Das Archivgesetz NRW § 10 (3) 1. + 2. legt detailliert fest, wer und mit welcher Qualifikation ein kommunales Archiv leiten darf.Nach § 10 (1) verpflichtet der Gesetzgeber sogar die Kommunen dazu“Sorge zu tragen, ihr Archivgut in eigener Zuständigkeit zu archivieren.“ Die Stadt Olpe ist gesetzlich verpflichtet, die Stelle des Stadtarchivars zu besetzen. Allenfalls kann die Stadt Olpe nach § 10 (2) 1. ihre Archivaufgabe durch „Übertragung auf eine für Archivierungszwecke geschaffene Gemeinschaftseinrichtung“ erfüllen. Die Leitung der freiwilligen Feuerwehr in Olpe, die in hoffentliche professioneller Hand liegt, sollte wohl auch nicht auf die Leitung der Feuerwehr in Drolshagen oder Wenden übertragen werden oder nebenbei von dem neuen Museumsleiter in Olpe geführt werden.“
Ich war in Radio Museum und zwar zwei mal ,das ist für mich Sehr interessant
Heute erschien in der Westfalenpost folgender Leserbrief von Dr. Michael Nies-Steffens (Nürnberg):
„Bei der Suche nach historischen Dokumenten in Olpe wurde mir immer der Name Josef Wermert genannt, den ich dann bald auch durch meine Besuche im Stadtarchiv Olpe näher kennenlernte. Durch die Gespräche mit ihm wurde ich, obwohl seit fast einem halben Jahrhundert nicht mehr in Olpe lebend, Mitglied im Heimatverein und seit zwei Jahren auch Autorim jährlich erscheinenden Jahrbuch. Die Qualität sowohl der mehrbändigen Olper Stadtgeschichte als auch die des Jahrbuches hatten mich sehr angesprochen.
Josef Wermert war mir bei meinen Recherchen immer eine große Hilfe und Stützew und als ich bei meinem letzten Besuch in Olpe von ihm erfihr, dass seine Stelle nicht wieder beyetzt werden soll, hielt ich seine Aussage für ein Gerücht. Scheinbar wird seine Arbeit im Verborgenen (Archiv) wohl nicht wahrgenommen und wertgeschätzt!
Zurzeit befinde ich mich auf einer Auslandsreise, bei der ich mich – wie beim Jahrbuch – ehrenamtlich einbringe. Als ich in Tokyo aus dem Newsletter der WP von der tatsächlichen Stellenstreichung erfuhr, habe ich mir die knappe mir zur Verfügung stehende Zeit genommen, um möglichst schnell durch diesen Leserbrief einerseits mein Unverständnis und meine Fassungslosigkeit über diese Stellenstreichung zum Ausdruck zu bringen und andererseits an alle, die diese Stellenstreichung zu verantworten haben zu appellieren, ihren Entschluss mit all den schon von anderen geäußerten Bedenken zu überdenken bzw. zurückzunehmen.
Nur weil durch die mehrbändige Stadtgeschichte und die Jahrbücher etwas Großes entstanden ist, darf nicht der Eindruck entstehen, es gäbe nichts mehr zu tun. Ein Museumsleiterkann nicht gleichzeitig das Stadtarchiv einer Kreisstadt führen – vielleicht ist dann die kommende Ausgabe des Jahrbuchs die letzte? ….“
Es gehört nicht zu den Pflichtaufgaben eines Archivleiters, den örtlichen Heimatverein bzw. dessen Jahrbuch zu betreuen. Herr Wermert wird dies wohl in seiner Freizeit tun, so dass der von Herrn Nies-Steffens konstruierte Zusammenhang mit der Olper Stellenbesetzung nicht besteht. Ferner ist es irrelevant, dass es sich um das „Stadtarchiv einer Kreisstadt“ handelt, da der Kreis Olpe (was im fernen Franken vielleicht nicht bekannt ist) für seine Überlieferung ein eigenes Archiv unterhält.
Wenn es denn – wie manche Leserbriefschreiber anscheinend wissen – zutrifft, dass das Personal im Stadtarchiv bislang nur aus 1,33 Stellen bestanden hat (1,0 für die Leitung + 0,33 für „eine weitere Mitarbeiterin“), bedeutet dies, dass sich der Leiter notgedrungen in beträchtlichem Maße mit Arbeiten befassen musste, für die er überqualifiziert und somit überbezahlt war. Denn was neben der Leitung in einem Stadtarchiv zu erledigen ist, hätte die/der FAMI oder gar abgeordnete Bürokraft mit ihrer/seiner Drittel-Stelle allein niemals bewältigen können. Es ist logisch, daraus zu schließen, dass für die wissenschaftliche Leitung dieses kleinen Archivs eine volle Stelle offensichtlich nicht zwingend erforderlich ist. Sollte dies der Fall sein (kann ich nicht beurteilen), ist es der Olper Stadtverwaltung kaum zu verdenken, hier Potential für die Einsparung von Personalkosten bei der Besetzung der Archivlleitungsstelle gesehen und diese Stelle quasi halbiert zu haben (Personalunion mit einem „halben“ Museumsleiter, auch wenn das im Stellenplan so nicht differenziert worden ist). Aber – und ich wiederhole mich – „Leitung des Stadtarchivs“ und „Personal des Stadtarchivs“ sind nicht das gleiche. Die Reduzierung der wissenschaftlichen Leitungsstelle auf 0,5 und gleichzeitig die Aufstockung der „weiteren“ Stelle auf 1,0 wäre ein Kompromiss, mit dem vielleicht beide Seiten leben könnten. Aber das müssten die unmittelbar Beteiligten in sachlicher Diskussion miteinander aushandeln. Endloses Lamentieren marginal betroffener Historiker und Waldorflehrer, die sich anhand fragmentarischer Medienberichte „ihre Meinung geBILDet“ haben, ist nicht konstruktiv und hilft dem Stadtarchiv Olpe konkret nicht weiter. Auch sollten nicht ständig die Kultubereiche „Archiv“ und „Museum“ – beide nicht auf Rosen gebettet – gegeneinander ausgespielt werden. Das ist unsolidarisch und kontraproduktiv.
Herr Peter Kunzmann wäre gut beraten, sich das Olper Stadtarchiv einmal vor Ort anzusehen und sich vom Stadtarchivar dessen Arbeitsgebiete erläutern und sich die umfangreichen Archivbestände vorstellen zu lassen. Da er diese offensichtlich nicht kennt, redet er wie der Blinde von der Farbe.
Wenn Sie schon persönlich herumpöbeln müssen, dann bitte nicht in die falsche Richtung. Ich wünsche viel Erfolg bei Ihren Protestaktionen und werde die Retter des Olper Stadtarchivs nun nicht weiter mit meinen frühern Erfahrungen aus der archivischen Praxis belästigen.
Sehr geehrter Herr Kunzmann, an Ihrer Antwort hat mich insbesondere gefreut, daß Sie mich fortan nicht mehr belästigen wollen. Halten Sie bitte Ihre Zusage ein, und „Schuster, bleiben Sie bei Ihren Leisten“, d.h., werkeln Sie als Bibliothekar in Ihrer Bibliothek, und rühren Sie nicht in fremden Töpfen herum!
Nur zur Information der restlichen Mitlesenden:
1. In „meiner“ Bibliothek kann ich seit meiner Berentung nicht mehr „werkeln“.
2. Als derjenige, der ab 2004 eine chaotische Ansammlung von Papierhaufen wenigstens so weit in ein funktionierendes Universitätsarchiv verwandelt hatte, dass ein fünf Jahre später dazukommender Diplomarchivar nicht mehr aus allen Wolken fallen musste, betrachte ich das Archivwesen durchaus nicht als „fremden Topf“.
Auf die von Herrn Thieme gestern und heute vorgebrachten und dem von einem Gymnasiallehrer i. R. zu erwartenden Niveau kaum angemessenen Unverschämtheiten werde ich nicht eingehen. Den Olpern kann ich nur wünschen, dass Herr Thieme mit seiner fragwürdigen Aktion (Auslösung eines bundesweiten „Shitstorms“ gegen die Olper Stadtverwaltung) dem Stadtarchiv keinen Bärendienst erwiesen hat. Und damit Schluss.
Herbert Bäumers Beitrag „Edith Langner – eine ungewöhnliche Frau der Stadt Siegen“ in der Zeitschrift Siegerland Band 99 Heft 2 (2022), S. 219 – 220, geht, wenn ich es recht sehe, nicht über dessen oben genannte Veröffentlichung hinaus.
Den Entscheidenden scheint nicht klar zu sein, dass sie nicht nur gegen gute Praxis und das nordrheinwestfälische Archivgesetz verstoßen, sondern sie die Geschichte Olpes für die Zukunft gefährden. Denn die fachlich kompetent geführte Sichtung und Bewertung der Akten schafft die alleinige Grundlage für historisches Arbeiten in zukünftigen Generationen. Ach ja, und seit der französischen Revolution sind die Archive ja noch ein – wenngleich vielen nicht bewußter – Grundpfeiler der Demokratie. Nur, wenn systematisch und fachlich kompetent Überlieferung gebildet wird, kann die Gesellschaft der Zukunft die Handlungen von Heute und Gestern anhand der Unterlagen im Archiv zumindest retrospektiv nachvollziehen. Will Olpe wirklich an solchen Grundpfeilern sägen? In jedem Falle ist die Olper Entscheidung nicht anders als dumm und gefährlich zu bewerten, den Entscheidenden war gar nicht klar, was sie riskieren.
@Peter Kunzmann
@Prof. Dr. Thieme [Anm.: Mein Fehler. Danke für den Hinweis an J.B.!]
@ alle
Ich darf ab jetzt um Äußerungen bitten, die keine persönlichen Angriffe, etc enthalten.
Heute erschien in der Westfälischen Rundschau, Ausgabe Siegerland im Print der Artikel „Stadtarchiv: „Die Entscheidung hat bundesweit für Aufsehen gesorgt.“ Verband deutscher Archivarinnen und Archivare übt harsche Kritik an geplanter Stellenstreichung in Olpe. ,Verweis auf archivfachliche Ausbildung des Nachfolgers.“ Zitat: „In den „Harry Potter“-Büchern kommen derartige Briefe als „Heuler“ per Eulenpost. So ähnlich wie einer der ausgeschimpften Hogwarts-Schüler dürfte Bürgermeister Peter Weber sich gefühlt haben, als er die Post des Verbandes deutscher Archivarinnen und Archivare (VdA) gelesen hat, die kürzlich im Rathaus einging. ….“
Auch die Siegener Zeitung berichtet heute: „Olpe. Archive leiten kann doch jeder – oder? Offener Brief zur Causa Olpe. Verband deutscher Archivarinnen und Archivare schließt sich dem Protest an.“ Zitat: “ …. „Das kann einem ziemlich sprachlos machen, wenn man es nicht zweimal gelesen hat“, sagt Ralf Jacob. Er hat den Brief als Vorsitzender des VdA unterzeichnet, fungiert ansonsten als Stadtarchivar in Halle an der Saale. Glücklicherweise seien solche Entscheidungen bislang immer noch Einzelfälle, es würden nicht flächendeckend Stellen gestrichen oder auf die hier geplante Weise ersetzt. Es sei bemerkenswert, wie hier versucht werde, „sich aus einer Pflichtaufgabe herauszuwinden.“ ….“
Ein weiterer Fund zur Biographie Irles (und zur NS-Geschichte des Siegerländer Heimat- und Geschichtsvereins):
Quelle: Siegener Zeitung, 13. Februar 1933 (nach: Klaus Dietermann: Die Siegener Synagoge. Vom Bau und der Zerstörung eines Gotteshauses, Siegen 1996, S. 19
Sehr geehrte Damen und Herren,
beim Eintrag zum Artikel von Andreas Bingener sollte es im Untertitel
„Brauchwasserentsorgung“ heißen. Auch die Familie „Otto“ im Beitrag von Herrn Lerchstein sollte groß geschrieben werden.
Vielen Dank!
„Finissage“ – die Ausstellung ist nur noch heute und morgen zu sehen:
Für die, die es nicht schaffen oder geschafft haben: „Tatsächlich tourt die Ausstellung schon in diesem Jahr weiter in den Kunstraum Grevy nach Köln. Dort eröffnet die Scholl-Stiftung die Ausstellung am 10. November.“
Heute erschien in der Westfalenpost Olpe folgender Artikel:
„SPD will Archivarsstelle neu diskutieren. Fraktion bezieht Stellung auf den offenen Brief in Sachen „kw“-Vermerk und betont die wichtige Rolle des Archivs.
…. Nun hat die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Olpe Stellung dazu bezogen: „Die bundesweite Aufmerksamkeitwurde durch einen offenen Brief an den Bürgermeister der Stadt ausgelöst, in dem die Verfasser in sehr sachlicher und emotionsfreier Form gute und schlüssige Argumente für den Erhalt der Stelle des Archivars formuliert haben“, schreibt Fraktionschef Volker Reichel.
Die Sorge um die qualizizierte Fortsetzung der Arbeit des jetzigen Archivars sei letztlich die Sorge um die Sicherung und Fortführung der Qualität des Stadtarchivs. „Für uns als SPD-Fraktion hat die Wahrnehmung der kommunalen Pflichtaufgabe „Stadtarchiv“ einen sehr hohen Stellenwert, den wir eindeutig vor den Belangen eines freiwilligen Museums angesiedelt sehen. Das Stadtarchiv sichert – wie in dem offenen Brief überzeugend dargestellt – die historische Identität unserer Stadt. Der Archivar schafft durch seine Arbeit auch die Basis für die in hohem Maß eingebrachte ehrenamtliche Tätigkeit zu unserer Stadtgeschichte.“
Allein das Autorenverzeichnis der Bände der Stadtgeschichte gebe eine Vorstellung vom enormen Maß an ehrenamtlicher Arbeit zum Wohle der Stadt. „Eine Arbeit, die vor allem auf den exzellent vorgehaltenen Quellen des Stadtarchivs fußt.
Dieser ehrenamtliche Einsatz ist ein hohes Gut, das wir nicht schmälern oder preisgeben dürfen! Daher ist für uns die fachlich qualifizierte Betreuung des Archivs im Hauptamt unabdingbar.“
Da die SPD die Errichtung eines Museums in Olpe sehr fragwürdig sehe, „haben wir uns von Anfang an dafür eingesetzt, dass ein Archivar beschäftigt wird, der im Rahmen seiner Tätigkeit allenfalls museale Ausstellungen organisiert“. Der Schwerpunkt müsse klar auf der Archivarbeit liegen. Die Neuauflage der politischen Diskussion über die Art der Fortsetzung des Archivs, über die Sicherung der Qualität der Archivarbeit sowie die personelle Ausstettung zur Gewährleistung dessen sei unabdingbar.“
Danke für den Kommentar! Leider fehlt bisher eine ausführliche Darstellung der Beweggründe der Stadtverwaltung bzw. der politischen Mehrheit, so dass man fröhlich mutmaßen kann. Wie zu hören ist beabsichtigt der Bürgermeister eine Erklärung auf der kommenden Stadtverordnetenversammlung am 15.2. Bis dahin wird man sich wohl gedulden müssen.
Was sagt eigentlich die konzeptionelle Grundidee vom Januar 2021 für das Olper Museum zur Übernahme der Archivleitung durch die Museumsleitung? Wenn ich es recht sehe – nichts!
Zur Qualifikaton der Museumsleitung finden sich folgende Angaben:
“ …. Anforderungen an die zu besetzende Stelle der
Museumsleitung (S. 9):
• Geisteswissenschaftliche Promotion (Europäische
Ethnologie, Kulturwissenschaften, Volkskunde oder
Geschichte)
• Einschlägige Erfahrungen im Bereich Museum
• Erfahrungen in den Bereichen Öffenlichkeitsarbeit,
Kulturmanagement, partizipative Projekte und
Museumspädagogik
• Teamfähig, engagiert und kreativ ….“
Da sich auch dort keine Hinweise auf die Übernahme der Archivleitung durch die Museumsleitung findet, wäre ein Blick auf die Stellenausschreibung nicht uninteressant …..
2 Funde zu Canstein:
„Canstein, Ernst
Wurde zu Wilhelmshütte (Lahn), Kreis Biedenkopf, am 14. Mai 1867 geboren. Nachdem er die Abiturientenprüfung am Großherz. Badischen Gymnasium zu Wertheim a. M. im Juli 1888 bestanden hatte, studierte er in Marburg Geschichte und neuere Sprachen. Im Frühjahr 1897 bestand er die Staatsprüfung in Marburg. Von Herbst 1897 bis Herbst 1898 war er Seminarkandidat am Realgymnasium zu Kassel. Von Herbst 1898 bis Ostern 1899 als Probekandidat an der Realschule zu Biebrich. Von Ostern 1899 bis 1. Oktober 1901 als Probekandidat und wissenschaftlicher Hilfslehrer an der Realschule zu Geisenheim am Rhein. Wird dann an die Oberrealschule zu
Kassel berufen. – Aus: Programm Kassel Oberrealschule 1902.“
aus: Kössler, Franz: Personenlexikon von Lehrern des 19. Jahrhunderts
Berufsbiographien aus Schul-Jahresberichten und Schulprogrammen
1825 – 1918 mit Veröffentlichungsverzeichnissen Band: Cadura – Czygan, Vorabdruck (Preprint) Stand: 18.12.2007, S. 11
– Ernst Canstein besuchte 1879 die Höhere Bürgerschule in Biedenkopf – s. Osterprogramm 1879 der Schule, S. 18
Der am 2. September 1928 geborene Netphener Heimatforscher Ewald Hatzig, der am 23. Dezember 2021 verstorben ist, hat mit Anita Ruth Faber alle 2 Jahre in Niedernetphen in derselben Klasse der katholischen Volksschule gesessen, da damals zwei Jahrgänge in einem Klassenraum gemeinsam unterrichtet wurden. Für ihn hieß seine Klassenkameradin mit Vornamen immer nur Anita, wie er mir einmal erzählt hat.
Vielen Dank für den Hinweis! In der Sammlung des Aktiven Museums Südwestfalen findet sich ein eigenhändiger Brief Anita Fabers, der mit Anita unterzeichnet ist:
Der Ausschnitt des Briefes ist Bestandteil der Sitzungsunterlagen für den Rat der Stadt Netphen.
s. a. folgenden Blogeintrag: Anna Krabbe, „“Wir haben doch schon eine Behindertentoilette!” – Menschen mit Behinderung als Nutzende von Archiven“, Archivwelt, 08/02/2023, https://archivwelt.hypotheses.org/3294.
vielen Dank für die Bereitstellung der Unterlagen. Toll, dass diese Aufzeichnungen erhalten bleiben. Gibt es noch weitere Aufzeichnungen zu Taufen nach 1911 und Sterbefällen nach 1920. Ich bin auf der Such nach näheren Informationen zu meinen Ahnen und hätte dazu noch weitere Fragen.
Die katholischen Kirchenbücher werden auf der erwähnten Seite nach Ablauf der Schutzfristen kontinuierlch ergänzt. Für den Fall, dass Sie in evangelischen Kirchenbüchern recherchieren wollen, bleibt Ihnen zunächst nur das kostenpflichtige Portal archion. Die Abteilung Personenstandsarchiv des Landesarchivs NRW in Detmold stellt auch Digitalisate von regionalen Standesamtsregistern zur Verfügung.
Heute erschien in der Westfälischen Rundschau folgender Artikel „Archivar-Nachwuchs appelliert an die Kreisstadt. 60 Fachhochschullehrgang an der Archivschule Marburg schreibt in Sachen Stadtarchiv an Bürgermeister Peter Weber und weist auf Unstimmigkeiten hin.“:
“ …. Nun haben sich die Mitglieder des 60. Fachhochschullehrganges an der Archivschule Marburg – Hochschule für Archivwissenschaft – an die Stadtverwaltung gewandt und plädieren energisch für die Wiederbesetzung der Stelle, wenn Wermert geht. „Mit Verwunderung haben wir von den Plänen erfahren, die Archivarsstelle in Olpe zu streichen und das Archiv dem geplanten Museum zuzuschlagen“, heißt es in dem Schreiben. Die zuständigen Entscheidungsträger werden von den angehenden Archivarinnen und Archivaren dringend gebeten, ihre Entscheidung zu überdenken.
Die Berufsbilder der Richtungen Museologie und Archivwissenschaft, so der Fachhochschullehrgang, „weisen grundlegende Unterschiede auf, was man auch anhand unserer Ausbildung erkennt. Aktuell durchlaufen wir eine dreijährige Ausbildung, um nach unserem Abschluss als Archivarinnen und Archivare in den verschiedensten Archiven in ganz Deutschland arbeiten zu können, vor allemin Kommunalarchiven, das heißt Gemeinde-, Stadt- und Kreisarchiven. Dafür bekommen wir fundierte Kenntnisse in den archivischen Fachaufgaben Bewertung, Erschließung, Erhaltung und Nutzbarmachungvon Schriftgut vermittelt.“ Natürlich gehöre dazu auch ein kurzer Überblick über die artverwandten Berufe der Bibliothekare und Museologen. „Auch wenn auf den ersten Blick viele Ähnlicheiten zu bestehen scheinen, sind die Unterschiede zwischen den Berufen schon inden grundlegendsten Ansätzen sichtbar.“ Zum Beispiel arbeiteten Archivarinnen und Archivare vielfach rein mit Schriftgut, während sich Museologinnen und Museologen mit dreidimensionalen Objekten beschäftigten. „Die unterschiedlichen Materialien bringen unterschiedliche Voraussetzungen mit sich, müssen unterschiedlich behandelt, gelagert, klassifiziert, erschlossen und können unterschiedlich genutzt werden.“
Nach der Ausbildung für den gehobenen Archivdienst, so der Jahrgang, könnten sie nicht ohne eine grundlegende Weiterbildung in einem Museum arbeiten, ebenso wie Museologinnen und Museologen nicht ohne Weiteres nach ihrem Studium in einem Archiv arbeiten könnten. „Ein viel grundlegendenererUnterschied ist die Aufgabe der Bewertung. LAut den Archivgesetzen der einzelnen Länder und des Bundes obliegt es allein der Archivarin oder dem Archivar, in die Behörden seines Sprengels zu gehen und deren Verwaltungsschriftgut zu bewerten, also die Entscheidung zu treffen, was dauerhaft im Archiv aufbewahrt und was vernichtet wird. Dies ist ein gesetzlicher Auftrag, deren Erfüllung die Verwaltung transparent machen und zur demokratischen Kontrolle der Verwaltung beitragen soll.“ Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, würden Archivarinnen und Archivare nicht nur die theoretischen Methoden, Praktiken und möglichen Verfahrensweisen einer Bewertung vermittelt, sondern sie hätten auch in den langen Praxisphasen die Möglichkeit, aktiv an Bewertungen teilzuhaben und Erfahrungen zu sammeln. „Dazu gehören ebenfalls Kenntnisse über digitales Schriftgut und die Kompetenz, fachgerecht auf Veränderungen in der digitalen Welt reagieren zu können, schreiben Ellen Kaiser, Simon Rusche und Simon Ernst im Namen des Lehrgangs.“
Ein genaues Lesen der Stellungnahme lohnt:
1) Offener Brief v. 23.1.23 – “ …. 16. dass die zunehmende Digitalisierung des Schriftgutes und mehr noch die Übernahme des heute nur noch rein digital entstehenden Registraturgutes sowie deren digitale Verwaltung, Aufbewahrung und Pflege ein neues, zusätzliches und ausgesprochen umfangreiches Arbeitsfeld für den Stadtarchivar darstellt, so dass nach Stellungnahme des Archivamtes sogar eine personelle Erweiterung im Archiv angemessen wäre, wobei die derzeitige Drittelstelle (von Frau Annalena Schäfer) keineswegs ausreichend ist, ….“ gegenüber Stellungnahme des Bürgermeisters: “ …. Weber wies ausdrücklich daraufhin, dass neben Archivar Wermert noch eine weitere Mitarbeiterin im Stadtarchiv arbeite, die in der bisherigen Diskussion gar nicht erwähnt worden sei. Die zeige fehlende Wertschätzung, was er sehr bedaure…..“
Ich erlaube mir mal die Vermutung, dass es mit der Wertschätzung der Arbeit von Frau Schäfer von Seiten der Stadt nicht weit her sein kann, wenn man ihr alle zusätzlichen Arbeiten, die bisher von der Archivleitung durchgeführt wurden und die künftig durch eine Ausweitung des Berufsfeldes u.a. auf digitale Unterlagen anfallen werden, bei einer Beschäftigung mit 0,33 VZÄ aufdrücken möchte. Die Museumsleitung soll ja offenbar keine archivfachlichen Aufgaben erfüllen, denn dafür ist sie nach der konzeptionellen Grundidee von 2021 nicht qualifiziert. Also bleibt der Bereich an der bereits vorhandenen Kraft hängen. Das schafft kein zukunftsfähiges Archiv und ist erst recht keine angemessene Personalpolitik.
Kommunale Archive sind kein Topf, aus dem man sich mal eben für Nostalgie oder historische Prestigearbeiten bedient, um sie dann wieder zu verschließen. Sie dokumentieren Verwaltungshandeln und ermöglichen es Bürger*innen, die Entscheidungen ihrer kommunalen Gremien und Ämter transparent nachvollziehen zu können. Werden an dieser Stelle so erhebliche Einschnitte vorgenommen, gefährdet das nicht nur das „historische Gedächtnis“, sondern kann langfristig auch massive Schäden am Vertrauen der Gesellschaft in demokratische Strukturen bedeuten. Um das zu vermeiden, müssen Archive nicht nur fachlich qualifiziert sondern auch ausreichend mit Personal ausgestattet sein – eine Planung, die bei der Streichung der Stelle der Archivleitung offenbar ebenfalls nicht berücksichtigt wurde.
Danke für den Kommentar! Zu berücksichtigen ist bei der Drittel-Stelle, dass die übrigen Zweidrittel für die Archivarbeit zweier Olper Nachbarkommunen „belegt“ sind, so dass eine Aufstockung nicht einfach ist.
Heute erschien in der Siegener Zeitung, Ausgabe Kreis Olpe, der Artikel „Stadtarchivar „kann wegfallen“? So reagiert der Bürgermeister auf die Debatte.“:
“ …. Sein aktueller Tenor lautet, die Diskussion mit mehr Gelassenheit zu führen und zur „Versachlichung zurückzukehren.“ Dies begründet Weber anhand des Termins, an dem der aktuelle und seit 1989 in dieser Funktion tätige Stadtarchivar Josef Wermert in den Ruhestand eintritt. Dies wird am 30. Juni 2024, also in über einem Jahr, der Fall sein.
„Es war immer geplant, dass wir im Laufe dieses Jahres das Thema besprechen“, eröffnete Weber seine Stellungnahme vor der Stadtverordnetenversammlung. …. Trotz dieser zunächst pragmatischen Analyse war Peter Weber anzumerken, dass die neu entflammte Debatte um die Stadtarchiv-Leitung Spuren hinterlassen hatte. …..
Eines hatten diese Briefe und öffentlichen Meinungsäußerung für Peter Weber offenbar gemeinsam: einen Vorwurf der fehlenden Würdigung der Wichtigkeit des Stadtarchivs seitens Bürgermeister und Stadtverordnete. „Es ist eine Unterstellung, die nicht zutrifft, dass die Arbeit im Stadtarchiv von uns nicht gewürdigt wird“, reagierte Weber entsprechend. Gleichzeitig bekräftigte er, dass er sich im Austausch mit Axel Stracke als Vorsitzenden des Heimatvereins Olpe befindet. Auch zum Münsteraner Leiter des Archivamtes in Münster, Dr. Marcus Stumpf, bestünde seit vergangenem Jar ein erster Kontakt. Marcus Stumpf war dennoch einer der prominenten Unterzeichner des ersten offenen Briefes.
Der erste offene Brief hat die Politik zeitlich auf dem falschen Fuß erwischt. Jetzt sollen die Wogen geglättet werden. Wir beraten in diesem Jahr die NAchfolge Lösung. Diese wird dann in dem Stellenplan für 2024 einfließen.. Und dieser wird letztendlich hier von uns entschieden,“ sagte Bürgermeister Weber. Hierzu sieht er sich und die Stadt in der Pflicht, die künftigen Aufgaben eines möglichen Stadtarchivars festzustellen. Daran wiederum orientiert sich der entsprechende Arbeitsaufwand.
Zeit und Aufwand waren in den vergangenen Jahren durch die Arbeit an den vier Bänden der Stadtgeschichte unter dem Titel „Olpe – Geschichte von Stadt und Land“ entsprechend hoch. Das Werk wird mit dem vierten Band, welcher in diesem Jahr fertiggestellt werden soll, seinen abschluss finden. Auch der Einsatz von Jofef Wermert als aktueller Stadtarchivar beim Aufbau des neuen Museums und der Betreuung der Museumsleitung falle laut Bürgermeister Weber künftig in die Hände des neuen Museumsleiters Sebastian Luke. Diese Faktoren bewertet Peter Weber mit „sehr, sehr viel zusätzlicher Arbeitszeit“ in den vergangenen Jahren.
Am Ende seiner Stellungnahme äußerte der Erste Bürger der Stadt olpe den Wunsch „zur Versachlichung und Gelassenheit zurückzukehren“. Auch der Begriff der „verbalen Abrüstung“ fiel mehrfach. Die anwesenden Stadtverordneten im voll besetzten Ratssaal reagierten mit klopfenden Beifall.“
„Mit Erstaunen haben die Unterzeichneten die Erklärung des Olper Bürgermeisters Peter Weber zur Besetzung der Stadtarchivstelle vor der
Stadtverordnetenversammlung am 15. Februar 2023 zur Kenntnis genommen, wie es LokalPlus berichtet hat.
Den „Offenen Brief“ vom 23. Januar 2023, mitunterzeichnet von 91
Wissenschaftlern, Historikern, Archivaren und Kulturschaffenden, hat der
Bürgermeister entweder nicht sorgfältig gelesen oder er stellt manches bewusst nicht korrekt dar.
1. Wir verwahren uns mit Entschiedenheit dagegen, dass der Bürgermeister
seinen „Eindruck“ kundtut, „von interessierter Seite werde versucht, die
Stadtverwaltung in Misskredit zu bringen.“ Die Formulierung „von
interessierter Seite“ kann sich aufgrund des Kontextes nur auf die
Unterzeichneten und Mitunterzeichneten beziehen. Sie müssen die zitierte
Formulierung als Diffamierung empfinden. Wenn geäußerte Vorbehalte und
Kritik als „Misskredit“ interpretiert werden, zeigt dies Verachtung dafür,
dass freie Bürger in einem freien Land von ihrer Meinungsfreiheit Gebrauch
machen und das Recht für sich in Anspruch nehmen, „Offene Briefe“ zu
verfassen. Allen unterzeichneten Fachkundigen geht es im „Offenen Brief“
vom 23. Januar ausschließlich um die Sache „Stadtarchiv Olpe“. Dies wird
auch daran deutlich, dass der Brief nach dem Urteil mehrerer politischer
Mandatsträger „in sehr sachlicher und emotionsfreier Form mit guten und
schlüssigen Argumenten“ für den Erhalt der Archivarsstelle verfasst wurde.
Bürgermeister und Stadtverordnetenversammlung haben jedoch
anscheinend ohne nähere Sachkenntnis eine politisch motivierte
Entscheidung getroffen und die neu geschaffene Stelle des Museumsleiters
auf Kosten der als entbehrlich angesehenen hauptamtlichen Archivleitung
installiert. Haben sich Bürgermeister und Stadtverordnete jemals im
Stadtarchiv und insbesondere im Archivmagazin eine Vorstellung von der
dortigen Arbeits- und Materialfülle verschafft? Haben sie Kenntnis von den
Aufgaben genommen, die zu leisten die Kommunen verpflichtet sind
(„Pflichtaufgaben“)?
2. Der Bürgermeister geht in seiner Erklärung mit keinem Wort auf die vom
Archivamt des Landschaftsverbandes und die von den Verfassern des
„Offenen Briefes“ vorgetragenen Argumente ein, mit denen eine
hauptberufliche Archivleitung als unverzichtbar begründet wird. Vor allem
das Archivamt ist – neben dem Leiter des Stadtarchivs – diejenige
Institution, die sachgerecht und unabhängig Arbeitsanfall, Arbeitsbelastung
und Arbeitsweise im Stadtarchiv beurteilen kann.
3. Im „Offenen Brief“ der 93 Unterzeichneten ist sehr wohl und entgegen den
Worten des Bürgermeisters auf die vorhandene Drittelstelle im Archiv
hingewiesen worden, die derzeitige Mitarbeiterin ist sogar namentlich
erwähnt (vgl. Punkt 16 des „Offenen Briefes“). Von einer durch den
Bürgermeister behaupteten „fehlenden Wertschätzung“ seitens der
Briefverfasser kann also nicht einmal ansatzweise die Rede sein.
4. Es verwundert sehr, dass der Bürgermeister, wenn er denn das Gespräch
favorisiert, dieses nicht zuerst mit dem Stadtarchivar und sachkundigen
Bürgern vor Ort (Vertreter des Heimatvereins, Verfasser regional- und
lokalgeschichtlicher Beiträge, Ortsheimatpfleger, ausgewiesene Historiker
etc.) gesucht hat. Zusammen mit den Stellungnahmen des LWL-Archivamtes
hätte damit eine angemessene Entscheidungsbasis vor einem möglichen
„künftig wegfallend“-Vermerk geschaffen werden können.
Wir hoffen weiterhin im Sinne der Sache, dass eine Wiederbesetzung der
hauptamtlichen Archivleitung erfolgt – sinnvollerweise vor dem Ausscheiden
des derzeitigen Stelleninhabers, wie dies vorbildlich in Attendorn praktiziert
wurde.
Für weitergehende Informationen verweisen wir auf die in dieser Sache
vollständige Dokumentation im Blog siwiarchiv.de.
Am 21.2.2023 erschien in der Online-Ausgabe der Westfalenpost – leider hinter der Bezahlschranke – der Artikel „Zukunft des Olper Stadtarchivs: Jetzt legen Kritiker nach“, der die oben wiedergegebene Reakktion der Verfasser des ersten Offenen Briefes wiedergibt.
Karnevalistischer Kommentar:
1. Auszug aus der Büttenrede vom „Entjräter“: :
„ …. Ich will heut´ nicht singen von Sundern,
die Stadt Olpe lässt mich wundern.
Das Stadtarchiv ward angezählt,
die Nachfolge ist längst erwählt.
Offenheit und Transparenz
finden dort bald ihre Grenz‘ .
Archivisches Arbeiten kann ein jeder,
sagt der Bürgermeister Weber.
Gezündet werden Nebelkerzen,
Briefeschreiber versucht anzuschwärzen,
um abzulenken von der eigenen Tat
wider bess‘ rem Experten-Rat.
Das Problem – verbal abgerüstet –
wird nun weggeflüstert.
Bleiben Misskredit oder politisches Gewürge?
Ach, ich hoff‘, es siegt der mündige Bürger! ….“
2. Fussgruppe der RKG „Lustige Historiker:innen“ für den Umzug mit dem
Motto: „Tom und Jerry im Archiv“ oder: „Schwarzer Kater jagt graue Maus“
3. Motivwagen des ACC „Närrische Regalbefüller“ unter dem Motto „Archivarischer Albtraum“:
Heute erschien in der Westfalenpost (Olper Ausgabe) der Artikel „Bürgermeister drängt auf Beruhigung. Peter Weber betont: Entscheidung für Archivars-Nachfolge fällt erst 2024.“:
„Die vielen Briefe, die inzwischen geschrieben wurden, um auch in Zukunft für eine hauptamtliche Leitung des Olper Stadtarchivs zu werben, haben ein Echo bekommen. Bürgermeister Peter Weber (CDU) nutzte dazu einen ungewöhnlichen Weg: Er ergriff am Mittwoch am Ende der Ratssitzung unter dem Tagesordnungspunkt „Informationen“ das Wort, um in einer ausführlichen Stellngnahme, Öl auf die Wogen zu gießen. Er habe ja „den einen oder anderen offenen Brief dazu erhalten, auch die SPD-Fraktion hatte sich in einer Stellungnahme geäußert, die Weber lobte: Darin sei im Grunde das wiedergegeben worden, was zwischen Rat und Verwaltungvereinbart worden sei: „Wir hatten im Haushalt vereinbart, dass wir uns im Laufe des Jahres darüber unterhalten.“ Doch nun werde „von interessierter Seite versucht, mit etwas verkürzter Sicht die Stadt ein bisschen in Misskredit zu bringen.“ ….
„Wir werden uns in diesem Jahr darüber unterhalten in welchem Umfang eine Nachbesetzung des Leiters des Stadtarchivs stattfinden wird.“ Wermert scheide am 30. Juni 2024, „wohlgemerkt nicht 2023, sodass das Ergebnis der Beratungen in den Stellenplan 2024 einfkießen wird.“. …. „Der Leiter des Stadtarchivs ist nicht der einzige Mitarbeiter, die weitere Mitarbeiterin, die wir uns mit Wenden und Drolshagen teilen, findet in all diesen Briefen keine Erwähnung, was kein wertschätzender Umgang ist.“
Richtig an der in den Briefen angeführten Kritik sei, „dass wir uns mit der Politik darüber unterhalten werden, welche freiwilligen Leistungen des Stadtarchivs wir künftig abdecken wollen. Auch wird es um die Frage gehen, ob bei der Vermittlung der Stadtgeschichte weiterhin auf die Schriftform gesetzt wird oder auch andere, moderne Mittel verwendet werden. Das Thema war uns wichtig und wird uns immer weichtig sein.“
Auch gelte es zu berücksichtigen, dass in den vergangenen Jahrzehnten vom Leiter des Stadtarchivs die Olper Stadtgeschichte in vier Bänden mit mehreren Teilbänden“in ganz hervorragender Weise verfasstworden“ sei. Der letzte Teilband solle 2024 erscheinen „und damit ist eine Arbeit abgeschlossen, die viel Arbeitszeit des Archivars gebunden hat. Zudem hat er die Museumssammlung betreut, und wir haben nun einen Leiter des Stadtmuseums in dessen Arbeitsbereich dies fällt. Es ist ein völlig normaler Vorgang, dass wir prüfen, in welchem Umfang wir eine solche Stelle nachbesetzen müssen. Da bis 2024 genügend Zeit dafür sei, „rate ich allen, verbal ein wenig abzurüsten und das Gespräch zu suchen statt offene Briefe zu schreiben. Es ist keine leere Floskel, wenn wir in der Vergangeneheit die Arbeitunseres Archivars gelobt haben.“
Allerdings sehe er „ein bisschen unabhängig davon die Frage der Zukunft des Jahrbuchs des Heimatvereins“. In diesem Jahr betreue Wermert es, „Diese Unterstützung ist immer von uns gewollt gewesen und soll nach meiner Meinung auch künftig sein“, die Frage sei aber, ob dies in Form von personeller Unterstützung sein müsse oder sie auch durch finanzielle Förderung erfolgen könne. Er stehe mit dem Heimatverein im Kontakt, “ ich persönlich sehe das Heimatbuch nicht gefährdet.“
Er hoffe, dass „die medieale Aufregung, die auch sehr inszeniert worden ist, versachlicht wird.“ Der Stadtrat untersützte diese Stellungnahme mit Applaus.“
„Es wird umfassend zu den Überlegungen hinsichtlich der Personalstelle des Leiters des Stadtarchivs der Kreisstadt Olpe informiert.“ aus: Niederschrift über die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 15.02.2023 vom 21.2.2023, S. 12
Siwiarchiv hätte gerne die umfassenden Überlegungen hier im Wortlaut wiedergegeben. Denn schriftlich waren sie gegenüber einem hier zeitweise Mitdiskutierenden bereits vor der Stadtverordnetenversammlung formuliert worden.
Heute erschien die Westfalenpost Olpe der Leserbrief „Gerne streiten, aber respektvoll bleiben. „Diskussion über die Stelle des Archivars“:
„In den letzten Wochen erschienen in der lokalen Presse und überregionalen Internetforen, z. B. im Blog der Archive im Kreis Siegen-Wittgenstein (siwiarchiv.de), viele Leserbriefe zum Wegfall der Stelle des Stadtarchivars in Olpe. Ich möchte hier nicht die zahlreichen Argumente dafür und dagegen wiederholen; diese sin hinreichend von den Autoren dargelegt worden. An dieser Stelle soll die Vorgehensweise des Bürgermeisters und der Politik, die zu einigen Irritationen führte, in den Fokus gerückt werden: Zunächst ist es unverständlich, dass weder kompetente Fachleute noch Sachkundige Bürger in den Entscheidungsprozess eingebunden wurden. Es existiert zwar – wie ich erfahren habe – eine Korrespondenz zwischen dem LWL-Archivamt für Westfalen als zuständiger und beratender Behörde des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe und dem Bürgermeister. Diese konnte jedoch vom LWL erst angeregt werden, als die Entscheidung bereits gefallen war. Es wäre für die Diskussion wichtig, etwas über den Inhalt des LWL-Schreibens und seine Rezeption durch den Kommunalpolitiker Weber zu erfahren. Auch der Stadtarchivar Josef Wermert wurde trotz seiner umfangreichen Fachkenntnisse nicht informiert; er erfuhr erst „auf der Straße“, dass seine Stelle schon jetzt mit einem kw-Vermerk (=künftig wegfallend) versehen ist. Der Schreiber dieser Zeilen, der an zahlreichen Publikationen des Stadtarchivs Olpe mitgearbeitet hat, ewrlebte, dass seine kritische Frage zu der zukünftigen Qualtät der Arbeit und der historischen Forschung im Stadtarchiv von Herrn Weber höflich mit Beschönigungen und Beschwichtigungen beiseitegeschoben wurde.
Die Stellungnahme des Bürgermeisters in der Ratssitzung am 15. Februar erscheint mir in erster Linie als Rechtfertigung für die getroffene politische Entscheidung und als ein Versuch, Wogen zu glätten. Webers Erklärung enthält einige Ungereimtheiten. Entgegen seiner Behauptung wurde im „Offenen Brief an den Bürgermeister unter Punkt 16 expressis verbis auf die Drittelstelle im Archiv hingewiesen und die Stelleninhaberin Annalena Schäfer namentlich genannt. Es ist bedauerlich, dass Her Weber den Eindruck hat, es werde von interessierter Seite versucht, die Stadtverwaltung in ÄMisskredit zu bringen. Ihm sei Folgendes ins Gedächtnis gerufen: Man kann in einer Demokratie in der Sache heftig streiten und dennoch sein Gegenüber respektvoll behandeln. Genau diesen Weg haben die Initiatoren und Unterstützer des Offenen Briefes eingeschlagen.“
Die Diskussion über die Wikipedia-Einträge von Kommunen aus dem Kreisgebiet wird durch die Siegener Zeitung um Kreuztal (Friedrich Flick) und Siegen (Adolf Hiteler als Ehrenbürger, Paul Giesler, Ernst Achenbach) erweitert:
Die Frage ist müssen Kommunen die Seiten korrigieren?
Mit etwas Abstand bleiben einige Fragen an die Stellungnahmen des Bürgermeisters gegenüber dem Sauerlandkurier, einer zeitweise hier an der Diskussion beteiligten Person und gegenüber der Stadtverordentenversammlung:
1) Warum äußerte sich der Bürgermeister nur gegenüber diesen dreien? Für mich wäre es nachvollziehbarer gewesen, wenn er zuerst vor der Stadtverordnetenversammlung zu den bis dahin vorliegenden Äußerungen Stellung bezogen hätte. Dies hätte m. E. der gewünschten Versachlichung gedient. Allerdings auch nur dann, wenn man den vollen Wortlaut des Statements dokumentiert hätte.
2) Ist es politisches Kalkül gewesen, dass der Bürgermeister seine Sicht der Dinge unter dem Tagesordnungspunkt „Informationen“ dargelegt hat? Wenn ich es recht sehe, ist unter diesem Tagesordnungspunkt keine Aussprache vorgesehen, so dass die Debatte in die politischen Diskussionen dieses Frühjahr verschoben wird.
3) Aus den in den Medien dokumentierten Äußerungen geht immer noch nicht hervor, warum genau die Stelle der Archivleitung bereits im Stellenplan 2023 mit „kw“ versehen wurde. Wie der Bürgermeister selber angibt, tritt der Stadtarchivar erst Ende Juni 2024 in den mehr als verdienten Ruhestand. Ist es ein haushalterischer Trick, um die im Januar 2023 besetzte Stelle der Museumsleitung zu kompensieren?
4) Der Bürgermeister betont, dass der Stadtarchivar die Museumssammlung der Stadt zumindestens bis zum Januar 2023 betreut habe und dass die Betreuung nun wegfalle. Dies ist mehr als verständlich.
Aber: warum bleibt die personelle Untersützung, die der Stadtarchivar für die Erledigung dieser Aufgabe hatte unerwähnt. So entsteht für mich entgegen dem Wunsch zur Versachlichung ein falscher Eindruck.
5) Der Bürgermeister betont, dass die Erstellung der auch von ihm gelobten Stadtgeschichte viel Arbeitszeit des Stadtarchivaren gebunden habe und bis zur Vorlage des letzten Bandes auch noch bindet. Wer hat diese Stadtgeschichte in Auftrag gegeben?
War dem Auftraggeber nicht nicht bewusst, dass dieses Vorgehen dazu führt, dass die archivischen Tätigkeiten auf das Mindestmaß beschränkt werden müssen, um das Projekt zu einem guten Ende zu bringen?
Ob diese Fragen in den stehenden politischen Diskussionen beantwortet werden?
Eine herzerwärende Geschichte. Gefunden habe ich sie im Kontext zu dem Experiment, die Enstehungsgeschichte der vhs Siegen-Wittgenstein durch KI, in der Realisation durch Chat-GPT, zusammenfassen zu lassen. Das kann die Software irritierend gut, leider ohne Quellenangaben. Die Validität zu prüfen bleibt Angelegenheit der Benutzenden und – diese Geschichte hatte KI nicht entdeckt. Das finde ich liebenswert. Greifbares Wissen entsteht eben durch menschliche Forschung – und durch Archive, die dies möglich machen.
Liebe Grüße an meine Vorkommentatoren und an den Archivar!
Na, ja…………….irgendwie muß die Stadt ja, wie alle anderen auch, Kosten
einsparen um die Flut der Asylanten bezahlen zu können! Da bleiben die
kulturellen Bedürfnisse der „schon länger hier lebenden“ halt auf der Strecke!
Ein Schelm, der dabei Böses denkt…………………..
Danke für den Kommentar! Man macht es sich m. E. allerdings zu einfach den erhöhten Kostendruck auf die Kommunen lediglich mit der Aufnahme von Asylsuchenden zu begründen. So führen z. B. soziale oder bildungsbedingten Bedürfnisse „schon länger hier lebenden“ ebenfalls zu Mehrkosten.
Dank für einen solchen „Kommentar“? Wer Einsparungen im Kulturbereich ausschließlich mit einer „Flut der Asylanten“ begründet, verrät aus welcher – rechten – Ecke er kommt. Und obendrein verstecken sich diese einfach gewebten Geister auch noch hinter Pseudo-Namen!
Ach du Schei…..
Schon wieder so ein links-grün indoktrinierter
Gutmensch, der blind für die Realität ist!
Aber keine Sorge! Die Realität kommt schon
noch zu Ihnen…………………
Brat Pit hat schon recht! Täglich sieht, liest und
hört man in allen Medien von der katastrophalen
Lage in den Kommunen. Wo leben, Sie um das
zu ignorieren? Sie sind in der Tat ein Realitätsverweiger aller ersten Ranges! Die finanzielle Belastung der Kommunen durch die
Unterbringung, Verpflegung und medizinischen
Versorgung der Flüchtlinge steigt ins Unermeßliche. Die Verwaltungen der Kommunen sind restlos überfordert. SIE verleugen das und packen die „Nazikeule“ aus.
(Nur mal so: Diese „Keule“ hat schon längst ihre Wirkung verloren und wird in dem allergrößten Teil der Bevölkerung nur noch mit
einem mitleidigen Lächeln quittiert). Jeder, der mal die Wahrheit anspricht, wird wohl von Ihnen gleich in die rechte Ecke gestellt, was?
Offensichtlich wohnen Sie nicht nur in einem
„hohlen Weg“.
Bitte keine off topic Kommentare mehr! Ansonsten wird die Kommentarmöglichkeit für diesen Eintrag zurückgenommen!
@archivar: Das ist ja schon erstaunlich! Da wird meine angebliche Wohnstraße zusammen mit einem gewissen Bedrohungspotential („Ludewich“) vom Administrator unkommentiert auf dieser Seite veröffentlich, und ich soll jetzt schweigen. Da nehme ich mir doch die Freiheit heraus, noch einmal ganz freundlich zu antworten!
@Sonja Kellermann: Liebe Sonja! Mit dem Recherchieren ist das so eine Sache. Da machst Du Dir solch eine Mühe, nimmst sogar ein Telefonbuch in die Hand, schlägst auch noch beim richtigen Buchstaben auf und landest doch nicht nur im „hohlen Weg“, sondern auch noch auf dem Holzweg. Dumm gelaufen! Da nun der „archivar“ keine „off topic Kommentare“ mehr wünscht, schlage ich vor, dass Du mir Deine Adresse zukommen lässt, damit wir unseren Gedankenaustausch fernab der Öffentlichkeit fortsetzen können. Oder ging es Dir vor allem um den Beifall einer bestimmten Öffentlichkeit? Bis bald. Viele Grüße aus …
Ludwig Burwitz
Am 4.3.23 erschien im Sauerlandkurier der folgende Leserbrief „Von archivarischen Aufgaben ist jedoch keine Rede“:
„Die Verfasser dieses Leserbriefes gehören zu den Autoren des „Offenen Briefes“, in dem gegen die Streichung der hauptamtlichen Archivarstelle in Olpe Position bezogen wird, und sie äußern sich zu den Ausführungen des Olper Bürgermeisters im „Sauerlandkurier“ wie folgt:
1. Bürgermeister Peter Weber geht nicht auf die vorgetragenen Argumente des „Offenen Briefes“ vom 23.1.2023 ein, der in 19 Punkten die Aufgaben des Stadtarchivars thematisiert.
2. Der Bürgermeister begründet nicht den im Haushaltsplan vermerkten Fortfall der hauptamtlichen Archivarstelle.
3. Museums und Archivstelle sind bezüglich Ausbidung, Tätigkeit und wachsenden Anforderungen nicht austauschbar(ebensowenig wie ein Bäcker und ein Metzger, nur weil sie beide mit Lebensmitteln zu tun haben). Beide Bereiche, Archiv und Museum, benötigen entsprechend ausgebildete Fachleute, die sich nicht ersetzen, wohl aber ergänzen können.
Zu den geplanten Tätigkeiten des neunen Museumsleiters ist die Pressemitteilung der Stadt Olpe vom 13.12.2022 aussagekräftig: „Abgesehen von den mit der Museumsentwicklung verbundenen administrativen Tätigkeiten, liegt ein Schwerpunkt von Sebastian Luke als Leiter des Stadtmuseums auf der Zusammenarbeit und Netzwerkpflege mit unterschiedlichen Zielgruppen, z. B. Verbänden, Schulen, Vereinen sowie regionalen und überregionalen Institutionen. Nach Fertigstellung des Museums gilt es, neben der fachlichenn und organisatorischen Führung, Ausstellungen und Veranstaltungen zu organisieren sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung des Museums zu gestalten.“
Das ist ein umfangreiches Aufgabenspektrum, zu dem wir dem Museumsleiter von Herzengutes Gelingen wünschen. Von archivarischen Aufgaben ist in der Presseinformation jedoch keine Rede – abgesehen davon, dass die von Förderverein und Stadtarchiv über viele Jahre aufgebaute Sammlung für ein Stadtmuseum übernommen werden soll..
– Wer also wird die akten der Stadtverwaltung, analoge und zunehmend digitale ,übernehmen, verzeichnen und sichern?
– Wer wird die öffentliche digitale Bereitstellung (Olpe digital) vorantreiben?
– Wer kümmert sich um die Ensäuerung gefährdeter Archivalien?
– Wer ist Ansprechpartner für Vereine und Privatpersonen, die dem Archiv Sammlungen und Nachlässe übergeben wollen, um sie für die Stadtgeschichte zu sichern?
– Wer unterstützt Schüler, Schülerinnen und Studierende bei ihren Facharbeiten, hilft ihnen beim Suchen, Finden und Sichten passender Quellen und vor allem beim Lesen der historischen Schriften?
– Wer unterstützt und motiviert die vielen ehrenamtlich arbeitenden Heimatforscher und Familienforscher?
– Und wer schreibt die Geschichte der Stadt Olpe fort, wie es bisher im Jahrbuch des Heimatvereins für Olpe und Umgebung e. V. geschah?
Um diese Aufgaben zu klären und die Notwendigkeit ihrer Fortführung zu erkennen, müssen nicht“viele Gespräche geführt werden“ (BM Weber), sondern es reichen eine Führung des jetzigen Archivars durch das Stadtarchiv Olpeund ein Gespräch mit dem LWL-Archivamt in Münster.
Dr. Roswitha Kirsch-Stracke, Wenden
Dr. Hans-Bodo Thieme, Olpe“
@alle Gleichgültig wie schlagend die Argumente bezüglich des Rückzugs der Stadt Bad Laasphe aus der Unterstützung des Radio-Museums auch sein mögen, bitte ich darum, von persönlichen (Vor-)Verurteilungen oder Angriffen abzusehen. Ansonsten droht die Löschung von entsprechenden Kommentaren.
s.a. Klaus Dietermann: Kriegsbeginn – 1939 in Stadt und Kreis Siegen. Dokumentation 6, Siegen 1988, S. 16, 22, 32, 33, 39, 41
2 weitere Irle-Funde:
aus: Sonderbeilage „Von der Idee zur Erfüllung“ der Siegerländer Nationalzeitung v. 30. Januar 1939
zitiert nach: Klaus Dietermann: Kriegsbeginn – 1939 in Stadt und Kreis Siegen. Dokumentation 6, Siegen 1988, S. 8
– „…. Eine weitere große Feierstunde („Tag der Wehrmacht“) führte die NSDAP eine Woche nach dem „Heldengedenktag“ im Apollo-Kino durch. Sie wurde von den beiden Pädagogen Fritz Fromme (Neunkirchen) und Dr. Lothar Irle durchgeführt, die „sich in vorbildlicher Weise ergänzten“….“
aus: Klaus Dietermann: Kriegsbeginn – 1939 in Stadt und Kreis Siegen. Dokumentation 6, Siegen 1988, S. 18:
Nationalzeitung vom 20. März 1939 (s. Bildergalerie oben)
Iserlohner Kreisblatt 23. März 1939 (s. Bildergalerie oben)
Folgende Veröffentlichungen von bzw. zu Oscar Robert Achenbach konnten in der Siegener Zeitung aufgefunden werden:
– „Der erste Schnee“, Jg. 79 (1901), Nr. 299
– „Das Glück auf der Walze“, Novelle, Jg. 80 (1902) Nr. 41, 42, 43, 44 Beilage 45, 46, 47 Beilage, 48
– „In letzter Stunde!“ Novellette, Jg. 80 (1902), Nr. 188 Beilage, 189
– „Der Siegener Dichter Oscar Robert Achenbach in München“ [darin sein Schauspiel „Schlagende Wetter“], Jg. 99 (1921), Nr. 83 vom 11. April
– Das Volk, 28. Mai 1908:
Oscar Ludwig Bernhard Wolff: Encyclopädie der deutschen Nationalliteratur oder biographisch-kritisches Lexicon von deutschen Dichtern und Prosaisten seit den frühesten Zeiten nebst Proben aus ihren Werken, Band 7 Schmauss bis Z, Leipzig, 1842, S. 137:
Es geht also weiter im Thema Straßenumbenennung in Siegen. Die Biografien zu verschiedenen Personen sind präzisiert (z.B. Porsche) oder erstmals (z.B. von Luckner) vorgelegt worden. Zu Porsche wie zu Luckner wird auf das Gutachten der Düsseldorfer Kommission durch einen Link Bezug genommen. Dazu eine Frage: Wie kann sich die Siegener Kommission auf das Düsseldorfer Gutachten beziehen, wenn Luckner in diesem Gutachten gar nicht erwähnt wird. Da scheint in der Belegführung etwas durcheinander geraten zu sein. Lässt sich das schnell nachbessern?
@archivar, genau auf S. 34-35. Dort wird aus der Akte des Bundesarchivs, wo der Vorgang seinen Niederschlag gefunden hat, ausführlich zitiert.
Aber es kann ja nicht unsere Aufgabe sein, derartige Belegstellen richtigzustellen. Aber wenn es denn so wäre, dann müssten wir hier den Text erneut einfügen und richtig zitieren: Zitat im Zitat, Fußnote.
Da es sich um das Hallenser Gutachten handelte, habe ich hier die Fußnote entsprechend geändert. Der Rest liegt in der Zuständigkeit des Arbeitskreises, der dies hier sicher wahrgenommen hat.
In der gestrigen Aktuellen Stunde des Westfälischen Archivtages wurde unter Punkt 2 „Novellierung ArchivG NRW / Kulturgesetzbuch“ von Prof. Dr. Marcus Stumpf folgendes berichtet:
„Was die Novellierung des Archivgesetzes angeht, kann noch kein festes Datum genannt werde. Dass dies allerdings hinfällig ist, aufgrund der Erneuerung der Datenschutzverordnung, ist unangefochten.
Um Überlegungen anzustellen, wie es weiter geht, wurde seitens des Ministeriums bereits eine Arbeitsgruppe gebildet. In dieser wirken auch [Mark] Steinert [LVR-AFZ] und [Eric] Steinhauer [und das Landesarchiv NRW] mit, allerdings gibt es auch dort noch keine endgültigen Entscheidungen.
-wie geht es weiter: ….: Überlegung: [die wegen der EU-DsGVO notwendig gewordene] Derogation aus zunehmen [und über das LDSG zu regeln].“
Quelle: https://archivamt.hypotheses.org/19859
Anm.: Die archivischen Arbeitsgemeinschaften der nordrhein-westfälischen , kommunalen Spitzenverbände haben Anfang des Monats ihre Änderungswünsche dem Ministerium gegenüber formuliert.
In der heutigen Sitzung sprachen sich die Vertreter von AfD und CDU für die Beibehaltung der nach Ferdinand Porsche und Carl Diem benannten Straßen aus. SPD, FDP und Volt folgten der Stellungnahme des Arbeitskreises. Die CDU-Fraktion beantragte die Graf-Luckner-Str. in Edith-Langner-Str. umzubenennen. Eine Aussprache erfolgte nicht.
Die Einordnung von Adolf Wagner in Kategorie B erfolgte mehrheitlich bei 9 Enthaltungen, ebenso wie die Umbenennung der Diem- und Porschestr. Überraschenderweise erfolgte ebenfalls mehrheitlich die Umbenennung der Graf-Luckner-Str. in Edith-Langner-Str., ohne den eigentlich zuständigen Kulturausschuss zu beteiligen bzw. ohne Expertise des Arbeitskreises.
Warum die Expertise durch den Arbeitskreis im Falle von Edith Langner wünschenswert gewesen wäre? Soweit mir bekannt ist, hat die federführend beantragende CDU-Fraktion keine biographische Ausarbeitung zu Edith Langner vorgelegt. Dass eine historisch-biographische Studie noch aussteht, zeigt der Eintrag auf siwiarchiv zu Edith Langner, der sich seit dem Ratsbeschluss schon um einige Aspekte geändert hat: https://www.siwiarchiv.de/edith-langner-eine-kandidatin-fuer-eine-strassenbenennung-in-siegen/#comment-128568 . Ändern die dortigen Funde die Einschätzung von Edith Langner? Nach gegenwärtigem Kenntnisstand eher nicht. Aber wer weiß?
– „Langner, Erich, * 27.12.1911 Murow bei Oppeln, Vater: Hermann L. Postassistent, Mutter: Emma Gerstenberger, Gymn. Strehlen, Uni Bsl Ord. 2.12.1938 Bsl d. D. Zänker, Pfarrvik. in Dittmannsdorf/FMÜ. 1.9.1942 Grünhartau (z. Zt. im Wehrdienst). Vermißt 27.6.1944 bei Bobruisk. verh. 9.10.1938 in Rothbach Krs Bsl Edith Diebitz, 23.1.1913, lebt um 1953/1984 in Siegen/Westfalen (Vater Hermann D. Gendarmeriemeister, Mutter Elsbeth Hoedt) K.: Hans Wilfried, *9.2.1940 Berufsoffizier, 9.2.1940 Dolmetscher“
[Lit: A 1942, 99,Dehmel, ord. Nr. 465, Silesia sacra 1953, 55.321, H-Blatt Strehlen-Ohlau 1984 Nr. 1, S. 27]
aus: Dietmar Neß: Schlesisches Pfarrerbuch: Dritter Band: Regierungsbezirk Breslau, Teil III, Leipzig 2014, S. 212
Im Bundesarchiv Bayreuth (Lastenausgleichsarchiv) findet sich eine Akte zum Vater Edith Langners, die im Siegener Ausgleichsamt erstellt wurde und ggf. Auskünfte über die Lebensverhältnisse Edith Langners für die Zeit, in der sie bei Ihren Eltern lebte, zulässt:
ZLA 1/15742781 Diebitz, Hermann (Geburtsdatum: 28.11.1885) als unmittelbar Geschädigter an Grundvermögen in Rothbach (Kreis Breslau)1952 – 2014
Am 24.3.23 erschien in der Siegener Zeitung der Artikel „So geht Burbach mit belasteten Straßennamen um“. Anlass sind die in Burbach vorhandene Stöckerstraße, die Friedrich-Flick-Straße, die Graf-Luckner-Straße und die Hindenburgstraße.
Heute erschien in der Siegener Zeitung der Leserbrief „Ergänzen statt Entfernen“ einer Burbacher Bürgerin, die sich .u. mit der Umbenennung der Lothar-Irle-Str. und der Graf-Luckner-Str. auseinandersetzt.
Heute erschienen in der Siegener Zeitung 2 Leserbriefe, die auf diesen Leserbrief Bezug nehmen. Während die „Beste Idee“ ausdrücklich das Anbringen von Erklärschildern mit QR-Codes begrüßt,lehnt „Nicht geeignet“ diese unter besonderem Hinweis auf Graf Luckner ab.
Aus dem Protokoll der Sitzung des Rates der Gemeinde Burbach vom 2. Mai 2023: “ ….. Bürgermeister Ewers schlägt vor, zunächst mit den Fraktionsvorsitzenden über den
Umgang mit den Namen der Straßen zu sprechen, die nach Personen benannt sind, die für antisemitisches Gedankengut bekannt sind (Stöcker-, Friedrich-Flick-, Graf Luckner-
und Hindenburgstraße). Dabei soll die weitere Vorgehensweise abgestimmt werden …“
Die FDP hat zur heutigen Kulturausschusssitzung einen Änderungsantrag vorgelegt:
– Die Hindenburgstraße soll in Straße des Grundgesetzes umbenennt werden
– die Hindenburgbrücke in Luba-Brücke nach Luba Budischewsla
Der Bürgermeister informiert auf youtube: Aktuelles aus dem Rat der Stadt Siegen | Sitzung vom 22. März 2023:
– ab 00:55 Stellungnahme des Arbeitskreises „Aufarbeitung der historischen Hintergründe von Straßennamen“ zu Adolf-Wagner-Straße, Diemstraße, Porschestraße und Graf-Luckner-Straße
In der gestrigen Kulturausschusssitzung wurde folgendes Vorgehen festgelegt:
Sämtliche Anträge auf Umbenennung müssen :
1. in den Bezirksausschüssen, dann
2. im Kulturausschuss und schließlich
3. im Haupt- und Finanzausschuss (im Dezember)
behandelt werden.
Eine Beschleunigung des Verfahres mittels einer Ratsentscheidung – vgl. Luckner/Langner – fand keine Mehrheit.
So besteht genügend Zeit um über den Antrag der FDP („Straße des Grundgesetzes“/Luba-Brücke) und über die Bitte des TV Jahn, die Diemstraße nach Hermann Diem umzuwidmen, zu beraten.
Siegener Zeitung und Westfälische Rundschau berichten heute leider nur hinter der Bezahlschranke über die Kulturausschusssitzung. Dennoch wird auf Facebook kommentiert.
Am 29. März erschien in der Olper Westfalenpost folgender Artikel „Archivarstelle: Wegfall sorgt in Hagen für Kritik. Bei Treffen diskutieren die Fachleute aus der Region über Olper Reizthema“: „Der 74. Westfälische Archivtag fand jetzt in Hagen statt, zu dem 280 Fachleute, Archivare, Historiker und Kulturschaffende aus Westfalen und ganz Deutschland angereit warten. Dabei wurde im Plenum auch über die derzeitige Situation im Olper Stadtarchiv berichtet. …. Diese Aussicht auf die Verschlechterung der Archivsituation in der Kreisstadt stieß bei den Fachleuten in Hagen auf massive Kritik, sorgte zudem auch für allgemeines Kopfschütteln und völliges Unverständnis.
Der für das Olper Stadtarchiv zuständige Referent im Münsteraner Archivamt, Dr. Gunnar Teske,berichtete: „Durch das Beispiel der voraussichtlichen Streichung der Leiterstelle des Stadtarchivs Olpe wird die angespannte Personalsituation nochmal deutlich. Von verschiedenen Seiten wurde die NAchbesetzung, unter anderen in offenen Briefen gefordert. Allerdings sieht der olper Bürgermeister die Zukunft eher im Stadtmuseum. Die Leistungen des Archivs können so jedoch nicht ersetzt werden. …. Dr. Teske äußerte sich anerkennend darüber, dass die Kritik amm „Künftig-wegfallend“-Vermerk der Stadtarchivarstelle aus Kreisen der Olper Historiker und Heimatvereine gekommen war, die immerhin einen massiven Qualitätsverlust vor Augen hätten.“
In der heutigen Siegener Zeitung erschien der Artikel „Archivare nicht nur in der Region besorgt. Warum die Causa „Stadtarchiv“ nach wie vor auf den Tagesordnungen steht. Die Debatte geht weiter. Trotz der Erklärung des Bürgermeisters im Februar im Rat wird weiterhin öffentlich und gerade in der Fachszene über das Olper Stadtarchiv diskutiert“
Artikel-Funde zu Fissmer in der Siegener Zeitung:
– „Bürgermeister Fißmer“, 7. Mai 1919
– „Die Vorstände der der Aufsichts des Magistratsunterstellten Innungen von Bürgermeister Fissmer zu einer Besprechung eingeladen“, 26. Juli 1920
– „Das Preussische Staatsministerium hat genehmigt, dass dem Ersten Bürgermeister der Stadt Siegen, Fissmer, die Amtsbezeichnung „Oberbürgermeister“ beigelegt wird“, 22. März 1922
– „Vor der Oberbürgermeisterwahl“, 7. Februar 1931
– „Das preußische Staatsministerium hat die erfolgte Wiederwahl von Oberbürgermeister Fißmer auf fernere 12 Jahre bestätigt“, 2. April 1931
– „Oberbürgermeister Fißmer in den Vorstand des Preußischen Städtetages gewählt“, 9. Juli 1932
– „Der Reichsminister des Innern hat Oberürgermeister Fißmer in den Ausschuß für das gemeindliche Kreditwesen berufen“, 26. Mai 1934
– „Drei Jahre nationalsozialistische Kommunalpolitik. Oberbürgermeister … vor der Ortsgruppe Hain“, 28. März 1936
2 Artikel-Funde zu J[akob?] Henrich in der Siegener Zeitung:
– „Wiege – Ade!“, 20. März 1940
– „Wenn ein Siegerländer hochdeutsch redet“, 13. April 1940
Gestern erschien in der Siegener Zeitung leider nur im Print – der Artikel „Straßennamen: Umbenennung könnte doch früher erfolgen“. Städtischerseits beabsichtigt man die Beratung in den Bezirksausschüssen durch Sondersitzungen vorzuziehen.
In der kommenden Wochen stehen die Straßenumbenennungen auf den Tagesordnungen des Bezirksausschgussen Siegen-Eiserfeld (24.4.) und Siegen-Mitte (27.4.)
Schon im Blogeintrag hatte ich auf die im Landesarchiv NRW in Duisburg vermutete Ordensakte hingewiesen und bin die Signatur zunächst schuldig geblieben. Da nun eine Straße in Siegen nach Edith Langner benannt werden soll, habe ich dort nachgefragt und erhielt dankenswerterweise folgende Angaben: NW O (Ordensakte) Nr. 21262
Name: Langner
Vorname: Edith
Geburtsdatum: 23.1.1913
Amt / Beruf: Hausfrau und Landtagsmitglied
Laufzeit: 19.12.1972-08.10.1973
Umfang: 36 Seiten
NW 1110 Nr. 2399
Aktenart: Entnazifizierungsakte
Name: Langner
Vorname: Edith
Geburtsdatum: 23.01.1913
Amt / Beruf: Kindergaertnerin
s. a. Siegener Zeitung, 23. Juli 1973, Leserbrief: „Eiserfeld sträubte sich gegen Mudersbacher Kinder“ [Stichwort: Gymnasium auf der Morgenröte]:
“ … 2. Warum stellen die SPD-Politiker Maurer, Sonneborn und Forster es fast als ihr Verdienst heraus, wenn endlich der Kultusminister Girgensohn sie zum 18. Juli 1973 nach Düsseldorf berufen hat, um ihnen die Aufnahme Brachbacher und Mudersbacher Schüler nahezulegen? Die Düsseldorfer Entscheidung war Eingeweihten schon längere Zeit vorher bekannt. Der Bundestagsabgeordnete Prinz Wittgenstein hatte von Minister Girgensohn eine klare Zusage für die Aufnahme der Kinder in Eiserfeld erhalten. Vorher hatte das Kultusministerium in Mainz, der Landtagsabgeordnete des Kreises Altenkirchen Paul Wingendorf, die Siegener Landtagsabgeordnete Edith Langner (mit ihren Fraktionskollegen Heinrich Köppler und Alfred Pürsten) lange genug und mit dem nötigen Nachdruck Eiserfeld und Düsseldorf auf die Unsinnigkeit und Ungerechtigkeit von Stadtdirektor Sonneborns hingewiesen. … Hat doch gerade Frau Langner durch ihre Erkundungen „vor Ort“ in Eiserfeld Lösungsmöglichkeiten herausgefunden und nach Düsseldorf weitergegeben. ….“
Guten Tag,
kann der ORIGINAL-Stummfilm (90 min. Dauer) über die Schacholympiade in Siegen 1970 (Nr. 4.1.5 / 164 im Archiv des Kreises Siegen-Wittgenstein) irgenwo angesehen werden ?
Gehörte Bode zum Umfeld von G.C. Kichtenberg. Ein Hinweis auf die Weggefährten Lichtenbergs auf der Seite der Lichtenberg-Gesellschaft lässt die Vermutung zu:
“ …. Im einzelnen können hier genannt werden (* = keine Korrespondenz überliefert):
die Teilnehmer an der herzlich-lärmenden Göttinger Runde, die sich im Haus seines Freundes und Vermieters Johann Christian Dieterich trafen und die außer diesem selbst v. a. aus Hofmeistern [z. B. Heinrich Christian Boie (1744 – 1806), Ferdinand August Bode[n](*) (1733? – 1812) und Johann Friedrich Gervinus(*) (1744? – 1826)] nebst ihren Zöglingen (englischen und anderen wohlhabenden Studenten) sowie dem Universitäts-Zeichenmeister Joel Paul Kaltenhofer (1716? – 1777) bestand; ….“
Die Vermutung wird erhärtet durch die Verbindung Lichtenbergs zu Christian Heinrich zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg.
s. a. Lichtenberg Briefwechsel Bd. 5: Register: Personen- und Sachregister, München 2004, S. 860.
Aus der Einleitung von Lothar Irles „Heiteres aus dem Siegerland“, 5. Auflage, Siegen 1967, S. 11-13:
“ …. Herbert Schöffler schrieb: „Humor ist bluts- und raumgebunden wie Sprache und Dialekt.“ ….. Es ist aber ein Zeichen für noch vorhandenen Gemeinschaftssinn, wie er sich auch in andersartigen Volksgut darstellt. Wo noch das Brauchtum eines Dorfes lebt, da stellt sich jeder außerhalb der Gemeinschaft, der sich nicht an der Ausübung der Bräuche beteiligt. Wer in einem Trachtendorf städtische Modekleidung trägt, begibt sich automatisch geistig aus dem Kreis der Dorfbewohner. Wer als in dem Dorf Geborener die Mundart des Ortes nicht mehr spricht, richtet eine kalte Wand zwischen sich und der Heimat auf. Die Gemeinschaft verlangt eine Anpassung an ihre Normen. Wer auch nur gering von diesen Normen abweicht, fällt dem Spott oder der Verachtung der anderen anheim. …. Zum Volkstum findet man keinen Weg, wenn man den Derbheiten ausweichen will, die in einer verkrampften Gesellschaftsordnung voll Unechtheit gesellschaftsunfähig geworden sind, während sie im unverbildeten Volke noch leben. Aus dieser Divergenz zwischen dem Drastischen derer, die sich bewußt gegen Überfeinerung wenden, und derer, die sich unbewußt solcher Begriffe bedienen, die nicht mehr allgemein gebräuchlich sind, auf der einen und anderer, die sich etepetete und modisch benehmen, auf der anderen Seite entstehtmanche Situation, die vom Volke belacht wird und in seinem Anekdotenschatz haften bleibt. …..“
– Landesarchiv Berlin A Pr.Br.Rep. 042-01 (Preußische Bau- und Finanzdirektion) Nr. 1733, Personalakte des Herrn Landrat im Kreis Wittgenstein Karl von Rumohr (* 27.12.1900, † 08.08.1967), 1934, Enthält nur: Übertragung des Landratsamts im Kreis Wittgenstein zum 01. April 1934
ich habe mit viel Freude und Lernerfolg die beiden eLearning Kurse „Bestandspflege“ und „Notfallversorgung“ absolviert. Durch beide Kurse habe ich einen tollen Einblick erhalten und viel neues gelernt. Vielen Dank für das tolle Angebot!
Gibt es eine Möglichkeit ein Teilnehmer-Zertifikat oder ähnliches zu erhalten? Oder können Sie mich an die richtige Stelle für mein Anliegen weiterleiten?
Vielen Dank im Voraus. Ich freue mich von ihnen zu hören und wünsche noch eine angenehme Restwoche!
Wolfgang Meyer „Der Weg zu den „Grauen Wölfen“. Friseur und U-Boot-Held Willy Meyer“, {Weyhe/Bremen] 2. Auflage 2022, weist auf die handgeschriebne 14-seitige Broschüre „Gestalten, die durchs Lager schlichen. Heitere Satiren“ von Lothar Irle hin. Sie entstand 1947 in Fallingbostel und enthält 8 Gedichten mit Beschreibungen des Lagerlebens.
…
Rita Morgenschweis war eine Arbeitskollegin von mir. Sie arbeitete nicht im Straßenbauamt der Stadt Siegen sondern im Landesstraßenbauamt von Straßen NRW an der Koblenzer Straße 76. Das Gebäude wurde aufgrund vom Schimmelbefall im Jahre 2012 geschlossen.
Zu Willi Busch s. a.:
– Kreppke, Hans Joachim: „Eine solche Fülle an begnadeten Künstlern . . . “
Bochum und die Brüder Busch – Eine Spurensuche“, in: Bochumer Zeitpunkte. Beiträge zur Stadtgeschichte, Heimatkunde und Denkmalpflege, Nr. 26 (1993), S. 25 – 49, Link: https://www.kortumgesellschaft.de/tl_files/kortumgesellschaft/content/download-ocr/zeitpunkte/Zeitpunkte-26-2011OCR.pdf
– Bundesarchiv Berlin,
R 9361-V/ (Sammlung Berlin Document Center (BDC): Personenbezogene Unterlagen der Reichskulturkammer (RKK) ) 47651
R 9361-V/ (Sammlung Berlin Document Center (BDC): Personenbezogene Unterlagen der Reichskulturkammer (RKK) ) 140350
– Staatsbibliothek zu Berlin. Handschriftenabteilung ; Nachl. Gerhart Hauptmann ; Signatur: GH Br NL (ehem. AdK) B 1798, Telegramm von Willi Busch an Gerhart Hauptmann, 14.11.1914
1) Link zum Facebook-Post (FB) der Siegener Zeitung:
Fünf Straßen, die nach Antisemiten und Nazis benannt sind, sollen jetzt ihre neuen Bezeichnungen bekommen. Bei einer liegen mehrere Vorschläge vor.Gepostet von Siegener Zeitung am Freitag, 21. April 2023
Fünf Straßen und eine Brücke bekommen in Siegen neue Namen, damit Antisemiten und Kriegstreiber nicht weiter geehrt werden:Gepostet von Westfalenpost Siegen am Montag, 24. April 2023
Heute erschien in der Siegener Zeitung der Kommentar „Die Natur als Namensgeber?“. Neben Namen aus Flora und Fauna wird dort auch die Durchnummerierung von Straßen diskutiert.
Übrigens: Edith Langner war nicht die erste Frau im Siegener Stadtrat. Diese Ehre gebührt Hedwig Heinzerling.
Klaus Dietermann, der Gründer und langjährige Leiter des Aktiven Museums Südwestfalen, besuchte 1984 Hermann Giesler in Düsseldorf (die Westf. berichtete ausführlich). Dietermann brachte als Geschenk ein Siegerländer Schwarzbrot mit. Er gab sich nicht zu erkennen. Giesler habe ihm gesagt, dass er nach wie vor Nationalsozialist sei. H. Giesler hat ein umfangreiches Buch geschrieben: „Der andere Hitler“, das K. Dietermann besaß.
s. zu Henrich: Schiemer, Hansgeorg: 40 Jahre CDU für Siegerland und Wittgenstein (Schriftenreihe des CDU-Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein e.V. Nr.6), Siegen 1986, S. 48 [Vorsitz der CDU-Ortsgruppe Krombach], 108 [Bei der Reaktivierung des Evangelischen Arbeitskreises der CDU Beisitzer]
s. zu Henrich:
1) Arbeitsgemeinschaft Eiserner Vereine e.V. (Hrsg.): Festschrift 725 Jahre Eisern, Siegen 2014, S. 37-38:
“ ….. Anlässlich seines 90. Geburtstages bekommt Jakob Henrich, der „Bergfrieder“, die Ehrenbürgerrechte der Gemeinde Eisern verliehen. Er hat in seinen Erinnerungen die soziale Situation in Eisern reflektiert und ist als Publizist für die christlich-soziale Bewegung tätig.
Ende Februar 1957 wird ihm zu seinem 95 Geburtstag das Bundesverdienstkreuz 1 Klasse verliehen ….“
2) Lutz Hagestedt (Hrsg.): Deutsches Literatur-Lexikon. Das 20. Jahrhundert. Band 16: Heinemann – Henz, Berlin 2011, Sp. 537: mehrmals Abgeordneter der Provinzialsynode
Der Vortrag von Dieter Pfau über „Zeitspuren in Siegerland und Wittgenstein im preußischen 19. Jahrhundert“, eine Gemeinschaftsveranstaltung des Hilchenbacher Geschichtsvereins e.V. und der Volkshochschule des Kreises Siegen-Wittgenstein, findet nicht am 10. Mai 2023, sondern am Donnerstag, dem 11. Mai 2023, 18.30 Uhr, im Ratssaal des Rathauses Hilchenach statt.
Wie bekomme ich die Broschüre Dokumentation historischer Grenzsteine?
Ich bin Mitglied im LBC Banfetal e,.V. mit Skihütte auf dem Sohl. Die Hütte liegt direkt an der Grenze zwischen Hessen und NRW.. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich noch einige alte Grenzsteine.
Für ein Antwort bedankt sich
Gerda Hackler-Georg
Untere Mühlhelle 16
57334 Bad Laasphe
Zu ergänzen ist noch folgender Quellenfund:
Archiv des Ev. Kirchenkreises Siegen Nr. 902:
Unterstützung und Beschäftigung von Ostpfarrern und deren Familien, 1946-1952
In der Ordensakte im Landesarchiv NRW, Abt. Rheinland, in Duisburg (Signatur: NW O 2508) findet sich eine ausführliche Begründung für die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Jakob Henrich. Mit Datum vom 8. Februar 1957 sandte der Siegener Oberkreisdirektor Erich Moning diese an die Bezirksregierung in Arnsberg:
„Herr Henrich wird für die Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz (Ansteckkreuz) vorgeschlagen.
Herr Henrich war von 1879 bisa 1880 zunächst als Hauslehrer am Preuß. Forsthaus Kalteiche (Kr. Siegen) tätig, bis er vom 1.4.1880 bis 31.3. 1883 das Lehrerseminar in Hilchenbach besuchte. Am 1.4.1883 trat Herr Henrich seine erste Lehrerstellein Weidenau an, am 13.1.1888 erfolgte seine endgültige Anstellung. Ab dem 1.5.1889 wurde er an die Volksschule in Krombach versetzt, wo er bis zur Erreichung der Altersgrenze im Jahre 1927 als Lehrer, seit 1906 als Hauptlehrer wirkte.
Herr Henrich war in seiner aktiven Zeit nicht nur ein vorbildlicher Pädagoge, der stets engsten Konnex mit der Jugend hatte, den er sich übrigens bis zum heutigen Tage erhalten hat, sondern er war neben seinem Hauptamt auch ehrenamtlich tätig als Gemeindevertreter und als Mitglied des Kreistages des Landkreises Siegen. Auf kommunalen Sektortrat seine besondere Aktivität dadurch hervor, daß er der Gründer der Krombacher Ortsfeuerwehr ist, die ihn für die Treue zur Sache und die Verdienste, die er sich um diese Feuerwehr erworben hat, zum Ehrenmitglied ernannte. In gleicher Weise führte ihn seine Verantwortungsfreude in die Kreis- und Provinzialsynode der evang. Kirche, wo er viele Jahre als gewähltes Mitglied mitarbeitete. Auf derselben Ebene liegen seine Bemühungen um die Förderung des kirchlichen Vereinslebens und der Jugendarbeit auf kirchlicher Basis. Wie stark er mit diesen Dingen verbunden war, zeigt die Tatsache, daß er ein persönlicher Freund des Hofpredigers Stöcker war, der bei seinen Aufenthalten im Siegerland stets bei Herrn Henrich Gastfreundschaft genoß. Aus dieser geistigen Grundhaltung resultiert auch die Mitgliedschaft und aktive Mitwirkung im ehemaligen evangelischen Volksdienst und an der Zeitung dieser politischen Richtung, nämlich der Wochenzeitung „Das Volk“, die in Siegen herausgegeben wurde. Trotz dieser vielseitigen Beanspruchung hat sich Herr Henrich seit Jahrzehnten auch schriftstellerisch mit bestem Erfolg als Heimatdichterund auf heimatkundlichem Gebiet betätigt. Durch seine Verbundenheit mit der Jugend, mit dem kirchlichen Leben, mit den politischen Anliegen seines Heimatbezirkes, mit den kulturellen Belangen der Siegerländer Bevölkerung hat sich Herr Henrich tief im Bewußtsein der Siegerländer Bevölkerung verankert. Als Beweis dafür mag gelten, daß er im Volksmund als „Bergfrieder“ lebt und sein Ruf bereits beginnt, Legende zu werden.
Nach 1945 hat Herr Henrich trotz des hohen Alters aus der Erkenntnis, daß alle Kräfte für einen staatlichen, geistigen und sittlichen Wiederaufbau wieder eingesetzt werden müssen, die Konsequenz gezogen, indem er die Christl.-Demokratische Union im Siegerland mitbegründete und aufbauen half. Er ist nicht nur bis zum heutigen Tage der Vorsitzende der Ortsgruppe Krombach der CDU, die er tätig leitet, sondern der älteste Ortsgruppenvorsitzende der CDU in der Bundesrepublik Deutschland überhaupt. Er hat durch rastlosen Einsatz auf der politischen Ebene über den örtlichen Bereich hinaus ein nachahmenswertes Beispiel gegeben und so einen beachtlichen Beitrag zum demokratischen Aufbau der Heimat geleistet. Herr Henrich ist auch nach wie vorals politischer Schriftsteller tätig, wie seine in der Siegener Zeitung ständig veröffentlichten Beiträge dartun, wobei er seine Aufmerksamkeit der grundsätzlichen politischen Linie widmet und seine Auffassungen über das politische Geschehen in einer volksnahen, vielfach heimatkundlich gebundenen Weise an die Leser heranträgt.
Durch seine Arbeit auf heimatkundlichem Gebiet, der nach wie vor seine unermüdliche Schaffenskraft gilt, leistet er in gleicher Weise einen wertvollen Beitrag zu den kulturellen Aufgaben des Siegerlandes. Seine beiden nach 1945 erschienenen Bücher („Bergfrieders Erinnerungen“ /Wilhelm Schneider-Verlag in Siegen und „Stöckerzeit – Steinzeit im Littfetal“/ Vorländer-Velag in Siegen) legen Zeugnis ab von seiner ungebrochenen Schaffenskraft. Dazu gehört auch das aktive Mitwirken im Siegerländer Heimatverein. Daß das Wirken im Sinne des Hofpredigers Stöcker Herrn Henrich ein echtes Anliegen hinsichtlich der geistig sittlichen Grundlag unserer jungen Demokratie ist, beweist die Tatsache, daß er nach wie vor der Vorsitzende der Stöckergilde im Siegerland ist.
Herr Henrich ist mit fast 95 Jahren noch von einer erstaunlichen körperlichen Frische und geistigen Lebendigkeit.“
Am 27. Februar 1957 erfolgte daraufhin die Verleihung durch den 1. Kreisdeputierten Joseph Büttner.
Arbeite an Lebenslauf von P. Alfred Delp SJ. Karl Neuhaus hatte ihn gefoltert. Beim Prozess gegen K.N. 1953 in Siegen wurde P. Delp Verletzung des Beichtgeheimnisses während der Aussageerpressung verleumderisch nachgesagt.
Wer weiß davon mehr. Herrn Rudolf Heider, der wohl ein Foto von K.N.hat, konnte ich nicht finden. Ebenso Hubertus Picard.
Der Bezirkausschuss Ost beschloss in der Sitzung die Umbenennung der Lothar-Irle-Str. einstimmig bei einer Enthaltung durch die CDU. (Quelle: Beschluss)
Die „Verteidigung“ Stoeckers durch Ernst Bach findet sich bereits in desssen Schrift „Adolf Stöcker – ein Prophet und Vorkämpfer des Christlich-sozialen Volkdienstes“, Siegen 1931.
Am 30.5.2023 ist es so weit. Der Dorfplatz wird fortan den Namen Gerhard-Stötzel-Platz tragen. Ebenso wird dort eine Gedenktafel ihm zu Ehren verankert. Schön, dass die Anregung der Bürger und Bürgerinnen so umgesetzt wurde von der Stadt Netphen. :)
Hallo, wir suchen das Buch „Hexenwahn im Wildenburger Land“.Leider blieb die Suche bis jetzt erfolglos. Können Sie uns einen Tipp geben? Vielen Dank LG C.Eichert
Vielen Dank für die Veröffentlichung der Datei und die damit verbundene
historische Betrachtung der Baracke. Der Vollständigkeit halben
will ich zuerst auf zwei Artikel hinweisen die in der Siegener Zeitung
erschienen sind und sich mit der Baracke beschäftigen:
SZ vom 24.12.2022 „Wellblechbaracke kommt ins Museum“
SZ vom 22.5.2023 „Wellblech für die Ewigkeit“
In Bezug auf den Artikel vom 24.12.2022 ist zu berichtigen, das es sich nicht
um einen Neunkirchner Bürger, sondern um eine historische interessierte
Bürgerin handelte, der die Baracke im Sommer 2021 auffiel und welche sich dann gemeinsam mit der VVN-BdA an das Kreisarchiv SiWi wandte, von wo aus dann Kontakt zum LWL in Münster hergestellt wurde.
Der historische Blickwinkel, der zur Entdeckung führte war, kein auf die Architektur gerichteter, sondern darauf gerichtet, wer in der Zeit des Faschismus in solchen Baracken untergebracht war.
Leider ist in keinem der Artikel und der PDF Datei davon die Rede.
Es ist zu vermuten, dass in dieser Baracke Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter untergebracht waren. Eindeutig belegt sind für den Raum Neunkirchen mehrere Lager für Zwangsarbeiter und auch das diese in den Neunkirchner Betrieben und Gruben Zwangsarbeit leisten mussten.
Bisher fehlt ein eindeutiger Beweis für diese Nutzung der Baracke, widerlegt ist die Unterbringung von Zwangsarbeitern in ihr aber auch noch nicht!
Hoffentlich fließt dieser Aspekt zur Geschichte der Baracke in die weitere Forschung ein und findet im Museum Lindlar bei einer Gesamtdarstellung den entsprechenden Raum.
Im Dokument des Arolsen Archives ist unter dem Stichwort „LK Siegen“ auf Seite 6 für Neunkirchen dokumentiert, dass sich auf dem Werksgelände der Firma Capito ein Lager für Kriegsgefangene während des zweiten Weltkrieges befunden hat.
Es könnte sich dabei um diese Baracke gehandelt haben.
Herr Kamp vom Museum Lindlar rief im Artikel der Siegener Zeitung dazu auf, dass sich Personen, die Näheres zu der Geschichte der Baracke wissen, bei ihm melden sollten.
Vielleicht finden sich noch Zeitzeugen oder jemand erinnert sich an Berichte darüber.
Unter dem Stichwort „LK Siegen“ für Landkreis Siegen finden sich Hinweise zu Kriegsgefangenen aus allen Orten des Kreises.
Heute findet sich in der Print-Ausgabe der Siegener Zeitung ein Bericht über die Stellenausschreibung. Tenor ist, dass für die im kommenden Jahr stattfindende 800-Jahrfeier der Stadt keine Einscnränkungen erwartet werden, da die Stadt zur Unterstützung des Stadtarchivs, das eine einbändige Stadtgeschichte und eine Vortragsreihe zu verantworten hat, eine halbe Historikerstelle eingerichtet hat.
Auf dem Rheinischen Archivtag informierte der Leiter des LVR-Archiv- und Fortbildungszentrums, Dr. Mark Steinert, heute die Kolleg:innen über den aktuellen Sachstand:
“ …. Seit Verabschiedung der EU-DSGVO ist bis heute nichts passiert, um das Archivgesetz NRW zu novellieren, sodass es mit der DSGVO vereinbar ist. Im Oktober soll eine Arbeitsgruppe zusammenkommen, die die Weiterentwicklung des Archivgesetzes in Einklang mit dem Kulturgesetzbuch besprechen soll. Konkrete Lösungen gibt es noch nicht und in näherer Zukunft wird wahrscheinlich auch weiter nichts passieren, sodass die Integration der DSGVO in das Archivgesetz weiter auf sich warten lassen wird. Steinert bedauert sehr, dass er keine positiven Nachrichten bringen kann. Die Probleme für das Archivwesens in NRW sind massiv und dringend anzugehen.“, Link: https://lvrafz.hypotheses.org/7660
Eine Abbildung Brossoks findet sich in Müller, Otto (Hg.) 100 Jahre Landwirtschaftlicher Kreisverein Wittgenstein e. V, Eine Denkschrift im Auftrag des Vereins Laasphe 1932, Anhang S. 3.
S.a. Lilla, Joachim: Leitende Verwaltungsbeamte und Funktionsträger in Westfalen und Lippe (1918-1945/46), Münster 2004, S. 128, Link: https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/finde/langDatensatz.php?urlID=1174&url_tabelle=tab_person
Folgende Archivalien sollten zu Brossok eingesehen werden:
1) Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin
– I. HA Rep. 77, Nr. 7494 [Ministerium des Innern] Personendossiers und Materialsammlung, v. a. zu NS-Mitgliedern und -Amtsträgern sowie NS-Gegnern, Buchstabe Bo – Bu, (1930), 1933-1934
Enthält v. a.:
– Strafrechtliche Ermittlungen, Entlassungen, Personalangelegenheiten, positive und negative Personenbeurteilungen, Stellenbesetzungen, Stellengesuche, Unterstützungsgesuche, Versetzungen, Weiterleitung von Informationen,
– I. HA Rep. 125, Nr. 775, [ Ober-Examinationskommission bzw. Prüfungskommission für höhere Verwaltungsbeamte], Einzelne Prüfungen: Brossok, Eberhard, Regierungsreferendar, Breslau, 1920
2) Bundesarchiv
– Berlin: R 1501/128032 [Reichsministerium des Innern, Personalkarten von höheren Beamten]
– Bayreuth: OSTDOK 10/23, Eberhard Brossok, Dezernent: Die Verwaltungstätigkeit bei der Regierung Königsberg/Pr. von Juni 1936 bis Ende Jan. 1945 (betr. Volks-, Mittel-, Berufsschulen, Kirchensachen, Volksbüchereien), 1959
3) Archiv der Evangelischen Kirche im Rheinland
– 6HA 005 (Studiendirektor Hellmut Lauffs), 46, Entwicklung eines Schulgesetzes in NRW, 1950-1951 enthält u.a.: Zusammenfassung des Referats von Landesverwaltungsgerichtsrat Brossok über den Schulgesetzentwurf
4) Staatsbibliothek zu Berlin. Handschriftenabteilung
– Archiv des Verlages J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) ; Signatur: Nachl. 488, A 0520,2, Blatt 239-242, 12.06.1951-07.09.1951
– Archiv des Verlages J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) ; Signatur: Nachl. 488, A 0516,2, Blatt 288-295, 18.07.1950-08.09.1950
Schließlich sei auf die Auswertung der Medien hingewiesen – s. bspw. Wittgensteiner Kreisblatt, 31. März 1933:
Zwei weitere Artikel Landrat Brossok im Wittgensteiner Kreisblatt fanden sich bei der Suche in den Zeitungsfindmitteln des Wittgensteiner Heimatvereins :
07.06.1929 Neuer Landrat Brossok
11.04.1933 Landrat Brossok im einstweiligen Ruhestand
Februar 1936 – Mitwirkung – Erstellung der Siegerland-spezifischen Ausstellungsteile – an der Ausstellung „Rasse. Sippe.Siedlung“ des NSDAP-Gauschulungsamtes Westfalen Süd, Quelle: Siegener Zeitung National-Zeitung, 3.2.1936, https://zeitpunkt.nrw/ulbms/periodical/zoom/15716581
Korrektur der Quellenangabe: richtig ist
National Zeitung, Siegerländer Ausgabe.
leider liegt die Siegener Zeitung bis dahin noch nicht digital vor und ist damit auch nicht über zeitpunkt.nrw zugänglich.
In der Kreistagssitzung vom 2. Juni 1949 wurde Dr. Wilhelm Güthling zum ehren amtlichen Archivpfleger für den Landkreis Siegen gewählt – s. Protokollauszug:
Warum beschäftigte sich Hermann Böttger mit der Vorgeschichte:
Tecklenburger Landbote, 20. März 1934:
Nationalzeitung Wittgensteiner Ausgabe, 9. März 1935:
Weitere noch nicht ausgewertete Presseartikel zu Böttger:
– Siegener Zeitung vom 14. Juli 1944 „Ehrung verdienter Schulmänner“ (darin Hermann Böttger)
– Siegener Zeitung v. 9. Januar 1936 über einen Vortrag Böttgers über die Wüstungen des Siegerlandes
– Siegener Zeitung v. 19. Juni 1929 über den Vortrag „Grundsätzliches über Heimatmuseen und dessen Anwendung auf das Museum des Siegerlandes“
– Siegener Zeitung vom 24. März 1927 „Über die Geschichte der Besiedlung des Siegerlandes sprach St.-Rat Böttger im Kursus für wissenschaftliches Wandern“
– Siegener Zeitung v. 14. Oktober 1922 Studentische Selbsthilfeorganisationen [s. a. „Das Volk“, 13.10.1922]
– Siegener Zeitung vom 10. April 1922 „Siegerländer Hilfe für das Deutschtum in den Grenzmarken“ [Wirklich von Hermann Böttger?]
– Siegener Zeitung v. 6. und 10. Augsut 1921 „Der deutsche Beamtenbund im Schlepptau sozialdemokratischer Gewerkschaften“ [s. a. „Eingesandt“, in: Das Volk, 5.8.1921]
s. a. Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung – Archiv, Berlin, Gutachterstelle für deutsches Schul- und Studienwesen im Berliner Institut für Lehrerfort- und -weiterbildung und Schulentwicklung – Personalbögen der Lehrer höherer Schulen Preußens, GUT LEHRER (Personalunterlagen von Lehrkräften), 79227
Die hier seit Oktober vergangenen Jahres ermittelten Presseberichte belegen überdeutlich, dass eine gründliche Presseauswertung aussteht. 2 weitere Artikel geben Hinweise zum politischen Engagement Böttgers im Jahr der Reichspräsidentenwahl 1925:
– Das Volk, 23. März 1925:
– Wittgensteiner Kreisblatt, 17. April 1925:
In den Anzeigenteilen der regionalen Zeitungen fand sich neben hauswirtschaftlichen Stellenangeboten der Familie Böttger auch folgende Geburtsanzeige, die die hier eher spärlichen Angaben ergänzt:
– Wittgensteiner Kreisblatt, 1. Oktober 1924:
Gibt es eigentlich etwas Neues zur Situation in Olpe? Wohl eher nicht, wenn man diesen Bericht liest:
“ …. Mittlerweile gibt es in Olpe einige Reaktionen aus der Politik, so will die SPD die Archivstelle neu diskutieren und auch der Bürgermeister der Stadt Olpe drängte auf Beruhigung der aufgeregten Diskussion. In der letzten Sitzung verwies er auf den Termin des k.w.-Vermerkes, da er ja erst am 30.06.2024 zum Tragen komme. Bis dahin habe der Rat Zeit, um über den Stellenplan zu diskutieren. Man nehme die Kritik schon sehr ernst und wolle überprüfen, in welchem Umfang die Stelle neu besetzt werden soll. ….“
Es ist ja zunächst nur eine Vorstudie entstanden. Auf der Universitäts-Seite von Heiner Stahl findet sich folgende Literautr zum Thema:
– Stahl, Heiner: Flavours of frozen ice cream around 1800. Gustatory knowledge, courtly pastry craft and cookbooks, in: Christina Bartz/Jens Ruchatz/Eva Wattolik (eds.): Food-Media-Senses, Bielefeld: transcript, 2023. [Im Druck]
– Stahl, Heiner: Eisgenuss und Hupgeräusche. Sinneswissen und -praktiken in städtischen Raumordnungen (1900-1930), in: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften (OeZG) (Ellinor Forster/Regina Thumser-Wöhs (Hg.)),Sinnesräume, 33. Jg, (2022), 2, S. 96-117.
Jan Schleusener: Rezension zu: Windolf, Paul; Marx, Christian: Die braune Wirtschaftselite. Unternehmer und Manager in der NSDAP. Frankfurt am Main 2022 , ISBN 978-3-593-51559-5,, In: H-Soz-Kult, 02.03.2023, <http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-117578>.
Ev. Taufregister St. Marien, Dortmund, 1871/30
Siegfried Ernst Frey, ehel, S.v. Lehrer Julius Frey u. Lina Schmitz
*29. April, ~11. Mai durch Pfr. Frey
Heute erschien in der Siegener Zeitung der Leserbrief „Stoppt das Kuddemuddel“ zur Denkmalumgestaltung: „… Jetzt rückt man auch noch der Geschichte zu Leibe mit der Unvereinbarkeit von Kriegerdenkmal und Friedenssymbolen. Wir sind zwar auch keine Kaiser-Fans, aber der erste Kaiser Wilhelm unter schied sich deutlich vom fanatischen zweiten Kaiser. Und das Gedenken an gestorbene Kaiser hat auch seinen Stellenwert als Erinnerung an furchtbare Kriege. ….“
Demjenigen, der hier als “Archivar” die Regenten im Kaiserreich kommentiert und Wilhelm II. als “fanatisch” beschreibt, empfehle ich anstatt solcher laienhistorischer Einlassungen, einmal eine Biographie (z. B. von Tyler-Whittle https://www.amazon.com/last-Kaiser-biography-Wilhelm-emperor/dp/0812907167) zu lesen. Spätestens seit Christopher Clarks “Schlafwandler” weiß jeder historisch belesene Mensch, dass die Monarchen des Kaiserreichs Kinder ihrer Zeit, aber keinesfalls “fanatische” Kriegstreiber oder sonst irgendwie “fanatisch” waren. Die Bad Berleburger Funktionäre haben sich beim Denkmal von linksgrünen Ideologen auf die schiefe Ebene eines absurden Geschichtsbildes führen lassen.
Stimmt. Das Zitat nahm den gesamten Post ein, so dass man vermuten darf, es drücke die Auffassung des Archivars aus. Sollte dem nicht so sein, freue ich mich …
Ergänzung der Veröffentlichungen von Kropffs:
– Die Bundesautobahnen Sauerlandlinie und Köln-Olpe-Hersfeld-Kassel, in: Kreis Olpe, Oldenburg 1970, S. 97-99
– Wiege der Eisenindustrie, in: Westfalenspiegel 1954 Heft 10 (Sonderheft Siegerland), S. 16 – 19
– Verkehrsfragen im südlichen Westfalen, in: Im Kranz bewaldeter Höhen, Dortmund 1955, S. 97-99
Schon 1945 „erweckte“ Hermann Meyer den Schachverband Südwestfalen mit den Vereinen im Siegerland zu neuem Leben. 1947 war er maßgeblich an der Organisation der ersten gesamtdeutschen Schacheinzelmeisterschaft vom 10. bis 31. August in Weidenau beteiligt. Die Turniere fanden in der Turnhalle des Fürst-Johann-Moritz-Gymnasiums statt. Hermann Meyer war leidenschaftlicher Schachspieler und spielte auch Telefonschach. Er gründete und betreute die Schulmannschaft. Während seiner Tätigkeit beim Geisweider Eisenwerk gründete er ebenfalls eine Schachgruppe. Aus „Hier geschieht niemandem Unrecht!“ – Zur Geschichte von Dr. Artur und Else Sueßmann und der Familie ihrer Tochter Annemarie Meyer. Hermann Meyer war ihr Ehemann. Dazu auch: Schach-Highlight 1947 in Weidenau, Erste deutsche Nachkriegsmeisterschaft ein Volltreffer, in: Zeitschrift „Blickpunkt“, Das Hüttental im Spiegel von Berichten und Bildern, 4/1997.
Der Kulturausschuss beschloss am 8.8. wie folgt:
1) Die Europastraße wurde mit einer Gegenstimme und 4 Enthaltungen angenommen
2) Die Margarete-Lenz-Straße wurde bei einer Gegenstimme [AfD-TD] und 2 Enthaltungen [AfD, GfS] angenommen.
3) Die Charlotte-Petersen-Straße wurde mit 2 Gegenstimmen und drei Stimmenthaltungen [AfD, GfS, UWG] angenommen.
4) Die Straße „Am Breitenbach“ wurde einstimmig bei 2 Enthaltungen [AfD-TD, GfS] angenommen.
[5) Die Straße „Auf dem Heuper“ wurde einstimmig bei 1 Enthaltung (GfS) angenommen.]
Quelle: Westfälische Rundschau, 10.8.2023 (Print); Ergänzugen aufgrund der Sitzungsniederschrift am 21.8.
Auf den Artikel „Schicksalsjahre einer Familie“ von Traute Fries in der Heimatland Beilage der Siegener Zeitung vom 28.1.2022 sei verwiesen, da dort weitere Angaben zu Albert Juncker und dessen Famile enthalten sind.
Ein Blick in die Siegener Kreistagsprotokolle des Jahres 1946 ergab folgendes: Albert Juncker war seit Februar 1946 Mitglied des Ausschusses für das Straßenverkehrsamt und Mitglied des gemeinsamen Ausschusses für den Wiederaufbau von Stadt- und Landkreis Siegen (bis Oktober 1946). Im April 1946 wurde Juncker als von Seiten der Stadt Siegen als Mit glied derr Entanzifizierungsspruchkammer vorgeschlagen.
In der heutigen Print-Ausgabe der Siegener Zeitung erschien der Artikel „Graf-Luckner-Straße: Anwohner gegen Umbenennung. Das beschlossene Vorhaben am Weidenauer Giersberg sorgt für Ärger. Dass weder der Bürgermeister noch die drei größten Fraktionen auf ihren Vorschlag [Anm.: Umwidmung der Straße noch Nikolaus Graf Luckner] eingehen, schockiert eine Reihe von Anwohnern, sie wenden sich jetzt an eine höhere Instanz.“
s.:
Ein weiterer Artikel zur Umbenennung der Graf-Luckner-Straße erschien in der heutigen Printausgabe der Siegener Zeitung unter der Schlagzeile: „Welcher Luckner war es denn nun? Der als „Seeteufel“ bekannte Kaperkapitän taugt nicht mehr als Namenspatron für eine Siegener Straße. Das ist für die Anwohner aber kein Grund, ihre Adressen umzubenennen. Was sie der Stadt Siegen vorhalten.“
Aus dem Bericht geht hervor, dass im Stadtarchiv Siegen kein Beleg aufgefunden werden konnte, dass die ehemalige Hindenburgstraße im Zuge der kommunalen Neugliederung 1975 nach Felix Graf Luckner benannt wurde. Aufgrund der Ungleichbehandlung mit den Anwohner der Stöckerstraße – hier fand eine Umwidmung (s. o.) von Adolf Stoecker in Helene Stöcker statt – haben sich die Anwohner an den Petitionsausschuss des Landtages gewendet.
S. a.:
Heute erschien in der Print Ausgabe der Siegener Zeitung der Artikel „Nach welchem Grafen die Luckner-Straße benannt ist. Können die Anwohner deren Umbenennung noch verhindern? Die Stadt kann nun belegen, wer der konkrete Namengebet ist.“ von Jan Schäfer:
“ …. Bürgermeitser Steffen Mues hatte in einem ersten Antwortschreiben in der Tat einräumen müssen, dass er im Archiv kein Dokument gefunden habe, das die Straßenbenennung seinerzeit eindeutig mit Felix von Luckner in Verbindung bringen könne. Er nehme aber an, dass es (sic!) der Rat damals den „Seeteufel“ ehren wollte, als er die einstige Hindenburgstraße im Jahr 1975 umbenannte. Mit einer „Annahme“ sei es aber nicht getan, meinten die Anwohner. Nun aber hat sich das Blatt gewendet: Die Verwaltung hat weiter suchen lassen im Archiv, um Klarheit zu bekommen. Uns sie wurde fündig. Inzwischen liegt ein Dokument vor, das die Widmung des Straßennamens eindeutig belegt.
In dem der SZ vorliegenden Schreiben vom 2. September 1975 sind 60 Straßen aufgelistet, die nach Personen benannt sind. Erläutert werden sie deshalb, weil im Rahmen der Kommunalen Neugliederung und damit der Eingemeindung der ehemaligen Stadt Hüttental zu Siegen eine ganze Reihevon Straßen wegen Dopplungen neue Bezeichnungen bekommen mussten, und zwar zum 1. Oktober 1975. In eben dieser Auflistung stehen die jeweiligen Namensgeber unmissverständlich. Im Falle der Graf-Luckner-Straße steht als Namensgeber: „Felix Garf Luckner, 1881 Dresden – 1966 Malmö, Seeoffizier“. Ein klare Sache also. ….“
„Auffällig ist wiederum die ausführliche und wohlwollende Berichtserstattung der ‚Siegener Zeitung‘ im Vorfeld der beiden ‚Luckner-Veranstaltungen‘. Siegener Zeitung v. 10.10.1924. Korvettenkapitän a. D. Felix Graf von Luckner sprach am 16.10.1924 in einer Versammlung in Siegen, Veranstalter war der ‚Verein Volkswohl‘. Am 18.10. fand in Kreuztal die Veranstaltung der Ortsgruppe des Deutschen Seevereins statt. Luckner sprach über ‚64.000 km Kreuzerfahrt mit dem’Seeadler‘ im Weltkriege‘, der Eintritt betrug 1,- Mark.“ (Anmerkung 196, T. Fries, Die Deutsche Friedensgesellschaft im Bezirk Sieg-Lahn-Dill in der Weimarer Republik.
Am 14.10. und am 16.10.1924 fanden in Kreuztal und Siegen Veranstaltungen der Deutschen Friedensgesellschaft statt. In Kreuztal sprach General Freiherr von Schoenaich über das Thema „Vom vorigen zum nächsten Krieg“, in Siegen lautete der Vortrag „Abrüstung, Sicherung und Vereinigte Staaten von Europa“. Beide Veranstaltungen dienten der Deusch-Französischen Verständigung. Der Auftritt des französischen Generals Verraux war von rechts gerichteten Kräften hintertrieben worden.
Bildersturm und kognitive Dissonanz
Die Provinz will nicht zurückstehen! Während in den Großstädten die Geschichtspolitk des allgegenwärtigen linksgrünen Establishments ohne Kompromisse durch Straßenumbenennungen und das Schaffen von stets steuerfinanzierten „Erinnerungsorten“ aller Art kompromisslos umgesetzt wird, wollen die Partei- und Verwaltungsvertreter im abgelegenen Bad Berleburg nicht zurückstehen. Erst recht nicht möchten dies die örtlichen Repräsentanten der mittlerweile schwindsüchtigen, aber dafür durchpolitisierten Evangelischen Landeskirche. Wie schon in vergangenen unglückseligen Zeiten entwickeln sie dabei sogar einen besonderen Eifer, gelehrig nachzuahmen, was ihre großen ideologischen Vorbilder vorleben. So setzten es die Anhänger der Grünen Partei tatsächlich durch, dass ein seit über 120 Jahren auf dem Bad Berleburger Goetheplatz vorhandenes Friedens- und Kriegerdenkmal postmodern „dekonstruiert“ und umgedeutet wird. Das Ergebnis ist ein mit Glasplatten verschandeltes historisches Bauwerk. Jenseits purer Ideologie und Bildungsferne ist kein Grund erkennbar, warum das historische, aus Namenslisten der örtlichen Kriegstoten der Bismarck‘schen Einigungskriege, der Verehrung Kaiser Wilhelms I. mittels eines Reliefs und einer Friedenseiche bestehende Ensemble einer Umgestaltung bedurfte. Das Denkmal weist eine eher kleine Größe auf und war in der Formensprache seiner Zeit ausgeführt worden, die sich wohltuend von der späteren monumentalen Denkmalarchitektur der Nationalsozialisten unterscheidet. Ganz ähnliche Gedenkorte finden sich überall in Europa. Bestand vor der Verschandelung des Berleburger Ensembles die Gefahr, das in einem Betrachter ohne weitere Belehrungen der Wunsch erwachsen könnte, die Monarchie wiederzubeleben? Oder mussten die Stadtoberen gar damit rechnen, dass bei den Berleburgern ohne weitere Erziehung zur Friedensliebe durch Parteien, Verwaltung und Kirche wieder Ressentiments gegen Frankreich Raum gewinnen könnten? Wohl kaum. Bei dieser Bilderstürmerei, die bewusst ein historisches Ensemble verschandelt und sinnentstellend, handelt es sich um einen kulturfremden Akt, der aus der Warte einer vermeintlich höheren Moral ein bestimmtes Geschichtsverständnis missionarisch verbreiten will. Es macht sprachlos, dass es gerade die linksgrünen, achso friedensbewegten Initiatoren dieser offen pazifistisch anmutenden Umgestaltung sind, die seit Monaten die Lieferung von immer mehr schweren Waffen in das Ukrainekriegsgebiet fordern. Friedensgespräche lehnen sie ab, es soll wieder „gesiegt“ werden, diesmal allerdings nicht mit heimischen Kriegsopfern, sondern ausschließlich mit ukrainischen. Anstatt sich selbst als Freiwillige bei den internationalen Brigaden der Ukraine zu melden, ziehen es die deutschen Parteien und ihrer Berleburger Abbilder vor, dass schon jetzt in jeder kleinen Stadt der Ukraine Gefallenendenkmäler und riesige Soldatenfriedhöfe entstehen. Auch diese Denkmäler tragen Tafeln mit langen Namenslisten der Opfer. Gelegentlich werden sie auch Bezüge zum Präsidenten der Ukraine, dem dortigen Staat oder seiner Regierung aufweisen. Stets aber drücken die ukrainischen Denkmäler Patriotismus und Trauer aus, ganz so, wie dies seit mehr als 120 Jahren das historische Berleburger Denkmal versinnbildlicht. Ob es in der Ukraine oder in irgendeinem anderen von Krieg und Elend betroffenen Land Leute geben wird, die die dortigen Denkmäler und Friedhöfe mit Glasplatten „dekonstruieren“ und verschandeln wollen, weil es ihnen an Respekt vor den Toten oder schlicht an historischer Bildung mangelt? An kognitiver Dissonanz sind die Berleburger Bilderstürmer aus Parteien, Kirche und Verwaltung, die sich allzu gerne mit den ukrainischen und Regenbogenfarben schmücken, jedenfalls nicht zu überbieten. Ob die vorangegangene Verschandelung des Goetheplatzes, die nun beim Denkmalsensemble ihren Abschluss fand, Rückhalt bei den Berleburgern hatte? Wohl kaum. Dies ist den ideologisierten Provinzpolitikern, Kirchen- und Verwaltungsleuten in ihrem bürgerfernen Resonnanzraum allerdings egal.
Umso trauriger ist es, dass die ehemals bürgerlichen Kräfte im linksgrünen Kulturkampf um die Deutungshoheit entweder nicht standhalten oder längst innerlich korrumpiert sind. Es tut sich in Bad Berleburg eine riesige Repräsentationslücke auf: Die ehemals bürgerlichen Kräfte repräsentieren einen wesentlichen Teil der Berleburger, besonders die hier angestammten, nicht mehr ausreichend. Die wählen CDU und bekommen grüne Weltanschauungspolitik. Abstimmungen der Bevölkerung über Sachfragen scheuen die Bad Berleburger Funktionäre wie der Teufel das Weihwasser.
Was aber kommt als nächstes? Glasplatten mit Kindergartenzitaten an der Bismarcksäule? Umbenennung der Moltke-, Roon- und Schützenstraße? Aufnahme der Regenbogenfarben in das Stadtwappen? Umbenennung des Schützenplatzes in Amadeo-Antonius-Platz?
Bürgerlichkeit heißt gegen jede Radikalität immun zu sein, weltoffen für Neues und verbunden mit dem Eigenen, der Heimat der eigenen Geschichte und Kultur. Erkennt der Stadtrat denn nicht, dass die Verschandelung und Umdeutung eines historischen Monuments die Vorstufe zum Abriss ist. Abgerissen wurden historische Denkmäler von den Taliban, Bücher verbrannten die Nazis. Selbst die DDR brachte genug Toleranz auf, um die vielen dörflichen Kriegerdenkmale, die an die 1864-er, 1866-er Kriege und den Krieg von 1870/71 erinnerten, unangetastet zu lassen. Wie umnachtet müssen CDU, FDP, der Bürgermeister und die Verwaltungsriege in Bad Berleburg sein, um so etwas mitzumachen?
Es hätte ja nichts dagegen gesprochen, an anderer Stelle ein “Friedensdenkmal” nach heutigem linksgrünen Geschmack zu errichten. Der Frevel der BAd Berleburger Funktionäre besteht darin, dass sie sich an einem denkmalgeschützten historischen Zeugnis vergriffen haben.
Steht das Kriegerdenkmal unter Denkmalschutz? Denn es findet sich lediglich im Kulturgutverzeichnis der Stadt Bad Berleburg und nicht in der Liste der eingetragenen Baudenkmäler, die Wikipedia angibt. Auch im Berleburger Ratssinformationssystem finden sich keine Hinweise auf eine Eintragung des Kriegerdenkmals in die Denkmalliste der Stadt.
Wenn es unter Denkmalschutz steht, sollte vor der Umgestaltung eine Abstimmung mit der oberen Denkmalbehörde stattgefunden haben.
Ästhetische Bewertungen von Umgestaltungen von Denkmälern sind auch immer eine Geschmackssache, über die man ja nicht streiten sollte.
Eine sehr bürokratisch-technokratische Sichtweise, die, um abzulenken, nicht zu den Argumenten des Beitrags durchdringt. Fakt ist, dass der Denkmalschutz bei der gesamten (misslungenen) Umgestaltung des Goetheplatzes, in dessen Mitte nun einmal das Denkmalsensemble steht, eine große Rolle spielte. Selbstverständlich wurde auch die Denkmalbehörde zu Platz und Denkmal konsultiert, und zwar mehrfach! Aus kunsthistorischer Sicht dürfte unbestritten sein, dass die Arbeiten Arnold Künnes nicht nur den Qualitätsanspruch der zeitgenössischen Berleburger, sondern auch aus heutiger Sicht den konservatorischem Rang des sogenannten Kaiser- und Kriegerdenkmals ausdrücken. Dabei geht es nicht um Ästhetik, wie der Archivar fälschlicherweise annimmt, sondern um den Erhalt eines historischen Monuments samt dessen Formensprache und seiner historischen Botschaft. Erst recht geht es nicht um persönlichen Geschmack.
Wenn wir aber schon einmal bei Ästhetik sind, so reicht ein schlichter Bildvergleich des Platzes im Zustand von etwa 1970 (vor der Asphaltierung) mit dem jetzigen Bauzustand aus, um festzustellen, dass die jetzige “Pflaster- und Betonwüste” in keinerweise mehr mit dem alten historischen Flair mithalten kann. Das mag zwar eine subjektive Sicht sein, sie dürfte aber von vielen Berleburgern geteilt werden. Ergo: Die Umgestaltung mit ihren “modernen” Baumaterialien aus Benton, der viel zu großen Steinfläche, ihrer Sterilität und der nun spärlichen Bepflanzung ist insgesamt misslungen.
Beim Denkmal aber geht es nicht um Ästhetik, sondern um Ideologie und linksgrünen Deutungsanspruch.
Danke für die Präziserung bezüglich des Denkmalschutzes!
Zur Verdeutlichung die Debatte hat ja mehrere Ebenen:
1) eine politische, die in den bisherigen Kommentaren, sehr eindeutig bewertet wird,
2) eine rechtliche, die bisher keine Rolle gespielt hat. Da der Denkmalschutz beteiligt wurde, scheinen dessen Belange durch die Gestaltung nicht berührt zu sein,
3) eine erinnerungskulturelle, die sich den Fragen widmet, ob Denkmäler der Kontextualiiserung bedürfen, und wie diese bestmöglich geschehen kann, und
4) sehr wohl eine ästhetische; wenn eine Einordnung als politisch befürwortet wurde, sie rechtlich zulässig, sie historisch als notwendig angezeigt ist, wie hat diese Einordnung auszusehen.
Ferner „leidet“ der konkrete Vorschlag der Denkmalumgestaltung auch unter der generellen Umgestaltung des Goetheplatzes (z. B. Baumfällungen), die aber m. W. in keinem ursächlichen Zusammenhang mit der Denkmalsumgestaltung steht. Also: Die Bäume wurden nicht wegen der Denkmalsumgestaltung gefällt. Die Baumfällungen eröffneten offentsichtlch die Möglichkeit der Denkmalumgestaltung
Johannes SCHERR – Mutter Eva; in: Größenwahn – vier Kapitel aus der Geschichte menschlicher Narrheit, Kassel, 1876, p. 22-86, [Link nachgereicht von AS am 22.8.2023]
Willi TEMME – Krise der Leiblichkeit – Die Sozietät der Mutter Eva (Buttlarsche Rotte) und der radikale Pietismus um 1700; Göttingen, 1998 (Vandenhoeck & Ruprecht), Marburg: Diss. theol. [Ergänzung durch archivar am 21.8.: Link]
Roman:
Roland ADLOFF – Evens Buch – Die Geschichte einer ungewöhnlichen Erpressung in der ehemaligen Grafschaft Wittgenstein; Kreuztal, 1996 (Verl. Die Wielandschmiede)
Die Provinz will nicht zurückstehen! Während in den Großstädten der Bundesrepublik die Geschichtspolitk des allgegenwärtigen linksgrünen Establishments durch Straßenumbenennungen und das Schaffen von immer neuen stets steuerfinanzierten „Erinnerungsorten“ aller Art kompromisslos umgesetzt wird, wollen die Partei- und Verwaltungsvertreter im abgelegenen Bad Berleburg nicht zurückstehen. Erst recht nicht möchten dies die örtlichen Repräsentanten der mittlerweile schwindsüchtigen, aber dafür durchpolitisierten Evangelischen Landeskirche. Wie schon in vergangenen unglückseligen Zeiten entwickeln sie dabei sogar einen besonderen Eifer, gelehrig nachzuahmen, was ihnen ihre großen ideologischen Vorbilder vorleben. So setzten es die Anhänger der Grünen Partei tatsächlich durch, dass ein seit über 120 Jahren auf dem Bad Berleburger Goetheplatz vorhandenes Friedens- und Kriegerdenkmal postmodern „dekonstruiert“ und umgedeutet wird. Das Ergebnis ist ein mit banalen Zitaten auf Glasplatten verschandeltes historisches Monument. Jenseits purer Ideologie und Bildungsferne ist kein Grund erkennbar, warum das historische, aus Namenslisten der örtlichen Kriegstoten der Bismarck‘schen Einigungskriege, der Verehrung Kaiser Wilhelms I. mittels eines Reliefs und aus einer Friedenseiche bestehende Ensemble einer Umgestaltung bedurft hätte. Das Denkmal weist eine eher kleine Größe auf und war in der Formensprache seiner Zeit ausgeführt worden, die sich wohltuend von der späteren monumentalen Denkmalarchitektur der Nationalsozialisten unterscheidet. Ganz ähnliche Gedenkorte finden sich überall in Deutschland und Europa.
Bestand vor der Verschandelung des Berleburger Ensembles die Gefahr, das in einem Betrachter ohne weitere Belehrungen der Wunsch erwachsen könnte, die Monarchie wiederzubeleben? Oder mussten die Stadtoberen gar damit rechnen, dass bei den Berleburgern ohne weitere Erziehung zur Friedensliebe durch Parteien, Verwaltung und Kirche wieder Ressentiments gegen Frankreich Raum gewinnen könnten? Wohl kaum. Bei dieser Bilderstürmerei, die bewusst das historische Ensemble mit Friedenseiche verschandelt und sinnentstellt, handelt es sich um einen kulturfernen Akt, der aus der Warte einer vermeintlich höheren Moral ein bestimmtes Geschichtsverständnis missionarisch verbreiten will. Einer vielstimmigen Deutung der Geschichte soll bewusst entgegengewirkt werden.
Es macht sprachlos, dass es gerade die linksgrünen, früher achso friedensbewegten Initiatoren dieser offen pazifistisch ausgeführten Umgestaltung sind, die seit Monaten die Lieferung von immer mehr schweren Waffen in das Ukrainekriegsgebiet fordern. Friedensgespräche lehnen sie ab, es soll wieder „gesiegt“ werden, diesmal allerdings nicht mit heimischen Kriegstoten, sondern ausschließlich mit ukrainischen. Anstatt sich selbst als Freiwillige bei den internationalen Brigaden der Ukraine zum Kriegsdienst zu melden, ziehen es die deutschen Parteien und ihre Berleburger Abbilder vor, dass schon jetzt in fast jedem Ort der Ukraine Gefallenendenkmäler und riesige Soldatenfriedhöfe entstehen. Auch diese Denkmäler tragen Tafeln mit langen Namenslisten der Opfer. Gelegentlich werden sie auch Bezüge zum Präsidenten der Ukraine, dem dortigen Staat oder seiner Regierung aufweisen. Stets drücken die ukrainischen Denkmäler Patriotismus und Trauer aus, ganz so, wie dies seit mehr als 120 Jahren das historische Berleburger Denkmal auf dem Goetheplatz versinnbildlichte. Ob es in der Ukraine oder in irgendeinem anderen von Krieg und Elend betroffenen Land Leute geben mag, die die dortigen Denkmäler und Friedhöfe mit Glasplatten „dekonstruieren“ und verschandeln wollen, weil es ihnen an Respekt vor den Opfern oder schlicht an historischer Bildung mangelt?
An kognitiver Dissonanz sind die Berleburger Bilderstürmer aus Parteien, Kirche und Verwaltung, die sich allzu gerne mit den ukrainischen und Regenbogenfarben schmücken, jedenfalls nicht zu überbieten.
Ob die vorangegangene Verschandelung des Goetheplatzes, die nun beim Denkmalsensemble ihren traurigen Abschluss fand, Rückhalt bei den Berleburgern hatte? Wohl kaum. Dies ist den ideologisierten Provinzpolitikern, Kirchen- und Verwaltungsleuten in ihrem bürgerfernen Resonnanzraum allerdings egal.
@archivar, gut strukturiert. Dann wollen “wir” doch einmal nach diesen Ebenen zusammenfassen, hoffentlich mit möglichst wenigen Wiederholungen:
Ad 3 “erinnerungskulturelle Ebene”
Man könnte auch von einer geschichtspolitischen Ebene sprechen. Und hier liegt auch gleich der eigentliche Knackpunkt der Debatte: die kultur- und bildungsferne Entgleisung der Bad Berleburger Partei- und Stadtfunktionäre. Diese besteht im Kern aus dem ideologischen Anspruch des grünen intellektuellen Milieus, ihr Geschichtsbild zu früheren deutschen Staaten mit semitotalitärem Anspruch im öffentlichen Raum und in den Diskursräumen zu verbreiten.
Hier will ich etwas ausholen: Angefangen haben die Kulturkrieger mit den Zeugnissen des verbrecherischen Nationalsozialismus, wogegen in vielen Fällen nichts einzuwenden war und ist. Und doch zeigte sich schon bei den NS-Themen seit dem sogenannten “Historikerstreit” (Nolte/Habermas) ein absoluter Anspruch auf Deutungshoheit. Seit dieser Zeit werden die himmelschreienden Verbrechen der Nationalsozialisten zur Selbstlegitimation und -erhöhung des grünlinken Milieus missbraucht. Joschka Fischer behauptete gar, der “Gründungsmythos” der Bundesrepublik sei Ausschwitz. Nach der NS-Zeit, deren Denkmäler mit Berechtigung geschliffen wurden, wandten sich die Kulturkrieger zunehmend dem deutschen Kaiserreich nach 1871 zu, das sie pauschal und unbeeindruckt von historischen Tatsachen als undemokratisch, kolonialistisch, rassistisch, imperialistisch und aggressiv brandmarkten. Zu einer Beurteilung nach den Maßstäben der damaligen Zeit, die sich um Distanz und Augenmaß bemüht, waren sie entweder nicht in der Lage oder nicht willens. Es geht ihnen darum, jegliche Traditionslinien zu zertrennen, um ihr multikulturelles globalistisches Gesellschaftsbild mit totalitärem Anspruch zu verankern. Seit vielen Jahren haben sie sich den woken US-Ideologien und deren Vertretern angeschlossen. Die Annahme eines “totalitären Anspruchs” ist leider keine polemische Übertreibung, sondern empirisch leicht nachweisbar. Die ideologischen Narrative und Disziplinierungsinhalte sind immer moralistisch gefärbt und erschreckend simpel. Die Durchdringung aller relevanten gesellschaftlichen und staatlichen Institutionen ist beachtlich. Die verbreiteten Inhalte reichen von Migration, LGBTQ, US-Werteideologie und -Geopolitik über Antirassismus, Multikulturalismus bis zur Klimaerzählung und einem ideologischen Geschichtsbild. Wer versucht nicht mitzumachen oder zu widersprechen, wird “gecancelt”. Das biedere Bad Berleburg ist dafür ein gutes Beispiel: LGBTQ, Migration, Klima und vieles mehr werden von oben übergestülpt oder die lokalen Funktionäre schalten sich selbst gleich. Was der Souverän denkt – denn nichts von alldem ist von unten gewachsen – ist schlicht egal. Soviel der Vorrede.
Nun zur geschichtspolitischen Deutung des Denkmalvorfalls. Was die dienstbaren Geister in Bad Berleburg auf die Glasplatten haben schreiben lassen, ist nicht zu beanstanden und inhaltlich schrecklich banal. Zu einer tieferen Reflektion des tiefschichtigen Friedensthemas waren sie wohl nicht in der Lage. Entscheidend aber sind nicht die Aussagen auf den Glasplatten, sondern die Negation der ursprünglichen Ausstrahlung und Wirkung des Denkmals: Vaterlandsliebe, Gefallenengedenken und eine positive Konnotation der damaligen Staatsform, damals dankbar unterstützt von den zeitgenössischen Berleburger Bürgern, sollen keinen Raum mehr haben auf einem der wichtigsten Plätze der Kleinstadt. Zentrales Ziel der Ideologen ist eine postmoderne Dekonstruktion dieser historischen Substanz. Dass den Bad Berleburger Lokalgrößen diese Zusammenhänge bewusst waren, davon ist nicht auszugehen. Vielleicht wollten sie wirklich nur ein naives Friedenszeichen setzen. Zudem haben es die Initiatoren aus der Grünen Partei bei Initiierung der Umdeutung des Denkmals nicht ahnen können, dass der auf den Glasplatten verewigte naive Vulgärpazifismus seit dem Beginn des Ukrainekriegs längst nicht mehr der Parteilinie entspricht. Aber wie gesagt, beim Kulturkampf der Woken und Grünen auf dem Gebiet vorhandener Straßennamen und Monumente geht es in erster Linie um Dekonstruktion und nicht um neue Inhalte.
Aus geschichtspolitischer Sicht ist die Dekonstruktion und faktische Umwidmung des Denkmals sehr verwerflich. Das historische Ensemble schloss die ältere Friedenseiche mit ein, weshalb selbst das Friedensanliegen bereits in der Formensprache der Zeit berücksichtigt war. Der Anspruch eines sogenannten “Perspektivenwechsels” ist eine geistige Anmaßung gegenüber einem schützenswerten historischen Monument, dem die dilettantischen Glasplatten noch nicht einmal gerecht werden. Er ist auch eine unverhüllte Bevormundung des Betrachters, dem nicht zugetraut wird, mit einem historischen Zeugnis umzugehen. Gleiches gilt für die paternalistische Vorstellung, historische Zeugnisse müssten “kontextualisiert” werden. Diese Vorstellung ist offen totalitär. Welche Lehrmeinung bestimmt denn, welche Kontextualisierung die Richtige ist? Der Stadtrat? Die Wissenschaft? Ein städtisches Amt für Wahrheit und Vordenken? Welche Grenzen hätte eine Kontextualisierung im öffentlichen Raum denn? Bekommt die Evangelische Stadtkirche demnächst auch eine Glasplatte, weil in ihr einst Pfarrer Hinsberg dem Fürsten huldigte? Muss nicht auch das Berleburger Schloss mit einer Mahnstele bedacht werden, um den Opfern der Leibeigenschaft zu gedenken? Oder sollte auf dem Gelände der Firma Stark nicht dem CO2-Ausstoß seit 1890 gedacht werden? Nein, diese Idee passt nicht zu einer freien und offenen Gesellschaft, wie sie Karl Popper beschrieb, sie würde nur zu einer “neuen DDR” mit einem staatlich verordneten Geschichtsbild passen. Bilderstürmerei darf in einer Kulturnation keinen Platz haben, auch nicht, wenn sie – wie hier – ideologisch und baulich kaschiert wird. Auch dann nicht, wenn Provinzfunktionäre nur nachäffen, was auf der großen politischen Bühne (leider) Usus geworden ist.
Ad 1 “politische Ebene”
Die politische Ebene ist hier im Wesentlichen identisch mit der geschichtspolitischen. Dass in Bad Berleburg bei der Dekonstruktion des Denkmalensembles wohl viele einer Meinung waren in ihrer kommunalpolitischen Blase, heißt nichts. In Schilda waren sie auch einer Meinung als dort Licht in Eimern transportiert wurde. Die Liste der städtebaulichen Sünden ist in Bad Berleburg besonders lang, obwohl es immer Mehrheiten bei den jeweiligen Funktionären gab, denn die Bevölkerung selbst darf ja nichts entscheiden.
Wenn es der Kommunalpolitik wirklich um ein Friedensdenkmal gegangen wäre und nicht um die Verschandelung und Umwidmung eines historischen Monuments, so hätte ich dagegen keine Einwendungen gehabt. Der Frieden ist tatsächlich in Gefahr und es wäre aller Ehren wert gewesen, ein wirkliches Friedensdenkmal zu errichten.
Die Grüne Partei könnte ja einen Vorschlag machen, der versucht, ihre nicht ganz widerspruchsfreie Programmatik in einem harmonischen und “bunten” Entwurf umzusetzen. Dazu habe ich folgende Anregungen: Das Denkmal könnte direkt vor dem Rathaus errichtet werden. Am linken Flügel könnte eine aus nachhaltigem Recycling-Kunstoff hergestellte Regenbogenflagge wehen. In der Mitte erhebt sich ein 20-Meter-langes Windrad mit je einer ausgestopften Friedenstaube auf den fünf Rotoren. Die Rotoren sind mit den Buchstaben L, G, B, T und Q benannt. Am rechten Flügel des Denkmals steht ebenfalls ein Fahnenmast mit der ukrainischen Flagge, davor eine Siegespalme aus der Toskana. In der Mitte vor dem Windrad könnte zur Abrundung ein parteigrün gestrichener Leopard-Panzer im Maßstab 1:3 mit roter Kanone stehen. Auf ihm werden vorerst leere Platten angebracht, auf die einmal die Namen der Berleburger Friedenskämpfer eingraviert werden sollen.
Ad 2: Rechtliche Dimension
Darum sollen sich die in ausreichender Zahl vorhandenen und von der Allgemeinheit alimentierten Beamten kümmern. Diese technokratische Ebene ist nicht wirklich relevant für die Kernfragen des Themas.
Ad 4: Ästhetische Ebene
Die Glasplatten mitsamt ihrer banalen Zitate sind einfältig und verschandeln das Denkmalensemble in baulicher Hinsicht sehr. Dies ist zwar Geschmacksache, aber viele Bad Berleburger dürften ähnlich empfinden. Die Neugestaltung des Goetheplatzes insgesamt ist misslungen. Ich empfehle einfach einmal historische Plätze in Polen, Litauen, Tschechien, Italien oder (schneller machbar) einfach das Städtchen Schmallenberg zu bereisen, vielleicht fällt dann der Groschen. Die klassizistische Altstadt Bad Berleburgs hätte fürwahr kulturhistorisch und ästhetisch besser bewanderte kommunale Funktionäre verdient. Aber sei’s drum: Der Platz passt jetzt gut zur Schlangenlinien-Poststraße, dem Betonbett der Odeborn, dem Autobahnzubringer Emil-Wolf-Straße, dem „herrlichen” Sparkassengebäude, der unproportionalen Seniorenheimbebauung an der Mühlwiese, dem Bürgerhaus-Glaskasten, der Ruine des 1A-Marktes samt Parkhaus, dem “Fernmeldegebäude” am Bahnhof, der Parkplatzwüste hinter McDonald’s und zu den vielen leerstehenden Schaufenstern der Odebornstadt!
Weitere Literatur zur Buttlarschen Rotte:
– Bauer, Eberhard: Die Buttlarsche Rotte in Saßmannshausen, in: Wittgenstein, Jg. 62 (1974), Bd. 38, Heft 4, S. 148-161
– Bauer, Eberhard: Zeitgenössische Berichte zum Prozess der Buttlarschen Rotte in Laasphe (1705), in: Jahrbuch für Westfälische Kirchengeschichte, Bd. 71/1978/
S. 167-192 [Auch als Sonderdruck erschienen]
– Bauer, Eberhard: Eine Stellungnahme August Hermann Franckes zur Buttlarschen Rotte, in: Jahrbuch für Westfälische Kirchengeschichte, Bd. 72/1979/, S. 151-152
– Hartnack, Karl: Weitere Nachrichten über die Buttlarsche Rotte, in: Das schöne Wittgenstein 1939/Nr. 4/S. 28
– Lückel, Ulf: „Freie Liebe in Wittgenstein praktiziert“ Eva von Buttlar und ihre Gesellschaft (1670-1721), In: Siegerländer Heimatkalender 81 (2006), S. 124-128
– Lückel, Ulf: Die „Sozietät“ der Eva Margaretha von Buttlar in Wittgenstein und ihr merkwürdiges Treiben, in: Jahrbuch Westfalen 2015, Westfälischer Heimatkalender – Neue
Folge 69. Jahrgang, Seiten 251-257
– Lückel, Ulf: Die Gesellschaft der Eva von Buttlar. Ein Sonderphänomen im pietistischen Zeitalter um 1700
In: Heimatland, Beilage zur Siegener Zeitung, 20.10.2018
– Müller, Hermann: Die Buttlarsche Rotte in Saßmannshausen
Das schöne Wittgenstein 1939/Nr. 3/S. 18-19
– Temme, Willi: Die Buttlarsche Rotte. Ein Forschungsbericht. in: Pietismus und Neuzeit, Bd. 16, 1990, S. 53-75, Link
Beide lokalen Tageszeitungen berichten leider nur jenseits der Bezahlschranke; allerdings wurden diese Berichte auf den Facebook-Präsenzen diskutiert:
1) Westfälische Rundschau/Westfalenpost:
In der heutigen Printausgabe der Westfälischen Rundschau erschien der Leserbrief „Strassennamen beibehalten“ zur Umbennenung der Graf-Luckner-Straße.
Ebenfalls heute erschien dort der Beitrag „Neue Straßenschilder sind bestellt. Anwohner erhalten Infoschreiben der Stadt“, der das weitere Vorgehen skizziert.
Zwei Beiträge haben einen regionalen Bezug:
Christian Brachthäuser: Friedrich Adolph Wilhelm Diesterweg (1790–1866). Die Diskussionen um eine Reform der Schulpolitik im Kreis Siegen 1848, S. 103 – 114
Andreas Krüger: Wilhelm Friedrich Groos (1801–1874). Schmerzenskind Wittgenstein, S. 205 – 216
Die Siegener Zeitung hat nicht nur Hermann Engelbert, sondern auch dem Verlagsleiter der Siegener Volkszeitung und Sozialdemokraten Gustav Vitt (1895-1960), der nach dem Überfall am 2. Mai 1933 auf das Haus der Gewerkschaft durch die SA-Sturmtruppe unter SA-Führer R. Odenthal arbeitlos wurde, geholfen. Vom 1. April 1935 bis Ende August 1945 war er in verschiedenen Funktionen für die SZ tätig. Während der Zeit litt er an den Folgen der Misshandlung durch die SA und die Inhaftierung und war dadurch fortwährend in ärztlicher ambulanter und wiederholter stationärer Behandlung (Nervenkliniken).Nach dem Krieg baute er seine selbständige Tätigkeit (Vertrieb von Karten, Drucksachen, Büropapieren) aus. Er war Stadtverordneter der SPD in Siegen und führte verschiedene Ehrenämter. Er starb an einem Herzinfarkt und den infolge seiner Mißhandlung und politischen Verfolgung entstandenen Gesundheitsschäden.
In der heutigen Print-Ausgabe der Siegener Zeitung erschien zudem der Leserbrief „Alleinstellungsmerkmal“, der bezüglich der Umbebennung der Porschestraße weitere Maßnahmen zur Tilgung des Namen Porsche aus dem Siegener Stadtbild forderte (Umbenennung der Werksvertretung, Fahrverbot für Autos der Firma). Weniger ironisch als vielmehr albern ….. m. E.
Neben dem o.g. Bestand NW 1127
sind für das Kreisgebiet noch die Bestände
NW 1090 und NW 1128 interessant, da sie einige
Akten zu Personen aus der Region Siegen / Wittgenstein enthalten.
auch nett die Geschichte welche immer wieder rund um diesen Besuch von Willy Brandt aufklappt (ob wahr oder nicht, aber glaubhaft ist sie schon!): Als Willy Brandt seine Rede hielt soll ein Postbote mit einem Telegramm den Raum betreten haben:“Ist hier ein Willy Brandt?“. Dieser habe sich sofort gemeldet und ein Telegramm in Empfang genommen. Dieses solle von Prinz Botho gewesen sein, mit dem kurzen Text: „Störe meine Kreise nicht“ :-) Alles nicht belegt, jedoch würde es zu Bothos Humor passen…..
Danke für die Anekdote! Ob sich das Telegramm im Nachlass Willy Brandts – oder Bothos zu Sayn- Wittgenstein-Hohensteins – befindet – wäre doch zu schön, wenn dies stimmt.
Zu Hermann Engelbert sind im Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen, eine Personalakte und eine Wiedergutmachungsakte (zusammen mit seiner Ehefrau) vorhanden. Die Akten tragen folgende Signaturen:
• R 001/Personalakten, Nr. 782
• K 104/Regierung Arnsberg, Wiedergutmachungen, Nr. 26918
Archivalia suchte nach einer Definition des Begriffs „Kuxenmarkt“. Eine Erklärung fand sich in in Peter Schaals Buch „Geldtheorie und Geldpolitik“, München/Wien 1998, S. 191:
Heute erschien in der Westfälischen Rundschau (Print) ein Leserbrief, der die politischen Umstände der Umbenennung der Graf-Luckner-Str. in Edith-Langner-Str. kritisch hinterfragt.
Heute erschien in der Siegener Zeitung folgender Artikel samt Kommentar zur Umbenennung der Graf-Luckner-Str. in Edith-Langner-Str.:
Auf der FB-Seite der Zeitung beginnt erwartungsgemäß eine Diskussion:
Heute erschienen in der Siegener Zeitung (Print) 2 Leserbriefe:
1) „Mit Porsche nichts zu tun“ verweist darauf, dass die Porsche-Strasse nach Ferdinand Porsche benannt worden war und der Grund für die Umbenennung dessen Verstrickung in das NS-System war. Die Firma Porsche sei erst 1948 von dessen Sohn gegründet worden, so dass die gerade in den sozialen Medien geforderte Umbenennung der Siegener Niederlassung des Fahrzeugherstellers sowie ein Fahrverbot für dessen Fahrzeuge jeglicher Grundlage entbehre.
2) „Gutsherrenart“ wird der Stadt Siegen im zweiten Leserbrief bei der Umbenennung der Graf-Luckner-Str. attestiert.
Die Verlinkung zur Mailadresse ist offenbar fehlerhaft. Hier die korrekte Mailadresse: Friedhelm_Ziegler@t-online.de. Weitere Kontaktdaten sind postalisch an Friedhelm Ziegler, Hauptstr. 27, 57250 Netphen-Unglinghausen oder telefonisch unter 02732-25117.
Heute erschien in der Siegener Zeitung der Leserbrief „Wie viel NS ist erlaubt?“ zur Edith-Langner-Str.: “ ….Was auch zu hinterfragen ist. ist die Tatsache, dass die Anwohner die Mitgliedschaft von Edith Langner in der NSDAP herausgefunden haben. Da hätte ich mir gewünscht, dass die Profis der Siegener Zeitung eine Recherche angestellt und darüber berichtet hätten. Dafür sind doch Journalisten eigentlich da.“
Anm.: 1) siwiarchiv hat bereits am 17. Mai 2022 auf das Vorhandensein einer Entnazifizierungsbogens im Siegener Stadtarchiv hingewiesen (Link). Dieser konnte über das NRW-Archivportal problemlos ermittelt werden.
2) Eine Mitgliedschaft Langners in der NSDAP ist bisher noch nicht nachvollziehbar belegt worden. Dem steht eine Auskunft des Berliner Document Centers aus dem Jahr 1973 entgegen, die im Rahmen des Ordensverfahrens routinemäßig eingeholt wurde. Es wurde damals keine Mitgliedschaft Langners nachgewiesen.
3) Für den am 20.9. erschienenen Artikel der SZ (s.o.) hat der Journalist die dem Kreisarchiv vorliegenden Scans bzw. Digitalbilder der Ordensakte und der Entnazifizierungsakte des Landesarchivs NRW sowie den Entnazifizierungsbogen des Stadtarchivs eingesehen.
Danke Archivar! Es ist schon erstaunlich, wie die „Luckner-Straße-Aktivisten“ mit aller Gewalt aus Edith Langner eine „Narzisse“ versuchen zu machen. Und das wider (potentiell) besseres Wissen. Am 14. / 15. September habe ich den hier veröffentlichten wissenschaftlichen Kenntnisstand einer der AktivistInnen in einem Mail-Austausch mit entsprechenden Links mitgeteilt.
Der Autor Weber fordert in seiner Bachelorarbeit einen reflektierteren Gebrauch der deutschen Sprache, ist aber selbst nicht korrekt in den Begriffen („Bildarchiv des Bundestags“). Ist zwar eine Kleinigkeit, stört aber und verringert den Eindruck von Seriösität.
Auszug aus der Niederschrift der 19. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Siegen am 23.08.2023 (S. 5-6), in der unter TOP 6 die Straßenumbenennungen (Vorlage Nr. VL 1361/2023) final beraten und beschlossen wurden:
„Herr Schiltz blickt zurück auf die jahrelangen und kontroversen Diskussionen, die nunmehr mit der Entscheidung über die Umbenennung einiger Straße nach Personen, die durch antisemitische und nationalsozialistische Gesinnung aufgefallen sind und daher einer Ehrung nicht würdig sind, beendet werden können. Bei der Neubenennung hat die SPD-Fraktion zwei Kriterien zugrunde gelegt; mehr verdiente Frauen in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken und einen klaren Bezug zu Siegen zu geben. Mit dem Vorschlag „Europastraße“ sollen die Verbindung und die Vorteile von Europa für die Bürgerinnen und Bürger in Erinnerung gerufen werden. Er dankt den Mitgliedern des Arbeitskreises, die sich intensiv mit der Geschichte der in Rede stehenden Personen befasst und die Grundlagen für die Beschlussfassung geschaffen haben.
Herr Groß ergänzt und stellt die Methode des Arbeitskreises, sich quasi wissenschaftlich den Fragen zu nähern, als die richtige heraus. Bedenklich war und ist für ihn der Umgang mit dem Thema in den sozialen Medien, das von einigen Zeitgenossen als unnötig und Zeitvertreib abqualifiziert wurde. Er sieht es als Aufgabe der Politik, sich auch mit solchen Themen auseinander zu setzen.
Seine Fraktion hat sich gegen die Umbenennung ausgesprochen, so Herr Steffe. Die Bürgerinnen und Bürger sind nicht alle mit der Vorgehensweise einverstanden und haben sich vielmehr in der Graf-Luckner-Straße und der Diemstraße für eine Umwidmung ausgesprochen. Diesem Wunsch sollte der Ausschuss folgen.
Die Hintergründe für die Änderungen sind nach Aussage von Herrn Rompf hinlänglich bekannt und von allen Seiten beleuchtet worden. Die CDU-Fraktion möchte nunmehr diesen Vorgang abschließen.
Beschluss:
Der Haupt- und Finanzausschuss des Rates der Stadt Siegen beschließt folgende Straßen um-
zubenennen:
1. “Bergfriederstraße“ in “Auf dem Heuper“
2. “Hindenburgstraße“ in “Europastraße“
3. der Name “Hindenburgbrücke“ wird ersatzlos eingezogen und sie ist nur noch eine Brücke
innerhalb der Straße mit dem neuen Namen
4. “Lothar-Irle-Straße“ in “Am Breitenbach“
5. “Porschestraße“ in “Charlotte-Petersen-Straße“
6. “Diemstraße“ in “Margarete-Lenz-Straße“
Beratungsergebnis: 16 Stimmen dafür, 1 dagegen (AfD-TD), 0 Enthaltungen“
Heute erschienen in der Siegener Zeitung 2 Leserbriefe zur Edith-Langner-Straße, „Bürgerferne statt -nähe“ und „Eine Beleidigung“. Beide äußern sich und bewerten das politische Verfahren kritisch. Aus Letzterem sei die Bewertung der Biographie Langners zitiert: “ …. Nun stellt sich heraus dass diese Frau Mitglied der Deutschen Frauenschaft war, eine der Eliteorganisationen unter den NS-Frauenorganisationen. Im Jahr 1944 war sie dieser Naziorganisation beigetreten, als ein großer Teil der deutschen Bevölkerung schon wusste, was für ein brutales und menschenverachtendes System die Naziherrschaft war. Jetzt den Namen dieser Frau an unsere Straße zu heften, halten wir für eine Beleidigung“
Anm.: Langner gehörte eigenen Angaben zufolge seit Sommer 1944 dem Deutschen Frauenwerk (!) an. Soviel Präzision muss schon sein.
Präzision gehört nun mal nicht zu den Kompetenzen derer, die es gewohnt sind, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Der eigentliche Skandal hingegen ist die Politik jener „Heimatzeitung“, die nach wie vor wider besseren Wissens Leserbriefe der selbst ernannten Nazi-Jäger druckt, obwohl der Redaktion mindestens eine gegenteilige, den Sachverhalt richtig stellende Zuschrift vorliegt. Hier wird mit den Mitteln der bewussten Desinformation eindeutige Stimmungsmache betrieben.
Heute erschien der oben angekündigte Leserbrief „Recherche zielführender“ in dier Siegener Zeitung, der die emotionale Diskussion um die Person Edith Langner mit Hinweis auf die hier publizierten Recherchergebnisse versachlicht sehen will.
Lieber Herr Burwitz, leider tragen auch Sie zur Stimmungsmache bei und auch bei Ihrer Bewertung der Angelegenheit mangelt es an Präzision. Es wird der Vorgang der Umbenennung der Graf-Luckner-Straße kritisiert. Dieser erfolgte im Gegensatz zum Vorgehen bei anderen umbenannten Straßen ohne Einbeziehung der Anwohner und ohne vorherige Prüfung der Person Frau Langner. Genau dies wurde von der Fraktion Volt – wie im Protokoll der Ratssitzung nachzulesen – gefordert. Zum Beispiel ist es auch üblich, dass die Familie der Person befragt wird. Dies ist nicht erfolgt. Falls nun in einigen Jahren neue Dokumente auftauchen, weil nicht gründlich genug recherchiert wurde, dann steht die Straße vor einer erneuten Umbenennung. Und wie sehr leicht nachzulesen, ist im Abschlussbericht des
Arbeitskreises Aufarbeitung der historischen Hintergründe von Straßennamen des Rates der Stadt Siegen die Mitgliedschaft in einer NS Organisationen (und das deutsche Frauenwerk gehörte zweifelsohne dazu ) ein wichtiges Kriterium zur Umbenennung einer Straße!
Schade, dass keiner jetzt den Mut hat, die Fehler zu korrigieren. Nochmal: es geht nicht nur um die Personalie Edith Langner, sondern auch um die Art und Weise, wie von Seiten der Stadt mit den Anwohnern umgegangen wurde!
Als Autor des dieser Diskussion zugrunde liegenden Eintrages verweise ich darauf, dass seit dem 27. Juni 2022 bekannt war, dass das Berliner Bundesarchiv in seinen einschlägigen Unterlagen zur NS-Zeit keine Hinweise auf Edith Langner hat. Im Originaleintrag finden sich zudem die Hinweise auf den Entnazifizierungsbogen in den Beständen des Stadtarchivs Siegen sowie auf die „Ordensakte“ im Duisburger Landesarchiv. Die Auswertung dieser Archivalien erfolgte hier am 10. Mai 2023.
Bei der Bewertung des politischen Verfahrens sind wir zwar nicht so weit auseinander; aber dem Rat der Stadt Siegen steht es zu, eine Entscheidung selbst zu fällen.
Schließlich empfehle ich noch einmal die im Abschlussbericht des „Strassennamenarbeitkreises“ gemachten Bewertungskriterien mit den konkreten Entscheidungen abzugleichen. Für mich jedenfalls ist das Ergebnis klar: Edith Langner gilt als unbelastet – unter Vorbehalt, dass keine neuen Quellen erschlossen werden. Dies jedoch gilt für alle Personennamen der Kategprien B und C des Abschlussberichtes.
Ich habe lange mit mir gerungen, ob es überhaupt angemessen ist, auf die die Anwürfe eines Anonymus („ein Anwohner“) an mich persönlich zu antworten. Ich halte diese Form der Auseinandsersetzung für nichts weniger als eine Unverschämtheit! Aber da Stillschweigen als Einvernehmen mit dem Schreiber gewertet würde, hier nur so viel: Ich schließe mich inhaltlich voll und ganz den vorstehenden Ausführungen von „Archivar“ an. Im Kern ging es mir darum aufzudecken, wie die Anwohner mit der „Personalie Edith Langner“ durch falsche Interpretation von Fakten versucht haben, Geschichte zu instrumentalisieren.
Irle versuchte sich beständig als Dichter – s. folgende Beispiele:
National-Zeitung, Siegener Ausgabe, 11. Januar 1940:
National-Zeitung, Siegener Ausgabe, 1. Oktober 1940:
National-Zeitung, Siegener Ausgabe, 3. September 1941; Wittgensteiner Ausgabe, 4. September 1941:
National-Zeitung, Siegener Ausgabe, 28. März 1942:
National-Zeitung, Wittgensteiner Ausgabe, 6. August 1942:
Eine löbliche Ausstellung! Zur Ergänzung dieses Blogeintrags und des umfangreichen Berichts in der Siegener Zeitung von morgen ein Link auf die seit Jahren bestehende Seite der VVN:
In dem heutigen Artikel „Denkmäler für Arbeiterinnen. Frauen und ihre Leistungen sollen sichtbarer werden im Siegener Stadtbild“ in der Westfälischen Rundschau erwähnt am Rande auch die von den Anwohner:innen kritisierte Benennung der Edith-Langner Straße.
Zitat aus Christian Brachthäuser:Ein „Schöpfungsakt von säkularer Bedeutung“ Zur wechselhaften Gründungsgeschichte der Gesamthochschule Siegen, Link:
„….. Schließlich wäre die Auflösung der PH-Abteilung Siegerland auch in erst einigen Jahren ein „
[…] bildungspolitischer Rückschritt, verbunden mit einer Fehlinvestition größten Ausmaßes“, wie es die CDU-Landtagsabgeordnete Edith Langner formulierte. ….“ Als Quelle für diese Äußerung wird dort die Westfalenpost Nr. 277 vom 1. Dezember 1969 angegeben.
Danke für den Hinweis! Mein Versehen. Ich tausche die PDF, sobald es mir möglich ist, aus. M.E. waren die fehlenden Fragen im Hinblick auf die Biographie Langners in der NS-Zeit nicht sehr aussagekräftig.
[Nachtrag 26.10: Austausch ist erfolgt]
Zur Vorberichterstattung in der Siegener Zeitung am 25.10.2023 erschien folgender Kommentar:
Das Abstimmungsergebnis im gestrigen Kulturausschuss lautet:
Punkt 1 des Antrags (Gedenktafeln) wurde gegen die Stimmen der AfD zugestimmt.
Punkt 2 des Antrags wurde mit den Stimmen von CDU und SPD abgelehnt.
Punkt 3 des Antrags „Die Verwaltung möge eine Auftaktveranstaltung für die Ehrung von Frauen im Stadtbild Siegens aus Anlass des Stadtjubiläums 2024 planen, in der Frauen, die aktuell oder in der jüngeren Vergangenheit prägend für Siegen waren, zu Wort kommen (z.B. Silvia Neid, Anna Heupel, Annemarie Carpendale o.Ä.). Eine Podiumsdiskussion wird angeregt.“ Diesem Änderungsantrag der VOLT wurde gegen die Stimmen der AfD zugestimmt.
Kommentar „Siegens schwarz-rote Kulturpolitiker haben es nicht verstanden.“ in der Siegener Zeitung (27.102023) von Susanne El Hachimi-Schreiber zur Abstimmung im Siegener Kulturausschuss:
„Eine GroKo aus SPD- und CDU-Mitgliedern im Kulturausschuss hat gestern den Vorschlag der Stadtverwaltung abgelehnt, ein Denkmal für die hart arbeitenden Frauen der Siegerländer Kulturgeschichte zu errichten. Die Kulturredakteurin der SZ, Susanne El Hachimi-Schreiber, ist fassungslos angesichts eines solchen Mangels an Verständnis.
„Sie haben es nicht verstanden…“ Nicht nur die Kulturamtsleiterin Astrid Schneider war fassungslos, nachdem der Beschlussvorschlag zur Prüfung der Voraussetzungen zur Schaffung eines stadtbildprägenden Denkmals zur Ehrung arbeitender Frauen durch die Stimmen von SPD und CDU abgelehnt wurde.
Man muss es Kulturdezernent Arne Fries und Astrid Schneider zugutehalten – sie haben wirklich versucht, den Mitgliedern des Kulturausschusses zu erklären, welche Chance ein stadtbildprägendes Denkmal zur Ehrung einer Gruppe von Frauen beinhaltet. Aber die Mitglieder der SPD und CDU haben es trotzdem nicht verstanden:
Traute Fries (SPD): „Eine Statue oder Skulptur ist nicht zeitgemäß.“ Die Stadt hatte in der Vorlage dargelegt, dass sowohl die Leitung des Siegerlandmuseums als auch des Museums für Gegenwartskunst involviert sind. Aber was verstehen sie schon von zeitgenössischer Kunst? Fries findet eine Fotoausstellung versteckt im Rathaus oder ein weiterer Bildband zu Frauen-Biografien zeitgemäßer. Auf die Frage, inwiefern Fotoausstellungen oder Bildbände das Stadtbild prägen, gab es als Antwort: „Dann müssen die Leute halt mal ins Rathaus oder in die Volkshochschule gehen.“ Nicht verstanden.
Ausschussvorsitzende Sybille Schwarz (SPD): „Die Statuen von Henner und Frieder stellen keine Männer dar, sondern stehen symbolisch/exemplarisch für den Bergbau und die Hüttenindustrie.“ Ja, genau das ist das Problem: Männer stehen symbolisch für eine ganze Gesellschaft. Außerdem: „Die Tätigkeiten, die mit der Darstellung eines Erzengels oder einer Haubergsbäuerin dargestellt würden, waren Hilfstätigkeiten und keine wirklichen Berufe.“
Diese Bewertung der Tätigkeiten von Haldenfrauen oder auch Haubergsbäuerinnen nicht als echte oder vollwertige Berufe zu begreifen und sie deshalb für nicht darstellenswert zu erachten, ist gelinde gesagt schwierig. Natürlich waren Frauen nicht in leitenden Positionen im Bergbau oder Hüttenwesen beschäftigt. Natürlich wurden typische Frauenarbeiten, so wie heute, gering geschätzt.
Aber umso mehr ist so eine Skulptur eine Chance, auch darauf hinzuweisen. Denn genau dieses Problem haben wir heute noch: Tätigkeiten, die hochgradig gesellschaftsrelevant sind und traditionell weiblich, wie zum Beispiel Care-Arbeit, werden nicht als Berufe anerkannt. Nicht verstanden.
Wirklich sprachlos machte jedoch die Begründung von Isabelle Cathrin Schmidt (CDU): „Eine oder sogar zwei Frauenskulpturen einfach nur als „GEGENstatue“ zu Henner und Frieder zu erstellen, weil es Männer sind, das finden wir nicht richtig.“ Da wird es dann wirklich gefährlich.
Denn diese Begründung trägt den Gedanken in sich, dass Bestrebungen zur gesellschaftlichen Gleichstellung von Frauen sich GEGEN Männer richten würden. Gedankengut, das man an Stammtischen oder, wie es heute heißt, auf „Facebook“ findet. Nicht verstanden.
Es bleibt die Hoffnung auf den Haupt- und Finanzausschuss im November. Dort sitzen andere Vertreter der SPD und CDU – vielleicht haben sie es ja verstanden.“ Link
Leserinnen-Brief von Helga Dellori an die SZ-Redaktion zum SZ-Artikel „Schwarz-Rot blockiert stadtbildprägendes Arbeiterinnen-Denkmal“ und Kommentar vom Sa 28.10.2023 und zum Kommentar (s.o.)„Siegens schwarz-rote Kulturpolitiker haben es nicht verstanden:“ von Susanne El Hachimi-Schreiber
„Die mehrfache Bewertung im Kommentar von Frau El Hachimi-Schreiber …nicht verstanden zur Diskussion und Votum im Kulturausschuss halte ich für völlig unangemessen, insbesondere mit dem Tenor, dass Frauen eine ablehnende Meinung zur Frage des Denkmals eingenommen haben.
Wieso sollten Frauen kraft Geschlecht einheitliche Positionen zu einem Sachverhalt einnehmen, bei einer gesellschaftlichen Bandbreite die aktuell mal mindestens von Sahra Wagenknecht bis Frau Weidel, Frau von Stosch, Frau Eger-Kahleis. reicht. Das ist doch völlig absurd. Allem Anschein nach versucht Frau El Hachimi-Schreiber über ihre berufliche Tätigkeit Einfluss zu nehmen.
Der Bürgerinnenantrag aus 2020, der Pressetermin im September bis hin zum aktuellen Artikel verfolgt das Ziel – die Haube und die Haubergsfrauen als Symbol in Form einer Skulptur für die gesellschaftliche Leistung von Frauen zum Stadtjubiläum sichtbar zu machen. Dazu trat Heinz-Dieter
Sassenberg im Pressetermin auf, der in epischer Breite den versammelten Frauen die Welt der schweren Frauenarbeit, insbesondere im Haus, der Landwirtschaft und im Hauberg meinte erklären zu müssen.
Die Würdigung der gesellschaftlichen Leistung von Frauen, der bezahlten und der unbezahlten, verdient sichtbar zu werden im öffentlichen Raum der Stadt Siegen; allerdings zeitgemäß, die Haube, Haubergsfrau, in Demutshaltung sind dafür ungeeignet. Der aktuelle Beitrag zur Blüte der Textilindustrie mit vielen Frauen in Heimarbeit zeigt – „der Stoff war wichtiger als das Erz“. (Dr. Bartolosch, SZ 28.10.2023), im Verlauf der Geschichte.
Der Vorschlag von Astrid Schneider, die m.E. sehr gut die Meinungsvielfalt und eine mögliche praktische Umsetzung in der Verwaltungsvorlage aufgezeigt hat, verdient mehr Diskussion. Und Frau El Hachimi-Schreiber wer so einseitig und selbstgerecht agiert und schreibt, sollte doch wenigstens
die Fakten richtig erwähnen. So wird in der 2. Spaltes des o.g. Artikels Astrid Schneider zu Astrid Schmidt und die Wiedergabe des Beitrags von Traute Fries aus dem Kulturausschuss ist schlicht und ergreifend falsch. In dem mir vorliegenden Wortbeitrag von Traute Fries wird kein Bildband und keine Ausstellung zu Frauen aus der NS-Zeit vorgeschlagen.
Mein Fazit: Frau El Hachimi-Schreiber, Aufgabe sorgfältige Journalistin … nicht verstanden.
Als Initiatorin der Gewerkschafts-Frauen für Waltraud Steinhauer halte ich fest, dass es kein Votum für oder gegen eine Skulptur o.ä. gibt. Für unseren Vorschlag Waltraud Steinhauer haben wir als geeignetes Medium für eine Tafel mit Foto und biografischen Daten votiert und freuen uns, dass dies breite Zustimmung findet und zum Stadtjubiläum 800 Jahre Stadt Siegen realisiert wird.“
Dank gilt Frau Dellori für die Bereitschaft den bisher unveröffentlichen Leserinnenbrief hier auf siwiarchiv einstellen zu dürfen!
Gestern erschienen in der Westfälischen Rundschau 2 Leserbriefe zur Kulturausschusssitzung – „Chance vertan“ widmet sich dem Sitzungsverlauf, der zweite Leserbrief schlägt vor den „Herrengarten um[zu]benennen“: in „Herren-Damen-Garten“.
Heuten erschienen die beiden schon in der Westfaälischen Rundschau veröffentlichten Leserbriefe auch in der Siegener Zeitung. Zusätzlich erschien noch der Leserbrief „Brauche kein Denkmal“, der das Denkmal als Quotendenkmal kritisiert.
„Schreiben bis zum gewünschten Ergebnis – Diplomatisches Protokoll oder Sitzungsmitschrift – sie sind gar nicht so verschieden, sagt Medienwissenschaftler Peter Plener, sondern Ergebnis eines vorherigen Aushandlungsprozesses. Wahrheiten enthält ein Protokoll aber nur bedingt.“ aus dem Podcast „Lesart“ (Deutschlandfunk, 4.11.23) – Link
Das Stadtarchiv Siegen ist zwecks telefonischer Terminvereinbarung für einen angestrebten Archivbesuch ab sofort unter der Festnetz-Nummer 0271 / 404-3095 und per Email unter stadtarchiv@siegen-stadt.de erreichbar! Allerdings ist die Benutzung nach wie vor mit Einschränkungen verbunden, da der Zugriff zur Archivdatenbank und zum Katalog der wissenschaftlichen Bibliothek zur Regionalgeschichte zurzeit noch nicht möglich ist. Das Stadtarchiv empfiehlt in regelmäßigen Abständen die Notfall-Homepage der Stadtverwaltung (www.siegen-stadt.de) aufzurufen, um sich über Neuigkeiten und eventuelle Anpassungen der Archivbenutzung zu informieren.
Der Haupt- und Finanzausschuss hat das Denkmal knapp abgelehnt (auf jeden Fall mit Stimmen der CDU und SPD). [Anm. v. 21.11.23: Folgendes Abstimmungsergebnis ist siwiarchiv gegnüber übermittelt worden: 8 ja, 8 nein, 1 Enthaltung durch den Bürgermeister]
Die Redakteurin der Siegener Zeitung hat mich in ihrem Bericht vom 28.10.2023 falsch zitiert. Ich habe keinen Bildband und keine Fotoausstellung im Siegener Rathaus zu konkreten Frauenbiografien aus der NS-Zeit vorgeschlagen. Die SZ hat die Richtigstellung verweigert! Daher der Wortlaut meines Beitrags, den ich im Kulturausschuss vorgelesen habe.
Frauen in der Arbeitswelt – Pendant zu Henner Frieder
Die Siegerländer Symbolfiguren von Prof. Friedrich Reusch, wurden 1902 auf der Industrie-ausstellung in Düsseldorf ausgestellt und später auf die Siegbrücke, gestellt. Sie sollten m. E. auf die beiden Berufe beschränkt bleiben. Die Figuren können in gewissem Maß als patriarchalisch angesehen werden. Eine Frauengestalt in Bronze wäre nicht zeitgemäß.
Ich halte die Darstellung auf Fotos für passend.
Erzengel und Haubergsfrauen haben jeweils in Gemeinschaft gewirkt und sollten mittels vorhandener historischer Fotografien dargestellt werden. Fotos von den Haubergsfrauen sind in dem Bildband von Otto Arnold „Siegerländer Arbeitswelt“ von 1985 reichlich vorhanden. Ebenso ein Foto der Erzengel sowie Frauen in der Leimherstellung und beim Spinnen.
Horst Günter Koch gibt im Buch „Erzväter“ (1982) die Erzengel am Leseband auf einem sehr anschaulichen Foto wieder (S. 221), ebenso die Übertagebelegschaft 1906 mit Mädchen u. Jungen, Frauen und Männern vor Röstöfen der Grube „Henriette“ in Niederschelden (S. 83).
Auf dem Foto in „Bevor die Lichter erloschen“ von H.G. Koch ist die Belegschaft der Grube „Apfelbaumer Zug“ von 1908 ebenfalls mit Mädchen, Jungen, Frauen und Männern zu sehen.
Beim Blättern im Buch von H. G. Koch „Feuer u. Eisen“ von 1970 fand ich das Foto von der bundesweit einzigen Hochöfnerin Gertrud Siebel, die 1946 bei der Birlenbacher Hütte zu-nächst als Kauffrau im Einkauf u. Lohnbüro arbeitete. Sie wurde von Dr. Marenbach angelernt, die Möllerung/Beschickung des Hochofens für die Roheisen-Sorten zu steuern. Das hat sie über Jahrzehnte mit großer Leidenschaft gemacht. An sie könnte ebenfalls erinnert werden.
Es war nicht die Masse der Frauen, die in der Siegerländer Schwerindustrie arbeitete. Ich erinnere mich noch an Kolleginnen bei den Stahlwerken, die wegen des Krieges als Kranführerinnen tätig waren, z. B. Anneliese Hahmann und Ilse Kessler. Die meisten Frauen waren in kaufmännischen, technischen, erzieherischen/schulischen, pflegerischen, landwirtschaftlichen und handwerklichen Berufen tätig. Nicht vergessen werden darf die Arbeit der Mütter und Hausfrauen. Sie waren teilweise zusätzlich im Hauberg und der Landwirtschaft tätig.
Mir persönlich wäre es auch ein Anliegen, an Opfer des Nationalsozialismus zu erinnern. Da schlage ich die junge Inge Frank (1922-1943) und Lina Althaus (1910-1943), beide aus Weidenau, vor. Das Leben von Lina Althaus galt als „lebensunwertes Leben“ und wurde in Hadamar ausgelöscht.
Die Fotogalerie sollte in Gebäuden der Stadt ausgestellt werden. Vielleicht in einem ersten, temporären Durchlauf im Ratssaal. Sie könnten mal vorübergehend die Gemälde der Frauen, die aufgrund ihrer Geburt privilegiert waren, ersetzen.
Sollten die Fotos im öffentlichen Raum angebracht werden, müssten sie gesichert werden.
Am 17.11.2023 erschien in der Kulturrubrik der Siegener Zeitung folgende kurze Notiz zum Sitzungsverlauf:
Einen Tag später erschien in der Westfälischen Rundschau der Artikel „Siegen: SPD lehnt Denkmal für arbeitende Frauen komplett ab“ und der Kommentar „Das, Sieener SPD, ist peinlich für eine´Arbeiterpartei´“ von Hendrik Schulz. Beides wird auf der Facebookseite der Zeitung kommentiert.
In der heutigen Ausgabe der Siegener Zeitung erschien im Kulturteil der Artikel “ Frauendenkmal geht auch zeitgemäß“, der die Venuskogge in Uelzen als gelungenes Beispiel anführt.
In der Westfälischen Rundschau finden sich heute im Print die Leserbriefe „Ohne Frauen ging es nie“ und „Fotos sind würdiger“
Gestern hat der Rat mehrheitlich beschlossen, dass der AK Strassennamen, Vorschläge für ein Kunstwerk – kein Denkmal – in öffentlichen Raum erarbeiten soll. Man mag mich korrigieren, wenn ich mich irre. Der Ton der Debatte folgte den jüngsten erinnerungspolitischen Diskussionen.
Heute erschien in der Westfälischen Rundschau der Artikel „Sie zanken wie die Kesselflicker. Debatte um Denkmal für arbeitende Frauen kocht im Rat noch ein weteres Mal hoch.“
Heute erschien in der Siegener Zeitung der Artikel „Frauenforum will mitreden“, der die Forderung des Forums nach einer beratenden Teilnahme an den Sitzungen des zuständigen Rats-Arbeiskreises (Strassennamen) wiedergibt.
En jo ihr Lagömbeser dad wird Zworn alles a de Chinese verscherwelt….bis de rore Genosse idr moschee dr lälles fa kinderbuchautor un dat furchtbare baerböckche….dad ganze heimatländche bid dem Olaf fa hamburch vollends vor de Wand jedeut ha….wad für wirre Lü Sinn dad bloß nur dumm Züch em Kopp….
Schepp veröffentlichte 1898 eine Zusammenstellung dreier Vorträge unter dem Titel “ Ländlichen Wohlfahrtseinrichtungen. Vorschläge aus der Praxis“. Die Vorträge „Eine Haushaltungsschule für das Land“, „Die Krankenpflege auf dem Land“ und „Die Wiederbelebung des Instituts der Waisenräte durch Einrichtung von Waisenämtern“ wurden für die Drucklegung mit Anhängen versehen.
Leider kann man zurzeit die Digitalisate, welche 2021 veröffentlicht wurden (Register zu diversen Standesamtsbüchern), nicht öffnen. Bei allen zeigt der DFG-Viewer nur eine weiße Seite an.
Gibt es eine Möglichkeit, das Ganze zu beheben?
Leider hat dieses Problem mit dem Cyberangriff auf die Südwestfalen-IT zu tun. Die Behebung der Probleme kann noch lange dauern, da die Wiederherstellung des Verwaltungshandeln Priorität hat.
Hallo, Brigitte, auch ich war von 1974-1976 in der Tagesschule Englisch und an die Reise nach London mit Dr. Bode im Grosvenor Victoria Hotel kann ich mich ebenfalls erinnern. Wir haben in der Sprachenschule sehr viel gelernt (auch über den Tellerrand hinaus) und Frau Bode war in ihrem Grammatikunterricht äusserst gründlich und gewissenhaft. Ich erinnere mich gerne an die Zeit zurück. Die Ausbildung hat mir einen guten Arbeitsplatz beschert. Nun bin ich auch schon im Ruhestand und grüsse hiermit alle ehemaligen Schüler und Schülerinnen des o.g. Jahrganges. Viele Grüsse von Birgit aus Bremen
Hallo, ich habe den tollen Film im Heimhoftheater, Würgendorf sehen dürfen. Im Film wurde Werbung für mobile Bauwagen gemacht, die man individuell mieten kann. Können Sie mir diesbezüglich einen Kontakt senden?
Als Kind welches in Siegen geboren wurde,habe ich die bedrückende Gemeinschaft einer Brüdergemeinde in Hilchenbach kennengelernt. Mein Opa war Unternehmer und hat diese pietistische ,sektiererische Gemeinde geleitet.Laienprediger,das war er,wo auch immer er ursprünglich her war.Ich bin dann in jungen Jahren nach Berlin gegangen,was für mich Freiheit im Denken pur war. Nichts hat mich an dieses Siegerland gebunden,ich war froh,dieser entsetzlichen Enge zu entkommen.Diese Gemeinden ,“Frei“kirchen gibt es immer noch. Es ist alles grau und schwarz wenn ich an diese 18 Jahre Siegerland zurückdenke.
Mit ihrer Dissertation („Schmerzenskinder der Industrie“) behandelt Dr. Ulrike Gilhaus „Umweltverschmutzung, Umweltpolitik und sozialer Protest im Industriezeitalter in Westfalen 1845 – 1914“.
Zahlreiche Beiträge des umfangreichen Werkes (600 Seiten) sind m.E. gut geeignet, den Ursache/Wirkung-Zusammenhang in der Stadtentwicklung Siegens deutlich zu machen und damit ein anspruchsvoller Beitrag im Jubiläumsjahr sein.
Auf Anfrage stelle ich gern 1 Expl. leihweise/unentgeltlich zur Verfügung.
Nach ca, 50 Jahren privater Ahnenforschung und den damit entstandenen
Erfahrungen und Enttäuschungen kann ich nur voller Hochachtung auf
das Werk von Jochen Karl Mehldaus “ Wittgensteiner Familiendatei “
blicken und meine Glückwünsche dazu aussprechen,
Mit freunlichen Grüssen aus dem Sauerland
Horst Rother
“ …. Am Mittwoch, 14.02.2024, um 17.00 Uhr startet die Ausstellung zu 50 Jahren Partnerschaft der Kreise Siegen-Wittgenstein und Emek Hefer in Israel im Bürgerhaus am Markt in Bad Berleburg offiziell. Das Jubiläum hatte 2023 stattgefunden, inzwischen besteht die Partnerschaft also sogar 51 Jahre. Der Verein für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Siegen hat die Ausstellung erstellt, die die Geschichte der Partnerschaft lebendig werden lässt. „Es sind die Menschen die diese Partnerschaft geprägt und mit Leben erfüllt haben“, lautet eine der zentralen Aussagen der Ausstellung, die einlädt sich zu informieren, auszutauschen und an der Weiterentwicklung der Partnerschaft mitzuarbeiten. Nachdem die Ausstellung in Siegen zu sehen war, wird sie nun also auch in Bad Berleburg gezeigt. Dazu sind alle Interessierten herzlich eingeladen. In die Ausstellung führt Heiner Giebeler vom Freundeskreis für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Siegen mit Wort und Bild ein. Die Ausstellung ist ab diesem Tag bis Donnerstag, 14.03.2024, zu den Öffnungszeiten der Tourist-Info im Foyer des Bürgerhauses am Markt zu sehen. Der Eintritt ist frei.“
Quelle: Stadt Bad Berleburg, Meldung vom 31.01.2024
Im Bildbestand „Sammlung LVA Westfalen: Wohnungsnot und Wohnbauförderung in den 1920er-1950er Jahre“ des LWL-Medienzentrums für Westfalen befindet sich unter der Archivnummer 03_3704 eine undatierte Porträtaufnahme Salzmanns von Ernst Krahn. Online kann eine Entnazifizierungsakte Salzmanns eingesehen werden (Landesarchiv NRW, Abt. Rheinland, NW 1039-S (SBE Hauptausschuss Regierungsbezirk Münster), Nr. 1011.
Im Berliner Bundesarchiv befindet sich eine Personalakte Salzmanns: R 3001 (Reichsjustizministerium), Nr. 73369.
mac paper, wurstkönig, hussel, city galerie, douglas, glücksstück, italienische pizza, ulla popken, liberty, dertour, adam&eve … und der ach so quirlige moderator hat fusseln am anzug.
in dreieinhalb von fünf minuten bekomme ich belangloses gequassel und werbung für die unterstadt-mall um die ohren, eine minute lang immerhin wird das wappen erklärt.
kein einziges bild des videos zeigt jedoch eine aussenaufnahme, zb. mit der martinikirche, auf die ja das stadtwappen vermutlich hinweist. das sind zu wenige facts, liebe leute, und noch weniger fun, sondern schlechtes konzept.
bitte neu machen!
Vielen Dank für den Kommentar!
Dies offensichtlich sehr niederschwellige Infotainmentangebot hätte m. E. eine Projektbeschreibung (inzwischen liegen drei Filme vor) verdient gehabt. Ziele und Zielgruppe hätten dort definiert werden können. Die eher knappe Auflösung im Siegener Stadtarchiv (Blick aus dem Multifunktionsraum in den Benutzerraum) hätte zudem mit weiterführenden Angaben zum Thema ebenfalls ergänzt werden können. youtube bietet dafür ja die Möglichkeit.
Etwas überraschend ist die Einordnung des Wappens als „funfact“. Sind Wappen wirklich nur noch eine amüsante, interessante Nebenbemerkung?
Westfälische Rundschau (online hinter der Bezahlschranke, daher nicht verlinkt) schreibt am 21.2.: “ Die neue Leitung sollte schon im August [des vorigen Jahres] ihren Dienst antreten. …. Die Ausschreibung sei „ergebnislos“ gebleiben, heißt es jetzt aus dem Rathaus, wobei offen gelassen wird, ob die Bewerbungen nicht geeignet waren oder sich niemand beworben hat. …..“
Literatur
Die Siegerländer Chronik im Siegerländer Heimatkalender (1936) vermeldet für den 18.07.1935: „Regierungsassessor Melcher übernimmt die Vertretung des Landrates.“
Joachim Lilla: Leitende Verwaltungsbeamte und Funktionsträger in Westfalen und Lippe (1918-1945). Biographisches Handbuch, Münster 2004, 218-219
Archivalien:
Bundesarchiv Berlin
R 3001(Reichsjustizministerium) /68012, [Personalakte]
R 9361-II/701684 (Sammlung Berlin Document Center (BDC): Personenbezogene Unterlagen der NSDAP / Parteikorrespondenz)
Als Bezeichnung für eine nicht eng ortsgebundene, sich mit kleinem Handel etwa mit irdenem Geschirr auf den Weg machende Bevölkerungsgruppe ist „Meckes“ keine Siegerländer Besonderheit, sondern weit verbreitet gewesen vom südlichen Sauerland bis zum Unterelsass. Auch übrigens als Familienname von Angehörigen dieser Sozialgruppe.
Guten Tag,
gibt es inzwischen eigentlich eine neuere Ausgabe der Siegener Beiträge? Die letzte ist offensichtlich die Ausgabe 27/2022 bzw. der Sonderband 2022. Ist danach keine neue Ausgabe mehr erschienen? Wann ist eine neue Ausgabe geplant
Guten Tag Herr Ahlering,
schauen Sie bitte einmal hier https://geschichtswerkstatt-siegen.de/
Dort finden Sie fast alle der gewünschten Auskünfte. Wir versuchen unsere Homepage so aktuell zu halten wie möglich. Über die Kommentarfunktion können Sie auch nachfragen, ob und wann eine neue Publikation erscheint.
Noch mehr Links zum Thema: https://www.bibliotheksverband.de/sites/default/files/2024-01/ArsenHandreichung2023-12-08.pdf
= ausführliche Stellungnahme des DBV, Stand Dezember 2023, mit Berücksichtigung der Vorarbeiten von UB Kiel, ULB Bonn und FH Köln. https://sites.udel.edu/poisonbookproject
= Homepage des von zwei Restauratorinnen an der University of Delaware 2019 ins Leben gerufenen interessanten „Poison Book Project“.
Zeitlich knapp vorausgegangen (2018) war die Zufallsentdeckung der Arsen-Kontamination dreier Bücher aus dem 16. und 17. (!) Jahrhundert in einer dänischen Bibliothek: https://theconversation.com/how-we-discovered-three-poisonous-books-in-our-university-library-98358
Es ist eine Binsenweisheit, dass alles, was in der Vergangenheit – vor allem, aber keineswegs nur, während des Aufschwungs der chemischen Industrie im 19. Jahrhundert – mit anorganischen Substanzen gefärbt wurde, potentiell gesundheitsgefährdend wirken kann, einschließlich sämtlicher für die Buchherstellung verwendeter Materialien. Dass diese seit Erfindung solcher Farben grundsätzlich bekannte Tatsache, der z.B. schon vor zwei Jahrhunderten in Lehrbüchern für Buchbinder Arbeitsschutzempfehlungen gewidmet waren, nun seit wenigen Jahren von Bibliothekaren als „neue Erkenntnis“ verkauft wird, ist ein kulturhistorisch interessantes Phänomen. –
Ganz unabhängig davon, ob tatsächlich ein akutes Problem für heutige Bibliotheksbenutzer vorliegt, das sofortige brachiale (und teure) Maßnahmen wie in Bielefeld, Siegen usw. erzwingt, oder sich alles nur als Sturm im Wasserglas („Viel Lärm um nichts“, wie es manche Fachkollegen anderwärts sehen) herausstellt: Die interessierte Öffentlichkeit sollte bei beiden Szenarien erwarten dürfen, dass sich die bibliothekarischen Spezialisten gründlich und konsequent mit dem Thema beschäftigen, bevor sie entweder die Leser ihrer Bücher vor qualvollem Siechtum warnen oder anderenfalls einfach die Kirche im Dorf lassen. Dreierlei zeugt aber weder von gründlicher Recherche noch von konsequenter Verfolgung eines zweifellos gutgemeinten Anliegens:
1. die in den Verlautbarungen seit 2018 immer wiederkehrende Hervorhebung der „verdächtigen“ Farbe Grün und Fixierung des Blicks auf arsenhaltige Farbstoffe: So wird dem fachfremden Publikum suggeriert, alle anderen Farben und seinerzeit verwendeten Metallverbindungen seien für die Beurteilung von Toxizität vergleichsweise irrelevant. Neben Arsen (häufig in anderer als grüner Farbgebung) kamen in breitem Umfang Salze von Chrom, Blei, Quecksilber, Cadmium, Kupfer und anderen Metallen als Farbstoffe zum Einsatz, die in ihrer Giftigkeit dem Arsen kaum nachstehen.
2. die aus Bielefeld mehrfach wörtlich übernommene Behauptung „Ledereinbände sind nicht betroffen“: Speziell im Siegerland mit seinem einst florierenden Ledergewerbe, aber auch anderenorts, sollte bekannt sein, dass seit dem 19. Jahrhundert die traditionell verwendeten Naturgerbstoffe (z.B. Eichenrinde) durch chemische Substanzen ersetzt wurden – in erster Linie durch hoch giftige Chromverbindungen (aber auch solche des Arsens und anderer Metalle). Diese dürften in den historischen Ledereinbänden sogar in höherer Konzentration vorliegen als ähnlich wirkende Gifte in gefärbten Vorsatzpapieren oder auf Buchschnitten und könnten, da sie bei der Lektüre am intensivsten berührt werden, ein Gesundheitsrisiko – z.B. für Allergiker – darstellen. Potentiell giftige Stoffe können ferner textile Bucheinbände (nicht nur gefärbte Papp-Deckel) kontaminieren; auch können sie während der gesamten Zeit, in der für den Buch- und Zeitungsdruck Bleilettern verwendet wurden, auf die Schriftseiten gelangt sein. Der Einsatz ungesunder Chemikalien schon bei der Papierfabrikation (oder davor der Pergamentherstellung) wäre gleichfalls zu bedenken. Kurzum: In jedem Teil eines Buches (farbige Illustrationen übrigens eingeschlossen) würde man, wenn man es darauf anlegt, auf Spuren von Giften stoßen können.
3. der regelmäßig wiederholte Verweis auf das „19. Jahrhundert“ oder gar nur Abschnitte desselben als Untersuchungszeitraum: Mit anorganischen Alternativen zu teuren oder unbefriedigenden pflanzlichen und tierischen Farbstoffen wurde experimentiert, seit der Bergbau farbenprächtige Mineralien ans Licht brachte. Gesundheitlich riskante Farben kamen definitiv lange vor 1800 zum Einsatz. Auch spricht nichts dafür, dass ihr Einsatz pünktlich im Jahre 1900 generell und international schlagartig zurückgegangen wäre und für die Massenproduktion von Büchern bis weit ins 20. Jahrhundert hinein keine Rolle mehr gespielt hätte. –
Solche buchhistorischen Reminiszenzen helfen natürlich kaum bei der Abwägung realer Gesundheitsrisiken. Diese müssen die Bibliothekare ohnehin medizinisch oder toxikologisch qualifiziertem Personal überlassen, wobei auch bei solchen Experten eine gewisse Meinungsvielfalt vorauszusetzen ist. Ein wenig Trost könnte den aufgescheuchten Bibliothekaren und von ihnen in Panik versetzten Bibliotheksbenutzern vielleicht der sogenannte „gesunde Menschenverstand“ spenden: Im Vergleich zu der Gesamtmenge gesundheitsgefährdender Schwermetalle, die jeder Erdbewohner während seines Lebens aus zahllosen Quellen seiner Umwelt aufnimmt und langfristig im Körper speichert, dürften die eher homöopathischen Dosen, die man sich gelegentlich bei der Lektüre von Büchern vielleicht einfängt, kaum ins Gewicht fallen. Für eine verringerte Lebenserwartung von Berufsgruppen, die jahrzehntelangen besonders engen Kontakt zu historischen Büchern pflegen (Bibliothekare, Antiquare, manche Gelehrte) oder Völkern, die sich intensiv vom bekanntlich stark arsenbelasteten Reis ernähren, spricht statistisch nichts – ganz im Gegenteil!
(PS: Als Siwiarchiv-Geschädigter weise ich vorsorglich darauf hin, dass dies ein Selbstgespräch war und ich auf die zu erwartenden Unhöflichkeiten gewisser Widersacher nicht reagieren werde.)
Sehr geehrte Damen und Herren, leider sind mir meine Unterlagen für das Geschlechterbuch Delius verlorengegangen. Könnten sie mir bitte eine Kopie senden damit ich es vervollständigen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Anna von Delius
In der Siegener Zeitung vom 9.2.2024 erschien der Leserrief „Andere Gefahren größer“ von Dr. Winfried Leist, Bibliotheksdirektor a.D.:
„Da wird wieder einmal mit Kanonen auf Spatzen geschossen bzw. eine Mücke zum Elefanten aufgeblasen. Sicherlich gibt es eine Gefährdung durch ältere Bücher. Aber sie ist sehr gering im Vergleich zu den tatsächlichenund sehr viel größeren Gefahren, mit denen wir täglich in unseren Städten leben. Etwa durch Asbest, den sehr viiele neuere Häuser ausdünsten. Sein Verbot konnte 1990 nur gegen vielen Widerstand im Bundestag durchgesetzt werden. Hier sind Todesfälle aktenkundig – in Bibliotheken nicht.
Oder die Gefährdung durch den Feinstaub von abgasen und Abrieb von Reifen. Eine ernste Gefährdung sehe ich auch durch die Produkte unserer Lebensmittelindustrie. Hier wären strengere Gesetze und Überwachung dringend erfordelich. Aber die Industrie wünscht sie auf keinen Fall und setzt das durchihre Vertreter im Bundestag durch.
Durch Sensationsartikel über zumeist harmlose alte Bücher wird wieder einmal eine dringend notwendige Diskussion auf ein Abstellgleis geleitet und die Öffentlichkeit vergackeiert.
Ich selbst bin jetzt 86 Jahre alt, habe sehr früh mit vielen alten Büchern zu tun gehabt und bin gesundheitlich noch immer in einem dem Alter zum Trotz recht guten Zustand. Da habe ich offenbar in gefährlicher Umgebung viel Glück gehabt. Nicht nur ich. Denn ich kenne iele alte Kollegen und Wissenschaftler, die offenbar das gleiche Glück hatten. Kann ein in Rente lebender Arbeiter das von sich und seinen Kollegen auch sagen?“
Am 29.11.2023 fand ein Experten-Workshop zum Archivgesetz statt. Landesarchiv NRW und die kommunalen Archive in NRW (vertreten durch die Archivämter der Landschaftsverbände und Vertreter der archivischen Arbeitsgemeinschaften der kommunalen Spitzenverbände) hatten diese Veranstaltung vorbereitet. Die Dokumentation des Workshops steht noch aus. Gegen Ende des Jahres 2024 soll eine Expertenanhörung im Landtag stattfinden, so dass man „vorsichtig optimistisch“ mit einem neuen Archivgesetz im Jahr 2025 rechnet.
Zu einer Lösung kam es am 29.11.2023 auf dem Archivrechtstag. Eine Beratung durch Experten hat ergeben, dass die Integration des NRW-Archivgesetzes in das Kulturgesetz eine schlechte Idee sei. Daraufhin wurde dieses Vorhaben erstmal fallen gelassen. Ein Referentenentwurf ist bereits in Arbeit und soll frühestens Mai 2025, noch vor der Landtagswahl, entschieden werden. Das Archivgesetz soll als eigenständiges Spezialgesetz stehen bleiben. ….“
Das Ministerium legte folgenden detaillierten Zeitplan vor;
April 2024 Referentenentwurf mit Beteiligung des LAV und Leiter der LVR-AFZ
Juni 2024 Ressortabstimmung
August 2024 Verbandsabstimmmung
Ministerialabstimmung
19.11.2024 Kabinettsbeschluss
Juni 2025 Verabschiedung
Aktuell zur Arsenbelastung ist:
Torsten Arndt/Karsten Stemmerich: Zur aktuellen Diskussion um mögliche toxikologische Belastungen beim Umgang mit arsenfarben-haltigen Bibliotheksbeständen (im Druck), PDF
Am 9. März erschien in der Westfalenpost im Wittgensteiner Regionalteil der Kommentar „Nicht schon wieder! von Lars Peter Dickel über mögliche Lehren aus dieser Geschichte:
„Nicht schon wieder! Ich kann die Menschen sehen und hören, die bei der Erinnerung an die Verbrechen der Nazizeit abwinken und es einfach nicht mehr hören wollen. Die Argumente sind immer die gleichen. Ich habe damit nichts zu tun. Das ist doch lange her. Lasst die Vergangenheit ruhen!
Wa rum ich die Vergangenheit nicht ruhe lasse, ist ein Beispiel, das sich in Berleburg, meiner Heimatstadt, direkt vor unserer Haustür abgespielt hat. Und ich lasse die Vergangenheit nicht ruhen, weil man sehr viel aus ihr lernen kann. Zum Beispiel, warum wir großes Glück haben, seit fast 80 Jahren in Frieden zu leben, seit 75 Jahren ein Grundgesetz zu haben, das die Würde jedes Menschen zum obersten Gebot macht und weil wir in Freiheit und Demokratie leben.
Was wir ebenfalls aus der Geschichte lernen können, ist wie eine grausame, menschenverachtetende Diktatur eine Demkratie aushöhlt, abschafft und die Menschheit in Kriege stürzt. Das hat vor 91 Jahren mit dem Naziregime begonnen.
Und wenn wir heute von einer Konferenz in Potsdam am Wannssee hören, bei der Rechtsextreme Pläne für die Ausgrenzung von Andersdenkenden, anders Aussehenden und Andersgläubigen schmieden, dann lohnt sich ebenfalls ein Blick in die Geschichte. Nicht nur zur eigentlichen Wannseekonferenz von 1942, bei der die „Endlösung der Judenfrage“ geplant wurde, sondern zur Wittgensteiner „Selektionsbesprechung“ 1943 im Landratsamtsgebäude in Berleburg und sogar bis zu den Jahren ab 1933. Direkt nach der Machtübernahme der NAzis schmiedeten Wittgensteiner Politiker einen Plan zur „Endlösung der Z-Frage“. Wittgensteiner planten, wie man integrierte Deutsche ausgrenzt, entrechtet, ihnen nicht nur die Arbeit und Lebensgrundlage nimmt, sondern sie sterilisert, deportiert und umbringen lässt.
Mit Blick auf den aktuellen Rechtsruck in Deutschland und dem Wissen darum, was daraus erwachsen kann, sage ich dann: Nicht schon wieder!“
In seinem Artikelt „Berleburg, Keimzelle des Völkermords. Im Provinzstädtchen wird die „Emdlösung der Z-Frage“ gesucht – lange vor Krieg, Wannseekonferenz und Auschwitz“ nennt Dickel exemplarisch drei Täter: Dr. Theodor Günther, Dr. Robert Krämer und Otto Marloh.
Daneben nennt das regionale Personenlexikon für die Zeit des NAtionalsozialismus noch folgende Teilnehmer an der Berleburger Selektionskonferenz (1943): Hermann Fischer, Robert Goedecke, Ernst Graf, Josef Iking, Friedrich Peußner, Emma Rittershaus, Norbert Roters, Karl Heinrich Schneider.
Dass die Fludersbach zum Ort des sog. Hilfskrankenhauses für „Ostarbeiter“, sprich für sowjetische Zwangsarbeitskräfte, und des dazugehörigen Gräberfelds wurde, ist alles andere als ein Zufall. Die Fludersbach am Stadtrand war seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der in Siegen markanteste Ort sozialer Ausgrenzung, etwa vergleichbar mit dem Berleburger „Zigeunerberg“. Hier fanden die ein äußerst bescheidenes Obdach, mit denen die klein- und großbürgerliche Stadtbevölkerung nicht zusammenleben wollte, angeblich „Asoziale“ der unterschiedlichen Herkunft, aus der lokalen Bevölkerung, Migranten, Sinti-Nachfahren, jenischer „Meckeser“ etc. pp. Es ist insofern ein Quartier mit tradierter Exklusion bis mindestens in die 2000er Jahre gewesen, wenn ich das richtig sehe.
Als ich in den ausgehenden 1980er Jahren die Geschichte der regionalen Nazi-Zwangsarbeit erarbeitete, stieß ich im Friedhofsamt(?) auf eine zeitgenössische Kartei der verstorbenen sowjetischen Zwangsarbeitskräfte, mit Angabe der Todesursachen. Gibt es die noch? Hat die heutige Nachrecherche sie ausfindig machen können?
Die Schließung des Friedhofs dürfte darauf zurückgehen, dass er damals Objekt einer Vandalenaktion war, die leider nie aufgeklärt wurde. Die Grabsteine wurden reihenweise umgekippt. Ich meine mich zu erinnern, dass unbekannt gebliebene Täter auch gegen Schlichthäuser von Bewohnern der Fludersbach vorgingen.
Uli, es war die Sterbekartei des Städtischen Friedhofsamtes. (Quelle: „Das Schicksal der Zwangsarbeiter im Siegerland – Projektwoche der Realschule „Am Häusling“ am 27./28.06.1986, Typoskript, SS. 18 und 19)
Und noch ein Hinweis: Schon vor Jahren stellte die regionale VVN-BdA umfangreich Informationen zur regionalen Nazi-Zwangsarbeit ins Netz, die nicht zuletzt auf eigene Recherchen zurückging. Wünschenswert wäre, dass hier eine integrative historische Forschung und Präsentation von Ergebnissen stattfände. Da hätten alle mehr davon.
Ja, das war damals der erste Einstieg. Wir haben dafür einen Preis des BuPräs in dem bekannten Wettbewerb bekommen.
Für mich der Einstieg auch in eine umfassende Bearbeitung des Themas. Ich hätte mir gewünscht, im Kontext der AMS-Ausstellung dazu mal nach Siegen kommen zu dürfen Auch als langjähriges Vorstandsmitglied.
U. a. soetwas stelle ich mir als integrative und kooperativ Geschichtsarbeit vor. Da lässt sich von der damaligen Projektgruppe am Häusling noch lernen.
Die VVN-BdA Siegerland-Wittgenstein hat im Mai 2013 auf dem Friedhof in der Fludersbach eine Gedenkveranstaltung zum Jahrestag der Befreiung durchgeführt. https://www.vvn-bda-siegen.de/termine.html#mai13 Einen Schlüssel brauchten wir nicht. Dort wurde auch die Gedenkortidee und die Idee eines Verkehrsschildes mit Hinweis auf den Friedhof zum ersten Mal geäußert. Fast alle TeilnehmerInnen waren damals zum ersten Mal auf dem Friedhof und erfuhren erst duch unsere Einladung von dessen Existenz. Vor gar nicht allzu langer Zeit wurden beide Gedanken dem Bürgermeister im persönlichen Termin und auf anderem Wege vorgebracht. Ebenso die Sorge um das Verschwinden des Hilfskrankenhauses. Da der Kreisel am Schleifmühlchen gerade neu entsteht, war das für uns der richtige Zeitpunkt die Idee eines Siegener Verkehsschild „NS-Gedenkstätte“ ins Rennen zu schicken. Ich überließ auch die Pläne des KH aus Uli Opfermanns Buch dem BM. Leider haben wir nichts mehr gehört, außer das Edeka dort bauen will. Ich hatte da noch angekündigt nötigenfalls mit dem Konzern über eine Form der Erinnerung dort zu sprechen (Stolperstein, Gedenktafel, Mahnmal). Mir sind diese Hinweis an dieser Stelle hier wichtig. Was ist denn eigentlich aus der Günen-Idee geworden? Auch davon nix mehr gehört… http://zwangsarbeit-im-siegerland.de/
„Seit Anfang der 1930er-Jahre ist der zunehmende Wandel der Zeitschrift zum Organ nationalsozialistischer Propaganda zu beobachten.“
Wer hat denn diese Dummheit geschrieben???
Die Vereinigten Stahlwerke Düsseldorf waren alles andere als Hitler-freundlich, hatten auch Juden in der Betriebsleitung, die, so gut es ging, geschützt wurden. (Notgedrungen mussten sie Kriegsmaterial liefern, waren aber so wenig kooperativ und nicht mit Hitlers Aggressions-Politik einverstanden, sodass Hitler einen Alternativ-Betrieb, die Herrmann-Göring-Werke Salzgitter bauen ließ.)
„Das Werk“ war ürsprünglich die Werkszeitschrift für die Mitarbeiter der Vereinigten Stahlwerke. Sie entwickelte sich aber rasch zu einer allgemein anerkannten und von vielen Menschen außerhalb der Stahlwerke gelesenen Kultur-Zeitschrift mit großem sozialen Engagement und auf hohem Niveau.
1943 wurde sie von Goebbels „mangels Staatstreue“ eingestellt und verboten.
Wer diese Monatszeitschrift als „aufwendig produzierte Illustrierte“ bezeichnet, wird wohl nie eine Ausgabe studiert haben: Er oder sie hätte sonst bemerkt, dass wertige Beiträge aus Kultur und Wirtschaft dort erschienen und – allerdings! – die Zusammenstellung der Beiträge mit viel Aufwand so gestaltet war, dass vom einfachen Arbeiter bis zu studierten Kreisen sich jeder angesprochen fühlte. Beiträge, welche Hitler und die Nazis hofierten sind sehr sporadisch und zurückhaltend eingeflochten, auch nach 1933.
Wer sich eingehender mit den Inhalten befasst, dem muss auffallen, dass die Herausgeber sich mit Fingerspitzengefühl zwischen Duldung und Verbot durch die Aufsicht des Propagandaministeriums bewegten.
Namhafte Autoren und erklärte Befürworter der Zeitschrift, denen man kaum Nazi-Nähe nachsagen kann (wie z.B. auch Albert Schweitzer), eben solche Fotografen und Fotografinnen (z.B. Ruth Hallensleben, nach 1945 vielfach ausgezeichnet und prämiert) zeugen ebenfalls von der qualitativen und moralischen Ausrichtung.
Bleibt noch zu sagen, dass der Chefredakteur und Schriftleiter von „Das Werk“, Wilhelm Debus, unter den Nazis als „politisch unzuverlässig“ deklariert war. Hermann Göring, der mit Wilhelm Debus im ersten Weltkrieg zeitweise in der gleichen Staffel geflogen war, wusste, warum er meinen Vater in diese Schublade steckte und auch nicht zuließ, dass er im 2.Weltkrieg mitkämpfen durfte, geschweige denn, seine erfolgreiche Laufbahn als Pilot wieder aufnehemen durfte.
Noch Fragen? Ich habe alle Jahresbände von „Das Werk“ bei mir. Jeder ist eingeladen, sie zu lesen und sich ein eigenes Bild zu machen.
Aber solche Unwahrheiten, oder mindestens Halbwahrheiten, wie sie oben verfassst sind, zu verbreiten, ist nicht zu akzeptieren.
Aus der aktuellen Stunde des Westfälischen Architages 2024:
“ …. Gesundheitsgefahr Arsen – Marcus Stumpf, Vertretung für Birgit Geller.
In grünen Einbänden von Büchern des 19. Jahrhunderts könnte potentiell Arsen belastete Farbe verarbeitet worden sein. Durchgeführte Tests seien jedoch zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Vergiftung mit Arsen bei normalen Arbeitsbedingungen so gut wie ausgeschlossen ist. Daher sind auch keine tiefergehenden Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.
Es wurde abschließend trotzdem auf die Wichtigkeit der Einhaltung von hygienischen Arbeitsmaßnahmen hingewiesen. …“
Heute. findet sich in der Siegener Zeitung der Artikel „Und wer macht jetzt das Programm für das Spiegelzelt? Bei der Stadt Siegen sind einige wichtige Stellen unbesetzt. Die Suche nach einem neuen Stadtarchivar und einem Festivalplaner stockt. . ….“ von Raimund Hellwig, Folgendes ist zu Stadtarchivleitung zu lesen:
“ ….Bereits im Mai 2023 hat Stadtarchivar Dr. Patrick Sturm seinen Abschied aus Siegen verkündet. Der Historiker hatte die Digitalisierung des Archivs fachkundig vorangetrieben und auch sonst viele neue Impulse gesetzt.
Kurz nach Bekanntwerden der Abwanderungspläne des Historikers startete die Verwaltung die erste Ausschreibung für die Nachfolge. Jetzt stellt sich heraus: Auch beidieser Stellenbesetzung scheiterte die Verwaltung, die nach TVÖD 13 ordentlich bezahlte Stelle wurde nicht besetzt. Dem Vernehmen nach gab es nur eine Bewerbung, die dann aber nicht realisiert wurde. Unangenehm ist nach wie vor das Fehlen des Statdarchivars. Der sollte eigentlich eine zentrale Rolle in den Vorbereitungen des 800-jährigen Stadtjubiläums spielen.. So sollte er eine moderierende Rolle im Redaktionsteam der historischen Festschrift spielen.
Das verbleibende Team des Stadtarchivs hat jedoch vieles aufgefangen, was durch die Vakanz nicht sofort erledigt werden konnte. Besetzt werden sollte die Stelle ursprünglich zum 1. August 2023. Die Suche nach einem Bewerber fällt in eine Zeit, in der gerade digitalisierungsbewusste Histroiker eher Mangelware sind. Zudem ist die Konkurrenz groß. In deutschen Archiven sind derzeit einige attraktive Stellen ausgeschrieben. …..“
Bin auf der Suche nach der Geburtsurkunde von Frau Gerda Schäfer, Mutter Elisabeth Schäfer geborene Witt.
Geboren in Siegen (wahrscheinlich)
Geboren um 1930 bis 1935
Quelle zur Geschichte des Kunstschutzbunkers in Siegen im Berliner Bundesarchiv:
R 4901/12297 (Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung), Auslagerung von Kunstbesitz. – Bergung in Bergwerke, März – Okt. 1944
Enthält: Überführung rheinischer Kunstschätze von Kochendorf (Württemberg) in Bergwerke; Einlagerungen in Alt-Aussee, Bergungsstollen für Museumsschätze in Siegen; Kunstgegenstände des Kölner Doms und anderer Kölner Kirchen (in Pommersfelden, Geibach, Köln)
In Otto Ermerts „Geschichte der Ingenieurschule für Bauwesen in Siegen, 1853-1962. Siegen 1967, finden sich auf den S. 46, 48, 59,60 Hinweise auf einen ehrenamtlichen Lehrer Arnold. Eine Überprüfung des Lehrerverzeichnises (Das Lehrpersonal der Wiesenbauschule und ihrer Nachfolge-Institutionen“ (1853-2003) beigefügt in Otto Ermert/Rudolf Heinrich:“ 150 Jahre Bauwesen in Siegen. 1853-2003 Von der Wiesenbauschule zur Universität.“ Siegen 2003, ergab folgende Angaben:
Arnold, Otto, †1944
1913 – 1932 Nebenamtlicher Lehrer der Wiesenbauschule/Kulturbauschule für Rechnen, Planimetrie, Geschichte, Erdkunde,
Naturkunde
Sehr schön! Aber dieser Mühe haben sich in letzter Zeit auch die beiden Wittgensteiner Bernd Homrighausen und Bernd Stremmel unterzogen. Ihre Ergebnisse sind auf der -noch nicht vollständigen- Homepage von Bernd Homrighausen in den Grenzen des Altkreises Wittgenstein eingetragen. https://grenzsteine-wittgenstein.de/
Eine spannende Geschichte könnte der Vergleich dieser beiden Erfassungen von Grenzsteinen sein. Immerhin liegen zwischen den Exkursionen vier Jahrzehnte, in denen viel im Wald passiert ist. Grenzsteine verschwinden auch schon mal, fahrlässig oder absichtsvoll.
Gestern erhielt siwiarchiv die Antwort der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück | Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten:
“ …. Die Recherche zeigte, dass wir keine originalen Dokumente zu Lucie Stöcker haben. Ein Dokument befindet sich in Wareschau bzw. in Lund. Dabei handelt es sich um eine Namensliste, die die Registrierung im KL Ravensbrück dokumentiert.
Laut dieser sogenannten Zugangsliste wurde sie am 12.9.1942 mit der Haft-Nr. 13825 im KL Ravensbrück registriert.
Quellen:
IPN Warschau, MF Nr. 135 Sygn. 57/108-109
Lunds Universitet, Samling Łakociński, Z., Volym 22 https://www.alvin-portal.org/alvin/imageViewer.jsf?dsId=ATTACHMENT-0267&pid=alvin-record:109656 https://collections.arolsen-archives.org/de/document/3761967 ….“
Die Geschichte von Lucie Stöcker ruft in Erinnerung, dass sozialrassistische/sozialchauvinistische Motive innerhalb der nazistischen Bevölkerungspolitik/Volksgemeinschaftspolitik neben zweitens ethnisch-rassistischen und drittens rassehygienischen Motiven eine große Rolle spielten. Es sei gesagt, dass die Bevölkerungsgruppe der als „Zigeuner“ oder „Zigeunermischling“ Kategorisierten immer aus den ersten beiden Gründen und mitunter auch aus allen drei (etwa als „Taube“ oder „Geisteskranke“) dieser Politik zum Opfer fielen. Dabei bedienten sich die Organisatoren der Ausgliederung und der Vernichtung an den Schreibtischen, an denen sie in der Regel saßen und über Auslese und Vernichtung entschieden, nicht nur „fachlicher“ Einschätzungen von Pädagogen, Medizinern und Bevölkerungsexperten, sondern zugleich der Ressentiments, die inzwischen mit modernen Massenmedien in die Bevölkerung eingebracht werden konnten und bei vielen Adressaten insbesondere aus den Mittelschichten auf einen fruchtbaren Boden fielen. Auch Angehörige der Roma-Minderheit gehörten – kollektiv gewertet als Angehörige der „Unterschichten“ – zu den Opfern der sozialen Auslese, der „Minusauslese“, wie die Experten es in ihren Schriften nannten. In diesem Fall kann das Aktive Museum mit seinem Namensverzeichnis der Opfer auf eine intensive Recherche verweisen.
Es ist auch festzustellen, dass das sozialchauvinistische Exklusionsmotiv nach wie vor lebendig ist und von der Mehrheitspolitik eingesetzt und wahlpolitisch genutzt wird. Z. B. in der Migrations- oder der Sozialhilfefrage.
Auch Gottfried Karl Alfred Kohn, * 02.07.1918 in Siegen, † 08.04.1983 in Siegen, gehörte zur Gruppe der „vergessenen Opfer“. Seine Eltern, der zum Protestantismus konvertierte Fabrikarbeiter Johann Ferdinand Kohn, geboren am 21.04.1876 bei Königsberg, heiratete am 05.07.1917 in Siegen die Dienstmagd Lina Susanne Hommrichhausen (1887-1949), ließen sich 1923 scheiden. Die Mutter heiratete erneut.
Gottfried Kohn wurde am 10.07.1941 in Siegen angeblich wegen Arbeitsverweigerung inhaftiert. Am 4. August 1941 wurde er von Siegen in das berüchtígte Polizeígefängnis Dortmund (Steinwache) überstellt. Im Gefängnisbuch wird er unter der Nummer 2733 aufgeführt. Es finden sich dort die Vermerke „politisch“ und „Arbeitsverweigerung“. Durch die Staatspolizei wurde er von Dortmund am 08.08.1941 in ein Arbeitslager nach Recklinghausen gebracht. Dort befand er sich bis zum 08.10.1941. In der Folgezeit war Kohn Häftling in mehreren Polizeigefängnissen und Konzentrationslagern. Im KZ Sachsenhausen war er ab September 1943 inhaftiert (Häftlingsnummer 71276). Anschließend wurde er ins KZ Buchenwald (Häftlingsnummer 61071) überstellt. Ab 11.04.1945 war er im KZ Dachau interniert (Häftlingsnummer 152846). Befreit wurde er dort am 29.04.1945 durch US-amerikanische Soldaten. Sehr wahrscheinlich hat er als KZ-Häftling an einem Todesmarsch teilgenommen, der in der Endphase des Krieges vom KZ Buchenwald über Flossenbürg nach Dachau führte.
Nach dem Krieg wurde er in den Jahren bis 1954 verschiedentlich straffällig wegen Diebstahls, Betrugs und Unterschlagung. Mit seiner ersten Ehefrau, Hilde Müller, hatte er ab 1955 drei Kinder. In zweiter Ehe war er ab 1959 mit Erna Fischbach (1925-1976) verheiratet. Bis zu deren Tod wohnte das Paar in ihrem Haus Boschgotthardshütte 35, das mit den übrigen Häusern dem Bau der Hüttentalentlastungsstraße weichen musste.
Gottfried Kohn war in Weidenau als „Möbel-Franz“ bekannt, der mit seinem Handkarren Sperrmüllstandorte aufsuchte und verwertbare Gegenstände, z. B. kleine Möbelstücke und anderen Krempel einsammelte, die er beim Haus in Boschgotthardshütten deponierte. Das Antiquitätengeschäft Borkenhagen gehörte wohl zu seinen Kunden!! Der Spitzname „Möbel-Franz“ passte insofern, als G. Kohn als Beruf Schreiner angab. Zuletzt war er als Maschinenarbeiter tätig. Er bezeichnete sich als „Halbjude“. Seine Bemühungen um eine Entschädigung für die erlittene Freiheitsberaubung und Verfolgung wurden abgelehnt. Mitte der 1970er Jahre wurde für Gottfried Kohn eine Amtsvormundschaft eingerichtet. Zuletzt wohnte er in der Körnerstraße in Siegen.
Der Text ist verkürzt aus dem Buch „Mein Schulweg“ von Rüdiger Fries entnommen. Der nach einjähriger Suche Fotos von Gottfried Kohn, seiner Frau und dem Haus in Boschgotthardshütten erhielt, die die ehemalige Nacharin, Frau Anneliese Flender, gemacht hatte.
Danke für die Ergänzung!
Ein weiteres Opfer dieser Verfolgung ist:
“ ….. Robert Wilhelm König, Rangierer und später Nachtwächter im Zwangsarbeiterlager der Hüttenwerke Siegerland in Eichen, wird im Juli 1944 verhaftet und als „Berufsverbrecher“ im KZ Neuengamme inhaftiert. Dort stirbt der Häftling mit der Nummer 69 000 am 5. Februar 1945 angeblich an den Folgen einer Darminfektion. „Rassenschande“ wurde dem Müsener vorgeworfen, er soll sexuellen Kontakt zu Zwangsarbeiterinnen gesucht haben. Tatsächlich, so später die Richter in der Bundesrepublik, sei der Müsener als NS-Gegner verfolgt worden — dafür spreche allein schon die unverhältnismäßig lange Haft. ….“ (Westfälische Rundschau, 26.10.2016)
In Müsen ist ein Stolperstein verlegt für Robert König, der seinerzeit aus der Gemeinde Dobel (Baden-Würtemberg) vermutlich zum Bergbau nach Müsen kam. Ich konnte damals mit dem Archivar der Gemeinde Dobel mich austauschen und einiges über Robert König erfahren, z.B. dass er mit 12 Jahren Vollwaise wurde und das jüngste von 12 Geschwistern war. Bei der Stolpersteinverlegung wurde vom Hilchenbacher Archivar Herrn Gämlich Grußworte von noch lebenden Verwandten aus Dobel verlesen. Das war sehr berührend. Weniger berührend war, dass auch 2016 noch Gerüchte über Königs Verhältnis zu russischen Frauen im Dorf verbreitet werden mit einem recht gehässigen Unterton. Bei Interesse stelle ich gerne die Unterlagen und/oder Kontakt aus Dobel zur Verfügung.
Eine personenbezogene Akte von Lucie Stöcker befindet sich im Archiv des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (Archiv LWL) im Bestand 663 (Landarmen- und Arbeitshaus Benninghausen). Die Signatur lautet: LWL-Archivamt für Westfalen, Archiv LWL, Best. 663/10588.
Lucie Stöcker ist am 7. August 1940 in Benninghausen aufgenommen worden und am 30. Juli 1942 mit einem Sammeltransport nach Dortmund entlassen worden.
Die Akte umfasst 63 Blätter.
Quelle: Email LWL-Archivamt, 15.4.2024
Rezension:
Stefan Gorißen, Rezension zu: Bartolosch, Thomas A.: Jung in Jungenthal. Die größte Baumwollmaschinenspinnerei in Preußen. Gründung, Aufstieg und Blütezeit, Krisen und Niedergang im 18. und 19. Jahrhundert. Betzdorf/Sieg 2022 , ISBN 978-3-00-073721-3, In: H-Soz-Kult, 19.04.2024, <http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-143134>.
Biographische Informationen zum Architekten des Siegener Landratsamtes (1903), Heinrich Markmann, finden sich hier: https://glass-portal.hier-im-netz.de/hs/m-r/markmann_heinrich.htm.
Einen ersten Einblick in des Wirken Günter Reicherts in der Stadt Siegen erlaubt: Reichert, Horst: Nachkriegsarchitektur in Siegen – Bauten von Günter Reichert, in: Siegener Beiträge; Siegen; 16 (2011), S. 181-215
Die Erinnerungen des Zeitzeugen Lorenz sollten auf jeden Fall in die noch zu schreibende Geschichte des „FFH Trupbacher Heide“ einfließen. Für die 1930er Jahre wäre allerdings die durch „oral history“ nicht zu ersetzende Verwertung archivischer Dokumente (u.a. reichhaltig im Siegener Stadtarchiv vorhanden) unverzichtbar. Kleine Korrektur zum Video: Es trifft nicht zu, dass nach dem Einzug des ersten Regiments irgendjemand plötzlich bemerkt hätte, dass zu den Kasernen doch auch ein Übungsplatz gehören müsse, worauf „man beratschlagt“ habe und dann „zu einem Entschluss gekommen“ wäre. Während der anfangs geheim gehaltenen persönlichen Verhandlungen des Oberbürgermeisters Fissmer mit dem Kriegsministerium bzw. der Wehrmacht hatten diese von vornherein klargemacht, dass Siegen nur bei Bereitstellung eines Übungsgeländes in der Größe mehrerer hundert Hektar eine Chance hätte, Garnisonstadt zu werden. Ein solches Areal war innerhalb der Stadtgrenzen Siegens nicht verfügbar. Das Problem löste Herr Fissmer dank seines selbstherrlichen und skandalösen Amtsverständnisses kurzerhand dadurch, dass er der Wehrmacht die verlangte Fläche in den Ämtern Weidenau und Freudenberg des Landkreises Siegen offerierte, über die er als OB der kreisfreien Stadt Siegen keinerlei Verfügungsgewalt hatte. Als der Landrat endlich davon erfuhr, musste er sich mit den vollendeten Tatsachen abfinden, da Herr Fissmer inzwischen die nötige Legitimation vorweisen konnte, nachdem er von der Wehrmacht zu ihrem Bevollmächtigten („Kommissar“) für den Ausbau des Militärstandortes ernannt worden war und somit jenseits der Zuständigkeitsgrenzen eines Kommunalpolitikers agieren konnte. Das versetzte ihn dann auch in die Machtposition, die Enteignung der ca. 90 Trupbacher Haubergsgenossen zu veranlassen, nachdem die Verkaufsverhandlungen mit ihnen gescheitert waren. Den Dokumenten zufolge war das Verhältnis der Trupbacher zu Fissmer schon seit den 1920er Jahren zerrüttet, da diesen die permanenten Versuche des Siegener Oberbürgermeisters, als Bauland geeignete Flächen in der Weidenauer Gemeinde Trupbach „seiner“ Stadt einzuverleiben, schlichtweg auf die Nerven gingen. Die vom Reichsarbeitsdienst vorgenommene Rodung des Haubergsgeländes auf der Trupbacher Höhe erwies sich schließlich als deutlich schwieriger und aufwendiger, als Fissmer vorausgesehen hatte. Immerhin ergab sich während dieser Arbeiten nebenbei noch die Gelegenheit zu archäologischen Entdeckungen.
Ich bin da groß geworden, habe meine Jugend in der Fr.-Friesenstrasse verbracht. War mit meinem Vater sonntags zum Fußballplatz und habe den Sportfreunde Siegen (fast) jedes Spiel, zugeschaut.
Es war eine unbeschwerte Zeit.
Bin 1941 geb.
In der Reithalle wohnte später ein Haus-Mitbewohner.
Hallo Herr Moisel,
Sie erinnern sich gewiss, dass ich Ihnen vor einigen Jahren eine genealogische Baumscheibe geschenkt habe. Sie erinnern sich auch, dass ich damals geschrieben habe, dass ich mich mit den Hoffmanns aus Eisern und den Daubs aus Eiserfeld beschäftige. Meine Arbeit ist inzwischen abgeschlossen, und ich würde sie Ihnen gerne mal zusenden, um den Fachmann dazu zu hören. Ich habe die Arbeit Herrn R. Daub und vier interessierten Genealogen zur Verfügung gestellt, weil ich nicht möchte, dass
sie in der Schublade vergammelt. Wenn Sie interessiert sind, eine Warnung vorab: Die Arbeit kann aufgrund des Umfangs (ca. 430 Seiten) nur am Bildschirm gelesen bzw. geblättert werden. Sie müssen das einleitende Lesebuch nicht lesen, sollten Sie aber, um besser zu verstehen, was ich eigentlich gemacht und wie ich gearbeitet habe. Nun bleibt mir nur noch, Ihnen einen guten Abend zu wünschen.
Glückauf!
Dr. Eckart Hoffmann
Zur Sicherheit habe ich Ihren Kommentar auch direkt an Kollegen Moisel weitergeleitet. Übrigens: Ihre genealogische Forschungsarbeit ist auch für das Stadtarchiv Siegen und Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein interessant.
aufgrund wichtiger Umstrukturierungen innerhalb des Arbeitskreises Heimatgeschichte Daadener Land wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns mitteilen könnten, wer von uns Ihnen zu welcher Zeit die Unterlagen der Erzbergbau überlassen hat.
Vielen Dank und freundliche Grüße
Volker Rosenkranz
Seit gut einem halben Jahr sind die Entnazifizierungsakten des Landesarchivs NRW online. Sie erlauben nicht nur die Suche nach einzelnen Personen, sondern auch die Suche nach Entnazifizierungsverfahren zu einer bestimmten Berufsgruppe (Suchworte Entazifizeirung + Siegen + Berufsgruppe). In der nachfolgenden Aufstellung finden sich nun Berufungsverfahren von Lehrerinnen, die am Siegener Berufungsausschuss nachgewiesen werden konnten. Ausgewertet wurden lediglich die zwischen 1933 und 1945 im Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein tätigen Lehrerinnen. Ein Hinweis noch: die bereits bekannten Lehrerinnen (s. o. ) wurden in der Aufstellung nicht(!) fett hervorgehoben: Entnazifizierungsverfahren des Landesarchivs NRW von Lehrerinnen, die zwischen 1933 und 1945 im Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein tätig waren
Belated congratulations on your 70th birthday celebrated last year. This is Hank Jones, formerly of San Diego, California now living (at aged 84) in Prescott, Arizona. We corresponded quite a few times about twenty years ago, and you were kind enough to purchase my two volume set THE PALATINE FAMILIES OF NEW YORK – 1710 as well as its companion volume MORE PALATINE FAMILIES, all of which contained some sections on emigrants from the overall Nassau-Siegen region. I wanted to let you know that all eleven of my books (now out of print) are available in a special section of Ancestry.com – the link being: https://www.ancestry.com/search/collections/62327/ if ever you would want to use some of my additional books such as the three volume EVEN MORE PALATINE FAMILIES. I am still collecting more information on the 18th century emigrant families and their origin.
I wanted to ask you specifically if you have ever encountered the PETER & JEREMIAH EIGNER (EICHENER, EGNER, AIGNER et var) family who arrived in colonial New York in 1710 – their origins still undocumented in Germany. The always seemed to associate with families from your area like the Hagers, Schramms, and Kiefers (see PFNY-1710). Any advice or suggestions certainly would be welcome. I started researching the 847 families in the „Palatine“ emigration while still at Stanford University in 1960 – and the hunt continues … it (happily) never ends.
My very best wishes to you and your family – and my thanks for all you have done over these many years in furthering our knowledge of Siegen history and genealogy.
Guten Tag,
ich suche Kontakt zur Familie von Gothmar Thiemann. Sein älterer Bruder Paul Gerhard war mit meiner Mutter befreundet, und ich habe in ihrem Nachlass Briefe von PG gefunden, die ich abgeben möchte.
Können Sie bitte meine email an die Familie weiterleiten?
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Vera Neumann
Anwort des Staatsarchivs München:
“ …. Lucie/Luzie Stöcker [konnte] in den hier verwahrten Haftbüchern und zeitgenössischen Karteien der Strafanstalt Aichach nicht nachgewiesen werden. Die Häftlingspersonalakten liegen zwar für die NS-Zeit relativ umfangreich vor (ca. 12.000 Einzelfallakten), für die Zeit nach dem 2. Weltkrieg wurde aber lediglich eine kleine Musterüberlieferung dieser Quellengruppe übernommen. Unterlagen zu Lucie/Luzie Stöcker befinden sich nicht darunter.“
Die Freigabe des kostenpflichtigen SZ-Archivs war ein Schnellschuss, wenn man sich die Qualität der Texte anschaut, die das Textbearbeitungsprogramm den Lesern zumutet. Natürlich sind diese Fehler in den Originalzeitungsartikeln nicht enthalten. Für die Jahre bis 1945 kann man aber die Suche im SZ-Archiv mit den gratis im Internet aufrufbaren SZ-Jahrgängen kombinieren. Ist zwar etwas umständlich, kostet aber kein Geld.
Ich hätte etwas mehr von einem Zeitungsarchiv erwartet. Leider möchte man damit aber weiterhin Geld verdienen und es nicht komplett der Öffentlichkeit zu Verfügung stellen.
Zwar kann man mit Stichwörtern suchen und diese zeitlich eingrenzen, aber dan wird nur ein Teil des Artikels angezeigt und die Zeitungsseite in schlechter Qualität. Für mehr muss man 3-8€ bezahlen.
Bei den Ausgaben mit Frakturschrift, lässt die digitale Erfassung der Texte zu wünschen übrig. Überprüfen lassen sich diese dann auf der Originalseite natürlich nicht.
Ich hoffe man kann als Studierender auch weiterhin Anfragen an das SZ-Archiv stellen und bekommt dann zu dem entsprechenden Thema die Seiten konstenlos zu Verfügung gestellt. Für Seminar oder Abschlussarbeiten wird wohl niemand so viel Geld für mehrere Seiten an Artikeln ausgeben.
Danke an den Hobbyheimatforscher für den Hinweis zu den Ausgaben bis 1945.
Ich gestehe jeder Zeitung, die ihr Archiv online stellt, zu, sich abzufeiern. Ist wenigstens ein für Historiker:innen nützliches Produkt; sonst erschöpft sich History Marketing ja häufig in „Wir waren schon immer die Grössten!“.
Aus Prinzip gar nicht anfreunden kann ich mich hingegen mit der Kostenpflichtigkeit. Ob das Angebot wenigstens in Bibliotheken gratis zugänglich ist?
Alles Gute für das schöne Projekt!
Bericht der Siegener Zeitung zur Ausstellungseröffnung v. 22.1.2012: http://www.siegener-zeitung.de/a/531405?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
* Texte und Bilder sollten unter einer freien Lizenz (am besten CC-BY) stehen.
* Archivalienabbildungen sollten in exzellenter Auflösung und ohne Wasserzeichen/Copyfraud zur Verfügung stehen. Regelmäßig sollten auch kleinere mehrseitige Digitalisate angeboten werden.
* Alle Beiträge sollten ihre Quellen korrekt nachweisen und auf einschlägige Materialien im Netz verlinken.
* Das Blog sollte Heimatforschern die Möglichkeit bieten, kurze miszellenartige Beiträge mit wissenschaftlichem Anspruch zu veröffentlichen (wie man sie z.B. in Heimatkalendern lesen kann).
Presseecho auf die Schulvorstellung am 3.2.2012 in Siegen:
Siegener Zeitung, 4.2.2012: http://www.siegener-zeitung.de/a/535163/EinStarwieJustinBieber
derwesten.de, 4.2.2012: http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/verliebte-worte-an-adolf-hitler-id6311492.html
Immerhin läßt sich der laut Pressemitteilung „anonym bleibende“ Spender (oder Verkäufer?) nicht auch noch öffentlich dafür beweihräuchern, dass er die jahrzehntelang in seinem trauten Heim gehorteten kommunalen Unterlagen nun endlich herauszurücken geruht hat. Unbequeme Fragen kann Herr Köppen in solchen Fällen ja schlecht stellen, sonst würde ihm von den anderen Dachböden seines Sprengels in Zukunft gar nichts mehr zugehen.
Diese privaten Sammel-Banausen sind eine Plage! Würden sie wenigstens selbst etwas Sinnvolles mit den unverdient ersessenen Schätzen anfangen, könnte man noch Verständnis aufbringen. Aber nein, sie hocken bloß faul darauf herum wie der Drache auf seinem Gold und grinsen schadenfroh über die dummen Historiker, die bei ihren Recherchen immer wieder ins Leere laufen. Wer der Öffentlichkeit potentielles Archivgut vorenthält, ist letztendlich auch nicht besser, als ein aktiver Geschichtsfälscher. Rückwärts auf einen Esel setzen und aus dem Dorf treiben!
Peter Kunzmann
Ergänzungen zum Architekten Markmann (siehe Fußnote 7):
Ein recht ähnlich aussehendes, etwas bescheideneres kommunales Projekt von ihm ist das 1904 eingeweihte Amtshaus in Mengede (Amt Castrop). Mehr dazu hier: http://www.heimatverein-mengede.de/heimatblaetter/heimatblatt_nr2.html
Auch das alte Kreishaus in Altena von 1908 stammt von ihm.
Zur Biographie: Das Dortmunder Adressbuch von 1894 nennt direkt unter Heinrich mit der selben Adresse eine gewisse „Louise Markmann, Witwe“. Das dürfte die Mutter des Architekten gewesen sein. Der Täufling von 1868, dessen Mutter Henriette hieß, wäre damit endgültig redundant. L(o)uise führt schließlich bei Familysearch zur Bestätigung des wohl aus einer anderen (welcher???) Quelle eruierten Geburtsdatums: Heinrich Gottfried Mar(c)kmann, 1818-1864, heiratete am 13.5.1851 L(o)uise geb. Wolters, 1824-?; ihr Sohn Friedrich Gottfried Heinrich wurde am 29.8.1852 geboren und am 22.9. d.J. in der ev. Reinoldikirche getauft (alles in Dortmund).
Leider verraten die Mormonen nichts über Geschwister dieses Heinrich Markmanns. Sollte es, wie im Architektenregister von Bücholdt angegeben, in Dortmund zur gleichen Zeit zwei Architekten namens Markmann (Heinrich und Hans bzw. Johannes) gegeben haben, wäre es nicht ganz unwahrscheinlich, daß es Brüder waren – vielleicht (sofern sie sich nicht innerhalb der Familie Konkurrenz machen wollten) sogar Partner in einem gemeinsamen Büro. Dessen Leitung hätte dann sicherlich beim erstgeborenen Heinrich gelegen, weshalb der jüngere Hans selten öffentlich in Erscheinung trat. Dies nur als vorsichtige Hypothese, die sich wahrscheinlich anhand der Dortmunder Personenstandsunterlagen oder bei der Reinoldi-Kirchgemeinde weiter verfolgen ließe. Aus den kärglichen Spuren von Hans gleich auf seine Nicht-Existenz („Verwechslung mit Heinrich“) zu schließen, ist jedenfalls nicht zwingend.
Über Heinrichs Wirken in Lippstadt gibt es eine Veröffentlichung: Roland Pieper, Architektur im Stilpluralismus um 1900: Lippstädter Bauwerke des Dortmunder Architekten Heinrich Markmann, Lippstädter Heimatblätter 89 (2009), S. 137-160 (liegt mir allerdings nicht vor). Womöglich enthält der Aufsatz auch für Siegen interessante biographische Informationen.
Gibt es in unserem Stadtarchiv Meldeunterlagen der Siegener Hotels Anfang des 20. Jahrhunderts? Bei seinen Besuchen hatte sich Markmann vermutlich mit vollem Vornamen eingetragen. Sollte er einen Bruder Hans gehabt und ihn mitgebracht haben, umso besser.
Peter Kunzmann
Ich finde es super, dass es jetzt auch einen Blog gibt, in dem über die Geschichte unserer Region berichtet wird. Die WordPress-Blogs bieten prima Möglichkeiten, weil sie einfach zu erstellen und zu bearbeiten sind. Werde den Blog abonnieren, damit ich auf dem Laufenden bleibe und ihn weiterempfehlen…;-))
Weiterhin viel Erfolg für Ihre Arbeit! Gruss Anntheres
Ein interessantes Dokument! Werde es weiterempfehlen
an Interessierte. Gruß Anntheres
Netter Blog, gefaellt mir sehr. Auch tolle Themen.
Betr.Fachwerkhaus Bericht Siegener-Zeitung
Interesse besteht,Bewohne ein gleiches Haus mit bilder und Zeichnung
von 1898..
mfg HG
Sogar die Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung in Berlin kann etwas zu den SiWi-Landrätebiographien beitragen:
http://bbf.dipf.de/hans/VLK/VLK-0014/vlk-0014-0441.jpg
P.K.
Der Link hat sich geändert: http://archivdatenbank.bbf.dipf.de/actaproweb/archive.xhtml?id=Vz++++++74a5fda8-0daf-46dd-a97f-38b55e00fc18#Vz______74a5fda8-0daf-46dd-a97f-38b55e00fc18
Den diskussionsfreudigen Siegerländer Beteiligten Ria Siewert (Stadtarchiv Kreuztal) und Thomas Wolf (Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein) ein virtueller herzlicher Dank und weiterhin gutes Flanieren im Web 2.0 !
Sie dürfen gerne unseren Informationsboulevard besuchen und nach Herzenslust kommentieren.
Da bislang noch keine weiteren regionalen archivisch-historischen Blogs existieren, werde ich auf diesem Wege gern zum virtuellen Siegerländer… ;-)
Damit hat der Blog schon einmal einen seiner Zwecke erfüllt. :-) Aber ich kann Ihnen eines versichern: noch in diesem Frühjahr wird ein weiteres interessantes archivisches Weblog seinen Betrieb aufnehmen. Es bleibt spannend!
Pingback: Schulchroniken in den siegen-wittgensteinischen Archiven I | siwiarchiv.de
„….. Wolfgang Suttner spricht die Möglichkeit einer Übernahme der Ostdeutschen Sammlung durch ein Kommunalarchiv auf vertraglicher Basis an. Auf dieser Grundlage könne klar geregelt werden, wie mit den Ausstellungsstücken umzugehen sei. Eventuell gäbe es Möglichkeiten für eine solche Lösung im Stadtarchiv. Auch könnten Teilbestände privater Nachlässe aus den Familien der Vertriebenen aus archivalischer Sicht möglicherweise interessant sein. Vor diesem Hintergrund erscheine es sinnvoll, zur nächsten Sitzung einmal Kreisarchivar Thomas Wolf einzuladen.
Die verschiedenen Möglichkeiten zur Sicherung der Ostdeutschen Sammlung werden intensiv diskutiert.
Landrat Paul Breuer unterstreicht, da die Ostdeutsche Sammlung im Besitz des BdV sei und sich die derzeitigen Standorte in der Zuständigkeit der Stadt Siegen befinden, könne der Kreis SiegenWittgenstein in dieser Angelegenheit lediglich eine Vermittlerrolle übernehmen. Man werde sich vor diesem Hintergrund seitens Kreises für die Erarbeitung von Lösungsansätzen einsetzen. Zentraler Punkt dabei müsse sein, für die Nachwelt mit ihren völlig unterschiedlichen Beziehungen zur Vertriebenenkultur das Verständnis für deren Bedeutung zu erhalten und dabei die Spezifika der Region Siegerland und Wittgenstein herauszuarbeiten. …“
Quelle. Beirat für für Vertriebenen- und Aussiedlerfragen, Öffentliche Sitzung, 29.02.2012, Niederschrift, S. 3
Link zur Niederschrift
Pingback: Siegener Straßenbenennungen in der NS-Zeit | siwiarchiv.de
Pingback: “Zeitzeugen auf Zelluloid” zogen Zuschauer an | siwiarchiv.de
Ach schade, habe ich leider nicht mitgekriegt…;-))
Schön, dass Herr Kohlberger noch gelegentlich zur Verfügung steht…;-)
Gruß Anntheres
Danke für den 50. Blogeintrag an das Stadtarchiv Siegen!
Pingback: 70. Jahrestag Deportation von Siegen von Zamosc | siwiarchiv.de
Vielleicht hätte man auch erwähnen sollen, daß Jung-Stilling .
h e u t e
.
vor allem in esoterichen Kreisen bekannt ist durch die (angeblichen) „nachtodlichen Belehrungen“, die dort diskutiert werden.
.
Kostenlos downloadbar sind diese von der Universität Siegen:
.
http://www.uni-siegen.de/fb5/merk/stilling/
.
Dort auf „Downloads“ gehen.
Pingback: Gebäude des Kreisbaudirektors Herbert Kienzler gesucht: | siwiarchiv.de
Es handelt sich um das Diakonissenmutterhaus Friedenshort.
Standort: Freudenberg, Friedenshortstraße 46, früher Triftstraße 46.
Infos dazu im Stadtarchiv Freudenberg.
Danke für die Klärung! Kienzler war laut der im Kreisarchiv vorhandenen Personalakte mit der Planung des Gebäudes betraut. So erklärt das Bild im Nachlass Kienzlers.
Pingback: Vortrag “Fritz Busch’s Aachener Jahre 1912 – 1918″ | siwiarchiv.de
Nachdem via Twitter nach der entlegenen Literatur gefragt wurde, folgt hier nun das Vollzitat:
„Die neuen Landräte
In der ersten Zeit kamen und gingen die Landräte. Einer musste innerhalb von 48 Stunden den Kreis wieder verlassen. Alle waren keine Verwaltungsbeamten, waren ungeeignet. Einer schikanierte die Leute, gab noch Anweisungen, obwohl alle Bediensteten längst wußten, daß er entlassen war, nur er selbst noch nicht.“ Dies trifft nur für ein kurze Spanne nach der Besetzung zu.“
Folgende Fußnote ergänzt diesen Absatz:
„Meine Chefs bei der Kreisverwaltung waren folgende Landräte und später Oberkreisdirektoren: Landräte Sandkuhl/Berleburg, Ewald Belz/Erndtebrück, Heinrich Treude/Aue, Osterrath/Saßmannshausen, Ludwig Bade/Feudingen, Müller, Heinz/Erndtebrück, Werner Möhl/ Laasphe. Landräte, später OKD: Schläper, Wendland, Nacken (in einer Bezirksversammlung wird erklärt, er sei jetzt OKD), Liebetanz (i. A.), Brombach (i. A.), Basarke, Markowsky (i.A.) Brossok (i.A.), Basarke, Lemnitz (i.A.) Oberregierungs- und Vermessungsrat); Richter, Lückert““
aus: Heinz Strickhausen: Berleburg. Eine Kleinstadt in der Nachkriegszeit, 2001, S. 65
Eine Überprüfung des Einwohnerbuches der Kreise Wittgenstein und Biedenkopf 1928/29, Siegen 1928, ergab, dass sich beide Nachnamen nicht finden lassen; sie stammen wohl nicht aus alteingesessenen Familien.
Pingback: BrüderBüschGedenkstätte im Stadtarchiv Siegen | siwiarchiv.de
Pingback: BrüderBüschGedenkstätte im Stadtarchiv Siegen | siwiarchiv.de
Wenn man es genau wissen will, wird man wohl am britischen Nationalarchiv nicht vorbeikommen.
Aus den Informationen des Bundesarchivs:
„Die Akten der britischen Militärregierung in Deutschland von 1945 bis 1949/55 befinden sich in den National Archives. Sie wurden mit dem elfbändigen Inventar „Akten der Britischen Militärregierung in Deutschland. Sachinventar 1945-1955 (=/Control Commission for Germany British Element. Inventory 1945-1955, hrsg. von Adolf M. Birke, Hans Booms, Otto Merker; unter Mitwirkung von Deutsches Historisches Institut London, Niedersächsisches Hauptstaatsarchiv Hannover, München 1993)“ erschlossen.“
Dieses Inventar lieferte zwar (bei allerdings nur eiliger Durchsicht) nicht den ganz großen Knüller, aber einige der Akten könnten durchaus etwas zu konkreten Landratsernennungen in der Provinz Westfalen enthalten. Lieber Herr Wolf, lassen Sie sich doch von Ihrem Chef einfach mal eine Dienstreise spendieren. Und wenn Sie in Kew nichts über die Wittgensteiner Landräte finden sollten, können Sie sich dort immer noch an ein paar alten Schätzchen aus Nassau-Siegen erfreuen oder im nahen Garten spazieren gehen.
Peter Kunzmann
Hi Felix!
Danke für den Hinweis!
Wie ich gerade gesehen habe, erfreuen sich diese „nachtodlichen Belehrungen“ ja weiter Verbreitung! Immerhin über 60000 Downloads!
Auch bei „Google“ findet man viel dazu.
Im Gästebuch dort wettern welche gegen einzelne der Botschaften, die ihnen nicht in den Kram passen.
Aber das alles ist ziemlich „hoch“!
Ich will damit sagen, daß man schon genau mitdenken muß um das alles zu verstehen.
Jetzt intressiert mich noch woher diese kommen?
Sind das viele Schreiber oder nur einer?
Pingback: “Der historische Hauberg” – Farbfilm aus dem 1960er Jahren | siwiarchiv.de
Pingback: Bildervortrag: Erinnerungen an “Pfannenberger Einigkeit” | siwiarchiv.de
Pingback: Vortrag zur Ruhr-Sieg-Eisenbahn | siwiarchiv.de
woher diese kommen?
.
aus der hölle!
.
es wird biblisches mit freimaurergeist gemickst.
Es handelt sich um eine sehenswerte kleine Ausstellung.
Die in der Filmanimation gezeigten Schriftzeichen / Symbole
sollten noch näher untersucht werden.
Detlef Köppen
In einer noch unverzeichneten Korrespondenzakte, die die Ausgangspost der Wittgensteiner Landräte von Juni 1945 bis August 1947 enthält, findet sich ein Schreiben des Landrates Carl Nacken an den Regierungspräsidenten Fritz Fries in Arnsberg vom 25. September 1945. Dort heißt es wie folgt:
„Sehr geehrter Herr Präsident!
Herr Schläper hält sich immer noch in meiner Residenz auf. Vor einiger Zeit hat er auch den Herrn Kommandaten der engl. Militär-Regierung aufgesucht, um über seine weitere Verwendung mit diesem Rücksprache zu nehmen. Der Herr Kommandant stand auf dem Standpunkt, daß ein Mann der einmal Landrat war, doch genügend Qualitäten besitzen müsse, um irgendwie einen leitenden Posten begleiten zu können. Ich sollte Herrn Schläper in meinem Amt Beschäftigung geben. Ich bedaure, Ihnen mitteilen zu müssen, daß ich an Herrn Schläper kein Interesse habe. …..“
Dieses Schreiben bestätigt erstmals „offiziell“, dass es einen Landrat Schläper im Kreis Wittgenstein gegeben hat!
Hi Paul!
Woher weißt Du so genau, daß die „nachtodlichen Belehrungen“ aus der Hölle kommen? Offenbar hast Du nach dort wohl besondere Beziehungen?
Vorsicht bitte! Die kritische Nachfrage nach der Herkunft ist ok, aber bitte keine persönlichen Angriffe.
Pingback: “Reise ohne Rückkehr” | siwiarchiv.de
Pingback: “Reise ohne Rückkehr” | siwiarchiv.de
dieser bericht ist uninteressant!! ;)
1) Danke für die Rückmeldung!
2) Verstehe ich Sie richtig, dass Einträge über neue kreisrelevante (Foto-)Bestände uninteressant sind?
3) Was würden Sie denn gerne hier lesen?
Antwort des Landesarchivs NRW, Abteilung Rheinland, 27.4.2012: “ …. Von Personen mit dem Namen Wendland haben wir 50, von Personen namens Schläper 13 Entnazifizierungsakten. Bei keiner der Personen ist als Berufsbezeichnung Landrat angegeben, keiner wurde vom Hauptausschuss für den Landkreis Wittgenstein, keiner vom Hauptausschuss für den RB Arnsberg entnazifiziert. … . Allerdings ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass Personen, die unmittelbar nach Kriegsende in hohe öffentliche Ämter kamen, frühzeitig von der britischen oder sogar noch der amerikanischen Militärregierung überprüft wurden und dann später nicht mehr vor einen deutschen Ausschuss mussten. Insofern kann es auch sein, dass Sie Unterlagen nur in National Archives in Kew finden werden. ….“
Pingback: Fotogalerie “Reise ohne Rückkehr” | siwiarchiv.de
Pingback: Siwiarchiv.de: Monatsstatistik 4/2012 | siwiarchiv.de
Pingback: Grunewald gemeinde | Kiddygrips
Da mein vor etlichen Wochen an unseren geschätzten Kreisarchivar gerichteter diskreter Hinweis offensichtlich kein Gehör fand, hier noch einmal und nunmehr öffentlich der Einspruch:
Die Schüler der Wiesenbauschule sind anhand der im Siegener Universitätsarchiv vorhandenen Unterlagen (Bewerbungen, Einschreibelisten, Zeugnisbücher, Prüfungsakten und manches andere) wahrscheinlich lückenlos nachweisbar. Spuren eines „Heinrich Otto“, der mit dem späteren Landrat identisch gewesen sein könnte, haben sich darin nicht finden lassen. Aus welcher „Quelle“ die irreführende Angabe abgeschrieben wurde oder ob hier die Phantasie mit dem Autor durchgegangen war, ist nebensächlich; der Fehler wäre jedenfalls schon vor zwei Jahren mühelos vermeidbar gewesen. Eine simple Rückfrage vor der Publizierung hätte nebenbei auch die Illusion ausräumen können, an der Wiesenbauschule seien Anfang des 20. Jahrhunderts „Ingenieurwissenschaften studiert“ worden.
Es ist ohne jeden Zweifel erfreulich, dass studentische Praktikanten (um einen solchen handelte es sich auch beim Autor dieser biographischen Skizze) im Kreisarchiv die Gelegenheit finden, sinnvolle historische Forschung zu üben und die Früchte ihrer Bemühungen in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Den jugendlich frischen Texten ein wenig redaktionelle Prüfung und Nachbearbeitung durch die „alten Hasen“ zu widmen, bevor sie ins Netz gestellt werden, wäre allerdings oft nicht überflüssig. Letztendlich tut man den publizistisch noch unerfahrenen Autoren keinen Gefallen damit, ihre Irrtümer oder Stilblüten vorzuführen; und was von der Öffentlichkeit als gewissermaßen „amtliche“ Geschichtsschreibung eines Archivs wahrgenommen wird, sollte so verläßlich wie möglich sein.
P.K.
1) Diskrete Hinweise sind im Web 2.0 kontraproduktiv.
2) Ein Blog, zumal siwiarchiv, versteht sich als Laboratorium. Unfertiges hat dort durchaus seinen Platz.
3) Siwiarchiv ist kein wissenschaftliches Blog. Eine peer review findet nicht statt.
4) Älteres Material, das nicht entstellend falsch ist, wird aufgenommen und soll hier diskutiert werden – s.o.
5) Der Artikel Kraumes ist mit Quellenanhang versehen, so dass erkennbar ist, woher die zu Recht angemerkte Information stammt.
Lieber Herr Wolf!
Zu 1) Die Existenz des „Web 2.0“ verpflichtet nicht dazu, direkte Kommunikationswege von Mensch zu Mensch nun abzuschaffen und künftig alles sofort im öffentlichen Bereich abzuhandeln.
Zu 2/3/4) Die biographische Skizze ist auf Mai 2010 datiert, also schon zwei Jahre alt. Ihre Erstveröffentlichung erfolgte nicht „labormäßig“ am 5.5.2012 auf Siwiarchiv, sondern zuvor auf den offiziellen Webseiten der Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein. Wenn dort etwas zur Kreisgeschichte angeboten wird, verläßt man sich als Leser darauf, dass es Hand und Fuß hat. Auch mir wäre der Fehler nicht aufgefallen, hätte ich nicht versucht, in den Wiesenbauschul-Akten ergänzende Details zur frühen Biographie Heinrich Ottos zu finden.
zu 5) Der Quellenanhang läßt nicht erkennen, woher diese spezielle Information stammte. Es ist mir auch egal, wie der Fehler zustande kam. Gewundert hat mich nur, dass weder der Autor (Geschichtsstudent) noch die Betreuer (Archivare) seinerzeit auf die Idee gekommen waren, die naheliegenden und sehr einfachen lokalen Nachfragemöglichkeiten (Aufwand für Anruf oder eMail ca. eine halbe Minute) in Anspruch zu nehmen.
Und noch einmal zu 1) Kontraproduktiv ist es für mich eher, die Weltbevölkerung mit solchen nur einen sehr eingeschränkten Personenkreis interessierenden Kommentaren zu überschütten.
Beste Grüße an Sie und den Rest der Menschheit,
Peter Kunzmann
1) „Die Schüler der Wiesenbauschule sind anhand der im Siegener Universitätsarchiv vorhandenen Unterlagen (Bewerbungen, Einschreibelisten, Zeugnisbücher, Prüfungsakten und manches andere) wahrscheinlich lückenlos nachweisbar.“
Wurde bei Ihrer Prüfung auch das im Bestand „Kreis Siegen, Kreisausschuss“ unter Nr. 538 vorhandene Aktenverzeichnis zu Rate gezogen, um die von Ihnen in Erwägung gezogenen Lücken (s. o.) weitestgehend auszuschließen?
2) Haben Sie die unter 1) erwähnte Ergänzungsüberlieferung auf möglicherweise einschlägige Unterlagen überprüft?
2a) Möglicherweise hat Otto ja auch die Wegebauschule besucht. „Nicht erfasst sind die Besucher der von 1901 bis 1939 bestehenden Wegebauschule, da über diese keine listennmäßigen Auf-zeichnungen verfügbar waren, „ heißt dazu im Schülerverzeichnis der Wiesenbauschule, in Ermert, Otto/Heinrich, Rudolf: 150 Jahre Bauwesen in Siegen. Von der Wisenbauschule zur Universität 1853 bis 2003, Siegen 2003 beigelgte CD?
3) Die Berufsbezeichnung „Kulturbautechniker“ bzw. „Techniker“ entstammt Selbstzeugnissen Ottos, die, wenn ich mich nicht ganz irre, in dem im Quellenverzeichnis aufgeführten Artikel in der „Freiheit“ Einfluß gefunden haben.
Die Berufsbezeichnung „Techniker“ findet sich in den Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft und des Volksgerichtshofes.
4) Noch einmal: Der Text sollte im weitesten Sinne populärwisssnschaftlich verfasst werden. Zu diesem Zweck wurde bspw. auf Fußnoten verzichtet. Benutzte Quellen und Literatur sind angegeben. Die Verwendung des Terminus „Ingeniuerwissenschaften“ ist der geforderten Verständlichkeit geschuldet und sicherlich unpräzise.
5) Wird der Text jetzt deswegen schlechter, weil er womöglich lückenhafte Quellen nicht benutzt hat, die keine Aussage über Heinrich Otto treffen?
6) Der Text versteht sich als Überblick, auf der weitere Forschungen aufgebaut werden können, dies findet sich bereits auf der ersten Seite des Textes. Jeder kann und darf nun weiter zur Biographie Heinrich Ottos forschen. Nach der Endfassung des Textes gab es den Hinweis, dass Heinrich Otto dem Siegener Soldatenrat angehört haben könnte. Ein Beleg ist m. W. noch nicht gefunden.
Ein Weiterforschen ist übrigens nicht durch die Veröffentlichung auf der Kreishomepage geschehen, weil dort entsprechende Möglichkeiten einer Diskussion nicht vorgesehen sind. Daher: siwiarchiv bleibt Labor bzw. Werkstatt.
7) Dieser Text – und er wird somit zu einer Quelle – hat allerdings Forschungen zur Geschichte der Friedensbewegung im Siegerland in Gang gesetzt.
Der Beitrag von Herrn Kraume war nicht der Anlass für meine Arbeit über die Friedensbewegung im Bezirk Sieg-Lahn-Dill. Damit hatte ich bereits vor der Einstellung des Beitrages von Herrn Kraume in den Internetauftritt des Kreises Siegen-Wittgenstein begonnen. Dieter Pfau wies mich auf den Beitrag hin. Ich konnte daraufhin einiges richtig stellen und das Foto vom Führerschein von 1927 beisteuern.
Danke für die Richtig- und Klarstellung!
Na gut, lieber Herr Wolf, vergraulen wir eben die Leser, die hier Spannenderes zu finden hoffen.
Zu 1) Die Formulierung „wahrscheinlich lückenlos“ war eine reine Vorsichtsmaßnahme: Prinzipiell sollte bei historischen Recherchen unterschieden werden zwischen dem, was objektiv nicht existierte, und dem, was der Rechercheur bloß nicht gefunden (oder gesucht) hat. Wenn ich allerdings einen halben Arbeitstag vergeblich dafür geopfert habe, den gewissen Heinrich Otto zu finden, dürfen Sie das „wahrscheinlich“ getrost ignorieren. Hätte er die Schule bis zur theoretischen Prüfung absolviert, wäre er auf jeden Fall mehrfach (nämlich mindestens einmal pro Halbjahr im Zeugnisbuch) aktenkundig geworden, auch wenn alle anderen Nachweise zufällig verlorengegangen sein sollten.
„Kreisausschuss Nr. 538“ kenne ich, ist aber in dem Zusammenhang irrelevant.
Zu 3) Ich habe nicht bestritten, dass Herr Otto kurzzeitig den Beruf eines Kulturbautechnikers ausgeübt haben könnte. Ob zu seinen Selbstzeugnissen auch gehörte, dass er dafür in Siegen ausgebildet worden sei, muß ich eben in der alten „Freiheit“ gelegentlich nachlesen. Spekulationen führen uns am jetzigen Punkt nicht weiter.
Zu 4) Was kann denn ein „unpräziser“ Terminus zur „geforderten Verständlichkeit“ beitragen? Hier wird doch gerade ein Miß-Verständnis provoziert, nämlich dass die Wiesenbauschule mit den zeitgenössischen Technischen Hochschulen vergleichbar gewesen sei.
Zu 5) Woher hätte der Autor wissen sollen, dass er in dem potentiell zuständigen Siegener Archiv keine positive Aussage über Herrn Otto finden würde, wenn er nicht nachfragt? Es gibt hier biographisches Material zu hunderten Schülern, auch Korrespondenzen Ehemaliger mit der Schule, Dienstzeugnisse usw.
Ich habe außerdem nicht behauptet, der Text sei schlecht. Der zweite Satz macht ihn aber auch nicht besser. Das kann mir natürlich alles völlig egal sein; ich bin nicht das Gewissen des Kreises Siegen-Wittgenstein. Bedauerlich finde ich nur, dass hier (wie so oft) versäumt wurde, mit wirklich ganz minimalem Aufwand (menschliche Kommunikation) den Erkenntnisprozess voranzubringen. Es gibt schon genug volkstümliche Legenden, gegen deren Konservierung Historiker und Archivare machtlos sind. Auch in tausend Jahren wird man sich im Siegerland unverdrossen am Stammtisch erzählen, dass Wilnsdorf von Wieland dem Schmied gegründet worden sei, dem Dörfchen Freudenberg im Mittelalter Stadtrecht verliehen worden sei, und was sonst noch das patriotische Herz erwärmen mag. Gegen kollektive Vorurteile kommt niemand mit Fakten an. Von Vertretern der „Zunft“ (angehenden Historikern, betreuenden Archivaren) läßt sich aber doch wohl wünschen, dass sie dieser Mentalität nicht ungewollt Vorschub leisten.
Zu 7) Klar, ich bin auch für den Weltfrieden.
Peace & love,
P.K.
Nur zwei Nachfragen:
1) Wurde die übrige Kreisüberlieferung auf Schülererwähnungen hin überprüft?
2) Könnte Otto denn Wegebauschüler gewesen sein – s. Nr. 2a) meines Kommentar?
Aus Privatbesitz (Großnichte Ottos) liegt hier seit heute als PDF-Datei eine Zeichnung der Gesteinsschichten eines Heinrich Otto für die Wegebauschule in Siegen vor. Die Zeichnung wurde für die Klasse W. 1913/194 erstellt; der betreuende Lehrer war: Gamann, Heinrich bis 1901 Nebenamtlicher Lehrer *1854 †05.03.1932 , 1891 – 1924 WBS Baukunde, Physik, Mechanik, Geometrie, geometr. u. Technisches Zeichnen, Stereometrie, Rechnungswesen
Ein zulässiges Indiz für die Annahme, dass Heinrich Otto, die Weisen- und Wegebauschule in Siegen besucht hat?
Na sehen Sie, geht doch! Das ist nicht nur ein zulässiges, sondern sogar ein überzeugendes Indiz dafür, dass Heinrich Otto die Wegebauschule in Siegen besucht hatte. Allerdings nicht die Kulturbauschule (früher Wiesenbauschule genannt). Diese war (trotz mancher Überschneidungen und der gemeinsamen Unterbringung) etwas anderes. Die Formulierung „zum Kulturbautechniker ausgebildet“ war mir Anlaß genug, mich bei der Recherche auf den Bestand derjenigen Schule zu beschränken, die eine solche Ausbildung angeboten hatte.
Heinrich Otto, „Bureaugehilfe“, hatte vom 2. Oktober 1913 bis zum 27. Juni 1914 die Wegebauschule besucht und die Entlassungsprüfung bestanden. Eine Berufsausbildung war dieser einjährige „Vor- und Hauptkurs“ gewiß nicht. Ob er anschließend zum Führen irgendwelcher Titel (definitiv aber nicht „Kulturbautechniker“) berechtigte, muß ich noch eruieren.
Aus dem Jahresbericht 1914/15 erfährt man, dass die „Abgangszöglinge [einschl. Otto] bald nach der Entlassung in geeigneten Stellen untergekommen“ waren, wohl vor allem im Straßenaufsichtsdienst. „Die Nachfrage war bald nach Ausbruch des Krieges so erheblich, dass sie auch nicht annähernd befriedigt werden konnte.“
Heinrich Ottos Vater Adolf war übrigens Gerber.
In den Akten haben wir auch einen zweiseitigen eigenhändigen Lebenslauf des jungen Otto, den ich bei Gelegenheit hier nachtragen werde, sofern mich der Scanner nicht im Stich läßt.
P.K.
Hello! Is it okay that I go a bit off topic? I am trying to read your blog on my iPhone but it doesn’t dslaipy properly, any suggestions? You can always email me at Thanks! Ethan
@Carlos: The answer to Your question You will find here: http://www.siwiarchiv.de/2012/05/siwiarchiv-de-iphone-ipad-etc/ We´re using slideshare to show presentations an PDFs. Slideshare didn´t work with iPhone and iPad. Sorry!
Pingback: Ausstellung: “Hier und anderswo – 90 Jahre ASK I” | siwiarchiv.de
Pingback: Ausstellung: “Hier und anderswo – 90 Jahre ASK I” | siwiarchiv.de
Zu einigen Punkten der Darstellung, die es aus meiner Sicht schon 2010 fragwürdig machten, diese Studenten-Arbeit mit der Autorität der Kreis-website auszustatten:
– „Russische Zwangsarbeiter“? Die meisten waren tatsächlich ukrainische Zwangsarbeiter, gemeint ist mit „russisch“ wohl aber „sowjetisch“? Außer im antikommunistischen Propagandajargon der Adenauerzeit/im Alltagsgerede ist „russisch“ ungleich „sowjetisch“.
– Zu Ottos „Hinwendung zum Kommunismus“ bzw. „Aufbauleistungen …. des Kommunismus“ (in der Britischen Zone??? Nach etwa einer bislang unbekannten, kurzzeitigen Etablierung sozialistischer Verhältnisse durch die britische Militärregierung, wie sie vorausgegangen sein müsste???): Da werden wohl KPD und Kommunismus miteinander verwechselt. Die hier vorgenommene Gleichsetzung von KPD und Kommunismus ist antikommunistischer Propagandajargon der Adenauerzeit/Alltagsdiktion. Man fragt sich, wie ein junger Mann auf sowas kommt..
– „bekleidete den Posten des …“: Propagandajargon, „Posten“, nicht gerade eine wissenschaftliche Kategorie.
– Otto habe zur „Führungsschicht“ der lokalen KPD gehört: zweifelsohne gehörte er zu den führenden Akteuren/der Führungsgruppe der KPD im UB Siegen. Den quantitativen Umfang einer sozialen „Schicht“ erreichte diese Gruppe in dieser kleinen Partei wohl nicht.
– Die RGO-Gewerkschafter waren durchaus nicht nur Mitglieder der KPD. Natürlich gab es dort auch Mitglieder anderer Parteien und Parteilose. Wenngleich die KPD den entscheidenden Einfluss ausübte, so wäre die Etikettierung „kommunistische RGO“ doch allzu undifferenziert. Das gilt in gleicher Weise für die Annahme, es handle sich um eine „Abspaltung“ vom ADGB. Die „Abgespaltenen“ waren von der ADGB-Führung in sehr vielen Fällen rausgeschmissen worden.
– Es wäre gut gewesen, darauf hinzuweisen, dass der UB Siegen der KPD in den 1920er/30er Jahren die politischen Kreise Siegen und Altenkirchen umfasste.
– Otto gehörte mindestens in den 1920er Jahren der Liga gegen den Kolonialismus an. Das war eine im Siegerland mit seinen starken antisemitischen wie generell xenophoben Traditionen außerordentlich seltene Mitgliedschaft.
– M. W. war die „Demokratische Arbeitsgemeinschaft“ zu keinem Zeitpunkt ein Personenverbund, sondern für die kurze Zeit ihrer Existenz ein Zusammenschluss der Parteiführungen von SPD, KPD, LDP (= später FDP) und CDU. Die CDU wurde in dieser Zeit von Zentrums-Leuten wie Albert Schopp, die LDP von eher Linksliberalen wie Josef Balogh geführt. Es gab einen Kreisausschuss und Ortsausschüsse mindestens in Brachbach, Mudersbach, Niederschelden, Niederschelderhütte.
– „Der Modus der Bestellung [richtiger: „Berufung“] hatte zur Folge, dass die linken Parteien überrepräsentiert waren und die CDU unterrepräsentiert.“ Auf welche Zahlen kann der Verfasser seine Behauptung stützen?! Gewählt wurde doch wohl 1945 noch nicht? Es wäre auch gut zu sagen, dass es 1945 darum ging, Weichen zu stellen.
– Otto sei „aus undurchsichtigen Gründen“ aus der KPD ausgeschlossen worden. Da wird suggeriert. Entweder man weiß es oder man weiß es nicht. In diesem Fall schweigt man oder spricht im äußersten Fall von „unbekannten Gründen“. M. W. – das nebenbei – ging es darum, dass Otto ein Verhältnis mit der Frau des lokalen KPD-Vorsitzenden unterhielt. Aber bitte, auch nur eine Annahme. Von einem Zeitzeugen, einer Spezies also, die bekanntlich bei aller Autorität aus natürlichen Feinde des Historikers besteht.
– Was vor allem dem Text fehlt, das sind die Belege. Die können durch eine lückenhafte Quellen- und Literaturliste (was ist z. B. mit Blanchet?) nicht ersetzt werden.
Mit Grüßen aus dem oberbergischen Ausland
Ulrich Opfermann
Dank an die Herren Opfermann und Kunzmann für die kritische Durchsicht und die ergänzenden Fakten! Hier wird redaktionelles Arbeiten erstmals auf siwiarchiv nachvollziehbar gemacht – auch dafür danke!
1) Der Text ist in der Tat frag-würdig. Ein weiteres Beispiel: War Heinrich Otto nach dem Verlust beider Unterschenkel während des ersten Weltkriegs in der Tat in der Lage nach dem ersten Weltkrieg im kaufmännischen Bereich, als Postbediensteter und als Landwirt zu arbeiten? Während Bürotätigkeiten durchaus denkbar erscheinen auf die obige Einlassung Kunzmanns sei verwiesen, ist dies für eine Tätigleit in der Landwirtschaft nur schwer vorstellbar. Hier gilt es die Quellen zu prüfen.
2) Blanchet, Philippe: Die CDU : ein Aspekt des Neubeginns des politischen Lebens im Siegerland 1945-1949 / Philippe Blanchet
(Lille, Univ., Hausarb. 1979) – 1979 ist sicher zur weiteren Präzisierung heranzuziehen.
3) Von zu Hause aus bleibt mir für heute noch die Zweifel Kunzmanns auszuräumen, dass dies für die Leser von siwiarchiv.de uninteressant sei. Gestern war der erfolgreichste Tag in der Geschichte von siwiarchiv.de: 176 Besucher klickten insgesamt 1124 Seiten des Blogs an. Auch sind es schon 150 Besucher mit 339 Seitenzugriffen. Der Blick in der Werkstatt der Historiker und Archivare ist also interessant!
4) Übrigens zum Vergleich der derzeit gültige Wikipedia-Artikel:
„Heinrich Otto (Nordrhein-Westfalen)
Heinrich Otto (* 5. August 1893 in Siegen; † 31. Juli 1983) war ein Landtagsabgeordneter der KPD in Nordrhein-Westfalen.
Otto war 1946 Landrat des Kreises Siegen und in der ersten Ernennungsperiode Mitglied des ernannten Landtages von Nordrhein-Westfalen.“
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Otto_%28Nordrhein-Westfalen%29
Traute Fries weist zur frag-würdigen Berufstätigkeit Heinrich Ottos auf folgende Quellen hin:
1) Der Pazifist Nr. 8 v. 22.2.1925, „Pazifisten sind Freiwild in der „freiesten Republik“ Unglaubliche Unternehmer-Freiheiten.“:
[…] „Der erfolgreiche Leiter der pazifistischen Bewegung im Siegerlande, unser Freund Otto, war jahrelang als Angestellter bei einer Siegener Firma tätig. Er ist, obgleich 100 Proz. kriegsbeschädigt, zum 1. Januar 1925 gekündigt worden.“
2) Bernd Schlenbäcker, Biographische Erkundungen zur Zeitgeschichte des Siegerlandes, Kassel 1978, S. 185. „Er [H.O.] war ja schwerbeschädigt und eine Zeitlang war er dann noch beschäftigt. Nachher gab er die Beschäftigung auf und lebte nur noch zum Einsatz für die Friedensgesellschaft. Er konnte sich das erlauben auf Grund von seiner Kriegsbeschädigtenrente.“ (Interview Wilhelm Fries)
Eine wenn auch nur schwache Spur läßt sich vielleicht noch verfolgen (von jemandem, der Zeit hat): Es ist anzunehmen, dass auch in Siegen besondere Kurse für Kriegsversehrte angeboten worden waren. Da Heinrich Otto in einem Adressbucheintrag als „Maschinentechniker“ geführt wurde, wäre es denkbar, dass er nach seiner Verwundung einen entsprechenden Kurzlehrgang besucht hatte. Hierfür wären in Siegen die Eisenfachschule (Akten allerdings verloren) oder die Städtische Fortbildungsschule in Frage gekommen. Hilfreich wären wohl die Unterlagen des „Kriegsbeschädigten-Fürsorge-Ausschusses für den Kreis Siegen“, wo immer diese (wenn überhaupt) liegen. Der Ausschussvorsitzende war anscheinend Landrat Bourwieg. (Die Online-Findbücher zu den Beständen „Landratsamt“ und „Kreisausschuss Siegen“ sind vom Landesarchiv leider vor Monaten aus dem Verkehr gezogen worden.) Beim LWL-Archivamt würde ich in den Beständen 610 bis 612 nur Allgemeineres vermuten, aber man kann ja nie wissen …
P.K.
1) Dem Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein lagen bis zur Publikation hier auf siwiarchiv folgende Reaktionen von in der Siegerländer Zeitgeschichte bewanderten Personen vor:
a) “ …. .es gibt halt immer was zu mäkeln, das sehen Sie ja. Das soll aber den Blick auf das positive Anliegen und seine ansonsten doch wohl gelungene Umsetzung nicht trüben.“
b) “ …… Eine schöne Arbeit, die mir viel Neues eröffnete. Für mich war vor allem die Kontaktaufnahme mit Kämer neu und interessant! …..“
2) Die unpräzise Formulierung, dass die RGO kommunistisch seien, scheint u.a. ihren Ursprung in der Darstellung D. Pfaus zu haben – s. „Christenkreuz und Hakenkruez. Siegen und das Siegerland am Vorabend des „Dritten Reiches“, Bielefeld 200, S. 197).
3) Als weitere Quelle zur Biografie diente das in Kraumes Literaturliste angegebene Handbuch Opfermanns. Der maßgebliche Eintrag sauf S. 243 soll hier zitiert werden:
„Otto, Heinrich
*5.8.1893, gest. 31.7.1983 Siegen, Siegen, Kulturbautechniker, im 1. Weltkrieg schwer verletzt (beide Unterschenkel amputiert), KPD (1928ff.), als Bezirksleiter der DFG intensive Aktivität im Raum Siegerland/Dillkreis, Liga gegen den Kolonialismus, nach der Machtübergabe mehrfach inhaftiert, noch in der Zusammenbruchphase Reorganisation der KPD, Politischer Leiter Kreis Siegen (=Stadt Siegen, Krse Siegen, Olpe, Wittgenstein)(bis 1947), Anfang der 1950er JahreAusschluß, dann parteilos, Beratender Ausschuß für den Land- und Stadtkreis Siegen (1945-46), LR Kr. Siegen (1946), Mitgl. Kr-Vorst. Verband der Kriegs-, Bomben- unbd Arbeitsopfer, erster Arbeitsdirektor der Hüttenwerke Geisweid AG, (später Stahlwerke Südwestfalen AG) ….“
Heute Artikel in der Siegener Zeitung:
http://www.siegener-zeitung.de/a/566070/34hier-und-anderswo34
Pingback: Landrat Heinrich Otto (1893-1983): | siwiarchiv.de
Die Diskussion um die Erarbeitung der Biographie Heinrich Ottos wird hier besprochen: http://archiv.twoday.net/stories/97017522/
Pingback: Hermann Reuter: “Unser Landrat Heinrich Otto” | siwiarchiv.de
Pingback: Hermann Reuter: “Unser Landrat Heinrich Otto” | siwiarchiv.de
Findet sich hier etwas über Heinrich Otto, das über das bisher hier publizierte hinausgeht:
Deutsche Kommunisten: biographisches Handbuch 1918 bis 1945
Autoren Hermann Weber, Andreas Herbst
Verlag K. Dietz, 2004
Länge 992 Seiten?
Gute Idee, leider Fehlanzeige. Ich habe in unser Bibl.-Ex. geschaut. Es gibt da zwar zufällig einen Heinrich Otto, aber nicht „unseren“.
P.K.
Wen es denn interessiert: Der persönliche Nachlass von Kreisbaurat Sommer befindet sich im Stadtarchiv Siegen (Sammlung 442, 2 Kartons, 19 Positionen).
Danke für die notwendige Ergänzung!
Moin aus Norden, Ostfriesland
Mein Name ist Axel Schade, ich bin gebürtiger Siegener, wohne aber bereits seit 2001 aus gesundheitlichen Gründen an der Nordsee. Als Frührentner braucht man ein Hobby, meines ist es, die Geschichte der Sportfreunde Siegen aufzuarbeiten. Dazu stehe ich auch mit dem Verein, in persona mit dem Medienbeauftragten Daniel Schäfer, in Kontakt. Nun zu meinem Anliegen. Ich suche zur Person Alfred Sommer Fotos. Insbesondere aus dem Bereich Sportfreunde und ganz speziell zum ersten Stadion, das Alfred Sommer geplant und gebaut hat. Der Stadtplatz auf der Schemscheid. Können sie mir diesbezüglich Auskunft geben, ob es Fotos gibt und wie ich an Kopien derselben kommen kann. Gruß Axel Schade,
In der Ausstellung “Geschichtsforum Wiederaufbau Siegen” – s. http://www.siwiarchiv.de/2012/05/siegener-architekturgeschichte-1950er-jahre/ – findet sich auch eine Biographie Sommers. Stephan Hahn, Mitglied des Geschichtsforums, weist folgende Gebäude Sommers aus den Nachkriegsjahren nach:
– Gustav-von-Mevissen-Str. 21, Einrichtung einer zweiten Wohnung durch Einbau einer Küche im ersten Obergeschoss, 1954
– Kirchweg 72, Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses (Damen- und Herrenfriseurgeschäft), 1949
– Koblenzer Str. 61, 63, Projekt Garagenbau [damals: Koblenzer Str. 29]
-Siegbergstr. 51, Wohnhaus, (nicht durchgeführt)
– Sandstr. 5, Wiederaufbau des zerstörten Wohn- und Geschäftshauses (Laden, Büro und Wohnung), 1955
– In der Hüttenwiese 28, Lagerhalle, (mittlerweile abgebrochen)
– Marienborner Str. 127, Bau eines Holzlagerschuppens 1951, Bau eines Treibgasflaschenlagers in einer bestehenden Garage der Fa. Richard Bernshausen Holz- und Kohlenhandlung,1956 (mittlerweile abgebrochen bzw. abgebrannt)
– Spandauer Str. 48 + 52, Bau eines Wohn- und Geschäftshauses mit zwölf Wohneinheiten mit vier Garagen, 1960
– Bahnhofstr. 5, Errichtung von Läden in Behelfsbauweise auf dem Trümmergrundstück Cafe + Restaurant Sommer, 1950, nicht durchgeführt
– Bahnhofstr. 5, Errichtung einer Projektionskammer für einen Reklamestand der Westdfeutschen Werbezentrale für Wirtschaftswerbung Hanaua, 1950 (ohne Genehmigung zeitweise errichtet)
Die mit dieser Veranstaltung wiederbelebte Diskussion wurde zuerst von der Linken Liste der Universität Siegen aufgegriffen. Die Siegener Straßenbenennungen wurde Thema ihrer Veranstaltung zum 8. Mai. Die Redebeiträge stehen hier als PDF-Dateien zum Download bereit: http://lili.blogsport.de/2012/05/08/redebeitraege-zum-8-mai/
In ihrer heutigen Ausgabe widmet sich die „Westfälische Rundschau“ dem „Problemfall Hindenburgstraße“: http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/problemfall-hindenburg-id6680799.html
Pingback: Ausstellung “Geschichtsforum Wiederaufbau Siegen” | siwiarchiv.de
Sehr geehrte Damen und Herren.
Ich suche Informationen zur Jugendzeit und Erziehung(Studium)des
Grafen Adolf von Neuenahr Alpen Limburg,der von seinem Vetter Graf
Hermann von Neuenahr Moers als Vormund betreut wurde.
Für Antworten bedanke ich mich im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Uwe Lex
Zunächst möchte ich Sie auf folgende Überblicksdarstellung verweisen, die die neuere Literatur aufführen:
– ADB-Artikel: http://de.wikisource.org/wiki/ADB:Neuenahr,_Adolf_Graf_von
– NDB-Artikel: http://www.deutsche-biographie.de/sfz71278.html
Ferner emfehle ich eine Recherche in Folgenden Archiven:
– Landesarchiv NRW, Abt. Rheinland,
– Vereinigten Adelsarchive im Rheinland e.V.
Informationen zu den genannten Archiven finden Sie hier: http://www.archive.nrw.de/index.php
Siegener Zeitung, 23. Mai 2012, S. 4:
„…. Und nach einer genauen Einweisung, was kleine Studenten während der Vorlesung alles nicht machendürfen, konnte Prof. Hering dann samt Powerpointpräsentationen loslegen. ….“
“ …. Der interessierte Nachwuchs zeigte sich – zum Teil mit Wasserflaschen ausgestattet – wie ein richtiger Student von seiner besten Seite und hörte Prof. Dr. Sabine Hering gespannt zu. Die Hochschulprofessorin verstand es, die Geschichte, wie die Universität ins Siegerland kam kundgerecht in einer Art Märchenform dazustellen. Wichtig war es den damaligen Initiatoren, dass bildungsschwache Regionen in den Genuss von Ausbildung kamen. Das ist mittlerweile längst gelungen. ….“
Pingback: Vortrag: “Der erste Siegerländer Kunstverein …. | siwiarchiv.de
Pingback: 70. Jahrestag der ersten Deportation der Juden aus dem Siegerland | siwiarchiv.de
Pingback: 70. Jahrestag der ersten Deportation der Juden aus dem Siegerland | siwiarchiv.de
Pingback: Andreas Rossmann: Der Fachwerkhaus-Schwund | siwiarchiv.de
Pingback: Siwiarchiv.de: Monatsstatistik 5/2012 | siwiarchiv.de
Im Podcast-Bereich von Radio Siegen findet sich am 23.5.2012 ein Bericht von Steffen Ziegler über diese erste Veranstaltung der Kinderuni: http://www.radio-siegen.de/aktuell/podcast/index.html
Kleine feine Kirche Ein Beitrag-MEDIATHEK – WDR.devon Marion Seemann, 30.05.2012:
Die Johanneskirche in Freudenberg-Oberfischbach ist ein kleines, eher unauffälliges Gotteshaus. Doch hinter der schlichten Fassade verstecken sich auch Besonderheiten. So ist sie eine der wenigen Kirchen im Siegerland, deren Turmuhr einmal in der Woche noch per Hand aufgezogen werden muss.
http://www.wdr.de/mediathek/html/regional/2012/05/30/lokalzeit-suedwestfalen-johanneskirche-denkmal.xml
WDR, Nachrichten Lokalzeit Südwestfalen, 5.6.2012:
„Die Hauberge im Siegerland sollen UNESCO-Weltkulturerbe werden. Dafür will sich der CDU-Bundestagsabgeordnete für den Kreis Siegen-Wittgenstein, Volkmar Klein, einsetzen. Der Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrates, Georg Schirmbeck, glaubt, dass das gute Werbung für die ganze Region sein kann. Er findet, in einer Region in der Forstwirtschaft müsse viel intensiver zusammengearbeitet werden und dafür lohne es sich, öffentlich zu werben. Die Aufnahme in eine UNESCO-Liste sei darum bestes Marketing.“
dat gibt es doch nit!
im gastbuch dort sint bilder von jetzt wie jungstilling als geist geht!!!
Pingback: “natur macht technik” | siwiarchiv.de
Sehr schön!
Und damit läßt sich die Lück-Literaturliste von neulich
(http://www.siwiarchiv.de/2012/06/archivare-alfred-lueck)
um einen Nachruf ergänzen:
Wied, Werner: Alfred Lück, in: Wittgenstein 46 (1982), H. 2, S. 66
P.K.
Wied, Werner: Alfred Lück, in: Wittgenstein 46 (1982), H. 2, S. 66
Ergänzung via:
http://www.siwiarchiv.de/2012/06/wittgenstein-bibliograhi/#comments
Danke an P.K.!
Pingback: “25 Jahre AIDS-Beratung im Kreis Siegen-Wittgenstein” | siwiarchiv.de
Pingback: Landrat Heinrich Otto: | siwiarchiv.de
Das im Eintrag abgebildete Gebäude ist heute abgerissen worden.
Der Artikel befindet sich hier online: http://archive20.hypotheses.org/149 Dort kann er auch kommentiert werden.
Das gesamte Archivar-Heft ist in Kürze als PDF abrufbar unter http://www.archive.nrw.de/archivar/hefte/2012/index.html
Pingback: Archivare aus dem Kreisgebiet II: Hans Kruse | siwiarchiv.de
Pingback: Vortrag “Walter Krämer – Von Siegen nach Buchenwald” | siwiarchiv.de
Pingback: Vortrag “Walter Krämer – Von Siegen nach Buchenwald” | siwiarchiv.de
also im „gästebuch“ dort tummeln sich ja fast nur gaudikids!
dem jungstillinggeist sein bruder, schneckenbremser und viele andere sind dort auch mit bild vertreten.
Pingback: “Ich wollte alles. Und zwar sofort.” | siwiarchiv.de
Pingback: Gratulationen, Rückblicke, Perspektiven – | siwiarchiv.de
Pingback: “40 Jahre Frauen an der Uni Siegen” | siwiarchiv.de
Pingback: “40 Jahre Frauen an der Uni Siegen” | siwiarchiv.de
Pingback: “40 Jahre Universität Siegen” | siwiarchiv.de
Pingback: Heinrich Otto im Visier des Volksgerichtshofes: | siwiarchiv.de
Pingback: Aus dem Fotoarchiv des Kreises: | siwiarchiv.de
Pingback: Heute: Vortrag “Städte im Vergleich” | siwiarchiv.de
Pingback: Vortrag “Städte im Vergleich” | siwiarchiv.de
Pingback: Aus dem Fotoarchiv der Universität Siegen: | siwiarchiv.de
Danke, Herr Wolf, sehr hübsch geworden.
Das soll natürlich nur eine Ergänzung zu Ihrem Beitrag „Aus dem Fotoarchiv des Kreises“ (19.6.), speziell zum dortigen letzten Bild, sein. Dieses zwischenzeitig von der Kreisverwaltung genutzte Gebäude ist vor genau 100 Jahren für die damalige Wiesenbauschule erbaut worden; heute beherbergt es die „Realschule am Häusling“. Der Namenspatron für die Straße, Louis Ernst, war 1882-1900 Direktor der Wiesenbauschule und zuvor einige Jahre lang Siegener Reichtagsabgeordneter gewesen. In seine Direktorenzeit fiel der Bau des ersten Domizils der Wiesenbauschule (und der Gewerblichen Fortbildungsschule) in der Martin-Luther-Straße, heute Hans-Kruse-Straße.
P.K.
Pingback: Vortrag “Walter Krämer – Von Siegen nach Buchenwald” | siwiarchiv.de
Pingback: Vortrag “Walter Krämer – Von Siegen nach Buchenwald” | siwiarchiv.de
Pingback: Regionale2013-Projekt: “WasserEisenLand” | siwiarchiv.de
Auch die Thüringische Allgemeine erinnert heute an den 120. Geburtstag Walter Krämers – durchaus mit Siegen-Bezug:
“ ….. So konnten auch mit großer Genugtuung Siegener und Weimarer Bürger erleben, dass sich ihr jahrzehntelanger Kampf für eine Anerkennung der Leistung Walter Krämers gelohnt hat. Der konservative Stadtrat von Siegen hat nunmehr beschlossen, dem Sohn der Stadt, Walter Krämer, ein Denkmal zu setzen. Bürgermeister Steffen Mens [sic!] Begründung zeigt die neue Position: „Es geht bei dieser dauerhaften Ehrung um das humanitäre und selbstlose Handeln und Wirken, das eindeutig über weitem die Kritik an seiner Person überstrahlt“.
Für Weimarer Bürger und Besucher der KZ-Gedenkstätte hat der VVN/BdA Siegerland-Wittgenstein und die Lagergemeinschaft Buchenwald-Dora im Vorraum zum Krematorium eine neue Erinnerungstafel angebracht. Hier kann der Besucher innehalten oder mit einer Blume des 120. Geburtstages von Walter Krämer gedenken.“
Quelle: http://weimar.thueringer-allgemeine.de/web/lokal/leben/detail/-/specific/Im-Gedenken-an-Walter-Kraemer-1927538088
Pingback: “Das WasserEisenLand. Tourentipps” | siwiarchiv.de
Dem Stadtarchiv Freudenberg gebührt der Dank für den 150. Artikel auf siwiarchiv.de !
Pingback: “Das WasserEisenLand. Tourentipps” | siwiarchiv.de
Ergänzender Link zu den Erlebnisorten der südwestfälischen Eisenstraße:
http://www.eisenstrasse-suedwestfalen.de/Erlebnisorte
Pingback: Rezension “Die Gründung und die Gründer – | siwiarchiv.de
Im Wikipedia-Artikel zu Bourwieg – http://de.wikipedia.org/wiki/Bourwieg – finden sich folgende Hinweise:
– 1883 Mitglied in der Burschenschaft Franconia Freiburg (Quelle: Ernst Elsheimer (Hrsg.): Verzeichnis der Alten Burschenschafter nach dem Stande vom Wintersemester 1927/28. Frankfurt am Main 1928, S. 50.)
– „hatte drei Söhne, von denen die beiden Ältesten im Ersten Weltkrieg fielen“
Bravo, eine gelungene Rezension! Endlich spricht jemand aus, was jedem auffallen muss, sich aber niemand traut offen zu sagen.
Gerade der letzte Absatz kann nicht genug betont werden. Ein „Alternativer Stadtführer 2.0“ wurde nicht nur bewilligt, nein, er nahm gleich mehreren Anträgen im Programm „Toleranz fördern“ die Möglichkeit der Förderung!
Es ist mehr als Unverständlich und mit „Siegener Klüngel“ auch nicht mehr treffend zu beschreiben!
Danke für die ehrliche Rezension, Herr Hesse!
1) Link zu einem Video über den Einsatz: http://youtu.be/4FawTs_srsM
2) Onlineberichterstattung: http://www.wirsiegen.de/2012/06/siegen-ast-knallt-vor-rettungswagen/
Auf zum Arbeiten an dem mangelhaften Geschichtswissen unserer Kinder!
Die Frage ist nur, wer macht mit? – Überforderte und ausgebrannte Lehrer und Pädagogen, von neuen pädagogischen Versuchen gebeutelte Schüler, überforderte Eltern?
Danke
Pingback: Lebenslauf Landrat Bruno Bourwieg | siwiarchiv.de
Pingback: Siwiarchiv.de: Monatsstatistik 6/2012 | siwiarchiv.de
Der Eloge schließen wir uns doch gerne an: „Die ‚Siegerlandbibliothek“ ist aus dem Kulturbereich der hiesigen Region nicht mehr wegzudenken […].“ Und wir zitieren weiter: „Bis vor kurzem als Wissenschaftliche Bibliothek der Stadt Siegen im Oberen Schloss untergebracht, befindet sie sich nun nach ihrem Umzug in Stadtarchiv Siegen im KrönchenCenter in neuen Räumlichkeiten. Sie heißt nun ‚Wissenschaftliche Bibliothek zur Regionalgeschichte‘ […] und gehört zu den wenigen deutschen Regionalbibliotheken“, so ein Bericht in der Zeitschrift “Siegerland“ (Bd. 84, Heft 1 (2007), S. 91). Dem Vernehmen nach soll diese (Freihandbibliothek, rund 15.000 Medieneinheiten) sogar ein wenig zugänglicher sein als ihr Uni-Pendant, und man wird sogar beraten! Insofern ist es schon ärgerlich, dass diese Institution im Zentrum der Stadt – für jedermann zugänglich – in der Berichterstattung über die Siegerlandsammlung der UB nur eine Randnotiz im letzten Absatz wert ist.
Pingback: Forschungsstelle Siegerland | siwiarchiv.de
Hier zwei Einträge aus dem „Handbuch der historischen Buchbestände“, die nun zwar nicht mehr ganz aktuell sind (Stand 2003), aber den Freunden des Stadtarchivs und seiner wissenschaftlichen Bibliothek immer noch zur Lektüre empfohlen werden können:
http://fabian.sub.uni-goettingen.de/?Siegerlandmuseum_(Siegen)
http://fabian.sub.uni-goettingen.de/?Stadtarchiv_(Siegen)
Zur Erinnerung an den Bibliotheksumzug – auch schon wieder 5 Jahre her! – noch dies:
http://www.inside-siegen.de/onlinenews2.php?id=5353&s=
P.K.
Der Vollständigkeit halber: am 24. Mai 2012 vermeldete die „Westfälische Rundschau“: „Hilchenbach entdeckt Hindenburg“ . Die Diskussion um einen Umbenennung der dortigen Hindenburgstraße wurde vom Ehrenvorsitzenden des CDU-Stadtverbandes angeregt.
Die für Juni angekündigte Behandlung einer Bürgereingabe Ruths im Hilchenbacher Hauptausschusses hat laut Ratsinformationssystem noch nicht stattgefunden. Der Ausschuss tatgt erst am 29. August wieder.
In ihrer heutigen Print-Ausgabe berichtet die Siegener Zeitung, dass die Hindenburgstraße in Hilchenbach nicht umbenannt werden wird. Der Straßenname soll vielmehr als Mahnmal erhalten bleiben. Ein Hinweistafel soll über Paul von Hindenburg informieren.
Im Ratsinformationssystem der Stadt Hilchenbach ist der der Entscheidung zugrunde liegende Vorgang einsehbar: https://sdnet.kdz-ws.net/gkz040/tops.do?tid=MnzMduEbsGSvGJ .
In der Print-Ausgabe der Siegener Zeitung vom 3.9.2012 findet sich der erste Leserbrief zur Nicht-Umbenennung der Hindenburgstraße, insbesondere zum Text der geplanten Hinweistafel („Völlig verfehlt“).
Heute findet sich in den Print-Ausgaben der Siegener Zeitung („Neutralität aufgehoben“) und der Westfälischen Rundschau („Sieger-Land“) ein gleichlautender Leserbrief des ehem. Hilchenbacher Stadtdirektors Dr. Hans Christhard Mahrenholz zur Beibehaltung der Hindenburgstraße in Hilchenbach. Tenor: Mahrenholz war bei seinem Amtsantritt 1962 in Hilchenbach verwundert über die Existenz einer Hindenburgstraße. Um die von ihm empfundene Unausgewogenheit ausgeglichen, schlug er vor eine Nachbarstraße nach Friedrich Ebert zu benennen.
Niederschrift der Hauptausschusssitzung v. 29.8.2012:
“ ….. 4. Änderung des Straßennamens „Hindenburgstraße“
Bürgereingabe von Herrn Wolfgang Ruth
Vorlage Nr. 377
Herr Hasenstab stellt den Sachverhalt kurz dar.
Beschluss:
Der Hauptausschuss macht sich die Sachdarstellung unter Ziffer 4. der
Vorlage zu eigen und beschließt:
1. Eine Umbenennung der Hindenburgstraße erfolgt nicht.
Dabei macht der Hauptausschuss deutlich, dass die Beibehaltung des
Namens nicht mit einer fortwährenden Ehrung der Person Hindenburg
gleichzusetzen ist.
Die Mitglieder sind sich der Fehler und Versäumnisse Hindenburgs
vollauf bewusst.
2. Auf einer Schrifttafel am Straßenschild ist auf die umstrittene
Rolle Hindenburgs bei der Machtergreifung der Nationalsozialisten
hinzuweisen.
3. Auf die Behandlung der Thematik „Hindenburg“ im Rahmen des
Geschichtsunterrichts der Hilchenbacher Schulen ist hinzuwirken.
Abstimmungsergebnis: Einstimmig mit 12 Ja-Stimmen
Ausschnitt an: 360, 147 ….“
Quelle: https://sdnet.kdz-ws.net/gkz040/tops.do?tid=MnzMduEbsGSvGJ
In der Print-Ausgabe der Siegener Zeitung v. 7.9.2012 findet sich ein weiterer Leserbrief (Prof. em. Dr. Ulrich Penski) für die Beibehaltung der Hindenburgstraße und gegen die „verkürzte Sichtweise“ der beabsichtigten Hinweistafel. Folgender Aspekt ist neu: “ …. Umso mehr verwundert es, dass die Bürgereingabe zur Umbenennung nicht etwa von antifaschitischen Gruppierungen stammt, die in verbreiteten Netzwerken solche Umbenennungen betreiben, sondern aus der Mitte des politischen Spektrums. …..“:
Erneuter Anlauf zur Umbennung der Hindenburgstr. in Hilchenbach – allerdings: “ …. Die damals vermiedene öffentliche Debatte soll es auch 2018 nicht geben. Er werde „das Thema nicht nochmals in den Hauptausschuss bringen“, ließ Bürgermeister Holger Menzel den CDU-Politiker wissen. Der lässt das nicht auf sich beruhen und hat sich nun an den Landrat als Chef der Kommunalaufsicht mit der Frage gewandt, ob diese Entscheidung des Bürgermeisters „sachgerecht“ sei. …..“ Quelle: Westfalenpost, 24.5.2018.
Kommentar Steffen Schwabs, Westfalenpost 24.5.2018 dazu: “ …. Die Hindenburgstraße trägt ihren Namen, weil die Nazis im Hilchenbacher Rat 1933 wollten, dass die Stadt sich an Hindenburg erinnert. Wenn sich der heutige Hilchenbacher Rat in dieser Gesellschaft nicht wohl fühlt, sollte er den Namen ändern.
Solche Konsequenz wird aber nicht zu erwarten sein, weil sie weitere Folgen hätte. Denn da ist ja immer noch Bernhard Weiss, Vater des heutigen Eigentümers der SMS group, Heinrich Weiss, der der Stadt gerade den Kulturellen Marktplatz Dahlbruch ermöglicht. Und Weiss war nun einmal nicht nur hoch geschätzter Unternehmer und IHK-Präsident, sondern auch als Wehrwirtschaftsführer im Flick-Prozess des internationalen Militärgerichtshofs in Nürnberg wegen Sklavenarbeit verurteilt worden. Ein Vorbild? Wie Hindenburg?“
Westfälische Rundschau, 30.5.2018, teilt das Ergebnis der Prüfung mit:
„Nach Hauptsatzung der Stadt und Geschäftsordnung des Rates sei „dem Hauptausschuss die Behandlung von Eingaben (….) vorbehalten,“ …. Dem Bürgermeister komme „kein Recht im Sinne einer eigenen materiellen Vorprüfung und anschließenden Verwerfungskompetenz zu.“
Heißt also der Hilchenbacher Hauptausschuss muss sich mit der Eingabe beschäftigen, die Hindenburgstr. in Paul-Benfer-Str. umzubennen.
In der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Rates der Stadt Hilchenbach vom 4.7.2018 (S. 12) heißt es zum erneuten Anlauf die Hindenburgstr. umzubennen: “ …. Für die rechtliche Klärung, ob eine erneute Behandlung erfolgen muss, steht die Stellungnahme des Städte- und Gemeindebundes NRW noch aus …..“
Link: https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz040/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZd32NLVr9zElOV6EN7gG4D7a1K3vgBb7oSYLAjUtFMWP/Oeffentliche_Niederschrift_Rat_der_Stadt_Hilchenbach_04.07.2018.pdf#search=Hindenburgstra%C3%9Fe
Auch der der Städte- und Gemeindebund hat eine erneute Behandlung des Antrages empfohlen, so dass der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Hilchenbach am 21.11. das Thema beraten wird.
Quelle: Siegener Zeitung (Print), 16.10.2018
Daß die Universität Siegen, wo immer sie kann, fleißig die Trommel rührt, ist nicht neu. Was sie der Öffentlichkeit präsentiert, sind PR-Texte im Gewand der Sachinformation. Diese sollte man ernst nehmen, aber nicht ernster als andere Werbeanzeigen, die, sagen wir, Hustenbonbons oder Babywindeln anpreisen.
Daß die Universitätsbibliothek die besagten „kleineren Schriften“, die „graue Literatur“, sammelt, die Siegen-Wittgenstein plus Nachbargebiete betreffen, darf man ihr glauben. Indes sind die Lücken erheblich. Es fehlt der UB, um den Überblick über all das, was erscheint, zu bewahren, schlicht an Personal und Know how. Wer je solch „graue“ Schriften gesucht hat, weiß, wie oft er auf lokale Archivbestände, private Hilfe oder die Landsbibliotheken Dortmund und Münster verwiesen war.
Und noch eins: Die Siegerlandsammlung zählt nicht (!) zum Freihandbestand, der dem Nutzer offensteht. Sie steht im geschlossenen Magazin. Wie sagt man so schön? „Aus den Augen, aus dem Sinn.“
Wie jeder andere hatte auch Artur Franz das gute Recht, ein widerspruchsvoller Mensch zu sein. Nistkastenbau für sympathische Käuze und Dokumentierung der heimischen Fauna sind Leistungen, für die er Anerkennung verdient. Nicht Anerkennung sondern kritische Hinterfragung verdient er als Trophäenjäger. Zoologische Leichensammlungen wie die von ihm angelegte sind immer das Ergebnis von Naturfrevel und als Anschauungsobjekte in der heutigen Zeit mit ihrem überreichen Bild- und Filmangebot längst nicht mehr erforderlich, um z.B. Biologiestudenten zu belehren. Jeder Eingriff in die lebende Umwelt, wenn er nichts besserem als der Dekoration des Arbeitszimmers dient, ist überflüssig; besonders ärgerlich wird die Sammelleidenschaft aber, wenn sie zu solchen Auswüchsen führt, wie man sie in der Siegener Zeitung illustriert findet: Stolz wie ein Großwildjäger vor dem erlegten Nashorn posiert die Biologie-Professorin mit Schmetterlingskästen voller Beweisstücke für exzessiven Raubbau: Anscheinend wurde einst skrupellos abgeräumt, was immer vor das Netz geriet, egal wie selten oder bedroht. Wie viele Siegener Biologiestudenten haben bei ihren Spaziergängen wohl schon einmal einen Schwalbenschwanz oder Segelfalter gesehen? An aufgespießten Kadavern herrscht beim „Vogel-Franz“ kein Mangel. Als Highlight der Sammlung sieht man an die 15 Exemplare des in Deutschland seit 1936 (und inzwischen weltweit als einzige nichttropische Schmetterlingsart) streng geschützten und hierzulande fast ausgestorbenen Roten Apollofalters. Welche Überraschungen mögen sich in der Sammlung noch verbergen?
Wie eingangs angedeutet, mag man es der Gedankenlosigkeit oder Getriebenheit des Menschen Adolf Franz zugute halten, dass er die Widersprüchlichkeit seiner Aktivitäten selbst nicht bemerkte. Ihn aber postum zur (Zitat SZ:) „Naturschutz-Legende“ zu stilisieren, ist wohl doch ein wenig unangemessen.
P.K.
„Fehlendes Personal“: Korrekt.
„Fehlendes Know how“: Bitte mal erläutern. Soll das wenige Personal daraus schließen, dass es zu dämlich ist?
„Erhebliche Lücken“: Es gehört nicht zu den Pflichtaufgaben der UB Siegen, sämtliche Lücken zu schließen. Die „Siegerlandsammlung“ kann und soll kein Konkurrenzunternehmen zu den Landesbibliotheken sein. Und so schlecht ist sie ja nun auch wieder nicht bestückt, dass man sich ihrer schämen und sie totschweigen müsste.
„Freihandbestand“: Ja, das war irritierend und ist, wie ich gerade sehe, schon korrigiert worden (übrigens unabhängig von dem schriftlichen Rüffel).
„Aus den Augen, aus dem Sinn“: Was weggeschlossen ist („und zwar für immer“), kann wenigstens nicht so leicht gestohlen werden. Immer positiv sehen!
P.K.
Pingback: Lokale Rundfunk- und Fernsehmedien – Quellen für ein Kommunalarchiv?! | siwiarchiv.de
Dank an den nunmehr als Lepidopterologen geouteten Kollegen Kunzmann für die klaren Worte, dem gibt es an sich nichts hinzuzufügen. Außer nochmal meine Fassungslosigkeit beim Anblick des Bildes auszudrücken: Ist die abgebildete Großwildjägerin wirklich Professorin? Oder vielleicht doch nur die ahnungslose Praktikantin der SZ ???
Pingback: Wissenschaftliche Bibliothek zur Regionalgeschichte im Stadtarchiv Siegen | siwiarchiv.de
Klaus Graf kommentiert dieses Angebot wie gewohnt meinungsstark und lesens- und bedenkenswert: http://archiv.twoday.net/stories/109324331/ .
Pingback: Vom Nachwuchsorchester zur Südwestfälischen Philharmonie. | siwiarchiv.de
Einzelnachweise zur Lahntalsperree im Landesarchiv NRW, Abt. Rheinland (s. o.):
NW 72 Staatskanzlei , Landesplanung:
345 Lahntalsperre [bei Laasphe] Bd. l 1953-1955
Enthält : Darin : Karten
Altsignatur : 803 i
346 Lahntalsperre Bd. II 1955
Altsignatur : 803 i
Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft
Raumordnung und Landesplanung
NW 310 Nr. 24
Landesplanungsgemeinschaft Westfalen, Sitzungen des Verwaltungsrates
Bd. 5
Feb.-Mai 1960
enthält u.a.: Raumordnungsplan Lahntalsperre
NW 310 Nr: 786
Lahntalsperre Bd. 1: 1955 bis 1957
enthält nur: gutachtliche Vorarbeiten für einen Raumordnungsplan; Gutachten über Auswirkungen und Folgemaßnahmen des Baues (Dr.-Ing. W. Schütte)
Aktenzeichen: 73.00 (732)
Signatur: NW 404-128
Lahntalsperre Bd. 2: 1957 bis – 1960
enthält: Gutachten; Raumordnungsplan (u.a. Straßenplanungen)
Aktenzeichen: 73.00
Quelle zu Anmerkung 12: Plenarprotokoll 2/56
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMP02-56.pdf
S. 2073 rechts oben
Spiecker: „Man kann doch wohl behaupten, daß damals gerade die Kirchen das einzige öffentlich-sichtbare Widerstandszentrum gebildet haben!“
(Frau Finger (CDU): „Sehr richtig!“)
Mehr gibt die Stelle nicht her.
Zur Demontage:
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMPEP5.pdf
S. 87
Dazu Landtagsdrucksache I-129
„Antrag der CDU-Fraktion betr. Rest-Demontage der Maschinen-Fabrik Dr. Waldrich, Siegen“
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMDEP129.pdf
P.K.
PowerPoint Präsentation zu „Lambert und Laurin“ auf der MAI-Tagung 2009:
http://www.mai-tagung.de/maitagung+2009/wolfmuellerpptmai2009.pdf
Literaturhinweis: Klaus Goebel: Die Vorfahren von Bundespräsident Johannes Rau (1931-2006), in: Romerike Berge 62. Jg. Heft 1/2012, S. 2-21
Pingback: Westfalen-Fotos im Unterricht | siwiarchiv.de | Unterricht in der Schule | Scoop.it
Pingback: Ausstellungen zur Siegener Unigeschichte verlängert | siwiarchiv.de
Pingback: Ausstellungen zur Siegener Unigeschichte verlängert | siwiarchiv.de
Pingback: “Köln verdankt Siegerländern den Erhalt der Archivschätze” | siwiarchiv.de
In der „Liste der Bestände des Staatsarchivs Marburg mit Angabe ihres Umfanges“ (1963) von Johannes Papritz findet sich auf S. 80 eine Erwähnung der westdeutschen Archivtage.
Eine Durchsicht des „Archivars“ ist erforderlich, denn so findet sich bspw.:
Westdeutscher Archivtag am 10. Juni 1967 in Altena. In: Der Archivar 20, 1967, Sp. 313 (s. a. Kreisarchiv des Märkischen Kreises, Zeitgeschichtliche Sammlung Nr, 140 „Einladung zum Westdeutschen Archivtag am 10.06.1967 in Altena“, „Der Märker“, Westdeutscher Archivtag in Altena 16, 1967 Heft 07/S. 141)
Zur Miszelle im Blog s. http://archiv.twoday.net/stories/109333155/
Pingback: “Köln verdankt Siegerländern den Erhalt der Archivschätze” | siwiarchiv.de
Ein kleiner Hinweis: Die Fußnotenverlinkung ist kaputt, alle Links führen zu „file:///I:/KREISARC/Texte/Maria%20Elisabeth%20Hedwig%20Finger%20geborene%20Schwunk.doc#_ftnref33“
Weiterhin gibt es auch Fußnotenplugins für WordPress, welche die Fußnoten wie üblich hochstellen. Das sieht irgendwie gewohnter aus.Ebenfalls fände ich es nett, wenn im Text nicht unbedingt allgemeinbekannte Gruppierungen verlinkt werden, sofern sie einen Wikipedia-Artikel haben. Die Westdeutsche Frauenfriedensbewegung wäre ein Beispiel und wenn man ein „neues Genre“ etabliert, hat man ja die Freiheit, dieses Genre etwas zu prägen. Aber ich mecker einfach zu gerne zu viel, der Artikel ist extrem gelungen und ich bemäkle einige Kleinigkeiten. Weiter so!
Danke fürs Mäkeln!
1) Ich werde mich um ein Fußnoten-Plugin bemühen. In diesem Fall habe ich den Text nur schnell aus Word herüber geschaufelt. Hochstellen könnte ich zur Not auch mit den Editor …..
2) Entgegen meiner Gewohnheit zu verlinken findet sich hier im Text gar nichts. Asche auf mein Haupt! Ich persönlich gehe gerne großzügiger mit Links um. Die Zielgruppe des Blogs sind ja nicht nur Historiker und Archivare, sondern auch, vielleicht sogar eher, regionalgeschichtlich „Erstinteressierte“.
Pingback: Exponate zu Johann Georg Hinsberg | siwiarchiv.de
s. a. Schicksal Rudolf Stähler aus Ferndorf: http://www.ferndorf.de/nachrichten.php?id=49
(Siegener Zeitung, 20.3.2008)
In der Westfalenpost v. 18.7.2012 findet sich ein Artikel zum Projekt: http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/erinnern-an-verbrechen-der-nazizeit-id6890321.html
Landesarchiv NRW – Abteilung Rheinland – BR 2093 Nr. 187: Westdeutsche Archivtage (1910-1939), enthält v.a. Einladungen, darunter eine Anzeige des Westdeutschen Archivtags am 25. September 1910 im Odenwald
Landesarchiv NRW – Abteilung Rheinland – BR 2094 Nr. 115, enthält nur Teilnehmerliste des Westdeutschen Archivtags am 17. Juli 1965 in Dortmund
Vielen Dank für die Ergänzung!
Neben der Bedeutung für die regionale Archivgeschichte werfen diese regionalen Archivtage, der südwestdeutsche existiert ja noch und ein norddeutscher ist mir bei der Literatursuche via google books auch über den Weg gelaufen, einge allegemine archivgeschichtlichenFragen auf: Gab es auch mittel- und ostdeutsche Archivtage? Wer waren die Initiatoren? Welche Archivthemen wurden wie behandelt? Warum hat m. W. nur der südwestdeutsche Archivtag überlebt ? ……
Der Westdeutsche Archivtag 1962 fand Anfang Juli in Koblenz statt. Am 6. Dezember 1961 befasste sich die Dezernentenkonferenz unter der Leitung von Oberbürgermeister Willi Werner Macke mit der Tagung. „Es nehmen etwa 120 bis 150 Personen teil. Koblenz hat durch die Beherbergung des Staatsarchivs und des Bundesarchivs einen Namen in diesen Kreisen bekommen. Ein Empfang der Tagungsteilnehmer durch den Herrn Oberbürgermeister erscheint daher angebracht. Die entstehenden Kosten sollen zur Hälfte vom städt. Verkehrsamt und zur anderen Hälfte aus den dem Herrn Oberbürgermeister persönlich zur Verfügung stehenden Mitteln getragen werden“ (Stadtarchiv Koblenz Best. 623 Nr. 9955, S. 184). In der Sitzung vom 23. Mai 1962 wurde beschlossen: „Herr Beigeordneter Dr. Richter (Kulturdezernent) wurde gebeten, mit Herrn Archivrat Dr. Becker [vom Staatsarchiv Koblenz] den Empfang, evtl. im Rathaussaal, zu besprechen“ (StAK 623 Nr. 9955, S. 255).
Die Koblenzer Rhein-Zeitung berichtete dann in ihrer Ausgabe Nr. 156 vom 9. Juli 1962: „Die Teilnehmer des Westdeutschen Archivtages wurden am Samstagmorgen [7. Juli 1962] durch den Kulturdezernenten der Stadt Koblenz, Beigeordneten Dr. Richter, im Rathaussaal empfangen. Dr. Richter hieß die Gäste im Namen von Rat und Verwaltung willkommen und gab seiner Freude darüber Ausdruck, daß der Westdeutsche Archivtag in Koblenz stattfinde. Er betonte in seiner Ansprache, Koblenz als ehemalige rheinische Provinzialhauptstadt fühle sich noch immer verpflichtet, geistiger Mittelpunkt am Rhein zu sein. Die Stadt bemühe sich sehr um ihre zahlreichen kulturellen Institutionen und unterstütze sie so weitgehend wie möglich. Der Direktor des Staatsarchivs Koblenz, Graf Dr. Looz-Corswarem, dankte für die freundlichen Worte und die herzliche Aufnahme. Unser Bild zeigt (von links nach rechts) den Direktor des Staatsarchivs, Graf Dr. Looz-Corswarem, den Leiter des Bundesarchivs, Direktor Dr. Bruchmann, den Beigeordneten der Stadt Koblenz, Dr. Richter, und Archivdirektor a. D. Dr. Schmidt [ehemals Staatsarchiv] mit Gattin. Das Zusammentreffen der Wissenschaftler, das der Festigung der kollegialen Beziehungen diente, fand nach einem Mittagessen auf dem Rittersturz seinen Abschluß mit einer Besichtigungsfahrt zur Marksburg.“ Die Abbildung in der Rhein-Zeitung ist identisch mit dem bereits erwähnten Foto aus der Sammlung des Landeshauptarchivs Koblenz (LHA Ko Best. 710 Nr. 4759), siehe http://www.archivdatenbank.lha-rlp.de.
“ …. Festigung der kollegialen Beziehungen …“ – Eine ehrliche Begründung für Archivtage!
Danke für diese Ergänzung, Michael!
Pingback: Karten, Pläne, Risse I | siwiarchiv.de
In den Beständen des Landeshauptarchivs Koblenz findet sich noch folgende, einschlägige Akte:
LHA Ko Best. 630,001 (Stadt Neuwied) Nr. 3092: Planung des Westdeutschen Archivtags in Neuwied, 1968.
Dank an Kollegin Grosche-Bulla!
Zum Symposium s. Titelseite „Querschnitt. Zeitung der Universität Siegen“ 4/2012: http://www.uni-siegen.de/presse/publikationen/querschnitt/querschnitt_2012/zeitung_querschnitt_sceen.pdf
“ …. „Die Studierenden finden die Sammlung toll“ sagt Kaludia Witte, viele Fingerabdrücke an den Vitrinenscheiben seien ein eindeutiges Zeichen. Von den ausgestopften Tieren hat Artur Franz keins geschossen oder gefangen. Auf seinen Spaziergängen fand er verendete Tiere oder Bekannte brachten ihm ihre Funde vorbei. …..“ Ziat aus dem Siegerländer Sonntagsanzeiger, 22. Juli 2012, S. 11, Link zur PDF-Datei: http://neu.swa-wwa.de/PDF/22.07.2012/SWA.S11-A-X.22.pdf
Gleichlautend: derwesten.de, 20.7.2012: http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/von-distelfinken-und-laufkaefern-id6901400.html
Pressemittelung der Uni Siegen, 23.7.2012:
http://www.uni-siegen.de/start/news/oeffentlichkeit/468692.html
Weiteres Fundstück zum Westdeutschen Archivtag:
1) Hessisches Staatsarchiv Marburg Slg 7 / c, Nr. 591: „Teilnehmer des Westddeutschen Archivtags auf dem Frauenberg, 1923“, in: Historische Bilddokumente http://www.lagis-hessen.de/en/subjects/idrec/sn/bd/id/65-173 (Stand: 8.3.2011)
Einen Bericht über die Schiffstaufe findet man in der Siegener Zeitung vom 20.8.1966. Der Reeder und Kapitän war Otto Albers. Mit Hapag-Lloyd hatte das Schiff demnach nichts zu tun.
P.K.
Eigentlich hatte ich nicht grundlos „Fortsetzung folgt“ geschrieben. Nun denn der Kollege aus dem Archiv der Hapag-Lloyd war tatsächlich hilfreicher, denn der Rest der Antwort lautete:
“ …..Ich habe …. einen Hinweis auf Ihr Schiff gefunden, den Sie
aber vermutlich schon kennen: http://de.wikipedia.org/wiki/Sietas_Typ_33 . Die Sietas-Werft gibt es immer noch ( http://www.sietas-werft.de/ ).
Falls Sie es nicht schon unternommen haben, empfehle ich Ihnen, sich mit Herrn Kiedel, Archivar beim Deutschen Schifffahrtsmuseum, in Verbindung zu setzen (kiedel@dsm.museum oder info@dsm.museum). Wegen Fotografien verweisen wir gelegentlich an die Schiffsbuchhandlung Wolfgang Fuchs (umfangreiches Schiffsfoto-Archiv der deutschen Handelsflotte seit 1870, http://www.hafenfuchs.de).“
Die SIETAS-Werft antwortete auf meine Anfrage:
“ ….. Die SIETAS Werft hat im Jahre 1966 und 1974 Schiffe mit dem Namen „SIEGERLAND“ an die Reederei Otto Albers in Hamburg- Neuenfelde abgeliefert.
Warum die Reederei den Namen „SIEGERLAND“ für die Schiffe gewählt hat wissen wir nicht.
Die ReedereI Otto Albers gibt es heute nicht mehr.“
Den anderen Hinweisen bin ich noch nicht nachgegangen -aus Gründen.
Guten Tag,
ich bin ein Enkel von Otto Albers und bin eben durch Zufall auf diese Seite gestoßen. Meine Oma kam aus Kreuztal, daher die Verbindung zum Siegerland.
Wünsche allen einen schönen Tag
Vielen Dank für diesen Hinweis! Nun fällt eine Erklärung für die Benennung leichter.
Dank für 200. Artikel an das Hilchenbacher Stadtarchiv!
Pingback: Quellenbeispiele zur Euthanasiegeschichte | siwiarchiv.de
Pingback: Archivischer Ferientipp: “Lambert und Laurin” spielen | siwiarchiv.de
Otto Köhler erinnert mit seinem Artikel „Als der Geier starb. Teil 1“ in linken Tageszeitung „Junge Welt“ (28./29.7.2012, Nr. 174, S. 10-11) an den Tod Friedrich Flicks.
Das Berlin-Brandenburger Wirtschaftsarchiv verweist auf diesen Eintrag: http://www.bb-wa.de/de/archivgut/100-flicksiwiarchiv.html
Auch das 25jährige Jubiläum wurde gefeiert. Der Siegerländer Heimatkalender 1988, S. 176, vermerkt für den 2. Juli 1987 folgendes:
„Anläßlich des 25jährigen Bestehens des Gillerbergheims eine kleine Jubiläumsfeier, zu der auch ein Forstdirektor aus Düsseldorf sowie andere prominente Gäste gekommen waren. Allenbacher Tanzgruppe trug zur Unterhaltung bei.“
Bücher sind ein interessantes Thema. Bücher sind überall zu sehen.
s. a. Andreas Rossmann: Siegerländer Fachwerkhäuser. Eine Kulturlandschaft verliert ihr Gesicht, in Westfalenspiegel 4/2012, S. 56-57
Ein polternder Kommentar auf „Archivalia“ von Klaus Graf: http://archiv.twoday.net/stories/115269432/
Pingback: siwiarchiv.de: Monatsstatistik 07/2012 | siwiarchiv.de
Mal wieder die Geschichte von Keil und Klotz
Das konnte ja nicht ausbleiben, dass der selbst ernannte Internet-Archivordnungshüter seinen Senf zur Schließung des Stadtarchivs durch’s Netz schleudern musste.
Just davor hatte ich seinerzeit gewarnt (Herr Wolf mag sich erinnern): Wer unbedingt einen regionalen Blog zum Archivwesen einrichten will, muss damit rechnen, dass irgendein Schnüffler im hintersten Winkel der Republik (oder gar noch weiter draußen) vor seinem Bildschirm hockt und seine von jeglicher Kenntnis örtlicher und sachlicher Eigenheiten säuberlich befreiten Kommentare absondert . Warum wohl sind dem Großinquisitor des Netzes unsere regelmäßigen Schließungen der letzten Jahre, alle auf unserer homepage angekündigt, entgangen? Wie abgehoben von der Archivwirklichkeit muss einer sein, um die Notwendigkeit einer temporären Schließung in einem Kommunalarchiv mittlerer Größe derartig zu verkennen? Was nämlich tut das Häuflein der von Personalnot und Arbeitsüberlastung geplagten Archivmitarbeiter in den drei Wochen (das macht auch an der holländischen Grenze immer noch keinen Monat)? Es verzeichnet Akten, Akten und nochmals Akten, wohl auch Fotos und Karten, alles zur Steigerung des benutzerfreundlichen Archivangebots.
Schließlich: Über die Gründe, warum der Text unserer Ankündigung dieses Jahr etwas strenger ausgefallen ist, will ich mich gar nicht äußern. Noch immer ist jedem, der während der Schließung mit einem angemessenen Anliegen zu uns kam, die Tür geöffnet worden. Davon spricht allein die jetzt schon feststehende Zahl an Ausnahmeterminen eine beredte Sprache. Aber für Nachfragen resp. saubere Recherchen haben Vielschreiber ja keine Zeit.
Und ein Letztes: Am 26.02.2012 schrieb ein gewisser Klaus Graf auf Archivalia: „Nach dem Treffen der Hochschularchivare in Siegen machte ich Gebrauch von den großzügigen Öffnungszeiten des Stadtarchivs Siegen …“ Ja, was denn nun? Um es mit des Kritikers eigenen Worten zu sagen: „Gesabber“.
PS: Da ich nun wirklich keine Veranlassung sehe, während meiner Dienstzeit auf jede Blähung im Netz zu reagieren (die pflege ich zur benutzerfreundlichen Beantwortung von sachlichen Anfragen zu nutzen), war ich leider genötigt, diese Zeilen während meiner Freizeit zu schreiben. Auch schade…
Pingback: Internationaler Gedenktag der Sinti und Roma in Auschwitz | siwiarchiv.de
Einen Vorgeschmack gibt es hier:
http://www.wdr.de/mediathek/html/regional/rueckschau/2012/08/02/lokalzeit_suedwestfalen.xml
Link zur Homepage der Sendung
Historische Filmsequenzen stammten u. a. aus „Der Eisenwald“ (1952) und „Revier hinter den Bergen“ (WDR 1964).
Pingback: Aus dem Fotoarchiv des Kreisarchivs: Olympiade in Siegen | siwiarchiv.de
Auch derwesten.de hatte die Sendung am 2.8.2012 vorgestellt: http://www.derwesten.de/panorama/wir-sind-nrw-reihe-zeigt-westfalens-wilden-sueden-id6942102.html
Bildarchiv des NRW- Landtags vermeldet heute 500 neue Bilder in der Datenbank: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/home.jsp
Aber da ist immer was los!
Und den Schneckenbrmeser und die Leutenz von der Jungstilling-Geisterparty sind och nett!
Pingback: Vortrag „Trupbacher Häuser aus den Jahren 1860-1939 und ihre Bewohner“ | siwiarchiv.de
Die nächsten Jubiläen der Eisenbahn stehen an: 2012 AW Siegen, 2014 Strassenbahn und 2015 Strecke Siegen-Haiger. Schöne Grüße aus Berlin
In der Print-Ausgabe der Siegener Zeitung v. 11.8.2012 findet sich in der Rubrik „Heimatland“ der Artikel von ph: „Vom Wunsch zur Wirklichkeit. 50 Jahre Jugendwaldheim auf dem Giller. Eine Erfolgsgeschichte“ – beachtenswert das Bildmaterial daus dem Zeitungsarchiv.
Pingback: Archivisches Ferienspiel “Lambert und Laurin” | siwiarchiv.de
Pingback: 50 Jahre Schulwaldheim Gillerberg | siwiarchiv.de
Pingback: Archivisches Sammlungsgut: Amtsdrucksachen II | siwiarchiv.de
In einer noch unverzeichneten Akte der Kreisverwaltung Siegen Wittgenstein, die Vorarbeiten zu folgender Publikation – Landkreistag Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Landräte und Oberkreisdirektoren in Nordrhein-Westfalen 1945–1991. Düsseldorf 1992 – enthält, findet sich folgender Hinweis:
“ …. Nach Erinnerung des Oberkreisdirektors a. D. [Wilfried] Lückert (Vorsitzender des Wittgensteiner Heimatvereins) wurde 1945 von der englischen Militärregierung ein Mann namens „Schläper“, der als Evakuierter in Berleburg lebte, zunächst als Landrat eingesetzt – etwa für 4 Wochen. Er wurde abgelöst durch einen Studenten, der als Dolmetscher bei der Militärregierung tätig war. Sein Name war Wendtland. H. Wendtland wurde nach kurzer Zeit von Herrn Nacken abgelöst. (s. auch beil. Ansprache des Landrates Nacken S. 2 unten)
Nähere Informationen zu den Herren Schläper und Wendtland sind nicht zu bekommen. ….“
Pingback: Landrat Heinrich Otto: “Für Einheit der Werktätigen” | siwiarchiv.de
Pingback: Kreiskrankenhaus Siegen, Juni 1974 | siwiarchiv.de
Bericht in der Westfalenpost, 17.8.2012: http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/in-hilchenbach-macht-der-wald-schule-id6993688.html
Pingback: Festschrift “Bismarckhalle im Wandel der Zeit” | siwiarchiv.de
Pingback: Günter Dick: Suche nach geätzten Fensterscheiben aus der ehem. SIS-Fischbacherberg | siwiarchiv.de
Da schau her: „Er wolle nunmehr mit Herrn Flick verhandeln“ etc.
Seinerzeit „Landschaftspflege“, jetzt „Private Public Parntership“.
Da spart der Spender bei den Steuern, im konkreten Fall. Wenn’s wg. leerer Kassen als Prinzip anerkannt ist, dann zudem generell. Die Idee hat sich ja inzwischen rundum durchgesetzt,: die Sätze sind heuer so niedrig sind wie nie, für den, der hat. Eine echte Erfolgsgeschichte ;-)
Aus den hier zitierten Äußerungen geht nicht hervor, ob Friedrich Flick tatsächlich Geld für das Gillerbergheim gespendet hat. Allerdings bleibt bemerkenswert, dass man mit Flick diesbezüglich sprechen wollte. Ist dies Flicksche „Landschaftspflege“ oder „Flick-Pflege“ durch die „Landschaft“?
“ …. „Das ist ein Bodendenkmal von europäischem Rang.“ … Bis zum 20. September noch dürfen Grabungsleiterin Dr. Jennifer Garner (Deutsches Bergbaumuseum Bochum) und ihr Team weiter buddeln. Dann läuft die Genehmigung aus, sie müssen das Grabungsgelände wieder verfüllen. …. So jedenfalls die Auflage der Behörden, das Waldgebiet ist schließlich Wasserschutzgebiet. …..Die Waldgenossenschaft Niederschelden, die Heimatgruppe Niederschelden und der Heimatverein Niederschelderhütte wollen nicht tatenlos zusehen, sie untersützen die Archäologen im Ansinnen, das Grabungsgelände samt Öfen für die Nachwelt zu sichern. …..Kreisheimatpfleger Dieter Tröps (Bürbach war gestern Morgen auch vor Ort. Unterstützung hat er den grabenden Experten und den Heimatfreunden zugesagt. …. Paul Breuer müsste die Untere Landschaftsbehörde bzw. die Untere Wasserbehörde dazu bewegen, dass die Grabungsstätte nicht im Herbst verfüllt werden muss. …..“
Quelle: Siegener Zeitung (Print), 25. August 2012, S. 3, „ist am 20. September für immer Schluss?“
Pingback: Fritz Busch in der Ausstellung ” Verstummte Stimmen- | siwiarchiv.de
Pingback: Festakt “50 Jahre Gillerbergheim”, 24.8.2012 | siwiarchiv.de
Die Siegener Zeitung und die Westfälische Rundschau berichten am 29.8.2012 über den gemeinsamen Antrag der Kreistagsfraktionen der CDU, FDP und der UWG, der eine abschließende archäologische Erkundung des Geländes beinhaltet.
Link zur gemeinsamen Pressemitteilung der genannten Parteien.
Bechtel-Nachlass nun vollständig im Stadtarchiv Siegen: http://www.wirsiegen.de/2012/08/nachlass-des-malers-georg-bechtel-jetzt-im-stadtarchiv/
In der Siegener Zeitung vom 18. August 2012 (Sonderseite „100 Jahre Bismarckhalle“) findet sich der Bericht „Milchbar gehörte zur Pacht“:
“ …. Zum Pachtgegenstand gehörte in den fünfziger Jahren auch die sogenannte Milchbar im benachbarten Stadtbad. …..“. Folgende Pächter führt der Bericht auf: Eheleute Hans Tepe aus Münster 1955 – 1958, Eheleute Bingener 1958, Eheleute Munkelwitz 1959 – 1960, Eheleute Marianne und Werner Gerlach 1960 – 1964.
Dank an Frau Luke für den Hinweis!
Bis zum Ende der Sommerferien in NRW wurde „Lambert und Laurin“ insgesamt 62 heruntergeladen (- Danke für die schnelle Zahlenlieferung gebührt Herrn Müller von outline development!). Erfahrungsberichte, Kritik, gerne auch Lob sind sehr erwünscht.
Pingback: 62 Downloads von “Lambert und Laurin” | siwiarchiv.de
Pingback: “Vertraute Fremde. Nachbarn in der Geschichte” | siwiarchiv.de
Interessant wäre zu wissen, warum die Synagoge als Motiv gewählt wurde. Das Motiv hat in der Entstehungsphase für leichte „Verwirrung“ bei einigen Passanten gesorgt, die vereinzelt auch die Künstlerin gefragt haben, was das wohl für eine Kirche sei. Ist eine Informationstafel an der Stelle geplant? Hoffentlich ist darin dann nicht auch von „der in 1938 abgebrannten Siegener Synagoge“ die Rede. „1938 von den Nationalsozialisten in Brand gesteckten/ zerstörten Synagoge“ o.ä. wäre treffender.
Ansonsten ist das Projekt künstlerisch wertvoll und bringt etwas Farbe nach Siegen. Bleibt zu hoffen, dass an der Stelle keine illegalen Graffiti gesprüht werden.
Pingback: Ausstellung über Opfer der NS-Euthanasie aus Siegen-Wittgenstein | siwiarchiv.de
Pingback: Ausstellung über Opfer der NS-Euthanasie aus Siegen-Wittgenstein | siwiarchiv.de
Aus dem Newsletter der Körber-Stiftung zum Geschichtswettbewerb:
“ Liebe Freundinnen und Freunde der historisch-politischen Bildung,
am 1. September hat der neue Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten begonnen. Bis 28. Februar 2013 können Kinder und Jugendliche zum Thema »Vertraute Fremde. Nachbarn in der Geschichte« auf Spurensuche gehen. Wir bieten zur neuen Ausschreibung umfangreiche Materialien und Fortbildungen für Schüler und Tutoren an.
Im europäischen Geschichtsnetzwerk EUSTORY kommen die Preisträger vergangener Wettbewerbe zu zwei Akademien im September zusammen, das FutureLab Europe begrüßt neue Teilnehmer und in zahlreichen Veranstaltungen in und außerhalb Hamburgs widmen wir uns der historisch-politischen Bildung und der Zukunft Europas. Mehr dazu in diesem Newsletter.
Start des neuen Geschichtswettbewerbs
Die neue Ausschreibung
In der neuen Ausgabe von spurensuchen dreht sich alles um die Ausschreibung »Vertraute Fremde. Nachbarn in der Geschichte«. Historische und aktuelle Nachbarschaftsgeschichten, Hintergrundartikel und Tipps sowie die »Gelben Seiten« mit den vollständigen Wettbewerbsunterlagen bereiten Jugendliche und Tutoren auf den Wettbewerb vor. Einzelhefte und Klassensätze können unter edv@awu.de bestellt werden. Basisartikel und Gelbe Seiten stehen auch online – – http://www.koerber-stiftung.de/bildung/geschichtswettbewerb/thema-nachbarn/magazin-spurensuchen.html – zur Verfügung.
Weiteres Material zum Wettbewerb
Elf Unterrichtseinstiege zum Thema Nachbarn bereiten einzelne Aspekte der Ausschreibung didaktisch auf und geben Lehrkräften die Möglichkeit, ihre Klassen in einer Unterrichtsstunde mit zahlreichen Quellenmaterialien an das Thema heranzuführen.
Hier geht es zum kostenlosen Download: http://www.koerber-stiftung.de/bildung/geschichtswettbewerb/thema-nachbarn/einstiegsstunden.html .
Zum Start des Geschichtswettbewerbs erscheint eine Sonderausgabe des Online-Magazins »Lernen aus der Geschichte«. Die vorgestellten Projektbeispiele, Onlinequellen und Unterrichtsmaterialien widmen sich ganz dem Thema »Nachbarn in der Geschichte«. Didaktiker und Praktiker geben Methodentipps zur historischen Projektarbeit.
Das Magazin zum online lesen und PDF-Download: http://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und-Lehren/Magazin
Sonderwettbewerb zu deutsch-französischen Beziehungen
Grenzüberschreitende Projekte zur deutsch-französischen Nachbarschaftsgeschichte haben eine doppelte Preischance. Sie können im Geschichtswettbewerb und einem Sonderwettbewerb der Körber-Stiftung mit der Föderation deutsch-französischer Kulturhäuser eingereicht werden. Diese Initiative unter der Schirmherrschaft der Bevollmächtigten für deutsch-französische Kulturbeziehungen, Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer, gehört zum Begleitprogramm der Feierlichkeiten zum 50. Jubiläum des Elyséevertrags.
Nähere Informationen hier: http://www.koerber-stiftung.de/bildung/geschichtswettbewerb/sonderinitiative/deutsch-franzoesischer-wettbewerb.html
Sonderinitiative »Deutsche und Polen: gegeneinander, nebeneinander, zusammen.«
Wettbewerbsarbeiten zur deutsch-polnischen Nachbarschaft haben in einer gemeinsamen Initiative mit der KARTA-Stiftung, unserem EUSTORY-Netzwerkpartner in Polen, ebenfalls eine doppelte Chance. Der polnische Geschichtswettbewerb »Historia Bliska« (Geschichte ganz nah) thematisiert in der nächsten Ausschreibung das Verhältnis Polens zu seinen Nachbarstaaten. Beiträge zu den deutsch-polnischen Beziehungen nach 1945 können unter bestimmten Bedingungen an beiden Wettbewerben teilnehmen oder Sonderpreise erringen. Ausschreibung der Sonderinitiative: http://www.koerber-stiftung.de/index.php?id=3733
Workshops für Schüler und Lehrer
Tutoren, und solchen, die es werden wollen, bieten unsere Lehrerworkshops Methodentraining und Erfahrungsberichte sowie Themen- und Quellenbeispiele zur Ausschreibung »Nachbarn in der Geschichte«.
Im bundesweiten Lehrerworkshop für »Einsteiger« sind noch einige Plätze frei. Er findet vom 16. bis 18. September im KörberForum in Hamburg statt.
Mit unseren Kooperationspartnern in den Bundesländern organisieren wir in den nächsten Wochen Tagesworkshops zum Geschichtswettbewerb, die überwiegend als Lehrerfortbildung anerkannt sind.
Termine und Anmeldemöglichkeiten: http://www.koerber-stiftung.de/bildung/geschichtswettbewerb/fortbildung/lehrerworkshops.html
Schülerinnen und Schüler können sich auf zwei zentralen Workshops im Oktober »wettbewerbsfit« machen. Auch für sie gibt es zusätzliche Angebote von Kooperationspartnern in den Bundesländern.
Anmeldung und Teilnahmebedingungen: http://www.koerber-stiftung.de/bildung/geschichtswettbewerb/fortbildung/schuelerworkshops.html
Schülerworkshops zur DDR-Geschichte
Deutsch-deutsche Nachbarschaftsgeschichten gilt es bei zwei weiteren Schülerworkshops zu entdecken. Das sächsische Kultusministerium veranstaltet vom 20 bis 22. September das erste sächsische Geschichtscamp. Das »Zeitwerk« des Landesjugendrings Brandenburg lädt vom 1. bis 5. Oktober zum Workshop »Leben mit der Mauer« ein. Bei beiden Veranstaltungen sind nur noch wenige Plätze verfügbar.
Informationen und Anmeldemöglichkeit: http://www.koerber-stiftung.de/bildung/geschichtswettbewerb/fortbildung/schuelerworkshops.html
Hinweise zur Archivarbeit
Jeder Ort und jede Familie hat eine eigene Nachbarschaftsgeschichte. Ein Blick in die Quellenübersichten, die unsere Partner aus Staats- und Stadtarchiven zusammengestellt haben, kann aber dennoch inspirieren, in welchen Beständen sich das »Wühlen« vor Ort lohnt.
Eine Übersicht über Archive mit eigenen Ansprechpartnern für Schülerprojekte findet sich auf den Seiten des Arbeitskreises Archivpädagogik und Historische Bildungsarbeit.
Auch die Archive der Stasi-Unterlagenbehörde BStU und ihrer Außenstellen unterstützen den Wettbewerb. Dennoch braucht die Bearbeitung und Bereitstellung dieser Quellen etwas Zeit. Anträge zur Nutzung von Akten sollten daher möglichst frühzeitig gestellt werden. Um eine schnelle und kostenlose Bearbeitung zu erreichen, ist eine Bescheinigung der Schule unbedingt nötig und der »Spurensucherpass« des Wettbewerbs hilfreich.
Geschichtswettbewerb und Web 2.0
Seit August ist der Geschichtswettbewerb mit einem eigenen Profil auf Facebook vertreten. Unter http://www.facebook.com/geschichtswettbewerb informieren wir über die Angebote rund um den Wettbewerb und Neuigkeiten von unseren Kooperationspartnern. In den nächsten Wochen werden wir zudem das eine oder andere Fundstück zum Thema Nachbarn in der Geschichte ausgraben und präsentieren.
Bereits seit dem Frühjahr ist der Bereich Bildung auf Twitter – https://twitter.com/sven_tetzlaff – präsent. Auch dort gibt es regelmäßig Informationen und Denkanstöße zur historisch-politischen Bildung. Und wer selbst aktiv werden möchte, dem empfehlen wir diesen lesenswerten Twitter-Leitfaden speziell für Historiker. …..“
Pingback: Ausstellung über Opfer der NS-Euthanasie aus Siegen-Wittgenstein | siwiarchiv.de
Radio Siegen hat heute einen Beitrag (Interview mit Stefan Kummer) gesendet.
Pingback: Ausstellung “325 Jahre Stadtrechte Hilchenbach” verlängert bis 30. September 2012 | siwiarchiv.de
Der Siegerlandkurier berichtet heute über das Pressegespräch: http://www.siegerlandkurier.de/index.php?kat=145&id=215253
Pingback: Bundeswettbewerb “Vertraute Fremde” – Themenideen: | siwiarchiv.de
Wir liegt leider der Artikel (Siegener Zeitung (Print), 25. August 2012, S. 3, “ist am 20. September für immer Schluss?”) nicht im Original vor, aber nach meiner Einschätzung sollten die Behörden hier einen Ausnahmeregelung machen. Es ist grundsätzlich richtig, dass wenn das Grabungsgelände in einem Wasserschutzgebiet liegt, die Stelle eigentlich wieder verfüllt werden muss. Ein dauerhaftes Offenhalten der Stelle ist sicher eine Prüfung wert, ebenso die Abwägung der Interessen des Wasserschutzes und der Heimatpflege bzw. des Fremdenverkehrs. Ich denke, dass der Gewinn durch die Ausgrabung für die Wissenschaft wie auch für den Tourismus und die Heimatpflege für die Region nicht zu verachten ist. Es wird sicher schwierig sein, die Öfen zu konservieren und einen freien Zugang zu ihnen trotz des Wasserschutzgebietes zu gewährleisten, aber man könnte auch über eine Translozierung der Öfen nachdenken. Und wenn es nur das „Anheben“ im Block ist, so dass die Öfen zukünftig oberirdisch stehen würden. Für Niederschelden wäre eine Art Freilichtmuseum bzw. archäologische Station sicher eine Bereicherung zumal sich die Heimatgruppe Niederschelden und der Heimatverein Niederschelderhütte sicher bei einem solchen Unterfangen beteiligen würden.
Sinan Sat in der Westfälischen Rundschau v. 7.9.2012 zum Projekt: http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/gegen-das-vergessen-und-zu-ehren-der-opfer-id7066574.html
Heute Artikel in der Print-Ausgabe der Siegener Zeitung (Autor: mir)
In der heutigen Print-Ausgabe der Siegener Zeitung findet sich ein Leserbrief „Regisseur, nicht Akteur“ zur Rolle Hindenburgs als Militärbefehlshaber und Politiker in der Weimarer Zeit. Ein sich auf Wolfgang Pyta berufendendes Zitat: “Er sei nicht Akteur, sondern Regisseur des Untergangs [der Weimarer Republik] gewesen!”
Anm:
1) Pyta, Wolfram: Hindenburg. Herrschaft zwischen Hohenzollern und Hitler, Berlin 2007, 1117 S.
2) Wolfgang Kruse: Rezension zu: Pyta, Wolfram: Hindenburg. Herrschaft zwischen Hohenzollern und Hitler. Berlin 2007, in: H-Soz-u-Kult, 28.01.2008, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2008-1-076 .
3) Homepage Pytas an der Universität Stuttgart: http://www.uni-stuttgart.de/hing/mitarbeiter/pyta/
Archäologische Grabungen im Gerhardseifen in Niederschelden: gemeinsamer Antrag der CDU-Fraktion, FDP-Fraktion und UWG-Fraktion heute unter TOP 5.1.2. im Siegener Kreistag: https://sdnet.kdz-ws.net/gkz110/tops.do?tid=MlyKcyCXsFSq7Pl6GJ
Pingback: Vortrag: “‘Wir beantragen ? unverzüglich umzubenennen.’ ….. | siwiarchiv.de
Ergänzungen zu Landrat Dörnberg:
1) Unser Heimtland 1967, S. 10:
“Nachdem sich am 18. August 1866 der Norddeutsche Bund konstituiert hatte, wurde am 12. Februar 1867 die erste allgemeine Reichstagswahl ausgeschrieben, für die allerdings das Dreiklassenwahlrecht maßgebend war. Ihr Ergebnis konnte damit damit nur ein die politische Meinung stark verzerrender Spiegel sein. Bei den auch im Wahlkreis Siegen-Wittgenstein-Biedenkopf durchgeführten Wahlen war hier zum Abgeordneten für den Reichstag des Norddeutschen Bundes der Landrat Freiherrn von Dörnberg aus Siegen gewählt worden. Auf ihn wurden 11547 Stimmen abgegeben; sein Mitbewerber, der Kreisgerichtsdirektor v. Beughem aus Neuwied, erhielt 5182 Stimmen. Dies geht aus einer am 19.Februar 1867 im Siegener Kreisblatt (früher Intelligenz-Blatt) erschienenen amtlichen Bekanntmachung hervor.
Dieser Wahl war ein wochenlanger Wahlkampf voraufgegangen, der in zahlreichen Veröffentlichungen des Intelligenz-Blattes seinen Niederschlag fand. Jetzt, wo die Wahl vorbei war, hielt es der Königl. Landrat v. Dörnberg für an der Zeit, in bezug auf einige ihm gemachte Vorwürfe eine Art von Rechenschaftsbericht abzulegen …..”
Klingt als wäre die Beschäftigung mit dem ersten Wahlkampf in Siegen-Wittgenstein nicht uninteressant.
2) In der Siegener Zeitung vom 21.5.1965 findet sich eine Würdigung der “Statistischen Nachrichten” (1865) durch den Siegener Stadtarchivaren Dr. Wilhelm Güthling: “…. Gleichzeitig aber erschien, ebenfalls als Druck der Vorländerschen Druckerei eine Veröffentlichung des Kreises Siegen. Auf 170 Seiten waren hier “Statistische Nachrichten über den Kreis Siegen aus den Jahren 1860-1865 ….zusammengestellt von dem Königlichen Landrat Freiherr von Dörnberg”. Diese Schrift ist offensichtlich ohne Zusammenhang mit der Fünfzigjahrfeier [der Zugehörigkeit Westfalens zu Preußen, Anm. Bearb.] erschienen. Sie ist vielmehr eine echte Landeskunde, für die wir heute, nach hundert Jahren, der damaligen Kreisverwaltung besonders dankbar sein müssen. …… Man kann nur bedauern, daß keiner seiner Nachfolger ….. ähnliche “Statistische Nachrichten zusammengestellt hat..”
Heute in der Printausgabe der Siegener Zeitung (S. 3) wird über die Kreistagssitzung (s. o.) berichtet:
„…. Eine finanzielle Beteiligung [des Kreises] an dem Projektsei aufgrund fehlender gesetzlicher Verpflichtung nur im Rahmen einer freiwilligen Leistung möglich, hieß es dazu in der Sachdarstellung des Kreises. Im Vorfeld der Grabungen habe es Kontakt zur Unteren Landschaftsbehörde gegeben, die für die Grabung eine Ausnahmegenehmigung erteilt habe, die über das Jahr 2009 [!] hinaus stillschweigend weiter verlängert worden sei „und die auch zukünftig stillschweigend weiter verlängert werden wird“ [!]. Eine mögliche Verfüllung und eventuelle Zerstörung von Bodenfunden hatten die Fraktionen in ihrem Antrag ebenfalls befürchtet. Dagegen wies der Kreis darauf hin, dass eine behördliche Verpflichtung zur Verfüllung des Geländesnicht bestehe. Der Antrag wurde in der Kreistagssitzung einmütig [!] und ohne Aussprache [!!] angenommen.“
na das hört sich doch großartig an !
s. nun auch im Siegerländer Wochen-Anzeiger: http://neu.swa-wwa.de/PDF/19.09.2012/SWA.S11-A-X.19.pdf
Fehlt nur noch der WDR!
Schön, wenn wir schnell und erfolgreich helfen konnten. Die Idee wurde übrigens von der CDU (maßgeblich Werner Schulte und Bernd Brandemann) initiiert und an UWG und FDP herangetragen. Als Historiker konnte ich mich da eh nicht verwehren und die FDP-Fraktion sah das genauso. Ein spannendes Grabungsprojekt. Es wäre schön, wenn man auch unseren Vorschlag aufgreifen würde, das Grabungsfeld didaktisch zu erschließen, um zu verstehen, was dort ausgegraben wird.
Gruß
Guido Müller
@Guido Müller Danke für die ergänzeden Informationen!
Pingback: Netzwerk “Eisenstrasse Suedwestfalen” | siwiarchiv.de
Pingback: Netzwerk “Eisenstrasse Suedwestfalen” | siwiarchiv.de
Ich habe von 1938 -56 in Siegen gelebt.Eisernerstr.26.Ich habe mich im Internet umgeschaut,aber ich erkenne kaum noch etwas.Werde demnächst noch einmal die Stadt besuchen. Sami
Pingback: “Klassenzimmer und Gottesdienste.” Fotoimpressionen. | siwiarchiv.de
Ich würde sagen, das ist die Siegtalbrücke mit der A45 und Eiserfeld im Hintergrund. Aus welchem Jahr stammt diese Aufnahme?
Pingback: “Nazi steel. Friedrich Flick and ….” | siwiarchiv.de
1) Richtig!
2) Leider sind weder Aufnahmedatum noch Photograph zu ermitteln
Die Siegener Zeitung berichtete heute [erst ? – s.u.] im Print, dass
Vertreter der CDU-Stadtratsfraktion mit dem Bundestagsabgeordnete
und CDU-Kreisvorsitzenden Volkmar Klein die Ausgrabungsstätte besuchten. haben. Zitat: „….. Wie dies [Zugänglichmachung für Besuchende] zukünftig geschehen könnte, darüber hat sich der Archivtekt Christian Welter schon Gedanken gemacht. Er präsentierte erste Entwürfe zur Einhausung des Areals.“
Über den (?) Besuch bloggte Volkmar bereits am 17.9.2012 (mit Bild): http://www.volkmarklein.de/index.php?option=com_content&view=article&id=1356:1792012-eisen-und-stahl-praegen-siegerlaender-identitaet-&catid=56:blog&Itemid=112
In der gut besuchten Informationsveranstaltung hat uns Kollege Kemper als „großes“ Blog bezeichnet. Dies motivert!
Die Präsentation des Vortrags von Dr. Joachim Kemper, Stadtarchiv Speyer, ist nun online. Unser Blog befindet sich auf Folie 11: http://de.slideshare.net/StadtASpeyer/deutscher-archivtag-2012-web-20
„Redaktion des Unger Blattes“??? Wohl ein Tippfehler. Schnabel war Redakteur des ab 1835 in Gummersbach erschienenen „Agger-Blattes“.
Bei der Eröffnung dieser neuen „Baustelle“ wäre es hilfreich, Genaueres über den Hintergrund zu erfahren. Will die Auszubildende und/oder das Kreisarchiv an dem Thema dranbleiben / soll etwas Umfassenderes erarbeitet werden / sind unsichtbar für die Siwi-Leser schon weitere Stellen (Archive) in die Recherchen involviert worden? Wenn die Angelegenheit so vage gehalten ist, verspürt man nicht unbedingt das Bedürfnis, mit einzusteigen. Und man will sich ja auch nicht aufdrängen. :-)
P.K.
Das Kreisarchiv stellt bei Recherchen zu Persönlichkeiten und Themen der Kreisgeschichte die ermittelten Informationen für eine evt. spätere Verwendung zusammen. Verfügt das Kreisarchiv über eine Pratikantin/einen Praktikanten so werden die Recherchen auf das vor Ort schnell Ermittelbare ausgedehnt.
Das Kreisarchiv hat in diesem Fall ferner das Landesarchiv NRW nach einer Personalakte, sowie das Universitätsarchiv Marburg nach einer Promotionsakte befragen. Sobald Ergebnisse vorliegen, werden sie hier als Kommentar eingestellt.
Nichts spricht dagegen, diesen Eintrag als Start für eine tiefere Beschäftigung mit Schnabel zu verwenden. Bei der Bedeutung für die Geschichte der Universität Siegen, wäre der „Bildungshügel“ vielmehr der geeignetere Platz als das ehem. Mädchengymnasium. ;-)
Nach der Personalakte hatte ich in Münster vor ein paar Jahren schon gefragt. Anscheinend gibt es dort keine. Informationen zu Schnabel finden sich dort aber in anderen Akten.
Das Universitätsarchiv Bonn hat eine Akte über den Studenten Schnabel. Der Umfang ist so gering, dass man sicher eine Kopie erbetteln kann.
Ein paar Briefe Schnabels (v.a. an den Chemiker Emil Erlenmeyer) liegen mir als Kopie bzw. Digitalisat vor, die müßte man also nicht noch einmal bestellen.
Die Korrespondenz mit Justus von Liebig ist verschollen. Anfrage beim Giessener Liebig-Archiv: negativ. (Einen Brief Liebigs an Schnabel gibt Kruse in seiner Gymnasiums-Festschrift 1936 nur nach einer Abschrift Suffrians wieder; diese soll in den Akten der Bürgerschule enthalten sein.)
Einen Nachlass Carl Schnabels jun. (zuletzt Prof. an der Bergakademie Clausthal), in dem man auch Unterlagen seines Vaters erwarten könnte, gibt es im Uni-Archiv Clausthal nicht.
Zu den von Schnabel jahrelang gehaltenen öffentlichen Vorträgen im Siegerland (Siegen, Kreuztal) sollte noch regional recherchiert werden.
Und so weiter.
P.K.
Danke für die ausführliche Antwort! Die Korrespondenz mit Erlenmeyer haben Sie dem Archiv des Deutschen Museums in München entnommen? Kalliope weist auf ein Brief dort hin, sowie auf einen Brief Schnabels an Johann Friedrich Benzenberg im Düsseldorfer Heinrich-Heine-Institut.
Deutsches Museum München: Schnabel an Erlenmeyer, Siegen 8.9.1869.
Heine-Institut Düsseldorf: an Benzenberg, Gummersbach 13.11.1836 (Bericht des jungen Lehrers über ein Schülerprojekt: Beobachtung von Sternschnuppen).
Ferner (nicht in KALLIOPE) Hugo-Dingler-Archiv in der Hofbibliothek Aschaffenburg: Schnabel an Erlenmeyer, Siegen 5.11.1846, 15.1.1847, 28.6.1847, 11.2.1849. Erlenmeyer, damals noch Student bei Liebig in Giessen, war mit den Siegener Hanekroths näher verwandt, was vielleicht seine frühe Bekanntschaft mit Schnabel erklärt. (Im Dingler-Archiv – H.D. war ein Enkel Erlenmeyers – sind übrigens auch 5 Briefe von Louis Ernst an den Chemiker aus den 1890er Jahren vorhanden.)
Nachtrag zum Lebenslauf:
Vorname der Mutter laut Personenstandsunterlagen (Stadtarchiv Siegen): Wilhelmine; wäre zu klären.
Schnabel war zweimal verheiratet: 1. Hermine (wie oben angegeben), aus dieser Ehe mind. 5 Kinder; 2. (1855) Charlotte Sophie geb. Manger, 1822-1867. Eugen, Sohn aus 2. Ehe, war beim Tod des Vaters (den er standesamtlich anzeigte) „Handlungslehrling“ in Siegen.
Der Sohn Carl hat einen autobiographischen Roman „Unter grünen Tannen“ hinterlassen, der aber in Bezug auf den Vater unergiebig ist. (Man erfährt immerhin, dass klein Carlchen daheim einmal Prügel bezog, weil er Vaters Mineraliensammlung geplündert hatte.)
Geheimes Staatsarchiv Berlin: I HA, Rep. 76, Va, Sekt. 3, Tit. X, Nr. 4, Bde. 1 u.2, ent. Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Seminars Bonn, darin auch Erwähnungen Schnabels.
LAV NW W: Regierung Arnsberg Nr. 463 = Konduitenlisten: Hilft nicht weiter (Schnabel aufgeführt, aber keine „besonderen Bemerkungen“).
LAV NW W, Oberpräsidium Nr. 214 a, Höhere Bürgerschule Siegen 1842-65, enth. Berichte Schnabels an OP Vincke über die von ihm im Sommer 1843 in Kreuztal gehaltenen naturwissenschaftlichen Vorträge für Gewerbetreibende.
Ebenda fol. 176-178: Charakterisierung Schnabels in einem Bericht der Kgl. Regierung an das Oberpräsidium 1849 „betr. die Haltung der höheren Bürgerschule zu Siegen“.
Die für eine Biographie evtl. relevanten Passagen aus diesen Archivalien liegen mir in Abschrift vor.
Alles bereits Vorhandene reicht m.E. für ein wirklich abgerundetes Lebensbild längst nicht aus. Es bleibt noch viel zu tun!
P.K.
Replik zur Rezension Hesses im Blog der Geschichtswerkstatt: http://www.geschichtswerkstatt-siegen.de/wordpress/2012/06/25/hellwigs-stadtrundgang/comment-page-1/#comment-51
Kontaktmöglichkeit auch über
0 2 7 3 4 / 4 3 – 1 4 8
Stadtarchivar Detlef Köppen
Heute berichtete die WDR, Lokalzeit Südwestfalen von der Suche Günter Dicks:
„Suche nach verschollenen Kunstwerken
Günter Dick studierte vor 50 Jahren Ingenieur-wissenschaften in Siegen. Jeden Tag ging er in der Hochschule an den Kunstwerken von Otto Sticht vorbei. Seit über 30 Jahren sind diese Kunstwerke verschollen. Günter Dick will sie finden.“
Dieser Beitrag ist auf jeden Fall in den nächsten sieben Tag in der Mediathek der Lokalzeit zu sehen: http://www.wdr.de/mediathek/html/regional/ergebnisse/sendung.xml?rankingtype=sendung&rankingvalue=Lokalzeit%20S%FCdwestfalen&rankingcount=5&rankingpage=0&rankingvisible=newest
Pingback: 4 Frachtschiffe trugen den Namen “Siegerland” | siwiarchiv.de
Das Deutsche Reich sollte groß geschrieben werden, da Eigenname.
Danke für die freundliche Belehrung; die Großschreibung von Eigennamen ist auch dem Stadtarchiv bekannt. In der Vorlage für den Kulturausschuss ist der Text in Großbuchstaben gesetzt und so auch im Ratsinformationssystem der Stadt Siegen zu finden. Der Beitrag wurde nicht vom Stadtarchiv in den Blog gestellt.
Pingback: Thomas Wolf: siwiarchiv.de - Erster Versuch eines regionalen Archiv-Weblogs in Deutschland - historyblogosphere.org - Bloggen in den Geschichtswissenschaften. Ein Open Peer Review-Buchprojekt
Pingback: Thomas Wolf: siwiarchiv.de - Erster Versuch eines regionalen Archiv-Weblogs in Deutschland - historyblogosphere.org - Bloggen in den Geschichtswissenschaften. Ein Open Peer Review-Buchprojekt
Pingback: Thomas Wolf: siwiarchiv.de - Erster Versuch eines regionalen Archiv-Weblogs in Deutschland - historyblogosphere.org - Bloggen in den Geschichtswissenschaften. Ein Open Peer Review-Buchprojekt
Pingback: Thomas Wolf: siwiarchiv.de - Erster Versuch eines regionalen Archiv-Weblogs in Deutschland - historyblogosphere.org - Bloggen in den Geschichtswissenschaften. Ein Open Peer Review-Buchprojekt
Pingback: Thomas Wolf: siwiarchiv.de - Erster Versuch eines regionalen Archiv-Weblogs in Deutschland - historyblogosphere.org - Bloggen in den Geschichtswissenschaften. Ein Open Peer Review-Buchprojekt
Pingback: Thomas Wolf: siwiarchiv.de - Erster Versuch eines regionalen Archiv-Weblogs in Deutschland - historyblogosphere.org - Bloggen in den Geschichtswissenschaften. Ein Open Peer Review-Buchprojekt
Danke für die Berichtigung des Tippfehlers! Sie wurde im Text entsprechend kenntlich gemacht.
In der Print-Ausgabe der Siegener Zeitung v. 10.10.2012 (Kultur, S. 20) findet sich ein Bericht zur Suche nach dem Sticht-Kunstwerk
Im Universitätsarchiv Marburg ist unter der Signatur 307d Nr. 71 II die Promotionsakte Schnabels erhalten. Sie enthält das Promotionsgesuch, die Stellungnahmen der Professoren dazu, einen handgeschriebenen Lebenslauf in lateinischer Sprache, das Abiturzeugnis, das Abgangszeugnis der Universität Bonn, ein handgeschriebenes Exemplar der Dissertation in lateinischer Sprache sowie das Doktordiplom.
Pingback: Magisterarbeit zur “Euthanasie”-Geschichte im Kreisgebiet liegt vor | siwiarchiv.de
Pingback: Siegerländer Hauberg als immaterielles Weltkuturerbe | siwiarchiv.de
Die Geschichtswerkstatt Siegen stellt in ihrem Blog berechtigte und lesenswerte Fragen an das Projekt.
Im Blog der Geschichtswerkstatt (s. o.) scheint sich eine dem Projekt reservierte gegenüber stehende Diskussion zu entwickeln.
Pingback: Ausstellung: “Opfer der NS-”Euthanasie”-Verbrechen aus Siegen-Wittgenstein …. | siwiarchiv.de
Hartmut Prange weist darauf hin, dass in der Liste der nach Theresienstadt deportierten Personen Jakob Wolff aus Arfeld fehlt und stellt daher dankenswerterweise seine Forschungsergebnisse zur Familie Wolff zur Verfügung:
„Henriette und Jakob Wolff aus Arfeld
Henriette Wolff, geb. Löwenstein, geboren am 5. Oktober 1872 in Arfeld. Sie war Tochter des David Löwenstein (1840-1910) und seiner Frau Karoline Löwenstein, geb. Löwenstein aus Arfeld. David Löwenstein arbeitete in Arfeld als Metzger und wohl auch als Viehhändler. Die Familie Löwenstein muss damals schon seit einigen Generationen in Arfeld gelebt haben. [6]
Jakob Wolff, geboren am 21. März 1875 in Altena. Als Beruf ist in verschiedenen Urkunden des Standesamts Arfeld Handelsmann, Metzger und Viehhändler angegeben.
Ob Jakob und Henriette in Arfeld oder in Altena geheiratet haben, ist nicht bekannt. Eine Heiratsurkunde ist nicht erhalten geblieben, sodass auch das Jahr der Eheschließung nicht belegt ist. [6]
Henriette und Jakob Wolf sind 1936 nach den Angriffen auf ihr Haus zur Familie des Sohnes Karl Wolff und seiner Frau Rose nach Treis an der Lumda gezogen.
Die Schmierereien und Angriffe auch auf weitere Häuser in Arfeld und den benachbarten Dörfern sollten als „Letzte Warnung“ verstanden werden. Das deutet eher auf Angehörige des RAD-Lagers Elsoff als Anstifter hin, als auf die „Dorfjugend“, die allerdings mitgemacht hat. (s. Opfermann, [4])
Henriette und Jakob Wolff sind am 14. September 1942 aus Treis verschleppt worden. Am 27. September 1942 wurden sie mit einem Transport von Darmstadt nach Theresienstadt deportiert.
Der Sohn Karl Wolff starb 1940 an den Folgen der Misshandlung in Buchenwald. Rose Wolff hat nach dem Tode ihres Mannes Karl zwischen 1940 und 1942 noch vergeblich versucht, sich und ihre Familie über Verwandte in Bad Nauheim und Frankfurt in Sicherheit zu bringen.
Karl Wolffs Frau Rose oder Rosi Wolff, geb. Plaut, * 31.10.1900 in Ottrau bei Ziegenhain, ihre Kinder Liesel, * 23.10.1929 in Gießen (Stieftochter), Bernd Jakob, * 14.05.1935 in Gießen, und die Schwester von Rose Wolff, die Witwe Jenny Wolff (?, nach [2]), geb. Plaut (Jg. 1900 ?; Jenny Kleeberg, geb. Plaut, * 20.05.1898 Ottrau (lt Gedenkbuch) ), sind am 14. September 1942 aus Treis verschleppt worden. Am 27. September 1942 wurden sie ebenfalls mit einem Transport von Darmstadt nach Theresienstadt deportiert.
Henriette Wolff starb in Theresienstadt am 30. Juni 1943.
Jakob Wolff wurde am 16. Mai 1944 von Theresienstadt in das Vernichtungslager Auschwitz gebacht. Für tot erklärt.
Rose Wolff und ihre Kinder Liesel und Bernd Jakob wurden vermutlich von Theresienstadt nach Treblinka weiter transportiert. „Verschollen“. Das gilt ebenfalls für Jenny Wolff.
Für Henriette und Jakob Wolff liegen Stolpersteine in Arfeld, Hauptstr. 30. Vier Stolper-steine liegen für die übrigen Familienmitglieder in Staufenberg-Treis, Hauptstraße 66.
Quellen:
[1] Liste, 21 Seiten, mit Namen und kurzer Lebensbeschreibung nach Theresienstadt deportierter Menschen aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein mit Angabe der Quellen:
http://www.siwiarchiv.de/wp-content/uploads/2012/07/Theresienstadt.pdf (Autor: Thomas Wolf)
[2] Stadt Staufenberg, Treis an der Lumba
Stolpersteine, u. a. für Mitglieder der Familie Wolff aus Arfeld
Zusammengetragen von der Stadtarchivarin Barbara Wagner, Stadtarchiv Staufenberg:
http://www.stadtarchiv.staufenberg.de/stolpersteine/opfer/opfer.pdf
[3] Volker Hess: Geschichte der Juden in den heutigen Ortsteilen Staufenbergs Daubringen, Mainzlar, Staufenberg und Treis, Staufenberg, 1990
http://www.tagebergen.de/home/v/publish/Hess1990a.pdf
[4] Ulrich F. Opfermann, „Mit Scheibenklirren und Johlen“, Siegen 2009, S. 86
[5] Opfermann weist hin auf: Heinz Strickhausen, Berleburg – Eine Kleinstadt am Rande des Krieges, Bad Berleburg 1999, S. 95 f.
[6] Private Mitteilung von Frau Gerda Achinger am 17.10.2012 „
Pingback: Schulbau und Denkmalschutz
Ulrich F. Opfermann rezensiert die Publikation im Blog der Siegener Geschichtswerkstatt.
Die Siegener Geschichtswerkstatt bietet am 21. März 2013 einen Vortrag zur Geschichte der Haubergswirtschaft an.
In den 16:30 Lokalnachrichten auf Radio Siegen wird über die Eröffnung des Burbacher Gemeindearchivs vermeldet:
„Die Gemeinde Burbach hat seit heute ein neues Archiv. Es befindet sich im Kellergeschoss der Grundschule Burbach. Für rund 150.000 Euro wurde es barrierefrei umgebaut. Bisher waren die Akten der Gemeinde im Keller oder auf dem Dachboden des Rathauses gelagert. Bei einem Tag der offenen Tür am Samstag gibt es für Interessierte einen Rundgang durch das neue Archiv.“
Patricia Ottilie, Burbacher Gemeindearchivarin, ist mit einem kurzem Statement zu hören:
http://www.radio-siegen.de/aktuell/lokale-news/index.html
Um 17:30 ist Bürgermeister Christoph Ewers mit einem Statement zur Eröffnung zur hören.
In der heutigen Ausgabe der Siegener Zeitung befindet sich auf Seite 10 ein Artikel zum gestrigen Festakt.
Landrat von Dörnberg gilt seit seiner Dienstzeit u.a. in Ostpreußen auch als maßgeblicher Unterstützer bei der Vermittlung Siegerländer Wiesenbaumeister für viele Einsatzbebiete in den Ostgebieten, besonders für die Provinzen Ost- und Westpreußen. Zuvor war er als Direktor des Kultur- und Gewerbevereins des Kreises Siegen besonders guter Kenner (und Förderer) des Siegener Wiesenbaues in seiner frühen Entwicklung.
Zur Vereinstätigkeit ist anzumerken: Der Verein ist maßgebender Förderer und zunächst einziger Träger:
1. Der ersten Wiesenbaukurse im Wiesenbau seit 1834 und 2. Der Gründungsverein der landwirtschaftlichen Sonntagsschule als Siegener Wiesenbauschule seit 1844 und dessen Wiedergründung (nach Auslaufen zwischen 1848 ff) im Jahr 1853 als Wiedergründung (offiziel: Neugründung) als die berühmte „Siegener Wiesenbauschule“, die später bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts in der Trägerschaft des Kreises Siegen unterrichtete, dann vom Land NRW übernommen wurde.
Diesen o. g. Hinweis zu dem ehemaligen kgl. Landrat des Kreises Siegen habe ich bei meiner Ausarbeitung über den Siegener als Notiz über den Wiesenbau erhalten; nähere Einzelheiten sind leider nicht (mehr) bekannt. Da die Siegener Wiesenbaumeister (und die Siegener Wiesenbauschule mit mehreren von Siegen maßgeblich geförderten Fachschulgründungen) als Pioniere im „Deutschen Reich“ und Mitteleuropa gelten, die „frühesten Fachschulen speziell im Wiesenbau“ einrichteten oder mitbegründeten, kommt dem „Siegener Wiesenbau“ und „seinen Förderern“ eine besondere Bedeutung zu.
Meine (umfangreichen) Ausarbeitung beschäftigen sich im Wesentlichen mit Wiesenbau-Themen, die bisher nicht -oder nur wenig- behandelt wurden. Dazu zählen die frühesten örtlichen Nachrichten in der nassau-oranischen Zeit (seit dem 15. Jahrhundert), möglichst frühe Beispiele örtlicher Wiesenbautätigkeiten, die Biografien früher Förderer Im örtlichen Wiesenbau, die ersten Wiesenbaumeister und ihre Betätigung im In- und Ausland. Die Situation des Wiesenbaues in Deutschland und im Siegerland und die Gründungen von Fachschulen im Wiesenbau.
Für Hinweise zum Thema zur Ergänzung meiner Ausarbeitung bin ich dankbar.
Hermann J. Hellmann
Vielen Dank für die Ergänzung!
Ihnen wird sicher der Bestand „Kreis Siegen, Kreisausschuss“, des Landesarchivs NRW, Abt. Westfalen, bekannt sein, der einschlägige Unterlagen zur Wiesenbauschule enthält. Der Bestand ist auch mikroverfilmt nach Rücksprache im Stadtarchiv Siegen benutzbar. Daneben verweise ich auf die Bestände „Regierung Arnsberg, Schulen“ und „Oberpräsidium Münster, Kirchen,Schulen, Juden“ im Landesarchiv in Münster.
Ebenfalls gehe ich davon aus, dass Sie sich bereits an das Archiv der Universität Siegen gewendet haben. Denn auch ist Einschlägiges zu Ihren Fragestellungen vorhanden.
Das Stadtarchiv Siegen vermeldete unlängst die Übernahme eines Wiesenbaumeister-Nachlasses: „Über einen wertvollen Zuwachs seiner Sammlungsbestände konnte sich jetzt das Stadtarchiv Siegen freuen. In den neuen Räumlichkeiten im KrönchenCenter übergab die Weidenauer Diplom-Sportlehrerin Susanne Müller Dokumente und Gegenstände aus dem Nachlass ihres Großvaters, des Kreiswiesenbaumeisters des Dillkreises Heinrich Müller, als Depositum zur dauernden Aufbewahrung“
Ich verweise auch auf die regionalgeschichtliche Bibliothek des Siegener Stadtarchivs.
Auf derwesten.de findet sich ein Bericht über die Veranstaltung.
Nach der Vorgabe des Stichworts durch Herrn Wolf kann ich wieder einmal bemängeln, dass Münster die Online-Findbücher für die Bestände Landratsamt und Kreisausschuss Siegen immer noch nicht wieder zugänglich gemacht hat. Wie lange liegt es jetzt zurück, dass diese zwecks Überarbeitung aus dem Netz genommen wurden? Vor vielen Monaten hatte mir das Landesarchiv die Auskunft erteilt, man müsse sich nur noch ein paar Tage gedulden …
Ihre Sammlung, lieber Herr Hellmann, dürfte inzwischen so umfangreich geworden sein, dass allgemein gehaltene Bitten um Hinweise kaum noch wirklich Neues für Sie ergeben werden. Sie haben da schon einen klaren Wissensvorsprung. Man müsste jeweils am konkreten Detail sehen, wo sich vielleicht noch gezielt weitergraben läßt.
P.K.
Pingback: Offizielle Eröffnung des Gemeindearchivs Burbach | siwiarchiv.de
Pingback: Erfolgreiche Filmvorführung “Revier hinter den Bergen” | siwiarchiv.de
Pingback: Matinée “G’rade der Vergang, das war das Geheimnis“ | siwiarchiv.de
Noch Plätze frei für die Impuls-Tagung „Kulturlandschaft betrachten, bewahren und beleben: Wege zur Erschließung historischer Kulturlandschaft in der Kulturregion Südwestfalen.“
Pingback: siwiarchiv.de: Monatsstatistik 10/2012 | siwiarchiv.de
derwesten.de (Westfälische Rundschau) berichtete am 2.11.2012 vom Tag der offenen Tür in Burbach: http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/burbach-sammelt-geschichte-id7254121.html
Heute überschreibt die Siegener Zeitung in der Print-Ausgabe ihren Bericht über den Tag der offenen Tür mit „Archiv begeisterte“ – ein Titel, der Archivierende erfreut!
s. a. Steffen Schwab: „40 Jahre Obernautalsperre. Drei Dörfer ruhen 45 Meter tief im Wasser“ in: Westfälische Rundschau, 6.11.2012
Pingback: Ausstellungseröffnung zur Geschichte der NS-Krankenmorde im Kreisgebiet | siwiarchiv.de
Pingback: Bilder landschaft | Kerriganmeats
Finde ich gut…;-))
Ein Archivar muss heute auch in Sachen Medien bewandert sein und die neuen Medien nutzen und sich vernetzen. Das passiert hier schon seit einiger Zeit…
Anntheres
Die Petition, die gerade auch für kleinere Archive nicht unwichtig ist, wie die Stellungnahme des VdA darlegt, hat bis jetzt 2.290 Mitzeichner. Als erster Erfolg des breiten öffentlichen Drucks – auch der Bibliotheksverband hat reagiert – darf der Verkaufsstopp der Bücher durch das betroffene Antiquariat gelten. Weitere Unterzeichnungen sind aber bis zur vollständigen Rückabwicklung gerne gesehen.
Pingback: Umgestaltung des Bahnhofs in Siegen | siwiarchiv.de
In Ruckersfeld ist demnächst wieder eine Jung-Stilling-Geisterparty:
`
http://286369.forumromanum.com/member/forum/forum.php?action=std_show&entryid=1102058281&USER=user_286369&threadid=2
`
Alle sind willkommen!
Die Petition zur Rettung der Stralsunder Archivbibliothek hat zurzeit 3064 Mitzeichnende.
In der heutigen Printausgabe der Siegener Zeitung finden sich drei Leserbriefe zum Neubau des Bahnhofes in Siegen.
Alle Proteste und Vorwürfe verpuffen, wenn nicht erforderliche Maßnahmen über die kommunale Zuständigkeit hinaus getroffen werden, um Wiederholungen zu verhindern. Wenn ein Behördenleiter seinen Archivar suspendiert, ist das eine Maßnahme innerhalb der Behörde, geht er damit aber an die Öffentlichkeit, ist das ein Bauernopfer zur Ablenkung der eigenen Verantwortung.
Hallo Herr Wolf,
herzlichen Glückwunsch zur Wahl und viel Erfolg bei der Amtsausübung!
Umfassende Informationen zur „Causa Stralsund“ findet man hier:
1) http://archiv.twoday.net/search?q=causa+stralsund
2) http://www.facebook.com/rettetarchivbibliothekstralsund
Erneuter offener Brief des VdA vom 28.11.2012 zur Causa Stralsund:
“ …. „Kein Archiv würde ohne Not oder äußeren Druck wertvolles Kulturgut veräußern. Auftrag und Selbstverständnis der Archive, Entscheidungen, Handlungen und Erinnerungen als einzigartiges, unersetzliches kulturelles Erbe zu sichern und von Generation zu Generation weiterzugeben, stehen dem diametral entgegen. …..Muss ein Stadtarchiv erst unter tragischen Bedingungen einstürzen oder sich ein Skandal wie in Stralsund ereignen, bis wieder die zentrale Bedeutung des historischen Kulturgutes für die Stadtgesellschaft in das Bewusstsein der Verantwortungsträger und der allgemeinen Öffentlichkeit rückt?“
Quelle: http://vda.archiv.net/index.php?id=1
Das Aktionsbündnis Bahnhof Siegen des BUND Siegen-Wittgenstein und des VCD Siegen-Wittgenstein-Olpe verfügt über eine eigene Homepage: http://www.aktionsbuendnis-bahnhof-siegen.de/ . Die Seite dokumentiert zurzeit 2 Leserbriefe, die sich mit der historischen Dimension des Projektes auseinander setzen.
Pingback: siwiarchiv.de: Monatsstatistik 11/2012 | siwiarchiv.de
Pingback: Walter Krämer – Stolperstein in Hannover | siwiarchiv.de
Auf der Homepage des VVN BdA Kreisverband Siegen-Wittgenstein gibt es inzwischen einen Bericht mit Bildern zur Stolpersteinverlegung in Hannover.
Heute berichtet die Westfälische Rundschau vom Erscheinen des 17. Bandes der Siegener Beiträge.
Pingback: Funde in anderen Archiven: 10.12.1950 – | siwiarchiv.de
Besprechung in der Printausgabe der Siegener Zeitung v. 8.12.2012 (Kultur)
Pingback: Ausstellung historischer Bibeln und religiöser Drucke | siwiarchiv.de
Pingback: Berleburger Weihnachtszeitreise mit historischer Bildergalerie | siwiarchiv.de
Je spezieller die Anträge sind, um so mehr Anlass zu Eifersüchteleien werden sie geben und folglich den fein ausballancierten interregionalen Frieden stören. Der Thüringer Kloß ist ja ohne jeglichen Zweifel ein beeindruckendes immaterielles Weltkulturerbe (schon Goethe wird ihn gegessen haben). Ohne ihn (den Kloß) hätte die Menschheitsgeschichte einen anderen Verlauf genommen. Doch läßt sich Gleiches ebenso vom verwandten Vogtländer Kloß behaupten. Und damit würde die UNESCO mit der Ehrung des einen und somit Diskriminierung des anderen einen Konflikt zwischen den Freistaaten Thüringen und Sachsen (den später als „Kloßkrieg“ in die Annalen eingehenden) heraufbeschwören, an dem nun wirklich niemand Interesse haben kann, schon gar nicht in der Weihnachtszeit. Hier sollte man sich also auf den „mitteldeutschen Kloß“ einigen.
Auch im Siegerland wäre ein möglichst allgemein gehaltener Antrag dem Konsens förderlich. Es gilt, die Anhänger von Siegerländer Hauberg, Siegerländer Kunstwiese, „Siegerländer Krüstchen“ (identisch, aber um Gottes Willen nicht zu verwechseln, mit dem Wittgensteiner, dem Sauerländer und all den anderen Krüstchen) und sonstigen regionalen Kulturleistungen unter einen Hut zu bringen. Was spräche eigentlich dagegen, um es allen recht zu machen, „den Siegerländer an sich und als solchen“ zum immateriellen Weltkulturerbe ausrufen zu lassen?
P.K.
Pingback: Gerhard freudenberger | Grabadive
Auf der Seite “Archäologie in Westfalen-Lippe 2011? erschienen
ist der Link:
Quelle: LWL-Archäologie für Westfalen, Publikationsseite
http://www.lwl.org/LWL/Kultur/WMfA_Zentrale
fehlerhaft. Er sollte lauten
http://www.lwl.org/LWL/Kultur/WMfA_Zentrale
Danke für den Hinweis! Wurde im Eintrag geändert!
Hallo,
ich bin der Sohn von Fritz Andreas Schubert. Vielen Dank für diese Darstellung meines Vaters.
Danke. Jochen Schubert
Danke für die Reaktion! Es freut mich, dass Ihnen dieser Artikel gefällt. Gerne dürfen Sie etwas ergänzen.
Pingback: Suchanfrage: Hermann Manskopf “Blick auf Siegen” (Aquarell) | siwiarchiv.de
Pingback: Zur Kriegefangenenschaft Dr. Lothar Irles (1905-1974) – | siwiarchiv.de
Interessant fände ich es, neben den erwähnten regionalgeschichtlichen auch über archivfachliche Themen informiert zu werden, also z.B. aktuelle Übernahmen, angewandte Bewertungsmodelle, Erfolge und Probleme bei der Überlieferungsbildung. Zugegebenermaßen bin ich mir aber nicht sicher, ob so etwas in das Profil von siwiarchiv passt, ob die Zielgruppe vielleicht doch lieber interessierte Nutzer sind als die Kollegenschaft. Meiner subjektiven Einschätzung nach arbeiten die Archivarinnen und Archivare in Deutschland im Alltagsgeschäft eher nebeneinander als miteinander – vielleicht auch weil wir weithin keine Blogs haben, um einen entsprechenden Austausch zu pflegen. Die Archive im Kreis Siegen-Wittgenstein hingegen, die haben ja eins, vielleicht wären da also auch solche Themen drin…
Genau dies steht eigentlich auch im Editorial des Blogs – daher vielen Dank für den Hinweis! Denn siwiarchiv soll auch archivisches Arbeiten vermitteln. Wir tun dies bis jetzt nur zu selten. Ihre Anregungen werde ich gerne an den Arbeitskreis weitergeben.
Ich werde gerne den Anfang machen und auch hier unsere Gedanken zur Überlieferung der Kriegsgefangenenentschädigungsakten vorstellen – s. a. Anfrage im forum-bewertung. Das Kreisarchiv hat auch Vorstellungen zur Überlieferung der Personalakten angestellt, die wir gerne zur Diskussion stellen.
Pingback: Cécile Hummel, „Zeit Sehen – Zurück Blicken“, 2012 | siwiarchiv.de
Pingback: Ausstellung: “Lebensläufe ins Siegerland” | siwiarchiv.de
Pingback: Eröffnung “100 x Studio für neue Musik” | siwiarchiv.de
Allmählich kommt die Universität Siegen in den Ruf, schlampig oder gar kriminell mit ihr anvertrauten Kunstwerken umzugehen. Nun bin ich nicht die Universität und brauche mich um deren generelle Ehrenrettung nicht zu kümmern; im hier vorliegenden Fall ist aber ein Kommentar angebracht.
Der Text zum erwähnten Druck in der Ingenieurschul-Festschrift von 1967 lautet: „Blick auf Siegen – nach einem Gemälde von Hermann Manskopf, freundlicherweise zur Verfügung gestellt von der Siemag-Feinmechanische Werke Eiserfeld“. Das interpretiere ich so, dass die Siemag das bei ihr hängende Gemälde für diese Broschüre reproduzieren ließ, also wahrscheinlich kurz an die ausführende Druckerei (Vorländer) zur professionellen Ablichtung ausgeliehen hatte. Daraus zu schließen, das Original habe als Siemag-Leihgabe jemals in der Ingenieurschule gehangen, scheint mir doch etwas weit hergeholt zu sein.
Erwähnt wird im Blog-Beitrag ferner, eine Anfrage bei Frau Prof. Blanchebarbe im Siegerlandmuseum sei „negativ verlaufen“. Das kann ich so recht nicht glauben, denn eine Schwarz-Weiß-Abbildung eben dieses Gemäldes („Stadtansicht von Siegen in Spachteltechnik vom Giersberg aus gesehen“) findet sich in Frau Blanchebarbes Beitrag „Der Maler Hermann Manskopf (1913-1985)“ in der Zeitschrift Siegerland 70 (1993), S. 69-74. Da dort (bis auf eine Ausnahme) keine Bildquellen angegeben sind, vermute ich, dass für die Druckvorlagen auf Bestände des Museums zurückgegriffen wurde. Anscheinend war das gesuchte Bild anläßlich der „umfangreichen Retrospektive im Siegerlandmuseum“ zu Manskopfs 80. Geburtstag, woran der Aufsatz erinnert, ausgestellt worden.
P.K.
Pingback: ?Ausstellungseröffnung „60 Jahre Städtepartnerschaft Spandau – Siegen” | siwiarchiv.de
Pingback: Siwiarchiv.de feiert heute Geburtstag | siwiarchiv.de
Zu Güthlings wissenschaftlicher Karriere ist auch der Aufsatz von Burkhard Dietz: Überlieferung und Rezeption der Werke von Erich Philipp Ploennies im 18. und 19. Jahrhundert, in: Zeitschirft des Bergischen Geschichtsvereins 97 (1995/96), S. 1-86, heranzuziehen.
Danke für den Hinweis! Habe ich wohl wegen des Aufsatzes in den Siegener Beiträgen versäumt in diese Literaturliste aufzunehmen.
2 Antworten vermuten nicht ganz abwegig, dass es sich um den Tod(estag) Moltkes handele. Doch siwiarchiv ist ein regionalarchivisches und -historisches Weblog. Daher: Weitersuchen!
Nein, es ist auch nicht die Verleihung der Ehrenbürgerwürde der Stadt Siegen an Bismarck Anfang April 1891.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Wolf,
herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum und weiter so! Es macht immer wieder Spaß, hier reinzuschauen.
Vielleicht zum 100-jährigen Bestehen des Moltkedenkmals in Siegen 1992?
Nein, leider auch nicht das Moltke-Denkmal.
Liebe Herr Wolf, auch aus Potsdam herzlichen Glückwunsch!
Mein Lösungsvorschlag: Die Zeitungen lagen im Grundstein zum ehemaligen Amtskrankenhaus Haus Hüttental des Kreisklinikums Siegen in Weidenau, dessen Grundstein (nach Wikipedia) am 8. Mai 1891 gelegt wurde.
Richtig! Man hätte gar nicht den Umweg über die Wikipedia gehen gehen müssen, denn http://www.siwiarchiv.de/?s=April+1891 hätte auch zur Lösung geführt.
Neben den Zeitungen undbefanden sich noch die Gründungsurkunde, eine Spendeliste ein Briefumschlag, die Blankopostkarte sowie 2 Münzen in dem Behältnis. Zeitungen und die beiden Schriftstücke werden voraussichtlich zeitnah restauriert werden. Weiteres dann hier im Blog.
Pingback: Workshop: „Vorbei und vergessen? Die Lösung: Das Vereinsarchiv!“ | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv auf soundcloud | siwiarchiv.de
Wieder ein interessantes Thema! Generell wollte ich mal sagen, dass ich es wirklich erstaunlich finde, wie viel ihnen immer an Berichten einfällt :-) das würde man in dem Archiv eines so „unscheinbaren“ Ortes gar nicht vermuten. Ich lese siwi-archiv immer gerne, obwohl ich gar keinen regionalen Bezug habe und bekomme viele Anregungen. Danke!
Pingback: Fotoausstellung “60 Jahre Städtepartnerschaft Spandau – Siegen” … | siwiarchiv.de
Der Ratschlag für Bildformate zur digitalen Archivierung ist arg verkürzt. TIFF unkomprimiert kann teuer werden, was den Speicherverbrauch angeht. Es lohnt sich aber, wenn man nur eine Kopie aufbewahrt, denn im Katastrophenfall kann man aus einer defekten Festplatte oder DVD wesentlich mehr Dateien retten, als wenn man Formate wie JPEG für Fotos und PDF mit JPEG-Kompression für Akten verwendet hätte. Hat der Verein eine bessere Speicherlösung mit sicherem Backup, so würde ich letztere Formate (in höchster Qualitätsstufe) empfehlen. JPEG2000 ist (noch) eher etwas für Institutionen, die sich Profisoftware leisten können.
Das Thema ist in der Tat sehr lohnenswert. Auch ich bekomme öfters Anfragen von Privatleuten, wie sie am besten ihre privaten Nachlässe und Vereinsunterlagen archivieren sollten bzw. wie sie sie für eine Anbietung an ein Archiv vorbereiten können. Und beides sollte man in jedem Fall unterstützen.
Ich meine die Präsentation deckt alle Themenfelder, die interessieren, ab. Ich würde dennoch den rechtlichen Aspekt etwas mehr hervorheben, da viele unsicher im Umgang gerade mit personenbezogenen Daten sind, was vor allem die Mitgliederlisten betrifft. Die Übersicht über die archivrelevanten Unterlagen finde ich gut, dennoch wäre ein Hinweis auf Webarchivierung sinnvoll – auch wenn sicherlich keine Zeit bleibt die Umsetzung zu besprechen. Aber gerade Websites spiegeln die Vereinsgeschichte sehr gut wider. Bei der Frage, womit verzeichnet werden sollte, würde ich von Textverarbeitungsprogrammen abraten. Excel wäre m.E. die Mindestanforderung. MidosaXML würde ich ebenfalls empfehlen (ohne Fragezeichen), da sich hier eine Excel-Tabelle erfolgreich importieren und mappen lässt. Außerdem ist damit die Online-Präsentation auch mit Digitalisaten recht leicht umsetzbar. Falls also jemand im Vereinsarchiv sich nicht scheut, sich in das Programm einzuarbeiten, ist dies für diese Anforderung eine gute Lösung. Bei dem Punkt Digitale Archivierung finde ich das Speichermedium auch sehr wichtig und würde hier darauf verweisen, dass CDs, DVDs etc. besser nicht verwendet werden sollte, sondern mindestens auf verschiedenen externen Festplatten doppelt gespeichert wird und diese an zwei verschiedenen Orten aufbewahrt werden sollten. Sicherlich kommt auch die Frage auf, ob die Speicherung in einer Cloud sinnvoll ist, sich der Verein aber im Klaren sein muss, dass dann der Anbieter auch Zugriff auf die Objekte haben könnte (personenbezogene Daten!). Über die Bild-Formate (wie auch Audio und Video) lässt sich stets streiten, aber der Verein sollte wissen, dass die Bildformate unterschiedliche Qualitäten mit sich bringen und TIFF derzeit etabliert ist, aber jpg für die Verwendung im Web nötig ist, gegebenenfalls also Bilder in zwei verschiedenen Formaten und diese jeweils mehrfach gesichert vorliegen müssten. Außerdem fände ich den Hinweis erofrderlich, dass dieses Vorgehen noch keine digitale Archivierung bedeutet, sondern nur als digitale Sicherung der Objekte verstanden werden kann.
Weiterhin viel Erfolg bei diesem Thema und ich freue mich auf weitere Berichte dazu.
@Jevgeni Vielen Dank für die Strategie! Externe Speicherplatte wird sicherlich auch vorgeschlagen – wie steht es mit der Glas-Disc?
@Frau Prof. Schwarz: Vielen Dank für die Durchsicht und die ausführlichen Hinweise! Ihren Anregungen werde ich für den nächsten Termin einarbeiten.
Klaus Graf weist auf Archivalia zurecht auf die Vermittlung des Provenienzprinzips hin. Ebenso richtig ist der Hinweis auf das Beratungsangebot anderer Archive, z. B. auf das für den Landesteil Westfalen zuständige LWL-Archivamt in Münster.
Pingback: ” …. fast zu jeder Gemeinde sind Prozessakten vorhanden…..” | siwiarchiv.de
Pingback: “Das Jahr 1933 in Stadt und Kreis Siegen” | siwiarchiv.de
Pingback: Aktionstag “Ich seh sie noch immer | siwiarchiv.de
… und ich fuhr als Leichtmatrose 1966 auf dem MS Siegerland für die British and Irish Steampacking in Charter zwischen Liverpool und Dublin mit Abstechern nach Cork.
Und habe tolle Erinnerungen und Stories an die Zeit :-))))
Kapitän Tom Schilling
Vielen Dank für den Kommentar! Sie dürfen gerne hier mehr berichten. Haben Sie noch weitere Bilder von der MS Siegerland?
an tom schilling kann ich mich nicht erinnern.
aber die zeit für die B&I Line war in jeder hinsicht schon toll !
da kann ich herrn schilling zustimmen.
ich hab noch viele bilder von der siegerland.
da fing meine seefahrtszeit an.
hab noch einen nachtrag , frau albers stammte aus kreuztal !
Hallo Herr Kapitän Welte,
vieleicht können sie sich an mich erinnern,
Mein Name ist Andreas Bartkowiak meine Zeit auf der MS Siegerland ist mir bis Heute noch in ereinnerung, für mich die schönste Zeit meines lebens.
Ich Heuerte am 27.05.1978 in Rotterdam an und dann began mein Abenteuer.
Würde mich freuen von Ihnen zu höhren, vieleicht können sie mir einige abzüge aus dieser zeit zukommen lassen.
Dear Kaptain,
I am an Irish lady from Cork.
My father was working on the Siegerland.
According to my mother he was a cook.
My mothers name is Joan Woods.
I am born on the 14 th of june 1968.
Im looking for my father.
Kind regards
My name is Regina Woods,
Please leave a reply on my e-mail adress.
Bereits 1936 wandte sich die Stadt Siegen auf Anregung eines in Hamburg lebenden Heinrich Irle an die Hapag in Hamburg und den Norddeutschen Lloyd in Bremen mit der Bitte eines ihrer Schiffe auf den Namen „Siegerland“ zu taufen. Zitat aus der Antwort des Norddeutschen Lloyd an den Herrn Oberbürgermeister: „Daß auch die Stadt Siegen und das Siegerland den Wunsch besitzt, den Namen ihres Landes durch ein deutsches Schiff vertreten zu sehen, ist begreiflich, zumal dieser Name, wie Sie selbst sagen, noch wenig bekannt ist. Aber gerade aus diesem Grund dürfte der Name ‚Siegerland‘ bei der Einstellung der Welt zu unserem deutschen Vaterlande im Auslande ganz anders ausgelegt und ihm eine Bedeutung gegeben werden, die keinesfalls erwünscht sein kann. Sie werden daher auch verstehen, wenn wir aus diesem Grunde Ihrer Bitte … nicht entsprechen können.“ (Quelle: Stadtarchiv Siegen, Best. Stadt Siegen D 313)
Pingback: “Die große Illusion. Simon Grünewald” | siwiarchiv.de
Wir haben Interesse, an dem Genealogentag teilzunehmen. Ist eine Anmeldung erforderlich? Welche Vorträge, Arbeitsveranstaltungen sind vorgesehen? Welche Kosten enstehen?
Weitergehende Informationen und Ansprechpartner finden Sie unter dem oben genannten, in blauer Schrift erscheinenden Link!
Pingback: siwiarchiv.de – Monatsstatistik 1/2013 | siwiarchiv.de
Pingback: Erste Editionen des Projekts “Zurück zu den Akten” | siwiarchiv.de
Eine Quellenedition zur Kultur in der Stadt Siegen findet sich hier: http://www.siwiarchiv.de/2013/02/editionen-zuruck-zu-den-akten/
Eine Zustandsbeschreibung zur Kultur im Siegerland bis 1948 findet sich als Ergänzung zur unter Punkt 2) genannten Edition hier: http://www.siwiarchiv.de/2012/05/kultur-im-siegerland-zwischen-1945-und-1948/
Eine gut gemeinte Aktion, die wie alle gut gemeinten Aktionen begeisterte Anhänger finden wird. Dennoch drei spontane Fragen:
1. Welches Publikum hofft der Herausgeber zu erreichen? Das unverbindliche Stöbern mag recht unterhaltsam sein, für gezielte thematische Erkundungen eignen sich die völlig unstrukturierten großen Dateien jedoch nicht.
2. Von welchen Auswahlkriterien läßt sich der Herausgeber leiten und warum? Kommentarlos aus ihren komplexen Zusammenhängen gerissen, sind Quellentexte für den historischen Erkenntnisgewinn oft wertlos.
3. Soll man über die Formulierung „im Auftrag des Stadtarchivs herausgegeben“ gründlicher nachdenken oder sie lieber schweigend auf sich beruhen lassen?
P.K.
Schweigen! Schweigen! Schweigen!
Der Herausgeber hat soeben zugesagt, alle Hinweise auf eine Beteiligung des Stadtarchivs bzw. meiner Person zu tilgen.
Verlinkung erfolgt jetzt auf die wie oben angekündigt geänderten Dateien!
s. http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/dem-laser-entgeht-kein-wall-und-keine-hecke-id7544057.html
Pingback: Neues Ego-Dokument von Dr. Lothar Irle | siwiarchiv.de
Das fand ich sehr spannend zu lesen (kam über Twitter drauf;-), da das ISG Frankfurt seit mehreren Jahren in Zusammenarbeit mit dem Landessportbund Hessen Seminare für Archivare von Sportvereinen anbietet.
Von den Themen sind neben der richtigen Aufbewahrung von Archivalien auch digitale Archvierung (Hinweis auf Datenträger= keine CD´s usw.), richtige Foto-Archivierung und zuletzt Datenschutzhinweise/ Fotorechte besonders gefragt. Auch machen alte Schriften oft Probleme.
Umgekehrt erfahren wir Archivare, ob/ was die Vereine an interessantem Material haben…
Ob es ein Spezialgefängnis war, kann bezweifelt werden. Dass da ein Gestapo-Gefängnis war, war bekannt, noch bevor Radio Siegen davon Wind bekam, und zwar spätestens seit Dieter Pfau die Lagepläne gefunden hat. Von damaligen Kommunisten gibt es Zeitzeugenberichte sowohl in Strafakten der Generalstaatsanwaltschaft als auch in später veröffentlichten Berichten.
Dieter Pfau publizierte in „Kriegsende 1945 in Siegen. Dokumentation der Ausstellung 2005“, Bielefeld 2005, im Zusammenhang mit dem Prozess gegen den Gestapo-Beamten Otto Faust auf S. 183 eine Lageskizze der Büroräume der Geheimen Staatspolizei – Außenstelle- im Landgerichtsgebäude Siegen. Die Skizze weist sieben Büroräume im Dachgeschoss aus (Pförtner u. „Dollmetscher“, Regitratur, 4 Vernehmungsbüros und einen Raum für den Fernschreiber). Pfau gibt folgende Quelle an: R- LG National Archives (vorm. Public Record Office), Kew bei London FO 1060 Nr. 1430.
Pingback: Literaturtipp: Ruth-E. Mohrmann (Hrsg.) “Audioarchive | siwiarchiv.de
Pingback: 300jährige Existenz der Höhendörfer | siwiarchiv.de
Dass sich dort das Landgericht samt Gefängnis und die Gestapo befand war ja bekannt, so dass ein „Spezial-Gefängnis“ durchaus plausibel ist. Aber welche neu aufgetauchten Dokumente, von der die Siegener Zeitung heute spricht, mögen dies sein, die eine so aufwändige Untersuchung (Mauerritzen, Fußböden) begründen?
Auch die Westfälische Rundschau und der WDR berichten heute.
„Eine „Dialog- und Gedenkstätte“ könnte sich der Rektor im Unteren Schloss gut vorstellen“, SZ, 8.2.
Tatsächlich eine interessante Idee.
Woher stammen die unbekannten Dokumente? Wurden die Kellerräume noch nie auf Akten durchsucht?
Mich beschleicht der Eindruck, dass nicht die richtigen Fragen gestellt wurden:
1) Warum fragt denn keiner beim Pressesprecher des LWL-Denkmalamtes nach?
2) Die aufgefundenen Schriftstücke gehören eigentlich in das Landesarchiv NRW. Warum fragt denn dort keiner nach.
3) Brauchen wir eine weitere Gedenkstätte wirklich oder wäre ein Ausbau des Aktiven Museums nicht ausreichend – eben um eine Dokumentation der Funde, so sie denn etwas hergeben?
„interessante Idee“, da scheinbar schon Gedanken hinsichtlich einer möglichen Nutzung angestellt werden (wobei ich die Frage des Journalisten nicht kenne), obwohl angeblich noch gar nicht bekannt ist, was genau dort gefunden wurde/ wird.
Abgesehen davon fände ich eine wie auch immer geartete NS-Gedenkstätte auf dem WiWi-Campus (noch dazu in direkter Nachbarschaft zum AMS) nicht naheliegend.
Pingback: Ausstellung “25 Jahre AIDS-Beratung im Kreis Siegen-Wittgenstein” | siwiarchiv.de
s. a. Pressemitteilung des Kreises Siegen-Wittgenstein, 12.2.2013
Pingback: Literaturhinweis: “Die Akten des Reichskammergerichts. Schlüssel zur vormodernen Geschichte” | siwiarchiv.de
Pingback: Ausstellung: “25 Jahre AIDS-Beratung im Kreis Siegen-Wittgenstein” | siwiarchiv.de
In der heutigen Printausgabe der Siegener Zeitung findet sich ein überaus denkmalschutzkritischer, fast schon polemischer Leserbrief. Das Thema scheint zu interessieren …..
Ob sich hinter folgenden Archivalien die neuen Aktenfunde verbergen: LWL-Archivamt für Westfalen, Archiv LWL, C 711 (Landeskonservator) 1041, 305 Altakte – Unteres Schloß 1946 – 1977, 1925 – 1940?
Karl Heinz Gerhards teilt gestern via E-Mail mit: “ ….. „Für die Siegerländer Familienkunde ist insbesondere der Rau-Vorfahre Adam Bäumer (+ 1674), einer der Ahnherren der weitverzweigten Siegerländer Familie Bäumer und deren Töchternachkommen (zu denen ich auch zähle) interessant. Auf die Berichterstattung über meinen Vortrag in SIEGERLAND, Bd. 89, Heft 2, 2012, S. 289, darf ich hinweisen.“
Der E-Mail beigefügt war ein Schreiben von Prof. Dr. Klaus Goebel an Herrn Gerhards, dass nach dessen Publikation (s. o.) weitere familienkundliche Forschungsergebnisse (u.a. auch von Herrn Gerhards) eine ergänzende Veröffentlichung lohnenswerte erscheinen lassen.
Pingback: Workshop „Vorbei und vergessen? Die Lösung: Das Vereinsarchiv!“ | siwiarchiv.de
1) Es ist ein Nebengebäude eines der 3 oben genannten …..
2) Hm, Siegen war selbst hochgradig zerstört, warum dann eine Aufbauhilfe für Münster?
Pingback: Erfolgreicher Vortrag zu Burgen im nördlichen Siegerland | siwiarchiv.de
Auf Archivalia kommentiert Kollege Graf gewohnt deutlich.
Pingback: Erfolgreicher Vortrag zu Burgen im nördlichen Siegerland | siwiarchiv.de
Pingback: Heilstätte Hengsbach 2 | siwiarchiv.de
Pingback: Kein Schimmel mehr im Archiv | siwiarchiv.de
Ich bin als dreieinhalbjähriges Kind 1947/48 Patient in der Heilstätte Hilchenbach gewesen. Mein damaliger Arzt war Dr. Kruse, der später in Salchendorf praktizirte.
Ich möchte wissen, in welchem Gebäude die damalige Heilstätte untergebracht war.
Pingback: Film “Revier hinter den Bergen” | siwiarchiv.de
Das Gebäude der ehemaligen Heilstätte Hengsbach ist heute das Altenpflegeheim der Diakonie, Haus Obere Hengsbach; zunächst wurde das Gebäude 1971 an die AWO veräußert, die dort ein Internat, einen sonderkindergarten und eine Werkstatt für Behinderte einrichteten… Alles weitere kommt noch in den folgenden Beiträgen..
Entschuldigung Herr Jud,
das war das Gebäude in Siegen..
Von dem Gebäude in Hilchenbach weiß ich (bisher) nur, daß es sich Richard-Masrtin-Heim nannte und dem „Verband evangelischer Arbeitervereine“ in NRW gehörte..
In 2009 wurde das Richard-Martin-Haus (vorher Richard-Martin-Heim) dann an Herrn Fuhrmann,vom Helberhäuser Seniorenheim Abendfrieden verkauft.
Das Gebäude ist heute noch vorhanden, in unmittelbarer Nähe der Straße nach Brachthausen.
Umfangreiche Informationen gibt´s beim Stadtarchiv Hilchenbach, Herr Gämlich.
Pingback: Heilstätte Hengsbach 3 | siwiarchiv.de
Pingback: Heilstätte Hengsbach 4 | siwiarchiv.de
Pingback: Lothar Irle und die Märchen der Gebrüder Grimm | siwiarchiv.de
Pingback: “Revier hinter den Bergen” erneut erfolgreich | siwiarchiv.de
Zigeunerverfolgung im Rheinland und in Westfalen: 1933-1945
Geschichte, Aufarbeitung und Erinnerung
Buchvorstellung von Dr. Ulrich Friedrich Opfermann
Sonntag, 10. März 2013
um 15.00 Uhr
im Bürgerhaus Eschenbach (www.buergerhaus-eschenbach.de)
Pingback: Heilstätte Hengsbach 5 | siwiarchiv.de
s. a. Westfälische Rundschau, 2.3.2013, Siegener Zeitung, 6.3.13
Pingback: Präsentation zur NS-Zeit in der Stadt Siegen ab 1933 | siwiarchiv.de
wann issn die jungstillinggeisterparty??
auf der jungstillingseite und im gästebuch iss abba nix geschrieben.
Pingback: Buchvorstellung “Zigeunerverfolgung im Rheinland und in Westfalen: 1933-1945 | siwiarchiv.de
Gab es kein Gestapo-Gefängnis im Unteren Schloss? Zumindestens schreibt dies die Siegener Zeitung in ihrer Samstagsausgabe. Zumindestens fanden sich im derzeitigen Bauzustand keine Spuren, ebenfalls nichts (zu und) in den neuen (!) Aktenfunden. Eine endgültige Stellungnahme der Denkmalpflege steht noch aus.
S.a. WP/R, 8.3.2013
Pingback: Buchvorstellung “Zigeunerverfolgung im Rheinland und in Westfalen: 1933-1945″ | siwiarchiv.de
Pingback: Heilstätte Hengsbach 6 | siwiarchiv.de
Wenn sich nun ein Gestapo-Gefängnis im Unteren Schloss in Siegen nicht nachweisen lässt, so wäre doch eine Aufarbeitung der Geschichte des Gefängnisses sicherlich nicht uninteressant.
Hierzu müsste u. a. folgende Bestände des Landesarchivs NRW, Abt. Westfalen, in Münster sichern:
1) Q 901 Justizvollzugsamt Westfalen-Lippe, Hamm, 210 Archiveinheiten, Laufzeit: 1919-1996
Dieses Amt war für die Aufsicht, Verwaltung und Bewirtschaftung der Gefängnisse zuständig.
2) Q 925 Vollzugsverwaltung, 90 Archiveinheiten, Laufzeit, 1929-1950.
Im ITS Arolsen befindet sich in der Gruppe P.P. der Ordner 418 (Inv. 1892). Dieser enthält wohl Auszüge aus Haftbüchern des Landgerichtsgefängnis Siegen mit 1280 Namen.
Weitere Hinweise auf durchzusehende Bestände sind gerne willkommen.
Pingback: siwiarchiv.de – erster Jahresbericht | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv.de – erster Jahresbericht | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv.de – erster Jahresbericht | siwiarchiv.de
Pingback: Siwiarchiv – ein erster Jahresbericht | Archive 2.0
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Experiment Siwiarchiv ist eine schöne digitale Wegmarke, die besonders für Auswärtige viel Licht in die dunklen Täler des Siegerlandes wirft. Bin gern zu Gast hier und erfreue mich an Vielfalt und Lebendigkeit sowohl historisch als auch archiv(ar)isch.
Herzlichen Glückwunsch zum 1. Geburtstag und viel Erfolg weiterhin!
Für eine Geschichte des Gefängnisses insgesamt müssen sicherlich auch die einschlägigen Archivalien in den Beständen „Kreis Siegen, Landratsamt“ und „Kreis Siegen, Landratsamt neu“ des Landesarchivs NRW, Abt. Westfalen, zu Rate gezogen werden.
Dumme Frage von jemandem, der das interessant findet, aber noch nie wirklich mit Archiven zu tun hatte:
Warum treibt man diesen Aufwand? Kann man nicht einfach den Ordner so, wie er ist, ins Regal stellen?
Kann man schon.
Aber:
1) die Metallteile des Ordners rosten und schädigen das Papier.
2) die liegende Aufbewahrung ist platzsparender als die stehende
3) Jede Verpackung schützt vor Brand-, Wasser oder sonstigen Schäden
4)Jedes Licht schädigt das Papier
5)Staub ist Nährboden für papierschädigende Sporen, Pilze, etc.
Ich hoffe, dass dies den Aufwand erklärt.
Danke für diesen wichtigen Nachweis!
Pingback: Heilstätte Hengsbach 7 | siwiarchiv.de
Pingback: Heilstätte Hengsbach 8 | siwiarchiv.de
Pingback: Siegener Wappen in Münster | siwiarchiv.de
Pingback: Siegener Wappen in Münster | siwiarchiv.de
Pingback: “EINBLICKE. Ein Themenabend über Siegener Künstler …. | siwiarchiv.de
Pingback: Westfälischer Archivtag 2013. Fotoeindrücke. | siwiarchiv.de
Für die nachher der Veranstaltung fernbleibenden Interessenten wird es erfreulich sein, dass Herrn Gleitsmanns Ausführungen (schon als Referat auf dem Deutschen Historikertag 2012 präsentiert) nun auch schriftlich zugänglich sind. Seinen aktuellen Zeitschriftenaufsatz zum Thema findet man seit kurzem als Open-Access-Dokument hier:
http://ejournal.uvka.de/spatialconcepts/archives/1622
Bedauerlich ist, dass solche Vorträge vom Veranstalter immer auf eine so späte Tageszeit gesetzt werden. Das führt zur Diskriminierung von Menschen, die nicht motorisiert sind und für den weiten Heimweg keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr finden. Es kann ja, um beim heutigen Beispiel zu bleiben, nicht Sinn der Sache sein, sich 60 oder 90 Minuten lang von einem (wenn auch qualifizierten) Loblied auf den Siegerländer Hauberg berieseln zu lassen. Die sehr komplexe Thematik bedürfte der vertiefenden Diskussion, für die eben nach der Einführung keine besinnliche Ruhe mehr bleibt, wenn erst um halb Acht begonnen wird.
P.K. (nachher abwesend)
Danke für die Antwort!
Interessant, was es da alles zu bedenken gibt!
Ich habe wohl wirklich unterschätzt, was es bedeuten, wenn man Papier wirklich dauerhaft erhalten möchte.
Für den normalen „Hausgebrauch“ ist Papier ja meist dauerhaft genug, aber ein Archiv muss wohl andere Maßstäbe anlegen.
Pingback: “Zeitzeugen auf Zelluliod”. Fotoimpressionen. | siwiarchiv.de
Neugierigerweise: Wie viele Akten dieser Heilstätte werden insgesamt „bearbeitet“?
Hier finden Sie die nachgefragten Mengenangaben: http://www.siwiarchiv.de/2013/02/heilstatte-hengsbach-1/ .
Pingback: Heilstätte Hengsbach 10 | siwiarchiv.de
Pingback: Heilstätte Hengsbach 11 | siwiarchiv.de
Vielen Dank für den Link!
Das ist ja doch eine ansehnliche Menge. Dank dem Foto hat man auch eine gute Vorstellung davon. Das ist ja durchaus einige Arbeit.
„Übergrößen“ sind nehme ich an alle Unterlagen, die größer als DIN A4 sind (Pläne usw.)?
PS: Ein interessantes Blog ist das hier. Als „normaler“ Mensch hat man ja üblicherweise keine Ahnung davon, was ein Archiv so genau tut. Ich finde es wirklich faszinierend, hier einen kleinen Einblick zu bekommen.
Vielen Dank für das Lob! Die Darstellung archiv(ar)ischer Arbeit ist einer der Gründe, warum wir dieses Blog schreiben. Schön, dass es Ihnen gefällt.
„Übergrößen“ meint im Kreisarchiv Formate über 33x21cm (Folio). Im konkreten Bestand handelt es sich um Unterlagen der Rechnungsführung.
Was ist denn das? Eingelegte Insekten? Sieht für mich nicht aus wie etwas, das ich in einem Archiv erwarten würde.
Normal ist dies tatsächlich nicht. Aber: ich halte die abgegebende Stelle für unbedingt archivwürdig, so dass ich tatsächlich mit solchen Präparaten umzugehen lernen muss. Diese Präparate werden evt. auch noch von der abgenden Stelle selbst benötigt.
Haben Sie einen Verdacht , um welche Stelle es sich handeln könnte?
Es handelt sich um Handakten des Landrats, die er daheim während eines kühlen Bades im Gartenteich studiert hatte. Dabei war ihm diese Libellenlarve zwischen die Seiten gekrabbelt. Was sagt das Naturschutzgesetz dazu???
P.K.
1) Glauben Sie wirklich, dass ein Landrat Libellenlarven präpariert? Nein, es handelt sich nicht um Handakten des Landrates ;-).
2) Ich denke die abgebende Stelle hatte das Naturschutzgesetz im Blick.
1) Landräte sind auch nur Menschen.
2) Biologische Station Rothaargebirge?
P.K.
Ich bin froh, dass Sie nicht Lebensmittelüberwachung angegeben haben. :-)
Gegen die angekündigten Kürzungen der Mittel für Archäologie und Baudenkmalpflege ist eine offene Petition an die Landesregierung eingerichtet worden, die alle engagierten Bürger zeichnen können: https://www.openpetition.de/petition/online/angekuendigte-streichung-der-landeszuschuesse-fuer-die-archaeologie-und-denkmalpflege-zuruecknehmen
Der Hinweis auf die Online-Petition wurde später auf siwiarchiv nachgereicht: http://www.siwiarchiv.de/2013/03/petition-gg-ende-nrw-denkmalfoerderung/ .
Ist Weiteres gegen die Kürzungspläne geplant? Ich poste dies gerne auch hier auf siwiarchiv.
Pingback: Heilstätte Hengsbach 12 | siwiarchiv.de
Falls es interessiert: Zum „Haus Dortmund“ in Meschede (kein Kinderheim, sondern eine Jugendherberge): http://www.s-teutenberg.homepage.t-online.de/meschede/haus_dortmund.html
Interessanterweise diente es im Krieg vorübergehend dem Stadtarchiv Dortmund zur Auslagerung von Urkunden.
Das Gebäude wird heute noch/wieder als Jugendherberge genutzt.
PS: Bei dem „Herrn Landesrat“ scheint mir der vorletzte Buchstabe eher ein i zu sein?
1) Vielen Dank für die Ergänzung!
2) Ja, es könnte auch ein i sein. Allerdings findet sich kein bekannter Eigenname, der so endet in Münster. Auf eine Anfrage beim LWL-Archivamt haben wir verzichtet.
Dazu brauchts nicht das Archivamt: Wird wohl Helmut Naunin gewesen sein, Erster Landesrat von 1954-1969.
Danke für die Ergänzung! Übrigens ein Bild Naunins findet sich im Bildarchiv des LWL-Medienzentrums. Sein Nachlass verwahrt das das LWL-Archivamt unter der Bestandssignatur 909. Naunins Personalakte befindet sich ebenfals dort: Best. 132/C 11 A K 374
Zur Verabschiedung Naunins in den Ruhestand findet sich ein Eintrag im archivamtblog: https://archivamt.hypotheses.org/11018 .
Ich fürchtete schon, ein pflichtbewusster Archivar hätte in irgend einem feuchten Behördenkeller die kleinen Tierchen als Untermieter in einem alten Aktenordner gefunden und sie als für die „Originalizität“ der Akte bedeutsam und daher erhaltenswert eingestuft. ;-)
Werden die Viecher jetzt auch gelocht, abgeheftet (in einem metallfreien Hefter versteht sich) und in einen säurefreien, langzeitbeständigen Archivkarton gelegt? ;-)
Fliegen und womöglich Spinnen, die von tapferen Verwaltungsbeamten durch Zuschlagen der Akten getötet wurden, finden sich durchaus in alten Akten. Auf deren Präparierung wird jedoch archiv(ar)ischerseits i.d. R. verzichtet. ;-)
Wie diese neue Archivgut möglichst dauerhaft aufbewahrt werden kann, ist eine Frage, die ich noch klären muss. Sobald ich eine gangbare Lösung gefunden habe, wird es sicher hier im Blog zu lesen sein.
Es handelt sich vermutlich um das Hotel Elephant in Weimar. Es wurde 1938 vom 1898 in Siegen geborenen NS-Architekten Hermann Giesler errichtet. Sein Bruder war Paul Giesler, unter anderem Gauleiter von Westfalen-Süd, später von München-Oberbayern.
Darf man fragen, ob die Bewerbungen erfolgreich waren? Ich weiß zwar nicht, was damals üblich war, aber der dritte Brief scheint mir doch ziemlich unbeholfen formuliert zu sein (besonders für eine Bewerbung); die Schreiberin hatte anscheinend nicht allzu viel Erfahrung im Schreiben „offizieller“ Briefe. Wobei man vermutlich bei einer „Hausgehilfin“ weniger strenge Maßstäbe angelegt haben dürfte, als bei einem Beruf, wo es auf Schreibfähigkeiten ankommt?
Ich freue mich übrigens, wieder ein paar Beispiele aus den bearbeiteten Unterlagen in Form von Abbildungen zu sehen, zumal ich mir vorstellen kann, dass das nicht nur einen gewissen Aufwand bedeutet, sondern dass aus Datenschutzgründen auch darauf geachtet werden muss, nicht „zu viel“ zu zeigen. Ich hoffe, die Reihe wird noch etwas fortgesetzt? Es sind ja anscheinend bisher erst die Personalakten behandelt worden, und wenn ich es richtig verstehe sind noch Akten aus diversen anderen Bereichen vorhanden.
Abschließend noch eine eher allgemeine Frage: Wissen die Stellen, von denen die Akten stammen, in der Regel vorher Bescheid, welche Akten später im Archiv landen, und können dann dementsprechend etwas sorgfältiger arbeiten? Nicht, dass es der Normalfall wäre, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Verwaltungsakten im Extremfall auch aus einem Haufen Notizzetellen und anderer kleinteiliger Unterlagen verschiedener Formate bestehen könne, zusammengehalten von hunderten Heftklammern. Nachdem ich ja nun weiß, dass im Archiv die ganzen Klammern entfernt werden müssen, kann ich mir vorstellen, dass solche Akten eine ziemliche Arbeit bedeuten würden. und hinterher stünde man vor dem Problem, diverse lose kleine Zettelchen zu haben, die zu klein zum Einheften sind.
PS: Auch wenn es schon etwas spät ist: Ich wünsche Allen Mitarbeitern des Kreisarchivs Siegen-Wittgenstein ebeso wie allen anderen Lesern hier frohe Ostern!
Pingback: siwiarchiv.de – Monatsstatistik 03/2013 | siwiarchiv.de
Gratulation! Beide Fragen sind korrekt beantwirtet:

Zu Hermann Giesler s. http://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Giesler
Pingback: siwiarchiv.de – Monatsstatistik 03/2013 | siwiarchiv.de
Vielen Dank für die Ostergrüße!
Zu dem Erfolg der Bewerbungsschreiben kann nichts sagen, gehe aber davon, dass diese erfolgreich waren, da sonst keine Personalakten entstanden wären.
Aus archivrechtlichen Gründen ist das hier vorgestellte Schriftgut anonymisert. Auf eine Berichterstattung aus den Personalakten zu verzichten, wäre aber bei einer Berichterstattung über die Bestandsbearbeitung kontraproduktiv gewesen. Für die abschließende Bestandsbearbeitung (Findbuch) sind Aussagen über den Dokumentationswert eines Bestandes sowieso erforderlich. Nichts anderes ist das, was bisher hier geschehen ist.
Die Bearbeitung der Sachakten steht tatsächlich noch aus und die Berichterstattung wird fortgesetzt.
Die archivische Einflussnahme auf die konkrete Aktenführung einer Verwaltung ist in der Regel gering. Ferner ist einer der wichtigsten Ziele archivischer Überlieferungsbildung die Dokumentation des Verwltungshandels, also auch der mehr oder weniger gelungenen Aktenführung. Die von Ihnen erwähnten Post-it-Zettel müssen ggf. in geeigneten Umschlagen an entsprechender Stelle in der Akten überliefert werden.
Pingback: Heilstätte Hengsbach 13 | siwiarchiv.de
Mein Kommentar war auch in keinster Weise als Kritik an dem Vorgehen gedacht. Auch wenn ich zugegebenermaßen nicht viel Ahnung von der genauen Gesetzeslage habe (bin kein Jurist), scheinen mir die hier gezeigten anonymisierten Ausschnitte völlig unproblematisch, es weiß ja niemand, um wen es sich jeweils handelt. Vielmehr wollte ich zum Ausdruck bringen, dass ich Verständnis dafür habe, dass man so eine Akte nicht mal eben komplett einscannen und hochladen kann (auch wenn ich es interessant fände, einfach mal „durchzublättern“).
Bei den hier gezeigten Bewerbungen finde ich übrigens auch die alte Handschrift der zweiten und dritten Bewerbung interessant, das ist ja nur in einer Abbildung erkennbar, nicht in einer Abschrift. Ich habe versucht, es zu lesen, es fällt mir allerdings schwer. Ist aber sicherlich eine Frage der Gewohnheit. (Kleinkarierterweise ist mir allerdings aufgefallen, dass es statt „noch per Eilboten“ „auch per Eilboten“ heißen müsste.)
Wird die Sache mit dem „Findbuch“ in einer späteren Folge erklärt? Es wäre sicherlich interessant zu erfahren, wie die Akten inhaltlich so erschlossen werden, dass man hinterher weiß, wo man findet, was man sucht.
1) Die archivrechtlichen Regelungen sind leider leider sehr restriktiv. Ob etwas problematisch ist oder nicht, liegt bei der betroffenen Person. Eine nicht anonymisierte Fassung einer Personalakte kann ohne Zustimmung der Person 10 Jahre nach Tod der Person bzw. 100 Jahre nach Geburt publiziert werden.
2) Da für Sachakten eine Frist von 30 Jahren gilt, könnte vielleicht eine interessante Sachakte publiziert werden.
3) Danke für den Hinweis auf den Verleser! Er wurde korrigiert.
4) Das Findbuch wird zu gegenbener Zeit erklärt werden.
Pingback: Heilstätte Hengsbach 14 | siwiarchiv.de
Die Fristen für die Personalakten sind tatsächlich deutlich länger als erwartet. Einerseits ist das sicherlich bedauerlich, aber andererseits beruhigt es mich ehrlich gesagt auch etwas.
Ich bin zwar in Sachen Datenschutz nicht gerade übervorsichtig, aber ich fände es doch etwas unschön, wenn irgendwelche Unterlagen, die private mich betreffende Angelegenheiten enthalten, einfach veröffentlicht werden würden. Solange es nur fremde Leute zu Gesicht bekommen, wäre es mir noch egal; aber man wüsste ja nicht, ob es nicht zufällig jemand findet, der mich kennt, und das wäre mir unangenehm. Ist nicht so, dass ich großartige Geheimnisse hätte, aber ein bisschen Privatsphäre muss trotzdem sein.
Ich warte dann dann mal ab, was die zukünftigen Artikel bringen bezüglich des ominösen Findbuchs. ;-)
„Schwupp!“ Ja, es ist mit Ton. :-)
Ich hatte die beiden Videos zufällig vor ein paar Tagen bei YouTube gefunden und mich gewundert, warum sie nicht im Blog erwähnt werden. Nun ja, das hat sich ja jetzt aufgeklärt.
Interessant, bei der Arbeit sozusagen über die Schulter schauen zu können. Vielen Dank dafür!
Die Akten sehen doch „abwechslungsreicher“ aus, als ich angenommen hatte. Man sollte meinen, das so ein Stapel Papier eine eher homogene Angelegenheit ist, aber die Blätter haben teils unterschiedliche Formate und Farben (und dementsprechend wohl auch Inhalte).
Ich war allerdings zugegebenermaßen etwas überrascht von dem *Ratsch*, ich hatte irgendwie erwartet, dass man in einem Archiv die Unterlagen sozuagen mit Samthandschuhen anfasst. Aber die Hefter werden ja ohnehin entsorgt, da spielt das natürlich keine Rolle, und man will ja auch vorankommen.
Schlaue Idee, das vordere Deckblatt der Hefter mitzuheften, sodass man gleich erkennen kann, wo die nächste Akte losgeht und was der Titel ist.
Die „Ausbeute“ war ja eher gering (im ersten Film eine Büroklammer und eine Heftklammer und im zweiten Film gar nichts), aber ich schätze, wenn es mehr wird, verflucht man irgendwann den Erfinder der Heftklammer? ;-) (So schnell würde ich es übrigens nicht schaffen, eine Heftklammer aus dem Papier zu bekommen. Sicherlich eine Frage der Übung.)
PS: Irre ich mich, oder ist der Hefter im zweiten Film „anders herum“ als der im ersten (Behördenheftung/kaufmännische Heftung)? Da würde ich vermutlich schon ziemlich durcheinanderkommen.
Die Filme waren zur „Überbrückung“ der Osterferien im Blog vorgesehen, daher zunächst die Publikation auf youtube. ;-)
Dies erklärt auch, warum die Metallausbeute so gering war. Es ist durchaus üblich, dass Akten mehr Metall enthalten: s. http://archiv.twoday.net/stories/6006919/ . Auszubildende der allgemeinen Verwaltung, die ein Praktikum beim Kreisarchiv machen, dürfen i. d. R. einen Tag lang entmetallisieren – in der Hoffnung auf einen späteren bewußteren Umgang mit Büro- und Heftklammer.
Welches Ablagesystem jeweils verwendet wurde, spielt beim „Umbetten“ keine Rolle. Wir nehmen, wie es kommt und dokumentieren so die Arbeitsweise der jeweiligen Stelle.
1) Das auch für Kommunalarchive maßgebliche Archivgesetz des Landes NRW können Sie hier einsehen.
2) Eine knappe Findbuch-Definition finden Sie bei Wikipedia.
Seit nunmehr drei Jahren befasse ich mich mit der Deutschen Friedensgesellschaft, Bezirk Sieg-Lahn-Dill. Da ich nun zu Ende komme, begegnet mir auch Frau Hedwig Finger. Dazu der Hinweis, auf S. 4 steht irrtümlich Hedwig „Zimmer“.
Das unter Anmerkung 32 von Dr. Opfermann aufgeführte Mitgliederverzeichnis (Nachlass meines Vaters) ist nicht aus den Jahren 1963/64. Es ist aus den ersten Nachkriegsjahren, denn es enthält einen großen Teil der Mitglieder, die bereits vor 1933 Mitglied der DFG waren. Auch der Hinweis: Karl Ley, Freusburg, spricht dafür. Ley war bis 1950 „Herbergsvater“ auf der Freusburg. In dem Mitgliederverzeichnis von 1961 der DFG Siegen (NL W. Fries) ist der Name Hedwig Finger nicht mehr enthalten. Es sind immerhin noch 24 Namen enthalten. Mir liegt das Rundschreiben Nr. 3 der Aktionsgruppe Siegerland der Notgemeinschaft für den Frieden Europas v.. 31.7.1952 vor. (Das ist die von Dr. Dr. Gustav Heinemann 1950 gegründete Gruppe.) Dazu gibt es die Einladung gleichen Datums für die öffentliche Versammlung am 5.8.1952 im Kaisergarten. Frau Hedwig Finger, Landtagsabgeordnete, war mit dem Thema: „Die Wiederaufrüstung und die Frau“ vorgesehen. Der Student Dieter Zitzlaff wollte die Frage: „Ist die heutige Jugend unpolitisch?“ beantworten. Es darf also nicht heißen „Später trat sie der DFG bei.“ Vermutlich trag Hedwig Finger der im Frühjahr 1946 wieder gegründeten Ortsgruppe Siegen der DFG bei. (Es existiert ein Artikel vom 10. Mai 1946, vermutlich der „Feiheit“. Ein Datum der Versammlung ist nicht angegeben. Die Versammlung könnte schon im März stattgefunden haben. da in einer Resolution dem Präsidenten der DFG, Freiherr von Schoenaich, Gruß und Glückwünsche zum 80. Geburtstag (16.2.1946) übermittelt wurden.
Vielen Dank für die Berichtigungen!
Pingback: Lothar Irle zur Vermittlung von “Rassen- und Familienkunde” im III. Reich | siwiarchiv.de
Siehe auch den „Bericht über die 1. Schulungswoche …“ in:
Die Mittelschule 47 (1933), S. 591-594; als elektronische Ressource (Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung Berlin) unter http://goobiweb.bbf.dipf.de/viewer/resolver?identifier=BBF0753504&field=ALLEGROID
P.K.
Ach, das ist Ländersache?
Dann schaue ich lieber bei Niedersachsen: http://www.tu-chemnitz.de/uni-archiv/info/gesetze/archgesetze/archgnieders.pdf
Die Fristen sind aber anscheinend die gleichen.
Baden-Württemberg dürfte auch noch Papierkram über mich haben: http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~n31/benutzer/archbw_dt.htm
Wiederum die gleichen Fristen, außer, dass es bei Personalakten, wenn das Todesdatum nicht bekannt ist, 90 statt 100 Jahre sind.
Ich kann also beruhigt sein, es scheint in ganz Deutschland vergleichbare Fristen zu geben.
Ja, die Fristen der Länder sind recht einheitlich. Allerdings muss ich noch auf das Bundesarchiv hinweisen; dort gelten sogar noch längere Fristen: § 5 (2) Bundesarchivgesetz.
Ach so, ich dachte, ein Archiv würde die Akten ggf. neu ordnen für eine einheitliche chronologische Ordnung.
Was die Heftklammern angeht: Falls ich jemals beruflich irgendwo landen, wo potentiell archivwürdige Akten erstellt werden (halte ich für unwahrscheinlich, ist aber bisher nicht auszuschließen), verspreche ich, damit sparsam umzugehen. ;-)
Siegener Zeitung berichtet in ihrer heutigen Printausgabe über Kürzung der Mittel für Denkmäler in NRW und verweist auf die Online-Petition. Als regionale Bespiele werden der „Alten Flecken“ in Freudenberg und die eisenzeitliche Montanregion Siegerland mit ihren jüngsten Funden in Siegen-Niederschelden erwähnt
Ürks! Sind das „nur“ Feuchtigkeit und Dreck oder schon Schimmel? Wie passiert sowas überhaupt?
Jedenfalls hat man es ja wieder sehr gut hinbekommen!
Glücklicherweise handelte es sich nur um Feuchtigkeit und Schmutz, die bei Bauarbeiten an das Archivgut gelangt sind. Schimmel hätte noch eine aufwändige Dekontaminierung nach sich gezogen.
Ich bin immer wieder über die Arbeitsergebnisse der Restauratorinnen und Restauratoren erstaunt. Der Dank gilt der Werkstatt des LWL-Archivamtes. Soviel Werbung darf sein!
Der Siegener Landtagsabgeordnete Jens Kamieth hat sich auf Anfrage zum Ende der Förderung der Denkmalpflege in NRW geäußert: http://www.abgeordnetenwatch.de/frage-928-50114–f375389.html#q375389
kleine Ergänzung:
a) 100%igen Alkohol gab und gibt es nicht.
b) in der äußeren Medizin wird vergällter (nicht unvergällter!) Alkohol, der nicht trinkbar ist, verwendet.
c) unvergällter Alkohol (Weingeist), der genießbar ist, fällt unter die sog. Branntweinsteuer.
Pingback: Heilstätte Hengsbach 15 | siwiarchiv.de
Ergänzend zu meinem Vorredner möchte ich anmerken, dass „vergällter Alkohol“ nicht bedeutet, dass der Alkohol verdünnt ist, sondern dass ein Stoff (Vergällungsmittel ) zugesetzt wurde, um ihn ungenießbar zu machen, wodurch er nicht mehr unter die Steuerpflicht fällt, da er nicht mehr trinkbar ist.
http://de.wikipedia.org/wiki/Verg%C3%A4llung
Pingback: Heilstätte Hengsbach 16 | siwiarchiv.de
@stefan kummer, @T.M. Vielen Dank für die Hinweise!
Pingback: Fotorätsel: Bauten mit regionalem Bezug 1a | siwiarchiv.de
Sehr geehrter Herr Dick, wir besitzen von Hermann Manskopf ein Bild in Spachteltechnik : Siegen-Unterstadt mit Martinikirche und dem Bau der Siegbrücke. Der Dicke Turm hat noch einen geraden Abschluß, also ohne Haube/Glockenspiel. Da es sich um ein Geschenk handelt, haben wir keine Idee was den Wert des Bildes angeht. Kennen Sie Bewerter von Manskopfbildern?
Sehr geehrte Frau Schmitz,
Ich habe heute diesen Beitrag von Ihnen gelesen. Ich habe an Kunstwerken von Siegerländer Maler. Sollten Sie Interesse haben ihr Bild zu verkaufen würde ich mich freuen wenn sie mit mir Kontakt aufnehmen.
Besten Dank.
Maria Ihne
Pingback: Vortrag: “Mozart und mehr: Fritz Busch und Glyndebourne” | siwiarchiv.de
Pingback: Vortrag: “Mozart und mehr: Fritz Busch und Glyndebourne” | siwiarchiv.de
Pingback: Vortrag zu Becher-Häusern | siwiarchiv.de
Pingback: Heilstätte Hengsbach 17 | siwiarchiv.de
Pingback: Rückblick: Arbeitskreissitzung “Historische Wege” | siwiarchiv.de
Oh toll, endlich wieder einen kleinen Einblick in die Heilstättenangelegenheiten. :-)
An „Korrekturen und Ergänzungen“ würde ich mich eventuell versuchen (ohne Erfolgsgarantie, die alte Handschrift ist mir immer noch recht ungewohnt), allerdings ist bisher nur die letzte Seite der Rechnung veröffentlicht (dafür allerdings gleich drei mal).
Die Bücher bleiben aber an einem Stück, nehme ich an? Oder werden die etwa ähnlich „ratsch“ zerlegt und neu zusammengeheftet, wie die Akten?
Nein, die Bücher werden nicht umgebettet. Eine restauratorische, buchbinderische Bearbeitung der Bücher ist nur dann angezeigt, wenn z. B. die Heftung der Blätter mit Metallteilen erfolgt ist, oder die Bindung sich löst. Diesmal also kein „Ratsch“.
Das freut mich zu hören. Es wäre irgendwie schade um die Bücher, wenn man sie in Einzelseiten zerlegen würde. So wirken sie doch um einiges originalgetreuer.
Betr. S. Vogt——- Werter Herr oder Dame, bin auch hobbymässig kunstinteressiert, habe vor ca. 20 Jahren in der Tschechei (Liberec/ Reichenberg) bei privaten Leuten (keine Kunstsammler¨) zufälligerweise ein Gemälde gesehen, es war signiert mit S. Vogt! Ein wunderbar gemaltes grosses Gemälde, Landleben auf dem Felde, es hat mich sofort fasziniert, grossartiger Künstler! Grösse vielleicht 1,5 m x 1,2 m, in starkem Goldrahmen gefasst! Ich wollte es damals auch kaufen, vielleicht für 1 oder 2 tausend DM, hatte aber damals nicht das richtige Fahrzeug um es in die Schweiz zu transportieren und der Zoll hat mich damals auch abgeschreckt!!! Habe aber damals Fotos gemacht, falls es sie interessiert schicke ich diese per E-mail oder per Post, gratis und franko selbstverständlich! Wo diese Leute resp. Gemälde jetzt ist, – weiss ich nicht, habe keinen Kontakt mehr! Leider! Hoffe Ihr Interesse geweckt zu haben!Also, auf bald! H. Beyeler
Ein SUPER Bildband, die Bilder sind einsame Spitze und die Texte von Dr. Lückel sind von einem echten Kenner geschrieben, ein TOLLES Geschenk für alle, die Wittgenstein lieben oder KENNENLERNEN WOLLEN – nur klasse, dieses Buch!!!! *****
Pingback: “Paula Fechenbach und Robert Jagusch” – | siwiarchiv.de
Aller möglichen Persönlichkeiten wird bei uns hier im Siegerland gedacht — und ich habe auch nichts dagegen!
Aber immer wieder muß man erfahren, daß unser Stilling zuhause in seiner Heimat ein Unbekannter geworden ist. Leider!
Wäre da nicht das Krankenhaus und verschiedene Straßen nach ihm benannt, so wäre sicher auch der Namen heute so gut wie ganz vergessen.
Um so erfeulicher finde ich es, daß die Ev. Studierendengemeinde einem ausgewiesenen Kenner von Jung-Stilling Gelegenheit gibt, unseren Landsmann jungen Akademikern vorzustellen.
Weitere Vorträge dieser Art in heimischen Vereinen könnten dazu führen, daß auch die weltweit bekannte „Lebensgeschichte“ wieder gelesen wird.
Pingback: Vitrinenausstellung zur “Siegplatte” im Stadtarchiv | siwiarchiv.de
Pingback: Vor 15 Jahren: Siegfried Vogt gestorben | siwiarchiv.de
Als Zeithistoriker war mir bislang nur der VDA bekannt, der schwer rechtslastige „Verband für das Deutschtum im Ausland“, nach dem NS-Ende einige Jahre verboten, vor einigen Jahren endlich doch wenigestens umbenannt.
Nun erfahre ich von einem Zusammenschluss mit ebenfalls diesem Kürzel, aber kleinem „d“, der sich auch noch dagegen zur Wehr setzt, dass mit dem Vorwand „facebuch“ die flächendeckend komplette, für die Historiografie (und die kritischen Mmedien) unverzichtbare Datenbestände vernichtet werden sollen. Ich lese ja noch regelmäßig die Zeitung, davon hatte ich aber noch gar nichts erfahren. Jedenfalls dankeschön an die aufmerksamen Archivare vom VdA!
Lieber Herr Beyerle, wenn es Ihnen nichts ausmacht…ich hätte sehr grosses Interesse an Ihren Fotos…es wäre sehr interessant, ein Bild zu sehen, das dem unnützen Inferno von Dresden entging…Danke…Herzliche Grüsse
Lieber Gerd, habe die Fotos Herrn Wolf geschickt! Seid bitte nicht enttäuscht, die Fotos sind extrem schlecht, mit einer alten Sofortbildkamera gemacht im Jahr 1995, damals gabs leider noch keine Cam’s, oder jedenfalls nhatte ich noch keine! – Viel besser wäre es – wenn wir das Gemälde nach Deutschland holen würden, der grossartige Maler S.Vogt hätte es alleweil verdient, vielleicht hängt er ja noch da! Wenn Du Lust hast – melde Dich bei mir! Grüsse aus der Schweiz!
I like the specialy for International Archives Day 2013 designed grey working coat ;-)
Viele Grüssen, Anneke
Dear Anneke,
sadly google doesn´t use the portrait format. Best regards Thomas
Pingback: Siegfried Vogt und siwiarchiv | siwiarchiv.de
Die Literaturliste zu Siegrfried Vogt muss um folgenden Ausstellungskatalog ergänzt werden:

Sächsischer Kunstverein Dresden: Kunstausstellung Gau Sachsen Brühlsche Terasse 13.Juni bis 22.August 1943, Dresden 1943
Pingback: Vortrag “Lothar Irle und seine Verstrickungen mit dem Dritten Reich” | siwiarchiv.de
Pingback: Vortrag “Lothar Irle und seine Verstrickungen mit dem Dritten Reich” | siwiarchiv.de
im Familienbesitz befindet sich noch ein Teil des Bilderzyklus: Krieg und Gefangenschaft, bestehend aus Aquarellen, Bleistiftzeichnungen und Ölskizzen. Für Interessierte könnte ich den Teil, zu dem ich Zugang habe, ins „net“ stellen. Falls Ihr daran interssiert seid, meldet Euch bitte kurz.
Von meiner Seite besteht großes Interesse! Ein Link in den Kommentaren wäre nett. Vielen Dank vorab!
Tur mir leid, ich habe die Nachricht erst jetzt gelesen.
Aus beruflichen Gründen kann ich mich erst um den Jahreswechsel 2013/14 der Sache annehmen.
Würde gern dann auch Kontakt aufnehmen.
Ein Vortrag mit salopp formuliert „steilen Thesen“. Denn viele Fragen bleiben.
Wie wichtig ist die Mentalität für Bauprojekte? Sind die vorhandenen Ressourcen (Finanzen, Baustoffe) nicht grundlegender?
Gibt es den Bautyp des Becherhauses nur in den ev. Gebieten des Siegerlandes? Wenn nein, überspringt die sicherlich calvinistisch geprägte Mentalität quasi die Religionszugehörigkeit?
Waren die Becherhäuser wirklich nur „Arbeiterhäuser“? Wenn es andere Bauherren gab, wie sind diese im Blick auf die These einzuordnen?
Wenn die verwendeten Baustoffe (Bims, Stahl) modern und erschwinglich waren und wenn die Becherhäuser Fertighäusern gleich produziert werden konnten, warum baute man in der Erscheinungsform so rückwartsgewandt, so antimodern?
Wurden andere calvinistisch geprägte Regionen Südwestfalens (z. B. märkisches Sauerland) als Vergleich herangezogen?
Pingback: Vortrag “Lothar Irle und seine Verstrickungen mit dem Dritten Reich” | siwiarchiv.de
Pingback: Vortrag “Lothar Irle und seine Verstrickungen mit dem Dritten Reich …. | siwiarchiv.de
„mittags von 15 Uhr bis 15 Uhr“ Klingt schaffbar. Ein allzu langer Mittagsschlaf ist da bei den Nachbarn aber nicht drin. ;-)
Ich hätte allerdings noch eine allgemeine Frage: Wie kommen die Unterlagen überhaupt ins Kreisarchiv? Die Heilstädte war wenn ich es richtig in Erinnerung habe als e.V. organisiert, unterstand also nicht direkt dem Kreis. Inwieweit ist das Kreisarchiv da überhaupt „zuständig“?
Sorry für den Verschreiber in der Hausordnung: die Mittagsruhe ging von 13 – 15 Uhr..
Und nun zur „Zuständigkeit“:
Richtig: die Heilstätte war als e.V. organisiert, dieser Verein lief unter Beteiligung des Landeswohhlfahrtverbandes, der Kreise Siegen, Olpe und Wittgenstein, des damaligen Amtes Eiserfeld und der damaligen Gemeinden Eiserfeld, Niederschelden, Gosenbach und Eisern; im Verwaltungsrat saß bspw. immer der Oberkreisdirektor Kuhbier.
Außerdem wurde nach der Auflösung des Vereins in 1967 der Verwaltungsrat Fischbach als Übergangsverwalter/ sog. „Liquidator“ eingesetzt; dieser saß beim Kreis.
Zitat aus einer Vereinbarung, ebenfalls zu finden in den Archivalien: „(…) Die Krankenakten der Anstalt werden mit deren Auflösung vom Landdkreis Siegen übernommen und dem Gesundheitsamt zur Verwaltung übergeben…“
via Mailing-Liste „Westfälische Geschichte“:
„Volkskundliches Museum Wilnsdorf feierte 20. Geburtstag
Der vergangene Sonntag im Museum Wilnsdorf war eine wahrlich runde Sache. Nicht nur, dass die volkskundliche Abteilung ihr 20jähriges Bestehen mit einem gelungenen Aktionstag feierte. Auch zu den Anfangstagen des Museums schloss sich ein Kreis. Denn wo am Sonntag 500 Besucher bestaunen konnten, wie zahlreiche Akteure historisches Handwerk wiederbelebten, waren Mitte der 1980er Jahre tatsächlich noch Handarbeit und Muskelkraft gefragt.
Was viele Besucher nicht wissen: Wo heute das Museum Wilnsdorf steht, war früher eine alte, ausgediente Industriehalle zu finden, in der bis 1985 produziert wurde. „Allerdings liegt der Fokus des Volkskundlichen Museums ein bisschen weiter in der Vergangenheit“, erzählt Museumsleiterin Dr. Corinna Nauck bei einem gemeinsamen Rundgang mit Wilnsdorfs Bürgermeisterin Christa Schuppler. Dem Leben und Arbeiten zu Beginn des 19. Jahrhunderts im südlichen Siegerland hat sich das Haus verschrieben, die Idee dazu entstand in den 1980er Jahren, als für ein Festbuch anlässlich des 800jährigen Bestehens Wilnsdorfs umfangreiches Wissen zusammengetragen wurde. Wissen über die Geschichte des Wilnsdorfer Raumes, das nicht einfach verloren gehen sollte. Und so begannen nach den Jubiläums-Feierlichkeiten die Vorarbeiten für die Einrichtung eines Volkskundlichen Museums: nämlich Sammeln, Sichten und Sortieren.
Im Mai 1993 war es soweit, das Museum Wilnsdorf öffnete seine Türen. Hinter ihnen verbirgt sich noch heute ein Museum der besonderen Art. Die Exponate stehen hier nicht abgeschieden in Vitrinen, losgelöst von Zeit und Raum. Das Museum gleicht vielmehr einem Bilderbuch, ganze Szenen aus der Lebens- und Arbeitswelt vor 100 Jahren wurden nachgestellt: Eine komplette Schusterwerkstatt ist zu sehen (ein Original aus dem Nachlass einer Wilnsdorfer Familie), eine Schneiderei, ein Kaufmannsladen und vieles mehr. Besonders eindrucksvoll ist die Front eines Siegerländer Fachwerkhauses, um die sich die Kompositionen über zwei Etagen verteilen. „Wir legen sehr viel Wert auf Detailtreue, auf Authentizität“, betont Dr. Nauck. Und mit sichtlichem Stolz fügt sie hinzu: „Bisher haben wir dazu weder von Wissenschaftlern noch von Besuchern Kritik erfahren“.
Vielmehr erhält sie immer wieder die Bestätigung, dass gerade die lebendige Darstellung, die Fülle an Details das besondere Flair des Wilnsdorfer Museums ausmachen. Selbst für langjährige Besucher gibt es stets Neues zu entdecken. Ohne das gelungene Konzept zu ändern, fügt Corinna Nauck der Ausstellung neue Stücke hinzu oder tauscht ältere Exponate aus. Dabei kann die Museumsleiterin auf einen umfangreichen Fundus zurückgreifen: Im Magazin lagern so viele Dinge, dass die Ausstellung noch fünfmal bestückt werden könnte. Diesen Hort weiß übrigens auch die Kulturabteilung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe zu schätzen und fragt oft und gerne nach Leihgaben. „Aktuell haben wir historische Badeanzüge für eine Wanderausstellung zum Thema Camping zur Verfügung gestellt“, verrät Corinna Nauck.
Aber nicht nur in der Ausstellung hält das Volkskundliche Museum die Siegerländer Geschichte lebendig. Immer wieder werden bunte Feste und Aktionstage veranstaltet, die hautnah einen Blick in die Vergangenheit erlauben – so wie am vergangenen Sonntag. Im Museum und auf dem Hof waren Imker, Butterfrau, Haubergsvorstand, Schmied und viele andere aktiv. Bei letzterem ließ es sich auch Christa Schuppler nicht nehmen, kräftig anzupacken. Wilnsdorfs Bürgermeisterin ist überzeugt von der Lebendigkeit des Museums: „Die Ausstellung ist spannend zusammengestellt, und gerade für Kinder und Jugendliche gibt es viele Angebote, um das Museum auf eigene Faust erkunden zu können“. Aber auch für alle anderen ist das Museum mit seinen regelmäßigen Festen, Aktionstagen, Sonderausstellungen und kulturellen Veranstaltungen immer wieder einen Besuch wert.
Im Herbst wartet übrigens schon der nächste Geburtstag darauf, gebührend gefeiert zu werden: Im Oktober wird die Kulturgeschichtliche Abteilung des Museums zehn Jahre alt. Natürlich wird auch dieses Jubiläum wieder zum Anlass für einen besonderen Aktionstag genommen, zu dem das Museum am 3. Oktober einladen wird. Besucher erwartet dann eine spannende Reise durch die Zeit, von der Steinzeit über die römische Antike bis hin zum Mittelalter.“
Der Rat in Bad Laasphe wird am 17.6.2013 über eine Resolution gegen die Kürzung der NRW-Denkmalpflegemittel beraten: https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz630/sdnetrim/Lh0LgvGcu9To9Sm0Nl.HayEYv8Tq8Sj1Kg1HauCWqBZo5Ok4KfyJawHWt9Vs4Qr1QezKeyDWq8Sn6Rk1Lf0KjvFavETqASj1Mj0KaxJYr8Zm9UGJ/Anlage_zur_Beschlussvorlage_2009-2014-401.pdf
s. a. dazu: http://www.siegener-zeitung.de/a/690140
Pingback: “Gipfeltreffen in Sachen Lothar Irle” | siwiarchiv.de
Wie kann es sein, dass noch Strassen nach diesem Mann benannt sind? Das ist mir unbegreiflich.
s. dazu: Steffen Schwab „Straßenschild für Unbelehrbaren. Erneute Kontroverse um Nazi-Funktionär und Heimatforscher Lothar Irle“, in: Westfälische Rundschau v. 15. Juni 2013:
„….. „Es wäre nicht das Schlechteste, ihn einfach verschwinden zulassen“, empfiehlt Dr. Elkar zum Umgang mit dem Heimatforscher, der sich nie von seiner NS-Vergangenheit distanzierte – wenn es denn nicht Menschen gäbe, die ihn stets aufs Neue verehrend würdigten. Für den aus seiner Sicht unwahrscheinlichen Fall einer Straßenumbenennung hatte Dr. Elkar zwei Vorschläge „Blaukehlchenweg“ für die vom Aussterben bedrohte Vogelart. „Oder einfach die Eisenhüttenstraße ein wenig länger machen.“ ….“
Wilhelm Güthling in: Torsten Musial: Staatsarchive im Dritten Reich: zur Geschichte des staatlichen Archivwesens in Deutschland, 1933-1945, Berlin 1996, S. 150,. 153, 154, 194. Die Quintessenz der Belegstellen findet sich in der auf S. 192 beginnenden Zusammenstellung der in den besetzten Gebieten eingesetzten Archivare:
Belgien, Nordfrankreich:
Güthling, Wilhelm (Reichsarchiv Potsdam): Okt. 1941 bis 13. Jan. 1942
Paris:
Güthling, Wilhelm (Reichsarchiv Potsdam): 7. Okt. 1940 bis 5. Okt. 1941
Pingback: Ausstellung “40 Jahre Frauen an der Universität Siegen – Die ersten Schritte auf dem Weg zur Chancengleichheit” | siwiarchiv.de
Pingback: Ausstellung “40 Jahre Frauen an der Universität Siegen – Die ersten Schritte auf dem Weg zur Chancengleichheit” | siwiarchiv.de
Pingback: Lothar Irle, das “Siegerland und Westfalen” | siwiarchiv.de
Pingback: Lothar Irle, das “Siegerland und Westfalen” | siwiarchiv.de
Pingback: Lothar Irle, das “Siegerland und Westfalen” | siwiarchiv.de
Pingback: Literaturhinweis: Dayanita Singh “File Room” | siwiarchiv.de
Pingback: Adenauer – Vater des Siegerlandkolleg | siwiarchiv.de
Hier die Verlegeorte und Inschriften der Stolpersteine (auf ein Symbol klicken) auf einer OpenStreetMap-Karte
http://www.netzwolf.info/kartografie/osm/stolpersteine?zoom=13&lat=50.98778&lon=8.0091&layers=B0T
Vielen Dank für diesen Hinweis! Werden noch weitere Stolpersteine eingearbeitet?
Und von da landeten die Akten dann irgendwann im Kreisarchiv? Klingt logisch.
Danke für die Antwort! :-)
Pingback: Ausstellung “40 Jahre Frauen an der Universität Siegen – Die ersten Schritte auf dem Weg zur Chancengleichheit” | siwiarchiv.de
Danke für den interessanten Artikel!
Das wäre wohl einer der Gründe, warum das wohl kein Job für mich wäre, auch wenn ich Archive recht interessant finde. Es fiele mir wohl zu schwer, Unterlagen zu entsorgen, ich hätte immer Angst, dass irgendwas dabei ist, wo sich später herausstellen könnte, dass es interessant oder wichtig ist. Da wäre das Archiv schnell voll. ;-)
Aber ist die große abgeschlossene Tonne nicht ein bisschen „overkill“? Datenschutz ist natürlich wichtig, aber es sind ja keine Staatsgeheimnisse, die darin entsorgt werden, sodass wohl eher nicht befürchtet werden muss, dass sich da jemand unberechtigterweise ein paar alte Rechnungen draus klaut. Selbst in Krankenhäusern, wo man ja durchaus mit sensiblen Patientendaten zu tun hat, habe ich bisher für solche Zwecke bestenfalls einfache Pappkartons mit passender Beschriftung gesehen.
1) Ja, die Bewertung von Archivgut ist die „Königsdisziplin“ des Archivierens, deren Ziel die möglichst dichte Überlieferung aller kommunaler Lebenswelten ist.
2) Die Tonne ist tatsächlich etwas „too much“, denn weder besonders schützenswerte personenbezogene Unterlagen, noch Unterlagen die noch einem Betriebsgeheimnis unterliegen wurden wohl vernichtet; so sprach für die Vernichtung in dieser Tonne: sie befindet sich im Gebäude des Kreisarchivs und stellt für alle enentuellen Fälle eine datenschutzkonforme Vernichtung dar.
Zu 1) Eine „Königsdisziplin“, bei deren Ausübung man aber auch nicht zu viel grübeln darf. Ist der Archivar phantasievoll genug, um zu jedem Blatt Papier ein potentiell mögliches Recherchethema zu imaginieren, für das gerade dieses Schriftstück unverzichtbar wäre, blockiert er sich selbst und kann ruhigen Gewissens überhaupt nichts kassieren. Wer würde seine Hand dafür ins Feuer legen wollen, dass nicht irgendwann ein Historiker und dank dessen Arbeit die Gesellschaft Nutzen aus den Einzelrechnungen über Obstlieferungen an die Heilstätte Hengsbach ziehen würde, die nun in der Mülltonne gelandet sind? Könnte nicht eine ganz unscheinbare Information auf einem dieser Belege gerade diesen künftigen Forscher – weil er sie mit anderen unscheinbaren Informationen in Verbindung bringen kann – zu unvorhersehbaren Fragen und Erkenntnissen führen – ein Zufallsfund mit weitreichenden Folgen? Wie viele Verbrechen blieben unaufgeklärt, wenn Kriminalisten nach dem Vorbild von Archivaren arbeiteten und bei der Spurensicherung nicht buchstäblich jede Faser eintüten sondern alles ignorieren würden, dessen Bedeutung für den Fall ihnen nicht auf der Stelle einleuchtete?
Archive sind keine idealen Rückzugsgebiete in dieser unvollkommenen Welt. Archivare lindern kein Elend und retten nicht die Menschheit. Wie jeder andere Zeitgenosse verzichten auch sie – vielleicht oder hoffentlich ein bißchen weitsichtiger – emsig auf den Erhalt von Informationen, und zwar insgesamt auf den überwiegenden Teil dessen, womit an den Schreibtischen dieser Welt Tag für Tag das geduldige Papier gefüllt wird. Für Archivare, die dem Wahn der prophetischen Unfehlbarkeit nicht erlegen sind, ist dies unbefriedigend, aber alternativlos. Deshalb kann die Arbeit in Archiven nur schicksalsergebenen und desillusionierten Menschen empfohlen werden.
(Übrigens nicht nur die Arbeit, sondern auch die Benutzung: Ein Archiv ist ein Konzentrat dieses irdischen Jammmertals, kein Schlaraffenland. Der Aspekt scheint mir bei all der archivpädagogischen Euphorie unserer Zeit übersehen zu werden.)
P.K.
„Ein Archiv ist ein Konzentrat dieses irdischen Jammmertals, kein Schlaraffenland.“ Sätze für die Ewigkeit – mit der Tastatur in Stein gemeißelt. Würde nicht der Autor selber einem radikalen Kassieren das Wort reden, man müsste den Kommentar allen Archiven dieser Welt zum ewigen Aufbewahren ins Stammbuch schreiben. Dank und nochmals Dank von einem
Schicksalsergebenen
Ehrenamtliche Archivtätigkeit ist eine reizvolle Aufgabe, von der schon viele kleinere Archive profitiert haben, wie hier das des Kirchenkreises Wittgenstein. Da Herr Burkardt noch nicht im Ruhestand ist und seinen Dienst weit ab von Wittgenstein verrichtet, würde mich interessieren, wieviel Freizeit er investiert, um diesen Spagat zu schaffen.
„Spagat“ trifft den Nagel auf den Kopf. Eine Wochenstundenzahl möchte ich für die Arbeit ungern angeben, das variiert, je nach Anfragenanfall. Im Schnitt rechne ich mit einem halben Tag Arbeit im Archiv pro Wochenende für die laufenden Verzeichnungsarbeiten. Dazu kommen Recherchen nach Bedarf. Entschädigung ist die Arbeit mit reizvollem Quellenmaterial zur Lokalgeschichte …
Danke für die offene Antwort. Und für die weitere Arbeit wünsche ich viele schöne Quellen als verdienten Lohn!
Pingback: siwiarchiv.de – Monatsstatistik Juni 2013 | siwiarchiv.de
„Umstrittener Beitrag in Festschrift
Das Siegerlandkolleg in Siegen wird im Internet gerade scharf kritisiert. An der Festschrift zum 50. Bestehen des Kollegs hat auch ein Mann mitgearbeitet, den der Staatsschutz der rechtsradikalen Szene zuschreibt und der für die NPD im Siegener Rat ist. Der Mann holt sein Abitur am Siegerlandkolleg nach. Das Siegerlandkolleg wollte den Mann nicht von der Mitarbeit an der Festschrift ausschließen. In der Schule oder im Unterricht sei er nie durch rechtsradikale Äußerungen aufgefallen.“
Quelle: WDR. Lokalzeit Siegen, Nachrichten v. 3.7.2013
„Weiter Ärger um Festschrift
Das Siegerlandkolleg bekommt wegen seiner Festschrift jetzt auch Kritik aus der Politik. Einen Artikel in der Festschrift zum 50. Bestehen des Kollegs hat der Siegener Sascha Maurer verfasst. Der Staatschutz rechnet ihn der rechtsradikalen Szene zu. Der Siegener Landrat Paul Breuer findet, dass das Siegerlandkolleg einen großen Fehler gemacht hat. Das Kolleg könne kein Interesse daran haben, mit Maurer in Verbindung gebracht zu werden, so Breuer. Sascha Maurer holt am Siegerlandkolleg derzeit sein Abitur nach.“
Quelle: WDR. Lokalzeit Siegen, Nachrichten v. 4.7.2013
Gemäß eines Fernseh-Beitrages in der heutigen WDR-Lokalzeit Südwestfalen wird die Festschrift ohne den Beitrag von Sascha Maurer erscheinen. Unter der Adresse http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit/lokalzeit-suedwestfalen/ ist die Lokalzeit nach Ausstrahlung noch sieben Tage im Internet abrufbar.
1) „Artikel von NPD-Ratsmitglied wird entfernt
Der Artikel des Siegener NPD-Ratsmitglieds Sascha Maurer wird nun doch aus der Festschrift zum 50-jährigen Bestehen des Siegerlandkollegs entfernt. Regierungspräsident Gerd Bollermann wolle nicht in der selben Festschrift auftauchen wie der bekannte Siegener Rechtsradikale, teilte die Bezirksregierung mit. Bollermann hatte ein Grußwort für die Festschrift verfasst. Die Mitarbeit von Maurer hatte im Internet und auch in der Politik für heftige Kritik gesorgt. Sascha Maurer hatte einen Artikel über das Einzugsgebiet des Kollegs in der Festschrift verfasst.“
Quelle: WDR, Lokalzeit Südwestfalen, Nachrichten v. 5.7.2013
2) „Neonazi steuert Beitrag hinzu
Siegerlandkolleg steht für Festschrift aktuell in der Kritik
Das Siegerlandkolleg in Weidenau steht aktuell für seine Festschrift zum 50. Geburtstag in der Kritik. Sie enthält einen Beitrag von Sascha Maurer. Er sitzt für die NPD im Siegener Rat und macht am Siegerlandkolleg sein Abitur nach. Der Beitrag über „Das Siegerlandkolleg in Tabellen, Grafiken und Karten“ ist nach Ansicht des Kollegs ein reiner Fachaufsatz und keine politische Abhandlung. Außerdem ist Maurer noch nie durch rechtsradikale Aussagen in der Schule aufgefallen. Deshalb gilt auch für ihn der Gleichbehandlungsgrundsatz. Durch Druck von außen soll der Beitrag jetzt allerdings aus der Festschrift rausgenommen werden. “
Quelle: Radio Siegen, Nachrichten v. 5.7.2013
3) „… Die Arbeit in der Festschrift beschäftigt sich mit der geografischen Darstellung des Einzugsgebietes des Siegerland-Kollegs. Sie ist aufgeführt im dritten Kapitel und beschreibt mit einem weiteren Text eines anderen Autoren „Das Siegerland-Kolleg in Tabellen, Grafiken und Karten“.
„Das ist ein reiner Fachaufsatz“, sagt der Kollegleiter Alfons Quast, „keine politische Abhandlung. Der 14-seitige Text mit Grafiken und Tabellen ist das Ergebnis eines sogenannten freiwilligen Projektkurses. Die Schüler arbeiten selbstständig ein Jahr lang an einem bestimmten Thema und präsentieren. Viele nutzen das als Vorbereitung für das Studium“, erläutert Alfons Quast.
Grundsätzlich gelte an der Schule der „Gleichbehandlungsgrundsatz“, so Quast weiter. Mauerer habe ihm zudem zugesichert, „die ungeteilte Würde aller Menschen“ zu achten. …..“
Jens Plaum „NPD-Politiker schreibt Text für das Siegerland-Kolleg. Sascha Maurers Arbeit in der Festschrift zum 50-jährigen“, in: Westfälische Rundschau, Print v. 5.7.2013
Pingback: Neues DSchG in NRW auf der Zielgeraden, Streichung vom Tisch? und weiter… | MinusEinsEbene
Ist das wieder eines dieser Rätsel, die uns von der Arbeit abhalten und am Ende nie aufgelöst werden? Na gut, dann rate ich mal: Es sind Prüfungsarbeiten von Absolventen des Hilchenbacher Lehrerseminars (andere mußten zum Abschluß Herbarien anlegen), aus den frühen 1920er Jahren (also Generation Lothar Irle), wobei die Blätter von den berühmten Palmen im Park des Stifts Keppel stammen. Wenigstens einen Trostpreis habe ich mir damit verdient!
Lieber Kollege, was soll man denn ernsthaft dazu sagen, wenn Sie zwar um Informationen bitten, aber selbst keine herausrücken wollen? Wie kommt das Kreisarchiv SiWi zu so etwas? Sind die überhaupt authentisch, d.h. „frühe Neuzeit“, keine modernen Nachahmungen orientbegeisterter Kunstgewerbler? Was ist Ihnen schon bekannt und was erwarten Sie? Wollen Sie von der Menschheit wissen, wie Sie im Archiv mit den Schätzchen umgehen sollen? (Siehe dazu z.B. „Eine Methode, Palmblattmanuskripte zu restaurieren und konservieren“ von 1975, http://www.iada-home.org/ta75_105.pdf ) Die Schrift ist anscheinend singhalesisch; es läßt sich also wild spekulieren, dass die Manuskripte während der Zugehörigkeit Siegens zu Oranien aus der damaligen niederländischen Besitzung Ceylon irgendwie hierher gelangt waren. Nur bringt das niemanden weiter. Fragen Sie doch einfach mal gezielt bei ausgewiesenen Experten nach. Als nächstliegender Anlaufpunkt bietet sich das Südasien-Institut der Uni Heidelberg an.
P.K.
Lieber Kollege Kunzmann,
nein, keine Hintergedanken! Gerade einmal Vermutungen, um welche Sprache es sich handelt. Diese 3 Stück wurde mir gestern von einem Nutzer des Archivs übergeben mit dem Hinweis, dass ich einmal sehen solle, worum es handelt. Dies wollte ich nicht alleine machen …..
Danke für den Hinweis zur Restaurierung der Stücke!
Gruß den Hügel hinauf!
T.W.
Weit gefehlt, Kollege Kunzmann! Die Generation Irle verschmähte Palmblätter als Beschreibstoff, von Dr. I. sind lediglich Runenmanuskripte auf herkömmlichem Eichenlaub überliefert.
Die hier vorliegenden Palmblätter stammen dagegen aus dem Kreisarchivbestand „Korrespondenzen des Landrats“. Heraldische und ikonografische Elemente weisen eindeutig auf den Maharadscha von Eschnapur als Verfasser hin. Der empörten Diktion des im seltenen ostsinghalesischen Dialekt verfassten Schreibens nach zu urteilen, handelt es sich ganz offensichtlich um die Antwort auf eine landrätliche Anfrage nach Überlassung einer Herde indischer Elefanten, die als Mammuts am Rothaarsteig angesiedelt werden sollten. Damaliger Projektleiter war ein gewisser Fritz Lang. Die Wisente sind demnach allerhöchstens zweite Wahl – und sehr wahrscheinlich Wittgensteiner Kühe im Wisentgewand.
Reicht doch für den Trostpreis.
Und einen schönen Sommer noch.
Ruhm und Ehre unserem Stadtarchivar! Bei nochmaligem Betrachten des Palmblattes Nr. 2 (das mit dem niedlichen Elefanten) fiel es auch mir wie Schuppen von den Haaren.
Des Maharadschas Empörung läßt sich gut nachvollziehen. Eine Elefantenherde im Tausch gegen ein paar heilige Siegerländer Kühe? Welch ein Affront! Jedoch muß das Geschäft am Ende trotzdem zustande gekommen sein, denn der vierköpfigen Eli-Herde wurde im Siegerland ein würdiges Denkmal errichtet: Es steht in Langenholdinghausen, an der Straße nach Meiswinkel, direkt vor der Steinmetzwerkstatt. Die heute unter einem anderen Namen florierende örtliche Wein- und Bierstube (mir nicht unbekannt) hieß seinerzeit „Zum Rüssel“, weil die tierischen Dickhäuter (und auch schon der eine oder andere menschliche) dort getränkt wurden, nachdem sie ihr Tageswerk im Hauberg vollbracht hatten. Nach ausgiebiger Zecherei suchten unsere Freunde eines Abends das nahegelegene Dorf Holzklau (jenseits der Grenze zum Freudenberger Hoheitsgebiet) heim und vergnügten sich dort so übermütig, dass die Einwohner in alle möglichen, d.h. zwei, Richtungen entflohen. So kam es zur Gründung der Orte Ober- bzw. Niederholzklau, während an die ursprüngliche Siedlung dazwischen heute nichts mehr erinnert außer einem rudimentären Bestand „Gemeinde [Mittel-]Holzklau“ im Stadtarchiv Freudenberg. Auch das im Besitz des Haubergsvorstehers befindliche letzte bekannte Exemplar des anonymen Traktats „Anweisung zum Holzdiebstahl oder: Wozu Bäume umständlich züchten, wenn es auch anders geht? Eine Erwiderung an Herrn von Carlowitz. Von einem wahren Siegerländer Patrioten. Herborn 1714“ wurde ein Opfer der Trampeltiere. Recht getan!
Pingback: Hans-Carl von Carlowitzs „Sylvicultura Oeconomica“ in Wittgensteiner Schlossbibliotheken | siwiarchiv.de
Um dem höheren Blödeln hier noch weitere Nahrung zu geben: gehörte Siegens berühmtester Fürst Johann Moritz nicht zu den Trägern des Elefantenordens(s. Alfred Lück: Das Haus Nassau-Siegen und der dänische Elefantenorden. In: Siegerland. Blätter des Siegerländer Heimatvereins e.V. Bd. 31 (1954), S. 65-66)?
Aber auch sachdienliche Hinweise werden weiter gerne angenommen.
Sieht mir nach Burmesisch aus: Schicken Sie das Ganze doch am besten an ein Südostasieninstitut, z.B. Passau
@Peter Kunzmann, @Jaganath: Ihren Hinweis, sich an ein Ostasieninstitut zu wenden, habe ich gerne aufgegriffen.
@Jaganath: Ich hatte auf Indisch bzw. Thailändisch getippt.
Niemand hat ein Ostasieninstitut vorgeschlagen. „Jaganath“: Südostasien (Burma = heute Mianmar); ich: Südasien (Ceylon = Sri Lanka). Dafür gibt es jeweils spezielle Institute. Falls Ihr Benutzer die Blätter im Urlaub auf dem Flohmarkt erworben hat, wird er sich vielleicht noch an das Land erinnern. (Manche Zeitgenossen machen es erfahrungsgemäß aber auch gern spannend: „Ich weiß zwar schon das meiste, aber mal sehen, ob der Archivar auch so schlau ist wie ich und selbst darauf kommt.“ Das motiviert enorm!)
P.K.
Beide genannten Institute sind eingeschaltet. Ich habe heute meinen Kopf ein wenig woanders, daher bitte ich um Entschuldigung.
Die Manuskripte stammen aus keinem Urlaubskauf, sondern wurden meinem Nutzer überlassen mit dem Hinweis bei der Schrift handele es sich um Hebräisch.
Aus Heidelberg kommt die Bestätigung, dass es sich um die birmanische Sprache handelt! Danke an Jaganath für den Hinweis und Danke an Dr. Gieselmann, Heidelberg, für die schnelle Reaktion!
„Stadt plant Archiv ohne Kunst- und Museumsbibliothek
Geschätzte Kosten sinken durch den Verzicht um 21,6 Millionen Euro
Der Rat hat die Stadtverwaltung beauftragt, den Neubau des Historischen Archivs am Eifelwall mit dem Rheinischen Bildarchiv, aber ohne die Kunst- und Museumsbibliothek (KMB) zu planen. Wenn diese Entwurfsplanung steht, muss der Rat noch über den Bau selbst entscheiden. Die geschätzten Kosten für das Gebäude belaufen sich auf etwa 76,3 Millionen Euro, 21,6 Millionen weniger als wenn die die Kunst- und Museumsbibliothek in den Bau integriert worden wäre. Der Rat beauftragte die Verwaltung, weitere Einsparpotenziale etwa durch den Verzicht auf eine Klimaanlage im Vortrags- und Ausstellungraum und eine Verkleinerung der Dienstbibliothek im Planungsprozess zu nutzen. Die Finanzierung des Neubaus erfolgt aus dem Wirtschafts- und Erfolgsplan der städtischen Gebäudewirtschaft.
In seinem Beschluss begrüßt der Rat das Angebot der Universität zu Köln, in Hinblick auf die Kunst- und Museumsbibliothek zusammenzuarbeiten. Er beauftragte die Stadtverwaltung, auf Basis des vom Rektorat der Universität zu Köln vorgelegten Angebots eine Rahmenvereinbarung zur wissenschaftlichen und administrativen Kooperation vorzubereiten. Die Zusammenarbeit soll das Leistungsangebot der KMB steigern und Synergieeffekte realisieren. Der Rat beauftragte die Stadtverwaltung weiterhin, die mit Unterstützung des Landes begonnene Initiative zur Zusammenarbeit von Universität und KMB fortzusetzen und weitere Kooperationspartner zu gewinnen.
Mit der Entscheidung für den Bau des Historischen Archivs ohne die Kunst- und Museumsbibliothek sind Umplanungen erforderlich, die mit einer zeitlichen Verzögerung von etwa sieben Monaten einhergehen. Die damit verbundenen Kosten können nach derzeitigerb Einschätzung durch die vorher angeführten Einsparpotenziale aufgefangen werden. Im Vergleich zu den eingesparten Kosten überwiegen die finanziellen Vorteile bei weitem.
Das vom Kanzler der Universität zu Köln übermittelte Kooperationsangebot gilt in allen Punkten bis auf die mögliche Beteiligung an den Betriebskosten auch für den Fall, dass die KMB nicht in den Neubau des Historischen Archivs zieht.
Stadt Köln – Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stefan Palm“
Pressemitteilung der Stadt Köln, 19.7.2013
Pingback: CDU-Landtagsfraktion zur Neuausrichtung der Denkmalförderung | siwiarchiv.de
Meine Frau und ich waren befreundet mit Ludwig Kirchhoff und haben einige Bilder von ihm.
Wir wären interessiert zu erfahren, wo Bilder von ihm ausgestellt werden.
Mit freundlichem Gruss
Heinz Werner
Eine ständige Ausstellung eines Bilder oder gar von Bildern Ludwig Kirchhoffs kann ich mir nur im Siegerlandmuseum vorstellen.
Habe auch einige Bilder von Ludwig Kirchhoff.
Wenn Sie diese sehen möchten können Sie mir eine Nachricht senden.
Hallo Heinz Werner,
wir haben von den Eltern ein Bild von Ludwig Kirchhoff geerbt. Dahlien. Auf Holz gemalt. Ölgemälde.
Können sie uns ein Signum von Kirchhoff zusenden, da wir nicht wisse, ob es der Ludwig Kirchhoff ist.
Vielen Dank.
Grüße aus Köln.
Christel Bülow
Hallo Heinz-Werner,
Ich habe ein mit Kirchhoff signiertes Ölgemälde auf Holz aus dem Jahr 1946 von meinen Eltern, die im Sauerland lebten, geerbt. Es stellt Hortensien in brauner Kugelvase dar. Ich würde gern die Signatur mit der von Ludwig Kirchhoff vergleichen. Können Sie mir weiter helfen?
Liebe Grüße aus Mainz
Margit Bode
Die Signatur des oben gezeigten Holzschnittes: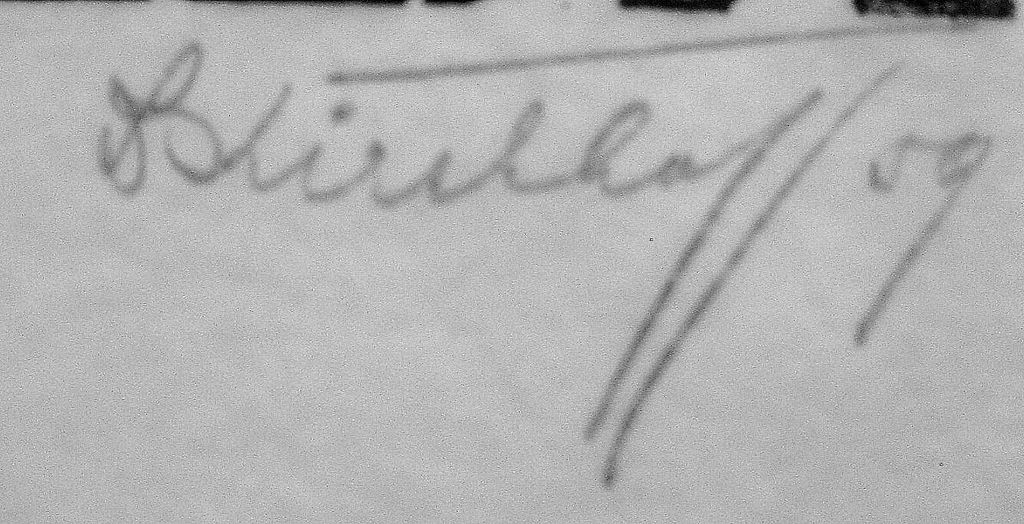
Danke für die Antwort. Die Signatur unter dem Holzschnitt entspricht in keiner Weise derjenigen auf meinem Gemälde. Die Signatur auf meinem Gemälde ist in geraden Druckbuchstaben gehalten. Mich würde die Signatur unter dem Dahliengemälde interessieren, da sie aus demselben Jahr stammt. Liebe Grüße aus Mainz Margit Bode
Pingback: Neues DSchG in NRW auf der Zielgeraden, Streichung vom Tisch? und weiter… | MinusEinsEbene
Insgesamt eine sehr aufschlussreiche Projektdokumentation mit der Findbuchveröffentlichung als Abschluss. Dazu möchte ich noch anmerken:
Bei schneller Durchicht scheint mir der für einzelne Klassifikationsgruppen vergebene Hinweis, die Sperrfrist laufe bis 1997, entbehrlich. Gleichzeitig dürften z.B. im Personalbereich viele Akten tatsächlich noch gesperrt sein, und das mit völlig unterschiedlichen Fristen.
Insofern ist es für die interessierte Öffentlichkeit sinnvoller, Sperrvermerke je Akte zu ermitteln oder durch einen pauschalen Hinweis auf im Einzelfall eingeschränkte Nutzung hinzuweisen.
Kleine Anregung: Vielelicht ist es sinnvoll, alle 32 Einträge des „Tagebuch einer Bestandsaufnahme“ irgendwie zu bündeln, damit dies für Praktiker schnell und umfassend greifbar ist.
Kollegiale Sommergrüße!
Pingback: Aufbruch in eine neue Zeit: | siwiarchiv.de
Stellungnahme des VdA zum Ratsbeschluss, 22. Juli 2013:
„Der Rat der Stadt Köln hat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause am 18. Juli 2013 mit den Stimmen von SPD, Grünen und Freien Wählern beschlossen, die Planungen für den Neubau des Historischen Archivs der Stadt Köln wieder aufzunehmen.
Nach dem aktuellen Ratsbeschluss sollen in den Neubau am Eifelwall nur das Stadtarchiv und das Rheinische Bildarchiv einziehen. Ursprünglich war geplant, die Kunst- und Museumsbibliothek im Gebäude zu integrieren und dieser bedeutenden Spezial- und Fachbibliothek eine neue Heimat zu geben.
In den vergangenen Wochen und Monaten setzten sich Fachgremien, Berufs- und Wissenschaftsverbände, Interessensgemeinschaften, Künstler- und Bürgerinitiativen aus dem In- und Ausland dafür ein, den im April 2013 verhängten Planungsstopp für den Neubau des Stadtarchivs und der Kunst- und Museumsbibliothek wieder aufzuheben. Die von Thomas Wolf (Siegen) initiierte Online-Petition fand in kurzer Zeit fast 9.000 Unterzeichner.
Der VdA ist zunächst erleichtert darüber, dass die Stadt Köln sich ihrer großen Verantwortung gegenüber dem Historischen Archiv bewusst ist und grundsätzlich zu der Entscheidung steht, einen Archivneubau am Eifelwall zu errichten. Der VdA bedauert allerdings sehr, dass die Politik nicht am Gesamtkonzept (Stadtarchiv + Rheinisches Bildarchiv + Kunst- und Museumsbibliothek) festhält.
Der VdA wird zusammen mit Fachgremien und Berufs- und Wissenschaftsverbänden die Fortschritte der Um- und Neubauplanungen sowie den Baufortschritt kritisch begleiten und sich ggf. erneut zu Wort melden.“
Link: http://www.vda.archiv.net/aktuelles/meldung/243.html
Pingback: Heilstätte Hengsbach 33 | siwiarchiv.de
Pingback: Heilstätte Hengsbach 33 | siwiarchiv.de
Pingback: Heilstätte Hengsbach 33 | siwiarchiv.de
Pingback: Heilstätte Hengsbach 33 | siwiarchiv.de
Pingback: Heilstätte Hengsbach 33 | siwiarchiv.de
Pingback: Heilstätte Hengsbach 33 | siwiarchiv.de
Pingback: Heilstätte Hengsbach 33 | siwiarchiv.de
Pingback: Heilstätte Hengsbach 33 | siwiarchiv.de
Pingback: Heilstätte Hengsbach 33 | siwiarchiv.de
Pingback: Heilstätte Hengsbach 33 | siwiarchiv.de
Pingback: Heilstätte Hengsbach 33 | siwiarchiv.de
Pingback: Heilstätte Hengsbach 33 | siwiarchiv.de
Pingback: Heilstätte Hengsbach 33 | siwiarchiv.de
Pingback: Heilstätte Hengsbach 33 | siwiarchiv.de
Da die Reihe nun anscheinend abgeschlossen ist, möchte ich nochmal sagen, dass es mich freut, dass ich auf diese Weise einen kleinen Einblick in die Arbeit eines Archivs bekommen konnte. Wenn man, wie ich und wie wohl die meisten Menschen, damit nicht selbst zu tun hat, weiß man vielleicht, dass es Archive gibt, aber nicht, was sie so genau tun. Ich denke, es ist wichtig, dass sowas auch öffentlich erklärt wird, damit auch Leute, die damit nicht zu tun haben, erfahren, was ein Archiv macht und wozu es wichtig ist (und warum es sinnvoll ist, dafür Steuergelder zu verwenden).
Die Idee ist super und ich habe es versucht und versucht, aber ich habe nichts zustande gebracht :-(
Pingback: “Die vergessene Sinti-Familie aus Eschenbach” auf youtube | siwiarchiv.de
Pingback: Kreisarchiv erhält Bücher zur Kreisgeschichte. | siwiarchiv.de
Sehr geehrte Damen und Herren !
Als ich den Speicher Aufgeräumt habe Entdeckte ich ein Illustrierte Frauen Zeitung von 1889 wo Bilder Abb,. von allen Bekannten Namen denn es in der Zeit gab.
Was kann ich damit Anfangen ?
Die Illustrierte Frauen Zeitung Ausgabe der Modewelt mit Unterhaltungsblatt.
Sechzehnter Jahrgang 1889 – 1890 Modenblatt Berlin,
Verlag von Franz Lipperheide in Berlin W.,Potstdamer Straße 38. Drug von Otto Dürr .Besitze ihn.
Eintritt in den Siegerländer Heimatverein im Jahre 1922
Mitgliedsnummer 2454
Wilhelm Schmidt, Bergmann, Obersdorf bei Eisern
Siegerland Band 6, 1. Heft, Mai 1924
Pingback: Friedrich „Fritz“ Wilhelm Müller – erster Siegerländer Reichstagsabgeordneter der NSDAP | siwiarchiv.de
Aus einer E-Mail des Stadtarchiv Lippstadt von heute: “ …. In dem betreffenden Verzeichnis [Anm.: Adressbuch] von 1940/41[!] ist ein Fritz Müller als Oberstfeldmeister, Geiststraße 47 aufgeführt, 1951 unter derselben Adresse als Wachmann. 1954 ist dort die Witwe Auguste Müller genannt, …“ Außerdem ein Sohn (?) und eine Tochter (?)
Weitere Veröffentlichungen von Wilhelm Schmidt:
De Gummizitt (Die Gummizeit)
Untertitel: Zor nationale Revolution 1933
Siegerländer Nationalzeitung (SNZ) vom 16.06.1933
Om Raerer Kirfich (Auf dem Rödgener Friedhof)
SNZ 30.03.1934
Ohser Goarel (Unserer Patentante)
SNZ 28.03.1934
Struthwalds Weiher
Beilage zur SNZ “ Volkstum und Heimat“ (Im Stadtarchiv Siegen nicht vollständig überliefert) 25.08.1934
Det Remmelche ( Der kleine Brunnen)
Volkstum und Heimat 10.11.1934
Dr Buhr om Kontor (Der Bauer im Kontor)
Volkstum und Heimat 26.01.1935
Eine Recherche in den weiteren Jahrgängen der SNZ steht noch aus.
Eintritt in die NSDAP:
Aufnahmeantrag gestellt am 17.03.1940
Aufnahme zum 01.04.1940
Mitgliedsnummer 7954924
Auskunft durch das Bundesarchiv Berlin vom 08.08.2013
Weitere Veröffentlichungen in der Siegerländer Nationalzeitung (SNZ)
Dr Aedde ah sin Jong (Der Vater an seinen Sohn)
SNZ 31.03.1934
Det Loehschealln (Das Lohschälen)
SNZ 17.05.1934
Neblung (dieses Gedicht heist später November)
SNZ 20.11.1933
Dr Aedde ah sin Jong (Der Vater an seinen Sohn, andere Fassung s.o.)
SNZ 26.07.1933
Dank an Torsten Thomas für die vielen Ergänzungen!
Mitte Juni 1933 veröffentlichte die Siegerländer National-Zeitung, Tageszeitung der regionalen NSDAP, von Wilhelm Schmidt ein politisches Gedicht „De Gummizitt. Zor nationale Revolution 1933“. Es stellte einen Abgesang auf die als verjudet beschriebene Weimarer Republik dar. Dem Weimarer „Gummivolk“ stellte Schmidt die Vertreter der neuen Ära, also die NSDAP und ihre deutschnationalen Bündnispartner, gegenüber, für die er sich entschieden habe („lewer doch die stracke Li“). Die repräsentierten den „deutschen Geist“. Undeutsches werde den „deutschen Menschen“ nun ausgetrieben werden.
Am 30. Juni 1933 kam es in Wilnsdorf zu Ausschreitungen durch SA-Angehörige. Sie richteten sich gegen den Schneidermeister Ferdinand Heupel. Er wurde mit Koppeln, Riemen und Stuhlbeinen von einer Gruppe zusammengeschlagen. Vier Wochen war er bettlägerig und trug bleibende Schäden davon. Eine zweite Gruppe wandte sich dem pensionierten Polizeibeamten Friedrich Ströhmann zu, prügelte ihn und hielt ihn im Amtshaus fest. Am 15. Juli fanden weitere Ausschreitungen durch SA-Angehörige im Amt Wilnsdorf statt.
Schmidt wird selbstverständlich über das Dorftelefon die Ausschreitungen mitbekommen haben. Er war ja ein aufmerksamer Beobachter der Heimat. Was er hörte, hielt ihn doch nicht vom weiteren Verfertigen ns-tauglicher Texte ab. In den folgenden Monaten entstand eine Verherrlichung Adolf Hitlers („Reichskanzler Adolf Hitler. Ehrenbirger vah Oeberschdorf“) . Mit diesem sei den Dorfbewohnern, soweit es sich bei ihnen um „Li … uß echtem, ditschem[so!] Holz“ handelte, ein sowohl „ditscher Mah voll Kraft on Geist“ als auch „änzjer Stern en Deutschlands Naecht“ erschienen. In Schmidts völkische Vorstellung von Deutschtum passte die Dorfnachbarin Hedwig Danielewicz, intellektuell, emanzipiert, konvertierte „Rassejüdin“, sicher nicht. Sie repräsentierte Schmidts „Gummivolk“.
Seine Zustimmung zum Regime noch einmal zu überdenken, bot sich dem „feinsinnigen Lyriker“ (so der NS-Multifunktionär, Heimatfreund und Dichterkollege Lothar Irle) in den folgenden Jahren zunehmend Gelegenheit. Die Einrichtung des KZ-Sytems, die Vertreibung und Enteignung der jüdischen Minderheit, dann die Pogrome im November 1938, die Agitation gegen „lebensunwertes Leben“ und der Einstieg in die Krankenmorde: dieser Radikalisierungsprozess fand nicht nur außerhalb, sondern natürlich auch innerhalb des Siegerländer Gebirgskessels statt, fand mediale Beachtung und wurde natürlich auch auf den Dörfern in seinen Einzelheiten kommuniziert.
Schmidt überdachte nicht, er festigte seine Haltung. Die nächsten bislang bekannten politischen Gedichte liegen aus dem Jahr des Überfalls auf Polen, des Kriegsbeginns also, vor. Wilhelm Schmidt übertrug die offizielle Propaganda in den Dialekt. Auf deutschem Boden („ditsche Ähr“) könne man weiterhin ruhig schlafen („Pionier off Mineposte“). Es werde zur Zeit eben „ahm Groeßditsche Reich“ gebaut. Dazu bedürfe es des Glaubens an den „ererwte Besetz ohser Ahle“, an „Heimat on Volk“ sowie an den Boden. Der diene nämlich sowohl als „Born“ wie auch als Bestimmungsort zu versenkender Wurzeln[so!], beste Mittel gegen den bösen „Fortschreattsgeist“ („Gedanke zom säjjerlänner Wärterboch“).
Schmidt kam unter dem Eindruck der Entwicklung nicht wie mancher andere zu vermehrter Distanz, er radikalisierte sich mit. Dafür steht seine Entscheidung zum Eintritt in die NSDAP 1940. Im Jahr darauf wurde Hedwig Danielewicz in die Vernichtung deportiert. Auch diese Nachricht erreichte Obersdorf.
„Ahgestammte Art“ und „Heimatähr“ – Blut und Boden – blieben durch die Zeiten Schmidts dichterische Grundlagen. Dass daran irgendetwas nicht gestimmt haben könnte, hat er zumindest öffentlich zu keinem Zeitpunkt verlauten lassen.
s. a. Hermann Engelbert: Hinterhüttsche Chronik, Kreuztal 1994, S. 423: “ …. Auch im Kreistag sind einige der „Herren“ [gemeint sind Nationalsozialisten, der Verf.] eingezogen. Sichtbar halten sie bei der Mitarbeit auf „gute Form“. ….“ [Eintrag für das Jahr 1932]
Pingback: Eine Tourismusbroschüre aus den 50er Jahren | siwiarchiv.de
Pingback: Broschüre zu Stadtrundgängen und -rundfahrten | siwiarchiv.de
„ …. Unsere Siegerländer Muttersprache ist bei den braunen Häuptlingen verpönt, man sieht darin separatistische Bestrebungen und schließt sie in der öffentlichen Arbeit aus. Die Siegener Zeitung hat ein ganz anderes Gesicht bekommen und ist längst nicht mehr die alte Heimatzeitung. ….“ [Aus: Hermann Engelbert: Hinterhüttsche Chronik, Kreuztal 1994, S. 450 [Eintrag für das Jahr 1943]
Diese tagebuchartige Notiz des sozialdemokratisches Lehrers aus Kreuztal lässt mindestens zwei Deutungen. Die naheliegendste, eine offizielles Verbot von Mundartdichtung in der Siegerländer Presse, bedarf zwar noch der Prüfung, aber für das benachbarte Sauerland, das ebenfalls einige Mundartdichtern und -dichterinnen beheimatete, lässt sich ein solches Verbot laut Auskunft des Mundartarchivs in Eslohe nicht nachweisen.
Oder es handelte sich lediglich um eine verlegerische oder redaktionelle Entscheidung der 1943 mit der nationalsozialistischen Siegerländer Nationalzeitung Siegener Zeitung, deren Hintergrund hier nur vermutet werden kann.
„Geheime Information“ Nr. 32/312 vom 26.7.1941, in: Verfügungen, Anordnungen, Bekanntgaben, hrsg. von der Partei-Kanzlei, Bd. 1, München 1942, S. 218:
„Es ist nicht erwünscht, daß Dialekte literaturfähig gemacht werden; u.a. sollen Wanderbühnen, die Theaterstücke in Mundart aufführen, nicht in Berlin auftreten. In der Presse darf höchstens ausnahmsweise einmal Dialekt in einer kleinen Ecke gebracht werden. Auch im Rundfunk wird streng hiernach verfahren werden.“
(Zitiert nach: Hanno Birken-Bertsch, Rechtschreibreform und Nationalsozialismus, Göttingen 2000, S. 78, Anm. 87.)
Von einem generellen Verbot des Mundartgebrauchs in der NS-Zeit kann jedoch nicht die Rede sein. Davon zeugen allein die vielen in den 1930er Jahren erschienenen deutschen Dialektwörterbücher (einschließlich des Siegerländer), deren Erarbeitung teilweise großzügig von der DFG gefördert wurde, oder auch die ca. 300 Schallplatten umfassende Sammlung „Lautdenkmal reichsdeutscher Mundarten“ 1967/37. Siehe hierzu http://www.staff.uni-marburg.de/~naeser/ld00.htm
Ob allerdings etwas an dem kolportierten Gerücht wahr ist, dass speziell der sächsische Dialekt wegen seines „unheldischen“ Klanges geächtet werden sollte, muss an dieser Stelle offenbleiben. Und auf persönliche Kommentare zum Siegerländer Platt (wobei womöglich Formulierungen wie „akustische Körperverletzung“ gebraucht würden) verzichte ich als friedfertiger Berliner lieber.
P.K.
Danke für die Ergänzung!
Zur Rolle der Mundartdichtung im Nationalsozialismus gilt es wohl auch folgende Literatur auszuwerten:
– Stefan Wilking, Der Deutsche Sprachatlas im Nationalsozialismus: Studien zur Dialektologie und Sprachwissenschaft zwischen 1933 und 1945, Hildesheim u.a. 2003 (Germanistische Linguistik Bd. 173/174).
– Klaas-Hinrich Ehlers: „Staatlich geförderte Dialektforschung 1920 bis 1960“ , in: Niederdeutsches Jahrbuch 130 (2007): 109-126, Link zum PDF
– Kay Dohnke u.a. (Hg.), Niederdeutsch im Nationalsozialismus. Studien zur Rolle regionaler Kultur im Faschismus, Hildesheim 1994
– Bürger, Peter: Faschistische Volkstumsideologie und Rassismus statt Wissenschaft. Zur Studie „Mundart und Hochsprache“ (1939) von Karl Schulte Kemminghausen. In: Niederdeutsches Wort. Beiträge zur niederdeutschen Philologie. Bd. 51 (2011), S. 1-24.
s. a. Arendt, Birte (2010): Niederdeutschdiskurse. Spracheinstellungen im Kontext von Laien, Printmedien und Politik. Berlin (Philologische Studien und Quellen, 224) [312 S.]
Arendt widmet sich auf wenigen Seiten der Einstellung der Nationalsozialisten zum Niederdeutschen (S. 109-115).
Das Video ist auf der
facebookseite „Du bist Freudenberger,wenn..“ sowie der
facebookseite „Eisenstraße Südwestfalen“ enthalten.
Hallo,
per Zufall bin ich auf diese Anzeige gestoßen und finde diese sehr interessant. Erst einmal zu meiner Person: Ich bin eine geborene Syberg und zwar genau dieser Linie. Ich habe eine Frage, in wie fern soll es da spuken?Es wäre lieb, wenn Sie mir etwas mehr über dieses Haus erzählen würden. LG
Zur Spukgeschichte hören Sie bitte den 2. Beitrag von Radio Siegen zum Verkauf des Schlosses. Nach meiner Minute schildert Frau Beer die Spukgeschichte.
Zur Geschichte von Schloss Junkernhees lies sich auf die Schnelle folgende Literatur ermitteln:
Wagener, Olaf: Burgen und Befestigungen in Kreuztal und Hilchenbach. Ein kulturhistorischer Führer, Kreuztal 2012
Gerhard Oberländer, Manfred Reitz, Klaus-Dieter Zimmermann (Hrsg.): Osthelden-Junkernhees. Ein Bilderbuch, Kreuztal 1990
Beer, Evelyne Beer, Falko [Hrsg.]: 475 Jahre Schloß Junkernhees und die ehemalige Wasserburg Hees (13. Jh.) 1523-1998, Schloß Junkernhees 1998
Scholl, Gerhard: Unsere Junkernhees. Schloß und Umgebung zwischen gestern und heute, Kreuztal 1974
Annerose Stöber: Schloß Junkernhees- ein Kleinod des Siegerlandes [geschichtliche Ausarbeitung zum Fach Städtebau], Siegen 1980
Eduard Manger: Geschichtliche Nachrichten über Ferndorf, Junkernhees, Langenau und Burgholdinghausen, Siegen (1880)
Hallo,
ist zwar schon etwas her. Schauen Sie doch mal im Schloss Junkernhees vorbei. Gerne auch mit Führung. Ein neu gegründeter Verein möchte sich jetzt im den Erhalt kümmern.
http://www.schlossjunkernhees.jimdo.comhttps://www.schloss-junkernhees.com/Oh das sind tolle Neuigkeiten, da schau ich gerne bald mal vorbei.
Nodda
S.Maschine
Heute fand sich ein Schreiben des Bundesarchis v Berlin v. 26.8.2013 (R1-2002/K-156) mit Kopien aus den personenbezogenen Sammlungen des ehemaligen Berlin Document Center (BDC) enthaltend Auszüge aus der sogenannten Parteikorrespondenz (PK) und der NSDAP-Gaukartei in der Post. Folgendes Ergänzende zu Friedrich Wilhelm Müller ließ sich ermitteln:
1) „Erklärung
Hierdurch erkläre ich als Nationalsozialist
auf Ehrenwort, daß ich das mir von Adolf Hitler und den
preußischen Wählern übertragene Mandat zum Preußischen
Landtag stetsim Sinne meines Führers ausüben will.
Sobald der Führer Adolf Hitler mich von meinem Mandat
abberuft, erkläre ich auf Ehrenwort, seiner Weisung zu
folgen. Im Falle meines Ausscheidens aus der Partei
lege ich selbstverständlich mein Mandat in die Hände
Adolfs Hitlerund meiner preußischen Wähler zurück.
Vor- und Zuname: Friedrich Wilhelm Müller
Adresse: Obersdorf Post Siegen Kreis Siegen Westfalen
Mitgliedsnummer: 55 069
Datum: 26.3.1932
Ort: Obersdorf“
2) Reichsschatzmeister (NSDAP) an Gauleitung Westfalen-Süd in Bochum, München, 10.1.1934:
„Anliegend übersende ich Ihnen Besitzurkunde nebst 2 Ehrenzeichen für Pg. Fritz Müller/Mitgl.-Nr. 55069 mit dem Ersuchen um Weiterleitung.
Auf Grund einer Verfügung des Stellvertreter des Führers kann Pg. Fritz Müller als M.d.R. nicht mehr bei der Sektion Reichsleitung geführt werden. Ich ersuche deshalb den Genannten mit Wirkung vom 1.1.34 der Sektion Gauleitung zuzuteilen.
Zur Anlage der Gaukartei-Karte teile ich Ihnen nachstehend die Personalien des Genannten mit:
Fritz Müller, geboren am 16.197 zu Obersdorf, Bergmann, aufgenommen unterm 14. Jan. 1927, unter Nummer 55069, wohnhaft: Obersdorf, Kreis Siegen.
Ihr Konto Ehrenzeichen wurde mit RM 2,50 belastet.“
3) Aus der Gaukartei-Karte geht hervor, dass Fritz Müller am 30.4.1935 in Dortmund, Arndtstr. 56 wohnte. Auf der zweiten Karte findet sich der Hinweis, dass Müller später in Dortmund auf der Kreuzstr. 90 wohnte und der NSDAP-Ortsgruppe angehörte. Er scheint bereits im November (?) 1936 nach Lippstadt, Geiststr. 47, verzogen zu sein. Nun gehörte er der dortigen NSADP-Ortsgruppe an.
Eine Antwort via Twitter:
Auf den ersten Blick dachte ich an Zeichenmaterial, z. B. vom Katasteramt. Aber so wirklich passt das nicht.
Handelt es sich womöglich um Werkzeug zur Restaurierung von beschädigtem Archivgut und stammt somit aus dem Kreisarchiv selbst? Soweit ich die dargestellten Gegenstände überhaupt identifizieren kann, könnten sie meiner (höchst unprofessionellen) Ansicht nach durchaus aus einer solchen Restaurierungswerkstatt stammen.
Lieber T.M., wenn Sie sich entscheiden müssten, wofür würden Sie sich entscheiden?
Das schrieb ich doch schon?
„Welche Verwaltungseinheit der Kreisverwaltung benötigte diese Arbeitsutensilienn?“ Das Kreisarchiv selbst. Ist ja auch eine Einrichtung des Kreises, oder? ;-)
Ich liege sicherlich meilenweit daneben, aber es geht ja eh nur um den Spaß an der Freude. :-)
Katasteramt ist richtig! Bearbeitung der DGK5 analog. Ich hab die Sachen abgegeben ;-)
Ja, da brauche ich ja nicht mehr aufzulösen. Entschuldigung an T.M., aber die 1. Antwort war nicht eindeutig.
Mist, so ein Ärger. Da hatte ich mit meinem ersten Eindruck doch richtig gelegen! :D
Tja, als ich Praktikum beim Katasteramt gemacht habe, hat man schon lange nicht mehr per Hand kartiert. (Und ehrlich gesagt finde ich es nicht allzu schade, dass ich mich damit auf keinen Fall mehr auseinander setzen muss.)
Hätte ich wenigstens irgendwas gewonnen, sodass ich jetzt auch einen Grund habe, mich zu ärgern? ;-)
Diesmal ging es nur um die Rater-„Ehre“; manchmal lobe ich für eine richtige Antwort ein „Paulchen“ aus.
Pingback: siwiarchiv – Monatsstatistik August 2013 | siwiarchiv.de
Also ich würde diese Dinge zur Signaturaufklebestelle/Verzeichnung zuordnen, um Altbestand mit Papieretiketten und Kleister zu bekleben.
Wer kann mir helfen mit der Adresse der Wwe. oder Kinder von Herbert Kienzler bzgl. der Rechte an der Veröffentlichung von Zeichnungen aus seinem damaligen Buch über Siegerländer Fachwerkhäuser?
Einen Beitrag zu der Wilnsdorfer fixen Idee lieferte schon vor etlichen Jahren Jürgen Kühnel: Wieland der Schmied, ‚Guielandus in urbe Sigeni‘ und der Ortsname Wilnsdorf, in: Diagonal. Zeitschrift der Universität Siegen 1997, Heft 1, S. 169-181 (Nachdruck in: Siegerland 75 (1998), S. 41-50; nochmals nachgedruckt im aktuellen Band 34 (2013) von Diagonal, S. 217-232). Aber es hat keinen Zweck, mit wissenschaftlichen Argumenten gegen den Aberglauben eines ganzen Dorfes vorgehen zu wollen. Die Legende wird am Ende immer stärker sein.
Und in der nächsten Folge unserer lokalhistorischen Exkursionen besuchen wir den Michelsberg bei Siegen-Eiserfeld. Der heißt bekanntlich deshalb so, weil der Erzengel Michael dort einmal in einer Köhlerhütte übernachtet hatte, während ein paar Kilometer weiter Schmidts Wieland ihm seine neue Rüstung schmiedete.
P.K.
Vermutlich stammen diese unscheinbar-schönen Stücke nicht aus dem Staatl.Vet.Unters.Amt, sondern aus dem Kr.Vet.Unters.Amt, lies „Kreis-Veterinär-Untersuchtungsamt“?? Gibt’s etwa auch für das Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein eine Reisewarnung?
1) Bis zur Auflösung dauert es noch etwas, wenn Sie sich bis Freitag gedulden können …..
2) Das Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein kann gefahrlos bereist werden. Wollen Sie die Stücke persönlich in Augenschein nehmen? ;-)
Auf einer Krawattennadel…..
Richtig!
Pingback: Entwurf für die Gestaltung des Walter-Krämer-Platzes in Siegen | siwiarchiv.de
Offizielle Erläuterung zum Entwurf
Im Zentrum des Entwurfs findet sich ein Weg. Dieser Weg symbolisiert den Weg der Menschheit in die Moderne. Er führt vorbei an drei massiven Wänden aus verschiedene Materialien, die unterschiedliche historische Zeitabschnitte veranschaulichen sollen. Die Zeit des Nationalsozialismus (Bronze), über die Nachkriegszeit und die Zeit des Wiederaufbaus (Stahl) hin zur Neuzeit (Beton).
Ausgangspunkt ist der Tag der Befreiung des KZ Buchenwald. Säulenbuchen, Kopfsteinpflaster und Auswahl der Sitzmöbel stellen den Bezug zum historischen Ort her.
Die Bronzetafel gibt eine Situation wieder, die unmittelbar im Bezug zum Wirken Walter Krämers in Buchenwald steht. Die Darstellung ist angelehnt an eine Zeichnung des niederländischen Künstlers Henry Pieck (ehemaliger Buchenwald Häftling, *19.04.1895 ? 12.01.1972 ) mit dem Titel „Vor dem Revier angetreten“ (Die Verwendung des Motivs geschieht mit ausdrücklicher Genehmigung der Familie Pieck. Diese wurde eingeholt von Bram Peters, dem Leiter des Liberty Parks im holländischen Overloon) und zeigt Häftlinge, die auf ihre Behandlung im Häftlingskrankenbau des Konzentrationslagers Buchenwald wartend auf einer Bank verharren.
Des Weiteren ist das Lagertorgebäude aus der Innensicht mit weit geöffnetem Tor, welches die Befreiung symbolisieren soll, dargestellt. Deutlich lesbar ist die Inschrift auf dem Lagertor „Jedem das Seine“.
Es wird ein unmittelbarer Bezug zum Park in seiner Funktion als Patientengarten hergestellt.
Auf der einen Seite die Häftlinge vor dem Revier. Was dürfen sie hoffen an einem solchen Ort – wehrlos, ausgeliefert? Auf der anderen Seite der betrachtende Patient. Mit welch unterschiedlichen Gefühlen kann er sich in Behandlung und Pflege begeben. So ähnlich die Rollen auch scheinen, unterschiedlicher könnten sie wohl kaum sein.
„Jedem das Seine“ lautet die zynische Formel auf dem Lagertor des KZ Buchenwald. Eine Formulierung, die heute noch jedem geläufig ist, aber beschädigt ist, durch den menschenverachtenden Gebrauch der Nazis. Was kann der Ausspruch heute für Menschen bedeuten, die sich mit ihren kleinen und schweren Leiden ins Krankenhaus begeben? Bei allen Bedenken, Sorgen und Ängsten können wir heute doch die Gewissheit haben unabhängig vom Ansehen unserer Person bestmögliche medizinische Versorgung zu erhalten. Mit dieser Gewissheit kann man weiter schreiten durch das weit geöffnete, einladende Portal, welches direkt zur Eingangspforte des Klinikums führt. Das Wissen um die demokratischen Errungenschaften der Moderne, die es zu bewahren gilt, vor dem Hintergrund der Verbrechen und Verfehlungen der Vergangenheit sollen sich Menschen an diesem Gedenkort immer wieder verdeutlichen können.
Der Eid des Hippokrates war von jeher Leitmotiv ärztlichen Handelns. Wenn auch heute nicht mehr von Ärzten in rechtsverbindlicher Weise geleistet, findet er doch Widerhall in modernen Leitbildern ärztlicher Ethik. Im Bewusstsein der Patientinnen und Patienten ist er jedoch allgegenwärtig und, auch wenn im Wortlaut sicher selten bekannt, eine wesentliche Basis des Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und Patient.
Das Gebot, Kranken nicht zu schaden, die Schweigepflicht und die klare Aussage, chirurgische Eingriffe nur den dafür ausgebildeten Fachleuten zu überlassen, sind Säulen des Eid des Hippokrates. Ein Bruch dieser Regeln, wie durch die Ärzteschaft im Nationalsozialismus, wird sich in der Geschichte der Menschheit wohl kaum noch einmal finden lassen. Allein die Bereitschaft von Ärzten im Konzentrationslager, einem Ort des Leidens und Mordens, ihren Dienst zu tun, ist kaum nachvollziehbar. Die zahllosen überlieferten Verbrechen von Ärzten an ihren „Patienten“ verschlagen uns immer wieder die Sprache.
Im Krankenbau des KZ Buchenwald, war es kein Arzt, sondern der gelernte Schlosser Walter Krämer, der half die Ehre eines ganzen Berufsstandes zu retten, in dem er sich medizinische Kenntnisse aneignete und sie zum Wohle seiner Kameraden einsetze.
Auf einer Gedenktafel soll den Besucherinnen und Besuchern sein Lebensweg in Erinnerung gebracht werden.
Anlässlich des SPD-Gemeindeverbandes Wilnsdorf zum Parteijubiläums war wauch die Wegebenennung Thema: “ …. Im Lichte dieses aufopferungsvollen Einsatzes dieser Personen [Anm.: Gemeint waren die Pfarrer Theodor Noa und Wilhelm Ochse (kath.)] wurde im anschließenden Gespräch auch die Benennung einer Straße im Wilnsdorfer Ortsteil Obersdorf nach dem Dichter Wilhelm Schmidt kritisiert. Zahlreiche Teilnehmer äußerten ihre Ablehnung darüber, dass jemand diese Ehrung erhalte, der erst 1940 in die NSDAP eingetreten sei, als schon die planmäßige Verfolgung Andersdenkender und die gezielte massenhafte Ermordung der Juden voll im Gang war. ….“
Quelle: http://www.spd-wilnsdorf.de/ , Aktuelles v. 3.9.2013
Es liegt jetzt noch wieder ein paar Tage zurück, soll aber doch die kurze Erinnerung noch wieder wert sein: der Überfall auf Polen – Alltagsjargon auch heute noch: „Polenfeldzug“ – am 1. September 1939. Bekanntlich wurde der äußere Anlass wie in einer endlosen Zahl von vergangenen und wohl auch künftigen Kriegen im Geheimen fabriziert, auf die Kriegserklärung verzichtet und losgelegt, da es sich ja um Schutz und Verteidigung handeln würde, um hehre Ziele gehe etc. pp.
Und Wilhelm Schmidt, der Dorfdichter? Stand an der Front und war nun ein Frontdichter, siehe Siegerland, Zeitschrift des Siegerländer Heimatvereins, H. 2-3, 1939, S. 35:
Pionier off Mineposte
Oa wäj, oa wäj, Franzoese
On protzig Tommyheer:
Et sall ou schleecht bekomme,
bliet weg va ditscher Ähr!
…
Dehähm, om stelle Räädche
Wird itz dr Sandmah goah –
Dat sie ea Roh konn schloafe
Ech he off Poste stoah.
…
So adressierte es Schmidt an seine Heimatfreunde: die Wehrmacht greife nicht an, sie setze sich gegen eine Bedrohung zur Wehr, sie verteidige, mit viel fremdem Blut den Boden. Interessant ist nun, dass man schon sehr naiv gewesen sein muss, um diese Lüge zu glauben, denn das Regime selbst stellte es durchaus ehrlicher dar, was ja denn auch für Begeisterung sorgte. Die Bildaussage des folgenden Filmplakats ist klar und eindeutig: wir walzen alles nieder, was uns beim Erobern im Weg ist:
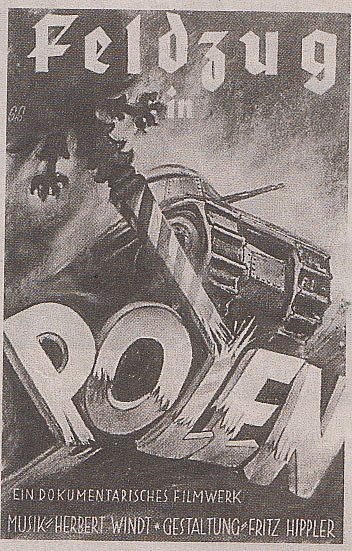
Über das Stichwort „Erobern“ zurück zu Wilnsdorfer Straßennamen: da gibt es nämlich noch die Ostland-Straße. Auf die passt das Plakat eigentlich auch ganz gut. Sie trägt den Namen des Reichskommissariats Ostland, übrigens erst seit 1967. Das Reichskommissariat wiederum erhielt diesen Namen von einem der Eroberungsziele der schon zu Kaisers Zeiten agierenden und Ziele vorschlagenden Großraumpolitiker („Nach Ostland wollen wir reiten“).
Im Reichskommissariat Ostland, genauer im Generalbezirk Weißruthenien lag Minsk. Im Ghetto in Minsk wurde bekanntlich im Juli 1942 Hedwig Danielewicz, die heute in Obersdorf so Geehrte, umgebracht. Und in die Ostland-Straße mündet die trotz Falschschreibung eindeutige Stöcker-Straße. Sie ist nach dem „Vater der antisemitischen Bewegung“ (so er selbst) Adolf Stoecker benannt. Der war der Heros der Siegerländer protestantischen „Christlich-Sozialen“, wie die nette Selbstbezeichnung für eine antisemitische, außerhalb von Siegen-Wittgenstein bedeutungslose, hier hegemoniale Parteibewegung lautete. In ihrem offenen Rassismus, in ihrer Hetze nicht nur, aber vor allem gegen die jüdische Minderheit unterschied sie sich von anderen antisemitischen Organisationen und Bewegungen ihrer Zeit in nichts. Es war eben schon alles da, als die Nazis und ihre Partner ihr Regime errichteten, wie der Antisemitismusforscher Wolfgang Benz einmal feststellte. Auch in diesen Dörfern.
Wilhelm-Schmidt-Weg, Ostland-Straße, Gedenkstein für Hedwig Danielewicz, Stöcker-Straße. Es lässt sich also dem Straßen- und Ortsbild einiges entnehmen. Also, liebe Aufklärer, an Stoff fehlt es nicht und die Gemeinde Wilnsdorf sorgt ja für kurze Wege.
Medienecho zur SPD-Veranstaltung:
1) Siegener Zeitung, 5.9.2013 [nur Print]
2) Westfälische Rundschau, 6.9.13: http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/kritik-an-strassenbenennung-aimp-id8407811.html
Anm. In diesem Artikel findet sich zum ersten Mal der Hinweis, dass die Benennung bereits 2009 erfolgt ist. Da hat wohl jemand siwiarchiv gelesen. ;-)
Im Zusammenhang mit dem Fall Wilhelm Schmidt muss meiner Meinung nach dringend über die Umbenennung der Lothar-Irle-Straße in Kaan-Marienborn nachgedacht werden. Bei Irle liegen die Dinge noch eindeutiger als bei Schmidt.
1) Es gilt zu beachten, dass der Wilherlm-Schmidt-Weg in die Zuständigkeit der Gemeinde Wilnsdorf, die Lothar-Irle-Str. in die der Stadt Siegen fällt.
2) Eine Aufstellung weiterer problematischer Straßennamen findet sich hier: http://strassensiwi.blogsport.de/strassennamen-uebersicht/
“ …. Eine Woche später, am 21. Juni 1933, ekalierte der Konflikt im Eichener Walzwerk [Anm.: Die NSBO verlangte die Absetzung des technischen Betriebsleiters Arnold Lerg, s. Literatur wie unten, S. 102-106]. Bereits vormittags kursierte im Amt Ferndorf das Gerücht, der Betriebsleiter Lerg solle aus dem Betrieb herausgeholt werden. Nachmittags gegen 16 Uhr erreichte das Kreuztaler Polizeikommissariat die Nachricht, dass in Krombach ein ganzer SA-Sturm zusammengezogen werde. Gegen 18 Uhr hatte sich vor dem Eingang zum Eichener Walzwerk eine große Menschenmenge eingefunden, die mit dem Ruf „Lerg heraus, Lerg heraus“ die Auslieferung des Betriebsleiters verlangte. Als der leitende Polizeikommissar Pabst am Werkstor eintraf, berichtete ihm der SS-Truppführer Werner Kurth aus Kreuztal, er habe mit einer Anzahl SS-Männer die erregte Menge von Tätlichkeiten abgehalten und für die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung gesorgt.Schließlich habe er um die Unterstützung durch die Ortspolizei nachgesucht. Im Vorraum des Verwaltungsgebäudes traf Pabst auf drei NS-Funktionäre, die mit der Werksleitung über die Beurlaubung von Arnold Lerg verhandeln wollten: der Siegener NSDAP-Reichstagsabgeordnete Müller, sowie zwei Beauftragte der der Siegener Kreisleitung der NSBO, Bedenbender und Blöcher. Die NS-Funktionäre konnten trotz Verweis auf den wachsenden Unmut der Arbeiter weder den anwesenden Direktor des Eichener Walzwerks, Notthoff, noch dessen über Telefon zugeschalteten Vorgesetzten in Niederschelden, Direktor Klein, zu einer Beurlaubung des Betriebsleiters bewegen. ….“, aus: Dieter Pfau, Die Geschichte der Juden im Amt Ferndorf (1797-1943). „Den Juden ist aber hier kein Leid zugefügt worden.“, Bielefeld 2012, S. 105-106.
Arnold Lerg durfte in der Folge den Betrieb nicht mehr betreten. Er wurde festgenommen und kurzzeitig inhaftiert.
Nach dem NS-Ende gehörte er zu den Gründern der CDU, die er im Kreistag vertrat.
Und noch ein Detail zum Thema Zeitgeist und zum Widerspruch dazu, zu dem das Stichwort MdR Müller Anlass bietet:
Der Bruder Clemens von Arnold Lerg wurde wegen Abhörens feindlicher Sender denunziert und zu anderthalb Jahren Zuchthaus verurteilt. Das war eine für das sog. Rundfunkverbrechen, das meist ungeahndet blieb, ungewöhnlich hohe Strafe.
Die Publikation ist mit 79,80 € sehr teuer – s. a. http://archiv.twoday.net/stories/465680654/#comments . Sie kann ggf. in Benutzerraum des Kreisarchivs eingesehen werden.
Anmerkung zu den Veröffentlichungen:
August Schmidt. Dokumentation in Briefen. Solingen: Schmidt 1975. 102 S.
Bevor sich jemand, wie ich, die Mühe macht das Buch per Fernleihe zu bestellen: es nicht von dem hier gemeinten Wilhelm Schmidt verfasst worden, sondern einem Namensvetter zuzuordnen.
Danke für den Hinweis! Der Hinweis auf dieses Buch stammte vom Westfälischen Autorenlexikon und wurde zunächst ungeprüft übernommen.
Veröffentlichung von W. Schmidt in der SNZ am 17.05.1939
De Isener Hedde
(siehe auch den Überblick „unselbstständige Veröffenlichungen“
Wilhelm Schmidt: De Isener Hedde, Siegerland 20, 1938, S. 63)
Die Nachfrage nach einer Rentenakte bei der wohl zuständigen Knappschaft hat ergeben, dass diese sehr wahrscheinlcich nicht mehr vorhanden ist. Entsprechende Akten werden dort 6 volle Kalenderjahre nach Tod Tod des Leistungsempfängers kassiert. Eis ist daher bei Wilhelm Schmidt von einer Kassation im Jar 1973 auszugehen.
Eine Datenspeicherung auf elektronischen Weg wurde ab Mitte der 70er Jahre praktiziert, so dass auch dort nichts zu finden ist.
Rückschlüsse auf die Einkommensverhältnisse über die Witwe Schmidts sind ebenfalls nicht möglich deren Akte ist wohl 1997 kassiert worden, die eventuell noch vorhandenen Daten werden lediglich auf die Witwenrente verweisen.
Eine Präsentation zu „Grundlagen der Archivierung: Geschichte im Verein bewahren und verlöffentlichen“ des Stadtarchivs Speyer: http://de.slideshare.net/StadtASpeyer/grundlagen-der-archivierung
Bei einem kurzen Besuch gestern im Landesarchiv in Münster war eine Personenrecherche zu Wilhelm Schmidt nicht erfolgreich – weder in der Datenbank für Münster noch für Düsseldorf. D. h. weiteres ausschließlich auf Wilhelm Schmidt bezogenes Schriftgut ist dort zurzeit nicht zu erwarten.
Gleiches gilt auch für das Bundesarchiv in Berlin, das heute mit Az.2002/K-156 folgendes mitteilte: „Nach den nun abgeschlossenen Recherchen in den hier überliefen personenbezogenen Beständen sowie relevanten Sachbeständen konnten keine Hinweise auf Unterlagen zu Wilhelm Schmidt ermittelt werden.“
Veröffentlichung von Wilhelm Schmidt in der Siegerländer Nationalzeitung
vom 11.09.1942
Gedicht „Om Räddche“ eingebettet in den Beitrag
„Dr Mettelpunkt“.
Medienecho zum Aufruf für die geplante Ausstellung zum Ersten Weltkrieg an der Siegener Heimatfront:
1) „Der Geschichtsverein und das Archiv der Stadt Siegen planen für das kommende Jahr eine große Ausstellung zum Ersten Weltkrieg. Dessen Beginn jährt sich dann zum 100. Mal. Ziel der Ausstellung ist es, den Alltag zwischen 1914 und 1918 in Siegen und den umliegenden Dörfern darzustellen, die heute zum Stadtgebiet zählen. Die Organisatoren hoffen auf zahlreiche Leihgaben aus der Bevölkerung. Fotos und Alltagsgegenstände aus der Zeit des Ersten Weltkriegs nimmt das Stadtarchiv Siegen entgegen. Das befindet sich im Krönchencenter in der Oberstadt.“
Radio Siegen, 19.9.2013
Zum Hören: http://radio-siegen.de/_pool/files/beitraege/652997.mp3
2) In den Print-Ausgaben von Siegener Zeitung und Westfälischer Rundschau finden sich heute ebenfalls Artikel über den Aufruf.
Pingback: Lothar Irle und der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland | siwiarchiv.de
Am 7. Oktober 1934 beantragte Wilhem Schmidt, damals in der Eiserfelder Helsbachstr. wohnhaft, die Verleihung des Ehrenkreuzes für Frontkämpfer des ersten Weltkrieges. Wilhelm Schmidt gehörte demnach als Pionier der 1. Kompanie des 4. Pionier Battalions in Magdeburg an. Er leistete Pionier- und Infanteriedienst in Frankreich und Belgien vom 27. August 1917 bis zum 11. November 1918. Ferner erhielt er das „Eiserne Kreuz“ II. Klasse. Das beantragte Ehrenkreuz wurde ihm zu Beginn des Jahres 1935 verleihen.
Quelle: LAV NRW, Kreis Siegen, Landratsamt Nr. 2278
Auswertung von Dieter Helmes: Aufstieg und Entwicklung der NSDAP im Siegerland vor der Machtübernahme, [Siegen-]Hüttental 1974, nach Erwähnungen von Fritz Müller:
Literaturhinweise:
Friedrich Alfred Beck, Kampf und Sieg. Geschichte der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterparte im Gaus Westfalen-Süd von den Anfängen bis zur Machtübernahme, Dortmund 1938
Dort u. a.: S. 17-18: Mitgliederliste des NSDAP:
505. Friedrich Müller, 35 900
506. Fritz Müller, 55 069
Weigand Paul: Die deutschen Gaue seit der Machtergreifung –
Westfalen Süd – , Berlin 1940 (Hrsg. Paul Meier, Benneckenstein)
S. 104:
“ …. Nach der Neugründung der NSDAP und der Gründung weiterer Ortsgruppenwuchs die SA an. …. Fritz Müller … kam […] bis 1927 in die SA. ….”
Quelle: Beck, S. 116
“ …. Wir entfachen das Feuer
Oberdielfen im Siegerland
Wegen anderweitiger Benutzung des vorgesehenen Lokals hielt Parteigenosse Müller, Obersdorf, eine Versammlung in der Dorfschmiede, der Arbeitsstätte des rührigen Parteigenossen Kretzberg, Oberdielfen, ab. Es wurden 10 Neuaufnahmen (Bergleute, Fabrikarbeiter und Handwerker) und einge Zeitungsbezieher gewonnen.”
Quelle: Völkischer Beobachter, 4. Juni 1930 zur Gründung der Ortsgruppe am 1. Juni 1930 nach SNZ, 29. Juni 1935
S. 87: Reichstagswahl 6.11.1932
„ …. Auf der Liste des Wahlkreises 18 war der Siegerländer Fritz Müller auf Platz 7 gesetzt worden und wurde damit wieder in den Reichstag gewählt. …“
S. 51 Kreistagswahl 17.11.1929
Ergebnis 10,9 %, 3 Sitze: Abg. Fritz Müller, Paul Preußer, Heinrich Klein
S. 36 [Ortsgruppe Niederschelden]„ …. So fand in Oberschelden schon 1927 eine Versammlung der NSDAP statt, in der Münz, Bedenbender, Müller (?) und ein Parteigenosse aus Siegen sprachen ……“
S. 137:
Fritz Müller, Obersdorf, 35 900 (Mtgliedsnr.) [Quelle: SNZ, 16. Juni 1934, Friedrich Alfred Beck, Kampf und Sieg. Geschichte der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterparte im Gaus Westfalen-Süd. Von den Anfängen bis zur Machtübernahme, Dortmund 1938, S. 17-18]
S. 34 -35 „ ……Die Ortsgruppe Eisern wurde 1925/26 gegründet und bestand zu einem großen Teil aus Bergleuten. So kamen von der Grube Ameise Männer wie Hannes Bedenbender und Fritz Müller. Über diese Grube wurde folgendes geschrieben: „Auf der Grube Ameise wurden unter der Führung eines Werksstudenten im Anfang 1924 einige Bergleute in die tief deutsch-revolutionäre Front eingegliedert. Als guter Literaturkenner und ausgestattet mit besten organisatorischen Fähigkeiten verstand es dieser junge Mann, seine fünf ersten Kameraden zu Fanatikern der Idee zu erziehen, und schon 1926 war die Grube Ameise als die Hochburg des Nationalsozialismus weithin bekannt. Nachdem der aktive und sehr begabte junge Führer aus unergründlicher Veranlassung heraus in ein anderes Lager hinüberwechselte, stand die Organisation, die er an seinem Arbeitsplatz geschaffen hatte, schon so fest, daß sie nicht mehr zu erschüttern war. Die neue Ortsgruppe wurde damals als Sammelgruppe dem Bezirk mit einer Gesamtmitgliederstärke von 16 Mann gemeldet. …..“
Im Sommer 1926 gehörten folgende Männer der Ortsgruppe Eisern an: …. Fritz Müller Obersdorf …..
Im August 1927 fand die Weihe der Ortsgruppenfahne statt. Der damalige Gauleiter Karl Kauffmann war Schirmherr der Veranstaltung.
„Zum ersten Male marschierte anläßlich dieser Begebenheit im Siegerlande eine uniformierte SA-Kapelle die aus Elberfeld verpflichtet worden war unter Vorantritt des Spielmannzuges des evangelischen Posaunenchores Eiserfeld. Der Kostenaufwand für diese Feier betrug 265 RM. Dieser Betrag in bar, daneben noch die Verpflegung der auswärtigen SA-Männern aus dem Bezirk Lenne, Volme und Dillenburg wurde im Umlageverfahren von den Parteigenossen zwangserhoben.“
[Quelle: Beck, S. 414, SZ, 9.12.1933, SNZ 16.6.1934]
Eine Recherche im Lesesaalrechner des Landesarchivs NRW, Abt. Westfalen in Münster ergab 2 Archivalien, die wohl im Zuge einer weiteren Recherche zu Fritz Müller eingesehen werden sollten:
1) Q 568g (Amtsgericht Siegen, Grundakten Obersdorf) Nr. 21455: F. W. Müller, Auguste Müller, Heinrich M., Hartmut M., Sieglinde M., Inge Sellmann, 1939-1957
2) Deutsche Arbeitsfront (Findbuch C 26) Nr. 1: Der DAF-Gau Westfalen-Süd in Karten und Zahlen zusammengestellt vom Organisationsamt des DAF-Gaus Westfalen Süd, enthält: Organisationspläne des DAF-Gaues, Karten des DAF-Bezirks Westfalen, des DAF-Gaues Westfalen-Süd, Karte der 24 Kreise des Gaues mit Einzeichnung der Ortsgruppengrenzen, Verzeichnis der KReis- und Ortsgruppen der DAF im Gau Westfalen-Süd
Ein weiterer Mosaikstein zur Biographie Schmidts aus dem Museum Wilnsdorf. Frau Dr. Nauck gebührt Dank für den Hinweis und die folgende. Transskription:
Ein Postkarte Helen Jung-Danielewiczs an Wilhelm Schmidt aus dem Museumbestand zu Frau Dr. Hedwig Jung-Danielewicz, datiert Düsseldorf, den 6. Juli 1930:
„Sehr geehrter Herr Schmidt!
Da am 3. August evangelisches Missionsfest in Obersdorf und am Nachmittag Wald-Gottesdienst ist, müssen wir schon die kleine Gedenkfeier zur Einweihung der Eisengussplatte [gemeint ist die Plakette am Elternhaus Jung-Dörflers] auf Sonntag den 27. Juli festsetzen. Ich hoffe, dass Ihnen das recht ist, und dass Sie durch Ihre Worte dazu beitragen werden, die Feier zu verschönen und ihre Bedeutung den Teilnehmern zum Bewusstsein zu bringen. Da sich an die kleine eigentliche Feier eine Bewirtung der Kinder anschließen soll, wollen wir schon um 3 Uhr anfangen. Für die Gäste von außerhalb ist ein Kaffeestündchen im Josephshaus vorgesehen, wohin ich Sie auch mitzukommen bitte.
Mit freundlichem Gruß!
Ihre ganz ergebene Dr. H. Jung-Danielewicz“
Eine Auswertung der online abrufbaren, stenographischen Berichte der Reichtatgssitzungen für die Wahlperioden, in denen Friedrich Wilhelm Müller Reichstagsmitglied war, hat folgendes Ergebnis:
Verhandlungen des Reichstages VI. Wahlperiode Band 454, Berlin 1932
1. Sitzung 30.8.1932: anwesend
2. Sitzung 12.9.1932: anwesend
Namentliche Abstimmung über die Anträge der Abgeordneten Torgler und Genossen auf Aufhebung der Verordnungen des Reichspräsidenten vom 4. und 5 September (Reichsgesetzblatt I S. 425 und 433) – Nr. 118. 119 der Drucksachen – sowie über den Misstrauensantrag der Abgeordneten Torgler und Genossen gegen die Reichsregierung von Papen – Nr. 44 der Drucksachen –
Müller (Westfalen) Ja
Verhandlungen des Reichstages VIII. Wahlperiode Band 457, Berlin 1934
1. Sitzung 21.3.1933 Staatsakt in Potsdam: anwesend
2. Sitzung 23.3.1933 Ermächtigungsgesetz anwesend
Namentliche Abstimmung: Schlußabstimmung über den von den Abgeordneten Dr. Frick, Dr. Oberfohren und Genossen eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Behebung der Not von Volk und Reich – Nr. 6 der Drucksachen
Müller (Westfalen) Ja
3. Sitzung 17.5.1933
Verhandlungen des Reichstages IX. Wahlperiode Band 458, Berlin 1936
1. Sitzung 12.12.1933 fehlt entschuldigt
2. Sitzung 30.01.1934 anwesend
3. Sitzung 13.7.1934: keine Angaben zur Anwesenheit vorhanden
4. Sitzung: Trauerkundgebung für den verstorbenen Reichspräsidenten Hindenburg, 6.8.1934: keine Angaben zur Anwesenheit vorhanden
5. Sitzung 21.5.1935: keine Angaben zur Anwesenheit vorhanden
6. Sitzung 15.9.1935 (Reichsparteitag): keine Angaben zur Anwesenheit vorhanden
7. Sitzung 7.3.1936: keine Angaben zur Anwesenheit vorhanden
Was für eine liebevoll gemachte Ausstellung!
Pingback: siwiarchiv – Monatsstatistik September 2013 | siwiarchiv.de
Pingback: 60. Geburtstag der beiden Landschaftsverbände | siwiarchiv.de
Ich bin im Besitz zweier Gemälde von Hanna Achenbach-Junemann
Mohnblumen in Vase und bunter Blumenstrauß in Glasvase.
Beide Gemälde sich gerahmt (leider 1 Rahmen an einer Ecke defekt).
Besteht Ihrerseits Interesse diese zu Erwerben?
Mit freundlichen Grüßen Gabriele Hauk
Zur Ehrenbürgerschaft Hitlers in Wilnsdorf-Obersdarf s. http://www.vvn-bda-siegen.de/Aktuelles.html#wilnsdorf
Bisher konnten noch keine Aussagen über eine Mitgliedschaft Müllers im Obersdorfer Gemeinderat gemacht werden. Ein gerade veröffentlichter Fund der VVn-BdA Siegerland-Wittgenstein – http://www.vvn-bda-siegen.de/Aktuelles.html#wilnsdorf – zeigt nun, dass auch die Protokolle dieses Gremiums durchgesehen werden müssen, um die politischen Aktivitäten Fritz Müllers vollständig darstellen zu können.
Im Landesarchiv NRW, Abt. Rheinland, noch in Düsseldorf befinden sich 2 einschlägige Ordensakten: NW O 07379 und NW O 7947.
na ja!
Na ja: positiv – oder eher negativ?
Als Teilnehmer der Veranstaltung sage ich eindeutig: positiv, auch wenn ich eine eigene Umsetzung derzeit noch nicht absehen kann. Hilfreich in dem Zusammenhang: http://archive20.hypotheses.org/905
Hier in Greven macht die Stadtbibliothek sowohl Facebook https://www.facebook.com/StadtbibliothekGreven als auch ein Blog http://schulbloggreven.wordpress.com/ (das aber nur Grundschullehrkräfte erreichen soll. Rückmeldungen sind offenbar rar). Es gibt also guten Grund, nicht stehenzubleiben.
Auf Facebook wird das Thema hier diskutiert: https://www.facebook.com/walter.kramer.52/posts/428982243879223. Die Westfälische Rundschau berichtete am 19.10.2013 vom Verlauf der Ratssitzung: http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/paul-von-hindenburg-entzweit-den-wilnsdorfer-rat-aimp-id8577826.html
Pingback: “Wiesenbauschule” | siwiarchiv.de
Pingback: Ausstellung zur Kreuztaler Sportgeschichte | siwiarchiv.de
Pingback: Nachruf auf Wolfgang Burbach | siwiarchiv.de
Das Wasserzeichen der „Biblia Latina“ ist ein Pro Patria-Wasserzeichen und zeigt den Freiheitslöwen, eine alte holländische Wappenfigur der Oranier, der in seiner rechten Pranke ein Schwert und in der linken Pranke ein Bündel mit sieben Pfeilen hält. Hinter dem Löwen befindet sich eine sitzende weibliche Gestalt mit Helm und einer Stange mit Dreizack in der rechten Hand: die griechische Göttin der Weisheit, des Krieges und des Friedens, Pallas Athene. Ein Palisadenzaun umrandet die beiden. Oben links über diesem Bild steht der Schriftzug „ProPatria“. Das Pro Patria-Wasserzeichen, das auch Hollandia-Wasserzeichen oder „Hollandse Magd” genannt wird, ist in den Niederlanden, Deutschland, Frankreich und weiteren europäischen Ländern weit verbreitet für Papiere im Folio-Format.
Aus: http://www.bibliotheca-johannei.de/bestand/besondere-bucher/biblia-latina/
Ein Leserbrief des VVN-BdA Siegerland-Wittgenstein, der die ausgebliebebene Distanzierung des Wilnsdorfer Rates zur Ehrenbürgerschaft Hindenburgs thematisierte und der bereits in der Westfälischen Rundschau und in der Siegener Zeitung abgedruckt wurde, befindet sich in den Kommentaren zu diesem Facebook-Eintrag: https://www.facebook.com/walter.kramer.52?fref=ts .
Das Motiv wurde im 17. Jahrhundert auch auf gußeisernen Kaminplatten verewigt; eine schöne Abbildung hier:
http://www.westlandlondon.com/stock/firegrates/firebacks/item/9449/detail.htm?page=3
Über den „Dreizack“ im Wasserzeichen läßt sich streiten. Die Kaminplatte zeigt definitiv keinen solchen, sondern einen Speer mit aufgesetztem Freiheitshut, was im historischen Kontext (niederländischer Freiheitskampf) stimmig ist. Die Deutung der allegorischen Figur als „Hollandia“, eben als das personifizierte Vaterland (patria), wäre näherliegend, ohne damit Bezüge zur Göttin Athene ausschließen zu müssen.
Aber, lieber Herr Wolf (ich erlaube mir, mich zu wiederholen): Wer Auskünfte sucht, möge doch bitte sein Anliegen klar formulieren. Ihre Frage „Wer weiß mehr?“ kann in so viele Richtungen führen, dass man sich nicht recht zur Beschäftigung motiviert fühlt. Was interessiert Sie denn nun konkret? Alles über frühneuzeitliche Wasserzeichen? Alles über genau dieses eine Wasserzeichen? Alles über ein mit diesem Wasserzeichen versehenes uns unbekanntes Objekt? Alles über die „Pro Patria“-Ikonographie auf Papier, Gußeisen und anderen Trägern? Alles über Frauen und Löwen? Wenn Sie eine präzise Frage stellen würden (unter Preisgabe der Ihnen schon vorliegenden Informationen), könnte sich möglicherweise irgendwo im Land ein Experte angesprochen fühlen. So aber …
„Pro archivo!“
P.K.
Ach Herr Kunzmann, zunächst einmal Danke schön für die Ergänzung!
Gönnen Sie uns doch den Spaß, ergebnisoffen eine allgemeine Frage zu stellen. Wäre präziser gefragt worden, wäre vielleicht nicht der für die Region nicht uninteressante Hinweis erfolgt, dass die figürliche Darstellung sich auch auf gusseisernen Ofenplatten befindet.
Lieber Herr Wolf, ich gönne Ihnen jeden Spaß! Im Archiv gibt es davon ja nicht allzu viel.
Wie ich inzwischen sehe, sind diese Ofenplatten hierzulande ein alter Hut. Siehe dazu u.a. Eugen Fritz, Die Pro-Patria-Kaminplatte. Ikonografische Betrachtung der Bildelemente und grafischen Vorlagen, in: Siegerland 63 (1986), S. 33 ff.
P.K.
Links zum pro patria Wasserzeichen:
1) Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz verwesit auf den wahrscheinlichen Herstellungsort: Stennert in Hagen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
2) National gallery of Australia mit Literaturhinweisen
Literatur:
Nana Badenberg: Das Pro-Patria-Wasserzeichen : zur Geschichte eines filigranen Motivs, 1699-1914, Basel 2010. 2012 erhielt die Autorin den Förderpreis der Schweizer Papierhistoriker für ihre Diplomarbeit.
Theo Gerardy: Die Hollandia-Wasserzeichen von F. C. Drewsen & Sohn 1822-1835.Versuch eines neuartigen Kataloges, in: Papiergeschichte, Bd. 8, 1958, Nr. 1: 1-8
Theo Gerardy: Die Hollandia-Wasserzeichen des nordwestdeutschen Raumes im 19. Jahrhundert, Oegstgeest 1961
Wisso Weiß: Sie ist in alter Volkskunst anzutreffen: die “ Hollandia“, ein patriotisches Wasserzeichen der Holländer. In: Nationalzeitung, Berlin, 34(1981-95-23)
Zu 1) Die Ähnlichkeit ist wirklich frappierend. Guter Fund, Herr Wolf! Laienhafte Frage: Waren Schöpfformenmacher immer exklusiv für einzelne Papiermühlen tätig, oder gab es bei so massenhaft verbreiteten Motiven wie der Hollandia Serienfertigung? In dem Fall wäre die Zuordnung zu Stennert nicht zwingend.
In Stennert war die Dynastie Vorster ansässig (wohl drei Papiermühlen im Besitz konkurrierender Brüder); auch niederländische Fachkräfte sind belegt (siehe http://www.blogus.de/Pmuehlen.html ). Literatur zur regionalen Papiergeschichte läßt sich leicht recherchieren. Hinweisen möchte ich bloß noch auf Alma Langenbach, Westfälische Papiermühlen und ihre Wasserzeichen, 2 Bände, Witten 1938. Das ist Frau Langenbachs Münsteraner Dissertation, anscheinend ein Standardwerk zu dem Thema.
Besteht Ihr geheimnisvolles Objekt nur aus einem Blatt? Sind wirklich keine Initialen des Papiermachers vorhanden, oder haben die nur nicht auf das Bild gepaßt? (Gönnen Sie mir den Spaß, Ihnen dämliche Fragen zu stellen?)
P.K.
1) Es ist sicherlich nicht auszuschließen, dass es quasi Wasserzeichenmuster gab – vor allem vor dem Hintergrund, dass das Hollandia-Papier weit verbreitet war. Insofern ist Stennert-These schon etwas spekulativ.
2) Das Wasserzeichen befindet sich selbstredend auf einem Bogen Paier. Mir ist jedoch keine „Signatur“ aufgefallen. Überprüfen muss ich jedoch, ob das „Stennert-Papier“ nur vom Arnsberger Regierungspräsidenten verwendet wurde, wie ein zweiter Fund dies nahelegt.
s. a. hier: http://archiv.twoday.net/stories/528989006/
Liebe Kollegen,
der hier angestoßene Diskussion möchte ich mich gern mit einer Frage anschließen und hoffe auf Unterstützung. Ich habe ebenfalls bei einer meiner Hildesheimer Handschriften (geschrieben um 1783) das WZ Pro Patria(wie im australischen Katalog: The ‚Maid of Dort‘ form of the Pro Patria watermark) gefunden, hinzutreten jedoch noch die WZ: H C M, und ab fol. 124: RC (verschlungen) mit Krone darüber, WZ: Polle,WZ: Felde. Das Papier erscheint wie aus einer Werkstatt. Ich konnte zwar in Polle eine Papiermühle ausfindig machen (s. hier:), aber die WZ nicht konkret am Beispiel zuordnen bzw. die WZ Felde oder RC weiter zuordnen. Mit herzlichen Grüßen R. Kunert
Kompetente Ansprechpartner (die wohl kaum Siwiarchiv zur Kenntnis nehmen) findet man hier:
Deutsches Buch- und Schriftmuseum Leipzig, Papierhistorische Sammlungen
http://www.dnb.de/DE/DBSM/Bestaende/PapierhistSammlung/papierhistsammlung_node.htm
Das Museum hat auch eine umfangreiche Wasserzeichensammlung und ist außerdem Herausgeber der Internationalen Bibliographie zur Papiergeschichte.
P.K.
Guter Hinweis! Vielleicht wird die Anfrage auch auf Archivalia – am besten mit Bild – gepostet.
Hallo,
ich bin in Besitz eines Aquarells von Hermann Manskopf, gerahmt45 x 34,5 cm in den Außenmaßen. Es stellt eine Landschaft dar und die original Signatur ist von 1933.
Meine Frage stellt sich nun, wenn ich das Bild veräußere, wie viel kann man hierfür bekommen?
Ein Foto davon kann ich Ihnen umgehend zusenden.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen!
Herzlichst
Ihr
Peter Held
Über den aktuellen „Marktwert“ des Bildes könnten Ihnen am ehesten die regionalen Museen, allen voran das Siegerlandmuseum und das Museum Wilnsdorf, sowie regional tätige Kunsthistorikerinnen bzw. Galerien Auskunft geben. Adressen finden Sie im Kulturhandbuch des Kreises Siegen-Wittgenstein.
Der Spendenaufruf für das Kölner Stadtarchiv ergab 3903 €:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=618836534835298&set=a.571570346228584.1073741830.448106221908331&type=1&theater
– ein schöner Erfolg. Dank an alle siwiarchiv-Lesende, die mitgemacht haben!
Archivalia kommntiert Literaturliste gewohnt robust, aber auch wie immer beachtens- und überlegenswert.
Gluckwunsch, auch von meinem iPad, das Glückwunsch nicht erkennt …
iPAD ging, aber nicht mein Hinweis (Desktop, Chrome) gerade beim Auswandererbeitrag auf den neuerlichen Archivalia-Beitrag, da kam wieder
200 OK
OK
The server is temporarily unable to service your
request due to maintenance downtime or capacity
problems. Please try again later.
Auskunft von Dr. Heinz Braun, Göttingen, vom via E-Mail am 3.11.2013, den ich auf Vermittlung von Dr. Uta Gärtner, Berlin, angeschrieben hatte und der selbst ein Jahr in Myanmar/Birma/Burma gelebt hat: “ ….. Die Sprache ist eindeutig Myanmar/Birmanisch/Burmesisch, d.h. die Handschrift kommt aus Myanmar/Birma/Burma. ….. Leider ist mir außerhalb des Landes noch keine astrologische Handschrift – um die handelt es sich eindeutig – in die Finger gekommen. Es sind 4 (?) astrologische Handschriften, erkennbar an der Kürze des Blattes – die „normalen“ Handschriften sind über 50 cm lang und haben 2 Schnürlöcher -. Bei der ersten läßt sich das Datum erkennen: 1933, also eine relativ junge Hs. …..“
Archivalia weist auf weitere Bibliographien zur Auswanderung nach Amerika hin.
Dazu heute im Lokalteil der WP/WR erschienen: http://www.derwesten.de/wp/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/schenck-sche-herbarium-erbe-eines-grossen-graeserkenners-id8634309.html
Auf folgende Ergänzung der Liste wurde von Kollegin Riedesel hingewiesen: Krämer, Fritz: Ein Diedenshäuser überschreitet die Sonnenlinie, in: Krämer, Fitz (Hrsg.): Wunderhausen Diedenshausen, Wunderthausen, Diedenshausen 1978, Seite 449-454.
Pingback: Nicht mehr ganz so unbekannte Palmblattmanuskripte | siwiarchiv.de
Lieber Herr Wolf,
herrlich und spannend! Vielen Dank für diesen schönen Beitrag zur Blogparade! Das in Sie gesetzte Vertrauen bestätigen die Handlungen des Archivs – prima! Ich bin sehr neugierig, wie die Geschichte weitergeht.
Herzliche Grüße
Tanja Praske
Pingback: Blogparade-Aufruf zu "Mein faszinierendes Kulturerlebnis"
Pingback: Blogparade “Mein faszinierendes Kulturerlebnis”: auch Wissenschaftsblogger/innen sind eingeladen | #KulturEr | Redaktionsblog
Zur Erinnerung
Heute, 13.11.2013 um 16.30 Uhr
Freudenberg, Mórer Platz 1
Flagge gegen rechtes Gedankengut
Mit freundlichen Grüßen
Köppen
Stadtarchivar
Gestern zufällig (!) beim Zeitunglesen entdeckt:
Stellungnahme von Johannes Oechelhäuser zur schlechten Wasserqualität des von ihm genutzten Leimbachs, in: Siegerländer Intelligenz-Blatt vom 6. Oktober 1826, S. 157-159.
Ergänzend noch dieses:
„Eine zweite Papiermühle war 1821 zu Rudersdorf bei Siegen errichtet worden, aber 1840 schon wieder eingegangen. Die Gründung der letzten heute [1936] noch stehenden ‚Papiermühle am Effertsteich auf der Schemscheid‘ erfolgte ein Jahrzehnt später. Der Bruder des obengenannten Johannes Oechelhaeuser, Jakob Heinrich Oechelhaeuser, erhielt am 9. Oktober 1834 Erlaubnis, an seiner Walkmühle am Effertsteich einen Anbau zu setzen, und am 14. April 1835 erschien eine öffentliche Bekanntmachung, nach der die Gebrüder Johannes und Jakob Oechelhaeuser um die Konzession nachsuchen, in ihrer bei dem Effertsteich gelegenen Walkmühle eine Papiermühle anlegen zu dürfen. Die Errichtung dieser Papiermühle auf der Schemscheid geschah jedoch allein durch Jakob Heinrich Oechelhaeuser, der damit der Gründer des Unternehmens war.“
Hermann Klingspor, 100 Jahre Papierfabrik Jakob Oechelhaeuser G.m.b.H. in Siegen, in: Wochenblatt für Papierfabrikation 67 (1936), Nr. 2, S. 27-28. (Klingspor war seit 1928 Inhaber der Firma.)
Und jetzt suchen wir mal fleißig nach Wasserzeichen der Oechelhäuser-Brüder!
P.K.
Danke Herr Kunzmann,
genau diese weiteren Angaben zu den Siegener Papiermühlen standen im Entwurf für meinen nächsten (III) Beitrag, aber nun stehen sie schon mal da…
Tut mir leid, dass ich Ihnen zuvorgekommen bin. Aber es bleibt ja noch genug für Sie zu tun. Den kurzen Beitrag von 1936 faxe ich Ihnen am Montag rüber (an welche Nummer???), falls er Ihnen nicht zufälllig (!!!) schon vorliegen sollte.
Mir fällt gerade ein, dass in den „Siegener Beiträgen“ mal ein Aufsatz über Johannes Oechelhäuser stand (Band 6).
P.K.
Dieter Pothmann, Johannes Oechelhaeuser (1787-1869) – einer der ersten Papiermaschinenfabrikanten in Deutschland, in: Siegener Beiträge Bd. 6 (2001), S. 37-52; ferner vom selben Autor: Zum 200. Jahrestag des Robert’schen Patentes: Johannes Oechelhaeuser, einer der ersten deutschen Papiermaschinen-Hersteller, in: Wochenblatt für Papierfabrikation 128 (2000), S. 102-114. Obwohl es verständlicherweise viele Überschneidungen gibt, handelt es sich um zwei separate Aufsätze Pothmanns.
P.K.
Gute Arbeit des Landesamts für Verfassungsschutz!
Weitere Veröffentlichungen von Wilhelm Schmidt in der Siegener Nationalzeitung des Jahrgangs 1937:
SNZ 11.06.1937 Gedicht Berchmahskeand (Bergmannskind)
SNZ 16.06.1937 Gedicht Schlechter Geschmaak orr gorre Margarin? (Schlechter Geschmack oder gute Margarine?)
SNZ 30.06.1937 Gedicht Dahäm, eh ohser Kammer, (Zuhause, in unserer Kammer)
SNZ 08.07.1937 Gedicht dr Fillste (Der Faulste)
SNZ 31.07.1937 längere Erzählung E zäher Hannel (ein zäher Handel)
SNZ 21.08.1937 Gedicht Dr Stefftekoop (der Siftkopf)
SNZ 26.08.1937 Gedicht Dr Rärer Jong (der Rödgener Junge)
SNZ 27.08.1937 Gedicht Det Veelwänche (das Vielwenige)
SNZ 13.09.1937 Gedicht Dr Stoat vam naije Hus (Das neue Haus)
SNZ 21.09.1937 Gedicht Wenn ech Riese Goliath wäre,,,
SNZ 24.09.1937 Gedicht Herbsttag (hochdeutsch)
SNZ 25.09.1937 Dr Nessebur on de elektrische
SNZ 03.11.1937 Ohs Altmeister am Ambos (Bezug zu Wieland dem Schmid)
man glaubt es nicht:
Wilhelm Schmidt: Tafel an Geburtshaus von Karl Jung-Dörfler. Ansprache bei der Weihe 1930 in Obersdorf, in: Siegerländer Heimatkalender 66, 1991, S. 161-162.
Ein Baustein zur Rezeptionsgeschichte Wilhelm Schmidts. Man sehe aber auch die Sendung „Mittendrin in Obersdorf“ der WDR Lokalzeit Siegen vom 27. April 2009: http://www.youtube.com/watch?v=w7duU5zIOuI . Dort werden ab 2min 35 eine Holztafel mit Zeilen Schmidts vorgestellt und eine Gedicht gelesen.
Martin Schulz hat ein Handbuch der SA mit zahllosen Bildern und Zeichnungen illustriert.
Was soll man da annehmen?
Als Lehrer war er jähzornig und unangenehm.
Seine Wasser in Wasser Maltechnik ist verunglückt.
Man sollte ihn in Ruhe lassen.
Sein Nachfolger Willy Schütz war das Gegenteil von ihm.
Grossartiger Künstler und Lehrer, Assistent bei Oscar Kokoschka gewesen.
Hallo Frau Deubner,
hatten Sie meinen Großvater als Lehrer kennengelernt?
Ich weiß als Enkelin, dass mein Großvater einer jüdischen Familie Schutz gegeben hat. Hierfür hat er sein Leben auf das Spiel gesetzt. Den jüdischen Kerzenleuchter, den er dafür geschenkt bekam, habe ich heute noch.
Heike Schulz
Deutsche Einwanderer = positive Einflüsse, nicht-deutsche Einwanderer und Ureinwohner = negative Einflüsse? Oder wie soll man das verstehen?
P.K.
Worauf begründet sich die von Ihnen aufgemachte Gleichung? Ich kann dies so weder in der Pressemitteilung noch in der Ausstellung erkennen.
Der erste Teil der Gleichung steht so im Text. Wenn man (worin sich anscheinend alle Redner einig waren) behauptet, 1. deutsche Einwanderer hätten die USA in überdurchschnittlichem Maße positiv beeinflußt, 2. die „US-Mentalität“ (was immer das sein soll) sei problematisch, 3. das würde sich zum Guten ändern, wenn man sich wieder auf die positiven deutschen Einflüsse besänne, dann folgt daraus rein logisch der zweite Teil der Gleichung: Die Einwanderer aus anderen Ländern hätten die jungen USA weniger positiv beeinflußt als die Deutschen oder seien gar schuld an den Unerfreulichkeiten der US-Politik. Die Italiener hatten die Mafia mitgebracht, die Iren den Alkoholismus, die Engländer das Fausstrecht („Motto: Der Stärkere gewinnt“ – eine in Deutschland und speziell im Siegerland wohl absolut unbekannte Lebenseinstellung???), die Chinesen das Fast Food, usw. — Kann man denn nicht einfach mal die Proportionen wahren? „Ergebnisse einer Volkszählung aus dem Jahr 1979 zeigten, daß fast 29 Prozent aller Amerikaner deutsche Vorfahren hatten.“ (http://usa.usembassy.de/etexts/ga-ad092883.htm) Wen wundert es, dass sich darunter auch Menschen befanden, die „positiven Einfluss“ auf die amerikanische Gesellschaft hatten, z.B. die erwähnten „Bergbau-Fachleute“. Jede andere Siedlernation könnte aber das gleiche von sich behaupten. Manche Siegerländer scheinen aber ein Problem damit zu haben, dass sie ganz normale Menschen wie alle anderen sind und dass ihr Ländchen nicht der Nabel der Welt ist.
P.K.
Finden sich für Ihre Kritik auch Belege in der Ausstellung selbst?
Ich habe nicht die Ausstellung kommentiert, sondern den obenstehenden Text.
Historische wie aktuelle Belege für provinziellen Dünkel finden Sie auch ohne mich bis zum Abwinken. (Ich behaupte nicht, dass es sich dabei um ein exklusiv Siegerländer Phänomen handeln würde.)
P.K.
Pingback: Ausstellung zur deutschen Auswanderung nach Amerika im Kreishaus in Siegen | siwiarchiv.de
Pingback: Ausstellung zur deutschen Auswanderung nach Amerika im Kreishaus in Siegen | siwiarchiv.de
Hier noch die Angaben aus den Personalveränderungen des Reichsarbeitsdienstes:
Müller, Wilhelm
30.01.1936: Ernennung v. Ofm./NSAD z. Oberfeldmeister/Reichsarbeitsdienst
01.04.1936: Ernennung z. Oberstfeldmeister 6/208a Brün (Abteilungsführer)
01.08.1938: Versetzung v. 6/204 Abtf. Brün n. 3/204(W IV – Westwall) Abtf. Gemünd-Malzbenden
31.08.1942: Ausgeschieden 3/204(Abtf.) Kierspe und Rangverleihung als Arbeitsführer
Vielen Dank für die Ergänzung! Darf ich nach der genauen Quellen- bzw. Literaturangabe fragen?
Hier die Angaben aus den (PV) Personalveränderungen und (DAL) Dienstaltersliste, wie ich sie vorgefunden habe:
Müller, Wilhelm
30.01.1936: Ern. v. Ofm./NSAD z. Oberfeldmeister/RAD
208a (PV 3 v. 04.02.1936 S. 39 RDA-Oz. 54)
01.04.1936: Ern. z. Oberstfeldmeister
6/208a(A 1)(PV 8 v. 29.06.1936 S. 430 RDA 29.6.36/42)
01.01.1937: Stichtag: 6/208a Abtf. – RDA 29.6.36/42
(DAL I v. 01.01.1937 S. 50 Lfd.Nr. 517)
01.08.1938: Vers. v. 6/204 Abtf. Brün n. 3/204(W IV) Abtf. Gemünd-Malzbenden
(PV 54 v. 20.07.1938 S. 7 Lfd.Nr. 110)
31.08.1942: Ausgesch. 3/204(1)
(PV 47 v. 25.09.1942 S. 240 Lfd.Nr. 8)
31.08.1942: Rangverl. Arbeitsführer
3/204 Abtf.(PV 49 v. 10.10.42 S. 246)
Bei Bedarf sende ich auch die Daten von anderen RAD-Führern.
Danke! Verstehe ich es richtig, dass es sich um periodisch erscheinende Veröffentlichung des DAF handelt. Wenn ja wo liegen diese (Bibliothek, Archiv)?
Pingback: siwiarchiv – Monatsstatistik November 2013 | siwiarchiv.de
Hallo Leute,
in Siegen gab es auch einen Arbeitsdienstführer Dr. Ludwig Kirchhoff, welcher die Arbeitsdienstgruppe 209 leitete und am 30. Juni 1937 ausgeschieden ist.
Wer hat dazu weitere Informationen?
Hallo liebe Leser,
hier noch einmal die Daten mit den Quellen:
Kirchhoff, Dr. Ludwig
18.12.1935: Ern. v. Arbf./NSAD z. Arbeitsführer/RAD
(Vbl. 35 Nr. 869 S. 343 Oz. 93)
01.01.1937: Stichtag: 209 Siegen Gruppenführer – RDA 18.12.35/99
(DAL I v. 01.01.1937 S. 16 Lfd.Nr. 72)
30.06.1937: Ausgeschieden – 209(1)
(PV 38 v. 24.07.37 S. 9 Lfd.Nr. 1)
Vbl. = Verordnungsblatt für den Reichsarbeitsdienst
DAL = Dienstaltersliste
PV = Personalveränderungen für den Reichsarbeitsdienst
RDA= Rangdienstalter
Anknüpfen kann man immer!
Zu Dr. Kirchhoff s. http://akteure-und-taeter-im-ns-in-siegen-und-wittgenstein.de/verzeichnis/gesamtverzeichnis#kirchhoff. Im Berliner Bundesarchiv lassen sich zu Akten zu einen Dr. Ludiwig Kirchhoff finden:
– R 77/12489 [Personalakte des Reichsarbeitsdienst] Kirchhoff, Ludwig, Dr., geb. 14.03.1897, 1933 – 1945
– R 9361-I/11138, Sammlung Berlin Document Center (BDC): Personenbezogene Unterlagen der NSDAP
Hallo Leute,
von der „Arbeitsgauleitung XXB Westfalen-Süd“ (Gaustab in Dortmund)
wurde eine Broschüre mit dem Titel „Der Arbeitsdienst Westfalen-Süd“ herausgegeben. Sie erschien 1934, 1936 und 1939.
Wer stellt mir gegen Kostenerstattung von diesen Broschüren Fotokopien zur Verfügung?
Noch eine Ergänzung zum Arbeitsführer Dr. Kirchhoff.
Der Stab der Arbeitsdienstgruppe 209 befand sich zuerst in Hilchenbach. Wann er nach Siegen wechselte ist mir noch unbekannt (vermutlich 1935).
Vielleicht stammt Dr. Kirchhoff aus Hilchenbach?
Neuser: Rudersdorf bei Siegen
Kempf: Herborn
Frahne: Olpe
„I.H.I.“ möglicherweise Johann He(i)nrich Jüngst (Herborn, Haiger, …)
Gruß, P.K.
Link zur Buchvorstelung auf derwesten.de: http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/im-dienst-des-friedens-id8732379.html
Ergänzung zu 2) Kirchhoff, Dr. Ludwig:
00.05.1934: Stichmonat: Ostfm., AG-Ltg. XXB Dortmund, Unterkunftswesen
(Der AG Westfalen-Süd, Dortmund 1934, S. 62)
3) Comblain,(?),
00.05.1934: Stichmonat: Arbf., Gruppenführer 209 Siegen
(D. AG Westfalen-Süd, Dortmund 1934, S. 15)
Pingback: Rezension zu Dieter Pfaus Geschichte der Juden in Ferndorf | siwiarchiv.de
Auf Uli Jungbluths Rezension des Buches in den Siegener Beiträgen 17 (2012), S. 313-314 sei hingewiesen.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ihren Veranstaltungshinweis nehme ich gern in der Rubrik >Veranstaltungen< auf der von mir betreuten o.a. Website (http://www.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de) auf. Soweit Sie uns / mir weitere Dokumente zum Inhalt der Sendung und/oder zu deren Aufzeichnung überlassen bzw. an meine E-Mail-Anschrift zusenden können, wären wir Ihnen dafür dankbar.
Mit freundlichem Gruß aus Bremen!
Günter Knebel,
gebürtig (Jgg. 1949) aus Siegen-Weidenau
Dasist das alte Programm von Geh-Denken 2012…
Danke! Eintrag wurde entsprechend geändert.
s. a. Westfälische Rundschau, 11.12.13
Die Siegener Zeitung berichtete heute lediglich (oder immerhin ?) im Print.
… schade, dass die beiden „Schulen ohne Rassismus“, das Löhrtor-Gymnasium und die Realschule Am Oberen Schloss, und das Jugendparlament nicht in der Auflistung der Akteure erwähnt wurden; waren sie doch mit ihren Projekten (u.a. Stolpersteine) am Ge(h)denken beteiligt und auch an ihrem Standort im Rathaus sehr präsent …
Pingback: Fazit #KulturEr - fantastische Facetten von Kultur (4) #Blogparade
Ob hier weitere Hinweise zu Fritz Müller enthalten sind, muss noch geprüft werden: Gründel, Reinhard: Das Siegerland in der Zerstörungsphase der Weimarer Republik. Eine regionalgeschichtliche Untersuchung von Bedingungen, die zur faschistischen Machtergreifung führten. Schriftliche Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt zur Sekundarstufe I im Fach Geschichte, Gesamthochschule Siegen, Mai 1979
Der Sauerländische Gebirgsverein (SGV) brachte mindesten drei Bände
mit folgendem Titel heraus:
„Euch grüßt die Heimat“
Untertitel: Feldpostgabe des SGV an seine feldgrauen Mitglieder zu Weihnachten 1940 (1941,1942,).
Die Bände waren nicht im Handel zu erwerben.
Auf der ersten Seite befindet sich jeweils ein Zitat Hitlers und auf der folgenden Seite ist ein Bild Hitlers abgedruckt.
In den Bänden befinden sich verschiedene Gedichte und Erzählungen mit deutlichen Bezügen zur Nnationalsozialistischen Blut und Boden Ideologie westfälischer Heimatdichter,unter anderem Beiträge von Josefa Berens – Totennohl.
In der Ausgabe 1940 ist das Gedicht “ Em Saijerland“ von Wilhelm Schmidt abgedruckt und in der Ausgabe von 1942 das Gedicht „De Hornerbläser em Nassauer“.
Damit ist auch eine überregionale Tätigkeit Schmidts belegt.
Wenn im Rahmen der Eisenstraße Südwestfalen mit öffentlichen Geldern kurze thematische Filme produziert werden, sollte deren Inhalt besser recherchiert werden: Beispiel:
1. Die zu Beginn des Films zu sehenden Reste der Bergbausiedlung Altenberg stammen aus dem 13. Jahrhundert. Der Kommentar spricht von urkundlichen Erwähnungen im 17. Jahrhundert.
2. Das Naturschutzgebiet befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Gruben Altenberg und Heinrichsegen. Im Film wird von der Grube Victoria gesprochen.
Herzlichen Glückwunsch, Stefanie Siedek-Strunk! ;-)
Pingback: 250 Ausstellungsstücke für “Siegen an der Heimatfront” | siwiarchiv.de
Pingback: Ein Versuch: Regionales 1. Weltkrieg-Projekt im Blog | Archive 2.0
Pingback: “Monument man” Clooney in Siegen – | siwiarchiv.de
Pingback: Denkmal des Monats Januar 2014: Ehemaliger Gasthof, Zum Festplatz 2 (Bad Berleburg) | siwiarchiv.de
Der Bericht wurde nicht nur in der Siegener Lokalzeit gesendet, sondern auch am 2. Januar 2014 in der WDR Lokalzeit Aachen.
Link zum Video der Aachener Lokalzeit: http://bernsau.wordpress.com/2014/03/16/aachen-die-jagd-nach-dem-domschatz/
Die Gründungsversammlung des neuen Trägervereins
4Fachwerk e.V.-das Mittendrin-Museum ist
am Dienstag 14.01.2014 um 19.00 Uhr im
Rathaus Freudenberg, Ratssal,
Mórer Platz 1, 57258 Freudenberg
Detlef Köppen
Stadtarchivar
Der Verein 4Fachwerk wurde am 14.01.2013 um 20.14 Uhr im Ratssaal des Rathauses Freudenberg von 40 Mitglieder gegründet.
Der Vorstand besteht aus :
Dieter Siebel, Vorsitznder
Dr. Ingrid Leopold, stellv. Vorsitzende
Heinrich Hubbert III, stellv. Vorsitzender
Bernd Brandemann, Schriftführer
Peter Mannes , Schatzmeister
Susanne Bensberg-Kreus, Beisitzerin
Christian Berner, Beisitzer
Michael Müller , Beisitzer
Ulrich Tiede, Beisitzer
Die nächsten Ziele des Vereins sind die Eintragung in das Vereinsregister,
die Erlangung der Gemeinnützigkeit, der Übernahmevertrag mit der Stadt Freudenberg und natürlich die Gewinnung weiterer Mitstreiter.
Die Gründung des Vereins hat es in die heutigen Kulturnachrichten von WDR.de geschafft.
Pingback: 2 Jahre siwiarchiv – Aufruf zur Blogparade | siwiarchiv.de
Wunderbar und danke für die Verlinkung! Ich wünsche sehr viele Beiträge und überlege mir zum Thema auch etwas.
Schöne Grüße aus München
Tanja
Pingback: (Archiv-)Blogparade! | Archive 2.0
Pingback: Blogparade: Warum sollten Archive worüber wie bloggen? | Redaktionsblog
Pingback: Günter Dick, St. Augustin: Metallbildhauer Prof. Otto Sticht (1901-1973) – | siwiarchiv.de
Pingback: Blogparade: Warum sollten Archive worüber wie bloggen? | Redaktionsblog
Pingback: Warum wird im Stadtarchiv Speyer gebloggt …? | Archive 2.0
Mal frei heute Mittag getextet, mit Grüßen aus Speyer! http://archive20.hypotheses.org/1156
Vielen Dank für den Beitrag! Der zunächst die jüngere deutsche Archivbloggeschichte skizziert und einen Einblick in die Speyersche Archivblogkonzeption gibt.
„Born to be filed“, tumblr-Blog eines Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste FR Archiv, der an der Fernweiterbildung Archiv an der FH Potsdam teilnimmt folgt als Zweiter Kollege unserem Aufruf zur Blogparade und betont die grenzenlose Kreativität der Archivierenden: http://fam03pf.tumblr.com/post/74392230103/warum-sollten-archive-woruber-wie-bloggen-ein-aufruf . Vielen Dank!
Über diese Fortbildung wird gebloggt. Zweit Einträge sind bereits verfügbar:
1) Begrüßung durch Dr. Walter Hauser, Prof. Dr. Bärbel Kuhn und Dr. Astrid Windus, 24.1., 15 Uhr: http://1914lvr.hypotheses.org/950
2) Eröffnungsvortrag „Grenzenloser Krieg? Der Erste Weltkrieg in Computerspielen“ von Prof. Dr. Angela Schwarz, Siegen, 24.1., 15.15 Uhr: http://1914lvr.hypotheses.org/952
http://madebyejanine.tumblr.com/post/74480527467/warum-sollten-archive-worueber-bloggen-aufruf-zur
#FAM03
Danke! Ein Beispiel für Blogs als Marketinginstrument von Archivpublikationen.
Da mache ich doch gerne mit!
Hier mein Beitrag „Warum ein Blog auch etwas für Archive ist“:
http://www.social-media-werkstatt.at/2014/01/24/warum-ein-blog-auch-etwas-f%C3%BCr-archive-ist
Herzlichen Gruß
Huberta Weigl
Vielen Dank für diesen ebenso lesens- wie beachtenswerten Beitrag! Der Blick von außen ist sehr hilfreich bei den ersten Gehversuchen.
Pingback: Lesenswert: Joachim Kemper, Warum wird im Stadtarchiv Speyer gebloggt …? | Geschichte Bayerns
Pingback: Worüber bloggen? Impuls: Blogparaden
Pingback: Worüber bloggen? Impuls: Blogparaden
Weiterer Blogeintrag zu den Impulsvorträge von Dr. Jens Aspelmeier: „Biene Maja – ein Bestseller für Kinder und Soldaten“, Prof. Dr. Bärbel Kuhn: „Le Tour de la France et de l’Europe – Lektionen für Kinder (1877–1916)“ und Prof. Dr. Angela Schwarz: „Krieg und die Frage von Grenzen in modernen Computerspielen – Materialien“, 25.1., 14.30 Uhr: http://1914lvr.hypotheses.org/1024
Pingback: Eine Generation künftiger Blogger-ArchivarInnen? | Archive 2.0
Vielen Dank für den Aufruf zu dieser Blogparade, die schon so viele spannende Beiträge sammeln konnte. Ich möchte mich heute noch anschließen – mit einem Beitrag, der sowohl Archive als auch Museen betrifft: http://www.marlenehofmann.de/blog/2014/01/28/bloggende-museen-archive-warum-bloggen-keine-zeitverschwendung-sein-muss/
Herzliche Grüße, Marlene Hofmann
Hier mein Beitrag zur Blogparade:
http://fam03-jk.tumblr.com/post/74830784724/warum-sollten-archive-worueber-bloggen-aufruf-zur
Viele Grüße aus Nürnberg
Marlene Hofmann weitet den Blick der Blogparade sinnvollerweise in Richtung der Museen aus: Vielen Dank dafür nach Kopenhagen!
Felicitas Noeske bloggt für ihre tolle Bibliothek und ihr (legales, weil mit Zustimmung des Staatsarchivs bestehendes) Gymnasialarchiv. Sie hat aber Archivalia für ihren beitrag zur Blogparade ausgewählt
http://archiv.twoday.net/stories/640154217/
Bitte um Pardon, ich hatte den Beitrag von Klaus Graf nicht gesehen, als ich meinen unten drunter setzte. Ich danke ihm, dass ich „Archivalia“ für den kleinen Artikel benutzen durfte, denn mein Blog „Bibliotheca Altonensis“ ist eher eine kommentierte Bilderschachtel (auch als solche gedacht) und Texte werden dort weniger wahrgenommen als in Archivalia.
Ihnen beiden vielen Dank für den schönen Beitrag! Das Schularchivblog sollte meines Erachtens sein Licht nicht so unter den Scheffel stellen – wer mit Peter Behrens aufwarten kann, der darf unbescheidener daherkommen.
We’ll do our best:-)
Dankeschön, Ihr Aufruf hat mich zu jenem Artikel bei Archivalia inspiriert: http://archiv.twoday.net/stories/640154217/
Falls er konveniert, mögen Sie ihn gerne hier einreihen, ich würde mich darüber freuen!
Das große alte Flaggschiff der Archivblogs reihte sich soeben auch in die Gratulantenschaar ein:
http://archiv.twoday.net/stories/640154245/
Vielen Dank für das Lanze brechen für mehr archivische und wissenschaftliche Blogs! Die Teilnahme der „Mutter aller Archivblogs“ ist uns eine Ehre.
Siegener Zeitung berichtete heute von der empörten Reaktion der Kreisgruppe des Bundes der Vertriebenen und von der Freude des Siegener Kunstvereins auf eine spannende Veranstaltung.
Pingback: Lesetipp: “Ist ein Archiv, das nicht bloggt, ein schlechtes Archiv?” | Redaktionsblog
Bericht der Siegener Zeitung über den gestrigen Vortragsabend: http://www.siegener-zeitung.de/siegener-zeitung/Denkmal-nicht-mehr-zeitgemaess-bf21a849-0077-41d0-8b24-dbb33b78dcca-ds
Link zum Artikel der Westfälischen Rundschau über den Vortrag v. 31.1.2014: http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/denkmal-diskussion-in-siegen-id8939953.html
„Das Gasthaus Stünzel ist das Wahrzeichen des gleichnamigen Wittgensteiner Höhendorfs. Es war ein legendärer Ausflugsort für betuchte Sommmerfrischler und Jäger aus dem Siegerland. Jahrzehntelang stand es leer und drohte zu verfallen. Holländer haben nun das alte Gasthaus gekauft und restaurieren es gemeinsam mit Bewohnern aus Stünzel.“
Link zum Beitrag in der WDR- Lokalzeit Südwestfalen vom 31.01.2014 : http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit/lokalzeit-suedwestfalen/videodasaltegasthaus100.html
Darf ich darum bitten, dass auch andere Archivare sich an der Seite „Digitale Sammlungen von Archiven“ sich aktiv beteiligen und dort unter M nach
https://de.wikisource.org/wiki/Digitale_Sammlungen_von_Archiven#M.C3.BCnchen.2C_Universit.C3.A4tsarchiv
das Staatsarchiv Münster eintragen? Danke.
Hallo Herr Graf, Wikisource ist ergänzt wird ab sofort hinsichtlich der digitalen Münsteraner Bestände kurrent gehalten. Danke für den Hinweis! Beste Grüsse, Thomas Reich
Hier der Beitrag eines Medienarchivars zum Thema „Bloggen im Archiv“:
http://fam03mm.tumblr.com/post/75588720167/warum-sollten-archive-wor-ber-bloggen
Vielen Dank für den Beitrag! Fachlicher Austausch ist tatsächlich ein sehr guter Grund zu bloggen.
Pingback: Video zur Vitrinenausstellung “Von den Stadtprivilegien zur Standeserhebung” | siwiarchiv.de
– Die Denkmaldiskussion aus der Sicht des „betroffenen“ Historikers: http://www.hans-hesse.de/ . Auch dessen Facebook-Seite – https://www.facebook.com/hans.hesse.75 – enthält Einträge zur Diskussion.
– Aus der Sicht eines Kommunalpolitikers stellt sich die Diskussion wie folgt dar: http://gerhard-koetter.de/?p=5706 .
– Die Printausgaben der Siegenr Zeitung nach der Veranstaltung enthalten einige Leserbriefe.
Zur Ausstellung und zur Lesung ist inzwischen auch eine Pressemitteilung der Universität Siegen unter folgendem Link erschienen:
http://www.uni-siegen.de/start/news/oeffentlichkeit/567309.htm
Hier kommt der Beitrag des Hochschularchivs der RWTH Aachen:
http://www.archiv.rwth-aachen.de/?p=5433
Pingback: Vortrag “Alte Häuser und Hausnamen in Buschgotthardtshütten” | siwiarchiv.de
Pingback: WDR 5 Scala auf den Spuren der realen Monuments Men | siwiarchiv.de
Pingback: WDR 5 Scala auf den Spuren der realen Monuments Men | siwiarchiv.de
Pingback: Der Krieg, wie ihn die Menschen erlebten | siwiarchiv.de
Auch Radio Siegen widmete sich dem „Monument men“ in zwei Beiträgen am 13.2.14.
Auf das Blog der Kunsthistorikerin Tanja Bernsau sei hier hingewiesen. Bernsau hat die Geschichte der Einheit am Sammelpunkt Wiesbaden untersucht und einige Beiträge dazu gepostet.
Pingback: Bloggen im Archiv - warum und worüber?
Pingback: Bloggen im Archiv - warum und worüber?
Finalement geschafft – hier nun mein Beitrag zur Blogparade: http://www.tanjapraske.de/2014/02/19/bloggen-im-archiv-warum-und-worueber/#more-328
Schöne Grüße
Tanja Praske
Ein Videoclip zeigt: Wiederaufbauarbeiten in Bonn, Beethovenhaus, Wiederholung des Inventars des Beethovenhauses aus einem Stollen bei Siegen und Anlieferung in Beethovenhaus durch US-LKW. Klavier und Flügel des Musikers, Büste
http://www.history-vision.de/historisches-filmarchiv/details/videoclip/1720.html
Hier nun noch der Hinweis auf das frisch geschlüpfte Blog des Archivtags Rheinland-Pfalz / Saarland:
http://archivtag.hypotheses.org/uber
Wir hoffen auf rege Beteiligung! ;)
Beste Grüße,
Andrea Rönz
Mein Beitrag zur Blogparade
ein FaMI aus Mecklenburg-Vorpommern
http://fam03faha.tumblr.com/post/77358679772/mein-beitrag-zur-blogparade
Vielen Dank für diesen Beitrag! Der Einsatz von Blogs zur Konkretisierung des Berufsbildes „Archivar/in“ stellt m. E. eine wichtige und auch bald wahrzunehmende Aufgabe des archiv(ar)ischen Berufsverbandes dar.
Pingback: “Warum sollten Archive worüber wie bloggen?” siwiarchiv.de ruft zur Blogparade auf | Geschichte Bayerns
Pingback: Warum sollten Archive worüber wie bloggen? – Das Archiv als dynamischer Ort | drama on twitter
Hier nun – knapp vor Schluss – mein Beitrag:
http://dramaontwitter.wordpress.com/2014/02/24/warum-sollten-archive-woruber-wie-bloggen-das-archiv-als-dynamischer-ort/
Herzliche Grüße
Tristan Schwennsen
Das Universitätsarchiv Bayreuth bloggt Lesenswertes zur Parade: http://archive20.hypotheses.org/1231 . Vielen Dank!
Pingback: Warum sollten Archive worüber wie bloggen? Oder: Die Herausführung der Archive aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit. | Archive 2.0
Bloggen als Mittel des mündigen Archiv(ar)s – ein Beitrag von Bastian Gillner, einer der Facebook-Redakteure im Landesarchiv NRW: http://archive20.hypotheses.org/1244#comment-8083 . Vielen Dank!
Pingback: Ein Archivtagsblog für Rheinland-Pfalz und das Saarland | Archivtag Rheinland-Pfalz / Saarland
Das Tagungsblog ist ein Grund für Archive zu bloggen. Vielen Dank für die Teilnahme nach Linz am Rhein!
Pingback: Lesetipp: Bastian Gillner, Warum sollten Archive worüber wie bloggen? Oder: Die Herausführung der Archive aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit. | Geschichte Bayerns
Pingback: Die “Monuments Men” in Siegen: Großes Interesse an Sonderveranstaltung | siwiarchiv.de
Das Archiv im Rhein-Kreis Neuss setzt seine historische Vortragsreihe „Geschichte im Gewölbekeller“ fort: Am Dienstag, 11. März, referiert Dr. Friedrich Weber aus Siegen über das Thema „Kapelle – Kirche – Krankenhaus: Vincenz Statz (1819-1898), Architekt der Neugotik“. Der Vortrag wird in Zusammenarbeit mit dem Kreismuseum Zons angeboten.
„Auf Vincenz Statz gehen die Baupläne für die Zonser Kirche St. Martinus zurück. Er hat aber auch an vielen anderen Orten im Rheinland und darüber hinaus Spuren hinterlassen. Wir hoffen, dass der Vortrag, bei dem auch interessantes Bildmaterial präsentiert wird, auf großes Interesse stößt“, so Archivleiter Dr. Stephen Schröder.
Alle Veranstaltungen der Geschichtsreihe finden im historischen Gewölbekeller unter der Nordhalle von Burg Friedestrom in Dormagen-Zons statt und schließen mit einem gemütlichen Beisammensein. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Nähere Informationen unter Telefon (02133) 530210.
Quelle: Pressemitteilung der Kreisarchivs der Rhein-Kreises Neuss, 28.2.2014
Auf Statz gehen auch die die Folgenden Bauten im Nachbarkreis Altenkirchen zurück: Katholische Pfarrkirche St. Ignatius Betzdorf und Katholische Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt Mudersbach.
Der Beitrag des Weblogs Kulturgut zur Blogparade:
“Machen Sie Ihr Archiv zu einem wirklichen ‘Bürgerarchiv’ …” http://kulturgut.hypotheses.org/342
Vielen Dank für den Beitrag! Just in time – 51min vor Ablauf der Frist :-).
Pingback: Vom Ende einer Blogparade | siwiarchiv.de
Vielen Dank für diese Blogparade samt Fazit – vorbildlich. Ich erlebte es immer wieder, dass die Initiatoren von Blogparaden das Potenzial nicht ausschöpften, eine Zusammenfassung bzw. Bewertung der Beiträge unterließen. Ihr habt das anders gemacht: Beiträge kommentiert (auch das ist leider nicht Usus) sowie in Euer Netzwerk hineingeteilt.
Die Beiträge bieten viele Denkanstöße für Kulturinstitutionen insgesamt, aber auch für mich. Ich hoffe, dass angehende Archivare das Bloggen für sich entdecken, ihr Arbeits-/Forschungsgebiet Fachleuten und Laien gleichermaßen näher bringen. Stoff zum Nachdenken dürfte für viele da sein. Wenn sich etwas aus der Blogparade auch für Euch ergibt, freue ich mich über die Berichterstattung hier.
Schöne Grüße aus München und bis bald in Stuttgart
Tanja Praske
Auch ich freue mich sehr über das Fazit, es gibt auch Anlass noch einmal in die Beiträge hineinzulesen und alle noch einmal im Überblick zu sehen. Schön, dass ich als Kommentator „von außen“ dabei sein durfte, ich habe dadurch viel mehr über die bloggenden Archive erfahren und freue mich darauf, über Blog und Twitter in Kontakt zu bleiben.
Herzliche Grüße, Marlene Hofmann
Die Westfälische Rundschau berichtete am 28.2.: http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/siegener-neue-zeitung-lesestoff-aus-der-nachkriegszeit-id9048649.html
Am 4.3. berichtete die Westfälische Rundschau vom Asylarchiv in Freudenberg: http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/nach-einsturz-des-koelner-stadtarchivs-lagern-akten-im-siegerlaender-exil-id9075896.html
Eine sehr interessante Sache diese Blogparade. Sie reicht in jedem Fall auch in andere Instituionen hinein. Spannend, was von außen dazu gepostet und geschrieben wurde. Es ist richtig, dass ein BLog die Sichtbarkeit eines Archivs nach außen, aber auch nach Innen erhöht. Der Zuspruch von der Seite der Auszubildenen lässt hoffen, dass die nächste Generation grundlegend anders mit dem Thema Web 2.0 umgehen wird, als die gegenwärtige.
Herzlichen Glückwunsch zu Deinem Buch.
Ich finde es sehr wichtig, daß es noch Menschen, wie Dich gibt, die das kulturelle Erbe in Wort und Bild festhalten.
Vieles wäre schon längst in Vergessenheit geraten, würde es nicht Menschen geben, die wie Du, historisches wieder in unseren Gedanken lebendig werden lassen.
Ich wünsche Dir, lieber Heinz, weiterhin viel Kraft und Spaß und sende Dir einen ganz herzlichen Gruß!
Karo
(entnommen aus meinem Gästebuch)
http://archiv.twoday.net/stories/714908878/
Die nicht unerwartet deutliche Kritik Grafs sei zum Lesen empfohlen.
siwiarchiv versteht sich primär nicht als wissenschaftliches Rezensionsorgan (s. Editorial und hier). Es verweist zunächst lediglich auf neue erschienene Literatur und freigegebene Webangebote zur regionalen Geschichte. Sollten Literatur oder Webangebote Mängel aufweisen, so kann hier daher gerne entsprechend kommentiert und ggf. darüber diskutiert werden. Dies gilt umso mehr, wenn Webangebote zur Diskussion keinen Raum bieten.
Pingback: Zeitzeugenprojekte an der Clara-Schumann-Gesamtschule Kreuztal | siwiarchiv.de
Pingback: Ausstellung zum Wettbewerb „Schutzbau für Ausgrabungsstätte am Gerhardseifen“ | siwiarchiv.de
s. a. Westfälische Rundschau, 13.3.2014
ebidat.de hat sich über die letzten 10 Jahre ja schon sehr vorteilhaft entwickelt. Diese Arbeit ist wirklich zu würdigen.
Einen wirklich wichtigen Beitrag zu den Burgen und Schlössern im deutschsprachigen Raum leistet seit Jahren auch Andreas Hein. Früher mit seinem Burgeninventar. Heute mit alleburgen.de.
Er listet hier über 2.300 Burgen und Schlösser in NRW auf. Akribische Recherche und unermüdliche Arbeit an seiner Website haben diese für mich zur Nummer Eins der Burgenseiten gemacht, wenn es darum geht einen ersten Überblick zu den sogar unbekanntesten Anlagen zu bekommen.
Zum Burgenportal s. a. http://www.burgerbe.de/2014/02/17/neues-burgenportal-16-burgen-in-krefeld/ und http://www.burgerbe.de/2013/09/22/lvr-und-burgenvereinigung-wollen-ubersicht-uber-alle-burgen-in-deutschland-und-europa/
Ich finde es grundsätzlich gut, dass es so etwas wie das Ebidat-Projekt überhaupt gibt. Mängel an der Quellen-Arbeit mögen schon sein, aber eine wissenschaftliche Datenbank, die alle allein in Deutschland ca. 18.000 – 22.000 Schlösser, Burgen, abgegangene Burgen und Burgruinen erfasst, fehlt bislang. Da hat auch das umfassende „Alleburgen“ erst 1/10 geschafft.
Radio Siegen berichtet heute von der Kulturausschusssitzung der Stadt Siegen am 18.3.2014 und TOP 6 wurde über dem Sachstand berichtet:
„Walter-Krämer-Platz“ beim Kreisklinikum in Weidenau
Entwurf der Platzgestaltung soll bald öffentlich vorgestellt werden
Bis zum Herbst soll der Bereich vor dem Haupteingang des Kreisklinikums in Weidenau künstlerisch als „Walter-Krämer-Platz“ gestaltet sein. Der Westerwälder Bildhauer und Maler Erwin Wortelkamp wird das machen. Wie genau der Platz einmal aussehen wird, soll in einigen Wochen vorgestellt werden. Das hat die Siegener Stadtverwaltung im Kulturausschuss angekündigt. Wortelkamp und die Führung des Kreisklinikums seien im Moment in der Endabstimmung des Projekts. Vorgesehen ist eine Plastik an der Gebäudefassade, ein Wortelkamp-Bild werde in der Eingangshalle hängen. Traute Fries von der SPD nannte die Symbolik Wortelkamps „sehr zutreffend für das Wirken Walter Krämers“. Fries äußerte aber die Befürchtung, dass so mancher Besucher das Kunstwerk nicht verstehen werde. Der Siegener Kommunist Walter Krämer war in der NS-Zeit mehrfach festgenommen und inhaftiert worden. Im KZ Buchenwald betreute er Mithäftlinge medizinisch. Das brachte ihm den Beinamen „Arzt von Buchenwald ein“. Die israelische Gedenkstätte Yad Vashem ehrte Walter Krämer mit dem Titel „Gerechter unter den Völkern“.
s. a. Westfälische Rundschau, 19.3. 2014 und Siegener Zeitung, 19.3.2014
Christian Trojans hat eine Computer Animation zu einer Wasserhebemaschine erstellt. Sie ist auf der Grundlage von Archivalien des
Wirtschaftsarchives in Dortmund am Beispiel der Wasserhebemaschine des
Bergwerks Guldenhardt / Dermbach (Bestand F 40 Wendener Hütte)konstruiert worden.
Sehr schön geschriebener Artikel. Selber bin Ich gebürtiger Siegener, aber belgiër. Zu der Zeit war Ich gerade mal 2 Jahre alt
Im Dorfbuch Kaan – Marienborn, erschienen 1957 und verfasst vom bekannten Siegerländer Nationalsozialisten Lothar Irle finden sich auch drei Gedichte von Wilhelm Schmidt.
Auf Seite 104 bezeichnet Irle Schmidt als „..der prächtige Heimatdichter..“.
Gut bekannt waren beide sicher miteinander und Seilschaften innerhalb der
der Heimatszene hielten so manchen Sturm der Zeit aus.
Was sie heute vereint?
Nach beiden ist nun eine Straße benannt!
Pingback: Ausstellung zum Wiederaufbau in Siegen | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv – Monatsstatistik März 2014 | siwiarchiv.de
Ein klasse Heft – Frau Dr. Achingers Art. über die letzten Juden in Arfeld lohnt allein den Kauf, aber auch die anderen Art sind recht interessant und gut aufgearbeitet. Herr Dr. Lückel leistet echt gute Arbeit – besser als das Siegerländer Geschichtsheft! DANKE – und kauft es!!!!!!
Heute widmet sich die Westfälische Rundschau problematischen Straßenbenennungen im Siegener Stadtgebiet, u. a. der Lothar-Irle-Str. im Ortsteil Kaan-Marienborn: http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/ehrung-mit-problemen-in-siegen-id9193128.html . Der Artikel nimmt Bezug auf die Elkars Forschungen, zuletzt in den „Siegener Beiträgen veröffentlicht.
Pingback: Was haben der Hollywood-Streifen „The Monuments Men“ mit einer Siegerländer Grubenlampe gemeinsam? | siwiarchiv.de
Pingback: Ausstellung “Historische Wege” im Forsthaus Hohenroth eröffnet | siwiarchiv.de
„…. Die Printausgabe 324 Seiten, 9.99 € ist …. auch erhältlich. Über amazon und im Regionalen Buchhandel ( Hugendubel, Mayersche, Mankelmuth Weidenau, Kreuztal und Betzdorf, Braun in Neunkirchen, Bergbaumuseum Herdorf- Sassenroth….“
Frdl. Hinweis Achim Heinz via E-Mail v. 2.4.14
Ist dies eine öffentliche Veranstaltung, d.h. können interessierte Menschen ohne Voranmeldung teilnehmen? Vielen Dank für eine baldige Rückmeldung und freundliche Grüße.
M.W. ist dies eine öffentliche Veranstaltung. Ansprechpartner der Arbeitsgemeinschaft ist Gerhard Moisel, Haus der Kirche, Burgstr. 21, 57072 Siegen. Dort können Sie zur Sicherheit nachfragen.
Die Veranstaltung ist öffentlich, BesucherInnen sind
willkommen!
Da ich leider nicht teilgenommen habe würde ich gerne wissen, ob der Vortrag zu einem späteren Zeitpunkt nochmal wiederholt wird. Vielen Dank und freundliche Grüße!
Nein, der Vortrag wird nicht wiederholt,
wenn du aber eine bestimmte Frage zu dem Thema hast, melde dich bei mir.
Dafür müsste wohl das WDR-Gesetz geändert werden: http://www1.wdr.de/unternehmen/organisation/rechtsgrundlagen/rechtsgrundlagen_gesetz100.pdf . Archivpflichtig ist der WDR wohl nach § 11 des ArchivG NW.
Dieser Artikel von Schmidt (W[ilhelm] Sch[midt]: Det Reise: Freaher – ho – on spärer, Siegerländer Heimatkalender 1964, S. 177-178) erschien bereits drei Jahre zuvor in: Aus dem Siegerland 11, 1961, H. 2, S. 4-5
Für mich als ortsunkundigen schwierig, aber ich tippe auf das Kreishaus Siegen-Wittgenstein. Architekt: Günter Reichert, 1974 wurde der Grundstein gelegt, offiziell eingeweiht wurde der Bau 1978. So, ich hoffe, dass ich da keinen Bock geschossen habe.
Oh, den Lösungsweg vergessen.
1. Google Bilder Suche um markante Hochhäuser in Siegen zu finden (habe mal auf Siegen getippt).
2. Am ehesten kam das Kreishaus hin.
3. Viele Fehlversuche in Google.
4. Auf slideshare was zu den Kreishäuser im Kreis Siegen-Wittgenstein gefunden.
5. Hoffentlich in der Eile richtig gelesen.
Danke, lieber Herr Wolf, für die erfrischende Aufgabe (die wahrscheinlich schon gelöst ist)! Mehr davon!
1. Es handelt sich um das Kreishaus, auch Kristallpalast genannt
2. Erster Spatenstich 11/1974, Fertigstellung 09/1978
3. Architekt Günter Reichert
Lösungsweg: www. google.de – Stichwort Kreishaus Siegen-Wittgenstein erbaut- und dann hatte ich schon die betreffende Seite http://www.siegen-wittgenstein.de/doc.cfm?seite=672&urlDoc=pfaddownloads/672downloads/1_Machtzentralen.pdf
Frohe Ostern!
Frank Burmeister
Hallo Herr Wolf,
es ist ein Foto des Kreishauses. Da ich am 1.8.1977 meine Ausbildung zunächst im Ordnungsamt in Weidenau begonnen habe, bin ich einer der ersten Azubis gewesen, die im Mitte September 1977 bereits in das Kreishaus einziehen durften. Ich Landmädel in diesem großen Glaspalast in Siegen, ich bin immer sehr stolz darauf gewesen. Der Architekt war Herr Günter Reichert, der – so glaube ich- einen Architektenwettbewerb gewonnen hat.
Auch die Nachbearbeitung der Tagung in Stuttgart findet sich auf: http://archive20.hypotheses.org/ . Bilderimpressionen , Dokumentation der Tweets, Präsentationen und Volltexte sind bereits online.
Leider ist der Vortrag wegen Erkrankung des Referenten ausgefallen. Er soll aber nachgeholt werden.
Ich vermute, dass es nicht das Kreishaus in Siegen ist. Es sieht ihm zwar ähnlich, aber die Proportionen der beiden Schenkel der Fassade stimmen nicht.
Der Entwurf des Kreishauses Siegen wurde bei einem Bauvorhaben in Stuttgart ähnlich ausgeführt, wobei ich nicht weiß, welches Gebäude zuerst geplant wurde. Das Gebäude auf dem Foto scheint das damalige GENO-Haus bzw. das Gebäude der heutigen DZ-Bank in Stuttgart, Heilbronner Straße 41, zu sein. Hier stimmen auch die Proportionen mit dem obigen Bildausschnitt.
Architekten dieses Gebäudes waren Professor Walter Belz und Professor Hans Kammerer (http://www.geno-haus.de/372.aspx). Die offizielle Offizielle Einweihung war danach am 10. Mai 1973, erbaut wurde es in den Jahren davor. Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Hochh%C3%A4user_in_Stuttgart) gibt das Baujahr mit 1972 an.
Gratulation! Wer, wenn nicht Sie, sollte die Lösung ermitteln können.
Von den Baudaten spräche ja einiges für die These, dass der Stuttgarter Bau zuerst geplant wurde. Allerdings stellt sich nun auch die Frage, ob noch weitere Hochhäuser mit dieser Fassadengestaltung gebaut wurden.
Sieht ein bisschen so aus, als habe Architekt Dominique Perrault 1990 ff. seine Bibliothèque Nationale den France (BNF, Paris) in Siegen abgeguckt, und weil’s ihm so gefallen hat, das Kreishaus gleich in vierfacher Ausführung an die Seine gestellt…:-) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Le_parvis_de_la_biblioth%C3%A8que_nationale_de_France_%284945111470%29.jpg
Eine Evaluierung und Aktualisierung des ArchivG NRW halte ich für angebracht. Allein der § 7 (7) zeigt die anachronistische Sichtweise, wenn geregelt wird: „Das Landesarchiv kann in besonders begründeten Fällen auf Antrag nach Ablauf der Schutzfristen die Überlassung von Vervielfältigungen von Archivgut an Archive, Museen und Forschungsstellen zulassen.“
Dies widerspricht der Open Data und Open Access Idee, verhindert die Zusammenarbeit mit historischen oder genealogischen Vereinen und negiert die Existenz von Digitalisaten.
Der Open Data Grundsatz muss in das ArchivG NRW einfließen.
Lt. http://archivamt.hypotheses.org/613 nimmt auch das Stadtarchiv Kreuztal am Projekt teil.
Archivalia verweist und kommentiert die „Regelungen über den Zugang für Wissenschaft und Forschung zum Archivgut der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in der Bundesrepublik Deutschland und des Deutschen Rundfunkarchivs „
Brilon hat eine Beamtenabteilung? Und alle essen gern Italienisch (bis auf Deutz und Müsen, die essen nur Rheinisch?:-) Nein? Schwierig…
Ich würde sagen, dass das eine Legende für eine Liste, Karte oder für Aktenbestände ist, die eine Mitgliedschaft in (oder die räumliche Zuständigkeit von) Knappschaftsvereinen oder Knappschaftspensionkassen angibt. Es gab einen Rheinischen Knappschaftsverein, einen Heller Knappschaftsverein, einen in Brilon, einen in Müsen etc. „Beamten“ sind die heutigen Angestellten.
Alternativ könnte es auch was mit Vereinsfarben oder einem Element der Knappenuniformen zu tun haben, aber da kenne ich mich leider gar nicht aus…
Bitte um Pardon für meine Scherzantwort oben, aber ich habe derlei noch nicht gesehen. Ich kann mir nur etwas wie eine – optische – Kennzeichnung durch Farben (vielleicht von Ablagen im Regal? Farbige Deckel/Kästen o.ä.?) vorstellen, für die das Abgebildete so etwas wie eine Art Legende ist?
Vielleicht Ordnerrücken?
In Büros und Kanzleien machen sie solche farbigen Kennungen von Ordnern manchmal. Die Farben scheinen in einer Art Zickzackkurs „anzuschließen“? Jedenfalls irgendetwas „Räumliches“, auch wohl älter (die Schrift ist bemühte ältliche Schönschrift…)
Nur eine Vermutung: Es geht um Akten der Bergämter bzw. -Reviere, die ja teilweise aufgelöst und neu zugeordnet wurden? Es gab Bergreviere in Hellertal, Arnsberg, Müsen und in Brilon ein Oberbergamt, daher die Beamten ;-) Und Deutz-Ründeroth habe ich auch gefunden
Sonst bleibt mir nur noch die Eisenbahn, aber da passt Müsen überhaupt nicht rein. Nettes Rätsel! Hab ich wieder viel über unser NRW gelernt :-)
Die Bezeichnungen lassen auf eine organisatorische gebietliche Unterteilung schließen. Beamtenabteilungen gab es unter anderem auch zu Zeiten der NSDAP.
Die farbliche Kennzeichnung lässt den Schluss zu, dass es sich hierbei um eine Anordnung/Reihenfolge und/oder Zuständigkeitsbereiche handelt. (Postverteiler, Schriftverkehr etc.)
Oh, hätt ich gar nicht gedacht. Aber wir wissen nun immer noch nicht so recht, was es genau erklärt: Reiter, Tabs, Ordnerrücken? Gibt es ein Foto dessen, was da in der Legende schematisch dargestellt wird?
Die Tafel beschreibt der farbliche Kennzeichnung der Amtsbücher: „Farbe ist das erste sichtbare Unterscheidungsmerkmal in der Registratur.“ (kommerzieller Link: http://www.zippelag.de/registraturlexikon-zippel.html
Nach erneuter Recherche im Internet (Berg- und Hüttenmännische Zeitschrift)handelt es sich wohl um Knappschaftsvereine (Krankassen/Pensionskassen) der hiesigen Region unter Bezugnahme deren geographischer Zusammengehörigkeit.
Na denn mal GLÜCK AUF !!!
Die Auflösung des Rätsels findet sich hier: http://www.siwiarchiv.de/?p=6928
Über den Quellenwert solcher aus vielen disparaten Vorlagen kompilierten „Biographien“ muss man sich keine Illusionen machen. „Bauschule in Siegen“ z.B. ergibt für einen jungen Mann, der im 19. Jahrhundert Architekt werden wollte, wenig Sinn. Etwas anderes als die „Wiesenbauschule“ kann man sich darunter kaum vorstellen, und in deren Schülerverzeichnis taucht Carl David Neuburger erwartungsgemäß nicht auf (lediglich ein Fritz Neuburger, geb. 12.4.1877 in Siegen, am 25.7.1891 ohne Abschluß ausgeschieden). In dem als Referenzwerk genannten Allgemeinen Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart („Thieme/Becker [Bd.] 25 [S.] 404“) findet sich der zusätzliche Hinweis „studierte in Berlin“, was auf die dortige „Königlich preußische Bauakademie“ schließen läßt. Wo Neuburger den für ein Architekturstudium mindestens erforderlichen Realschulabschluß erworben hatte, ist unklar, in Siegen jedenfalls nicht (sofern die Schülerlisten bei Kruse, Geschichte des höheren Schulwesens … 1936 verläßlich sind).
P.K.
Vielen Dank für die Hinweise! Könnten die spärlichen Funde darin begründet sein, dass Neuburger kein Architekt, sondern Baumeister war – s. Wikipedia-Eintrag? Dafür hätte er wohl nur eine (Bau-)Gewerbeschule besuchen müssen, die es wohl in Siegen gegeben haben wird – auch dies ist also noch zu überprüfen …..
M. E. ist es erstaunlich, dass Neuburger in der regionalen, biographischen Literatur nicht erwähnt wird, die doch normalerweise auf jeden Siegerländer hinweist, der es in der „Fremde“ zu etwas gebracht hat.
Lebenslanges Lernen ist unbedingt zu befürworten!
In der Tat war in Siegen 1858 eine städtische „Baugewerkschule“ (Fortbildungsschule für Bauhandwerker) eröffnet worden. Die könnte also der Maurer-Sohn Neuburger besucht haben. Ob ihn das zum „Baumeister“ qualifizierte, lassen wir erstmal offen. Als „Architekt“ führt ihn das zitierte Künstlerlexikon, was an eine Zusatzausbildung (vielleicht das Studium in Berlin) denken läßt. Wegen der umfangreichen Kriegsverluste bin ich, was die Überlieferung der Bauakademie angeht, nicht sehr optimistisch, aber Sie können ja mal im Archiv der TU Berlin nach den alten Matrikeln fragen.
Übrigens fehlen im digitalisierten DBBL, soweit ich sehe, die Seiten 903-927 mit den Quellenangaben (oder ich bin zu blöd, um sie dort zu finden). Die im Eintrag zu Neuburger angegebenen Siglen bedeuten: Wilhelm Neumann, Lexikon baltischer Künstler, Riga 1908; Bernhard Becker, Aus der Bauthätigkeit Rigas und dessen Umgebung in der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts, Riga 1898; Thieme/Becker siehe oben; Rigascher Almanach 44 (1901).
P.K.
In der Bibliographie zur baltischen Bau- und Kunstgeschichte 1939-1981, Berlin 1984, ist nichts auf Neuburger und seine Tätigkeit in Riga Bezügliches zu finden.
In Daina L?ce, Pirmais R?gas pils?tas arhitekts Johans Daniels Felsko (1813–1902), Riga 2012, findet sich der Hinweis (S. 323) auf ein Grundriss des Rigaer Doms von Karl Neuburger im Historischen Staatsarchiv Lettlands.
Danke für den schönen Preis!
Auch das archivamtblog verweist auf diesen Grundsatzappell: http://archivamt.hypotheses.org/662
Eintrag in Neumann, Lexikon baltischer Künstler, Seiten 114-115 (die Seitenangabe „144 f.“ im Biogr. Lex. ist falsch) digital:
https://archive.org/stream/lexikonbaltisch00drgoog#page/n126/mode/1up
Eine lobende Erwähnung Neuburgers hier:
http://iaptieka.lv/?lapa=alte&id=3
Bei weiteren Recherchen müßte auch die lettisierte Namensform „Karls Neiburgers“ beachtet werden (das „i“ ist kein Tippfehler). Z.B. liefert die Anfrage „Neiburgers Riga“ bei Google Books ein paar möglicherweise interessante Treffer (Snippets), denen der architekturbegeisterte Kreisarchivar vielleicht nachgehen möchte.
P.K.
Ein erster, eher skeptischer Tweet zum neuen Landesarchiv:
Ein weiterer Tweet von der Eröffnungsveranstaltung:
Die Eingringungsrede der Kultusministerin wurde gerade zu Protokoll gegeben und der Entwurf eiinstimmig in den Kulturausschuss überwiesen. Die Volksvertreter wollen wohl nur noch nach Hause ……
Der Vollständigkeit halber: der Link zum Beschlussprotokoll der gestrigen Landtagssitzung: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMPB16-58.html
s. a. Westfälische Rundschau v. 7.5.2014: http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-bad-berleburg-bad-laasphe-und-erndtebrueck/tagebuch-schaetze-im-internet-aimp-id9318666.html
Links zu „Soundarchiven“ finden sich unter der Rubrik „Musikarchive“ auf Archivalia: http://archiv.twoday.net/topics/Musikarchive/
Zu 1) meine Studie unternimmt erste Schritte in die Richtung, Klanglandschaften und Geräuschkulissen für städtische Räume zu untersuchen. Siegen, Weidenau und Geisweid (Gde Hüttental) sind seit dem frühen 20 Jhd. hochindustrialisierte Ort, in welchen die Stahl- und Metallverabeitenden Betriebe prägend sind. Untersuchung über eher ländlich strukturierte Räume vergleichbar dem Siegerland oder dem Wittgensteiner Raum gibt es meines Wissens nach nicht. Hinsichtlich des Straßenverkehrlärms würde ich erwarten, dass dieser im Vorfeld der Errichtung der Hüttental-Straße von seiten des NRW-Verkehrsministeriums untersucht, gemessen und begutachtet wurde.
2) Gewerbeaufsichtsamt (Regierungspräsidium), Stadtausschuss zur Genehmigung gewerblicher Anlagen, Verkehrsbetriebe, Gesundheitsamt, Bau-, Verkehrs und Gewerbepolizei etc., Tiefbauamt, Städtische Betrieb/Elektrizitätswerk etc.
3) Diejenigen, die noch in den städtischen Ämter lagerten. Das sind für Essen noch ziemlich viele.
4) Auf jeden Fall würde ich eine aktive Dokumentation von Sound-Landschaften befürworten? Da ließen sich sicherlich spannende Projekte mit den unterschiedlichen Studiengängen der Universität Siegen und dem Kreisarchiv bzw. der lokalen Wirtschaft entwickeln.
Mein Kontakt:
Dr. Heiner Stahl
Lehrkraft für besondere Aufgaben (LfbA)
Neuere und Neueste Geschichte/ Europäische Zeitgeschichte seit 1945
Universität Siegen
Philosophische Fakultät
Historisches Seminar
Raum: AR B 2110
Adolf-Reichwein-Str. 2
57068 Siegen
Tel.: 0271 / 740 – 2918
Fax: 0271 / 740 – 3466
Mail: heiner.stahl@uni-siegen.de
Vielen Dank für die ausführliche Beantwortung der Fragen und für die Bereitschaft ein regionales Projekt anzudenken!
Auch Archivalia verweist auf diesen Eintrag: http://archiv.twoday.net/stories/876867684/ . Danke!
Laienhafte Frage: Wie verträgt es sich mit dem Naturschutz-Status der Halde, dass anscheinend „ein Recycling der Schlacke unter Berücksichtigung fortschreitender Technik“ erwogen wird?
P.K.
Ich vermute, dass das Arnsberger Verwaltungsgericht lediglich die denkmalschutzrechtlichen Aspekte geprüft hat. Falls ein Objekt aus denkmalrechtlicher Sicht zweifelhaft ist, so spielen die wirtschaftlichen Verwertungsmöglichkeiten des Eigentümers eine wohl zu beachtende Rolle. Dies steht jedoch, wie Sie richtig bemerken, im Gegensatz zum geltenden Naturschutz für die Halde. Leider bin ich allerdings ebenfalls kein Jurist, der eine belastbarere Aussage treffen könnte, und kann nur hoffen, dass dieser Fall höchstrichterlich entschieden wird.
Übrigens am 23.7. um 17:00 findet eine Natur- und pflanzenkundliche Führung „Monte Schlacko – botanisch gesehen“ des Naturschutzbund (NABU) Siegen-Wittgenstein (Leitung: G. Rinder, C. Kosch, N.N) – Treff: Sackgasse der Haardter Berg Straße nördlich der Universität Siegen. Quelle: http://www.biologische-station-siegen-wittgenstein.de/cms/upload/bilder/downloads/prog_2014_a6quer_140228web.pdf, S. 60.
Einbringungrede zum Archivgestz NRW ist online:
„Wertvolles, unersetzliches Archivgut zu bewahren und die entsprechenden Nutzungsmöglichkeiten sicherzustellen, ist für die Landesregierung eine sehr wichtige Aufgabe. Ihr kommt in Nordrhein-Westfalen ein verfassungsrechtlicher Rang zu.
Der Verfassungsauftrag richtet sich dabei gleichermaßen an Land, Gemeinden und Gemeindeverbände. Um ihn zu erfüllen, ist eine gesetzliche Regelung unverzichtbar.
Alle Bundesländer und der Bund haben daher Archivgesetze verabschiedet. Das nordrhein-westfälische Archivgesetz vom 16. März 2010 tritt am 30. September 2014 außer Kraft. Die Befristung war Anlass, das 2010 weitgehend neu gefasste Gesetz auf seine Tauglichkeit und auf eventuell notwendige Änderungen hin zu überprüfen.
Von den Fachleuten in den Archiven wurden nur wenige Änderungen vorgeschlagen. Das hat die Einschätzung der Landesregierung bestätigt, dass sich das geltende Archivgesetz bewährt hat. Auch außerhalb Nordrhein-Westfalens gilt es als modern und zukunftsfähig.
Vor allem zwei inhaltliche Änderungen sind nach Auswertung der fachlichen Rückmeldungen vorgesehen:
Erstens. Mit Blick auf die Archivierung digitaler Unterlagen ist eine Erweiterung des Aufgabenspektrums für das Landesarchiv vorgesehen.
So soll auch anderen staatlichen und kommunalen Kultur- und Gedächtniseinrichtungen die Nutzung eines sogenannten „Speicherknotens“ des Landesarchivs ermöglicht werden.
Zweitens. Auf Wunsch der kommunalen Familie sollen Regelungen, die bisher nur für das Landesarchiv Gültigkeit haben, auf die kommunalen Archive übertragen werden.
Das betrifft unter anderem die Mitwirkung bei der Feststellung von Austauschformaten zur Archivierung elektronischer Dokumente – oder die Einbindung der kommunalen Archive, wenn es um die Planung und Einführung beziehungsweise Veränderung von IT-Systemen geht.
Außerdem sollten auch die Kommunalarchive – wie jetzt schon das Landesarchiv – das Recht haben, Unterlagen bereits in den Verwaltungen einsehen und so auf ihre Archivwürdigkeit prüfen zu können.
Mit diesen wenigen Änderungen wird Nordrhein-Westfalen auch weiterhin über ein praxistaugliches Archivgesetz verfügen: über eine gute gesetzliche Grundlage, die es dem Landesarchiv und den kommunalen Archiven erlaubt, ihre wichtigen Aufgaben auch in Zukunft fachgerecht wahrzunehmen“
Link: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMP16-58.html#_Toc388036353
„Hexenjäger“ – „Hainchens bedeutender Sohn“.
Ein Beispiel dafür, wie blind die Lokalgeschichtsschreibung gegenüber anderweitiger Regional- und Landesgeschichte ist.
Hallo,
mögliche Lösung:
1) Es handelt sich um einen „Archivschrank“.
2) Die Kamera wurde an die Stirnseite des Schranks aufgelegt und das Objektiv zeigte in Richtung Decke. Durch digitale Bildbearbeitung wurden die Farben invertiert und/oder andere Filter benutzt.
Lösungsweg: Derartige Schränke kamen mir aus dem jüngst erschienenen Blogeintrag über eine „Nacht im Archiv“ bekannt vor.
Mit besten Grüßen
Thomas Poggel
Da das Rätsel diesmal etwas einfacher war, bitte ich um mehr Präzision bei den Antworten.
Das bearbeitete Bild: https://www.flickr.com/photos/102122941@N02/14036401639/
Benutzte Kamera: Canon PowerShot SD1100 IS (Digital IXUS 80 IS).
Benutze Software: Vermutlich eine der Bekannten: Photoshop, Gimp etc.
Hersteller und Modellbezeichnung des Archivregalsystems: Unbekannt.
1) Regal und kein Schrank!
2) Kamera ist auch richtig – und war auch nicht so schwer ;-).
3) Programmname ist eigentlich unerheblich, aber was habe ich mit dem Bild genau gemacht. Einen Hinweis kann man auf den Web 2.0-Kanälen von siwiarchiv finden, dann muss man nur noch etwas googlen – oder man kann es selber ausprobieren ;-)
Damit das Ganze nicht noch alberner wird, sollte sich jemand anderes über das kleine Präsent freuen :-). Mit freundlichen Grüßen und einen schönen Feiertag wünschend…
Hallo Zusammen! Haben am vergangenen Sonntag versucht,den neuen Pfad zu wandern. Jedoch OHNE ein Wanderzeichen und Ortskenntnis war dieses schlecht möglich. Wie kann man einen so schönen Weg einweihen ohne an eine Ausschilderung zu denken. Mfg M. Affholderbach Bitte um Rückmeldung
Wandern Sie statt dessen auf dem Fachwerkwanderweg
„Wilder Mann“ in und um Freudenberg. Natürlich gibt es dort eine Beschilderung. Wie wäre es mit Pfingsten?
Ich empfehle anschließende Waffeln mit Kirschen im Weinhaus „Zum Knoten“!Zum letzten Satz: Bitte zukünftig keine Werbung mehr!
Ich bezweifle, dass die Auflösung ausreichend ist.
Der aktuelle Stand der Petition lautet 592 Mitzeichnende, davon 316 aus NRW. Auch aus dem Kreisgebiet haben schon erfreulich viele diese Petition unterschrieben. Vielen Dank!
Auf siwiarchiv erfolgt in der Regel der Link zum „Original“. Das Bild hier soll lediglich einen ersten Eindruck vermitteln.
Auflösung des Vatertagsrätsels:
1) Es handelt sich um eine Regalwand der Rollregalanlage des Kreisarchivs Siegen-Wittgenstein.
2) Das bearbeitete Bild befindet sich mit dem Titel „Archive like Ruff“ auf dem Flickr-Account von siwiarchiv. Es verweist auf den deutschen Fotografen Thomas Ruff, ein Schüler der Siegerländer Fotografen Bernd und Hilla Becher. Ruff beschrieb das Vorgehen für seine aktuelle Ausstellung in Gent. Er „nutzt historische Fotografien unterschiedlichster Herkunft und Genres. „Historische Fotografien besitzen in der Regel eine braune Patina. Wenn man diese Fotografien ins Negative dreht, entsteht ein schöner Blauton, den ich übernommen habe.“
So musste das s/w-Bild nur mit der Bildbearbeitung in ein Sepia-Bild umgewandelt werden, dann davon das Negativbild erstellt werden.
1.: Wassermühle
2.: bei Salchendorf / Netphen 1930
3.:“Fotograf nicht überliefert“ (LWL)
Die Google-Bildersuche führt schnell zum Ziel, d.h. zum LWL-Bildarchiv.
Siehe dort: http://www.lwl.org/marsLWL/pic/7371
Aber irgendein Haar in der Suppe wird es wohl noch geben, sonst wäre es ja zu leicht gewesen.
P.K.
Ich glaube auch nicht, dass man über eine zweite Mühle nachdenken muß. „Bei Salchendorf“ in der LWL-Bildbeschreibung ist eine sinnvolle Angabe zur Lage der Helgersdorfer Mühle gewesen. Salchendorf war von der Einwohner- bzw. Häuserzahl her mindestens zehnmal größer als das benachbarte Helgersdörfchen und deshalb als Orientierungshinweis in einer Fotosammlung besser geeignet, wenn diese nicht ausgesprochen wissenschaftlichen Zwecken dienen sollte. Wegen der Datierung und des Fotografen müßte man beim Landschaftverband anfragen, wie authentisch dessen Angaben sind und ob dort evtl. Korrekturbedarf besteht. Sollte es sich um einen Fehler handeln, wären davon möglicherweise noch andere Aufnahmen der Siegerländer Bildreihe betroffen.
Ist die genau Lage der ehemaligen Mühle eigentlich bekannt? Falls das Haus nicht mehr stehen sollte, könnte vielleicht noch die kleine Brücke (am linken Bildrand) weiterhelfen. (Da ich zu den zukunftslosen nicht-motorisierten Deppen gehöre, kann ich nicht selbst hinfahren und suchen.)
P.K:
Zur genaueren Erforschung dieser „Auswanderwelle“ scheint es ratsam folgende Akten des Bestandes „Kreis Siegen, Landratsamt (alt)“ auszuwerten:
1) Nr. 114 Auswanderungen, 1910-1929
2) Nr. 115 Auswanderungen und Auswanderagenten, 1921-1932
3) Nr. 116 Nachforschungen nach ausgewanderten Personen, Todesnachrichten, 1925-1932
4) Nr. 1207 Polizeiliches Meldewesen, 1898-1931
Eine kurze Beschreibung der 1812 „an den Meistbietenden“ zum Verkauf stehenden Mühle:
„Die herrschaftliche Mahlmühle zu Helgersdorf hat einen oberschlächtigen Mahlgang, ist 2stöckig unten massiv, im 2ten Stock von Holz erbauet, und nebst dem ihr angebauten Eishause mit Stroh gedeckt. Sie enthält eine kleine heitzbare Stube für einen Müllerknecht. Die Grundfläche ist 4 1/2 Ruthe groß. Überdem gehört dazu ein kleiner obig der Mühle gelegener Weiher. Die Taxe beträgt 309 Fr. und das Brand-Assecuranz Quantum 290 fl.“
Zeitung des Großherzogthums Frankfurt, Beilage zu Nr. 116 vom 25.4.1812, letzte (ungezählte) Seite, rechte Spalte oben; Zugang via Google books.
(Außerdem sollten „im Canton Netphen“ die Mühle Irmgarteichen und das Schloß Hainchen verkauft werden.)
P.K.
Jetzt online: Dokumentation zur Fachtagung „Erinnern für die Zukunft“*** Mehr als 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten am 21. Mai 2014 beispielhafte Einblicke in Projekte aus Bildungspartnerschaften von Gedenkstätten und Schulen und erörterten die Frage, wie das Erinnern in der Einwanderungsgesellschaft anschlussfähig gestaltet werden kann. Die Dokumentation zur Veranstaltung finden Sie hier: http://www.medienberatung.schulministerium.nrw.de/Medienberatung/Dokumentationen/2014/04-Fachtagung-Gedenkst%C3%A4tten.html
Eine ganz andere Form von Sounds werden in der heutigen Ausgabe der ZEIT (Nr. 27 vom 26.6.2014, S. 16) beschrieben: Wie hörte sich das Abspielen von Aufnahmen auf einem Kassettenrekorder an? „Nichts läuft mehr, Der tonlose Abschied von der Kompaktkassette“ von CST in der Rubrik „Der Klang der Zeit“. Diese Kolumne soll nun zweiwöchentlich erscheinen.
Nachtrag: Interview mit Gerhard Paul:
http://www.zeit.de/2014/26/gerhard-paul-diktatur-klang
“ …. Das Blog siwiarchiv stelle eine gute und ressourcenschonende Möglichkeit für die Archive im Kreis Siegen-Wittgenstein zur archivischen Öffentlchkeitsarbeit dar. …..“ – so Thomas Krämer in der Ergebnissicherung der Sektions zu kooperativen Web 2.0 Anwendungen im Archiv.
Monika Marner fasste den Beitrag zusammen.
Tatsächlich fasste eine Kollegin / ein Kollege aus dem Blogger-Team den Beitrag zusammen, hat aber offensichtlich vergessen, sich mit der eigenen Kennung anzumelden. Da ich selbst auf dem Podium war und nicht die Gabe der Bilokalität besitze, habe ich zu den Sektionen 5 und 6 nicht gebloggt. ;-)
Zum gegenwärtigen Projektstand s. Westfälische Rundschau, 27.6.2014: “ …. Zwar zeigte sich Wortelkamp auskunftsfreudiger, den Start der Bauarbeiten kennt er allerdings auch nicht, aber: Die Verantwortlichen seitens der Klinik hätten von der zweiten Augusthälfte gesprochen.
„Meine Unterlagen sind beim Kreisklinikum“, betonte er. Wenn die Krankenhausleitung sage, es geht los, könnten die Arbeiten starten. „An mir wird es nicht liegen.“ Detailfragen zwischen Klinik und Künstler seien weitgehend geklärt. Er sprach von einem Lichtmast und einem Parkschein-Automaten. Beides müsste versetzt werden. Zudem stehe ein Verteilerkasten im Weg. ….“
Bericht der Geschichtswerkstatt Siegen z. Tag der Region: http://geschichtswerkstatt-siegen.de/2014/06/15/tag-der-region-2014/
1. Paul Kanstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Kanstein
2. Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944
3. Fritz-Detlof von Schulenburg
Suchweg: Kein Erfolg mit Lebensdaten und Abitur Lennep, aber dann
https://www.google.de/search?&tbm=bks&q=%221899-1980%22+danemark (ipadbedingt ohne ä gesucht, mit ä steht der QFIAB-Treffer wesentlich weiter hinten)
1) Wer bin ich?
Paul Kanstein, * 31. Mai 1899 in Schwarzenau (Bad Berleburg); † 7. September 1981 in St. Wolfgang (Sterbedatum nicht genau bekannt)
2) Welche gefährliche Situation ist gemeint?
Verhaftet wegen des engeren Kontaktes zu den Drahtziehern des Hitlerattentates am 20.07.1944. Freilassung.
3) Wer war der “Königsberger Freund”?
Fritz-Dietlof Graf von der Schulenburg, * 5. September 1902 in London; † 10. August 1944 in Berlin-Plötzensee
1933 waren beide in Königsberg „beschäftigt“ und traten in etwa zur selben Zeit der NSDAP bei. Schulenburg gehörte später der Widerstandsbewegung an und plante die Operation Walküre mit.
Lösungsweg:
Die erste Suche führte über die „Königsberger Tage“ zum Ort Königsberg und die Schlacht um Königsberg. Der erste Ansatz war Elisabeth Gräfin von Bassewitz (1899–1980), hier fehlte jedoch ein Zusammenhang zu Wittgenstein und dem „Freund“.
Im zweiten Versuch mit den Begriffen Königsberg und Dänemark, verbunden mit dem Geburts- und Sterbedatum fiel ein Treffer auf Paul Kanstein.
Der Rest ergab sich dann aus dem Biographieausschnitt bei Wikipedia.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Kanstein)
Klaus Graf hat dieses Rätsel als Erster richtig gelöst. Gratulation! Wegen des Gewinns werde ich mich via E-Mail melden.
Eigentlich hatte ich den Hinweis auf die regionale Literatur erhofft: Elisabeth Strautz: Paul Kanstein – ein Mann, der “ … den Persönlichkeiten des 20. Juli freundschaftlich verbunden war, ihre Ziele gebilligt und zumindestens moralisch unterstützt hatte“, in Siegener Beiträge. Jahrbuch für regionale Geschichte 9 (2004), S. 207-210.
An dieser Stelle verweise ich auch auf die online verfügbaren Zeugenaussagen Kansteins im Archivs des Instituts für Zeitgeschichte (ZS 552): http://www.ifz-muenchen.de/archiv/zs/zs-0552.pdf .
Zur verspäteten Freischaltung des Gewinners s. http://archiv.twoday.net/stories/910175680/ und http://archiv.twoday.net/stories/909746123/
Lieber Herr Wolf,
vielen Dank für die Veröffentlichung dieser Dokumente!
Torsten Thomas
In Siegen wurde 1577 ein Junge geboren, der nur sehr kurz in dieser Stadt wohnte, wahrscheinlich wusste er gar nicht, dass er dort geboren wurde.
Heute schmückt sich die Stadt Siegen mit diesem Menschen bei jeder Möglichkeit. Eine Straße, ein Gymnasium ein Kunstpreis ist nach ihm benannt.
Die Stadt ist stolz auf ihren „Sohn“. Eigentlich verbindet diesen Jungen nicht mehr mit Siegen als Ernst Bieberstein mit Hilchenbach.
Der eine hat ein positives Image das der Geburtsort gerne übernommen hat, der andere ein negatives, das der Geburtsort gerne ablegen würde.
Dennoch bleibt Hilchenbach sein Geburtsort.
Torsten Thomas
Pingback: » Oberes Schloss Siegen: Gas gegen Holzschädlinge Burgerbe-Blog
Zu Raimund Hellwigs Aufsatz zu dem Obersdorfer Wilhelm Schmidt:
Es ist sicher eine Überraschung, dass die Zeitschrift sich einmal für ein Thema öffnet, dass die regionale NS-Geschichte berührt. Wie diese Neuerung zu verstehen sein könnte, möchte ich hier gar nicht ansprechen, auch wenn sie es wert wäre. Mir geht es um ein paar sachliche Fehler in Hellwigs Aufsatz, die mir beim ersten Lesen in den Blick fielen:
– Hellwig nennt als Freund von Wilhelm Schmidt den Hilchenbacher Fritz Forschepiepe. Der wurde aber nicht, wie Hellwig schreibt, im Zuge der „Gleichschaltung“ aus dem Deutschen Jugendherbergswerk herausgedrängt. Der war Lehrer, Mitglied der NSDAP und zeitweise Blockleiter. Mit dem DJH hatte er nichts zu tun. Der Herausgedrängte war dessen Bruder Hermann Forschepiepe.
– Er beschreibt die Zusammenarbeit zwischen Schmidt und dem Heimatdichter und Lehrer Adolf Wurmbach. Dabei beruft Hellwig sich auf eine Schrift „Erich Koch, Adolf Wurmbach, Selbstverlag“. Verfasser und Titel gibt es nicht. Mag sein, Hellwig meinte den protestantischen Pfarrer Erich Schmidt. Der schrieb
a) „Deuter der Heimat – Mahner der Zeit. 15. Juli 1891 – 17. Januar 1968. Zur Erinnerung an seinen Geburtstag vor 100 Jahren. Ein Büchlein gegen das Vergessen“, 1991 erschienen im Verlag der Wielandschmiede in Kreuztal und
b) „Adolf Wurmbach als Pazifist. Das totgeschwiegene Jahrzehnt“, das leider nie erschien, sondern Manuskript blieb.
– Schmidt verschweigt bei aller Verehrung von Wurmbach nicht, dass dieser vor der Konversion zum Pazifisten 1924 einer der zeittypischen Chauvinisten war. Zwar wurde er 1934 zwangsweise in den mit Ruhegehalt ausgestatteten Ruhestand versetzt, aber seit 1938 gab es mit Unterstützung aus NSDAP und Gestapo Bemühungen zur Wiedereinstellung, die auch erfolgreich waren. Wurmbach wurde vollständig rehabilitiert. Bitte mal in die Entnazifizierungsakte gucken! Im Nationalsozialismus kehrte Wurmbach dorthin zurück, wo er 1924 unterbrochen hatte, um nach 1945 erneut Pazifist zu sein.
– Hellwig: Wurmbach sei „alles andere als lininentreu“ gewesen. Ach? Wurmbach war der klassische Wendehals. Im NS veröffentlichte er laufend in den regionalen Medien, vor allem aber in der National-Zeitung der NSDAP völkische und auch kriegspropagandistische Texte, oft in einem der „großen Zeit“ angepassten germanisierenden Duktus. Wurmbach und Schmidt passten, auf andere Weise als Hellwig suggeriert, gut zusammen, obwohl der erste der NSDAP nicht beitrat: „Mit ihren Leibern schirmen der Besten viel/Und heißem Herzen Marken und Heimstatt dir,/Damit sie leben oder sterben -/Segne der Himmel den Schwur! – für Deutschland.“ (Wurmbach, zum Kriegsbeginn 1939).
Raimund Hellwigs Beitrag verdient gewiss eine grundsätzlichere Reaktion als nur die Korrektur einiger seiner sachlichen Fehler. Soviel sei aber doch schon auf die Schnelle einmal mitgeteilt.
Der Artikel „Die späte Entnazifizierung des Wilhelm Schmidt“ von Raimund Hellwig findet sich im „Siegerland“ Heft 1 (2014), Seite 156-163, und eine erste Stellungnahme dazu findet sich hier: http://www.siwiarchiv.de/?p=7428#comments .
Gestern ging ich in meinem Beitrag zu Raimund Hellwigs Aufsatz Über „Die späte Entnazifizierung des Wilhelm Schmidt aus Obersdorf darauf ein, dass er Literatur einsetzte, die es nicht gibt und dass er Wilhelm Schmidt mit NS-Gegnern freundschaftlich verband, die es nicht gab, um den NS-Kritiker auch in Schmidt zu suggerieren.
Heute zunächst noch einmal zu formalen Mängeln.
Abgesehen davon, dass der ganz überwiegende Teil von Hellwigs inhaltlichen Aussagen bei mageren 17 Fußnoten unbelegt bleibt, ist das, was Fußnoteninhalt sein soll, durchweg ungeeignet, etwas zu belegen. Sei es,
– dass der Literaturangabe mindestens die Seitenangabe, aber zusätzlich vielleicht auch Verfasser, Erscheinungsort und Jahr fehlen (FN 7, 10, 11, 12, 13, 14),
– dass ein als „Nekrolog“ ausgewiesener, in eine Fußnote gesetzter Auszug aus einem Personenlexikon kein bisschen Nekrolog enthält (FN 11),
– dass der archivalische Ort komplett fehlt (FN 15),
– dass die Anmerkung die Aussage nur fortführt, ohne aber auf irgendeine Quelle zu verweisen (FN 6, 9, 16),
– dass die Aussage nicht belegen kann, weil die für NSDAP-Amtsträgernamen in den als Quelle pauschal angegebenen „Siegerländer Adressbücher“ Namen gar nicht enthalten oder nur solche der höheren Hierarchieebenen (FN 4) oder weil die genannte Literatur überhaupt nicht existiert (FN 8) oder
– dass ein Hauptstaatsarchiv Düsseldorf inzwischen nicht mehr existiert (FN 3).
Hellwig ruft mit dieser Arbeitsweise die von ihm verantwortete Neuauflage der älteren Schrift „Siegen unter dem Hakenkreuz“ von 2011 in Erinnerung. Der Rezensent Alexander Hesse stellte damals fest, dass die Fülle der Fehler enthülle, „dass der Text nicht nur schludrig geschrieben, sondern auch nie gründlich Korrektur gelesen wurde“. Damit fällt die mangelhafte bis ungenügende Form, die kräftig ins Inhaltliche durchschlägt, auf die Zeitschrift „Siegerland“ zurück, die das zuließ.
Was den Umgang mit Inhalten angeht, beschränke ich mich hier auf zwei Punkte:
1. Hellwig spricht von einer „völkischen Grundhaltung“ vieler westfälischer Heimatdichter, auch Schmidts „Oeuvre“ „völkisch angehaucht“. Das sehen die Schmidt-Kritiker auch so, meinen aber etwas anderes, denn zugleich bemerkt Hellwig, „von Wilhelm Schmidt sind politische Äußerungen nicht überliefert“. Der Leser darf demnach meinen, „völkisch“ sei so was wie „volkstümlich“, „besonders volks- und heimatverbunden“, habe aber jedenfalls nichts mit Politik zu tun. Dem ist nicht so, wenn Schmidt das „Ererbte“ dem „Fortschrittsgeist“ gegenüberstellt, Franzosen und „Tommies“ vor Übergriffen auf „deutsche Heimaterde“ warnt, in der die Geschichte „wurzele“ bzw. in die Wurzeln zu versenken seien, die „heilig“ ist und „Treue der angestammten Art“ gegenüber einfordert, zumal man „mit liebendem Herzen am Großdeutschen Reich“ baue usw.
Hellwig sollte sich vor Eintritt ins Thema erkundigt haben, was mit dem in der Diskussion um westfälische Heimatdichter zentralen Begriff des „Völkischen“ und auch mit „Völkischer Bewegung“ gemeint ist.
Dazu zwei Handbuchartikel: Günter Hartung, Völkische Ideologie, in: Uwe Puschner,Walter Schmitz,Justus H. Ulbricht (Hrsg.), Handbuch zur „Völkischen Bewegung“ 1871-1918, München/New Providence/London Paris 1996, S. 22-41, und Hellmuth Auerbach, Völkische Bewegung, in: Wolfgang Benz, Hermann Graml und Hermann Weiß herausgegebenen Enzyklopädie des Nationalsozialismus, Stuttgart 1997, S. 784.
Hartung: „…’völkisch’ hatte im allgemeinen Gebrauch bereits am Ende der Weimarer Republik seine neutrale Bedeutung fast völlig eingebüßt. … der Große Brockhaus (definierte) … ‚Verdeutschung des Wortes ‚National’ im Sinne eines auf dem Rassegedanken begründeten und daher entschieden antisemitischen Nationalismus.“ (S. 24)
Auerbach: „Der V[ölkischen Bewegung]. Liegen drei Hauptkomponenten zugrunde, die … nach dem Ersten Weltkrieg ins Extreme getrieben wurden: 1. die sozialdarwinistische Vorstellung vom ‚Kampf ums Dasein’, in dem sich der Starke, Wertvolle durchsetzt; 2. damit verbunden die Notwendigkeit eines Kampfes um Lebensraum für das germanische dt. Volk, v. a. im Osten Europas; 3. ein ‚rassisch’ begründeter Antisemitismus.“
Wilhelm Schmidt ist wie andere, bekanntere Exponenten der westfälischen Heimatbewegung (siehe: http://www.sauerlandmundart.de/daunlots.html, dort die Ausgaben 69-71 der „daunlots“ oder exemplarisch das folgende Gutachten: http://www.hamm.de/fileadmin/user_upload/Medienarchiv/Startseite/Dokumente/Gutachten_Steffen_Stadthaus_ueber_Luhmann_neu.pdf) der „Heimatkunstbewegung“ zuzurechen. Die war ein Segment der Völkischen Bewegung.
2. An keiner Stelle findet sich nach Hellwig bei Schmidt Antisemitismus. Das Gedicht „De Gummizitt“, das Schmidt der „nationalen Revolution 1933“ verehrte, spreche an keiner Stelle von der „Gummizeit“ als von einer „verjudeten Republik“. Hellwig scheint nicht geläufig zu sein, dass dort wo Antisemitismus gut verwurzelt ist, nicht ständig explizit von Juden die Rede sein muss, wenn Juden gemeint sind. Die sind nämlich auch so leicht zu erkennen/zu benennen.
1886 war in der antisemitischen Tageszeitung Siegerländer Volksfreund in einer „Volkserzählung“ die Rede von einem „dicken Herrn, aber mit nicht ganz geraden Füßen und einer dicken goldenen Uhrkette“. Oder 1892 von einem Ignatz Barteck, vermutlich, aber unbeweisbar „wucherische Geschäfte“ betreibend. Moral sei, so dieser „Ignatz“, „ein Ding wie ein Gummiband“. Man könne „heutzutage“ alles machen, wenn man dafür nur eine unschuldige Form finde. Lernen könne man das nicht. Man müsse „das Talent dazu im Blute haben“.
Dergleichen konnten die Siegerländer generationenlang lesen, das übt sich. Der Antisemtismusforscher Wolfgang Benz spricht von „Bildern in den Köpfen, die als abrufbare Codes funktionieren“ (Wolfgang Benz, Bilder vom Juden. Studien zum alltäglichen Antisemitsmus, München 2001, S. 11). Er ist auch überzeugt, der „antisemitische Code“ (Shulamit Volkov) lebe fort.
Jedenfalls dürfte er 1933 das Erkennen umstandslos ermöglicht haben, wenn es in der „Gummizeit“ z. B. hieß „Gummili hah och en Gott/deam sie deen beat Herz on Leppe/amer dä dm Socher sech/offenbart als Foererkreppe“ und die Aufforderung „Awer weg vahm ditsche Geist!/Ruß uß ohse ditsche Mensche!“ folgte.
Wobei zu sehen ist, dass für viele Antisemiten „die Definition über das ‚Blut’ … sekundär mit der des ‚jüdischen Geistes’ verbunden“ war, „als Herrschaftsinstrument des Judentums“ (Werner Bergmann in der Enzyklopädie des NS, S. 366). Das hätte Schmidt sicher nicht so geschrieben, verstanden hätte er den Satz sicher.
Mit ein wenig Aufwand müsste es dem Verfasser möglich gewesen sein, sich zu Themen kundig zu machen, zu denen er dann schrieb, ohne auch nur ein Grundwissen zu haben. Offenbar war – ungeachtet des Faktors Bequemlichkeit – anderes wichtiger als Kompetenz in der Sache. Darauf wird noch weiter einzugehen sein.
Im Berliner Bundesarchiv finden sich zu Neuhaus in den Beständen des ehemaligen BDC:
NSDAP-Gaukarteikarte
Karteikarte NS-Lehrerbund
Akte Parteikorrespondenz
Akte SS-Führerpersonalunterlagen
Akte Rasse- und Siedlungshauptamt-SS
Darüber hinaus liegt hier eine Akte aus dem Bestand Präsidialkanzlei unter der Signatur R 601/2077 – Laufzeit 1940 – vor. Es handelt sich konkret um einen Ernennungs-Vorschlag des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung. (lt. E-Mail v. 28.7.2014, Az.: Az.: 1002/K-156)
Eigentlich kann es nur die Endung „-fe“ sein, weil es keine lokale Kombination von Ednungen im Kreisgebiet und Lage der Orte entsprechend des Musterbildes gibt.
Aber die Zahl der bundesweiten Treffer stimmt nicht überein, es gibt bundesweit 94 Treffer. Wenn man die Endung auf „-nfe“ erweitert, gibt es sogar nur 2 Treffer in unserem Kreis und die Buchstabenzahl passt nicht in den schwarzen Balken des Musterbildes. Wahrscheinlich ist also mein Lösungsvorschlag falsch.
Nein, Sie liegen richtig! Banfe und Benfe sind gemeint. Gratulation!
Der aktuelle Stand der Petition lautet 1736 Mitzeichnende, davon 890 aus NRW. Auch aus dem Kreisgebiet haben weiterhin erfreulich viele diese Petition unterschrieben. Die Facebook-Seite der Petition (s. o.) hat derzeit 165 Likes. Vielen Dank!
Die Fraktion der FDP im Düsseldorfer Landtag widmet sich in einer kleinen Anfrage dem Anliegen der Petittion: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-6082.pdf . Die Antwort der Landesregierung liegt ebenfalls online vor: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-6344.pdf .
In den Medien wurde die Petition bisher hier aufgegriffen:
1) http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/archivgut-der-kommunen-koennte-jederzeit-verkauft-werden-id9430285.html
2) http://www.mt.de/lokales/minden/20196703_Widerstand-gegen-Verkaeufe-aus-Archiven.html
3) http://www.mt.de/lokales/minden/20197526_Anfrage-zum-Archivgesetz.html
4) http://www.mt.de/lokales/minden/20197528_Neues-Archivgesetz-Identitaet-nicht-verscherbeln.html
5) http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/regierung-bislang-kein-verkauf-von-archivgut-bekannt-id9631784.html
Ob Wurmbach zwischen 1931 und 1943 Schriftleiter des Siegerländer Heimatkalenders war, erscheint fraglich. Zumindestens bis zum Tode von Dr. Hans Kruse (1941) scheint dies nicht der Fall gewesen zu sein – s. zu Kruse: http://www.siwiarchiv.de/?p=1451 .
Weiterer Wurmbach-Fund:
“ Eltern den Stock weg ! “ [Beitrag gegen die Prügelstrafe:] in: Schule und Elternhaus. Halbmonatsschrift für Eltern und Erzieher. Blätter für aufbauende Kultur., Berlin-Hermsdorf. Ohne Jahresangabe ( um 1931 )
English version:
Currently the state parliament of North Rhine Westphalia is verifying the practicability of the newly instated “Archive Act NRW”. Also the historians of NRW are following these investigations with great concern…, since in § 10 clause 5 phrase 2 of this draft (see below) it is stated, that the inalienability of records now only applies for municipal documents.
But town and county archives in North Rhine Westphalia do not only store municipal documents derived from official registries, but also diverse documents such as papers of important personalities, club records or collections of photographs, posters and newspapers. According to the laws currently valid, archived goods are not inalienable, therefore may be sold. The redraft of the new law does not contain any change. Historical researchers in NRW cannot agree to this: All communally archived goods need to be inalienable. To effectively protect the cultural heritage of our country, § 10, clause 5, phrase 2 must be removed without replacement from the National Archives Act!
Modern municipal archives have long been more than only the archives of the government, they are archives of the citizens, depicting the social life in its entire width. In a civilian society with an increasingly retreating government, certificates from the private sector concerning the lives of citizens are becoming increasingly important. As these sources are fundamental to regional and local historical studies, their results must be verifiable according to historical science standards, claiming a proof with the original. If this cannot be guaranteed, for example through loss or sale, all research loses value. Ultimately this opportunity for a sale of communally archived goods puts an end to all research concerning the regional history of North Rhine Westphalia. Just one example: The most important source for the history of the city of Jülich during the Weimar Republic, after the destruction of most of the official documents in late 1944, is the collection of the local press prints in the city archives. A sale of this collection would end all further research concerning this topic.
As the successful protest against the sales from the high school archive of Stralsund in 2012 proved, a wide consensus against the sale of communally archived goods, therefore also items so far being valued as archived goods, does exist. Regarding alienations, especially sales are problematic, since they remove the archived goods from public accessibility and split them up in the case of collections, resulting in a entire loss of the historical source. The protection, the state constitution provides for monuments of history and culture, must also be ensured for archived goods. In the other provinces archived goods are generally inalienable.
materials:
Parliamentary debate on a motion of the pirate faction to evaluate the Archives Act: https://www.youtube.com/watch?v=ok28El2Iq2I.
Session transcript of the debate: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMP16-51.html#_Toc380942657.
Design of the Archives Act: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-5774.pdf
Introduction speech on the draft Public Records Act (Appendix 6 to TOP 23): http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMP16-58.html#_Toc388036353
Three members of the FDP parliamentary group in Düsseldorf parliament devote themselves in a small request of the inalienability of collection items: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-6082.pdf. The response of the state government is also present: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-6344.pdf.
To see legislation also http://archiv.twoday.net/search?q=sammlungsgut+nrw
In the media, this issue has been taken up here:
1) http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/archivgut-der-kommunen-koennte-jederzeit-verkauft-werden-id9430285.html
2) http://www.mt.de/lokales/minden/20196703_Widerstand-to-data truncated-from-Archiven.html
3) http://www.mt.de/lokales/minden/20197526_Anfrage-to-Archivgesetz.html
4) http://www.mt.de/lokales/minden/20197528_Neues archive Act-identity-not-verscherbeln.html
5) http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/regierung-bislang-kein-verkauf-von-archivgut-bekannt-id9631784.html
An online petition has been addressed under: https://www.openpetition.de/petition/online/kein-sale-by-urban-archive-in-nrw.
The petition Facebook page: https://www.facebook.com/keinverkaufkommunalesarchivgutnrw.
See More
Lukas Lamla (@Maltis) zur Evaluierung vom Archivgesetz in NRW
Mittwoch, 19.02.2014 Top 7. Archivgesetz NRW jetzt evaluieren und ein geordnetes Gesetzgebungsverfahren gewährleisten Antrag der Fraktion der PIRATEN Drucksa….
LikeLike · · Share..Write a comment…..28 people reachedBoost Post.Kein Verkauf von kommunalem Archivgut in NRW 17 hours ago.Nachfolgend ein englischer Textentwurf zur Petition. Kann jmd drüber schauen und ggf. verbessern. Ansonsten darf er gerne weiterverbreitet werden: Currently in the state parliament of North Rhine-Westphalia (NRW) is done to check the Archives Act NRW on its practicality. The historians in NRW pursue this method with care. For in § 10 paragraph 5, sentence 2 of the draft bill (see below) applies th…e inalienability for archival in municipalities only for administrative records.
But city and county archives in North Rhine-Westphalia store not only documents of official origin, derived from the official registries, but also diverse documents such as papers of important personalities, club records or collections of photographs, posters and newspapers. After the Archives Act now in force this collection items is not inalienable, and can therefore be sold. The draft law revision provides for no change. Historical research in NRW can not agree explain: The entire municipal archives in NRW must be inalienable. To effectively protect the cultural heritage of our country, § 10, paragraph 5, sentence 2 must be removed without replacement in the National Archives Act!
!
Because modern municipal archives have long been more than authorities archives, they are citizen archives that depict the social life in its entire width. In a civil society with an increasingly retreating government certificates from the private sector over the lives of citizens are becoming increasingly important. These sources are fundamental to regional and local historical studies, their results must be verifiable historical science standards following the original. This is no longer the case – for example, through loss or just sell the sources – decreases the value of the research. Ultimately therefore means the possibilities of disposing of municipal archives from for the scientific regional history in NRW. Just one example: The most important source for the history of the city of Jülich during the Weimar Republic, after most of the official documents in the destruction of the city was destroyed in late 1944, is the collection of the local press in the city archives. A sale of this collection would stop any further research.
How has the successful protest against the sales from the high school library Stralsund shown in 2012, there is a great consensus, local cultural goods, including archival properly valued collection items, be regarded as inalienable. In the sale is to think primarily of sales beyond the affected cultural heritage of its public accessibility in the rule and destroy in the case of collections by dismemberment as a historical source. The protection of the state constitution for the monuments of history and culture must also be ensured for archival. In the other provinces archive is generally inalienable.
materials:
Parliamentary debate on a motion of the pirate faction to evaluate the Archives Act: https://www.youtube.com/watch?v=ok28El2Iq2I.
Session transcript of the debate: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMP16-51.html#_Toc380942657.
Design of the Archives Act: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-5774.pdf
Introduction speech on the draft Public Records Act (Appendix 6 to TOP 23): http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMP16-58.html#_Toc388036353
Three members of the FDP parliamentary group in Düsseldorf parliament devote themselves in a small request of the inalienability of city archives collection items: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-6082.pdf. The response of the state government is also present: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-6344.pdf.
To see legislation also http://archiv.twoday.net/search?q=sammlungsgut+nrw
In the media, this issue has been taken up here:
1) http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/archivgut-der-kommunen-koennte-jederzeit-verkauft-werden-id9430285.html
2) http://www.mt.de/lokales/minden/20196703_Widerstand-to-data truncated-from-Archiven.html
3) http://www.mt.de/lokales/minden/20197526_Anfrage-to-Archivgesetz.html
4) http://www.mt.de/lokales/minden/20197528_Neues archive Act-identity-not-verscherbeln.html
5) http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/regierung-bislang-kein-verkauf-von-archivgut-bekannt-id9631784.html
The online petition has been addressed for publication of the draft bill against the possibilities of disposing of municipal archives: https://www.openpetition.de/petition/online/kein-sale-by-urban-archive-in-nrw.
A Facebook page is also on the petition: https://www.facebook.com/keinverkaufkommunalesarchivgutnrw. See More
Ernst Graf wurde am 11.01.1889 in Rinsdorf als Sohn der Eheleute Bergmann Philipp Graf und Karoline Hoffmann geboren.
Er war auch der erste von 19 Kriegstoten aus dem kleinen Ort Rinsdorf.
Der zweite Kriegstote aus Rinsdorf war sein fünf Jahre älterer Bruder der Grubensteiger Ewald Graf.
Der berufliche Werdegang von Ernst Graf war sicher etwas ungewöhnlich, die meisten jungen Rinsdorfer seiner Generation folgten ihren Vätern erst als Haldenjungen und später als Bergmänner auf die Gruben, besonders in Eisern.
Quelle: Kirchenbuch Rödgen, evang.,
Herbert Diehl, Rinsdorf gestern und heute, 1976,
3 weitere NAchträge zu Wurmbach:
1) Dieter Pfau: Die Geschichte der Juden im Amt Ferndorf (1797-1943). „Den Juden ist aber hier kein Leid zugefügt worden“. Kreuztaler Rückblicke. Eine Veröffentlichung aus dem Stadtarchiv Kreuztal Band 1, Bielefeld 2012. Die Publikation enthält Erhellendes zum Verhältnis Wurmbachs zur jüdischen Bevölkerung.
2) Ein must read: „Wo ich zehren muß vom Vorrat meiner Seele.“ Zwischen Tradition und Moderne: Der Pazifist Adolf Wurmbach. Kindheit, Jugend und Gelsenkirchener Jahre bis 1933. In: Literatur in Westfalen. Beiträge zur Forschung 4. 1998. Hrsg. im Auftrag des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe von Walter Gödden. Paderborn, München, Wien, Zürich: Schöningh 1998, S. 135-174.
3) Hermann Engelbert schreibt in seiner „Hinterhüttschen Chronik“ (Kreuztal 1994, S. 406) zur 700-Jahr-Feier Siegens Folgendes „…. Im August heftige Zeitungskämpfe, ob unser Heimatdichter Adolf Wurmbach aus Littfeld, ein vaterländisch-„gesinnter“ Mannist. Sein Weihespielzur 700-Jahr-Feier der Stadt Siegen wird abgelehnt. …..“
Seit einiger Zeit beschäftige ich mich mit Untersuchungen nach dem Lebenslauf von Ernst Szymanowski (später Ernst Biberstein). Diese Geschichte von einem Mann der als Pastor anfing und im Nürnberger Einsatzgruppenprozess 1947 zum Tode verurteilt wurde fasziniert mich.
Im Buch von Gerhard Hoch ‚Ernst Szymanowski-Biberstein – Die Spuren eines Kaltenkirchener Pastors‘ wird geschrieben: „Geboren wurde Ernst Szymanowski am 15. Februar 1899 in Hilchenbach, Kreis Siegen / Westfalen. In Mühlheim an der Ruhr besuchte er die Volksschule. 1906 wurde sein Vater Ernst Szymanowski als Eisenbahnbeamter nach Neumünster versetzt.“ Sie schreiben, dass die Familie schon am 30. April 1901 nach Neumünster umgezogen sei. Dazu habe ich einige Fragen:
* Weil der Name seiner Mutter mir nicht bekannt ist, möchte ich gerne eine Kopie seiner Geburtsurkunde empfangen;
* Gibt es eine Notiz über den Umzug nach Neumünster? Ist es möglich mir davon eine Kopie zu schicken?
* Es gab auch noch einen jüngeren Bruder; wurde er auch in Hilchenbach geboren? Gibt es davon auch eine Geburtsurkunde? Dann gerne auch eine Kopie.
Wenn daran Kosten verbunden sind, dann höre ich das gerne.
Mit freundlichen Grüßen,
Gerben Dijkstra
Anjer 51
2678 PC De Lier
Niederlande
Für die Beantwortung der hier gestellten Fragen ist das Stadtarchiv Hilchenbach zuständig. Eine entsprechende E-Mail-Antwort wurde bereits verschickt.
Die Tagesordnung der Anhörung zum Archivgesetz im Kulturausschuss des Landes NRW, 28.8.2014 15:00 Uhr, in Düsseldorf ist online: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/GB_I/I.1/Tagesordnungen/WP16/800/E16-829.jsp
Offener Brief dazu von Dr. Klaus Graf, Archiv der RWTH Aachen, an Prof. Dr. Eric Steinhauer, Teilnehmer der Anhörung, liegt ebenfalls bereits online vor: http://archiv.twoday.net/stories/948994023/
Folgende schriftliche Äußerungen zum Archivgesetz NRW für die „Hinzuziehung von Sachverständigen“ durch den Kulturausschuss des Landes NRW liegen vor:
Stellungnahme zur Anhörung v. Prof. Eric W. Steinhauer, Fernuniversität Hagen: https://www.dropbox.com/s/s8kam5sxqeoktky/Stellungnahme_Steinhauer_Archiv_Piraten.pdf
Stellungnahme zur Anhörung des Verbandes deutscher Archivarinnen und Archivare: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST16-1965.pdf?von=1&bis=0
Stellungnahme zur Anhörung des LVR-Dezernats für Kultur und Umwelt: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST16-1984.pdf?von=1&bis=0
Stellungnahme zur Anhörung des Städtetages NRW: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST16-1991.pdf?von=1&bis=0
Gemeinsame Stellungnahme zur Anhörung des Landkreistages NRW und des Städte- und Gemeindebundes NRW: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST16-1986.pdf?von=1&bis=0
Wurmbach war Hauptlehrer und Schulleiter der Volksschule in Krombach – frdl. Hinweis von T. Fries.
Radio Siegen, Podcast, 21.8.2014: „Ältester Bergbau im Siegerland. Bei Kreuztal ist ein Bergbauschacht aus dem 13. Jahrhundert gefunden worden. Er gilt als der älteste Fund bei uns in Siegen-Wittgenstein.“: http://radio-siegen.de/_pool/files/beitraege/735526.mp3
Beiträge in der Siegener Zeitung der Jahrgänge 1930/32 von Wilhelm Schmidt
Dr Ädde ah sin Jong – Gedicht, Mundart,
SZ 03.05.1930
Zur Reichspräsidentenwahl – Gedicht, Mundart,
SZ 09.04.1932 (veröffentlicht einen Tag vor dem zweiten Wahlgang zur Reichspräsidenwahl 1932),
Wä en Freund bim Koenig haedd – Gedicht, Mundart,
SZ 28.05.1932
Dr Rärrer Kirfich – Gedicht, Mundart,
SZ 19.11.1932
Am 06.10.1931 fand in der Eisefelder Turnhalle ein Familienabend des Evang. Volksdienstes statt.
Redner waren (Gustav Adolf ?) Weigelt, Eiserfeld, der eine Lobesrede auf das Wirken und Schaffen Stöckers hielt und Professor (Karl ?) Veidt.
Zwischen den Redbeiträgen trug Wilhelm Schmidt einiges aus eigener Dichtung vor.
SZ 07.10.1931
“ ….. Bei einer Anhörung im Landtag unterstützten die Landschaftsverbände aus dem Rheinland und aus Westfalen-Lippe die Forderung eines generellen Verkaufsverbots. Das Archivgesetz liegt dem Landtag derzeit zur Überprüfung vor.“
Quelle: WDR.de, Kulturnachrichten, 28.8.2014
s. a. Pressemitteilung der Piraten-Fraktion zur heutigen Archivgesetzanhörung in NRW:
“ …. Die Sachverständigen haben bestätigt, dass am Archivgesetz NRW Verbesserungen vorgenommen werden sollten. Es darf kein Archivgut zweiter Klasse geben, deshalb muss zukünftig auch kommunales Sammlungsgut vor dem Verkauf geschützt werden – schließlich ist Kulturgut keine Handelsware und sollte nicht zur Haushaltssanierung der Kommunen verscherbelt werden. Außerdem müssen die Regelungen zur digitalen Archivierung und Digitalisierung klarer gefasst werden. Wir fordern, dass möglichst viele kulturell wertvolle Unterlagen den Menschen im Internet zugänglich gemacht und auch weiterverwendet werden können. Kultur gehört allen Menschen. …..“
Link: http://www.piratenfraktion-nrw.de/2014/08/nordrhein-westfalisches-kulturgut-in-gefahr/
Gern und mit Nachdruck unterstütze ich diesen überfälligen Appell für die Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes! Danke für die Initiative! Astrid Rothe-Beinlich, MdL BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; Vizepräsidentin im Thüringer Landtag
Ich besitze zwei signierte Gedichtbände von Wurmbach (Blumen im Brachland). Als Literaturwissenschaftler (M.A.) und Siegerländer überlege ich schon seit einiger Zeit, eine Dissertation oder eine Biographie über ihn zu verfassen. So langsam müsste ich mich entscheiden. Es gibt bis auf wenige wissenschaftliche Aufsätze kaum Literatur über diesen Dichter, da er kaum über das Siegerland hinaus gewirkt hat (- bis auf die Gelsenkirchener Tage) und mit seiner betont christliche Weltsicht keinen weiten Leserkreis gefunden hat. Ich kenne den Teilnachlass in Kreuztal. Das westfälische Handschriftenarchiv hält sich mesitens sehr bedeckt, das liegt wohl am Leiter des Archivs.
Infos für Nachwuch-Forscher gibt es bei
Stadtarchiv Freudenberg
Rathaus Mórer Platz 1, Zimmer 109. 02734 / 43-148
d.koeppen@freudenberg-stadt.de
http://www.siwiarchiv.de
Detlef Köppen
Stadtarchivar
Was haben Sie denn in Freudenberg zu bieten?
Die einstige gar ganz andere Minderheit
hat heute den Namen Pfarrgemeinde St. Marien
Freudenberg.
Detlef Köppen
Beiträge von Wilhelm Schmidt in der Beilage zur Siegener Zeitung
„Unser Heimatland“:
1926 (erster Jahrgang)
Eam Heidemich, Gedicht, Mundart, Seite 32
Am alten Stollen, Gedicht, Hochdeutsch, Seite 47
Frehjohr, gedicht, Mundart, Seite 80
Det Veelwennche, Gedicht, Mundart, Seite 112
Dr schlagfertige Mechel, Gedicht, Mundart, Seite 125
Noahsommer, Gedicht, Mundart, Seite 176
1927
Dr Stefftekopp, Gedicht, Mundart, Seite 15, unterzeichnet mit Welmes Willäm,
E Peffekus, Gedicht, Mundart, Seite 96, Welmes Willäm,
1928
De Hornbläser eam Nassauer, Gedicht, Mundart, Seite 48, Welmes Willäm,
En goare Uhlouw, Anekdote, Mundart, Seite 96, Welmes Willäm,
1929
De Schläfe, Gedicht, Mundart, Seite 95
1930
kein Beitrag
1931
kein Beitrag
1932
kein Beitrag
1933
kein Beitrag
1934
Zur Nachtschicht, Gedicht, Hochdeutsch, Seite 140
1935
Dr Stoat vam najje Hus, Gedicht, Mundart, Seite 64
Dat Freamdwort, Gedicht, Mundart, Seite 77
Auszug: On bliewe ditsch eam Wäse, vah allem Waelche fräj –
Ohs Ditschland, et wird läwe, bliebt et sr sealwer träj!
1936
Wie dr Pinnejoest sin Arwet net feanne konn, Gedicht, Mundart, Seite 16
1937
kein Beitrag
1938
kein Beitrag
1939
Die letzte Ausgabe 1939 der Beilage „Unser Heimatland“ bringt
bewußt eine vielzahl von mundartlichen Gedichten und Beiträgen,
allerdings keine von Wilhelm Schmidt.
1940 (letzter Jahrgang bis zum Wiedererscheinen nach dem Krieg)
Die Nummer 2 des Jahrgangs 1940 ist eine
„Schwänke und Andekdoten-Nummer“
die aus schon früher veröffentlichten Beiträgen besteht.
Dr Fillste, Gedicht, Mundart, Seite 18, 1924
Dr Schlagfertige Mechel, Gedicht, Mundart, Seite 19, 1926
Wie Franzes Ädde sech binah ohglecklich gemmacht hädde, Gedicht, Mundart, Seite 19, 1930
Dr Hermedeicher Keandsguck, Gedicht, Mundart, Seite 20, 1925
Schlechter geschmack oarrer goahre Margarin, Gedicht, Mundart, Seite 20, 1925
Det Hondsexame, Gedicht, Mundart, Seite 24, 1936
Wie dr Pinnejoest sin Arwet net feanne konn, Gedicht, Mundart, Seite 28, 1936
Decke Duffeln, Gedicht, Mundart, Seite 31, 1925
Die Ausstellung im Mittendrin-Museum enthält ein Familien-Brettspiel
„Kampf gegen Russland“. Durch diese Siel wird augenfällig, wie weit die
eigentlich unbeteiligten Kinder vor 100 Jahren mit dem Thema 1.Weltkrieg konfrontiert wurden.
Bereits am Eröffnungstag protestierte ein Besucher (verm. Putin-Versteher)
gegen dieses Ausstellungsstück. Man sieht es ist Gesprächsstoff gegeben.
Morgen erfolgt die 2. Lesung des Archivgesetzes im Düsseldorfer Landtag unter TOP10 : http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/GB_I/I.1/Tagesordnungen/WP16/001/PT16-66.jsp . Im Sinne der Petition Mut machender Änderungsantrag der PIRATEN-Fraktion zur 2. Lesung des Archivgesetzes liegt ebenfalls vor: http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD16-6747.pdf
Archivalia weist daraufhin, dass die Veräußerungsmöglichkeit für kommunalarchivisches Sammlungsgut nicht mehr besteht: http://archiv.twoday.net/stories/985928688/ !
s. a. eigenen Eintrag auf Archivalia zum Thema.
1.) Jugendstilvilla, Poststraße 44, Bad Berleburg
2.)
Die Villa wurde 1897 durch die Holzwaren-fabrik Breimer als Wohnhaus erbaut. Im Laufe ihrer Geschichte hat das Gebäude zahlreiche Nutzungsänderungen erfahren und vielfach den Eigentümer gewechselt. Trotz der häufigen Nutzungsänderungen hat die Villa ihr charakteristisches Aussehen bis heute bewahrt, so dass die Stadt Bad Berleburg das Gebäude einschließlich der Garteneinfriedung am 15.10.1984 in die Denkmalliste eingetragen hat.
Die Villa ist ein dreigeschossiges, massiv errichtetes Bauwerk. Das Sockelgeschoss ist in hammergerechtem Bruchsteinmauerwerk her-gestellt. Die Mittelgeschosse sind in verputztem Ziegelmauerwerk ausgeführt, haben Verzierungen im Eckbereich und abgesetzte Fensterlaibungen. Das Dachgeschoss besteht aus sichtbarem Fachwerk mit ausgemauerten Gefachen. Das Walmdach ist mit Pfannen gedeckt und weist auf der Ostseite eine Ziereindeckung aus.
Der erste Eigentümerwechsel erfolgte in den 30-er Jahren des 20. Jahrhunderts, als die Samesreuther Müller-Schuss Metallbau (SMS) die Villa, sowie die sich nordwestlich anschließenden Fabrikationsanlagen aufkaufte. Mit dem neuen Besitzer ging die erste Umnutzung des Gebäudes einher, da die Villa nun auch im Untergeschoss als Bürogebäude genutzt wurde. 1973 erfolgte die Aussiedlung der Firma SMS und der Kreis Wittgenstein wurde neuer Eigentümer. Im Zuge der Umsiedlung wurden die Fabrikgebäude abgerissen.
1980 erwarb die Stadt Bad Berleburg die Villa, nutzte sie als Musikschule und später als Jugendzentrum. Das Umfeld der Villa wurde als öffentliche Grünfläche umgestaltet, wobei der alte Baumbestand im Nahbereich der Villa mit einbezogen wurde. Eine grundlegende Renovierung erfolgte 1993 durch die Wittgen-steiner Kliniken Allianz, die die Villa von der Stadt Bad Berleburg langfristig angemietet hatte. Im Erdgeschoss wurde ein Kur- und Verkehrszentrum eingerichtet. Das Obergeschoss beherbergte die Praxisräume der Kurärztin. Auf der gleichen Etage ist das städtische Standesamt nebst Trauzimmer untergebracht.
Park und Gebäude dienen seither zahlreichen Brautpaaren als repräsentative Fotokulisse. Zwischenzeitlich ist die Praxis durch eine Versicherungsagentur ersetzt worden. Für die nahe Zukunft sind weitere Nutzungsänderungen nicht ausgeschlossen. Die Dachgeschossnutzung knüpft mit zwei Wohnungen an die ursprüngliche Nutzung der Villa als Wohnhaus an.
Quelle: AG Historische Stadt- und Ortskerne NRW
Bildausschnitt erkannt an der Farbgebung und der Fensterform, den Rest lieferte Google……
Der erste Lösungs-Kommentar war bei mir zunächst nicht sichtbar, deswegen 2. Versuch bitte löschen. :-)
Meines Wissens handelt es sich um die Jugendstilvilla in Bad Berleburg (neben dem Bürgerbüro). Derzeit wird es für verschiedene Zwecke genutzt wird (u.a. für standesamtl. Trauungen).
„Die Villa, die im Jahre 1897 von der Unternehmerfamilie Koch als Wohnhaus auf der kurz zuvor aufwendig fertiggestellten Stadtchaussee, der heutigen Poststraße, erbaut wurde, galt neben dem etwa 2 Jahre eher fertiggestellten Landratsamt, welches zuvor in der Oberstadt angesiedelt war, als repräsentatives Aushängeschild unserer damaligen Kreisstadt Berleburg“ (Zitat Homepage Stadt Bad Berleburg).
Stefan Scholz hat richtig und schnell gelöst – Gratulation!
Kürzlich schaute ich noch wieder in die Entnazifizierungsakte von Adolf Wurmbach und musste leider feststellen, ich hatte bis dahin etwas übersehen.
In seinem Fragebogen hatte Wurmbach unter „Mitarbeit an Zeitschriften u. Zeitungen“ zwar eine Vielzahl von Titeln angegeben, nicht aber die Siegerländer National-Zeitung der Siegerländer NSDAP, in der er ja seit der ersten Hälfte der 1930er Jahre ständig Lyrik publizierte. Das wird er 1949 wohl kaum vergessen haben. Mutmaßlich dürfte es wohl auch mindestens dem einen oder anderen Angehörigen des Entnazifizierungsausschusses bekannt gewesen sein, so dass diese offenbare Lücke allen hätte bekannt sein können.
Wurmbach gab auch an, er habe nur „belletristische“ Texte publiziert, mit Politik und z. B. NS-Kriegspropaganda habe er nichts zu tun gehabt. Das war eine Suggestion und ebenfalls unzutreffend. Da musste man nur mal in die ja nicht untergegangene Ausgabe des Heimatkalenders für 1939 reingucken und die Beiträge zum Kriegsbeginn aufblättern. Wiederum kaum zu glauben, dass das entsprechende Kriegseinstiegsgedicht von Wurmbach (oder auch die späteren von ihm) im Ausschuss so völlig unbekannt gewesen sein sollen.
Dass Wurmbachs „Bergmannsgedichte“ (1942) von dem bekannten nationalsozialistischen Polit-Komponisten Georg Hermann Nellius so wertgeschätzt wurden, dass der sie vertonte, musste der Dichter nicht im Fragebogen mitteilen, war aber gewiss ebenfalls im Siegerland nicht gänzlich unbekannt geblieben.
Schlussfolgerung: Nicht nur Wurmbach selbst arbeitete fleißig nach dem „Zusammenbruch“ an seiner Mythisierung zum unermüdlichen Friedenskämpfer, sondern ein ganzes Netzwerk, denn Lichtgestalten fehlten wohl?
Hier noch ein Einblick in das von mir so genannte Kriegseinstiegsgedicht von 1939 (jährte sich erst kürzlich):
„O Deutschland, reich an Liedern und Wälderpracht -/Doch steht dir auch die Sprache des Zornes an,/Damit du züchtigest den Frevler,/Der an den heiligen Frieden rühret./Mit ihren Leibern schirmen der Besten viel/Und heißem Herzen Marken und Heimstatt dir,/Damit sie leben oder sterben -/Segne der Himmel den Schwur! – für Deutschland.“
Erfrischender Beitrag!!! Leider muss immer damit gerechnet werden, dass „Netzwerke“ wie das oben erwähnte bis in die Gegenwart hinein aktiv sind und, vor allem wenn Nachfahren der betreffenden Prominenten am Hebel sitzen, dem Schlachten (un-)heiliger Kühe nicht tatenlos zusehen werden. Beispielsweise wäre es (wie ich aus gut unterrichteten Kreisen erfahren durfte) vermutlich nicht zu empfehlen, die längst überfällige Aufarbeitung der Amtsführung eines gewissen bundesverdienstkreuzbehangenen Siegener Bürgermeisters während der NS-Zeit öffentlich vorzunehmen: Nicht nur, dass man sich als Autor leicht um Kopf und Kragen schreiben könnte; auch Schikanen gegen die benutzten Archive und das als Plattform in Frage kommende Printmedium wären nicht auszuschließen. Ob solche Seilschaften auch im Falle Wurmbachs auf der Lauer liegen, weiß ich nicht.
P.K.
Sehr geehrter Herr Kunzmann und Herr Dr. Opfermann, haben sie eigentlich Beweise für solche Verschwörungstheorien? Wir sollten bei den Fakten bleiben, alles andere ist wissenschaftlich unseriös.
Mit besten Grüßen,
Matthias Dickel
Was meinen Sie mit „Verschwörungstheorien“? Weder Herr Dr. Opfermann noch ich haben solche aufgestellt.
P.K.
Wenn ich Herrn Dickel richtig verstanden habe, geht es sich um Belege für das von erwähnte Netzwerk der „Heimatliteraten“.
Hallo Herr Kunzmann,
Herr Wolf hat es genauer ausgeführt, ich habe es nur ein bisschen plakativer formuliert.
Mit vielen Grüßen,
Matthias Dickel, M.A.
Die Frage ist nun, welche Belege lassen sich finden? Indizien für ein Netzwerk in der Siegerländer Heimatliteratur der 20er bis 70er Jahre des 20. Jh. sind die häufig ungebrochenen Bibliographien einzelner Protagonisten (bspw. Lothar Irle, Otto Krasa, Adolf Wurmbach, Wilhelm Schmidt, Hermann Böttger) in den maßgeblichen regionalen Publikationsorganen („Siegerland“, Siegerländer Heimatkalender“, etc.). Ferner könnte ein weiteres Indiz die Mitgliedschaft der „Netzwerker“ im Siegerländer Heimat- und Geschichtsverein sein. Ein Blick auf die Rezensionen der eigenständigen Werke könnte ebenfalls hilfreich sein. Vielleicht ergeben sich bei einer Auswertung der Entnazifizierungsakten weitere Hinweise.
„Netzwerk“ und „Seilschaft“ sind genauso plakative Formulierungen wie „Verschwörungstheorie“; wir müssen darauf nicht herumreiten. Auch Sie werden sicher nicht anzweifeln, dass es im Siegerland nach wie vor nicht wenige Menschen gibt, die sich untereinander gut kennen, aus mir persönlich unerfindlichen Gründen Adolf Wurmbach für einen begnadeten Dichter und eine denkmalgeschützte Lichtgestalt halten (was ja nun mal sein jahrzehntelang kolportiertes Image ist) und kein Interesse daran haben, dass irgendein Schatten auf ihren Helden fällt. Ich wollte neulich nur daran erinnern, dass das Ideal der „historischen Wahrheitsfindung“ in der Gesellschaft keineswegs große Sympathie genießt. Und eine erste Unmutsbekundung ist ja auch prompt gekommen (von Ihnen), kaum dass jemand (U.O.) am Denkmalssockel zu kratzen wagte. Solange sich der Protest auf entrüstete Siwiarchiv-Beiträge beschränkt, ist das auch gar kein Problem. Es können sich aber (vielleicht nicht gerade bei Wurmbach, bei anderen Persönlichkeiten der Zeitgeschichte sehr wohl) durch Recherchen Erkenntnisse ergeben, deren öffentliche Darstellung von gewissen „Denkmalschützern“ für justiziabel gehalten würde. Und vor Gericht ginge es dann nicht um dokumentierbare Geschichtswissenschaft, sondern darum, welche Partei den gerisseneren Anwalt engagieren kann. Teuer und rufschädigend würde es für den Beklagten auf jeden Fall, unabhängig vom Ausgang.
P.K.
Danke Herr Wolf, das war eine sachliche Antwort! Ich werde mich vorerst an der Diskussion nicht weiter beteiligen, um zu verhindern, dass das Thema hier im Forum weiter hochkocht.. Denn ich sehe die Wurmbach-Problematik aus einer anderen, der literaturwissenschaftlichen Warte. Mit besten Grüßen, Matthias Dickel
Hallo,
habe von 1923 noch 4 Feldpostkarten gestempelt Weidenau-Sieg in meinem Besitz. Wenn gewünscht kann ich diese gerne zur Verfügung stellen.
Da auch die Geschichtswerkstatt Siegen in Zusammmenarbeit mit dem Stadtarchiv Siegen für 2015 eine Ausstellung zum 1. Weltkrieg vorbereitet (Arbeitstitel „Siegen an der Heimatfront. 1914-1918. Weltkriegsalltag in der Provinz“, vgl. Eintrag auf siwiarchiv vom 13.09.2013) würden wir uns ebenfalls für diese Feldpostkarten interessieren.
….. zumal der Stempel „Weidenau-Sieg“ auf einen heutigen Stadtteil Siegens, nicht auf Wilnsdorf verweist.
Warum muss eigentlich jedes Dörflein seine eigene Kriegsausstellung veranstalten? Ich halte das nicht für professionell. Bei der überschaubaren Größe des Siegerlandes hätte es doch möglich sein sollen, die Aktivitäten zu bündeln. Und dass die Stadt Siegen etwas Größeres und für den gesamten Kreis Relevantes plant, ist ja lange genug bekannt. Unter dem von den Dörfern hier wiedereinmal verfochtenen Gießkannenprinzip leiden letztendlich die großen wie die kleinen Projekte.
P.K.
Und das mit DER Zange?! Respekt! Hier mal ein Einkaufstipp, damit lässt es sich doch wesentlich einfacher, und für das Archivgut schonender, arbeiten –> http://archivbox.com/archivzubehoer/abheftbugel-gurte-klett-heft-und-entheftgerate/heftgerate-klammern-enthefter/enthefterzange.html
„Wer weiß schon, dass die angeblichen Hexen bei lebendigem Leibe verbrannt wurden …“
Ich weiß etwas anderes und das steht in jeder neueren Einführung zum Thema:
„Die Hinrichtung von Hexen erfolgten im angelsächishcen Raum durch den Strang, in Kontinentaleuropa in der Regel durch das Schwert mit anschließender Verbrennung des Leichnams.“ (Johannes Dillinger, Hexen und Magie, Frankfurt 2007, S. 87)
Das „Gesetz zur Änderung des Archivgesetzes Nordrhein-Westfalen“ ist im Gesetz- und Verordnungsblatt (GV. NRW.) Ausgabe 2014 Nr. 27 vom 29.9.2014, Seite 603 bis 606, veröffentlicht. Die Unveräußerlichkeit des gesamtem, kommunalen Archivguts ist dort in § 1 Ziff. 4 Buchst. b geregelt.
Zur Ausstellungseröffnung. s folgenden Eintrag im Archivamtblog: http://archivamt.hypotheses.org/1168 , das Facebook-Album zur Eröffnung des Stadtmuseums Münster https://www.facebook.com/media/set/?set=a.804168076292691.1073741894.169980926378079&type=1 sowie folgende Wikimedia-Kategorie: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ausstellungser%C3%B6ffnung_%E2%80%9EWestfalen_hilft_K%C3%B6ln%E2%80%9C,_Stadtmuseum_M%C3%BCnster?gallerymode=packed&uselang=de .
Sehe ich das falsch, oder hätte 1963 der Kreisausschuss vom Kreistag beauftragt werden müssen, sich mit der Angelegenheit zu beschäftigen? In dem Fall könnten sich noch weitere aufschlußreiche Informationen in den Sitzungsprotokollen des letzteren finden, besonders wenn das Thema im Kreisparlament kontrovers diskutiert worden wäre. Auch vermute ich, dass Frau von Bredow sich weniger als Privatperson oder Oberin von Stift Keppel an den Landrat gewandt hatte, sondern eher als Kreistagsabgeordnete (übrigens die erste weibliche seit dessen Gründung).
P.K.
Zur Abrundung könnte man sicherlich noch einmal die Kreistagsprotokolle überprüfen. Der hier eingestellte Text ist im Rahmen eines nur vierwöchigen Praktikums entstanden und, da sich am Ergebnis aller Voraussicht nach nichts ändern wird, wurde auf diese Überprüfung verzichtet.
Ja, Juliane von Bredow ist hier wohl als Kreistagsabgeordnete aktiv. Ob sie allerdings wirklich die erste Kreistagsabgeordnete war, darf bezweifelt werden, denn eigentlich gebührt diese Ehre Lotte Friese-Korn – s. http://www.siwiarchiv.de/?p=6477 .
Danke für die Korrektur! Wenn ich nicht noch weitere Frauen übersehen habe (was der Kreisarchivar monieren würde), waren die drei ersten im Kreistag also: Lotte Friese-Korn (FDP) 1946, Juliane von Bredow (CDU) 1956, Waltraud Steinhauer (SPD) 1966.
P.K.
Ich schrieb:
„In seinem Fragebogen hatte Wurmbach unter “Mitarbeit an Zeitschriften u. Zeitungen” zwar eine Vielzahl von Titeln angegeben, nicht aber die Siegerländer National-Zeitung der Siegerländer NSDAP, … .“
Das muss ich nach erneutem Einblick in die Akte insofern korrigieren, als tatsächlich in der maschinenschriftlichen Auflistung „Nationalzeitung“ nachträglich per Hand hinzugefügt wurde. Von wem ist unbekannt. Handschriftlich hinzugefügt wurden auch Erscheinungsorte und -jahre der Publikationen. Das ist deshalb interessant, weil Wurmbach in seinem Fragebogen ein 1934 gegen ihn ausgesprochenes „Schreibverbot“ behauptete. Ausweislich bereits der handschriftlichen Angaben in diesem Fragebogen kann ein etwaiges Schreibverbot nicht allzu lange angedauert haben.
Es ist nicht auszuschließen, dass die handschriftlichen Nachträge in der Liste ganz oder teilweise von Wurmbach stammen, obwohl sie sich graphisch nicht mit Wurmbachs Eintragungen im Fragebogen decken: das erste ist kursive Schreibschrift, das zweite Blockschrift. Er könnte ja beide Varianten eingesetzt haben.
Festzuhalten ist aber noch, dass die Liste ein Nachtrag zum Fragebogen war. Sie traf ausweislich der Eingangsstempel erst eine Woche nach dem Fragebogen ein.
Die Angabe „Nationalzeitung“ ist demnach ein Nachtrag zu einem Nachtrag. Wann und von wem vorgenommen, ist unbekannt. Gesichert dagegen sind Datum und Autor (Adolf Wurmbach) der Aussage „1934 Schreibverbot“.
Das als präzisierender Nachtrag. Ich hoffe darauf, dass mir meine kürzliche Ungenauigkeit mit etwas Wurmbach-Toleranz nachgesehen wird.
U. O.
Zu Wurmbach fehlt eine umfassende literaturwissenschaftliche Erforschung seiner Arbeiten, um seine eigentliche Haltung zu identifizieren. Man kann nicht nur historisch anhand der Aktenlage einen Menschen erfassen. Ich finde, dass ein solcher „Sockelstoß“, wenn dieser denn stattfinden muss, auf fundierter Basis erfolgen muss. Ich wage einmal die Behauptung, dass man sich mit der publizistischen Situation der nicht völkischen und nationalsozialistischen Schriftsteller im Dritten Reich eingehend auseinandergesetzt haben sollte, bevor man über einen Menschen den Stab bricht.
Das Schreibverbot mit dem Adolf Wurmbach nach seinen eigenen Angaben
in dem Fragebogen der Entnazifizierungsakte im Jahre 1934 belegt wurde,
hat nicht lange Bestand gehabt.
Bereits ab1935 veröffentlicht Wurmbach regelmässig in der Zeitschrift Siegerland, die mir zurzeit erste bekannte Veröffentlichung ist aus dem Heft
Siegerland, 17. Band, 2. Heft, April – Juni 1935.
In diesem Band hat Wurmbach gleich zwei Gedichte:
„Das Backhaus“ und „Meiner Siegerländer Bergheimat“
beide auf Seite 67 und in hochdeutsch verfasst.
Zu Wurmbach, heißt es oben, fehle „eine umfassende literaturwissenschaftliche Erforschung seiner Arbeiten, um seine eigentliche Haltung zu identifizieren.“ Ich unterscheide nicht zwischen einer „eigentlichen“ und einer „uneigentlichen“ Haltung, wohl aber zwischen unterschiedlichen, wechselnden Haltungen zu Nationalismus, Militarismus, Krieg und Nationalsozialismus. Dass Wurmbach jemals als Nationalsozialist anzusprechen gewesen sei, würde ich nicht annehmen. Was aber nicht wegzudiskutieren ist, das sind eben diese wechselnden Positionierungen. Das lässt sich durchaus und auf dem kurzen Weg auch aus seinen Beiträgen zur regionalen Literatur erschließen.
Das sind die kriegspropagandistischen Texte aus dem Ersten Weltkrieg, da sind die pazifistischen Texte aus der Weimarer Zeit (die gewiss mit einer Ablehnung des Nationalsozialismus einhergingen) und das sind kriegspropagandistische Texte aus den NS-Jahren. Natürlich auch viel heimatlich Volksgemeinschaftliches, mal germanisierend formuliert, mal in Treue zum konventionellen Vers und zum Endreim. Und dann nach dem Ende des Nationalsozialismus wieder Pazifistisches.
Ich denke, das genügt schon, um sagen zu können, dass er ein Wendehals war. Warum auch immer.
Um das zu belegen, braucht es die Unwahrheiten nicht einmal, die sich aus Wurmbachs Umgang mit seinem Entnazifizierungsfragebogen erschließen. Aber sie sind schon ein interessanter, in den Kontext passender zusätzlicher Akzent.
Noch einmal einige Textauszüge:
Zum Arbeitseinsatz während der Aufrüstungsphase:
„Schaffendes Volk
Rühret die Hände!
Not macht hart!
Über der Gegenwart,
Über dem Heute
Leuchtet der Zukunft Schein.
Wenn wir leben
Nicht uns allein,
Leben dem Morgenden,
Das sich bereitet
Machtvoll um uns.
Darum rühret die Hände,
Daß Not sich wende
Und Opfer, Verzicht –
Zu Freiheit und Licht!“
(National-Zeitung, 25.4.1936, darunter ein Gedicht von Will Vesper zu u. a. dem „Vaterland“ in seinem „Herzen“)
„Für dich!
Fürs Vaterland sterben,
O heilige Saat,
Du höchstes Opfer
Verklärender Tat!
Ein namenlos Grab
So schlicht und klein,
Es schließt eine Welt
Voll Liebe ein.
Vergessen ist keiner,
Der fern verblich –
Gefallen – o Deutschland
Für dich, für dich!“
(Siegerländer Heimatkalender für 1942, S. 49)
„Sie [= Sparkassengründer] aber wußten auch um die Verpflichtung
Aus solcher Sicht und scheuten Kampf und Opfer
Und Fehlschlag nicht und führten kühlen Hauptes
Und heißen Herzens ihren Kampf und nahmen
Vorweg die Losung, die in unsern Tagen
Ein ganzes Volk zu sich geführt: Gemeinnutz
Geht über Eigennutz!“
(SZ, 5.8.1943, „Adolf Wurmbach, des Siegerlandes Dichter“, so die Zeitung, zur Hundertjahrfeier der Sparkasse der Stadt Siegen)
13 Jahre später:
„Würze zur Tagessuppe
Gibst Kanonen deinem Jungen
Du zum Spiel, mit Angst und Beben
Mußt du später den Kanonen
Deinem Jungen geben.“
(Westf. Rundschau [der SPD] im Getümmel der Atombewaffnungsdebatte, 13.8.1956)
Ulrich Opfermann weist via E-Mail auf neue Einträge zu Lehrerinnen und Lehrer im regionalen Personenlexikon zum Nationalsozialismus in den Altkreisen Siegen und Wittgenstein hin:
Beineke, Albert Friedrich Wilhelm
Bode, Adolf
Bonstein, Wilhelm
Born,Marie
Bredow, Juliane von
Breitenbach, Karl
Hohlsiepe, Wilhelm
Knappmann, Friedrich Wilhelm
Lehmann, Walter
Lepetit, Gustav
Mathi, Ernst Georg
Montanus, Hermann
Mugler, Edmund
Müller, Wilhelm August Robert
Vollmer, Wilhelm
Weigelt, Gustav.
erweitert: Müller, Hans
Die Geschichtswerkstatt Siegen zeigt in ihrem Blog Bilder dieser Ausstellung: http://geschichtswerkstatt-siegen.de/2014/10/15/1-weltkrieg/#more-192
Die Ausstellung im Stadtmuseum wird noch in der Zeit bis zum 22. Oktober 2014 gezeigt. Sie ist jeweils Samstags, Sonntags und Mittwochs von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet.
Mit kollegialen Grüßen
Detlef Köppen
Zu Gustav Busch:
In unserer Jugendzeit (ich bin Jahrgang 1930) war Gustav Busch für uns Geisweider,obgleich er ja an der Klafelder Schule unterrichtete,eine bekannte Persönlichkeit,vor der ich immer Respekt gehabt habe.Als Kinder und Jugendliche kannten wir natürlich nicht den vollen Umfang der geistigen und politischen Haltung die diese Leute während des Dritten Reiches verkörperten.Meine Frau war Schülerin in seiner Klasse an der Bismarckschule,bevor sie eine weiterführende Schule besuchte und sie hat sich eigentlich immer positiv über ihn geäußert.Wenn sie noch lebte und könnte heute, im Regionalen Personenlexikon zum Beispiel,nachlesen,welche
Gedanken und öffentliche Äußerungen G.Busch während der Nazizeit produziert hat,würde sie genau so wie ich total schockiert sein.Neben Walter Nehm von der Geisweider Schule,ist dies schon der zweite Lehrer aus unserer Jugendzeit,der mich heute als älteren Menschen,im Nachhinein so maßlos enttäuscht hat.Um weiteren Enttäuschungen vorzubeugen habe ich beschlossen,mir keine Schriften dieses Personenkreises mehr anzulesen.
PS:Sie können meine E-Mail-Adresse ruhig veröffentlichen.
Konsolidierte Fassung des Archivgesetzes NRW: https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=2&gld_nr=2&ugl_nr=221&bes_id=13924&aufgehoben=N&menu=1&sg=0#FN3
Lieber Thomas,
vielen Dank für den #KultTipp Siegerland – eine facettenreiche Museumslandschaft! Ich drücke fest die Daumen, dass ganz viele Besucher des Portals zu „echten“ Besuchern werden.
Schönen Abend!
Tanja
Pingback: Aufruf - Blogparade "Mein Kultur-Tipp für Euch" #KultTipp | Pearltrees
Gibt es seit der Monatsstatistik Mai 2014 keine weiteren mehr?
Danke für die Nachfrage! Leider haben wir seit geraumer Zeit Probleme mit dem Plugin. Es sieht daher nach einem Wechsel aus.
Lieber Thomas Wolf,
pardon, jetzt ließ ich es länger liegen – die Blogparade #KultTipp, bei der Sie auch mitmachten und uns über das Museumsportal Kreis Siegen-Wittgenstein – vielen Dank dafür – vorstellten, vereinnahmte mich komplett.
Jetzt habe ich mich ein klein wenig von der Blogparade erholt, die Einschläge zum Schluss waren heftig. Endlich konnte ich Ihr Blogstöckchen in Ruhe lesen – wunderbar! Das Gute an Blogstöckchen ist, dass sie irgendwann bearbeitet werden können. Bei mir lag es auch ein paar Wochen, bevor ich es beantwortete und weiterwarf. Mit Ihnen haben es jetzt alle zehn Museen und Archive bearbeitet, gestaltet und weitergereicht. Ich bin froh, dass ich ein Institutions-Blogstöckchen wagte, denn auch Ihre Antworten zeigen, wie spannend Archiv- und Museumsarbeit sein kann.
Vielen herzlichen Dank dafür! Und ich hoffe noch mehr Antworten von Ihren Kollegen lesen zu dürfen – Sie werden dadurch für mich unmittelbar und ihre Archive erhalten für mich ein Gesicht, worauf ich mich schon freue!
Schönes Wochenende!
Tanja Praske
„Älteste Montanregion Europas“??? „Bis in die Neuzeit eine geistige, religiöse, politische und wirtschaftliche Sonderstellung“??? „Zu Beginn des 20. Jahrhunderts befindet sich das Siegerland auf einem wirtschaftlichen Höhepunkt“??? „Das […] Herz der Bundesrepublik“??? „Die Demontage blieb im Siegerland aus“??? — Kühne Thesen …
P.K.
Kühne Thesen, die der Pressemitteilung der Fa. mundus.tv zum Erscheinen der DVD entnommen wurden.
Die hier vergebenen Fragezeichen darf man gern als Auftrag an Wirtschaftshistorikerinnen und – historiker verstehen. Im Falle der Demontage bspw. ist die Quellenlage erfreulich gut (Landesarchiv NRW) und die bisherige Forschung erstaunlich gering.
„Mit der Veröffentlichung von Revier hinter den Bergen kommen wir einem großen Wunsch vieler Menschen der Region nach, mehr über die Geschichte des Siegerlandes zu erfahren“. Wenn diese Aussage von Herrn Fischbach stimmen würde, dann müssten die anderen Veranstaltungen zur Siegerländer Geschichte jedesmal überlaufen sein. Dem ist aber nicht so!
Die Pressemitteilung ist zunächst nur Marketing in eigener Sache, dann Marketing für das Siegerland, den Siegerländer und die Siegerländerin (?, die bleibt dabei meistens außen vor) und inhaltlich wird solange an Sachverhalten herumgebogen, bis sie in die vorgefasste Meinung passen.
Hier ein Beispiel: „Denn nur Siegerländer wurden in die Zünfte aufgenommen. Dies verdeutlicht die Inschrift auf einem Pokal der Zunft der Gerber die da heißt: „Wer uns getreu in dieser Zunft, den geht auch dieser Becher an. Der Pflichtvergessene sich dieser Gnade nicht mehr rühmen kann“.“ In dem Zitat zur Zunft geht es um Getreue und Pflichtvergessene, aber nicht – wie ich es auch drehe und wende – um SIegerländer. Das entspricht aber dem Niveau der Siegerländer (Heimat-)Geschichtsschreibung, die dadurch glänzt, Altbekanntes immer wieder neu in Worte zu kleiden, niederzuschreiben, zu veröffentlichen und unter das Volk zu bringen – und das einschließlich der vorhandenen Fehler. Der Siegerländer als Erfinder des Perpetuum Mobile der Geschichtsschreibung.
Pressebericht zur Ausstellungseröffnung: http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-bad-berleburg-bad-laasphe-und-erndtebrueck/die-rolle-der-kirche-im-ersten-weltkrieg-id10048499.html
Die Mediengestaltung der DVD enttäuscht sehr. Von einem „Menü“ kann man nicht sprechen, Bonusmaterial (Bei dem Preis!) Fehlanzeige. Und etwas mehr als der schiere Hinweis auf den ursprünglichen Sendeort („Prisma des Westens“) hätte dem Produkt gut getan.
Mit Professor Reininghaus bietet das Siegener Forum wahrhaftig ein Juwel der westfälischen Landesgeschichte auf. Respekt!
…und ein „Juwel“ zum Eintrittspreis von nur drei Euro! Kommt massenhaft!
Ich werde kommen – aller Voraussicht nach – und wenn, dann benutze ich sogar noch vorher das Stadtarchiv!
(Ich weiß, dass ich mich wiederhole:) Menschen, die in dörflicher Randlage wohnen und auf den ÖPNV angewiesen sind, werden vom späten Beginn (bzw. Ende) solcher Veranstaltungen eher abgeschreckt. Für die meisten einschichtig tätigen Arbeitnehmer wird wohl der Dienst spätestens um 16 Uhr enden (oder bei Gleitzeit beendet werden können), so dass es kein Problem sein sollte, ab 17 oder 18 Uhr „massenhaft“ Publikum für interessante Vorträge ins Krönchen-Center zu locken. Außerdem entspräche ein früherer Beginn dem menschlichen Biorhythmus besser, da abends die Konzentrationsfähigkeit und Gedächtnisleistung rapide nachlassen, jedenfalls bei Berufstätigen, Schülern, Studenten und ähnlichen Lebewesen. Motorisierte Rentner, die sich vor den Veranstaltungen beim Mittagsschlaf regenerieren können und am nächsten Morgen nicht um 5 Uhr aufstehen müssen, sehen das möglicherweise anders.
P.K.
Lieber Herr Kunzmann,
wir arbeiten an einer besseren Lösung!
s. a. Pressemitteilung des Kreises Siegen-Wittgenstein v. 28.11.2014
Die Westfälische Rundschau berichtet heute: http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/auswirkungen-papierloser-ratsarbeit-aimp-id10090436.html . Leicht gekürzter Artikel erschien heute auch in der Siegener Zeitung (Print).
Am Mittwoch den 03.12.2014 findet die Bauausschusssitzung der Gemeinde Wilnsdorf statt.
Tagesordnungspunkt Nr. 8: Straßenbenennung in Obersdorf
es geht um die Einziehung des Weges „Wilhelm-Schmidt-Weg“.
Weitere Informationen unter:
https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz100/sdnetrim/Lh0LgvGcu9To9Sm0Nl.HayIYu8Tq8Sj1Kg1HauCWqBZo5Ok6KfyIjvIWsCSn4Rj3Qe-Hd.CXuCWn4Oi0Lg-IbvDauHTp8To1Ok0HbwHau8Vt6Pi7Kj2GJ/Vorlage_ohne_Beschlussvorschlag_157-2014.pdf
https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz100/sdnetrim/Lh0LgvGcu9To9Sm0Nl.HayEYv8Tq8Sj1Kg1HauCWqBZo5Ok7KiyIiuLWsFSq4Qq0TezKeyDWq8Sn6Rk1Lf0KjvFavETqASj1Mj0KaxJYr8Zm9UGJ/Anregung_Strassenbenennung_Obersdorf_v._17.11.2014.pdf
Bericht zur Ausstellungseröffnung erschien die der Siegener Zeitung v. 29.11.2014 (Print).
„Mit dem Band ,Siegerland – Eine Montanregion im Wandel’ ist eine fundierte Aufsatz-Sammlung entstanden, die die Siegerländer Wirtschaftsgeschichte der letzten Jahrhunderte zu einem außerordentlich bunten Bild zusammenfügt. Sie zeigt, wie viele Krisen wir überstanden haben. Sie veranschaulicht zugleich, mit welch harter Arbeit die hier lebenden Menschen dieser Umgebung ihr Dasein abringen mussten. Und auch wie erfolgreich wir dabei über die letzten Jahrzehnte unterwegs gewesen sind.“ Mit diesen Worten fasste Klaus Th. Vetter, Ehrenpräsident der Industrie- und Handelskammer Siegen (IHK), kurz und knapp das neu erschienene Werk zusammen, das jetzt in der IHK vor über 130 Gästen präsentiert wurde. Herausgegeben wurde es
von Prof. Dr. Manfred Rasch. Ergänzt ist das Ganze mit dem „Eisenwald“, einem Siegerländer Heimatfilm aus den 1950er Jahren.
Das rund 330 Seiten umfassende Buch ist ein neuer Sammelband zur Siegerländer Industriegeschichte. Zahlreiche Persönlichkeiten aus der heimischen Region haben daran mitgewirkt. So zum Beispiel Dr. Jaxa von Schweinichen (Geschäftsführer der Walzen Irle GmbH aus Netphen-Deuz), Monika Löcken (Museumsleiterin der Wendener Hütte und des Südsauerlandmuseums) oder der Historiker Dr. Andreas Bingener. Ergänzt wird das Buch durch ein Kapitel von Andreas Rossmann, Feuilleton-Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Sein Thema „Vom Verschwinden der Häuser in die Bilder. Wird das Siegerland, wie es Bernd und Hilla Becher fotografiert haben, nur in ihren Aufnahmen überleben?“
„Nicht nur die Wirtschafts- und Technik-Geschichte findet in dem Band ihren Niederschlag“, erläuterte Rasch im Rahmen der Buchpräsentation. „Es wird gleichzeitig auch der politische wie konzeptionelle Hintergrund erläutert. Vom Hauberg zum Holzkohlenmeiler. Von den Wertpapieren zur ndustriefassade.“ Und nicht nur damals, sondern auch heute sei die Region überaus erfolgreich, spannte IHK-Hauptgeschäftsführer Franz J. Mockenhaupt anschließend den Bogen in die Gegenwart. „Wir sind ein Industrieland auf der Basis von Stahl und Metall“, ging er ins Detail. „Jeder zweite Angestellte bei uns ist direkt beschäftigt in einem Industriebetrieb. Eine Quote, die bundesweit ihresgleichen sucht.“
Quelle: IHK Siegen, Pressemitteilung Nr. 146/November 2014
Schöne Idee, schönes Motiv.
Weitere Online-Adventskalender findet man in dieser sorgfältigen Aufstellung: http://bibliothekarisch.de/blog/2014/12/01/mehr-oder-minder-bibliothekarische-adventskalender-2014/
Am 10.12.2014 wird der Rat der Stadt Siegen über die erwähnte Veranstaltung beraten – s. hier.
Bericht zur Ausstellungseröffnung auf freudenberg-online v. 28.11.2014: http://www.freudenberg-online.com/index.php/8-aktuelle-nachrichten/2090-ausstellung-alte-schaetze-eroeffnet
Zur Eröffnung der Ausstellung gibt es einen detailierten Bericht auf der
facebook-Seite von 4fachwerk.
Auch Archivalia verweist auf unseren Adventskalender: http://archiv.twoday.net/stories/1022374939/ . Danke!
Hilfreich wären hier eine Ortsangabe gewesen.
Da gebe ich Ihnen recht, aber leider war keine Ortsangabe zu ermitteln. Wer also weiß, um welches Gebäude es sich hier handelt, der kann dies gerne hier kommentieren. Ich vermute es im Raum Bad Berleberg, Langewiese, Mollseifen. Schön ware es, wenn ein Bildbeleg „mitgeliefert“ werden kann.
Zur Verortung des Bildes Grobbel Nr.259 die folgende Info:

„Schedas Haus“, Grenzstraße 9, an der Postwiese in Mollseifen.
Das Belegfoto zeigt den Blick von der Rückseite.
Das Foto in siwichrchiv.de wurde von dem auf dem Belegfoto erkennbaren Weg aufgenommen.
Auf der heutigen Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde Wilnsdorf
wurde der Wilhelm-Schmidt-Weg eingezogen.
Die Abstimmung erfolgte einstimmig.
Soviel ich weis, muss das nun noch durch den Rat der Gemeinde,
das sollte aber nach dem heutigen Ergebnis keine Schwierigkeit darstellen.
Vielen Dank für die „Live“-Berichterstattung aus dem Ausschuss! Die Westfälische Rundschau widmet heute auch einen Artikel dieser Entscheidung: http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/gedicht-auf-hitler-wilhelm-schmidt-weg-ist-passe-id10107898.html
Die Siegener Zeitung berichtet heute nur im Print über die Ausschusssitzung.
Klaus Graf hat via google+ dankenswerterweise auf die Rezension von Gerhard Köbler (Innsbruck) in der Zeitschrift integrativer europäischer Rechtsgeschichte (ZIER) 04/2014 hingewiesen: http://www.koeblergerhard.de/ZIER-HP/ZIER-HP-04-2014/HandbuchderhessischenGeschichte3-RitterGrafenundFuersten.htm
Ist das nicht das gleiche Motiv wie bei Nr. 2? Wenn man das Beweisfoto des Stadtarchivs Freudenberg (Kommenter zu Adventskalender Nr. 2) zu Rate zieht, sieht man das noch deutlicher.
Ja, es handelt sich auch hier um „Schedas Haus“, Grenzstraße 9, an der Postwiese in Mollseifen. Der Adventskalender ist quasi ein Rätsel ;-). Dass sich Motive aus anderen Perspektiven wiederholen, liegt daran, dass es sich in diesem Kalender um Sammlungsgut eines Postkartenverlags handelt, der auch Mehrmotivkarten hergestellt hat. Zu diesem Zweck wurde ein Motiv in unterschiedlichen Ansichten fotografiert. Zudem schränkte die Jahreszeit die Auswahl ein.
Zum Glasaugenkünstler F. Ad. Müller ist auch die Website http://www.deutsche-biographie.de/sfz66941.html sehr interessant.
Mein Textvorschlag geht auf die m. E. ganz unzureichende Qualität der bisherigen Darstellung des Landrats Weihe (Larissa Pittelkow, Justus Weihe) zurück.
Dazu die folgenden Anmerkungen:
• „Am 12. Mai 1921 heiratete er [Weihe] Anna Klara Karoline Bertelsmann, Tochter des Direktors der Ravensburger Spinnerei Konrad Bertelsmann und Frieda Schweitzer. … So verrichtete Weihe seine ersten landrätlichen Geschäfte als Vertreter in Usingen und Gelnhausen, wo er seine spätere Ehefrau kennen lernte, deren Vater dort Landrat war.“ Abgesehen von der Grammatik im ersten Satz wäre bei Pittelkow nachzubessern, dass
a) Conrad Bertelsmann, geb. 1835, (übrigens Mitbegründer des Langnam-Vereins) nicht eine „Ravensburger“, sondern die Ravensberger Spinnerei in Bielefeld zwar zeitweise besessen hatte, sie aber mit seinem Tod 1901 verkauft worden war.
b) Er war also nicht ein etwa nur von den Eigentümern eingestellter Direktor, sondern der Inhaber des Unternehmens gewesen.
c) Seine nun verwitwete Ehefrau Frieda Marie Elmire geb. Schweitzer heiratete 1913 ein weiteres Mal, nämlich den Juristen Conrad Delius, von 1919 bis 1933 Landrat in Gelnhausen, der im August 1945 in Allenbach bei Hilchenbach, offenbar bei seinem Schwiegersohn also, verstarb.
Wie passen die Geburtsdaten (Vater/Tochter Bertelsmann) hier zusammen? Es besteht weiterer Recherchebedarf.
• 1931/32: „Simmern war der einzige protestantische Kreis in der Rheinprovinz.“ Allein in der südlichen Hälfte der Rheinprovinz gab es vier mehrheitlich protestantische Kreise. Dennoch ist natürlich zu sagen, dass die Rheinprovinz ganz überwiegend katholisch war.
• „Im Oktober 1933 wurde er Regierungsrat.“ Das geschah nach unterschiedlichen Quellen schon einige Jahre zuvor in Koblenz.
• „Weihes Vorgänger in Siegen, Landrat Goedecke“: Weihes Vorgänger war der nach dem Abgang von Goedecke vertretungsweise eingesetzte Gerhard Melcher.
• Weihe „wurde Mitglied der SS.“ Die Aussage, Weihe sei Mitglied der SS gewesen, lässt annehmen, dass er aktives Mitglied der Allgemeinen SS gewesen sei. Das ist unzutreffend. Weihe war ausweislich der Entnazifizierungsakte Förderndes Mitglied der SS. Das war etwas anderes.
• Zwar sei er Vorsitzender des „Rechtswahrerbundes“, also des NSRB gewesen, der aber sei „von der Partei unabhängig“ gewesen. Das Gegenteil war der Fall. Der NSRB war eine nationalsozialistische Gründung und Formation.
• „Ebenso“ sei Weihe Mitglied von der Partei „angeschlossenen Verbänden“ wie der NSV, dem RBL, dem NSKB, der Deutschen Jägerschaft, dem Tennisklub, dem Deutsch-Österreichischen Alpenverein und dem DRK gewesen. Die Verfasserin weiß offenbar nicht zu unterscheiden zwischen der Partei mit ihren Gliederungen wie SA und SS, den ihr angeschlossenen Verbänden wie dem NSRB oder der NSV und dem, was es in formaler Unabhängigkeit sonst noch so gab: Deutsche Jägerschaft, Tennisklub, DAV oder DRK.
• Die Verfasserin reicht aus unbekannter Quelle die unbelegte Mutmaßung weiter, Weihe „sei zu dieser Zeit [1932] schon Gegner des Nationalsozialismus gewesen“, und sie bekräftigt, „Weihe war bis dahin [bis zur Machtübernahme 1933] Mitglied der Deutschen Volkspartei (DVP) gewesen.“ Er trat 1931, also zum Zeitpunkt seines Dienstantritts als Landrat in Simmern, in die DVP ein. Eine inhaltlich-politische Überzeugung muss hinter dem späten Eintritt nicht gestanden haben. Eine Gegnerschaft zum Nationalsozialismus schließt die Entscheidung nicht unbedingt ein. Siehe auch eine Angabe weiter unten.
• Es heißt beleglos, Weihe sei „im September 1938 sogar aus der Partei ausgeschlossen worden.“ Im Januar 1939 sei dann der Parteiausschluss zurückgenommen worden. Dort, wo dergleichen zu finden sein müsste, im Zentralregister bzw. im Ortsregister der NSDAP im Bundesarchiv, die beide penibel geführt wurden, findet sich zwar Weihes Mitgliedskarte, darauf oder sonstwo aber nicht, dass er jemals ausgeschlossen und anschließend wieder aufgenommen worden wäre, wie man es in solchen Fällen in der Parteiverwaltung dokumentierte.
• Die Verfasserin bezieht sich mit ihrer Behauptung vom Ausschluss darauf, dass „man“ Weihe vorgeworfen habe, … mit einer „unarischen“ Frau verheiratet zu sein … . [Das war] eine ungerechtfertige Intrige. Seine Frau Anna Bertelsmann stammte aus einer sehr angesehen Familie.“ Der Satz reproduziert die antisemitische Perspektive der Nazi-Zeit: hier die Nicht-Arierin, die Jüdin, dort die angesehene „arische“ Familie. Ich gehe davon aus, dass das ebenso wie bei anderen Formulierungen mit falscher oder unklarer Sichtweise keine Absicht war, sondern gedankliches und sprachliches Ungeschick, dennoch m. E. fatal und kennzeichnend für die fachliche Kompetenz der Schreiberin.
• Nichts vom angeblichen Ausschluss/Wiedereintritt ist durch einen Beleg auch nur als Möglichkeit plausibel gemacht. Belegt ist vielmehr das Folgende: Weihe wird eingeräumt, dass er trotz „nicht rein arischer Abstammung seiner Ehefrau … weiter der NSDAP ohne Einschränkung der Mitgliedschaftsrechte angehören kann.“ So kein Geringerer als Adolf Hitler am 20.12.1938 in einem Führer-Erlass (BAB, VBS 1, 1/1.130.017.081).
• Weihe habe ein Buch von Churchill „vor den Flammen der Bücherverbrennung“ gerettet. Die Aussage ist einem Entlastungsschreiben im Entnazifizierungsverfahren entnommen. Es gab im Siegerland keine Bücherverbrennungen, und der Sprecher behauptete sie auch nicht. Es handelt sich um eine Erfindung der Verfasserin.
• „So wurde Weihe Landrat in Radom/Polen. Er arbeitete in Kalisch.“: Radom lag im Generalgouvernement, Kalisch im Warthegau. Hier war er zuerst eingesetzt, nämlich als kommissarischer Regierungsprädident, dann in Radom als Kreishauptmann (Markus Roth, Herrenmenschen. Die deutschen Kreishauptleute im besetzten Polen – Karrierewege, Herrschaftspraxis und Nachgeschichte, Göttingen 2009, 2. Aufl., S. 509).
• „Vor Kriegsende hat er sich außerdem mit Pfarrer Münker für den Rückzug der Truppen aus Siegen eingesetzt.“ Gemeint ist der Mitbegründer des DJH Wilhelm Münker, nicht Pfarrer, sondern Unternehmer. Anzunehmen ist, dass die Verfasserin Münker mit dem Pfarrer Hermann Müller durcheinanderbrachte.
• „Unter Lebensgefahr“ sei Weihe zu einem rettenden General Engel unterwegs gewesen, heldenhaft habe er gegen die Partei und in Todesgefahr für die Bevölkerung gekämpft „wie der Kapitän auf seinem untergehenden Schiff“. Bei Elkar (S. 283f.), den die Verfasserin in ihrer Literaturliste angibt, steht etwas anderes. Der Handelnde ist dort Wilhelm Münker, Weihe eine Figur am Rande ohne jegliche Initiative, ein Angsthase, den Münker zur Fahrt zu Engel habe „nötigen“ müssen. Weihe habe Angst um sich und um seinen Wagen gehabt. Nicht um einen Abzug aus Siegen ging es dabei, sondern um das nördliche Siegerland. Münker diplomatisch oder auch mit Spitze im Entnazifizierungsverfahren zu den Ereignissen: „Landrat Weihe war für alle Maßnahmen im Sinne des Guten und Schönen.“
• „Durch die Übernahme der Regierung, wurden automatisch alle Personen der höheren Ämter festgenommen.“ Der Verfasserin geht es um die Mitteilung, Weihe sei festgenommen und interniert worden. Das war in allen Besatzungszonen die gemeinsame Politik der Alliierten, um NS-Einflussträger und mutmaßlich -Belastete aller Ebenen, also keinesfalls nur „Personen der höheren Ämter“ und auch nicht diese insgesamt durch Isolation in Lagern bis zum Abschluss einer ersten Überprüfung aus dem Verkehr zu ziehen. Die entsprechenden Festnahmelisten gründeten vor allem auf Angaben von NS-Gegnern im Land (und aus der Emigration).
• Zur Entnazifizierung: „Fakt ist, dass die Militärregierung ihn am 12. Juli 1948 unter den Bestimmungen der Verordnung entlastete. Er wurde in die fünfte Kategorie eingestuft: unbedingt tragbar, makellos, ohne Sperre.“ Das ist unzutreffend. Die Militärregierung stufte ihn in III ein, der ungünstigsten Kategorie in den Massenverfahren. Der deutsche Ausschuss (Hauptausschuss) war wie immer freundlicher, aber in diesem Fall auch gespalten. Fünf Mitglieder waren für IV, fünf für V. Deshalb: „Wir bitten die Militärregierung um Entscheidung.“ (1.12.1947) Daraus folgte Kategorie IV ohne Kontensperre, aber mit politischer und Bewegungsbeschränkung (17.12.1947). Erst im weiteren Berufungsverfahren wurde daraus durch die nun wiederum deutschen Ausschussmitglieder V = „unbelastet“. Für seine Beurteilung übernahm der Ausschuss schlicht eins zu eins unbelegte Selbstaussagen und unbelegte Aussagen von Entlastungszeugen.
• „Die Richter“ hätten Weihe entlastet. Gemeint sind die Ausschussmitglieder. Richter gab es in den Verfahren keine, weil sie ja keine Strafprozesse waren. Die Verfasserin scheint den Unterschied nicht zu kennen. Überhaupt scheint sie die Regelungen des Entnazifizierungsverfahrens weder in der Form noch dem Inhalt nach zu kennen.
• Einen Ausschluss aus der NSDAP teilte Weihe im Entnazifizierungsverfahren nicht mit, obwohl er hier ja bestens gepasst hätte. Die Verfasserin hätte aus dieser Leerstelle den notwendigen Schluss ziehen müssen. Den Führererlass ließ Weihe auch fort. Auch das fiel ihr nicht auf, oder sie kannte ihn nicht.
• Über ihre vormaligen Parteimitgliedschaften schwiegen die entsprechenden Entlastungszeugen. Die Verfasserin schweigt darüber oder ist ohne Problembewusstsein. Sie verschweigt auch den Opportunismusvorwurf gegen Weihe (Pg., „um sein Amt zu halten“), der von mehreren Zeugen kam.
• In Übertragung einer Behauptung aus einem dieser zahlreichen Entlastungs- und Leumundsschreiben: „So gelang es ihm, die grundlos inhaftierte Frau von Cantstein zu befreien.“ Das mag so gewesen sein oder auch nicht, es ging jedenfalls um eine Frau von Canstein.
• 1944 habe es viele Lager „für Kriegsgefangene und Fremdarbeiter“ – die Verfasserin scheut den Rückgriff auf die NS-Terminologie nicht – im Kreisgebiet gegeben. „Zu der Zeit waren viele Zivilisten bewaffnet und suchten die Wälder nach Alliierten ab“: einfach nur Unsinn.
Sprachlich-Gdeankliches:
• „Die Entnazifizierungsunterlagen besagen weiter, Weihe habe die Judenaktionen und die Vernichtung der Erbkranken verurteilt und sich nicht an Rassenverfolgungen beteiligt. Trotzdem brannte am 10. November 1938 die Siegener Synagoge …“.
• „Wer nicht starb, wanderte aus.“
• „So konnte sich das Siegerland im September 1944 damit rühmen, ‚judenfrei’ zu sein.“ „Das Siegerland“? Wer bitte hätte das verkündet? Oder ist es die Verfasserin, die findet, damit hätte „das Siegerland“ sich (etwa ganz zu recht) rühmen können?
• Ein Satz wie „Der Nationalsozialismus und der daraus folgende Zweite Weltkrieg haben große Spuren hinterlassen – auch in Siegen. Viele Menschen waren damals am Spiel der Mächte beteiligt“ wird dem Thema wenig gerecht und weist die Schreiberin als themenfremd und/oder als Schwadroneuse aus.
Die inhaltliche Betrachtung breche ich hier ab und komme zur Form:
• Fußnoten fehlen völlig, keine der Aussagen ist einem Beleg zugeordnet.
• Die angegebene Liste von Primärquellen weckt Zweifel, ob bzw. wie sorgfältig nach Belegen gesucht wurden/mit ihnen gearbeitet wurde:
a) „Entnazifizierungsakten“, ohne Bestandsbezeichnung und Signatur
b) Dreimal nennt die Verfasserin zwar Archivalien, bezieht sich aber nur auf deren Nennung in der Literatur „Oberpräsidium Münster generell (z. B. Nr. 7443 lt. Stelbrink)“, „Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin, HA Rep. 77 Ministerium des Innern generell ( z. B. Nr. 4435 lt. Stelbrink)“, „Bundesarchiv Berlin Document Center, Nr. Akte Weihe (lt. Stelbrink)“. Da hat sie sie dann offenbar herausgeschrieben, ohne ins Original zu gucken. In einem Ausnahmefall ist einmal eine Signatur angegeben (Bundesarchiv, R 18/3.819), was darunter zu finden sein soll nicht. Worauf im Text sie sich damit bezieht, natürlich auch nicht. In einem anderen Fall ersetzt die Archivadresse einschließlich Telefonnummer die Angaben („Archiwum Panstwowe w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Zlota 43 Tel: 73-591“).
c) Da wichtige Angaben (Führererlass zu Weihes Parteirechten, Einstufung in Kategorie III, …) im Text fehlen, die in den angegebenen Primärquellen enthalten sind, wurden diese Angaben entweder verschwiegen oder waren unbekannt, weil die Quellen entgegen dem Anschein nicht eingesehen wurden.
d) Ein Quellentyp sind „Zeitzeugen“angaben, nämlich eines Sohns des Landrats. Sie sind reichlich in den Text eingearbeitet. Sie werden gläubig/quellenunkritisch/ungeprüft übernommen. So kann man an die Dinge nicht herangehen. Ohne eine Absicherung/Überprüfung geben diese Angaben Ansichten des Sohns wieder, sind Selbstauskünfte des Sprechers über sich, mehr nicht.
d) Die Angaben zu den als Quellen herangezogenen Medien (Siegener Zeitung u. a.) sind z. T. unüberprüfte, tatsächlich unzutreffende Übernahmen aus Lothar Irles „Persönlichkeitenlexikon“, das exakt dieselben Fehler enthält. Die Originale dürften also gar nicht eingesehen worden sein.
• Das Literaturverzeichnis entpuppt sich als ein (unzureichender) Lesevorschlag zum regionalen NS. Mit dem Aufsatz der Verfasserin hat es kaum etwas zu tun hat, denn die genannten Schriften enthalten in der Mehrzahl tatsächlich entweder gar keine oder nur minimale Angaben zu Weihe.
Zur eingehenderen Beschäftigung mit dem Leben Weihes sei auf folgende Literatur hingewiesen:
Romeyk, Horst: Die leitenden staatlichen und kommunalen Verwaltungsbeamten der Rheinprovinz 1816 – 1945, Düsseldorf 1994, S. 805.
Landratsamt Simmern/Hunsrück: Landkreis Simmern, in: Heimatführer der deutschen Landkreise ; 2, Bonn 1967, S. 100.
Rademacher, Michael, Handbuch der NSDAP-Gaue 1928-1945, Vechta 2000, S. 327 lt. regionalem Personenlexikon zum Nationalsozialismus in den Altkreisen Siegen unf Wittgenstein
Ferner sind diese Archive zu konsultieren:
1) Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen, Münster:
– Kreis Siegen, Landratsamt Siegen generell [z. B. Nr. 1951 Vereinfachung der Verwaltung im Kriege usw. (Handakten des Landrats Weihe) 1941-1944] und Kreisausschuss Siegen generell
– Personalakten Oberpräsidium G 12
– Oberpräsidium Münster generell (z. B. Nr. 7443 lt. Stelbrink)
2) Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin
– HA Rep. 77 Ministerium des Innern generell ( z. B. Nr. 4435 lt. Stelbrink)
– HA Rep. 90 Staatsministerium
– HA Rep. 125 Prüfungskommission für höhere Verwaltungsbeamte
3) Landeshauptarchiv Koblenz
-491 Landratsamt Simmern
-492 Kreisausschuss Simmern
4) Kreisarchiv Rhein-Hunsrück, Simmern.
5) Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein
– Kreisausschussprotokolle des Altkreises Siegen von 1936 bis 1944.
6) Archiwum Panstwowe w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Zlota 43 Tel: 73-591
Diese Presseartikel wären zu sichten: Siegener Zeitung 20.02.1936, 12.10.1939, 12.03.1955, 09.03.1961, 09.03.1966, 09.03.1971, 13.03.1971, 09.03.1976, 07.01.1980, Unser Heimatland 1974, S. 44-48.
Gerade finde ich in Martin Dröge (Hg.): Die Tagebücher Karl Friedrich Kolbows (1899 – 1945). Nationalsozialist der ersten Stunde und Landeshauptmann der Provinz Westfalen, Paderborn 2009, drei Belege auf die Bekanntschaft von Kolbow und Weihe.
Es ist schon interessant, wie sich die Arbeit an der Biografie zu Weihe entwickelt, angefangen mit dem kleinen Aufsatz von Frau Pittelkow. Angesichts der nachfolgenden notwendigen Korrekturen und Ergänzungen stellt sich die
Frage, ist Frau Pittelkow nicht betreut worden, fühlte sich keiner von Seiten der Universität oder des Kreisarchivs dafür verantwortlich? Manche
Kritikpunkte hätten sich sicherlich frühzeitig beseitigen lassen oder wird hier extrem dem Prinzip des Web 2.0 gehuldigt? Verantwortung sieht anders aus!
1) Der kleine Aufsatz von Frau Pittelkow war mehrere Jahre kritiklos auf der Kreishomepage greifbar und hat solange als ausführlichste Darstellung des Lebens Justus Weihe fungiert. Die Schwächen wurden solange also auch von der regionalen Zeitgeschichte toleriert.
2) Dank gebührt Ulrich F. Opfermann, der diese Schwächen erst vor kurzem gegenüber dem Kreisarchiv benannt hat.
3) Dr. Opfermann hat sich bereit erklärt einen eigenen Text zur Diskussion zu stellen. Auch dafür ein Danke schön!
4) Aufgrund der neuen Lage wurde der Text von Pittelkow nicht mehr verlinkt.
Fazit: Dies ist keine „extreme Huldigung“ des Prinzipes Web 2.0 , sondern ein Beleg für den bisweilen langsamen Fortschritt in der regionalen Zeitgeschichte.
Präzisierung einer Signatur:
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin:
Ober-Examinationskommission bzw.Prüfungskommission für höhere Verwaltungsbeamte, I. HA Rep. 125 Nr. 5341 (Einzelne Prüfungen, W, Weihe, Justus, Regierungsreferendar, Kassel), 1920
Eine weitere Akte findet sich im Bundesarchiv in Freiburgunter der Signatur: PERS 6/223910 (Personalunterlagen von Angehörigen der Reichswehr und Wehrmacht ). Der dort angegeben Dienstgrad lautet Oberleutnant der Landwehr.
Folgende Literatur wurde hier noch nicht erwähnt:
– “Die Juden im Siegerland zur Zeit des Nationalsozialismus”. hrsg. Dietermann, Klaus, Übach, Gerd, Welkert Hans-Joachim, Siegen 1981
– Dietermann, Klaus: Siegen – eine Stadt unterm Hakenkreuz, Stätten des Nationalsozialismus, des Widerstands und heute Gedenkstätten. Siegen 1994 – – Feldmann, Gerhard, Heintz, Mirko: Die “Heimatfront” – Krieg und Alltag im Siegerland. in: “Der Nationalsozialismus im Siegerland, Ein Quellenband zur Regionalgeschichte” hrsg. Flen-der, Armin, Schmidt, Sebastian, Siegen 2000
– Grebel, Markus, Mertens, Joachim: Spuren der Gewalt, Verbrechen von Angehörigen der SA und des FAD im Siegerland in den 30er Jahren. in: “Der Nationalsozialismus im Siegerland. Ein Quellenband zur Regionalgeschichte” hrsg. Flender, Armin, Schmidt, Sebastian, Siegen 2000
– “Krieg und Elend im Siegerland, Das Inferno an der Heimatfront in den 1940er Jahren.” hrsg. Müller, Adolf, Siegen 1981
-Pfau, Dieter: Christenkreuz und Hakenkreuz, Siegen und das Siegerland am Vorabend des “Dritten Reiches”. Bielefeld 2000
– Schmidt, Ihmke: Reaktionär oder modern? – Frauenleben im Nationalsozialismus. in: “Der Nationalsozialismus im Siegerland, Ein Quellenband zur Regionalgeschichte” hrsg. Flender, Armin, Schmidt, Sebastian, Siegen 2000
– Stelbrink, Wolfgang: Die Kreisleiter der NSDAP in Westfalen und Lippe, Versuch einer Kollektivbiographie mit biographischem Anhang. Münster 2003
– Rhein-Hunsrück-Kalender. – 65 (2009), S. 108
200 Jahre Westfalen im Jahre 2015.
Was machen Siegerländer+Wittgensteiner?
Gibt es 2017 ein Jubiläum 200 Jahre Zugehörigkeit in Westfalen?
Immerhin war der ranghöchste Westfale vor Ort zu Besuch.
Kurz. zum Zwischenstand: Man befindet sich noch in der Entscheidungsfindung. Das Kreisarchiv hat sich für 2017 bei einer Wanderausstellung des Landkreistages NRW zur 200jährigen Geschichte der Kreise in NRW als Ausstellungsort angemeldet.
„Für das Magnetbild “Schwarzes Rechteck – Gelbe Scheibe” erhielt er 1971 den NRW-Staatspreis aus der Hand des damaligen Wissenschaftsministers Johannes Rau“.
Nach Recherchen von Bernd Brandemann, Freudenberg, müsste der Satz korrigiert oder erläutert werden, da der Staatspreis des Landes erstmals 1986 vergeben wurde(„Er wurde 1986 erstmalig aus Anlass des 40. Jahrestages der Gründung des Landes vergeben“ – http://www.nrw.de/landesregierung/staatspreis-nordrhein-westfalen/ .
Es müsste wahrscheinlich richtig heißen: …erhielt er den Staatspreis manufactum der Arbeitsgemeinschaft des Kunsthandwerks NRW e.V. im Zusammenwirken mit der NRW-Landesregierung. So zumindest nachzulesen unter http://www.staatspreis-manufactum.de/1963-1999/staatspreis.html.
Weitere Info: http://www.staatspreis-manufactum.de
Heute berichten Westfälische Rundschau und Siegener Zeitung über die Buchvorstellung.
Bereits heute berichtet die Westfalenpost von der gestrigen DVD-Premiere.
Auch die Siegener Zeitung berichtet heute von der DVD-Premiere.
Die filmischen Streifzüge der 1920er bis 1980er Jahre sind im Rathaus der Stadt Bad Berleburg (Stadtarchiv, Bürgerbüro) zu einem Preis von 14,90 € erhältlich oder können zzgl. Portokosten über den Medienshop des LWL – (westfalen-medien@lwl.org), LWL-Medienzentrum für Westfalen, Fürstenbergstraße 13-15, 48147 Münster, Fax möglich: 0251/591-3982 – bezogen werden.
Das DVD-Begleitheft enthält Informationen zu den historischen Filmen.
Pingback: Walter Krämer | Punkgebete
Link zum PDF der Dissertation: http://dokumentix.ub.uni-siegen.de/opus/volltexte/2014/826/pdf/Dissertation_Peter_Vitt.pdf
Link zur Pressemitteilung des Kreises Siegen-Wittgenstein von heute.
Link zur Nachricht der WDR-Lokalzeit Siegen v. 10.12.2014
Meine erste Frage ist noch nicht beantwortet worden.
Frau Pittelkow hat ein Praktikum beim Kreisarchiv absolviert.
Wäre schön, wenn man wüßte, wo die Gebäude stehen bzw. gestanden haben…Ortsangabe…
Beste Grüße Anntheres Dell
In Winterberg-Langewiese steht dieses Gebäude.
Der Siegerlandkurier berichtete am 10.12.2014 über die Einweihung: http://www.siegerlandkurier.de/vermischtes/walter-kraemer-platz-eroeffnet/
Alle Jahre wieder das gleiche Rätsel: Als gedenkwürdig deklariert werden genau 348 Opfer, nämlich die ums Leben gekommenen Einwohner der Stadt. Wofür hält man den Tod der unfreiwilligen Gäste Siegens? Kollateralschaden, der keiner Erwähnung bedarf? Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern blieb die Zuflucht in den städtischen Luftschutzeinrichtungen, bei deren Ausbau sie zuvor eingesetzt worden waren, verwehrt, und außer den unmittelbaren Opfern während der Bombardierung gab es sicherlich weitere bei den anschließenden lebensgefährlichen Arbeiten zum Wohle der Stadtbevölkerung, z.B. der Beseitigung von Blindgängern und der Bergung Verschütteter. Oder glaubt man im Siegener Rathaus vielleicht, nur Herr Flick und Konsorten hätten von den billigen Arbeitskräften aus Ost und West profitiert?
P.K.
Der nicht von der Hand zu weisenden und mit gewohntem Verve vorgetragenen Kritik an der Pressemitteilung der Stadt Siegen fehlt m. E. wenigstens ein Lösungsvorschlag. Eine Redaktion des Textes schwebt mir allerdings da nicht vor. Wie wäre es, wenn die bald in der Siegener Oberstadt einziehenden Wirtschaftswissenschaftler mit ihren Studierenden sich mit dem Themenkomplex Zwangsarbeit auseinander setzen? Dies wird dem Charakter der Veranstaltung am 16.12. gerecht, bereichert ihn (hoffentlich) und man darf von wirtschaftsethischen Erkenntnisgewinnen träumen.
Leider irrt der geschätzte Kollege Kunzmann bei seiner „mit gewohntem Verve vorgetragenen Kritik an der Pressemitteilung der Stadt Siegen“: Diese spricht von 348 Menschen, nicht von Einwohnern oder gar von Bürgern der Stadt. Nach älteren, seriösen Quellen ist diese Zahl aufzuschlüsseln nach 290 deutschen Zivilisten, 26 deutschen Soldaten und 32 Zwangsarbeitern, so Flender (1979) und zuletzt D. Pfau (2005). Diese sicherlich in abschließenden Untersuchungen nach oben zu korrigierenden Zahlen wurden in der Vergangenheit so auch immer vom Stadtarchiv kommuniziert.
Eine andere überlieferte Aussage über den Luftangriff lautet z.B.: „Dabei starben 348 Deutsche sowie eine nie festgestellte Zahl ausländischer Zwangsarbeiter“. Ob das auf eine unseriöse Quelle zurückgeht, lasse ich offen; vielleicht kann der Autor dieses Satzes hier etwas dazu sagen. Auf jeden Fall scheint mir die Angabe „nie festgestellte Zahl“ sehr viel wahrscheinlicher zu sein als die (von wem wann und warum?) angeblich gezählten „32“. Und ob es nun 348 oder „nur“ 290 Siegener waren, halte ich für nichtssagend: Jeder Tote war genau einer zu viel, und das läßt sich durch wie auch immer lautende Summen nicht relativieren. Wenn meine Interpretation der städtischen Pressemitteilung unkorrekt war, nehme ich sie zurück. Meinen Eindruck, dass die Stadtvertreter an einer gründlichen Dokumentation der kommunalen Geschichte 1933-45 (einschließlich der sich daraus womöglich ergebenden Konsequenzen für einen gewissen Personenkult) nicht ernsthaft interessiert sind, kann ich bis auf weiteres nicht revidieren.
P.K.
Die Zahlen fußen laut Pfau und, wie das Stadtarchiv bereits kommentiert hat, auf: Hans-Martin Flender: Der Raum Siegen im Zweiten Weltkrieg. Eine Dokumentation, Siegen 1979, S. 50.
Hilfreich wäre nun die Benennung der anderen Quelle!
1) Ich beantworte dann ´mal meine Bitte selber. Kunzmanns Zitat findet sich im Wikipedia-Artikel Siegen und dieser beruft sich wohl auf: Ulrich Friedrich Opfermann: Dezember 1944. „… een licht als van een bliksemschicht en een slag als van de donder …“. In: Siegener Beiträge. Jahrbuch für regionale Geschichte 10 (2005), S. 165. Aus Opfermanns Anmerkungen geht nicht hervor, dass er Flenders Buch benutzt hat. Vielmehr verweist er auf „Siegerländer Chronik von 1940-1949“ in: Adolf Müller (Bearb.): Krieg und Elend im Siegerland. Das Inferno an der Heimatfront in den 1940er Jahren, Siegen 1981, S. 233. Allerdings schlägt Opfermann bereits hier einen Abgleich der Daten des Standesamtes und des Friedhofamtes der Stadt Siegen vor, um die Zahl ausländischer Toten zu ermitteln.
2) Leider liegt mir Flenders Buch nicht vor. Vielleicht könnte jemand dort nach der Quelle für die konkreten Zahlen suchen?
Grußwort des Bürgermeisters der Stadt Siegen zur Einweihung des Walter-Krämer-Platzes
Der Artikel in der SZ vom 13.12.2014 den ich mal als regionalen Start
zur Person Fritz Klein bezeichnen möchte, beschreibt leider nur den
Zeitraum bis zum Ende des 1. WK.
Die Zeit danach wird nur kurz angerissen.
Zitat „Später nach dem Krieg, strebte Fritz Klein eine geistige Verschmelzung von Orient und Okzident an. Wie bereits eingangs erwähnt, pflegte er Kontakt zu zahlreichen Philosophen.“ SZ vom 13.12.2014 Seite 43 „Unser Heimatland“.
Mich würde interessieren, was Fritz Klein
nach dem 1. WK gemacht hat und besonders, wie
war seine Haltung zum Nationalsozialismus.
Vieleicht verfügt jemand über genauere Kenntnisse und kann diese hier mitteilen.
Fritz Klein im Nationalsozialismus wird offensichtlich nicht in den Fokus genommen s. z. B. auch
“ ….. Hauptmann Fritz Klein repräsentierte den Typ des weltläufigen preußischen Offiziers westlicher Prägung. Aus einer Siegerländer Industriellenfamilie stammend, verbrachte der Berufsoffizier seine Militärzeit ganz überwiegend bei einem rheinischen Infanterie-Regiment, meldete sich 1904 für eine einjährige Weltreise ab und wurde zwischen 1910 und 1913 jeweils für ein Jahr als Militärattaché an die Gesandtschaften in Rio de Janeiro, Kairo und Teheran abkommandiert. Schon in jenen Jahren widmete sich der Offizier, vom Dienst nicht allzu sehr beansprucht, den frühen Hochkulturen Ägyptens und Vorderasiens. Nach seiner Orient-Mission 1914–16 entwickelte sich Klein zum heftigen Kritiker der Kriegsziel- und Innenpolitik der 3. Obersten Heeresleitung und machte Kapitalismus und Imperialismus bei allen Kriegsparteien für die Katastrophe des Krieges verantwortlich. Ernüchtert war auch das spätere Fazit seiner Mission: Der „Heilige Krieg“ sei nur ein „scheinheiliger Krieg“ gewesen, da sowohl die persischen wie arabischen „Glaubenskämpfer“ ihren Einsatz überwiegend vom geschäftlichen Standpunkt aus betrachteten. Nach dem Krieg verbrachte Klein seine Jahre als erkenntnistheoretischer Philosoph und erstrebte eine geistige Verschmelzung von Orient und Okzident. Kein anderer der militärischen Führer im Orient, auch T. E. Lawrence nicht, sollte sich so weit von den imperialistischen Grundlagen seiner Expedition und den Denkgewohnheiten seines sozialen Umfeldes entfernen. ….”
in: VEIT VELTZKE: Mission in der Wüste. DIE VERGESSENE ORIENT-EXPEDITION DES PREUSSISCHEN HAUPTMANNS UND OSMANISCHEN MAJORS FRITZ KLEIN UND SEINER MÄNNE, ROTARY MAGAZIN 11/2014, http://rotary.de/gesellschaft/mission-in-der-wueste-a-6577.html (Aufruf: 25.11.2014)
Folgende weitere Literatur konnte auf die Schnelle eruiert werden:
U. Gehrke, Persien in der deutschen Orientpolitik während des Ersten Weltkrieges, Darstellungen zur Auswärtigen Politik 1, 2 vols., Stuttgart, 1960
H. Lührs, Gegenspieler des Obersten Lawrence, 5th ed., Berlin, 1936.
Adolf Wurmbach: Schriftsteller und Philosoph Major a. D. Friedrich Klein 80 Jahre alt, Siegener Zeitung, 14.1.1957
Veit Veltzke: „Heiliger Krieg“ – „Scheinheiliger Krieg“: Hauptmann Fritz Klein und seine Expedition in den Irak und nach Persien 1914-1916,in: Wilfried Loth / Marc Hanisch (Hgg.): Erster Weltkrieg und Dschihad. Die Deutschen und die Revolutionierung des Orients, München: Oldenbourg 2014, S 119-144
Siegerländer Heimatkalender 1958 mit kurzem Nachruf auf Fritz Klein
Siegerländer Geschlechterbuch 1937 mit genealogischen Angaben
Im Bundesarchiv befindet sich unter der Signatur N 1541 der Nachlass seines Adjudanten EdgarStern-Rubarth. N 1541/32 enthält „A Dying Empire or The Last Days Of The Sultans or Playing ‚Lawrence‘ On The Other Side“ (Enthält auch:
Deutschsprachiges, selbstgezeichnetes Deckblatt: „Versinkendes Reich“)
Im Buch finden sich auf S. 341 einige spärliche Hinweise zum Verhältnis Kleins zum Nationalsozialismus
1) Missverständnis des „Führers“: Zunächst ging Klein von einer Pazifizierung durch Hitler aus.
2) Parteizugehörigkeit: Klein gehörte der NSDAP von Mai 1933 bis zum 29.11.1934 an. Klein ist „aktiv“ ausgetreten.
3) in seinen Schriften finden sich ab 1938 antisemitische Stereotypen. Ein Vertreten der nationalsozialistischen Rassenideologie ist nicht nachweisbar.
Mein Eindruck: Klein war wohl zu großbürgerlich und zu individuell für den Nationalsozialismus.
In dem für die Forschung zu regionalen Funktionären der NSDAP
wichtigen Beitrag zu Fritz Müller in Band 19 der Siegener Beiträge, Jahrbuch für regionale Geschichte 2014, Seite 182 ff ist leider ein kleiner Fehler.
Die Ehefrau von Fritz Müller Auguste Münker stammte nicht wie angegeben
aus Obersdorf sondern aus Oberdielfen.
Zur Familie Münker in Oberdielfen siehe auch:
Deutsches Geschlechterbuch Band 199 Seite 265 ff.
Danke für die Korrektur! Der Fehler ist wirklich ärgerlich.
Ebenfalls ein Dank für die Anmerkung: Da sieht man doch, dass die Siegener Beiträge wahrgenommen werden. Die Redaktion wünschte sich mehr Rückmeldungen – positive wie negative.
Dies zeigt nicht nur, dass die Siegener Beiträge wahrgenommen werden – wer würde ernsthaft daran zweifeln – , sondern es demonstriert, eine der Stärken des Web 2.0: Aktualität. Ohne diesen Hinweis, müsste man evt. ein Jahr warten bis zur Berichtigung in den nächsten Siegener Beiträgen.
Die Zahlen der Toten befinden sich bei Flender auf Seite 50 in
der oben genannten Dokumentation.
Als Quelle wird angegeben „Unser Heimatland Jahrgang 1954
(Verlag Vorländer, Siegen)“
Danke fürs Nachschauen!
Lieber Kollege Kunzmann, nun wird es aber ganz bunt. Lediglich Ihre zentrale Aussage unterschreibe ich vollinhaltlich: „Jeder Tote war genau einer zu viel, und das lässt sich auch durch wie auch immer geartete Summen nicht relativieren.“ Sollte der letzte Halbsatz aber als Replik auf meine Äußerungen gemeint sein, dann liegen Sie auch hier falsch. Ich habe nicht und Nichts relativiert, sondern unter Hinweis auf die in der Zahl 348 Menschen enthaltenen 32 Ausländer lediglich Ihre irrige Aussage zurechtgerückt, es handele sich dabei ausschließlich um Siegener Bürger.
Kommen wir zu den Zahlen und den Quellen: Die Angaben von Wikipedia habe ich nicht überprüft; Opfermann beruft sich, wie Kollege Wolf schreibt, auf Adolf Müller, Krieg und Elend (1981), und gibt dessen Zahlen für den gesamten Landkreis und den Zeitraum vom 4.2.1944 bis zum 23.3.1945 an: „starben 1.096 Deutsche und eine nie festgestellte Zahl ausländischer Zwangsarbeiter“. Dann kommt erst der Bezug zu Siegen: „Sie [die Bombardierung Siegens, L.B.] forderte 348 Tote (wiederum ohne Ausländer).“ Für die letzte Aussage fehlt bei Opfermann ein Quellennachweis. Flender führt in seinem Buch von 1979 auf S. 50 die von mir genannten Zahlen an und zwar im Rahmen einer Liste, die alle Opfer von Bombenangriffen auf die Stadt Siegen aufführt; dies unter Berufung auf „Unser Heimatland“ 1954. Er kommt zu einer Gesamtzahl von 715 Toten („566 Deutsche Zivilisten, 98 Deutsche Soldaten, 32 Ausländer“).
Die erste Zahl korrespondiert auffällig mit den Angaben im ersten Verwaltungsbericht der Stadt Siegen von 1950, dort werden als Opfer von Fliegerangriffen bzw. der Kämpfe um Siegen 565 Zivilpersonen angegeben. Die gescholtene Kommune gibt dort (S. 6) in der zeitgebundenen Terminologie aber auch an: „Infolge von Krankheit und Fliegerangriffen sind ferner umgekommen: 675 ausländische Zivilarbeiter (einschl. deportierte Personen), 39 ausländische Kriegsgefangenen“.
Worauf kommt es nun an: Nicht auf Zahlen und Summen, denn die sind nichtssagend, siehe oben. Es kommt darauf an, wie mit den Opferzahlen umgegangen wird. Und da konnte jeder, der es wollte, seit 1950 nachlesen, dass in der Stadt Siegen auch die zwangsweise nach hier deportierten und hier umgekommenen Menschen zumindest ‚gezählt‘ wurden. Ob diese Opfer auch immer angemessen gewürdigt wurden, steht dahin.
Links zur Berichterstattung der lokalen Medien über die Veranstaltung:
1) http://www.siegener-zeitung.de/siegener-zeitung/Gedenken-an-die-Opfer-35517af2-303e-4402-8eb6-47998ff9ddd7-ds
2) http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/zu-fuss-durch-das-brennende-siegen-id10148320.html
3) „Am 16. Dezember 1944 sind über Siegen mehr als 50.000 Bomben abgeworfen worden. Der Angriff dauerte nur wenige Minuten. 348 Menschen starben. Eberhard Jung aus Siegen überlebt.“: http://radio-siegen.de/_pool/files/beitraege/767559.mp3
4) WDR, Lokalzeit Siegen v. 16.12.2014 (7-Tage online): http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit/lokalzeit-suedwestfalen/videolokalzeitsuedwestfalen1090.html
Lieber Herr Burwitz,
Sie wissen genau, dass Sie von mir keine gemeinen Repliken zu erwarten haben. Mit meiner in der Tat „zentral“ gemeinten Aussage wollte ich nur dem Verdacht vorbeugen, mir ginge es um irgendwelche statistischen Spitzfindigkeiten.
Herrn Opfermanns Originalbeitrag hatte ich gestern gerade nicht zur Hand, deshalb der provisorische Griff nach Wikipedia.
H.-M. Flenders „Quelle“ ist, wie hier schon erwähnt, „Unser Heimatland“. Das sind bekanntlich jährlich zusammengestellte Nachdrucke von Artikeln der „Siegener Zeitung“. Ob der entsprechende Beitrag dort als „seriöse Quelle“ zu betrachten ist oder ihm wenigstens eine solche zugrunde lag, wäre zu klären. Die Widersprüche zu dem von Ihnen dankenswerterweise zitierten Verwaltungsbericht (seriösere Quelle als die Zeitung) springen nun natürlich ins Auge: Laut letzterem „sind ferner umgekommen: 675 ausländische Zivilarbeiter (einschl. deportierte Personen), 39 ausländische Kriegsgefangenen“. Das ist nun wahrlich eine andere Größenordnung als die von Unser Heimatland bzw. Siegener Zeitung insgesamt für den Zeitraum 1940-45 angegebenen 51 Ausländer, auch wenn sich „675+39“ vielleicht nicht nur auf das Stadtgebiet beziehen sollte.
Mit Ihrem letzten Satz „Ob diese Opfer auch immer angemessen gewürdigt wurden, steht dahin“ haben Sie sehr treffend zusammengefasst, worauf ich letztendlich hinweisen wollte: Es mag ja sein, dass die Stadtoberhäupter bei ihrem „Ge(h)Denken“ immer auch eine abstrakte Zahl nicht-Siegener Opfer im Hinterkopf haben. Das ist bestenfalls Sentimentalität. Natürlich entgeht mir vieles, aber jedenfalls ist mir nicht bekannt, dass z.B. im Laufe der vergangenen 70 Jahre seitens der Stadt irgendwelche Bemühungen unternommen worden wären, den Umfang und die Bedeutung von Zwangsarbeit für die Kommune Siegen und ihre Bürger während der Kriegszeit zu ergründen und angemessen zu würdigen. Mir ist auch nicht bekannt, dass sich im Rathaus jemand beim täglichen Blick von der Chefetage hinunter auf die sogenannte „Fißmer-Anlage“ ernsthaft Gedanken darüber machen würde, wem eigentlich diese fragwürdige „Ehrung“ zuteil wird.
Dies etwas in Eile und ohne das Bedürfnis, hier mal wieder (wie es neulich in anderem Zusammenhang moniert wurde) eine Diskussion „hochkochen“ zu lassen.
P.K.
Ist dies Langewiese?
Gute Frage! Ich leite dies gerne an ortskundigere siwiarchiv-Leser weiter.
… Nicht schuldig bleiben möchte ich zum Schluß die Erwähnung des vor einigen Jahren von der Stadt in Auftrag gegebenen und seitdem von den Mitarbeitern des Stadtarchivs in mühseliger Kleinarbeit angelegten „Gedenkbuches für die Opfer von Krieg und Gewalt“. Nach bisherigem Stand wurden bereits annähernd 700 ausländische Zwangsarbeiter (Russen, Polen, Franzosen, Belgier, Niederländer, Tschechen) namentlich erfaßt, die während des 2. Weltkriegs in der Stadt Siegen gewaltsam ums Leben kamen, darunter viele Kinder und Jugendliche. (Dank an Herrn Burwitz, der mich gestern darauf aufmerksam machte und fleißig zählen ließ.) Es bleibt nun zu hoffen, dass die Existenz dieses wachsenden Verzeichnisses nicht als Alibi dafür herhalten muss, es bei öffentlich zelebrierter Betroffenheit nach Vorgabe des Terminkalenders bewenden zu lassen. Stadtgeschichtsschreibung, sofern sie wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht werden und sich nicht mit bequem vor Ort recherchierbaren Teilaspekten begnügen will, bedürfte wegen des großen zeitlichen und finanziellen Aufwandes der institutionellen Förderung; verbale Interessebekundungen allein wären nicht ausreichend.
Die von H.-M. Flender 1979 nach „Unser Heimatland“ wiedergegebene ominöse Tabelle war in einer 60seitigen Sonderbeilage zur „Siegener Zeitung“ („Aus Not und Verderben zu neuem Aufstieg“, S. 32) vom 16.12.1954 ohne Nachweis der Quelle (falls es ein Nachdruck war) oder der zugrundeliegenden amtlichen Erhebung(en) veröffentlicht worden.
P.K.
Zur ersten Kriegsweihnacht in Siegen s. Westfälische Rundschau, 23.12.2014: http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/erste-kriegsweihnacht-in-siegen-id10171716.html
und immer, wenn ich meine, dass mich in sachen propaganda nichts mehr überraschen kann… merci fürs teilen dieses starken stücks!
Dieser kostenfressende „Lehr-Stuhl“ ist so unnötig wie ein Kropf.
Die rheinische Landesgeschichte wird vor Ort in den Vereinen viel besser und kostengünstiger vertreten.
Die protestierenden Unterschreiber können ja durch eine monatliche Zahlung einen Stiftungslehrstuhl finanzieren.
Übrigens: warum nicht auch ein „Lehr-Stuhl“ für westfälische Landesgeschichte?
In der Rubrik „Debatte“ der Petition für die Erhalt wurde das Argument, das Vereine kostengünstiger Landesgeschichte betrieben könnten, wie folgt zurückgewiesen:
„Die Vereine sind angewiesen auf eine wiss. Instanz wie die Rhein. Landesgeschichte an der Uni mit ihren fachlichen Kompetenzen und die Uni. ist auf die Lebendigkeit, die Kreativität u. das Engagement der Vereine angewiesen. Dies wissen beide u. sollten sich nicht gegeneinander ausspielen lassen. Vereine gegen die Uni et vice versa auszuspielen u. dies noch mit dem – ökonomisch übrigens vollkommen unsinnigen – Argument, dass dies angeblich kostengünstiger sei – ist volks- u. betriebswirtschaftlich schlicht falsch!“
Kritische Bemerkungen von diesem Niveau sollten
nicht der Normalfall auf siwiarchiv.de sein.
Siwiarchiv .de ist einfach keine Bildzeitung!!!
Natürlich hilft der fachliche Blick über die Grenzen hinaus.
Für mich als „Frontschwein“ der regionalen Geschichte ist
die Information über und Kooperation mit anderen Institutionen von Groningen über Den Haag bis Wiesbaden, von Erfurt über Siegen bis Altenkirchen, von Altena über Wenden bis Dillenburg der alltägliche Normalfall.
Das diese Kooperation natürlich auch über die wissenschaftlichen Institutionen hinaus für Geschichts-, Kultur- und Heimatvereine gilt, bedarf eigentlich keiner Erwähnung.
Und für Westfalen-Fans sei gesagt: es gibt es auch das Regionalinstitut für westfälische Geschichte in Münster.
1) Mir fehlt ein Beleg dafür, dass Vereine besser und kostengünstiger wissenschaftliche Geschichtsforschung betreiben können. Ich würde mich sehr darüber freuen.
2) Gibt es eigentlich landeshistorische Stiftungsprofessuren?
3) Zu dieser wenig differnzierten Äußerung soll hier noch lediglich bemerkt werden, dass westfälische Landesgeschichte tatsächlich an der Universität Münster angeboten wird: http://www.uni-muenster.de/Geschichte/histsem/LG-G/ .
Zu welcher Zeit sollte wohl diese Verbindung entstanden sein?
Zu Melchert Schuurmann gibt es eine niederländische Biographie:
Pantsers stooten door, stukas vallen aan
Melchert Schuurman: een muziekleven in dienst van de NSB en Waffen-SS
Gerrit Valk,
http://www.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.uitgeverijboom.nl%2Fupload%2F9789089532282.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.uitgeverijboom.nl%2Fboeken%2Fgeschiedenis%2Fpantsers_stooten_door__stukas_vallen_aan_9789089532282%2F&h=277&w=200&tbnid=PsWIMTSWbw7sbM%3A&zoom=1&docid=pp1UiuE2kxuBOM&ei=vAadVPKZCMGzabbAgSA&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=296&page=1&start=0&ndsp=42&ved=0CDcQrQMwBw
Ich stimme Herrn Lars hundertprozentig zu! Es muß jetzt einmal Schluß damit gemacht weden, haufenweise Geld in die Universitäten und dazu noch für Orchideenfächer zu schaufeln. Die Grund-, Haupt- und Berufschulen verkommen
Und was die Bemerkung von Herrn Wolf hinsichtlich der Kostengünstigkeit anbelangt: fast alle Geschichtsvereine haben ehrenamtliche Mitarbeiter; und diese bringen neben ihrer Freizeit auch oft genug Geld ein, um die Forschungszeile zu erreichen.
Ellen, ich hätte mir eine präzisere Beantwortung meiner Fragen gewünscht. Zudem halte ich es für sinnvoll, dass die deutliche Meinungsäußerung auch direkt bei der Petition erfolgt: https://www.openpetition.de/petition/argumente/erhalt-des-lehrstuhls-fuer-rheinische-landesgeschichte-an-der-universitaet-bonn
Melchert Schuurman: http://home.zonnet.nl/hagespraak/liederen.htm, http://resources21.kb.nl/gvn/EVDO02/EVDO02_KONB15-62/EVDO02_KONB15-62_1_X.jpg, http://resources21.kb.nl/gvn/EVDO02/EVDO02_NIOD05_8594/EVDO02_NIOD05_8594_1_X.jpg.
PS:
Wer kann denn mal die Uniform von Schuurman identifizieren? NSB? Legion?
Mir scheint, historische Forschung soll auf ehrenamtlicher Basis getätigt werden, von solchen Deppen, die ihren Urlaub im Archiv verbringen und dafür noch zahlen. Ich habe beispielsweise für einen längeren Aufsatz nicht nur Zeit investiert, sondern mir entstanden auch erhebliche Fahrkosten, Kosten für Literatur, Vervielfältigungen und Gebühren. Geld für zusätzliche Übernachtungen, beispielsweise in Berlin, hatte ich aber nicht. Irgendeinen Topf, der solche Kosten übernehmen könnte, habe ich nicht gefunden. Honorare können die meisten Vereine nicht zahlen. Die Druckkosten werden aus den Mitgliedsbeiträgen gezahlt. Inwieweit in Vereinen grundsätzliche Forschung betrieben werden kann, sehe ich ganz und gar nicht. Es wäre hübsch, wenn die beiden, Lars und Ellen, denn doch wenigstens ein Beispiel eines Vereins nennen würden, der nicht nur im Geld schwimmt, sondern auch massenweise Mitglieder hat, die mit älteren Akten und sehr alten Urkunden umgehen können. Der Verein, in dem ich Mitglied bin, deckt ein größeres Gebiet ab – hat viele Mitglieder und keinen Pfennig zuviel seiner Kasse. Natürlich lässt sich mit dem Argument, dass Schulen verkommen, alles, aber auch alles tot schlagen. Dagegen möchte ich vor Augen führen, wieviele andere Orte der Kultur schon abgebaut und geschlossen wurden – Museen, Orchester, Archive etc. Vielleicht sollten die Mitglieder von Geschichtsvereinen ja erst mal Archive öffnen und ordnen, in denen sie dann forschen? Lars und Ellen, Sie vertreten hier eine merkwürdige Haltung zur Kultur, finde ich. Vielleicht ist es auch gar keine Haltung – weil es Sie einfach nicht interessiert.
Vielen Dank für diesen Beitrag! Archivalia nimmt übrigens lesenswert Stellung zum Arbeitsfeld „Landesgeschichte“.
Nachdem ich mir so einiges im Internet angeschaut habe, halte ich die
Uniform, die Schuurman auf dem Foto, das unter dem ersten Link von Herrn Opfermann zu sehen ist, für eine Uniform der „Weerafdeling (WA)“ der
Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) in den Niederlanden.
http://www.geschiedenis.nl/index.php?go=home.showBericht&bericht_id=3163
Ein Anhaltspunkt zur Datierung des oberen Fotos sind die Fahrzeuge.
Das Auto in der Mitte ist ein BMW 501/502 „Barockengel“. Der BMW
wurde von 1952 (Produktionsbeginn) bis 1963 gebaut.
Aufgrund der Stoßstange und der Beleuchtung dürfte das abgebildete
Modell aus den Jahren 1954 – 1961 stammen.
Das Auto rechts ist ein Opel Kapitän. Bestimmung vor allem anhand des
Kühlergrills. Der Kapitän gehört vermutlich der Baureihe 56 /57 an, diese
wurde von 1956 – 1958 gebaut.
Somit ist der frühstmögliche Aufnahmezeitpunkt des Fotos 1956.
Vielen Dank! Automobilgeschichte ist nicht gerade der Bereich, wo ich mich wohlfühle. Weil aber auf dem zweiten Bild das ehemalige Nürnberger Haus (heute:City-Galerie) noch nicht steht, hätte ich vorsichtig Mitte der 50er Jahre des 20. Jhdts. getippt. So decken sich Einschätzung und NAchweis ja doch.
Auf dem zweiten Bild ist an der Bahnhofgaststätte das Werbeemblem
für „Siegener Pilsener“ zu sehen. Wo wurde das gebraut und wann stellte die Brauerei ihren betrieb ein?
Es handelte sich wohl um die Siegener Aktien-Brauerei, Siegen .“ …. Gegründet wurde die Brauerei als AG 1892, der Rechtsvorgänger bereits 1846; Spezialitäten „Siegener Pilsener“. Zweck:Betrieb von Brauereien. Erzeugnisse: ober- und untergärige Biere. Spezialitäten außerdem Germania Pils Edelbitter und Kraft-Malz-Bier. ….“ (Quelle: http://www.tschoepe.de/auktion53/katalog/477bis483.pdf, Los-Nr 480, 481). Dieser Quelle zufolge wurde die Brauerei 1957 geschlossen. 1968 erfolgte die Umfirmierung in Siegener Brauerei Gmbh – laut dieser Quelle.
Der größte Bierproduzent im Kreisgebiet hat sich von der Universität Siegen einmal eine Geschichte erarbeiten lassen. Vielleicht geht daraus etwas hervor …..
Pingback: Vor 40 Jahren: Kreis Siegen-Wittgenstein gebildet | siwiarchiv.de
Zur Neugliederung im Siegerland s. Westfälische Rundschau, 1.1.2015: http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/drei-staedte-werden-zusammen-gross-id10192500.html
Noch wieder ein Fund. Diesmal bei Herbert Knorr, Zwischen Poesie und Leben. Geschichte der Gelsenkirchener Literatur und ihrer Autoren von den Anfängen bis 1945 (= Schriftenreihe des Instituts für Stadtgeschichte, Bd. 6), Essen 1995, S. 450. Wurmbach bedichtete für eine Schulfeier den „Tag von Potsdam“ (21.3.1933), einer Goebbels-Inszenierung, bei der Hitler und Hindenburg vor der Reichsöffentlichkeit zusammenkamen, um das historische Bündnis zwischen der älteren und der jüngeren Reaktion und den gemeinschaftlichen Sieg über den demokratischen Verfassungsstaat zu feiern. Knorr gibt ein Faksimile der Maschinenniederschrift wieder, das am Seitenende des Manuskriptblatts abschließt. Es mag also sein, dass es auf einer uns unbekannten zweiten Seite weitergeht. Noch wieder also ein Hinweis, dass ohne Einblick in die Archivalien ein vollständiges Bild nicht möglich ist! Wie auch immer, ein weiteres Selbstbild aus dem deutschen wertebewussten Bildungsbürgertum:
„Tag von Potsdam
Lasst Fahnen wehn von allen Dächern,
Verkünden uns das deutsche Jahr,
Und macht der Glocken Mund zu Sprechern
Der grossen Tat, die Sieger war.
War wie ein Sturm in deutschen Landen
Der Freiheit strahlender Beginn;
Ein ganzes Volk ist auferstanden,
Die Zeit hat einen neuen Sinn.
Der Sonne zu lasst wehn die Fahnen
Der Freiheit siegreich durch die Luft.
Und – Tritt gefasst! Wie Frühlungsahnen
Brichts aus des grossen Friedrichs Gruft.“
Tja, die energische Zuschrift von Ellen macht mich doch staunen. Von irgendwelchen Einsichten in Finanzen und Möglichkeiten der Geschichtsvereine scheint sie nicht getrübt, noch weniger aber von Kenntnissen über das Handwerkszeug, das man mitbringen muss, um überhaupt einen ordentlichen Aufsatz zur Geschichte verfassen zu können. Nur als Beispiel: viele Hobbyhistoriker glauben, dass sie gut ausgerüstet sind, wenn sie „Sütterlin“ lesen können…. angesichts von Akten des 19. Jh. sah ich schon so manchen vollmundig scheitern. Auch die Frage der Finanzen können sich Lars und Ellen vielleicht plastisch vor Augen führen, indem sie sich informieren, was häufige Archivreisen kosten, beispielsweise ins Landesarchiv (wenn man nicht gerade in Duisburg wohnt). Abgesehen davon müssen sich berufstätige Menschen für solche Reisen Urlaub nehmen…. Außerdem möchte auch ich darauf hinweisen, wie es um kulturelle Einrichtungen insgesamt bestellt ist. Seit langen Jahren sind die Kommunen klamm und kürzen, was das Zeug hält. Archive werden gerne ganz geschlossen oder auf ehrenamtlicher Basis „geführt“. So kommt es, dass Menschen städtische Archivalien „verwalten“, die deren Inhalt nicht einmal lesen können….Eine Schande, was sich hier abspielt! Den Hinweis auf Haupt- oder Berufsschulen halte auch ich für ein Totschlagargument. Wenn Sie sich nicht interessieren, Lars und Ellen, sollten sie es frei raus sagen. Aber ist es nicht ein Armutszeugnis für ein Land, dass Theater, Orchester, Museen, Archive usw. immer wieder um ihre Existenz kämpfen müssen und manche den Kampf auch schon verloren haben? Wie gehen wir mit unserem kulturellen Erbe um?
Gerade eben unterschrieben, denn natürlich geht es hier einmal mehr darum, dass Geld verschoben werden kann, das am Hindukusch verballert werden soll oder ähnlich hehren Zwecken zur Verfügung steht. Einmal mehr Kulturabau zugunsten höherer Ziele. Und die’s haben, bleiben außen vor und feixen zufrieden, während die Betroffenen übereinander herfallen. Doofer geht’s nicht?
Stichwort: Kulturabbau zugunsten „höherer Ziele“. Das ist an sich nichts Neues, leider; an Kultur wird immer wieder gerne gespart. Aber sind nicht generell die Mittel zwischen Bund, Ländern und Kommunen falsch verteilt? Muss die „Provinz“ nicht kämpfen, während der Bund gut gesättigt ist?? Das denke ich immer, wenn wieder in Berlin z. B. wieder einmal ein (staatliches) Museum im neuen Glanz erstrahlt, während in Kommunen gekürzt oder ganz gestrichen wird? Und nach Ehrenamtlern geschrieen wird? In diesem Zusammenhang möchte ich noch erwähnen, dass Unkosten, die durch die Ausübung des „Ehrenamtes“ entstehen, nicht einmal bei der Steuererklärung geltend gemacht werden können. Da hält die Finanzverwaltung sich vornehm zurück.
Es gab damals eine kreisfreie Stadt Siegen mit einem eigenen Straßenverkehrsamt. In dieser Stadt wurden Kennzeichen vergeben, die einen einzelnen Buchstaben als Mittelkennzeichen hatten. Im Landkreis Siegen gab es Doppelbuchstaben.
Übrigens:
1) Das heutige System der Autokennzeichen wurde in der Bundesrepublik Deutschland am 1. Juli 1956 eingeführt – s. Wikipedia.
2) Am 1. Juli 1966 erfolgte die Eingliederung der kreisfreien Stadt Siegen in den Landkreis Siegen. Allerdings stammen die Bilder aus Kreuztaler Privatbesitz …..
s. nun
1) Historiker der WWU untersuchen, wie Inoffizielle Mitarbeiter die „Zentren des Feindes“ bespitzelten / Projekt an vier Universitäten: Link: http://www.uni-muenster.de/Rektorat/exec/upm.php?rubrik=Alle&neu=0&monat=201501&nummer=17971
2) Sabine Kittel: Jenseits von Zahlen. Überlegungen zur Staatssicherheit der DDR an Westuniversitäten, Deutschland-Archiv, 4.7.14, Link: http://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/deutschlandarchiv/187440/jenseits-von-zahlen-ueberlegungen-zur-staatssicherheit-der-ddr-an-westuniversitaeten
Alles klar Herr Dr. Opfermann. Was ist nun Ihre Schlussfolgerung? Sie müssen Leben und Werk zusammenhängend betrachten. Es ist eine biographische und literaturwissenschaftliche Analyse seiner Werke in der Periode der NS-Zeit notwendig. Mit einer pauschalen Vorverurteilung sollten Sie vorsichtig sein. Dann müssten Sie die Werke vieler nicht-nationalsozialistischer Künstler, die in dieser Epoche in Deutschland gwirkt haben, aus dem Kanon verbannen (Carossa, Benn, Richard Strauss, Hans Pfitzner, Erich Kästner ( – auch der hat für das Regime gearbeitet) usw.
Pingback: DVD-Trailer “Das Wittgensteiner Land” | siwiarchiv.de
Hier wird niemand vorverurteilt. Es wurde ein Text bekannt gemacht, der nicht sehr bekannt ist. Obwohl er schon lange veröffentlicht wurde. Offenbar wurde die Arbeit von Knorr, in der der Text nachzulesen ist, in der Heimat Wurmbachs nicht oder nur unzureichend rezipiert. Sollte das besser so bleiben?
Was hat es mit einer „(Vor-)Verurteilung“ zu tun, wenn der Text bekannt gemacht wird? Warum diese Abwehr?
Das Objekt möglicher Abwehr ist m. E. ganz besonders gründlich zu betrachten. Da muss man es wohl auch kennenlernen können? Und es wäre zu diskutieren? Mit dem Ziel, mehr Klarheit zu bekommen? Also ohne die Diskussion gleich mit „Vorverurteilung“ eher schwierig zu machen?
Gerade frage ich mich nach der Bedeutung der Bemerkung, Leben und Schriften seien im Zusammenhang zu sehen. Da fehlt mir was: Zeit (Gesellschaft, Kultur, Politik), individuelles Leben und Schriften. Ein Kontext der nicht ohne Widersprüche in den individuellen Biografien bleiben kann. Das würde ich wohl auch für Wurmbach annehmen. Nochmal: was hat das mit Vorverurteilung zu tun?
Niemand hat hier bislang behauptet, Wurmbach sei ein geradlinieger Aktivist oder auch nur ein passiver Anhänger der NSDAP gewesen. Aber warum soll ausgeschlossen sein, dass er sich opportunistisch verhielt wie andere auch? Und nun einmal kein Widerstandskämpfer, keine „Lichtgestalt“, sondern ein (nicht ganz stummer) Mitläufer war, der unter den gegebenen Bedingungen seinen Vorteil suchte? Und nun eben einmal weiter Gedichte schreiben und gedruckt sehen wollte?
Ob das oder auch eine andere Einschätzung ihm gerecht würde, lässt sich doch nur sagen, wenn man was von ihm weiß. Möglichst viel natürlich. Und eben auch das vielleicht Unerwartete, das Widersprüchliche erfahren konnte.
Als Einstieg zur Person Vinckes bietet sich vor allem an:
Ludwig Freiherr Vincke, Ein westfälisches Profil zwischen Reform und Restauration in Preußen, hrsg. v. Hans-Joachim Behr und Jürgen Klosterhuis, Münster 1994 sowie der gleichzeitig erschienene Katalog: Ludwig Freiherr Vincke (1774-1844). Ausstellung zum 150 Todestags des ersten Oberpräsidenten der Provinz Westfalen, Münster 1994.
Die erste Publikation weist Bezüge zum Siegerland (u.a. Verkehrswesen) auf, die in der Region von den einschlägigen „Forschern“ noch gar nicht wahrgenommen worden sind.
Danke für den Hinweis: ein weiterer Grund, sich vielleicht doch einmal intensiver mit Vincke aus regionaler Sicht auseinanader zu setzen!
Die VHS Siegen-Wittgenstein, der ich vorstehen darf, bietet sich gerne als Forum für die Verbreitung an.
Einen knappen Einstieg in Leben und Werk Vinckes bietet: Schleberger, Erwin: Vincke – ein Leben für Westfalen, in: Gr0ßfeld, Bernhard (Hg.): Westfälische Jurisprudenz, Münster 2000, S. 193 – 218. Dank an P.K.!
Dort findet sich übrigens folgendes Zitat von Annette von Droste-Hülshoff zum Tode Vinckes: „Vincke starb und ward begraben, ohne daß ein Hahn darnach krähte.“
Das ist hervorragend. Davon profitieren wir auch im benachbarten Lahn-Dill-Kreis. Auch bei uns gab es einst ein bedeutendes Köhler-Handwerk.
Pingback: Westfalen wird preußisch – vor 200 Jahren | siwiarchiv.de
2 Zitate zu Vinckes Wirken im Siegerland:
“ …. Der verdienstvolle, allem Neuen aufgeschlossene Oberpräsident von Westfalen, Freiherr Friedr. Wilh. Ludwig von Vincke, unternahm 1835/36 erste Schritte zu einer geregelten Ausbildung der Wiesenbauer, indem er 50 junge Leute aus den 3 westfälischen Provinzen sowie aus Köln, Kurhessen und Breslau unter Anleitung des Siegener Kreishaubergsoberförsters Friedrich Vorländer am Umbau der Wiesen des Stiftes Keppel im Ferndorftal teilnehmen ließ. …..“
Quelle: Aus einem Text für die Ausstellung der Universitätsbibliothek Siegen zum 150-jährigen Jubiläum „Von der Wiesenbauschule zur Universität“ vom 17.-27. Juni 2003 im Foyer der Universitätsbibliothek und am 28. Juni 2003 zum 2. Alumni-Tag der Universität Siegen im Audimax-Foyer; fußend auf: Annette Schnell: Zur Geschichte der Siegener Wiesenbauschule…, Hausarbeit, Siegen 1980 (maschinenschriftl.).
2) „…. Das Siegerland wurde ein Teil der Provinz Westfalen, deren Operpräsident Ludwig von Vincke der Eisenwirtschaft besonderes Interesse entgegenbrachte. Er sorgte auch dafür, daß das Siegener Einsenwesen 1819 ein „Regulativ zur Verwaltung des Berg-, Hütten und Hammerwesens“ erhielt, das die überlieferten genossenschaftlichen Privilegienzwar mit vollem Recht für veraltet erklärte, sie aber um der Ruhe willen bestätigte – zum Schaden des Siegerlandes. ….“
aus Wilhelm Treue: Wirtschafts- und Technikgeschichte Preußens, Berlin 1984, S. 416
Eine Fundgrube sind natürlich die Tagebücher, deren auf 11 Bände angelegte Gesamtedition leider noch ziemlich am Anfang steht; erschienen sind bislang erst die Bände 1 (1789–1792), 2 (1792-1793) und 5 (1804-1810). Die Jahre 1813-1818 deckt vorläufig eine ältere, separate Ausgabe (von 1980) ab. Die regionalen Vincke-Forscher werden sich also wohl noch gedulden müssen, bevor sie quellenmäßig so richtig aus dem vollen schöpfen können.
P.K.
Die Tagebücher sollten allerdings im Original in Münster einsehbar sein. Aber vielleicht startet man hier mit dem Blick in die Überlieferung der beiden Kreise, die mindestens verfilmt hier vorliegt. So findet sich bspw. im Bestand „Kreis Wittgenstein, Landratsamt“ unter der Nr. 838 ein Aktenband mit dem Titel „Korrespondenz mit dem Oberpräsidenten v. Vincke“ (1833 – 1834), der die Korrespondenz mit dem Oberpräsidenten v. Vincke u.a. wegen Gewerbeförderung u. dem Kreis-Gewerbeverein enthält. Dieser Aktenband kann verfilmt im Stadtarchiv Bad Berleburg eingesehen werden.
Im Bestand „Kreis Siegen, Landratsamt, Schenkung Stadtarchiv, Verzeichnis A“ des Kreisarchivs Siegen befindet sich unter der Signatur A 36 ein Aktenband mit dem Titel „Wegewesen im Kreis Siegen“ (1822 – 1848). Auch hier tritt Vincke in Erscheinung.
Natürlich steht es jedem frei, in Münster mal kurz die Originale durchzulesen. Vinckes Handschrift gilt, vorsichtig ausgedrückt, als Herausforderung. Ich glaube, schon Güthling hatte sich einmal an der Herausgabe der Tagebücher versucht und ganz schnell das Handtuch geworfen. Deshalb ja auch der großzügige personelle und zeitliche Rahmen des laufenden Projektes.
Vincke war ein sehr reisefreudiger Oberpräsident. Aus den persönlichen Notizen sind viele Hinweise auf dienstliche Besuche des Siegerlandes zu erwarten, die nicht immer einen direkten Widerhall in den Behördenakten gefunden haben müssen. Das wären dann Anhaltspunkte für gezielte Recherchen in diversen Archivbeständen, auf die man vielleicht ohne solche Hinweise gar nicht kommen würde. So und nicht anders hatte ich das gemeint. Dass man schon mal mit den selbstverständlichen Provenienzen (Landratsämter, Oberpräsidium, Regierung Arnsberg) starten kann, ist ja trivial.
P.K.
Im Archiv des evangelischen Kirchenkreises Wittgenstein befindet sich unter der Signatur Kirchengemeinde Wingeshausen Nr. 41 ein Aktenband zum Kirchenbau, der u. a. ein Dankschreiben des Pfarrers Ohly an Oberpräsident Vincke für die gestifteten Kirchenfenster und Bericht über deren Einbau (1831) enthält.
Im Kirchenkreisarchiv findet sich weiter unter der Signatur Kirchengemeinde Schwarzenau Nr. 42 (Verschiedenes zur Gemeindeverwaltung) die Mitteilung des Oberpräsidenten von Vincke an die Einwohner von Schwarzenau, dass der Fürst zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein nicht beabsichtige, ihnen die bisher verpachteten Ländereien zu entziehen (1842). Unter der Signatur Kirchengemeinde Schwarzenau 81 findet sich ein kurzes Anschreiben des Oberpräsidenten von Vincke, in der Streitsache der Gemeinde mit dem Fürsten Wittgenstein-Wittgenstein nicht zuständig zu sein (1843).
“ …. Die Spuren der ersten Bauern entdeckten die Archäologen im Siegerland. Hier half ein Hobby-Forscher den LWL-Archäologen dabei, die seltenen Fundstellen aus der Steinzeit um einen neuen Eintrag zu erweitern. Ein Stein-Artefakt sorgte für Begeisterung unter den Fachleuten: Die Dechselklinge stammt aus der Jungsteinzeit und kam bei den ersten Bauern als Beil oder Hacke zum Einsatz……“
Quelle: Mailingliste „Westfläische Geschichte“, 13.1.15
s. a. Westfälische Rundschau, 15.1.15: http://www.derwesten.de/region/sauer-und-siegerland/expedition-in-die-steinzeitwaelder-id10236367.html
Sehr schöner Beitrag! Hoch interessant! Man möchte mehr erfahren!
Auf siwiarchiv finden sich in diesen Einträgen etwas über Hohlwege: http://www.siwiarchiv.de/?s=hohlweg&submit=Suchen .
Dieser profunden Kommentierung kann ich mich nur anschließen!
Pingback: Literaturhinweis: “Schatzungs- und Steuerlisten als Quellen der landesgeschichtlichen Forschung” | siwiarchiv.de
Köbler neigt zu Schnellschüssen, ich zu kritischer Betrachtung:
http://archiv.twoday.net/stories/1022387832/
Mein Beitrag:
http://archiv.twoday.net/stories/1022388197/
Zitat: „ad multos annos“.
GastautorInnen dürfen gern auch in Archivalia bloggen, um an der Blogparade des Siwiarchivs teilzunehmen.
Gratulation zum 3. Geburtstag!
Ich teile gerne den Aufruf zu eurer Blogparade und wünsche euch viele Einsendungen.
Wer den Ablauf einer Blogparade gerne grafisch aufbereitet anschauen möchte – bei MusErMeKu gibt es eine übersichtliche Infografik: http://musermeku.hypotheses.org/1943
Viele Grüße
Angelika
Pingback: Faszinierendes Kultur-Angebot in NRW und Niedersachsen #KultTipp 5
Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Wolf,
weiterhin bestes Gelingen mit siwiarchiv. Möge es zukünftig auch noch weitere Nachahmer finden – das Modell ist es wert!
Herzlichen Glückwunsch zum dreijährigen Geburtstag! Nun überschneidet sich gerade die Blogparade zum Wissenschaftsbloggen von de.hypotheses mit dieser hier von siwiarchiv. Das war leider nicht absehbar, obwohl beide zum jeweils dreijährigen Geburtstag sind. Falls siwiarchiv jemals vorhat, die Plattform zu wechseln bzw. sich einer größeren Blog-Community anzuschließen: die Tore von de.hypotheses stehen offen! Alles Gute!
2 Hinweise auf siwiarchiv:
1) Als filmisches Material ist die Siegesparade vom 9.5.1945 bekannt: s. http://www.siwiarchiv.de/?p=4385 (Dank an Kollege Köppen!).
2) Ob die Aktenedition des Siegener Politikwissenschaftlers Bellers zum Thema hilfreich ist, muss geprüft werden: http://www.siwiarchiv.de/?p=3556
WDR, Lokalzeit Südwestfalen v. 16.1.2015, Bericht über den Test der App an der Gesamtschule Eiserfeld: http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit/lokalzeit-suedwestfalen/videoschuelertestenweltkiegsapp100_size-L.html?autostart=true#banner Leider nur wenige Tage online!
Habe mir erlaubt, ein Feuilleton beizusteuern: „Abenteuer Archiv“.
http://histgymbib.hypotheses.org/608
Leider fehlt der Band 1807. Meine Bitte gegenüber der SuUB Bremen, den fehlenden Band zu digitalisieren wurde bisher leider nicht gehört. Vielleicht übernimmt diese Aufgabe ja eine andere Bibliothek. Das wäre sehr wünschenswert, damit der Bestand komplett im Netz stehen würde.
Danke für den Hinweis! Können wir da irgendwie helfen?
– Welche Überlegungen lagen der Auswahl zugrunde? Ich frage, weil Kriterien nicht erkennbar sind.
– Was sollen denn diese Schwärzungen? Geschwärzte Namen zu Vorgängen nichtigen Inhalts noch aus der Kaiserzeit?
Eine merkwürdige Ansammlung, die da ins Netz geriet.
Danke für die Kritik an dieser Webpublikation, die tatsächlich mehr Fragen als Antworten aufwirft!
Wünschenswert wäre eine mit den Göttinger Digitalisaten vergleichbar hohe Auflösung des Bandes 1807. Die Datei sollte dann in der DDB zur Verfügung gestellt werden und die bisher schon digitalisierten Jahrgänge der Zeitung komplettieren. Ob dies durch das Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein, das Stadtarchiv Siegen, die Unibibliothek Siegen oder eine andere Einrichtung geleistet werden kann, sollte einmal besprochen werden.
Berichterstattung:
– Siegener Zeitung 27.01.2015
– Freudenberg-online 27.01.2015
Ich schrieb oben: „ein (nicht ganz stummer) Mitläufer“. Wie liest das Folgende sich? AW schrieb es zum Jahresbeginn 1944 auf S. 4 des Siegerländer Heimatkalenders, ein Vor-Wort an den Leser. Kann man das so lesen und hat einfach nur Freude an den schönen Reimen und dem wohlgeformten Wort? Also, als ob nichts wär?
„Zum Beginn!
Der Tag geht auf so morgenklar,
Ruft ihm entgegen von den Zinnen:
Wir grüßen dich, du junges Jahr,
Zu neuem Kampf, zu neuer Fahr,
Zu neuem Wagen und Gewinnen!
Laß uns mit Großem dich beginnen!
Was ungelöst das alte ließ
In uns, das führe du zum Guten.
Es ist die Welt kein Paradies,
Und muß recht in der Finsternis
Das edle Erz der Bergmann muten.
Geläutert wirds in Feuersgluten!
Zünd an der alten Väter Licht,
Das sie im starken Glauben trugen –
In ungebrochner Zuversicht.
Bei dem sie bis zur letzten Schicht
Das Silber aus dem Berge schlugen –
Und ging die Welt drob aus den Fugen!
Wir fahren ein! Dem jungen Jahr
Glück auf! erschallts von allen Zinnen.
Zu neuem Kampf, zu neuer Fahr
Den Arm gestrafft, das Auge klar
Zu neuem Wagen und Gewinnen!
Laßt uns mit Gott es recht beginnen!“
Danke auch für diesen „Fund“! Ich frage mich, ob man die hier vorgestellten Gedichte Wurmbachs, die in der NS-Zeit entstanden, als so mehrdeutig bezeichnen kann, dass eine „Verteidigung“ möglich ist. Nach Stalingrad noch „ungebrochner Zuversicht“ zu dichten, wirft schon die Frage auf, ob sich hier nicht eindeutig um „Durchhaltelyrik“ handelt, die die Metapher des Bergbaus nutzt …….
Zur Veranstaltung s. Westfälische Rundschau, 30.1.15
Hallo Herr Dr. Opfermann, hallo Herr Wolf,
da haben Sie beide nun doch recht. Wurmbach beschreibt die Arbeit im Bergwerk als Kampf. Natürlich lässt sich ein Beug zum Krieg herstellen. In diesem Gedicht greift er auf martialische Formulierungen zurück: „Ruft ihm entgegen von den Zinnen“, „Zu neuem Kampf“, „Geläutert wirds in Feuersgluten!“ und „Den Arm gestrafft [!], das Auge klar“. Für einen erklärten Pazifisten und Christen finde ich die Formulierungen doch sehr ungewöhnlich. Die Zeile „Zünd an der alten Väter Licht,
Das sie im starken Glauben trugen –
In ungebrochner Zuversicht.“ spielt auf den religiösen Glauben der Vorfahren an und kann natürlich als Aufruf an die Zeitgenossen zum Festhalten an der neuen Religion des Faschismus verstanden werden.
Wäre eine öffentliche Diskussion über den Dichter und Pazifisten nicht längst überfällig? Vielleicht im Rahmen einer Diskussion innerhalb der Siegener Geschichtswerkstatt? Es gibt zu Wurmbach kaum wissenschaftliche Veröffentlichungen (- eine Ausnahme ist sicherlich die Knorr-Dissertation -), geschweige denn eine erste Biographie.
Pingback: Ausstellungseröffnung “Walter Krämer ´Arzt von Buchenwald´” | siwiarchiv.de
Pingback: Filmtipp: “Nackt unter Wölfen” | siwiarchiv.de
Pingback: Vorstellung des Aktiven Gedenkbuchs für NS-Opfer | siwiarchiv.de
Radio Siegen, 2.2.15: “Die Suche nach einem Käufer für das rund 500 Jahre alte Gemäuer wurde aufgegeben. Freie Bahn für den Förderverein, der das Gebäude bis zum Herbst für Besucher herrichten will.”
Link zum Podcast: http://radio-siegen.de/_pool/files/beitraege/779416.mp3
Danke für die Meldung! Derzeit läuft der erste Link ins Leere; der dritte funktioniert auch nicht, was aber ein Problem der FH Potsdam zu sein scheint.
Danke für den Hinweis! 1. Link geht nicht mehr ins Leere, 3. Link funktionierte gerade.
s.a. Westfälische Rundschau: 5.2.2015
Pingback: 6. Westfälischer Genealogentag 2015 | siwiarchiv.de
Ein allgemeiner Hinweis zum Antisemitismus Vinckes aus der regionalhistorischen Literatur: „…. Der Oberpräsident der Provinz Westfalen und einstige preußische Reformer Ludwig von Vincke äußerte noch 1826 in einem Gutachten, der Jude sei „ein Mensch, der Kunst und Wissenschaft nicht ehrt und sich ihnen nicht widmet, wenn sie nicht unmittelbar zum reichen, raschen Gelderwerb ihm die Aussicht bieten, der den Ackerbau und das Handwerk meidet, weil jede ruhig, anhaltende und körperliche erfordernde Arbeit, die nur langsamen Gewinn verspricht, ihm zuwider ist.“ In einer für den preußischen König bestimmten Stellungnahme machte Vincke als vehementer Anhänger der Judenbekehrung den Vorschlag, alle Juden innerhalb einer Zehnjahresfrist vor die Alternative zu stellen, sich entweder taufen zu lassen oder das Königreich endgültig zu verlassen. ….“
aus: Dieter Pfau: Die Geschichte der Juden im Amt Ferndort (1797-1941). „Den Juden ist aber hier kein Leid zugefügt worden.“, Bielefeld 2012, S. 24
Podcast zum 6. Westfälischen Genealogentag
Siehe dazu den informativen Beitrag „Vincke und die Juden“ von
Diethard Aschoff und Rita Schlautmann-Overmeyer in:
H.-J. Behr; J. Kloosterhuis (Hg.), Ludwig Freiherr Vincke. Ein westfälisches Profil zwischen Reform und Restauration in Preußen, Münster 1994, S. 289-308.
Danke für diese Ergänzung! Der Hinweis zu dieser Literatur war der Fußnote zum zitierten Passus nicht zu entnehmen. Auch die Literaturliste enthält den Aufsatz nicht. Ob diese antisemitische Haltung Vinckes Auswirkungen auf die jüdischen Bewohnerinnen und Bewohner im Kreisgebiet hatten, ist wohl noch nicht untersucht worden?
Vinckes Verhältnis zu Juden ist bereits früher in den Blickpunkt geraten – vermutlich unter anderem Vorzeichen: Wilhelm Steffens: Oberpräsiddent Vincke und der 1. Provinziallandtag 1826 zur Judenfrage in Westfalen, in Westfalen 23 (1938), S. 95 – 104
Grundlegend für die Siegerländer Sicht auf Vincke dürfte Hans Kruse „Das Siegerland unter preußischer Herrschaft: 1815 – 1915, Festschrift aus Anlaß der hundertjährigen Vereinigung des oranischen Fürstentums Nassau-Siegen mit Preußen“, Siegen 1915, S. 45-48 sein.
Die Einschätzung Güthlings (s.o.) geht jedenfalls kaum über Kruses Wertung hinaus, ist lediglich etwas detailreicher.
Klasse Fundstück. Der Mitteilung zufolge genügt eine 63jährige Witwenschaft zur Qualifikation für die Ehrenbürgerwürde. Da hätte ich auch noch ein paar …
Pressemitteilung der Stadt Hilchenbach zur Ausstellungseröffnung, 9.2.15: http://www.hilchenbach.de/standard/page.sys/details/eintrag_id=621/content_id=7852/586.htm
Pingback: Heimische Fachwerkbauten sind individuell | siwiarchiv.de
Pingback: Herbert Krämer (1931 – 2015) | siwiarchiv.de
Pingback: Jürgen Bellers: Umfangreiche Spionage an der Uni Siegen für die Stasi | siwiarchiv.de
Das ist einfach nur widerlich und peinlich!!!
Wer welches Gesellschaftssystem besser findet, ist für die Art und Weise der Industriespionage der früheren DDR von keiner Relevanz. Dies gilt genauso für die derzeitige Schulpolitik der Stadt Siegen.
Wenn eine solche unsachliche, persönliche Hetze eines vermeintlichen Vertreter der wissenschaftlichen Intelligenz den Weg in die Presse findet, ist dies schlimm genug.
Der Administratot wird hier ernstlich an seine Aufsichtspflicht erinnert.
Wenn der Archivblog siwiarchiv in seiner Informationsarbeit auf das Niveau der Siegener Zeitung absinkt sollte er besser eingestellt werden.
Prof. Bellers fungiert hier als Gastautor, die historischen Angaben sind mit Quellennachweis belegt und können – gerne – überprüft werden und die Meinungsäußerung des Gastautoren ist bereits publiziert gewesen. Eine Kürzung meinerseits käme daher der Zensur gleich.
Generell ich halte siwiarchiv für den Platz, an dem historische Nachrichten, die mit subjektiven Einschätzungen verquickt sind, sachlich (!) auseinander genonmmen werden können und sollten.
Es ist ja erfreulich, dass der Politologe Jürgen Bellers so tapfer gegen das Unrecht in Ost und West streitet. Vielleicht möchten auch seine an dieser Stelle eines disziplinar- und strafrechtlich relevanten Verhaltens (Verrat von Dienstgeheimnissen ans Ausland) bezichtigten ehemaligen Kollegen Bauingenieure ein bißchen Gerechtigkeit für sich beanspruchen: Was auch immer sich in den 1980er Jahren zugetragen haben mag, Herrn Prof. Bellers Aufgabe ist es wohl kaum, nach der Lektüre einer Stasi-Akte öffentliche Vorverurteilungen vorzunehmen. Wenn sich ihm der begründete Verdacht auf Straftaten ergeben hat, steht es ihm frei, dies zur Anzeige zu bringen. Bis zu einem gerichtlichen Urteilsspruch würde dann, wie immer, die Unschuldsvermutung gelten. Abgesehen davon nehme ich an, dass sich Herr Bellers vor Einsicht in diese Akte verpflichten mußte, keine personenbezogenen Informationen daraus zu veröffentlichen. So riesige Forscherteams haben sich in den 1980er Jahren in Siegen sicher nicht mit Steinzerfall und Keramikplättchen beschäftigt, dass den Mitarbeitern der betroffenen Institute nun keine konkreten Namen dazu einfallen würden.
Schließlich sei daran erinnert, dass Stasi-Akten auch eine Menge grotesken Unsinn enthalten. Wenn ich alles für bare Münze nehmen würde, was in meiner steht, müßte ich mich entweder aufhängen oder totlachen.
P.K.
1. die namen der je mehr als 7 projektmitarbeiter in siegen liegen mir nicht vor.
2. aber die akten sind sehr eindeutig und nicht wie andere, die eher nebulös sind, auch bezüglich meiner stasi-akte und die meiner frau. da steht wirklich oft Unsinn drin. oder hinsichtlich der unklarheiten in stolpes akte. die akten über die uni siegen sind eindeutig und unbezweifelbar.
3. rückschlüsse auf Personen sind durch die projektnennungen nicht möglich, siehe oben. auch dritte außerhalb der Projekte hatten ja zugang zu deren unterlagen. hätte ich stattdessen die gesamten Bauingenieure nennen sollen? das hätte ja den kreis der verdächtigen vergrößert.
4. soll ich nun wirklich zum Staatsanwalt laufen, ich will die leute von damals nicht kriminalisieren. es geht mir nur um die öffentliche Diskussion, und dass wir lernen.
5. strafrechtlich kann man das nicht aufklären, allein wg Verjährung und weil die gerichte sehr zurückhaltend sind. nach ihren Vorstellungen wäre also nichts passiert. da ist die veröffentlichung in einer Regionalzeitung doch zumindest etwas. auch für die opfer.
6. meine Kampagne gegen die linke war vielleicht unangebracht und der Sache nicht dienlich. aber zuweilen bin ich auch etwas verbittert, da meine gesamte Familie infolge DDR-haft bis heute schwerbehindert, auf dauer.
Jbellers
Mit Verlaub, ein paar Anmerkungen:
zu 1) Nachdem die konkreten Projekte genannt wurden, wäre es eine Sache von wenigen Minuten, anhand öffentlich zugänglicher Nachschlagewerke die Namen der Mitarbeiter herauszufinden. Insider aus den Instituten, die dort schon länger tätig sind, bräuchten nicht einmal nachzuschlagen. Das Problem ist weniger, dass vielleicht wirklich schuldig gewordene Personen unter Verdacht geraten, sondern dass es gleichermaßen die Unschuldigen trifft. Irgend etwas von einmal in die Welt gesetzten Gerüchten bleibt bekanntlich immer hängen. Und logischerweise ist es unmöglich (auch Ihnen, mir, dem Papst), zu beweisen, dass man niemals für einen Geheimdienst gearbeitet hat: Die Verleumder können immer kontern, dass man eben bloß seine Spuren erfolgreich verwischt hat.
zu 2) Wie „eindeutig und unbezweifelbar“ kann eine Stasi-Akte sein? Steht in der von Ihnen eingesehenen wirklich drin: „Ich, Mitarbeiter X. / Y. / Z. der Uni Siegen, habe bewußt und vorsätzlich folgende Spionagedienste für die DDR geleistet …“? Und haben Sie von Fachleuten prüfen lassen, ob die an die DDR gelangten Forschungsergebnisse tatsächlich geheim waren und nicht vielleicht schon veröffentlicht oder zur zeitnahen Veröffentlichung vorgesehen?
zu 3) Wenn Unbeteiligte Zugang zu den Projektunterlagen hatten, können die ja wohl nicht so vertraulich gewesen sein, oder?
zu 4) Die öffentliche Behauptung, identifizierbare Mitarbeiter der Uni Siegen hätten geheime Informationen an die DDR weitergeleitet, also Straftaten begangen, sehe ich schon als Kriminalisierung. Auch die Behauptung „An der Uni Siegen fand umfangreiche Industriespionage statt“ ist problematisch, weil sie einige Fragen impliziert: Ist die Uni Siegen womöglich auch heute noch ein Paradies für Industriespione (russische, chinesische, amerikanische usw.)? Hat sich die Uni Siegen unter Mißachtung ihrer gesellschaftlichen Aufgaben in so hohem Maße an die Industrie verkauft, dass Spionage hier besonders lohnenswert war oder ist? Wurden Forschungsaufträge für konkrete Industrieunternehmen mit öffentlichen Geldern finanziert? Das sollen keine Anregungen für Verschwörungstheorien sein; es sind Fragen, die sich aus Ihrem Industriespionage-Vorwurf nun von selbst ergeben. Wenn etwas dran sein sollte, müßte es aufgeklärt werden (allerdings nicht von der Siegener Zeitung oder Siwiarchiv, denn das sind meines Wissens keine Ermittlungsbehörden); wenn nicht, wäre es eine Behauptung, die dem Image der Uni Siegen nicht gerade förderlich ist.
P.K.
lieber herr Kunzmann, dank für die Diskussion, zumal wir ja durchaus freundlich an der uni miteinander umgegangen sind und ich mich an sie gerne erinnere. bin nun pensioniert.
aber: warum darf man die gesamte Reichswehr als faschistisch bezeichnen, obwohl alle meine verwandte dort sicherlich nicht faschistisch waren – im Gegenteil! aber ich ertrage dass, denn das Argument, man dürfe keine nestbeschmutzung betreiben, tötet die meinungsfreiheit.
Landesverrat – und darum, da militärisch relevant, handelt es sich hier – ist nicht erst dann gegeben, wenn man geheimnisse verrät, sondern schon dann, wenn man der Bundesrepublik schadet. das ist der Tatbestand. und schaden hat man verursacht, weil allein durch die übergabe der papiere die Bundesrepublik in ihrem ansehen (das von Ihnen angeführte „Image“) als schwächlicher Staat erschien.
vielleicht gibt es auch heute noch so etwas bei uns, wer will das ausschließen? wir sind da viel zu naiv. der Verfassungsschutz ist ja glücklicherweise schon an der uni aktiv. ausländische studenten haben mir zB erzählt, was „ihre“ Geheimdienste an der uni tun. ich sage die länder nicht, um die Studenten nicht zu gefährden. das geht sehr weit, was da abläuft. nur die deutschen wollen das nicht sehen. aber die welt ist nicht gut.
ich habe nebenbei lange zur stasi geforscht und habe sie auch selbst erlebt.
schließlich: die Mitarbeiter der Projekte und zT die projekte selbst sind nicht in den öffentlichen verzeichnissen der uni und auch nicht im forschungskatalog des BMFT. ZT erscheinen die Projekte sogar unter anderem namen. mehr an Anonymisierung geht wohl nicht.
und ganz zum schluß: ich wurde mal ein Straftat zu unrecht verdächtigt. das ist so im leben. es hat mir nicht geschadet. auch wenn das nie aufgeklärt wurde und sehr öffentlich war. (bild Zeitung) und wenn es mir geschadet hat, dulde ich das wegen der Meinungsfreiheit, die mir sehr wichtig, die aber leider bei uns immer mehr durch antifaschistische, antischwule usw. Kampagnen eingeschränkt wird. sie wissen nicht, was ich jetzt wieder an shitmails bekommen habe. die USA sind da offener. dorthin werde ich bald emigrieren. in vielen erinnert man mich die lage heute an die schwierige Aufarbeitung der nazi-zeit in den 60ern. denn die nazis war ja auch eine linke Bewegung (aber damit meine ich nicht Ihre berechtigten Kommentare. man sollte leute nie unnötig belästigen oder verdächtigen. ich bin sehr libertär.)
beste grüße ihr j bellers
Lieber Herr Prof. Bellers,
das alles ist wahrlich ein weites Feld. Ich bin (wie Sie?) kein Freund fruchtloser Spekulationen und will in Anbetracht meines begrenzten Informationsstandes nun nicht länger auf dem Thema herumreiten. Ihrer Aussage „die Welt ist nicht gut“ stimme ich voll und ganz zu. Alles Gute in Ihrer neuen Lebensphase!
Ihr P. Kunzmann
lieber herr Kunzmann, ich halte die hier aufgeworfenen fragen schon für sehr wichtig und prinzipiell, letztlich für alle Archivare und Historiker. die frage ist schlicht und einfach:
ist snowden der Straftäter, oder die, die Informationen mißbrauchen? oder der Archivar und Historiker? (womit ich natürlich nicht sage, dass ich geheimnisse veröffentlicht habe, im Gegenteil).
denn auch einige Infos von snowden haben sich nicht als richtig herausgestellt. was tun? und darf er wahre geheimnisse veröffentlichen? in den USA gibt es auch gerichte.
aber alles auf die gerichte schieben? das dauert und führt oft zu nichts und kriminalisiert. oder wahrheitskommission an der uni siegen?
ich wäre schon an der Meinung der Archivare interessiert.
beste grüße und dank ihr Jürgen bellers
Pingback: Dorothea Jehmlich: Die Farben Schwarz-Weiß-Rot: Stift Keppel im 1.Weltkrieg | siwiarchiv.de
Man sollte doch einmal in Siegen eine Wahrheitskommission wie in Südafrika einrichten wegen der Stasi-Vorfälle, die ja wohl nicht nur an der uni vorgekommen sind, sondern im gesamten Kreis.
Wenn man andauernd Snowden feiert (obwohl das ja Geheimnis-/Landesverrat ist), dann sollte man sich zumindest zu dieser Kommission verpflichtet fühlen, ohne die Spione vor Gericht bringen zu wollen. Das ist sicherlich eine Aufgabe der Archivare. Oder ist das wieder „widerwärtig“? (s. ersten Kommentar)
MPL
dem kann ich nur zustimmen. warum sind viele so zögerlich? woanders ist man ja anders.
j bellers
Letztlich liefe dies ja auf eine Ausweitung des hier vorgestellten Forschungsprojektes hinaus, quasi „Stasi im Kreis Siegen-Wittgenstein“, hinaus. Warum Archive dann so zögerlich auftreten? Es sind m. E. vor allem 3 Gründe:
1) bis jetzt noch nicht formuliertes öffentliches oder Nutzungsinteresse,
2) vermutlich nur spärliche und bereits zugängliche, regionale Quellen, und daraus folgend
3) nicht vorhandene personelle und finanzielle Ressourcen.
na ja, Diktaturen sollte man schon aufarbeiten, wer sie trug und förderte, das zum öffentlichen Interesse, und Gelder muß man beantragen, ich würde mitmachen, was an quellen beim mfs, weiß man erst später
Ein gelungener, runder Beitrag mit guten Illustrationen. Ließe sich der nicht noch weiter ausbauen und in die „Siegener Beiträge“ setzen?
Es solle mit diesen Darstellungen niemand kriminalisiert werden, heißt es, und dann im weiteren Verlauf, er, der Sprecher, sei schon mal fälschlich angeklagt worden: „Das hat mir nicht geschadet.“ Nun ja, dann darf ja wohl schon ein bisschen (oder etwas mehr) kriminalisiert werden?
Besonders ärgerlich: die allgemeinpolitische Positionierung. DDR und NS-Deutschland werden gleichgesetzt, was auf Verharmlosung von NS-Deutschland, Massenverbrechen und Krieg hinausläuft. Macht man (völlig zurecht) mit den USA und deren Foltergefängnissen usw., ja auch nicht. Bitte mal ins Geschichtsbuch schauen.
Zur Frage der „Kriminalisierung“ bzw. des Datenschutzes ist, da es sich laut Eigenaussage um ein von der Stasiunterlagenbehörde gefördertes Projekt handelt, davon auszugehen, dass die Benutzung nach den einschlägigen Regelungen des Stasiunterlagengesetzes erfolgt ist. Somit wäre den vorgetragenen Bedenken hinreichend Rechnung getragen.
Die allgemeinpoltische Positionierung wurde hier bereits mehr oder weniger deutlich nachvollziehbar beanstandet. Darauf hat der Gastautor auch reagiert. Bemerkenswert ist allerdings, dass noch nicht die Frage der regionalen Erinnerung an die Opfer der DDR diskutiert wurde, die im Eintrag m.E. ebenfalls diskussionswürdig, weil ebenfalls der Bezug zur Erinnerung an die NS-Opfer (Stolpersteine!) hergestellt wurde, angerissen wurde.
ok, also regionale Erinnerung an die opfer der DDR als forschungsprojekt, wer macht mit? Befragung?
was das BStU-G betrifft, wurden nun wirklich keine namen genannt, auch nicht indirekt erschließbar, selbst die genannten einheiten sind verfremdet, sicher ist sicher, in heutiger zeit wird ja scharf geschossen, insbesondere gegen die, die auch mal ein kritisches wort gegen links äußern, aber das ziehe ich sofort zurück, ich darf ja nicht politisieren
Vielleicht sollten wir hier weitere Fragestellungen sammeln. Die Spionage militärischer Ziele im Kreisgebiet wäre ebenfalls interessant. Die Begleitung von Ost-West-Kontakten im Kreisgebiet ein weiteres, interessantes Thema ……
Die genaue Beobachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist meiner gegenwärtigen Wahrnehmung nicht an politische Bekenntnisse gebunden – s. aktuelle http://www.nw.de/lokal/kreis_minden_luebbecke/minden/minden/20331714_Datenschuetzer-legt-Mindener-Archiv-ueber-Juden-lahm.html
an archivar: ich würde gerne diesbezüglich in ihr Archiv kommen, um zu recherchieren; vielleicht teilen sie mir mit, ob das aussichtsreich ist:
juergenbellers@gmx.de
die wahrheitskommission in Südafrika hat gerade nicht krominalisiert
außerdem sollte man die DDR nicht verharmlosen, ich kenne die opfer, die noch heute in heimen schwerbehindert leben müssen
machen wir uns an die arbeit
für die Politisierung habe ich mich schon entschuldigt, weil nicht der Sache förderlich
seien wir couragiert
Übrigens so wurde auf der Facebookseite der „Siegener Zeitung“ der Artikel diskutiert: https://www.facebook.com/permalink.php?id=132588013420290&story_fbid=963656173646799 .
leider komme ich nicht rein
Womöglich müssen Sie bei Facebook (FB) angemeldet sein, daher:
Die bekannte These „Die Welt ist nicht gut“ (Bellers u. Kunzmann 2015) ist zu ergänzen: „… und sie wird nicht dadurch besser, dass ich bei jedem Thema meinen Senf dazu gebe.“ Deshalb nur ganz kurz:
Zu einem Leitbegriff der noch jungen Forstwissenschaft wurde „Nachhaltigkeit“ am Anfang des 19. Jahrhunderts. Hier hätte sich für einen über Nassau schreibenden Autor der Hinweis auf G.-L. Hartig angeboten („… denn es läßt sich keine dauerhafte Forstwirthschaft denken und erwarten, wenn die Holzabgabe aus den Wäldern nicht auf Nachhaltigkeit berechnet ist.“ Anweisung zur Taxation und Beschreibung der Forste, 2. Aufl. 1804, S. 1). Forsthistoriker haben später die Bagatelle (wieder)entdeckt, dass das umgangssprachliche Wort „nachhaltend“ schon von Carlowitz in einem ihrer literarischen Klassiker benutzt worden war. Aber natürlich konnte es (bzw. die substantivierte Form) auch nach Carlowitz weiterhin umgangssprachlich für alles mögliche verwendet werden. So auch vom Autor des hier eingestellten Artikels. Der Titel ist irreführend; es geht um frühneuzeitliche Holzeinsparung, nicht um Nachhaltigkeit im forstwirtschaftlichen Sinne als Prinzip der Aufstellung langfristiger Forsteinrichtungspläne.
P.K.
Sehr geehrter Herr Kunzmann,
besten Dank für Ihre Kritik.
1. Ebenfalls Dank für Ihren Literaturhinweis.
2. Es geht sehr wohl um Nachhaltigkeit im forstwirtschaftlichen Sinn. Dieser besteht darin, dass nur so viel Holz gehauen wird, wie im gleichen Zeitraum nachwächst. Wie im Aufsatz erwähnt, sind absolute Zahlen fast nicht zu belegen. Ihre gewünschten Forsteinrichtungspläne auf Grunddaten basierend wie z. B. Vorrat, Vornutzung, Alter und Ertragstafeln mit Bestockungsgraden, Bonitierungen etc. sind meines Wissens nach für die Frühe Neuzeit nicht existent und erst mit preussischer Herrschaft annähernd zu fassen. Ich kann im Detail z. B. nicht sagen, 1589 wurden auf Fläche xy ein nachhaltiger Hiebssatz angewandt und nur 50fm pro ha Holz gehauen. Stattdessen wurde im Aufsatz der Weg aufgezeigt, dass immer mehr Holz angepflanzt als geerntet wurde. Nicht mehr und nicht weniger.
3. Und so sind diese paar Seiten zu betrachten, als Schlaglichter einer regionalen Alltagswelt, eingebettet in das größere Thema Carlowitz und Nachhaltigkeit.
Mit besten Grüßen
Thomas Poggel
s. Amtsblatt der Gemeinde Burbach 8. Jg. Nr.8 v. 25.2.2015, S. 1: http://www.burbach-siegerland.de/media/custom/2024_1877_1.PDF?1424848696
Hier der Beitrag von „Born to be Filed“: http://fam03pf.tumblr.com/post/112065616423/blogparade-siwiarchiv-wird-3-jahre-alt
Alles gute!
Vielen Dank für den Beitrag! Die Anregung etwas mehr zur Archivgeschichte im Kreisgebiet zu machen, nehmen wir gerne auf.
Pingback: Abenteuer Archiv | bibliotheca.gym
Der Sinn, wiederholen Sie, besteht darin, „dass nur so viel Holz gehauen wird, wie im gleichen Zeitraum nachwächst“. Für diese Formulierung sind Sie nicht verantwortlich zu machen; sie geistert seit langem in verschiedenen geringfügigen Variationen aber mit jedesmal demselben logischen Grundübel durch die Medienwelt und wird immer aufs neue gedankenlos abgeschrieben. Was soll der erwähnte „Zeitraum“ bedeuten? Welchem anderen soll er „gleich“ sein? Was soll man sich unter dem abstrakten „Holz“ vorstellen? Die vielleicht einzige Möglichkeit, diese sprachliche Fehlgeburt so zu interpretieren, dass nichts Falsches herauskommt, führt zu der Aussage „Auf einer im Jahr x abgeernteten Fläche wird im Jahr x+n nicht mehr Biomasse gewonnen, als in den vergangenen n Jahren nachgewachsen ist“. Trivialer geht es freilich nicht! Aber ich vermute, dass sich hinter der Verklausulierung sowieso nur die bekannte Devise verbirgt: „Wälder sollen in der Gegenwart so behandelt werden, dass sie auch zukünftigen Generationen noch zur Verfügung stehen werden.“ Das ist nun allerdings banal. Ein vorhandener Wald bleibt solange ein Wald, wie er forstlich genutzt wird. Hören Nutzung und Pflege auf, ist er immer noch ein Wald, der allmählich verwildert. Bestand die letzte Kulturmaßnahme im völligen Kahlschlag, bildet sich eine natürliche Waldgesellschaft über die Zwischenstufe der Heide wieder heraus. Wenn ein Wald verschwindet, dann deshalb, weil außerhalb des Forstwesens stehende Interessenten (z.B. argentinische Viehfarmer oder deutsche Gewerbegebietsplaner) sich durchsetzen konnten, nicht deshalb, weil der Förster zu viel Holz schlagen ließ.
Ich bin nicht streitsüchtig und habe auch nicht die Zeit, seitenlang ins Detail zu gehen. Jeder Mensch darf „Nachhaltigkeit“ so interpretieren, wie er will. Ich selbst bleibe dabei, dass die zahllosen frühneuzeitlichen Forstregelungsversuche in Europa Ausdruck hausväterlicher Sparsamkeit waren, einer Tugend, die das kleine Haus des Familienoberhaupts ebenso wie das dem Landesvater unterstellte „große Haus“ des Staates ansprach. Wenn, wie damals gefordert worden war, jemand sein Grundstück mit einer lebenden Hecke umgab und kein gutes Bauholz für einen Lattenzaun verschwendete, war das vernünftige Ressourcenschonung, aber keine forstliche Nachhaltigkeit. Anlaß für die starke Verwissenschaftlichung im Forstwesen seit dem ausgehenden 18. Jahrhunderts war nun gerade die Wahrnehmung, dass simple Sparsamkeit, gesunder Menschenverstand und einseitig kameralistisch geprägte Forstpolitik den besorgniserregenden Verfall der Wälder bislang nicht hatten aufhalten können und erst recht nicht die für die Zukunft befürchtete oder lokal schon eingetretene Bauholzkrise (nicht Holzkrise schlechthin, auch nicht Energieholzkrise) abwenden würden. Mit der komplexen Forschung unter dem Leitmotiv „Nachhaltigkeit“ kam eine neue Qualität in die Behandlung des Forstwesens, die so in den vorangegangenen 2-3 Jahrhunderten eben noch nicht präsent war. Man stellte sich der enorm anspruchsvollen Herausforderung, Forsten so zu planen und zu pflegen, dass sämtliche Interessentengruppen – vom Küfer über den Zimmermann bis zum Schiffsbauer – kontinuierlich und über lange Zeiträume zu ihrem speziell benötigten Holz kamen, ohne sich gegenseitig etwas streitig zu machen. So entstanden um 1800 Pläne, die unter Berücksichtigung teils langer Umtriebszeiten bis weit ins 20. Jahrhundert ausgearbeitet waren, leider aber schnell zu Makulatur werden konnten: Auch Forstexperten waren keine Propheten und konnten beispielsweise in der Segelschiff-Ära nicht voraussehen, dass demnächst kaum noch 150jährige Eichenstämme für Schiffsmasten benötigt würden, dafür aber nun hunderttausende aus jüngerem Buchenholz gesägte Eisenbahnschwellen. Im übrigen ging es bei diesen Sisyphusarbeiten um den Hochwald. Separate Niederwälder hatte man mit im Blick, aber da waren die Verhältnisse unvergleichbar simpler. In der Theorie konnte eine der Energieholzgewinnung dienende geregelte Niederwaldwirtschaft (solange sie nicht durch agrarische Nebennutzungen gestört wurde) gar nicht anders als „nachhaltig“ entworfen werden, weil es keine legitime Konkurrenz verschiedener Interessenten gab. Die Köhler wollten Holz von ganz bestimmter optimaler Stärke haben, was bei der auf Zeitintervallen beruhenden Staffelung von Schlägen eben das Hauen nach einem festen Turnus von meist 18 Jahren (mit standortabhängigen Abweichungen) erforderte. Die Produzenten von Kohlholz wären dämlich gewesen, wenn sie diesen Rhythmus sabotiert hätten. Leider sind Niederwälder so empfindliche Systeme, dass sie nur unter geschützten Laborbedingungen der Theorie gemäß konsequent ökonomisch nachhaltig funktionieren würden. In der offenen Außenwelt stehen Stockausschläge (wie jedes andere noch nicht widerstandsfähige Gehölz) unter so vielen störenden Einflußfaktoren, dass ihre späteren Erträge zu Beginn eines Turnus nicht prognostiziert werden können. Einem gut gepflegten älteren Hochwald wird ein Blitzeinschlag wenig anhaben; man verliert eben einen Baum unter vielen. Im Hauberg könnte der gleiche Blitz unschwer der Auslöser großflächiger Bestandsausfälle sein. Dies nur als ein Beispiel für etliche Faktoren (natürliche wie anthropogene), die innerhalb der kurzen Umtriebszeiten sehr drastisch wirken und zum völligen Kollaps führen können. Und schon kleinere Kalamitäten bringen das ganze System aus dem Takt. Dabei belasse ich es jetzt, und wenn Sie alles ganz anders sehen wollen, soll mir das auch recht sein. Danke jedenfalls für die Anregung.
Noch ein methodischer Hinweis: Wenn man über Rechtsgeschichte arbeitet, ist es sinnvoll, direkt auf die relevanten Rechtsquellen zuzugreifen und sich nicht mit sekundären Überblicksdarstellungen zu begnügen. Rühle von Lilienstern (Rühle ist übrigens Teil des Familiennamens) hatte die Texte der in seinem Weistum referierten „Gesetze, Ordnungen und Vorschriften“ zur Forstpolitik größtenteils schon in den Dillenburgischen Intelligenz-Nachrichten sukzessive abgedruckt. (Leider fehlt ausgerechnet die Ordnung betr. „Hauberge im Siegnischen“ vom 8.2.1718, die ihm anscheinend nicht im Volltext zugänglich gewesen war. Diese stand im Zusammenhang mit der Konsolidierung der Haubergsgüter, wenn es sich dabei nicht sogar um die legendäre und bisher nicht lokalisierte „Güldene Jahnordnung“ handelte). Die Fundstellen sind in dem zum Weistum gehörenden 90seitigen chronologischen Verzeichnis angegeben oder können den jeweiligen D.I.N.-Jahresregistern entnommen werden. Da das Weistum nur den Stand bis Ende 1802 wiedergibt, empfiehlt sich immer die Durchsicht der danach noch erschienenen D.I.N.-Bände. Im Jahrgang 1805, Sp. 617-622, findet man zum Beispiel die sicherlich von Hartig ausgearbeitete (wegen der französischen Besetzung dann nicht mehr wirksam gewordene) letzte Haubergsordnung für das Fürstentum Siegen.
P.K.
Viel hilft bekanntlich nicht immer viel und so ist das unstrukturierte Herunterschreiben von Wissen und Unwissen nicht gerade sachlich und auf den Aufsatz bezogen. Ihr Beitrag liest sich eher nach dem Motto „Ich weiß was, ich weiß was!“.
1. Die Formulierung „Es wird nur so viel Holz gehauen, wie im gleichen Zeitraum nachwächst“ ist kein „Grundübel“ der „Medienwelt“, sondern derzeitig vertretene wissenschaftliche Lehrmeinung. Sie wird in der näheren Umgebung z. B. im Forstlichen Bildungszentrum Neheim und den einschlägigen Universitäten gelehrt.
2. „Was soll der erwähnte ‚Zeitraum‘ bedeuten? Welchem anderen soll er ‚gleich‘ sein? Was soll man sich unter dem abstrakten ‚Holz‘ vorstellen?“ Kurzfassung: Ich berechne den Zuwachs eines bestimmten Bestandes. Diese beträgt z. B. 6,3 Fm/ha im Jahr. Ein Hiebssatz müsste dementsprechend kleiner 6,3Fm/ha im Jahr sein, um als nachhaltig bezeichnet werden zu „dürfen“. Und was soll an Holz abstrakt sein? Alles Biologie, Chemie und Physik.
3. „Bestand die letzte Kulturmaßnahme im völligen Kahlschlag, bildet sich eine natürliche Waldgesellschaft über die Zwischenstufe der Heide wieder heraus.“ Falsch! Die von Ihnen angedeutete natürliche Sukzession definiert sich als I. Waldfreie Fläche, II. Vorwaldstadium mit Pionierbaumarten, III. Zwischenwaldstadium mit den Schlusswaldbaumarten und IV. dem Schlusswaldstadium mit Zerfalls- und Verjüngungsphase. Die Heide entsteht durch menschlich bedingten Nährstoffentzug (Vieh, abplaggen, verbrennen….), ist also alles andere als natürlich.
4. „Wenn, wie damals gefordert worden war, jemand sein Grundstück mit einer lebenden Hecke umgab und kein gutes Bauholz für einen Lattenzaun verschwendete, war das vernünftige Ressourcenschonung, aber keine forstliche Nachhaltigkeit.“ Wo ist der gravierende Unterschied zwischen Ressourcenschonung und forstlicher Nachhaltigkeit?
5. Was haben Kalamitäten – Ihr genannter Blitz – konkret mit dem Aufsatz zu tun? Dass biotische wie abiotische Schäden Bestände schwächen und Holz zerstören ist offensichtlich und kein sachdienlicher Hinweis und keine ernstzunehmende Kritik.
6. Sicherlich ist es immer von Vorteil archivalische Originale in Händen zu halten und nicht eine „Quellenedition“. Aber mal daran gedacht, dass es v. a. die zahllosen Heimatforscher, Ehrenamtlichen etc. sind, die die Siegerländer Vergangenheit am Leben halten und nicht selten Zeit und finanzielle Mittel fehlen? Es handelt sich hier um einen kurzen, wie gesagt schlaglichtartigen Aufsatz, nicht um eine Dissertation, die z. B. im Rahmen einer zweijährigen wissenschaftlichen Anstellung mit Forschungsgeldern finanziert wird.
In Zukunft vielleicht nicht alles unnötig verkomplizieren. Das ist in wissenschaftlicher Sicht auch kein guter Stil. Für konstruktive Kritik und streitbare Aspekte bin ich offen, aber nicht für jemanden, der sich anscheinend auf Kosten anderer gerne reden hört.
No offense! Die persönliche Note wird revidiert.
Gut so! Ich sah mich schon Zeigefinger hebend eingreifen.
Lieber Herr Wolf, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich weiß, wie sehr Ihnen Ihr Blog am Herzen liegt. Um ihn nicht in Verruf zu bringen, ziehe ich mich aus der aktiven Teilnahme zurück und werde deshalb auch auf die Einsendung der Ihnen für die kommenden Tage angekündigten historischen Miszelle verzichten. Alles Gute, Ihr P.K.
Ich respektiere natürlich Ihre Entscheidung. Aber ein paar Worte des Bedauerns müssen Sie leider ertragen: Mit 74 Kommentaren waren Sie, lieber Herr Kunzmann, ein Garant für die Lebendigkeit des Weblogs. Ohne Kommentare, ohne Diskussion, ja auch ohne Aneinandervorbeireden ist ein Blog uninteressant. Zudem haben Ihre Kommentare mit ihren Literaturhinweisen, Quellenfunden und Ihren pointierten Einschätzungen dazu beigetragen aufgegriffene Themen zu vertiefen. Ich erinnere exemplarisch an die Einträge zu Heinrich Otto und Lothar Irle. Schade auch, dass wir hier auf die Miszelle verzichten müssen.
Vielleicht kehren Sie nach einer Zeit des „Blogfastens“ ja wieder zurück. Ich würde mich – wie viele Leserinnen und Leser des Blogs sicher auch – jedenfalls sehr freuen.
Mit Ihrer Replik hatten Sie ganz offensichtlich das Ziel, mich als ahnungslosen Spinner und Dummschwätzer vorzuführen; der pro forma angehängte Nachtrag ändert an der Wirkung des Ganzen auch nichts mehr. Da ich mich auf Siwiarchiv schon öfter zu Kommentaren habe hinreißen lassen, ist ja vorauszusehen, dass sich manche permanent im Hintergrund bleibenden Voyeure nun schadenfroh die Hände reiben: „Endlich hat es diesem Klugscheißer mal jemand so richtig gegeben!“ Nun gut, irgendwie bin ich ja selbst schuld.
Von meinen Ausführungen habe ich nichts zurückzunehmen, wenn auch die angestrebte Kürze wohl auf Kosten der Verständlichkeit ging. In meinem fortgeschrittenen Alter darf ich mir mittlerweile die Freiheit erlauben, ein wenig Vertrauen in das zu setzen, was ich mir in den zurückliegenden Jahrzehnten erarbeitet habe. Wenn Sie hier mit Ihren forstpraktischen Spezialkenntnissen auftrumpfen, um in der öffentlichen Meinung einen Expertenstatus geltend zu machen, ficht mich das nicht an. Ich habe nie behauptet, z.B. eine Ertragsberechnung vornehmen oder mit der Boussole umgehen zu können. Aber das von Ihnen gewählte große Thema ist schließlich kein Monopol praktizierender Forstwirte (auch wenn manche Vertreter der „Zunft“ das vielleicht für sich beanspruchen). In einer ausführlichen Abhandlung hätte ich mich in aller Breite auf Belege gestützt. Naiverweise war ich davon ausgegangen, dass Sie hinter meinen fragmentarischen Andeutungen mehr als lediglich persönliche Phantasieprodukte vermuten würden.
Damit ist von meiner Seite dieses sinnlose Aneinandervorbei-Reden beendet. Wenn Sie das letzte Wort haben wollen, überlasse ich es Ihnen ohne weitere Erwiderung.
Kunzmann
PS 1: Ihr oberlehrerhaft triumphierendes „Falsch!“ akzeptiere ich insofern, als meine ganz nebensächliche Erwähnung der Heide in dieser Knappheit mißverständlich war. Wenn Waldflächen nach langer Übernutzung des Bodens wegen zu starker Rentabilitätsabnahme aufgegeben werden, liegt die für das Entstehen einer (vorübergehenden) Heidevegetations-gesellschaft nötige Voraussetzung der Nährstoffarmut vor. Aber Sie haben natürlich recht, ein aus anderen Gründen gerodeter Wald verwandelt sich nicht automatisch in eine Heide.
PS 2: Wenn Ihnen das Aufsuchen sehr leicht zugänglicher gedruckter Quellen zu mühsam ist, können Sie sich den Aufwand des Publizierens doch ganz sparen; etwas erwähnenswertes Neues entdecken Sie dann sowieso nie. Ich kann nicht verhehlen, dass ich die weit verbreitete wiederkäuende Art historischer „Heimatforschung“, deren Akteuren Lokalpatriotismus viel wichtiger als Erkenntnisgewinn ist, nicht sympathisch finde.
1. Mein Ziel war es nie, Sie als „Spinner und Dummschwätzer“ vorzuführen. Sie sind mir erst seit Ihrem ersten Kommentar zu meinem Aufsatz „bekannt“.
2. Es ging weder darum, irgendeinen „Expertenstatus geltend zu machen“, noch „oberlehrerhaft [zu] triumphieren(…)“ oder ein letztes Wort haben zu wollen.
3.Dieses gibt es – zum Glück – vermutlich in keiner Wissenschaft. Und nur ein kleiner, bescheidener wissenschaftlicher Beitrag war mein Aufsatz. Ich habe primär das „Weisthum“ und die Dillenburgischen Intelligenz-Nachrichten „befragt“ und thats it! Es sind Facetten, nicht mehr und nicht weniger. Eine größere Arbeit würde sicherlich in die Archive nach Wiesbaden, Münster, Den Haag, Siegen etc. führen.
4. Sie haben darauf reagiert, wofür ich Ihnen danke, und Ihre Sicht der Dinge dargelegt. Meinungen treffen aufeinander, der eine weiß dies, der andere weiß jenes. Das ist Wissenschaft! Es geht hier um Inhalte, nicht um persönliche Reputation.
5. Als Historiker, der an „Ihrer“ Universität ausgebildet worden, aber nun einmal Sauerländer ist, sind mir lokalpatriotische Absichten fremd. Und letztlich ist eine „wiederkäuende (…) ‚Heimatforschung‘“ – sofern sie denn betrieben wird – weniger schlimm als die Alternative: Weniger Kultur, weniger Geschichte. Der Staat, das Land spart an dieser Stelle als erstes. Verdienen Sie mit Heimatforschung Ihren Lebensunterhalt und ich ziehe meinen virtuellen Hut!
Übrigens, Herr Kunzmann, mein Beitrag über die Funktion der Dillenburgischen Intelligenz-Nachrichten erscheint in den nächsten Nassauischen Annalen. Bin da ja schon sehr auf Ihre Kritik gespannt :-)!
Dank an „archivar“ für die Verballhornung meines Namens.
Asche auf mein Haupt! Aber jetzt sollte er richtig sein.
Pingback: Vincke-Brief in der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen | siwiarchiv.de
Nachhaltigkeit – oder was?
Bei diesem interessanten Thema für die Region will ich nicht abseits stehen und meinen Beitrag dazu leisten, dass zwar nicht die Welt, aber immerhin das Siegerland ein wenig besser wird.
1. Back the roots, soll heißen, lasst uns die Originaltexte nutzen und nicht die verkürzte Form aus zweiter Hand. Rühle von Lilienstern schrieb im Weisthum: „Jeder soll um seine Wiesen und Gärten jährlich 12 Stämme von 9 Fuß Länge und armsdicker Stärke setzen.“ Hier beginnen schon die Missverständnisse: 12 Stämme von was, von Bäumen aus dem Hoch- oder Niederwald oder von Sträuchern? Wenn man dazu mehr wissen will, muss man schon den Originaltext in die Hand nehmen. Rühle von Lilienstern berief sich auf eine Ordnung aus dem Jahr 1498, die Graf Johann für die beiden Ämter Siegen und Dillenburg erlassen hatte. Nachzulesen ist diese Ordnung im Corpus Constitutionum Nassovicarum: das ist; Sammlung der Gesetze, Verordnungen, Vorschriften und Ausschreiben […], 1. Band, Dillenburg 1796, Sp. 31-64.
Unter Punkt 41 „Von der Wyden setzen“ werden im Stil der Zeit recht weitläufig und umständlich die Untertanen (Hausväter) der Ämter angehalten, jedes Jahr um ihre Wiesen und Gärten „uffs aller Wenigste“ 12 „wyden stemme“ von einer bestimmten Größe (9 Fuß lang und armdick) zu setzen.
2. Es handelt es sich nicht um beliebige Holzstämme, nicht um Eichen oder Buchen, sondern um Weiden, die anzupflanzen waren (diesen wichtigen Hinweis unterschlägt RvL – warum auch immer). Dieser Sachverhalt führt zu der Frage: warum Weiden? Welche Bedeutung könnten Zeitgenossen den Weiden gegeben haben, laut Wikipedia sind sie „schnellwüchsig“ und „relativ kurzlebig“. Sie besitzen also Vorteile und Nachteile. Ihre Schnellwüchsigkeit entlastete sicherlich andere Waldungen.
3. Meine Vorstellung, wie die Verordnung praktisch umgesetzt worden ist, stößt aber an Grenzen. Offenbar sind mehrjährige (armdicke) Weidenstämme (andernorts ausgegraben?, wohl kaum, da die Weiden tiefgründig wurzeln) als Setzlinge an der eigenen Grundstücksgrenze wieder eingepflanzt worden. 12 Stück pro Jahr, über mehrere Jahre, bis alles eingehegt war. Wie ging es dann weiter? Den abgeholzten / abgestorbenen Teil wieder durch neue Anpflanzungen ersetzen?
Bei einer geschätzten Häuserzahl von ein- bis zweitausend (1000 allein im Amt Siegen, vgl. Geschichte des Netpherlandes, S. 43) um 1500 in den beiden Ämtern macht das 12 – 24.000 mehrjährige Weidenstämme pro Jahr, die gepflanzt worden sind. Wo kamen die her? Führte das nicht anfänglich zum Raubbau an Weiden, bis man zum Teil auf die angepflanzten Weiden selbst zurückgreifen konnte und sich alles auf einem höheren Niveau neu einzupendeln begann? Wurde überhaupt der Ordnung nachgelebt? Fragen über Fragen, aber keine Antworten.
4. Ein spannendes Thema, ohne dass der beliebig und inflationär genutzte Nachhaltigkeitsbegriff herangezogen werden müsste. Wer den Begriff nutzt, muss sich zu Recht mit den anregenden Fragen von Herrn Kunzmann und mit einigen neueren Büchern zum Thema auseinandersetzen.
5. Die hier verbreitete optimistische Sicht der Heimatgeschichtsschreibung teile ich ganz und gar nicht. Dazu nur soviel: Sie, die Heimatgeschichtsschreibung, nutzt gerne die Ergebnisse zweiter Hand, wiederholt sie gebetsmühlenartig und lässt jegliche Auseinandersetzung mit der (wissenschaftlichen) Literatur vermissen. Soweit mein Urteil dazu, nach mehr als drei Jahrzehnten regionalgeschichtlicher Forschung.
Sehr geehrter Herr Dr. Plaum,
1. die von Ihnen zitierte Verordnung von 1498 wurde von mir lediglich als Einstieg genommen und Ihre Fragen nach den Baumarten und die Motivation eben diese zu pflanzen wurden anhand von meinen Ausführungen mit den späteren Verordnungen beantwortet. Und ja – anhand des Weisthums. Aber immerhin ist das geradliniger als von „Back [to] the roots“ zu sprechen und wenige Sätze später Wikipedia zu zitieren. Weide finden Sie bei mir genauso wie Schnellwüchsigkeit.
2. „Wie ging es dann weiter? Den abgeholzten / abgestorbenen Teil wieder durch neue Anpflanzungen ersetzen?“ Es ging durch vegetative Vermehrung – Stockausschlag (und Wurzelbrut) – weiter. Die Weide wurde gepflanzt und nach mehreren Jahren abgehackt/-geschnitten. Aus diesem Stock schlugen neue, mehrere Triebe aus. Das gleiche Prinzip wie beim Hauberg und bei Kopfbäumen. Ein Einpflanzen neuer Bäume war nicht notwendig.
3. Ein weiteres Mittel den Bedarf zu decken, waren die von mir angedeuteten ersten „Baumschulen“, die Pflanzgärten, in denen Bäume für Wiederaufforstungen herangezogen wurden.
4. „Wurde überhaupt der Ordnung nachgelebt? Fragen über Fragen, aber keine Antworten.“ Gleichfalls im Rahmen der benutzten Quellen beantwortet: Die stetige Aktualisierung der Verordnungen und die Beschäftigung der Obrigkeit mit der Thematik deutet darauf hin, dass es eine Kluft zwischen Theorie und Praxis gegeben haben muss. Wenn im alltäglichen Leben alles „rund“ läuft, dann bedarf es keiner Anstrengung, Bestehendes zu ändern.
5. Das Diffamieren des Begriffes „Nachhaltigkeit“ macht das, was darunter verstanden wird, nicht weniger sinnvoll. Selbst wenn „Nachhaltigkeit“ inflationär gebraucht wird, so ist diese Wirtschaftsweise, egal in welchem Bereich, nicht verkehrt. Wenn Sie nach dem Prinzip „Nach mir die Sintflut!“ leben wollen, dann bitte.
6. Der Einwand der bescheidenen Literaturrecherche ist berechtigt.
7. Optimistische Heimatgeschichtsschreibung ist dem Aufsatz fremd. Der „Siegerländer“ ist nicht besser oder schlechter als wer anderes. Mein Fazit erwähnt, dass die Region nur ein Fallbeispiel ist und reichsweite Forstordnungen in dieselbe Richtung gingen.
Mit besten Grüßen
Thomas Poggel
Sehr schön. Passend dazu:
„Was das Goethe-Zitat für den Bildungsbürger des 19. Jahrhunderts war, das ist die Nachhaltigkeit für den umweltbewußten Deutschen von heute: ein wohlklingender Referenzpunkt ohne tiefere Bedeutung. […] Zur Nachhaltigkeit ist, so scheint es, alles Sinnvolle gesagt und auch ein guter Teil des Sinnlosen. […] Der Rekurs auf die Geschichte wirkt vor einem solchen Hintergrund wie der Wunsch nach einem terminologischen Defibrillator.“
Frank Uekötter [Guter Mann. Radkau-Schüler], Ein Haus auf schwankendem Boden: Überlegungen zur Begriffsgeschichte der Nachhaltigkeit, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 64 (2014), Nr. 31-32 (Themenheft Nachhaltigkeit), S. 9-15, hier S. 9 – Link zur PDF: http://www.siwiarchiv.de/wp-content/uploads/2015/03/APuZ_2014-31-32_online.pdf.
Meiner Meinung nach berechtigen Pseudonyme à la „Hans Wurst“ nicht die Teilnahme an einer wissenschaftlichen Diskussion.
Pardon, meiner Meinung nach hat der Hans Wurst nicht diskutiert, sondern lediglich einen in der wissenschaftlichen Welt anerkannten Umwelthistoriker zitiert. Merci.
Zur allgemeinen Position zu anonymen Kommentaren auf siwiarchiv s. http://www.siwiarchiv.de/?page_id=103#comment-39848
Die Personalakte zu seiner Zeit als Lehrer und später Oberlehrer (ab 1924) der Wiesenbauschule befindet sich im Universitätsarchiv Siegen (UASi WBS 137) und reicht von 1900 bis zu seinem Tod 1945. Demnach ist er als Oberlehrer erst zum 1. April 1929 in den Ruhestand versetzt worden, dies aber nur, weil eine weitere Verlängerung der Amtszeit (Er war immerhin schon 71 Jahre alt!) aus gesetzlichen Gründen nicht mehr möglich war. Die Todesanzeige datiert vom 23. Febr. 1945, der Nachruf in der Siegener Zeitung vom 1. März 1945. Beigesetzt worden ist er auf dem Lindenbergfriedhof in Siegen.
Lothar W. Holzgreve
Vielen Dank für den Hinweis! Übrigens, ein weiterer Nachlass eines Siegener Wiesenbaumeisters wurde bereits vor einiger Zeit an das Siegener Stadtarchiv abgegeben: http://www.siegen.de/standard/page.sys/details/eintrag_id=5324/content_id=5453/465.htm
Aus gegebenem Anlass wird hier die Position zu anonymen Kommentaren dargelegt:
1) Anonymität ist ein Grundbestandteil aller sozialen Medien. Dies achtet siwiarchiv.
2) Es gibt nachvollziehbare Gründe für die Anonymität.
3) Daher werden entsprechende Kommentare den Regeln unterworfen, die auch für namentlich gekennzeichtete Kommentare gelten:
– Löschung erfolgt nur bei Verstoß gegen rechtliche Regelungen sowie bei Werbung
– Bei Überschreiten blogimmanter Umgangsgepflogenheiten erfolgt ein entsprechender Kommentar des Admin.
Übrigens: Carlowitz war bereits zweimal Thema auf siwiarchiv:
1) Ausstellung “300 Jahre forstliche Nachhaltigkeit”
2) Hans-Carl von Carlowitzs „Sylvicultura Oeconomica“ in Wittgensteiner Schlossbibliotheken
Versierte Rezension von Kai Naumann dazu nun in ARCHIVAR 68 (2015), H. 1, S. 57f.
s. Artikel in der Westfälischen Rundschau v. 14.3.15: http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/bauhaus-alma-siedhoff-buscher-in-kreuztal-geboren-id10455538.html
Pingback: Buchvorstellung “Siegerland – eine Montanregion im Wandel” | siwiarchiv.de
s. a. Pressemitteilung der Uni Siegen v. 17.3.2015. Siegener Zeitung und Westfälische Rundschau berichteten ebefalls über die Funde.
Wäre nach dem Wisent-Erfolg nicht auch hier das Auswildern eine Überlegung wert (für ehrenamtliche Schirmherrschaften drängen die Vorschläge sich auf)?
Ein „Wisent-Erfolg“ darf bezweifelt werden. Zum einen werden die Waldbesitzer mit einem nicht unerheblichen Schadfaktor konfrontiert, zum anderen sind ausgewilderte Tiere noch immer an die Menschen gewöhnt.
“ ….. Ein David Joseph, Schutzjude aus Herborn (Von Achenbach, S. 694), ….. trieb … kräftig Handel mit dem Siegener Fürstenhaus. Er durfte noch bis 1735 mit der Erlaubnis der letzten beiden reformierten Fürsten,“im ganzen Land handeln und wandeln.“ David Joseph (ebd.) besaß zuletzt vermutlich ein Warenlager im Wittgensteinischen Flügel des Unteren Schlosses, wo er seine Waren aufbewahrte. Derselbe fand sich im Kirchenbuch der reformierten Gemeinde Siegens (Thiemann, S. 8). Somit haben David Joseph und seine Familie sich ebenfalls taufen lassen. um vielleicht den gesetzlichen Beschränkungen zu entgehen.
Über die alte Bezeichnung der Judengasse in Siegen, woher diese Bezeichnung rührt, für eine parallel zur Straße auf dem Graben verlaufenden Weg, gibt es bis heute nur Spekulationen. Während von Achenbach die Bezeichnung auf das o. a. Warenlager und Abstiegsquartier des Juden zurückführt, vermutet Walter Thiemann (ebd.) in seiner Schrift, daß dies vielleicht auch eine Flurbezeichnung aus dem 13. Jahrhundert sein könne, als in Siegen vielleicht die erste jüdische Gemeinde (s. vorheriges Kapitel) bestand. Jedenfalls wurden die herrschaftlichen Gebäude am Unteren Schloss 1825 abgerissen, damit verschwand auch die Judengasse. Eine endgültige Klärung wird sich wohl nicht mehr finden lassen. ….“ (Quelle: Klaus Dietermann: Jüdisches Leben in Stadt und Land Siegen,Siegen 1998, S. 15.)
Dietermanns Publikation (S. 9 – 19) stellt wohl den derzeitigen historischen Forschungsstand zur mittelalterlichen neuzeitlichen Geschichte der Juden in der Stadt Siegen dar. Ferner sind Walter Thiemann: Von den Juden im Siegerland, Siegen 1970 (2. Aufl.) und Heinrich von Achenbach: Geschichte der Stadt Siegen, 2 Bde, Siegen 1894 zu benutzen. Zur Ersterwähnung eines Juden in Siegen wird auf Bernhard Brilling: Urkundliche Nachweise über die ersten Ansiedlungen von Juden in westfälischen Städten des Mittelalters, in: Westfälische Forschungen 12 (1959) , S. 156, verwiesen. Rüdiger Störkel: Dokumentation zur Geschichte der Juden in Herborn, Herborn 1989, sollte weiteren Aufschluss über die Familie Joseph geben.
nach dem Ende der Zeichnungsfrist stehen 3954 gültige Unterschriften. Insgesamt haben 4006 Personen die Petition für den Erhalt der Rheinischen Landesgeschichte an der Bonner Universität unterzeichnet. Dies ist ein großer Erfolg und ein deutlliches Zeichen für das weitreichende Interesse an einer starken Landesgeschichte an der Bonner Universität. Für die Unterstützung bedanken sich die Initiatoren der Petition herzlich.
Die Petition ist beim Rektor der Universität, Prof. Jürgen Fohrmann, und dem Dekan der Philosophischen Fakultät, Prof. Andreas Bartels, eingereicht worden. Gleichzeitig sind die Zeitungen, welche im Verlauf der Petition über die Entwicklungen berichtet haben, über das Ergebnis und die Einreichung informiert worden.
Über Reaktionen und weitere Neuigkeiten wird informiert.
Zu den „sensationellen“ Funden der Archäologen sollten einige Fragen aus Sicht des Historikers erlaubt sein:
Warum taucht die Bezeichnung „Judengasse“ erst im frühen 19. Jahrhundert in einer schriftlichen Quelle auf, wenn doch eine jüdische Gemeinde bereits im 15. Jahrhundert existierte? Hat sich deren Existenz über gute vier Jahrhunderte im kollektiven Gedächtnis der Siegener bewahrt, um dann unvermittelt hervorzubrechen? Warum findet sich in den schriftlichen Quellen seit dem 15 Jahrhundert, die sämtliche Straßennamen der Stadt aufführen und in Form von Schatzungslisten, Feuerschillingsregistern, Einwohnerverzeichnissen etc. reichhaltig vorliegen, keine Erwähnung einer Judengasse?
Warum findet sich in den Schatzungsregistern des 15. Jahrhunderts kein einziger jüdischer Name, wo doch jetzt in der fraglichen Situation angeblich „der erste Nachweis für eine nennenswerte jüdische Siedlung“ (SZ vom 17.03.2015) gefunden worden sein soll?
Und dann die Stadtmauer! Wo bitteschön verlief denn diese? In der einschlägigen Literatur ist nachzulesen, dass sie im 15. Jahrhundert vom Löhrtor hinter dem späteren Krankenhaus quer über den heutigen Schlossplatz zum Dicken Turm bzw. Kölner Tor verlief, dabei aber just die später so genannte Judengasse von der Stadt ausschloss. Erst im frühen 16. Jahrhundert wurde der Bereich um die Martinikirche durch die Erweiterung der Stadtbefestigung in das städtische Areal einbezogen.
Fazit 1: Die Archäologen haben ausgegraben die Reste eines Kellerfußbodens, der höchstwahrscheinlich zu den Resten der „extra muros“ befindlichen Häuser der „aldestat“ gehörte. Diese wurden in den 1520er Jahren abgerissen, ihre Überbleibsel bei der Errichtung des Wittgensteiner Flügels überbaut. Für die Namengebung „Judengasse“ dürfte das von Dietermann erwähnte Warenlager des Schutzjuden David Joseph in der Remise des Wittgensteiner Flügels verantwortlich sein.
Fazit 2: Wir freuen uns, dass mal wieder Mittelalterarchäologen den Weg nach Siegen gefunden haben und eine städtischen „hotspot“ umgraben. Wir sind auch gerne bereit, unsere Stadtgeschichte anhand archäologischer „Sensationsfunde“ umzuschreiben. (Eine blühende jüdische Gemeinde innerhalb der Stadtmauer des 15. Jahrhunderts wäre sicherlich ein absolutes highlight in unserer an Sensationen nicht wirklich reichen Stadtgeschichte.) Dann aber bitte nicht aus ein wenig altem Fußboden und einigen Keramikscherben Spekulatives in die Welt setzen, sondern im Zusammenspiel von schriftlichen Quellen und Bodenfunden belegbare Fakten schaffen. Diesen Dialog haben die Archäologen des LWL in den neunziger Jahren beim Bau der Karstadt-Tiefgarage vorbildlich vorgemacht (siehe Siegener Beiträge – Jahrbuch für regionale Geschichte 1/1996 Ausgrabungen in Siegen).
Zum Diskurs zwischen Geschichte und Archäologie s. a. Westfälische Rundschau v. 24. März 2015
Moije Bernhard, also ich bin von deinem Fotobeitrag begeistert. Wunderbares Material aus alten Zeiten und mein Geburtshaus ist auch dabei.
Danke Uwe
Hallo kleiner Bruder, toll!!!!!!!!!!! Da stehst Du im Internet als Verfasser der Geschichte. Das Fach hat Dich ja schon immer interessiert im Gegensatz zu mir.
LG sendet Dir Christa
Es ist eine bemerkenswerte Fleißarbeit. Als Vorsitzende des Heimat- und Verkehrsvereins Hüttental bin ich Bernhard Lohrum sehr dankbar für den Beitrag. Ich hoffe, dass sich viele Menschen für die Arbeit interessieren.
Traute Fries
Pingback: „Fast jedes kleine Dörfchen des Landkreises Siegen besitzt sein Ehrenmal“ | siwiarchiv.de
Pingback: Judengasse in Siegen – Geschichte vs. Archäologie? | siwiarchiv.de
Die Wahrheit liegt wie so oft vermutlich in der Mitte. Faszinierend ist, dass für den Historiker nur das existiert, was irgendwann mal irgendwo niedergeschrieben wurde. Dass sich nicht alles schriftlich tradiert haben kann, sollten gerade die aussondernden Archivare wissen. Genauso dürfen mündliche Überlieferungen, die sich in ein „kulturelles Gedächtnis“ gebrannt haben, nicht außer Acht gelassen werden. Würde man diese Schriftfixiertheit „der Historiker“ auf die Spitze treiben, müsste die gesamte schriftlose Urgeschichte verneint werden.
Welch bodenloser Unsinn! Nicht jeder frühe Vogel fängt zwangsläufig einen Wurm! Hier geht es nicht um „Schriftfixiertheit“, sondern darum, Ausgrabungsergebnisse an den tatsächlich vorhandenen Schriftquellen zu überprüfen, sonst haben wir nämlich eine „Spatenfixiertheit“. In diesem Zusammenhang empfehle ich dem Kommentator noch einmal die Lektüre des ersten Bandes der Siegener Beiträge (1996, Ausgrabungen in Siegen). Daran zeigt sich, zu welchen stadtgeschichtlich bedeutenden Erkenntnissen die fruchtbare Zusammenarbeit von Archäologen und Historikern führen kann. Im Übrigen lag es nie in meiner Absicht, einen ideologischen Gegensatz zwischen beiden Gruppen zu konstruieren.
Und was die Frühgeschichte angeht, da vertrau ich mal auf die Archäologen, denn sonst habe ich nichts. Aber warum sollte man schriftliche Quellen außer Acht lassen, wenn man sie denn hat?
Und jetzt rudere ich erst mal ein Stück zurück: Meine ‚Gedächtnisfixiertheit‘ hat mich verleitet, den Kommentar am Wochenende aus dem Stand ohne Überprüfung der Quellen zu schreiben. Genaueres Recherchieren in den Archivbeständen hat denn doch eine frühere Quelle für die „Judengasse“ ergeben. In einem Plan des Unteren Schlosses, der vermutlich auf 1802 zu datieren ist, wird diese erstmals erwähnt. Er zeigt aber auch, dass die Judengasse eben nicht da eingezeichnet ist, wo die Archäologen graben. Punktum.
1. Dass die Wahrheit vermutlich in der Mitte liegt und manch ein Historiker einen papiernenen Tunnelblick besitzt, ist sicherlich kein „bodenloser Unsinn“. Mein Kommentar war allgemein gehalten und lediglich Anreiz für jeden, eigene methodische Vorgehensweisen zu hinterfragen.
2. Ich bin bei Ihnen, wenn es darum geht, dass Historiker und Archäologen mehr zusammen arbeiten sollten. Immerhin wird ein und die selbe Vergangenheit erforscht.
3. Einen „ideologischen Gegensatz zwischen beiden Gruppen“ brauchen Sie ohnehin nicht mehr „konstruieren“. Die Historiker bekommen an den Universitäten gelehrt, die Archäologie sei eine reine Hilfswissenschaft. Umgekehrt sieht es nicht wesentlich anders aus. Ein Punkt, den aus zu beseitigen gilt.
4. Ihr Beispiel (Siegener Beiträge 1996) sowie etwa neuere Forschungen des mittelalterlichen Siegerländer Bergbaus zeigen zum Glück, dass es anders geht! Intensive Zusammenarbeiten zwischen Historikern und Archäologen bieten noch viel Potential, das es zu nutzen gilt.
Vollkommen richtig: „Dass die Wahrheit vermutlich in der Mitte liegt“ ist natürlich kein „bodenloser Unsinn“, sondern eine Plattitüde der ergreifendsten Schlichtheit. Der Rest BLEIBT Unsinn! Sich jetzt damit herauszureden, lediglich Anreiz schaffen zu wollen, „eigene methodische Vorgehensweisen zu hinterfragen“ ist Rückzug der billigen Art. Weitere Ausführungen erübrigen sich, zumal Sie mir in Ihren Punkten 2 bis 4 ja in meiner inhaltlichen Kritik grundsätzlich beipflichten. Für mich ist diese absolut überflüssige Diskussion hiermit beendet, es sei denn, Sie haben etwas Substantielles zu den von mir angesprochenen inhaltlichen Fragen beizusteuern.
Eins noch: Wenn anderen „Plattitüde[n] der ergreifendsten Schlichtheit“ vorgeworfen werden, gleichzeitig aber von „Nicht jeder frühe Vogel fängt zwangsläufig einen Wurm!“ gesprochen wird, dann ist genau dies z. B. ein Punkt, wo die eigenen methodischen Vorgehensweisen gerne hinterfragt werden dürfen. Da ich weder im Archiv sitze, noch irgendwelche Befunde/Funde kenne, gibt es nichts Substantielles und ich bin raus.
Zur archäologischen Fundlage s. Westfälische Rundschau v. 24.3.2015: “ …. Zwar habe sein Team „kein spezifisch jüdisches Fundmaterial“ entdeckt, „aber eindeutig eine Bauzeile gefunden“ – und das an eben jener Stelle, wo in einem alten Plan eine „Judengasse“ eingezeichnet sei. In diesem Fall sei „Übertragung das Naheliegende“. ….“
Für einige vielleicht interessant: Wenngleich kurz nach 1802/1806 datiert, finden sich in folgenden Archivalien vielleicht noch Hinweise auf frühere Belege für eine „Judengasse“:
Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen
B 415, 1 Regierung Arnsberg – Domänenregistratur
3.7.7.3 Gebäude
0 III A Fach 107 Nr. 13 – Vermietung der Gebäude im unteren Schloss, Wittgensteiner Flügel halber Mond, Kutschenremise, Judengasse
Laufzeit : 1822 – 1829
Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen
B 415, 1 Regierung Arnsberg – Domänenregistratur
3.9.8.3 Gebäude
0 III A Fach 137 Nr. 3 – Verkauf der sogenannten „Judengasse“ beim unteren Schloss zu Siegen
Laufzeit : 1822 – 1825
1816, nicht 1806 – Tippfehler.
Nachtrag:
Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen
3.3.2.8 Domänenrentämter (Renteien)
Domänenrentamt Siegen
B 481 Si Domänenrentamt Siegen
Verzeichnungseinheiten
876 – Abbruch des Judengasse genannten Gebäudes im unteren Schloß zu Siegen und Verpachtung des Gartens
Laufzeit : 1822-1876
„des Judengasse genannten Gebäudes“ – ein Hinweis, dem wohl mal nachgegangen werden sollte!
Bezieht sich diese Archivalie auf die bereits hier zitierte Textstelle „Jedenfalls wurden die herrschaftlichen Gebäude am Unteren Schloss 1825 abgerissen, damit verschwand auch die Judengasse. Eine endgültige Klärung wird sich wohl nicht mehr finden lassen. ….” (Quelle: Klaus Dietermann: Jüdisches Leben in Stadt und Land Siegen,Siegen 1998, S. 15.)“? Hatte Herr Dietermann die Akte in den Händen oder könnten ihr noch neue Erkenntnisse entlockt werden?
Im Quellenverzeichnis Dietermanns ist dieser Aktenband nicht aufgeführt.
Gratulation zu den Quellennachweisen, denen nachgegangen werden muss! Diese decken sich zeitlich mit den Erkenntnissen aus hier vorliegenden Zeitungsberichten des 19. Jahrhunderts.
Inzwischen hat sich auch Stadtarchivar a.D. Friedhelm Menk der Sache angenommen und einen ersten Fund getätigt: „In dem hölzernen Vorgebäude an der Judengasse vor dem halben Mond in der 2ten Etage befindet sich …“ (Quelle: Landesarchiv Münster, Fürstentum Oranien-Nassau II D Nr. 3 „Inventarium von dem herrschaftlichen untern Schloß zu Siegen mit allen darin befindlichen Gebäuden aufgestelt im Julio 1785“) Full credits to him!
Neben der genannten Quelle könnten ferner die „benachbarten“ Archivalien im Landesarchiv noch interessant sein:
1776-1793
Bauten im Garten des Unteren und Oberen Schlosses zu Siegen
Bestellsignatur : Fürstentum Siegen, Oranien-Nassauische Behörden, Nr. II D 2
Altsignatur : Rentamt Siegen 40
1802
Inventar des Unteren Schlosses zu Siegen
Darin: Grundriß der Hälfte des Unteren Schlosses von 1789
Bestellsignatur : Fürstentum Siegen, Oranien-Nassauische Behörden, Nr. II D 5
Altsignatur : Rentamt Siegen 459,1
1783-1805
Bauerlaubnisse an fürstlichen Gebäuden, vornehmlich in Siegen
Bestellsignatur : Fürstentum Siegen, Oranien-Nassauische Behörden, Nr. II D 9
Altsignatur : Rentamt Siegen 1033
Pingback: Lebenslauf des “königlichen Wiesenbaumeisters” Andreas Heinemann | siwiarchiv.de
Pingback: Markierungen 03/30/2015 - Snippets
Pingback: Fernsehhinweis: “Nackt unter Wölfen” | siwiarchiv.de
Lieber Bernhard,
vielen Dank für Deine schöne Dokumentation, und das Du sie uneigennützig hier für uns alle präsentierst!
Grüße auch an Deine Frau
Manfred aus Eisern
Pingback: Literaturhinweis: Stephan Scholz “Vertriebenendenkmäler. Topographie einer deutschen Erinnerungslandschaft” | siwiarchiv.de
„Der ARD-Fernsehfilm „Nackt unter Wölfen“ war am Mittwochabend die meist gesehene Sendung. 5,45 Milionen Zuschauer, das enspricht einem Marktanteil von 17,3 Prozent, sahen die Neuverfilmumg des Romans von Bruno Apitz zum 70.Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald.
In der Doku im Anschluss „Buchenwald. Heldenmythos und Lagerwirklichkeit“ informierten sich 4,47 Millionen (MA 15,6 %) über die historischen Hintergründe. Bei den jüngeren Zuschauern (14 bis 49 Jahre) lag der Marktanteil für den Film bei 13,1 % (1,42 Millionen).“
Quelle: ARDtext, S. 422 v. 2.4.15
Brucks Schicksal ist das vieler Tausender in der Kriegsendphase. Dazu: Ulrich Sander „Mörderisches Finale“: http://shop.papyrossa.de/epages/26606d05-ee0e-4961-b7af-7c5ca222edb7.sf/de_DE/?ObjectPath=%2FShops%2F26606d05-ee0e-4961-b7af-7c5ca222edb7%2FProducts%2F388-6
„Am 07.11.2006 fand die feierliche Enthüllung bzw. Übergabe der Gedenktafel für den Obersteiger Ignaz Bruck auf dem Klafelder Markt statt. …..“ – s. http://www.detlef-rujanski.de/Archiv/RujanskiAktiv/Frameset_Bilder/Bilder.htm
Das ist ein schiweriges Rätsel, nur die Antwort auf die 1 Frage ist leicht: das Bild zeigt Gerber bei ihrem Tun. Die 2. Frage, wie siwiarchiv darauf aufmerksam wurde, rate ich mal: vielleicht in den eigenen Archiven? Das Siegerland, hab‘ ich gegoogelt (bin nicht von dort), hatte florierende Gerbereigewerbe. Die 3. Frage ist (nicht nur wg. der Grammatik:-) insofern verwirrend, als sie mich auf die 2. Frage zurückweist: das gezeigte Foto mit der Darstellung der Gerber war also an einem Ort aufgenommen, den’s nicht mehr gibt? Einer nicht mehr existierenden Gerberei? Google sagt, dass man in Hilchenbach die Gerberei schloss und die zugehörige Villa abgerissen habe. Eine andere Seite zeigt ein noch verbliebenes Gebäude. Ist so etwas gemeint?
http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/bestand.jsp?archivNr=4&tektId=3
http://www.ahlering.de/Gerberei/gerberei.html
(naja, irgendwer muss ja anfangen mit den falschen Antworten…:-)
Danke für Ihren Mut, den Eisbrecher zu geben! Die Beantwortung der ersten Frage ist natürlich korrekt. Allerdings sind sowohl die zweite wie auch die dritte Frage nicht richtig beantwortet. Um die Antwort zur zweiten Frage zu finden, müssen Sie nicht googlen. ;-) Die dritte Frage verlangt einen Spaziergang durch einen der Orte des Siegerlandes mit entsprechender Lederindustrie – s. schon hier: http://archiv.twoday.net/stories/1022414157/#1022415010 .
P.S.: Ich hätte mir gewünscht, daß Sie meinen Fehler in der dritten Frage als Flüchtigkeitsfehler gewertet hätten. :-)
Vielleicht kam’s ja im Film http://www.siwiarchiv.de/?p=7608 vor. Aber Rätsel, deren Antwort sich nicht sicher nachweisen lässt, machen irgendwie keinen Spaß. „Wie wurde siwiarchiv auf das Objekt aufmerksam?“ kann man nicht beantworten. Beim Spazierengehen? Wäre auch eine Antwort, die man als Mitrater nicht falsifizieren könnte.
Ja, das Bild zeigt Gerber, und zwar wohl beim Entfleischen der Häute. Das ist eine ganz klassische Darstellung des Gewerbes, siehe z. B. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Balthasar_Behem_Codex_Tanner.jpg
Mich erfreuen solche Wandbilder immer wieder und ich finde es schade, dass diese Kunstform seit den 1970er Jahren so gut wie ausgestorben ist. Viele davon werden zur Zeit bei Renovierungen und Abbrucharbeiten zerstört (dieses hier z. B.: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ravensburg_Seestra%C3%9Fe_Wandgem%C3%A4lde_Maurer.jpg ) . Ich möchte daher dazu aufrufen, die Wandmalereien und Sgraffito-Werke an den Handwerksbetrieben und auch Wohnbauten des 20. Jh. zu fotografieren und zu dokumentieren, etwa bei den Wikimedia Commons. Die Werke unterliegen der Panoramafreiheit und sind daher urheberrechtlich unproblematisch zu veröffentlichen.
@APraefcke Gratulation! Die zweite Frage ist nun auch schon richtig beantwortet. Ich hatte eigentlich gehofft, dass einer der ca. 40 Besucher der Filmveranstaltung sich am Rätsel beteiligt. Übrigens, handelte es sich bei dem Film um eine Produktion für die FWU, so dass eine verschwindend geringe Möglichkeit besteht, dass man den Film gesehen hat. Ach, das ist Unsinn. ;-)
Die Dokumentation von Kunst am Bau in den 50er bzw. 60er Jahren – somit auch der Sgraffito-Werke – wird gerade in der Stadt Siegen aktuell gepflegt. Ihre Anregung werde ich gerne weiterleiten.
Übrigens im oben erwähnten Film sah das Kunstwerk noch so aus:
 aus: Film „Lederherstellung im Siegerland“ (Heinz Dörr, Siegen-Kaan, 1950).
aus: Film „Lederherstellung im Siegerland“ (Heinz Dörr, Siegen-Kaan, 1950).
Ei, ein Wink mit dem Zaunpfahl? Ich sollte vielleicht Ihren Site mal etwas genauer studieren?:-) Ein Spaziergang ist mir leider nicht vergönnt…
(„sowohl…als(!) auch“ benötigt den Plural…:-p)
@FeliNo Sie haben tatsächlich noch eine Chance. Sie müssen nur an der richtigen Stelle im Netz suchen – dort, wo man sich in Gruppen gerne alte Bilder der eigenen Kommune ansieht …… Jetzt winke ich gerade mit einem Siegerländer Hauberg.
Bei den US-Truppen wurden die Ereignisse zweifach festgehalten.
Zunächst wurde während der Kampfhandlungen gefilmt. Anschließend gab es die gleichen Szenen „schauspielerisch“ nachgestellt. Dies konnte man der Heimat besser zeigen. Die Aufnahmen zeigen die zweite Variante.
Das Kunstwerk ist an der westlichen Giebelseite des Hauses Flurenwende 12 in Siegen zu betrachten.
Gratulation! Diese Antwort ist korrekt: Foto: Chr. Br.
Foto: Chr. Br.
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 25.3. – 7.4.15 | siwiarchiv.de
Ich habe gute Erfahrung mit einer Schulung „Die Vereinschronik“, ursprünglich für die Schriftführerinnen des Frauenbundes, dann geöffnet für andere, auch nichtkirchliche Vereine. Dabei geht es um praktische, handefeste Fragen (Welches Material, wie lege ich Beilagen ab, Leitzordner oder Band, Folien mit Weichmacher zum „Schutz“ der wertvollen Stücke, etc.) und um Inhaltliches.
Pingback: Achim Heinz, Neunkirchen: Lesung aus seinem Roman „Tagesbrüche“ | siwiarchiv.de
Passend dazu: „Vor 70 Jahren haben die Allierten das Siegerland erobert. Auch die Zwangsarbeiter wurden befreit. Allein in Dreis-Tiefenbach arbeiteten während des Zweiten Weltkriegs mehr als 1.000 Menschen unter anderem aus Russland, England und Frankreich. Sie wurden zum Beispiel bei der Siegener Eisenbahnbedarf eingesetzt – heute Bombardier. Die 94-jährige Hedwig Wilhelm arbeitete damals dort im Lohnbüro und erinnert sich: „Hier hatten die Wachleute abends auf dem Rückweg einen erschossenen Zwangsarbeiter hingelegt und den sollten wir uns angucken. Sie sagten, das ist das Resultat, weil sie geklaut haben. Aber die hatten sich nur gebückt, um was Essbares, vielleicht eine Kartoffel oder ein Stück Brot aufzuheben, und dann wurden sie erschossen.“ 16 russische Zwangsarbeiter und 17 Kinder sind auf dem Friedhof in Dreis-Tiefenbach beerdigt. Die meisten starben an Unterernährung.“
Quelle: WDR Studio Siegen Nachrichten v. 8.4.2015
Pingback: Ausstellung “Historische Momente ganz groß” | siwiarchiv.de
Danke für den Hinweis!
Wiederum offensichtlich ein erschreckendes Beispiel für sensationalistisches, journalisierendes Geschichtenerzählen anstelle einer analytischen, professionellen Zugangsweise, die für die Geschichtsschreibung um diesen Ort besonders charakteristisch ist, nachdem bislang ernsthafte, kontextualisierende Forschung zur politischen Schulung in der NSDAP stark vernachlässigt worden ist und auf der anderen Seite die journalistische Lieblingsquelle schlechthin, die Zeitzeugenerzählungen, das Geschichtsbild bestimmen. Ein Beispiel, das auch in diesem Film bemüht wird, ist die Legende, wonach in den Luftschutzbunkern NS-Raubgut aus den besetzten Gebieten gelagert worden sei, weil diese Zeitzeugen berichten, dass ihnen dessen Zutritt bei Luftangriffen verwehrt worden sei – das ist auch Thema in einem sehr schlechten, epigonalen „Eifelkrimi“ des Journalisten Stefan Everling („Totenvogelsang“). Demgegenüber muss ich nach mehreren wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu diesem Thema (z.B. in der Zeitschrift „Geschichte in Köln“ 54, 2007 und 56, 2009 sowie zur Schulung in Band 25 der Jahresschrift des Geschichtsvereins des Kreises Euskirchen, ISBN 978-3-941037-83-0) und der Einsicht in alle archivalischen Quellen zu den Ordensburgen selbst sowie u.a. des Einsatzstabes Rosenberg (BAB NS 30 etc., Staatsarchiv Kiew, National Archives Washington etc.) feststellen, dass diese Geschichten bestenfalls Legenden sind, weil sich für diese Zeitzeugen-Erzählungen kein archivalischer Beweis erbringen lässt. Sie werden allerdings – horribile dictu – von den für die Konversion Vogelsangs Verantwortlichen der „Vogelsang ip“ selbst auch noch unterstützt: ein dort angelegtes sog. Archiv – zu dem ich selbst beigesteuert habe – ist für die Forschung nicht nutzbar, und eigene Forschung findet nicht statt, während Fernsehsendungen und Zeitungs-Berichterstattung wie dieses Produkt gefördert werden. Ergebnis: solche Sendungen müssen mit äußerst kritischem Auge und sehr wachem Gehirn wahrgenommen werden.
Pingback: Vereinsarchiv-Vortrag online | siwiarchiv.de
Super Präsentation, damit lässt sich gut arbeiten. Danke dafür! Aber: Für „Eingeweihte“ erschließt sich die Präsentation. Für Vereinsvertreter bedarf es neben der Präsentation aber auch vollständig ausformulierter Sätze. Sonst bleibt einiges unverständlich. Schließlich betritt der/die ehrenamtliche Vereinsarchivar/-archivarin in der Regel Neuland.
Daher meine Frage: Wird der Vortrag auch als Textfassung publiziert, und wenn ja: wo? Es ist ja ein allgemeines Problem, und es wäre schön, wenn die Nachnutzung des Artikels über den Verweis auf eine ausführliche Darstellung in siwiarchiv möglich wäre (das würde dann nämlich einerseits alle betroffenen Kommunalarchive mit ähnlichem Aufklärungsanspruch deutlich entlasten und über die positiven Auswirkungen an Klicks auf siwiarchiv würde ich mich nicht wundern).
Vielen Dank für das Kompliment! Bei Präsentationen für Vorträge verzichte ich gerne auf ausformulierte Sätze. Meine Vorträge sind immer „tagesformabhängig“, so dass ich bisher noch nicht an eine Ausformulierung gedacht habe. Ihre Anregung werde ich mir aber gerne durch den Kopf gehen lassen.
Auf 2 weitere Links zum Themenkomplex möchte ich noch hinweisen:
– http://www.vibss.de/vereinsentwicklung/lebendiges-vereinsarchiv/sinn-und-zweck-eines-lebendigen-vereinsarchivs/
– http://de.slideshare.net/StadtASpeyer/grundlagen-der-archivierung .
Pingback: VdA: Sitzung der Expertengruppe Öffentlichkeitsarbeit und Social Media | siwiarchiv.de
Vielen Dank für die Präsentation, habe einige neue Eindrücke mitnehmen können. Sehr hilfreich für anstehende und neue Aufgaben.
Volker Greis
Pingback: Vortrag “Provinz im Aufbruch. Siegens vergessene Kulturgeschichte” | siwiarchiv.de
Pingback: Heute vor 51 Jahren: August Sander (1876-1964) | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 8.4.15 – 21.4.15 | siwiarchiv.de
Pingback: Denkmalschutz contra Abriss beim Siegener Hochhaus | siwiarchiv.de
s. a. Siegerlandkurier, 24.4.2015: http://www.siegerlandkurier.de/kultur/ein-schatz-aus-zelluloid/
s. a. Westfälische Rundschau v. 27.4.2015: http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-bad-berleburg-bad-laasphe-und-erndtebrueck/ueber-den-ersten-weltkrieg-id10611001.html
Auf diese Broschüre mit Hinweisen zur Geschichte des Landesstraßenbauverwaltung in diesem Gebäude sei verwiesen:

eine aktuelle Ergänzung zu dem Blogeintrag vom 16. April 2015: http://www.rundschau-online.de/eifelland/3-4-millionen-euro-mehrkosten-in-schleiden-forum-vogelsang-wird-noch-teurer—eroeffnung-erneut-verschoben,16064602,30547684.html?dmcid=sm_fb . Das Ausmaß an Peinlichkeiten und Fehlplanungen rund um diese Konversion wird unerträglich.
Sehr geehrte Damen und Herren,
da der unter http://www.siwiarchiv.de/?p=7855 als pdf eingestellte Titel nicht im regulären Buchhandel erschienen ist, rege ich an, dass Sie trotzdem Pflichtexemplare an die Deutsche Nationalbibliothek und an die für Sie zuständige Bibliothek in NRW senden; vielleicht sogar auch an die Staatsbibliothek Berlin oder andere Fachbibliotheken.
Darüber hinaus sind die obigen Titelangaben irreführend, schon allein, weil der eigentliche Verfasser des Manuskripts gar nicht angegeben ist. Ich vermute, dass man in der Behörde Vorort den Vornamen des „Oberregierungs- und Baurat a.D. Meyer“ (vgl. S. 4) noch recherchieren kann. Dann könnte der Titel auf Ihrer Homepage lauten:
### Meyer: Chronik der Wasserwirtschaftsverwaltung 1859-1952. Von der meliorationstechnischen Planstelle beim Oberpräsidium in Münster zum Wasserwirtschaftsamt Münster. Bearbeitet von Dietrich Schedensack. Münster: Staatliches Umweltamt Münster 1995.
Mit freundlichem Gruß, Helker Pflug.
Vielen Dank für den berechtigten Hinweis! Die Broschüre wurde vom Landesarchiv NRW, Abt. Westfalen, online gestellt, so dass ich mir erlaube, Ihren Hinweis in der kommenden Woche dorthin weiterzuleiten.
Das komplette Siegener Programm zum 70. Jahrestag der Befreiung finden Sie hier: http://befreiungwassonst.blogsport.de/
Dienstag, 05.05.2015 um 18:00 Uhr geht es im Unteren Schloß, Raum: US-F 103, los mit dem Vortrag „Oradour hat keine Frauen mehr…/ Oradour hat keine Kinder mehr…“ – Zur Geschichte eines Massakers mit Florence Hervé.
Auch Absagen können im Netz veröffentlicht werden! Gerne hätte der Besucher einen früheren Hinweis auf den Ausfall der Veranstaltung gefunden und nicht erst an der Tür des endlich gefundenen Vortragsraums, der sich nicht wie angekündigt im Unteren Schloss fand! Oder wollte die akademische Linke unter sich bleiben?
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 22.4.15 – 4.5.15 | siwiarchiv.de
Pingback: Erfolgreicher Vortrag zur Entwicklung Obersdorfs | siwiarchiv.de
Es sollte aber gesagt werden, daß dieses Digitalisat ledglich ein Abdruck der „Jugend“ von Jung-Stilling ist, und dazu natürlich in Frakturschrift.
>>> Die *vollständige* Lebensgeschichte in kritischer Ausgabe, besorgt von Gustav Adolf Benrath, erschien bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, Darmstadt in Antiquaschrift.
Eine neben der von Jung-Stilling selbst geschriebenen Texte auch viele andere Quellen auswertende Biographie mit vielen Abbildungen und Registern erschien zuletzt 2014 im Verlag der Jung-Stilling-Gesellschaft Siegen. Der Titel: „Jung-Stilling. Ein Umriß seines Lebens“. Verfasser ist der Siegener Jung-Stilling-Experte Gerhard Merk.
Danke für die Information!
Lieber Ludwig Burwitz,
der Kommentar trifft mich in der Tonart sehr hart. Muss ich leider gestehe. Unter diesem Eintrag ist er zudem auch noch falsch platziert, denn Ulrich Sander hat gesprochen. Sehr kurzfristig ausfallen wegen des Streiks der GDL (mit dem sämtliche VeranstalterInnen solidarisch sind) ist der Vortrag von Florence Hervé. Ich persönlich bedaure dies auch sehr. Versprochen wurde jedoch ein Nacholtermin, der auch wieder öffentlich angekündigt wird. Voraussichtlich der 19.05. am selben Ort. Die VeranstalterInnen verfügen nicht wie andere, etwa gewisse Verbände, Vereine, Instituationen und Parteien, über einen hauptmatlichen Apparat und viele sind berufstätig. Wenn also am frühen Nachmittag eine Absage kommt, kann nur im begrenzten Rahmen reagiert werden. In diesem wurde aber reagiert. In den Veranstaltungsblog konnte jedoch kein Eintrag mehr erfolgen. Das bedauern wir sehr. Daraus abzuleiten, die VeranstalterInnen hätten unter sich bleiben wollen ist geradzu absurd. Von den Medien bis auf eine Ausnahme wurde die Veranstaltungsreihe komplett ignoriert. Eine einzelne Veranstaltungsangkündigung wäre gesendet worden, aber die betraf ausgerechnet die Abgesagte. Nachberichterstattung über keine einzige. Mir kann etwas durchgegangen sein, dann möge man mich korrigieren. „Befreiung! Was sonst!“ War und ist auch durch die beiden noch ausstehenden Veranstaltungen des AStA und des autonomen Fraunreferats ein bemerkenswerter Beitrag zum 70. Jahrestag der Befreiung. Den haben andere hier nicht auf die Kette bekommen und können sie sicher auch nicht trotz hohem Einsatz von öffentlichen Geldern. Dies beweisen die im Bündnis vertretenen Gruppen an anderer Stelle ebenfalls von den Medien und somit weiten Teilen der Bevölkerung immer wieder. Dies ist meine feste Überzeugung. Nichts für ungut! Freundschaft!
Danke für die klarstellenden Worte!
Gern geschehen. Leider ist mir nach einem wieder einmal langen Tag in puncto Rechtschreibung einiges schief gegangen. Ich bitte dies zu entschuldigen. ;-)
Lieber Joe Mertens!
Zugegeben: Die Tonart ist etwas hart geraten, vielleicht zu hart. Spricht aber vielleicht für meine Enttäuschung und meine Erwartungshaltung an die ausgefallene Veranstaltung. Solltest Du dich persönlich getroffen fühlen, dann entschuldige ich mich. Aber: Meine Kritik war keineswegs falsch platziert, sondern direkt im Anschluss an Deine Ankündigung der dann ausgefallenen Veranstaltung. Und: Ich habe nicht aus der fehlenden Information im Veranstaltungsblog abgeleitet, „die VeranstalterInnen hätten unter sich bleiben wollen“, sondern diese Kritik bezog sich allein auf die völlig irreführende Angabe des Veranstaltungsortes: Wir (immerhin zwei Personen) waren nicht die einzigen, die kurz vor 18 Uhr Deinen Veranstaltungshinweis („geht es [los] im Unteren Schloß“) ernstnehmend über den Schlossplatz irrten und auch an Eingangstür des schließlich gefundenen ehemaligen Krankenhauses keinen Hinweis auf die Veranstaltung oder den Ort fanden. Das war mehr als merkwürdig!
So weit meine „klarstellenden Worte“! Für alles Weitere brauchen wir nicht die öffentliche Bühne. Schließe mich an: Nichts für ungut! Freundschaft!
Pingback: Gedenkstein für Hedwig Jung-Danielewicz | siwiarchiv.de
Es war wirklich eine gelungene Enthüllung des Gedenksteins.
Die Gedenktafel ist mit einem schönen Bild von Frau Danielewicz gut
gestaltet.
Der Text weist jedoch schwächen auf, so heist es auf der Gedenktafel
“ Sie wurde ihrer Herkunft wegen ausgegrenzt, verfolgt…“
Frau Danielewicz stammte aus Berlin, das war aber nicht der Grund für ihre
Ermordung.
Da wollte die Gemeinde Wilnsdorf wohl das Richtige schreiben, hat es aber nicht geschafft.
Einen bittern Beigeschmack hat die Einweihung des Gedenksteins dadurch
erhalten, dass vor einigen Wochen das Grab von Karl Jung-Dörfler auf dem Rödgener Friedhof eingeebnet wurde.
Dieses Grab war auch als letzte Ruhestätte von Frau Danielewicz vorgesehen, wenn sie nicht im Minsker Ghetto ermordet worden wäre.
Nach Auskunft der Gemeinde Wilnsdorf ist der Grabstein gesichert und soll
an anderer Stelle des Friedhofs aufgestellt werden.
Denkmalschutz an Ort und Stelle wäre hier angebracht gewesen!
Also, die Ankündigung von siwiarchiv bezog sich auf “Verbrechen der Wirtschaft“
Referent: Uli Sander, Bundessprecher der VVN-BdA
Mittwoch, 06.05.2015 um 19:30 Uhr, VEB Siegen
Der hat wie geplant stattgefunden. Ich habe das komplette Programm drunter gepostet. Und Auftakt wäre gewesen: „Oradour hat keine Frauen mehr…/ Oradour hat keine Kinder mehr…“ – Zur Geschichte eines Massakers
Referentin: Florence Hervé. Dienstag, 05.05.2015 um 18:00 Uhr im Unteren Schloß, Raum: US-F 103. Der musste aber ausfallen.
NACHHOLTERMIN STEHT NUN ABER FEST: Dienstag, 19.05.um 18:00 Uhr im Raum US-F 103 (Campus Unteres Schloss/ Kohlbettstr. 115)
Alles gut! ;-)
In der Westfälischen Rundschau v. 13.5..2015 findet sich ein Leserbrief zur Veranstaltung: http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/einer-blieb-ungenannt-aimp-id10667010.html .
Pingback: Vitrinenausstellung zu Ehrenmalen in Siegen | siwiarchiv.de
Es ist eine Schande, daß die alten Bücher auch als Digitalisat relativ wertlos sind, weil (nach Umfragen) keine 3% (!!!) der Deutschen Frakturchrift lesen können.
1) Ob digitalisierte ältere Bücher tatsächlich angesichts der Frakturschrift eine Schande darstellen, bleibt jedem selbst überlassen. Allerdings ist die Wertlosigkeit tatsächlich relativ, da man online sich sehr schnell mit der Frakturschrift vertraut machen kann. Hier als Beispiel: http://www.suetterlinschrift.de/index.html.
2) Die „Umfragen“ hätte ich gerne präzisiert. Im Netz findet sich diese Diskussion im Herbst 2013. Vielen Dank vorab!
Wer diese Bücher nutzt, lernt die Fraktur. Im Gegensatz zu Kurrentschriften (Handschrift), bei der tatsächlich immer häufiger eine Notwendigkeit zur Transskription vorhanden ist, besteht meines Erachtens bei der Fraktur kein erhebliches Problem. Auch unsere studentischen Hilfskräfte erlernen sie in wenigen Stunden, sobald sie die Kenntnis benötigen.
sollte jemand tatsächlich ernsthafte schwierigkeiten mit druckfraktur haben: in jeder grösseren bibliothek gibt es klassiker und andere literarische texte in fraktur- und in antiquaausgaben. üben.
Frakturschrift ist ein Überbegriff.
Es gibt eine Reihe von einzelnen Schriften, die heute tatsächlich nur von Fachleuten gelesen werden können.
Als Erbstück besitze ich noch das „Lehrbuch der Landwirthschaft“ von Jung-Stilling.
Hier sind auch die einzelnen Zeilen auf jeder Seite so eng aneinander gerückt, daß die Serifen und Haken der Großbuchstaben einer Zeile in die nächste hineinragen.
Hier hilf auch eine Lupe wenig.
Nebenbei: dieses in verschiedener Hinsicht wichtige Lehrbuch hat der Siegener Jung-Stilling-Biograph Professor Merk ebenfalls neu in Antiquaschrift herausgegeben und mit Register versehen.
Ich hatte ja bereits auf den Wikipedia-Eintrag zur Frakturschrift hingewiesen. In der Tat existiert diese Schrift schon lange und mit unterschiedlichen Ausprägungen. siwiarchiv hat in letzter Zeit allerdings nur auf Werke aus dem beginnenden 20. Jahrhundert hingewiesen, die in der Regel nicht die Problematik aufweisen, wie Sie sie für das Werk Jung-Stillings aus dem Jahr 1783 beschreiben.
Fraktur lernen mit Wilhelm Busch – ist ein weiteres Online Angebot: http://www.lyrikheute.com/2013/05/fraktur-lernen-mit-wilhelm-busch.html . Auch auf der folgenden Seite finden sich Leseübungen für die gedruckte Frakturschrift: http://www.familienkunde.at/Alte_Schriften.htm .
Die erinnerungskulturelle Perspektive für Vertriebenendenkmäler beschreibt Scholz mit deutlichem Bezug zur Siegener Diskussion (Link s. Eintrag) wie folgt (S. 373):
“ …. Neben der bloßen Historisierung von Vertriebenendenkmälern besteht jedoch auch die Möglichkeit, sie als gültige symbolische Systeme gegenwärtiger historischer Selbstverständigung, aktueller Positionsbestimmung und prospektiver Zukunftsentwürfe zu begreifen. Das würde auf lokaler Ebene eine aktive Auseinandersetzung sowohl mit den existierenden Denkmälern und deren Entstehungs- und Nutzungsgeschichten als auch mit den heutigen Grundwerten und dem historischen Selbstverständnis der Gesellschaft nötig machen. Ein solcher Verständigungsprozess könnte darin münden, vorhandene Denkmäler nicht nur schriftlich zu kommentieren, sondern künstlerisch zu ergänzen oder umzugestalten. Vertriebenendenkmäler könnten so zu Ausgangspunkten der Reflexion über die spezifisch deutsche Verknüpfung von Täter- und Opfergeschichte und die darauf basierende besondere Erinnerungsgeschichte oder gar über die allgemeine Bedeutung von (erzwungener) Migration in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft werden.“
Auch der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen ist mit dem Archivgesetz zufrieden:
“ …. Die Evaluation des ArchivG NRW, die im Jahr 2014 anstand, ist dagegen ein gelungenes Beispiel für die rechtzeitige und umfassende Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Belange. Nachdem das Kulturministerium NRW in seiner Vorprüfung festgestellt hatte, dass die geplanten Änderungen möglicherweise den Datenschutz berühren
könnten, wurde ich frühzeitig beteiligt und um Stellungnahme gebeten. Erfreulicherweise wurden meine Ausführungen (abzurufen unter http://www.ldi.nrw.de) im Weiteren berücksichtigt, so dass die Novellierung des ArchivG NRW letztlich zu keinen Einschränkungen des Datenschutzes führte.
Auch bei der Verarbeitung von Archivdaten ist sorgfältig darauf zu achten, ob Datenschutzbelange betroffener Personen berührt sein könnten. Je frühzeitiger derartige Überlegungen im Rahmen eines Projekts berücksichtigt werden, desto besser.“
Quelle: Datenschutz und Informationsfreiheit. Bericht 2015, S. 91
Vermutlich ist folgender Hinweis bekannt:
“ …. 10. August. Bey dem gestrigen Gewitter hat ein zündender Blitzstrahl das Dorff Freudenberg gantz in Asche gelegt. Es sind auff den Lärmenstreich viel Leuth auß vnserm Ambt herüber gemacht/ aber nichts mehr helffen können vnd nur ein Hauß am Seelbachs Weiher verschonet ist. Alß von denen Hintergegangenen die Mär hier verbreitet worden/ sofort jeder etwas an Victualien und Kleydung gegeben/vmb dem Elend in etwas zu steuern. Wird jeder ein hertzlich Mitleyden mit den Verbranten haben. Der allmächtige Gott verhelff ihnen vor dem Winter zu einem Unterkommen vnd verschon vns gnädig mit so harter straf. ….“
aus: Hermann Engelbert: Hinterhüttsche Chronik, Kreuztal 1994, S. 131
Die Hinterhüttische Chronik ist trotz der Anmutung kein Zeitzeugenbericht.
Stimmt! Allerdings scheint sich Gustav Siebels „Zur Geschichte der Stadt Freudenberg“, in: Wilhelm Güthling: Freudenberg in Verrgangenheit und Gegenwart. Festbuch zur 500. Wiederkehr der Bestätigung städtischer Rechte für Freudenberg, Freudenberg 1956, S. 69-70, auf eine ähnliche lautende Quelle zu beziehen.
Engelbert hat öfter auf tatsächlich vorhandene Quellen zurück gegriffen. Für das 18. Jahrhundert hat er beispielsweise Texte aus den Dillenburger Intelligenznachrichten genutzt. Der Freudenberger Text von Engelbert wird sicherlich irgendwo seinen tatsächlichen Ursprung haben. Leider sehr ärgerlich, dass Engelbert keine Quellenangaben gemacht hat.
Nachtrag: Noch näher am Text von Engelbert als Siebel ist Karl Sterzenbach in seiner Geschichte der Stadt Freudenberg, Freudenberg 1908, S. 20.
Heinrich von Achenbach berichtet folgendes: “ …. Aus Nachrichten in siegen´schen Chroniken ist bekannt, daß 1666 am 10. August Freudenberg in Folge eines Blitzschlages abbrannte. ….“ (Quelle: Geschichte der Stadt Siegen, Teil IX Geschichte der Stadt Siegen vom Jahre 1653 bis 1700, Siegen 1894, S. 24, Digitalisat) . Dann gilt es wohl diese Chroniken zu finden, evt. Johannes Textor von Haiger, Nassauische Chronik, 2. Ausgabe: Wetzlar 1712 ……
Die Textor-Ausgabe aus dem Jahr 1712 liegt digitalisiert in München vor und kann online eingesehen. Beim ersten kursorischen Drüberlesen bin ich nicht fündig geworden.
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 5.5.15 – 18.5.15 | siwiarchiv.de
Kurzer Bericht (natürlich auch nicht aus erster Hand) über den Brand im „lustige[n] Flecken Freudenberg“ in: Theatri Europaei Zehender Theil, Frankfurt a. M. 1703, S. 445.
Vielen Dank! Die Existenz dieses Buches war mir völlig unbekannt.
Liebe Klementine, nett wäre auch der Link zum Buch auf google books gewesen.
Der Text der Nassauischen Chronik von Textor 1712 ist nur eine Neuauflage. Er ist leider keine Fortschreibung der Chronik von 1617.
Übrigens der Vollständigkeit halber: Steinseifer nennt folgende Quellen zum Standtbrand 1666:
1) 3 Hausinschriften
2) Siegener „Protocolum deß Extraordninari-Allmoßen-Kosten“ v. 6.9.1666
3) Siegener Kastenrechnung von 1666/67
4) Freudenberger Kirchen- und Kastenrechnung von 1669/70
5) Privilegienbrief von Fürst Johann Moritz v. 1.5.1687
6) Inventarverzeichnis der Ev. Kirchengemeinde Freudenberg v. 18.2.1695
aus: Bernd Steinseifer (Hrsg.): Freudenberg. Beiträge zur Geschichte der Stadt und des frühreren Amtes, Kreuztal 2006, S. 155-156.
Theatri Europaei Zehender Theil sagt 1m Jahre 1703:
in Freudenberg brannten im Jahr 1666 immerhin 71 Häuser und
25 Scheunen nieder.
Ist Friedrich Grosse-Dresselhaus: [Siegerländer] Feuersbrünste in alter Zeit, in: Heimatland 1929, S. 63-64 bekannt ?
Der Freudenberger Stadtbrand wird hier nicht erwähnt. Lediglich der Stadtbrand von Hilchenbach im Juli 1689 (60 Wohnhäuser, Kirche, Pfarrhaus, Schule) und der Stadtbrand von Siegen im April 1695 werden behandelt. Allerdings hat man in beiden Fällen den Kurfürst von Brandenburg um Hilfe in Form einer Genehmigung von Sammlungen gebeten. Im Siegener Fall ist sogar Sammelliste aus der Grafschaft Ravensberg erhalten. Vielleicht hat Johann Moritz ja auch um entsprechende Hilfe gebeten?
Hier ein Link zum Bild des Gedichtes, das in der Freudenberg Kirche hängt, auf ein großformatiges Holzbrett gepinselt, früher direkt auf die Wand geschrieben (Fragmente noch unter der heutigen Farbschicht erhalten).
Hm, Link klappt nicht, weil am Ende „.jpg“ abgeschnitten wird. Bitte per Hand in URL hinzufügen.
Vielen Dank für den Link, der jetzt direkt aufgerufen werden kann! Problem waren wohl die Klammern.
Pingback: 9. Juni – Internationaler Archivtag | siwiarchiv.de
Pingback: Vortragsreihe „Historische Standuhren“ wird fortgesetzt | siwiarchiv.de
Gibt es eventuell eine Beischreibung im Geburtenregister 1882 des Standesamtes Siegen, die auf die Beurkundung des Todes verweist? Sollte sich im StadtA Siegen klären lassen…
Dieser Aufforderung kommt das Stadtarchiv Siegen natürlich gerne nach. Leider kein Hinweis auf das Sterbedatum. Dafür einige andere Erkenntnisse (wesentliche und unwesentliche): Beruf des Vaters „Locomotivheizer“, Mutter „geborene Wienand“, Name des Jungen „Robert Christian Heinrich“ laut Nachtrag vom 11.09.1882; also ohne Oscar, der muss später dazugekommen sein.
Im Sterbeeintrag der Ehefrau Gabriele Anna Glashoff geb. Grau (Stadtarchiv München, Standesamt München IV 1399/1948) ist folgender Vermerk angebracht: „Ehemann + September 1946 in Degerndorf, Kreis Wolfratshausen“.
Degerndorf liegt heute in der Gemeinde Münsing, vielleicht lässt sich dort das genaue Sterbedatum feststellen.
Die Witwe wohnte laut Sterbeeintrag zuletzt in „Aufhofen, Kreis Wolfratshausen“ (heute Gemeinde Egling), verstarb jedoch in München.
Danke fürs nochmalige Nachschauen! Anfrage in Münsing läuft ……
Anfrage bei der Gemeinde Münsing verlief ebenso erfolglos, wie die von dort angeregte Anfrage an die Gemeinde Brannenburg wegen deren Ortsteil Degerndorf.
Nachtrag: Die Geburtsurkunde Jüchen Nr. 35/1881 weist als Eltern Schreys den evangelischen Lehrer Gerhard Schrey und Johanna Auguste geb. Steinfartz aus. Danke an das Gemeindearchiv Jüchen!
Das Universitätsarchiv München wies heute via E-Mail auf die online verfügbaren, im Druck erschienenen Personal- und Studentenverzeichnisse (1826-1946) hin. Die daraufhin erfolgte Durchsicht der Jahrgänge 1903 bis 1907 verlief erfolglos.
Das New Yorker Stadtarchiv verweist in seiner E-Mail vom 29.5.2015 auf die online verfügbaren Datenbanken der German Genealogy Group. Die beiden, wohl einschlägigen Datenbanken zum Ausländerwesen enthalten keine Hinweise auf Achenbach.
Auskunft des Landesarchivs Berlin vom 1.6.2015: In der Einwohnermeldekartei konnte Oscar Robert Achenbach nicht ermittelt werden. Die Berliner Adressbücher sind im Internet verfügbar: http://digital.zlb.de/viewer/sites/collection-berlin-adresses/. Die Suche in den in Frage kommenden Jahrgängewn 1930 und 1931 verlief erfolglos.
Pingback: Quellenkundlicher Workshop zum Thema „Rechnungen“ | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 19.5. – 1.6.2015 | siwiarchiv.de
Pingback: 25 Jahre Radio Siegen | siwiarchiv.de
Eine Durchsicht der Adressbücher für die Stadt Siegen aus den Jahren 1902/03 und 1907/08 ergab, dass Achenbachs Vater in der Siegener Sandstr. 63 wohnte, so dass angenommen werden kann, dass Oscar Robert Achenbach 1905 von München aus nach dort zurückkehrte. In der Siegener Straßenkartei fehlte leider die Nr. 63 der Sandstr..
Pingback: Günter Dick (St. Augustin): Luftschiff LZ 37 über Gent zerstört | siwiarchiv.de
Mr. Dick war nicht bei der Einweihung anwesend. Die Gedenktafel , wie er fälschlicherweise erklärt auf Initiative der Stad Gent gamacht würde aber auf Initiative des Direktors des Westfriedhof Rudy D’Hooghe und ich gemacht würde. Ebenso haben wir die Wiederherstellung der beiden Grafen von Vander Haegen und Ackermann gewährleistet. Seit Jahren haben Frederik Vanderstraeten und ich selbst die Initiative ergriffen die Erinnerung an dieses Ereignis, am Leben in unsere verschiedenen Veröffentlichungen zu halten
– Vanderstraeten Frederik, Luchtschip ontploft boven Gent, Heemkundige Kring De Oost-Oudburg vzw, Deel I in Jaarboek XXXVI, 1999 – Deel II in Jaarboek XL, 2003
– Vanderstraeten Frederik & Dhanens Piet, Luchtschip ontploft boven Gent, uitg. in eigen beheer van de heemkundige kring De Oost-Oudburg, Gent, 2011
– Dhanens Piet i.s.m. De Decker Cynrik, De Zeppelins van Gontrode en
Sint-Amandsberg, in Een eeuw luchtvaart boven Gent, Deel I 1785 – 1939,
Uitgeverij Flying Pencil, Erembodegem, 2008, blz 88 – 114
Freundliche Grüsse
P Dhanens, Gent ( Belgien)
Vielen Dank für die (Literatur-)Hinweise, die hier nicht im Blick waren!
In der Siegener Zeitung vom 6.6.2015 ergänzt die Reaktion der Seite „Heimatland“ den Beitrag Günter Dicks um den Hinweis auf den Nachruf auf Otto von der Haegen in der Siegener Zeitung vom 8. Juni 1915. Der Nachruf weist u. a. auf die Luftschifffahrten von der Haegens hin.
Pingback: Sitzungssaal des Siegener Kreistages (1955) | siwiarchiv.de
Happy International Archives Day! Das Stadtarchiv Greven hat sich ebenfalls beteiligt und das Thema „Demokratie“ aufgegriffen.
Pingback: Video-Vortrag „Kein deutscher Lawrence. | siwiarchiv.de
Der Internationale Archivrat bedankt sich via Facebook bei allen Teilnehmer: „Vielen Dank Archivare aus aller Welt!
International Archives Tag #IAD15 war ein Riesenerfolg „smile“-Emoticon
810 Elemente im Portfolio auf der Webseite http://www.internationalarchivesday.org
510 Einträge in diesem Jahr 380 davon neue Teilnehmer sind, nahmen 130 für das zweite Jahr
Am 9. Juni gab es 1.965.55 Hits, 29,446 Seitenzugriffe und 6,105 Besucher!
Heute haben wir 3.014.247 total Hits und 12,263 Besucher!
Herzlichen Glückwunsch an alle von euch !“
Wir haben gerne teilgenommen!
Dieser Twitter-Event hat nicht nut Spaß gemacht und die Vernetzung mit der weltweiten Archiv(ierenden)gemeinschaft gefördert. Sie hat nicht zuletzt zu 3 sehr erfolgreichen Tagen auf siwiarchiv geführt. Mit siwiarchiv haben wir sowohl am Projekt des ICA teilgenommen, als auch den Twitter-Event ( #IAD15 , #democracy) genutzt, um neue wie auch thematisch passende ältere siwiarchiv-Blogeinträge zu posten. Zur ein Einordnung der folgenden Zahlen sei gesagt, dass siwiarchiv zurzeit täglich durchschnittlich 250 einzelnen Besucher und etwa 500 Seitenzugriffe verzeichnet. Hier nun die Ergebnisse der letzten drei Tage:
9.6.: 459 Besucher, 1705 Seitenzugriffe
10.6.: 319 Besucher, 1265 Seitenzugriffe
11.6. 355 Besucher, 1734 Seitenzugriffe.
Ich verbuche dieses Ergebnis als Erfolg. Wenn bei „herkömmlicher“ Öffentlichkeitsarbeit ähnliche Werte erzielt werden, so glaube, würde in jedem anderen Archiv – auch – gefeiert werden.
Pingback: Dr. Lothar Irle – Schlaglichter auf dessen Kindheit. | siwiarchiv.de
Pingback: Dr. Lothar Irle – Schlaglichter auf dessen Kindheit. | siwiarchiv.de
Nach dem Brand wurde der „Alte Flecken“ von Freudenberg einheitlich wieder aufgebaut. Diese Leistung bzw. die Vorgabe wird Fürst Johann-Moritz von Nassau-Oranien zugeschrieben.
Es müsste für einen solchen einheitlichen planmäßigen Aufbau eine landesherrschaftliche Vorgabe gegeben haben. Bisher sind weder solche Dekrete oder Planunterlagen bekannt. Wo sind dazu interessante Unterlagen zu finden, die mit diesem Ereignis zusammen hängen?
Im Jahr 1979 ist ein Sonderheft SIEGERLAND (Band 56, Heft 1-2) „Johann Moritz Fürst zu Nassau-Siegen“ erschienen.
Darin verfasste Alfred Lück einen Artikel „Johann Moritz Fürst zu Nassau-Siegen als Landesherr in seinem eigenen Territorium“ und formuliert auf Seite 52:
„Im Jahre 1666 wurde der alte Marktflecken Freudenberg durch ein Großfeuer bis auf ein einziges Haus zerstört. Sofort unterstützte der Fürst den Wiederaufbau. Er gestattete den Bürgern, die Steine der militärisch wertlos gewordenen Burg zum Aufbau der Kellerräume ihrer neuen Häuser zu verwenden. Er ließ einen Bauplan (Fußnote 22) ausarbeiten, nach welchem die Scheunen mit ihrem leicht brennbaren Inhalt an die Straßen vor die Tore gelegt wurden. Zwischen den einzelnen Häusern blieb ein freier Raum, um das Übergreifen der Flammen in Zukunft zu verhüten. Johann Moritz gab für den Wiederaufbau Bauholz und Geld. Das Rathaus ließ er auf seine Kosten errichten und schenkte es dem „Flecken“. Die Kirche wurde erst 1675 vollendet. Ihr Turm ist der einzige Teil des alten Freudenberger Schlosses, der erhalten blieb. (…)“
In der Fußnote 22 heißt es: „Herbert Kienzler: Siegerländer Fachwerkhäuser, S. 62, Siegen 1974, vermutet, dass Pieter Post daran beteiligt war, während Helmut Delius: ‚Die städtebauliche Bedeutung des Grafen Johann Moritz von Nassau-Siegen in ‚Westfalen‘, 29. Band, Heft 1, Münster 1951, Seite 62, dies nicht für wahrscheinlich hält.“
Es wäre interessant zu wissen, ob Lück (1912-1982) eigene Recherchen angestellt hatte oder die „Überlieferung“ wiedergab.
In einer Biographie „Johann Moritz von Nassau-Siegen“ des Autors Holger Kürbis (Sutton-Verlag Erfurt, 2005) las ich auf Seite 80:
„Als im Jahre 1666 der Ort Freudenberg einem Feuer zum Opfer fiel, unterstützte Johann Moritz den Wiederaufbau, sowohl durch steuerliche Erleichterungen als auch in Form von Plänen und Bauvorschriften für die neuen Gebäude, die ein ähnliches Unglück künftig verhindern sollten.“
Antwort des Staatsarchivs München von heute (via E-Mail): “ …. in den Beständen der Regierung von Oberbayern konnten weder ein Einbürgerungsakt bzw. ein Akt zur Aufnahme in das bayerische Staatsgebiet zu Oscar Robert Achenbach noch Unterlagen zur Entlassung
bzw. Ausreise aus dem bayerischen Staatsgebiet ermittelt werden. Im entsprechenden Findbuch konnten für das Jahr 1918 generell keine Einbürgerungen festgestellt werden. Eine Recherche im Bestand des Bezirks- bzw. Landratsamtes München verlief ebenfalls ergebnislos.“
Ich erinnere mich an ein Seminar an der Universität Siegen, in welchem der Siegener Historiker Dr. Wolfgang Degenhardt davon sprach, dass Johann Moritz Freudenberg nach einem universal verwendbaren, stark durchdachten Plan eines niederländischen Architekten errichten lies. Ob es Post war, kann ich nicht mehr sagen. Da Herr Dr. Degenhardt sich mehrfach als „Johann Moritz Experte“ ausgewiesen hat und meines Wissens nach auch in den niederländischen Archiven geforscht hat, sollte man ihn bei Bedarf mal kontaktieren?!
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 2.6. – 15.6.2015 | siwiarchiv.de
Pouvez-vous me donner l’historique de la Société Fölzer Söhne
Qui était implantée à Hagondange Lorraine pendant la période 1897 à 1918 et 1940 à 1944.
Cette société existe-t-elle encore à Siegen?
Sinon à quelle date a-t-elle cessé son activité?
Merci d’avance de votre obligeance.
Borri
Mit folgendem Literaturhinweis zur Geschichte der Kölnsch-Fölzer-Werke via E-Mail beantwortet:
Peter Vitt: Die Industrialisierung des Siegerländer Amtsbezirks Netphen in der preußischen Zeit 1815/16 bis 1946, Siegen 2014, S. 395-404, Link:
http://dokumentix.ub.uni-siegen.de/opus/volltexte/2014/826/pdf/Dissertation_Peter_Vitt.pdf .
Der Wikipedia-Eintrag zu Vincke verweist auf die Vinckestraße in Siegen. Das Foto zum Schild wird nun hiermit nachgereicht:

Eine Abbildung des aktuellen Straßenschildes wird hiermit nachgereicht:

Pingback: Vorstellung der Tagebücher des Freiherrn Ludwig Vincke | siwiarchiv.de
Pingback: Rheinland: Archivheft 45 erschienen | siwiarchiv.de
Pingback: Plakat „Offene Archive 2.2″ | siwiarchiv.de
Es liegt ein Druckfehler des Geburtsjahres von Dr.Dr.Karl Neuhaus vor:Das Geburtsjahr war 1910 und nicht 1915! Leider sind keine weiteren spätere biographischen Daten vermerkt, auch nicht in dem Text von Thomas Schattner. Es gibt allerdings Vermutungen.
Die Biographie von Neuhaus zu erforschen, ist aufgrund der vielfältigen, von einander abweichenden Angaben aufwändig. Eben bis zum Geburtstag hin muss alles überprüft werden. Allerdings ist das Jahr 1910 wohl korrekt; es wird übrigens bereits im Eintrag selbst bereits erwähnt.
Die Recherchearbeit finde ich gut gelungen, aber diesen Herrn als „Heimatschriftsteller“ zu bezeichnen, finde ich recht gewagt (bezgl. der geringen Quantität der Publikationen und der fehlenden umfangreicheren Monographien). Ich würde ihn eher als Heimatforscher titulieren.
Daher wurden die Anführungszeichen im Titel verwendet. Irle bezeichnete Heifer als „freien Schriftsteller“ (s Fn 46).
Vielen Dank für Ihre Antwort. Lässt sich die spätere Tätigkeit nach Ende der Verurteilungszeit ausmachen und wann, bzw wo Herr Dr. Neuhaus verstorben ist?
Neuhaus verlegte seinen Lebensmittelpunkt vom wittgensteinschen Laasphe, da er dort nur schwer Arbeit fand, nach Bonn, wo er in Adressbücher zuletzt als Prokurist geführt wurde. Am 21.12.2000 ist er in Wertheim verstorben.
Heute findet sich in der Westfälischen Rundschau ein Artikel von Jens Plaum zu Otto Krasa und zur Ausstellung in Siegen- Gosenbach: http://www.derwesten.de/wp/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/heimatforscher-und-sa-mann-otto-krasa-id10815684.html
Für uns Kinder war in den 1960ern und 1970ern die Ruine dieses Hauses, also das erhalten gebliebene Untergeschoss aus Bruchstein, einer der geheimnisvollsten Orte in der Umgebung. Mein Vater, Jahrgang 1928, erzählte uns, dass das mal ein Gasthaus war und dass er dort sogar mal selbst als „Kegeljunge“ gearbeitet hatte. Vorstellen konnten wir uns das alles aber nicht, denn zu unserer Zeit war das „Haus“ ein düsteres, bemoostes Gemäuer unter Bäumen, auf dem oben eine kleine Wiese wuchs. Von daher ist es toll, nach so vielen Jahren jetzt nochmal Hintergrundinformationen zu der Ruine zu bekommen (ah schau, sie hatte sogar einen Namen – Waldhaus!) und gar erstmals BILDER zu sehen, wie das Haus mal aussah. Danke!
Beim Bau der Hüttentalstraße kam die Ruine ja leider abhanden, zusammen mit dem gesamten Wald entlang des Siegufers. Die Ruine war natürlich nur eine Ruine, aber irgendwie gehörte sie eben dazu, war gar der Höhepunkt dieses wunderschönen, lauschigen Wanderweges mit dem rostbraunen Geländer unter den Bäumen entlang der Sieg. Im Wasser schwammen Enten, deshalb war der Weg für uns Kinder der „Wulle-Wulle-Entenweg“. Aber auch das kann sich heute angesichts der sterilen Steinwüste unter der Hüttentalstraße niemand mehr vorstellen, der es nicht selbst gesehen hat.
Pingback: Zuwachs zum Kreisarchiv – Fortsetzung | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 16.6. – 29.6.2015 | siwiarchiv.de
Ich schätze die ist aus dem Jahr 1904.
Gratulation! Hier der Beweis:
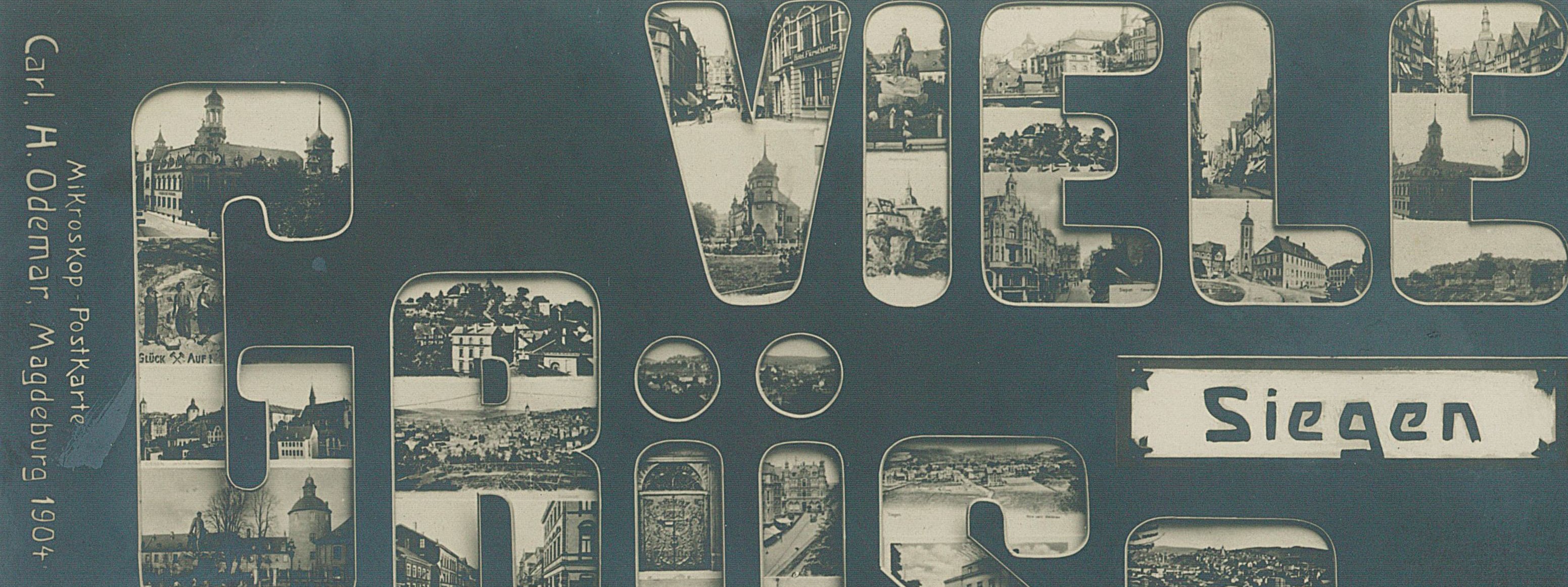
Ich schätze dann mal 1910.
Weil Synagoge wurde erst 1904 eröffnet.
LG Martina Dreffke-Halft
Leider ist das Rätsel schon gelöst!
Flyer und Plakat zur Tagung sind um ein roll-up ergänzt worden: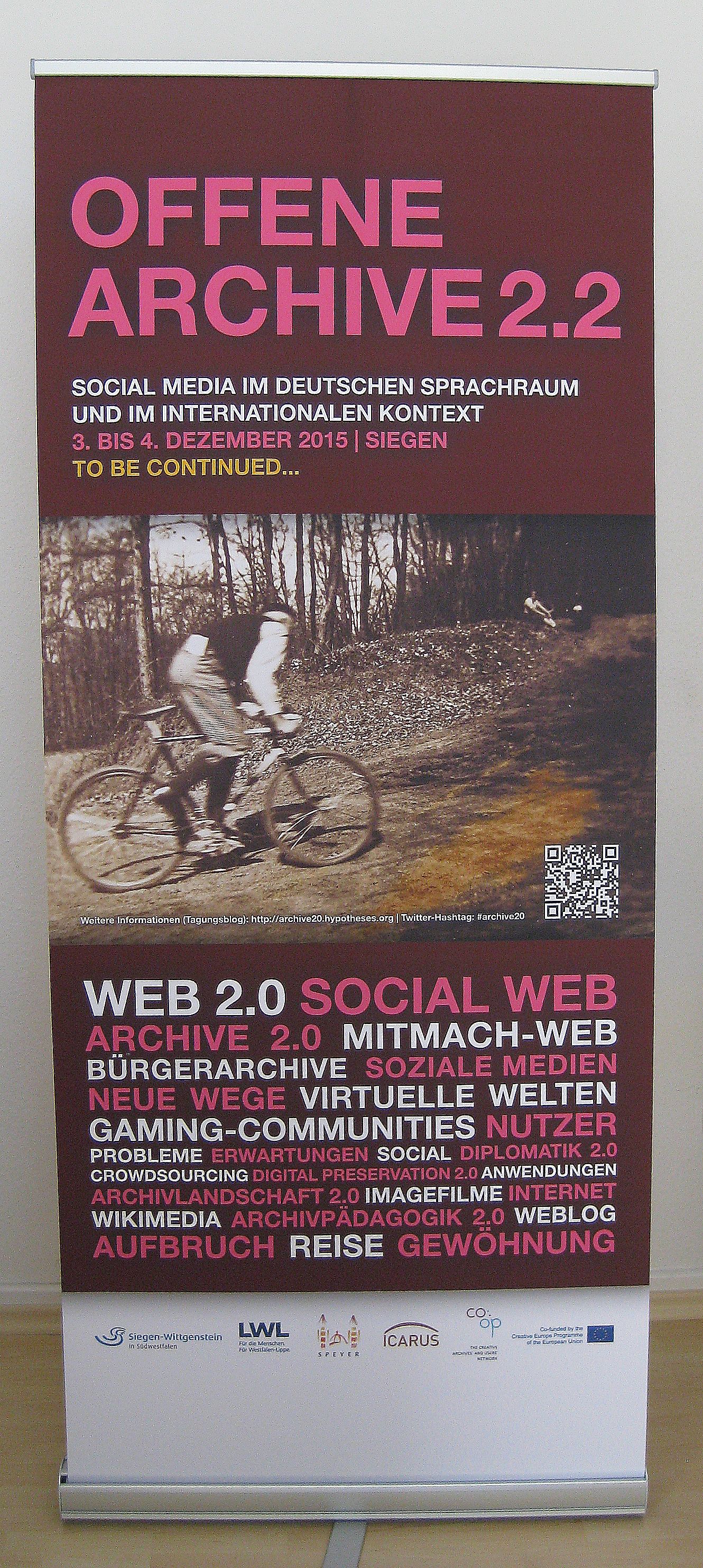
Ein Zwischenbericht zu den Forschungsergebnissen auf freudenberg-online.de von gestern erwähnt auch siwiarchiv: http://www.freudenberg-online.com/index.php/8-aktuelle-nachrichten/2514-neues-zum-stadtbrand-fuer-heimatpfleger
Pingback: Archive 2.0 – Ein Überblick zu Links und Literatur | Archive 2.0
Heute liefert auch die Westfälische Rundschau einen Zwischenbericht zu den Forschungsergebnissen mit Erwähnung von siwiarchiv: http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/flecker-feuer-neue-erkenntnisse-zum-stadtbrand-id10839694.html
Pingback: Ausstellung „Als der Hexenwahn zum Alltag gehörte – Eine Zeitreise ins 17. Jahrhundert“ | siwiarchiv.de
Pingback: Blogparade: "Kultur ist für mich ..." - Aufruf #KultDef
Lieber Thomas,
ganz hervorragend! Vielen herzlichen Dank für diesen erhellenden Beitrag über die Ethik des Archivierens und über dein persönliches Verständnis von Kultur, dass auch durch deine Arbeit geprägt ist.
Das Stichwort „vorurteilsfrei“ finde ich sehr treffend, kam bislang in der Blogparade noch nicht direkt vor, aber indirekt, wenn es auf das Sich-Einlassen-auf-fremde-Kulturen ging.
Vielen Dank und schönes Wochenende!
herzlich,
Tanja
Pingback: Günter Dick, St. Augustin: Feier in Gent zum 100. Jahrestag LZ 37-Absturzes | siwiarchiv.de
wunderbar, ich bin begeistert, denn ich war Schüler von von
Fehling und Meyer Lippe in den 50er Jahren der Malschule.
Es gibt ein gutes Gefühl erinnert zu werden an die Meister,
die einem das „Laufen“ lernten;
Pingback: Aus dem Fotoarchiv der Universität Siegen: | siwiarchiv.de
Ein schöner Beitrag…Nur frage ich mich gerade, wer archiviert solch eine Blogparade? :)
Danke für die Reaktion! Manche Blogs werden von der Deutschen Nationalbibliothek archiviert – s. http://www.blog.de/thema/dnb/ . Literarische Blogs werden vom Deutschen Litaraturarchiv Marbach gesichert – s. http://www.dla-marbach.de/dla/bibliothek/literatur_im_netz/literarische_weblogs/.
Die technische Archivierung des Blogs ist demnach wohl kein Problem.
Aber wer sich für die große Anzahl regionaler, lokaler oder spezialwissenschaftlicher Blogs kümmert, ist noch nicht ausdiskutiert, geschweige denn, dass die zuständigen Archive, Bibliotheken oder Museen darüber überhaupt sprechen.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Archivierung der blogspezifischen Elemente wie Blogparade oder auch Blogstöckchen Probleme darstellen, über die noch nicht (genügend) nachgedacht wurde.
Pressemitteilung der Stadt Siegen, 6.7.2015:
„Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Nr. 297 „Koch’s Ecke“ fand vor Ort am 27. Mai 2015 eine erfolgreiche Planungswerkstatt mit zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Gemeinsam wurden Ideen gesammelt und Vorschläge erarbeitet, wie das Quartier zukunftsfähig entwickelt werden könnte. ….. “ Übereinstimmend formulierten die Teilnehmenden: “ ….. Das Straßen.NRW-Gebäude wird erhalten und soll als Wohnhochhaus für verschiedene Bewohnergruppen genutzt werden. Alternativ könnte es aber auch als Gründerzentrum mit einem Panorama-/Dachcafé genutzt werden. Die Hammerhütter Schule und das Straßen.NRW-Gebäude sollen saniert und ausgebaut als zentrale Merk- und Orientierungspunkte im Quartier dienen und zur Identifikation beitragen. …..“
Pingback: Tankstellenparty im LWL-Freilichtmuseum in Detmold | siwiarchiv.de
Pingback: Otto Krasa im Gosenbacher Gemeinderat | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 30.6. – 13.7.2015 | siwiarchiv.de
Pingback: ARCHIVAR 2/2015 | siwiarchiv.de
Pingback: Oscar Robert Achenbach – ein Lebenslauf aus dem Januar 1938. | siwiarchiv.de
Kleine Korrektur (um möglicher Legendenbildung vorzubeugen): 1945 war die Siegener Zeitung verboten; hier dürfte es sich wohl um die „Amtlichen Bekanntmachungen“ der Alliierten Militärregierung handeln.
Danke für die Korrektur!
Das Buch kann hier online eingesehen werden: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10081966-0
Pingback: Archivarbeit: Einlagern in der Außenstelle | siwiarchiv.de
Geh auf den Bau arbeiten, Mertens – Universität ist nichts für Dich !Zukünftig werden unsachliche und lediglich den Verfassenden oder Mit-Kommentierenden angreifende Kommentare gelöscht werden.
Pingback: Wappen der Altkreise Siegen und Wittgenstein | siwiarchiv.de
Pingback: Listen der Baudenkmäler : | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 14.7. – 27.7.15 | siwiarchiv.de
Alexander Kraus: Rezension zu: Haber, Peter; Pfanzelter, Eva (Hrsg.): historyblogosphere. Bloggen in den Geschichtswissenschaften. München 2013, in: H-Soz-Kult, 28.07.2015, <http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-21319>.
Gibt es irgendwelche Erkenntnisse darüber, wann der Arbeitskreis Wegeforschung im HB Siegerland-Wittgenstein endlich brauchbare
Ergebnisse (Register, Karten, Buch, Homepage) liefert?
Die Dokumentation der bisher bekannten Wege ist abgeschlossen. Diese wurden (!) und werden durch Exkursionen in der Öffentlichkeit bekannt gemacht. Neu hinzugekommene Wege sollen zukünftig dokumentiert werden.
Selber anschauen!
Mittelaltermarkt mit verkaufsoffenem Sonntag von 13-18 Uhr.
Datum: 17.10.2015 bis 18.10.2015
Veranstalter:
Werbegemeinschaft Freudenberg
Carmen Kikillus
Oranienstraße 2
57258 Freudenberg
Telefon: 02734 1474
Fax: 02734 1674
Veranstaltungsort:
Historischer Stadtkern „Alter Flecken“ Freudenberg
Der Alten Flecken und die Stadt Freudenberg werden auch im Travel Magazine der Singapore Airlines (Heft Juli 2015) besprochen (frdl. Hinweis Bernd Brandemann).
Danke für das Lob!
Eine erste ausführlichere Besprechung der „digitalen Schriftkunde“ findet sich hier: http://dkblog.hypotheses.org/710 .
Pingback: Ankündigung: Wittgenstein Heft 2/2015 | siwiarchiv.de
Pingback: Fahrt zur Ausstellung „Geraubte Jahre – Alltag der Zwangsarbeit in Westfalen“ | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 28.7. – 10.8.2015 – oder: | siwiarchiv.de
Da wir für die Fahrt noch freie Plätze haben, aber eine gewisse Planungssicherheit brauchen, bitten wir um Anmeldungen bis zum 16.08.2015.
Danke!
Ein Lösungsversuch wurde bereits gepostet: http://geschichtswerkstatt-siegen.de/2015/08/10/sommerraetsel-ii/#comments
Habt ihr nicht vielleicht noch ein schöneres Digitalisat? Dieses hat doch sehr starkes Bildrauschen und ganz grade ist es auch nicht.
Können Sie mit dieser Datei besser arbeiten: http://www.siwiarchiv.de/wp-content/uploads/2015/08/20150817105514.pdf ?
Sehr geehrte Damen und Herren,
habe aus dem Nachlass meiner Mutter eine Ölgemälde bekommen.
Dieses Ölgemälde muesste in dern 1970iger-/achtziger Jahren in der Gegend von Olpe, Freudenberg erstanden sein. Aus der Signatur kann ich nur Vogt erkennen. Bei meiner Recherche bin ich auf dieser Seite gelandet.
Das Ölgemälde muss nach meinen Recherchen die historische Altstadt
von ‚Rothenburg o.d. Tauber sein (mit Plönleinbrunnen). Das dieses Gemälde Rothenburg o.d. Tauber darstellt, wurde mir von meiner Mutter zu deren Lebenszeit immer wieder betont. Sie hing sehr an diesem Bild. Eine Aufnahme könnte ich Ihnen zukommen lassen. Ich würde zu gerne wissen, ob ich richtig liege. Zumal es ja sehr interessant ist, dass es ja tatsächlich aus dem Siegerland einen Maler mit diesem Namen gab. Vielleicht kann man ja auch die Signatur vergleichen. Bin oft im Siegerland (wohne allerdings in Düsseldorf). Bin einfach neugierig, und möchte wissen, ob es sich um den besagten Künster handelt,
Herzliche Grüße
M.Hurlin
Pingback: Ende der Bearbeitung von Einzelfallakten nach Schwerbehindertenrecht | siwiarchiv.de
Archivalia kommentiert das Projekt gewohnt robust und (!) nachvollziehbar: http://archiv.twoday.net/stories/1022468662/ .
Überraschende Erinnerungen an meine Kinderzeit, die ich in der Oberen Kaiserstraße 10 verbrachte – das hat mich doch sehr bewegt! Vielen Dank für die Fleißarbeit (und Dank auch an meinen ältesten Volksschulfreund Klaus aus der Unteren Kaiserstraße, Haus Solms, der mich auf die Dokumentation aufmerksam macht) !
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 11.8. – 24.8.2015 | siwiarchiv.de
Ein Bericht zur Ausstellungseröffnung findet sich hier: http://heimatvereine-in-freudenberg.de/content/ministerpr%C3%A4sidentin-er%C3%B6ffnet-ausstellung-200-jahre-westfalen-jetzt
Pingback: Der „Do-it-yourself“ Zebrastreifen in Freudenberg. | siwiarchiv.de
Eine interessante Geschichte über die lokale Bürgerinitiative und wie man sich manchmal ins Zeug legen muss, um etwas zu erreichen. Grade solche Begebenheiten sind manchmal interessanter als die große (Welt-) Politik.
Bemerkenswert ist das der amtliche Zebrastreifen vor der Volksbank
verlegt wurde. Raten Sie mal wohin? Genau….
Pingback: Ausstellung „„Unser Volk betet wieder – wenigstens am Anfang des Krieges“ in Freudenberg | siwiarchiv.de
Pingback: Ausstellung „Unser Volk betet wieder – wenigstens am Anfang des Krieges“ in Freudenberg | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statitisk: 25.8. – 7.9.15 | siwiarchiv.de
Die heutige Print-Ausgabe der Westfälischen Rundschau greift den Blog-Eintrag zum Zebrastreifen auf. Nachtrag (8.9.15, 9:55): Link zur Online-Fassung: http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/freudenberger-malen-selbst-einen-zebrastreifen-id11068549.html
Pingback: Ausstellungseröffnung „Die Kirchenkreise Siegen und Wittgenstein im Ersten Weltkrieg“ | siwiarchiv.de
Am 17. September wird es in der Sitzung des Kulturausschusses des Landes NRW einen mündlichen Sachstandsbericht zum Digitalen Archiv NRW geben – Link zur Tagesordnung.
Auf der Homepage des DA NRW finden sich weitere Bilder der Veranstaltung.
Pingback: Fotoeindrücke vom gestrigen Vereinsarchiv-Workshop | siwiarchiv.de
Pingback: Rafael Greboggy: Tagungsbericht des 9. Detmolder Sommergesprächs am 26. August 2015 | siwiarchiv.de
Pingback: Online: Denkmalpflege in Westfalen-Lippe Heft 02/15 | siwiarchiv.de
Pingback: 50.000 Karten digitalisiert und recherchierbar | siwiarchiv.de
Pingback: Abstimmung: Zukunftspreis Siegen-Wittgenstein 2015: Mausklick-Champion | siwiarchiv.de
Zu den im weitesten Sinne geschichtlichen Themen gehört auch:
FRids e.V. – Die Scouts – Jugendliche Fachexperten als Workshopleiter, Stadtführer und mehr…
Insbesondere dazu gehören die Flecken-Scouts.
Man dankt !
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 8.9.15 – 21.9.15 | siwiarchiv.de
Pingback: Digitalisierung von Archivgut und Einrichtung eines elektronischen Langzeitarchivs | siwiarchiv.de
Hi,
wenn du magst finde ich es für dich raus. Bin gerade bissel im Stress aber wenn ich in etwa zwei wochen mal zuhause bin schau ich für dich nach.
Scann mir doch einfach die Unterschrift und schick mir eine Mail.
Beste Grüße,
Jens
Das Kreisarchiv hat die Anfrage bereits via E-Mail beantwortet. Es handelt sich wohl um einen anderen Siegfried Vogt.
oh okay
Pingback: Personalakten von Fritz und Willi Busch online einsehbar | siwiarchiv.de
Neuste Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt: Stasi im Siegerland (Sipri-Akten des MfS der DDR)
Die Strategie der Stasi im Siegerland war erstaunlich breit.
In Siegen waren vor allem betroffen : Industriebetriebe, Hotels, maoistische Gruppen, Friedensgruppen, „EDV-Behörde“ einer Verwaltung, Militär, sogar Schulen. Oft wurden belanglose Informationen „abgeschöpft“, die aber zusammen ein Bild ergaben. Die detaillierten Ergebnisse werden Mitte 2016 veröffentlicht.
Jürgen Bellers
Insgesamt finde ich die Seite gut geordnet und gelungen. Allerdings empfinde ich sie etwas zu grau und damit trist. Das scheint im Allgemeinen allerdings eher ein Fall für eine andere (IT-)Abteilung zu sein. Eventuell könnten auf der Seite des Kreisarchivs manche Abschnitte mit anderen Graunuancen hinterlegt werden, um diese Tristesse aufzubrechen. Die weiße Untermalung des Kontaktfeldes ist da schon ein guter Anfang, lenkt aber etwas vom Inhalt ab.
An dem selben Ast, an dem auch das Blatt „Kreisgeschichte / Kreisarchiv“ hängt, hängt ebenso eines mit dem Titel „MdEP, MdB, MdL“. In dem Abschnitt Zeittafeln im Blatt „Kreisgeschichte / Kreisarchiv“ werden allerdings nur die Landtags- und Bundestagsabgeordneten bedacht. Da freuen sich Interessierte sicherlich über eine weitere Zeittafel.
Danke für die Antwort! Das Farbdesign ist durch die CI der Kreisverwaltung festgeschrieben, aber Grau passt doch ganz gut zum Archiv …. Alle Verlinkungen werden zeitnah überprüft werden.
Pingback: Online: Aufsatz „Neue Erkenntnisse zum spätmittelalterlichen Bergbau im Siegerland anhand der Grube Victoria bei Kreuztal-Burgholdinghausen“ | siwiarchiv.de
Zum aktuellen Sachstand: s. folgenden Kommentar Bellers´ a.a.O.: http://www.siwiarchiv.de/?page_id=5#comment-46816
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 22.9.15 – 5.10.15 | siwiarchiv.de
Pingback: Video der Vitrinenpräsentation „Siegen 1915“ | siwiarchiv.de
Liebes Kreisarchivteam,
ich habe ein Gemälde von Siegfried Vogt in meinem Besitz, das höchstwahrscheinlich ziemlich unbekannt ist. Es handelt sich um eine Portraitskizze von Susanne Meckel. Dies ist die Enkelin des Architekten Meckel aus Ferndorf. Als ihre Eltern vor 3 Jahren verstorben sind habe ich es beim ausräumen des Hauses gesehen und war sofort davon begeistert. Sie hat es mir darauf hin geschenkt. Je länger ich es in meinem Besitz habe desto mehr verfolgt mich der Gedanke, daß es irgendwann wieder zurück ins Siegerland sollte. Es handelt sich hierbei schließlich um einen Maler, der dort gelebt und beliebt war. Zumal ich keine Kinder habe und es mir unerträglich wäre, wenn es nach meinem Ableben in irgend einem Speicher verstaubt. Meine Frage wäre deshalb. Gibt es im Raum Siegen ein Stadt, bzw. Gemeindemuseum, das daran Interesse hat und es ausstellen würde? Ich würde es als Dauerleihgabe mit Eigentumsübergang nach meinem Ableben verleihen. Bedingung wäre natürlich, daß es in Ehren gehalten und nicht veräußert wird. Verschenken kann ich es leider nicht, da ich ein Geschenk nicht weiter verschenken kann. Mit Frau Meckel habe ich das auch schon abgeklärt. Sie fand die Idee sehr gut.
Fotos des Gemälde schicke ich Ihnen sehr gerne zu. Geben Sie mir bitte eine E-Mail Adresse.
Für eine kurze Nachricht wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Vielen Dank und viele Grüße aus München
Sigi Morgen
Sehr geehrter Herr Wolf,
vielen Dank für Ihre prompte Antwort und der Auswahl der Museen.
Ich habe Ihnen Fotos von dem Gemälde inc. der Rückseite beigefügt. Bitte überprüfen Sie, ob für das Kreisarchiv das Gemälde von Interesse ist. Ich würde darauf hin mit Frau Meckel sprechen, denn ich würde es gerne gemeinsam mit ihr dem Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein schenken.
Da das Gemälde für mich einen hohen persönlichen Wert hat, wäre mir besonders wichtig, daß es nicht veräußert wird. Außerdem sollte es nicht nur in Kellern verschwinden, sondern gelegentlich bei Ausstellungen den Interessierten gezeigt werden. Damit sich die Menschen in Ihrer schönen Gegend daran erfreuen können.
Bin gestern Abend zufällig auf diese Seite gestoßen und habe versucht den Rest der Karte von Herrn Bärlin zu entziffern. Nach meiner Meinung müsste der Wortlaut folgender sein:
Freudenberg Kreis Siegen / Vereinslazaret Westfalen
Liebe Freunde.
Will Euch mitteilen, daß ich
Euren lieben Brief auf dem
Weg zum Sturm auf Grafen
stafel erhalten habe abends
4 Uhr bekam ich 1 Schuß in den
linken Oberarm es war ein
Wunder wir lagen (schon) mehrere
Stunden da und durfen uns nicht
regen vor dem Feind doch mit Gottes
Hilfe aus dem Feuer zu entkommen
Lebt wohl mit Gott auf Wiedersehen
grüßt Euch alle
Karl Bärlin“
Feldpost
An
Karoline Gall
Affalterbach b d Kelter
O/A Marbach
Württemberg
Das in Klammern gesetzte „schon“ könnte ein Kürzel aus der Stenographie sein. Es würde sinngemäß hineinpassen.
Sehr geehrter Herr Seysen, vielen Dank dafür, dass Sie die Transkription hier eingestellt habe,!
Die Siegener Zeitung berichtet heute vom Ausgang der Kulturausschusssitzung: http://www.siegener-zeitung.de/siegener-zeitung/Kreis-will-ein-digitales-Archiv-b4227729-0832-4084-9a47-d25bf29516fa-ds
Die Niederschrift der Sitzung kann hier eingesehen werden: https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz110/tops/?__=LfyIfvCWq8SpBQj0Ne.LaxCYv8Us4Pi3Mi5GJ
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 6.10. – 19.10.2015 | siwiarchiv.de
Pingback: Vortrag „Simon Grünewald – drei Lehrer aus Pömbsen“ | siwiarchiv.de
Pingback: Lesung: Achim Heinz „Tagesbrüche“ | siwiarchiv.de
Pingback: Der Evangelische Brüderverein | blog.archiv.ekir.de
Aus Anlass der spontanen Neubeschriftung des Ostvertriebenendenkmals im Kontext der seit einiger Zeit in Europa auftretenden Flüchtlingskarawanen vor allem aus dem europäischen und dem Nahen Osten sei einmal angemerkt, dass dieser kleine Akt einer begrenzten Regelverletzung doch jedenfalls zum Nachdenken anregte? Was ja doch immer das Beste ist, was sich von einem bemerkenswerten Ereignis sagen lässt. Ich habe daraufhin im Geschichtsbuch gestöbert.
Vom sozialdemokratischern Regierungspräsidenten Fritz Fries aus Siegen zu den Ostflüchtlingen und Ostvertriebenen seiner Amtszeit:
„Das Flüchtlingsproblem … ist eines der vordringlichsten unserer Tage. Mein Protesttelegramm gegen weitere Zuweisung mit Flüchtlingen hat schlagartig die Situation, in der wir stehen, beleuchtet. … Soweit die ortsansässige Bevölkerung helfen kann, muß sie zur Hilfe herangezogen werden, denn zu keiner Zeit hat das Wort von der Liebe zum Nächsten mehr Geltung gehabt als heute … einer trage des anderen Last.“
Wenngleich – so bei anderer Gelegenheit – manches zu bedenken sei:
„… wir sehen, daß unsere Mädels zu einem großen Teil nicht mehr wählerisch sind. … Die Hauptsache ist, daß sie ihrem Genuß leben können. So ist die Geschlechtskrankheit zu einer Volksseuche geworden. Ich kann Ihnen sagen, da, wo sie von Osten eingeschleppt ist, ist die Syphilis meistens in ein bis zwei Jahren tödlich, da sie viel gefährlicher ist als bei uns im Westen. … Wir bekommen jetzt die Leute aus den Balkanstaaten, aus Österrreich und der Tschechoslowakei, wir bekommen sie vornehmlich aus Polen und zu einem Teil aus der russischen Zone. Die Menschen sind besonders in der polnischen Zone von Haus und Hof vertrieben, sie kommen zerlumpt, zerissen, krank und siech ohne Hab und Gut an. Die kranken und siechen Körper sind für alle Epidemien empfänglich, und wir haben daher eine ganz besondere Vorsicht walten zu lassen.“ (Manfred Zabel, Die Heimatsprache der Begeisterung. Ausgewählte Reden und Schriften von Fritz Fries, Siegen 1990, S. 91, 104)
Der nahe und weitere Osten demnach ein irgendwie schon auch so etwas wie ein Seuchengebiet! Von anderem einmal abgesehen (Kaninchenhaltung in der Badewanne, Unkenntnis mitteleuropäischer Sanitärinstallation usw.). Offenbar Annahmen von langer Dauer.
Eine Schwierigkeit immerhin existierte damals offenbar noch nicht: dass die Praxis, weibliches Kopfhaar durch ein Tuch dem männlichen Blick zu entziehen, Aufsehen erregt hätte. Diese Erscheinung nahm ja damals sprunghaft zu! Auch von Aversionen, die fremdartige Bindetechniken beim tuchgewohnten Publikum ausgelöst hätten, hat man noch nichts gehört. Insofern lässt sich m. E. aus dem Ereignis über das reine Nachdenken hinaus auch ein bisschen was lernen.
Dass unsere Grundordnung/der EU-Wertekanon durch die Denkmalsverfremder/-neugestalter verletzt worden wäre, wie laut Zeitung manche staatliche Stellen annehmen, kann ich noch nicht erkennen. In dieser Hinsicht dürfte m. E. eher an Steuerflüchtlinge (mit und ohne Kopftuch) zu denken sein und ein entsprechender Aufklärungs- und Handlungsbedarf bestehen?
Dr. Ulrich F. Opfermann
Link zum Artikel zur Denkmalsüberklebung in der heutigen Siegener Zeitung: http://www.siegener-zeitung.de/siegener-zeitung/Siegener-Denkmal-ueberklebt-2210732c-5687-4d8d-8565-c74765971c80-ds
Pingback: Linktipp: Archivpflege in Westfalen und Lippe (Heft 83) erschienen | siwiarchiv.de
Pingback: Linktipp: Archivpflege in Westfalen und Lippe (Heft 83) erschienen | siwiarchiv.de
Pingback: Film „Als die Amerikaner kamen – US-Filmaufnahmen vom Kriegsende 1945 in Westfalen“ | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 20.10. – 2.11.2015 | siwiarchiv.de
Pingback: Markierungen 11/07/2015 - Snippets
Pingback: Global Player Nassau – Archivdatenbank Nassau-Oranien freigeschaltet | siwiarchiv.de
Pingback: Vortrag „Diesterwegs Popularisierung – | siwiarchiv.de
Liebes Kreisarchiv,
mich erreichte eine Anfrage zu den Nach-NS-Amtszeiten von Erich Moning. Da ich in der Recherche auf unterschiedliche Angaben stieß, bitte ich das Kreisarchiv und zugleich die interessierten Leser um Unterstützung bei der Klärung:
a) Auf der Seite des Kreises ist für Erich Moning als Amtszeit in der OKD-Rolle „1946-1963“ angegeben
(http://www.siegen-wittgenstein.de/Kreisverwaltung/Landrat-und-Politik/Kreisgeschichte-Kreisarchiv/index.php?La=1&NavID=2170.72&object=tx|2170.390.1&kat=&kuo=2&sub=0).
b) Nach einer Angabe der Siegener Zeitung vom 19.1.2010 („Mit dem Zusammenbruch des Dritten Reiches Anfang 1945 verlor er sein Kreuz¬taler Amt [als Ferndorfer Amtsbürgermeister], wurde aber bereits ab Juni 1945 als bewährter und letztlich unverzichtba¬rer Verwaltungsfachmann von der britischen Militärregierung zum Kreis Siegen berufen, zunächst als Kreisfinanzdirektor und ab 1947 bis 1963 als Oberkreisdirektor.“, siehe auch: http://www.ferndorf.de/nachrichten.php?id=524) war es bereits 1945.
c) Beide Angaben sind ausweislich seiner eigenen Angaben in der Entnazifizierungsakte unzutreffend. Demnach wurde er 1946 Kreisfinanzdirektor, und 1947 wurde er zum OKD gewählt. Das Wahlergebnis bedurfte der Bestätigung der Militärregierung, die ebenfalls 1947 erging. Moning gibt in seinem Fragebogen das präzise Wahldatum an und auch die Stimmenverhältnisse. Ich sehe keinen Anlass, daran zu zweifeln. Daher findet es sich so auch in dem bekannten Regionalen Personenlexikon (http://akteureundtaeterimnsinsiegenundwittgenstein.blogsport.de/a-bis-z/gesamtverzeichnis/#moning).
d) Inwiefern wurde er zu was „von der Militärregierung berufen“?
Mit Dank für Unterstützung
Ulrich Opfermann
Ein Auszug aus unserer Landräte- und Oberkreisdokumentation gibt Auskunft darüber, dass Moning bereits 1946, wenn auch kommissarisch bzw. vertretungsweise Oberkreisdirektor war:
1946-1963 Moning, Erich Dr
“Ich kann nicht mit halber Kraft arbeiten” (aus Kuhbiers Trauerrede, 18.9.1967)
• geb. 11.11.1902 in Schwerte/Ruhr, gest. Mi. 13.9.1967 19:45 Uhr in Buschhütten (Herzinfarkt)
• Heinrich Moning, Oberbahnassistent in Hagen, Marie geb. Nolte; 1 Bruder; Beamtenfamilie
• 1906 verzog die Familie nach Hagen
• Ev., Konfirmation: Psalm 91
• Seit 14.6.1929 verh. mit Hedwig geb. Ackermann (*30.1.1904, gest. 20.5.1990), 4 Kinder
• 1909 – 1913 ev. Volksschule
• 1913-1921: 8 ½ Jahre Städt. Oberrealschule, (1 ½ Jahre Primaner)
• Abitur Ostern 1921
• Banklehre 1.10.1921- Juli 1923 bei Barmer Bank-Verein
• 3.8.1923 – 31.3.1924 Hilfsangestellter bei Stadtverwaltung Hagen (Wohlfahrtsamt, Rechnungsführung)
• SS 1924 – 1927 Studium der Wirtschaftswissenschaften an den Universitäten Tübingen (SS 24, WS 24/25) und Köln (Dipl. Volkswirt: 31.5.1927 (gut))
• Diplom-Arbeit: “Die Theorien der Preis- und Einkommensbildung bei Jevons und Cassel” (gut)
• Diss. In Köln: Arbeitsbeschaffung für Erwerbsbeschänkte” im Mai 1928 (gut) [Referent Prof. Lindemann, Staatsminister a. D. dort auch alle Vorlesungen und Prüfungen besucht]
• 1. Staatsexamen, 2. Staatsexamen
• ab 18.06.1928 wissenschaftlicher Hilfsarbeiter bei der Stadt Finsterwalde
• ab 1. Juli 1929 Bürgermeister der Stadt Hilchenbach
• 3.7.1929 feierliche Einführung (Artikel Kreuztaler Zeitung 3.7.1929, SZ 4.7.1929)
• ab 25.1.1932 Bürgermeister des Amtes Ferndorf (ca. 6000 RM jährlich))
• 29..8.1934 Beamteneid auf A. H.
• 1934 NS-Rechtswahrerbund
• 1934-1939 förderndes Mitglied der SS
• 1.5.1937 Beitritt zur NSDAP
• Tätigkeit für des Kreisamt der NSDAP für Kommunalpolitik: Berichte (Anregungen für die Herausgabe von Gesetzen und Erlassen)
• seit 11.12.1940 Freistellung vom Heeresdienst “entgegen seinen persönlichen Wünschen”
• Anhänger der Bekennenden Kirche, 1933 Einschreiten gegen SA-Auftreten (während des Krieges Beleidigung in öffentlicher Versammlung in Ferndorf)
• Landkreis Siegen: Kreisoberverwaltungsrat 1. Juni 1945-Februar 1946
• Kreisfinanzdirektor 5. Februar 1946-Juni 1947
• 1.7.46 vtw. OKD, 23.8.1947 OKD Siegen
• April 1947 Vertreter des Kreises in den Gremien des RWE
• Dez. 1947 Aufsichtsrat der Hüttenwerke Siegerland (Eichener Walzwerk)
• Aufsichtsratsmitglied Westfälische Ferngas AG
• Aufsichtsratsmitglied Gewerkschaft Steinkohlebergwerk Viktoria Matthias Essen
• Schulausschuss Südwestfälische Verwaltungs- und Beamtenschule, Hagen
• Juli 1948 Beirat Ev. Jung Stilling Krankenhaus Siegen
• 1960 Stiftskurator Geseke-Keppel
• 1962-1966 Beirat der Staatl. Ingenieurschule in Siegen
• Oberleiter des Gillerbergheims (Verdienst Ms!?)
• Ehrenmitglied des Siegerländer Turnbundes
• Förderer Turnverein Eichen
• Förderer Ev. Gymnasium Weidenau
• Mitglied des vorläufigen Provinzialausschusses und des beratenden Ausschusses für die Provinzialverwaltung 1947-1953
• Mitglied in Gremien des Landkreistages NW: Vorsitzer des Finanzausschusses 1947-1963, Vorstand 1947-1954, stell. Vorstandsmitglied 1957-1963
• Vor 1963 Vorsitzer der Landeskonferenz der Oberkreisdirektoren in NW
• Mitglied in Gremien des Deutschen Landkreistages: Finanzauschuß
• OKD: 23.8.1947-22.8.1959 u. 23.8.1959-31.12.1963 (vorzeitiger Ruhestand wegen dauernder Dienstunfähigkeit nach Dienstunfall mit PKW in der Nähe von Kleve am 9.11.1962 (Herzinfarkt))
• 1964 Ehrenplakette der IHK
• Dienstwohnung: Fürst Moritz Str. 12/14, später: Bruchstr. Buschhütten
• Trauerfeier 18.9.1967 Bühne der Stadt Siegen: Siegerland-Orchester: Bach, Air, Mendelsohn-Bartholdy, Andante con moto d-moll op. 90, Beethoven, Ouvertüre “Coriolan”
• Verdienst/Würdigung: Verfechter bürgerschaftlicher Selbstverwaltung, Menschenführung, Fleiß, Mann des Ausgleichs
• Themen: Wiederaufbau, Wirtschaftsförderung, Wohnungsbau, kommunale Neugliederung, Kultur- und Gesundheitspflege, Finanz- und Schulwesen, Sozialpolitik, 1953 gegründeter Wasserverband Siegerland (!)
Quellen:
Kreis SIWI, Altregistratur, Personalakten(4 Hefter) Dr. Erich Moning
Häming, Josef: Die Abgeordneten des Westfalenparlaments 1826–1978 (Westfälische Quellen und Archivverzeichnisse, Bd. 2), Münster 1978, S. 459 (Nr. 1085)
Landkreistag Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Dokumentation über die Landräte und Oberkreisdirektoren in Nordrhein-Westfalen 1945 – 1991 stammen, Düsseldorf 1992, S. 704.
SZ 30.5.1973
Pingback: DVD „Wittgenstein – Weißer Fleck auf der Landkarte“ erschienen | siwiarchiv.de
Pingback: DVD „Heimatabend Siegen“erschienen | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 3.11.15 – 16.11.15 | siwiarchiv.de
s. a. Stadt Siegen, 16.11.2015: http://www.siegen.de/willkommen/detailansicht-news/news/heimatabend-siegen-im-stadtarchiv-erhaeltlich/
5 Omnibus-DVDs werden bis zum 23.11., 12:00 verlost. E-Mail an folgende Adresse reicht zur Teilnamhe aus: gewinnspiel@wirsiegen.de .
Sehr geehrter Herr Seysen,
herzlichen Dank für die Entzifferung. So konnte ich jetzt auch den Ort des Kriegsgeschehens herausfinden: Grafenstafel ist das belgische Gravenstafel, bei Ypern, wo im Zuge der zweiten Flandernschlacht der Schreiber Karl Bärlin verwundet wurde. Unsäglicherweise wurde in dieser Schlacht auch zum erstenmal am 22. April 2015 Giftgas (Chlorgas) durch die deutsche Armee eingesetzt, was bei Tausenden von Soldaten zu einem qualvollen Tod führte. Weder der ‚Feind‘ noch die deutschen Soldaten hatten Schutzmasken zur Verfügung. Der Schuss in den Oberarm war so gesehen vielleicht lebensrettend.
Pingback: Kriegsgefangene im Ersten Weltkrieg im Kreisgebiet | siwiarchiv.de
Pingback: Architektur als „Gesicht“ der Region | siwiarchiv.de
Man sollte nicht alles ändern, verlegen und krampfhaft nach Neuerungen suchen.
Das Staatsarchiv in Würzburg hat sich bewährt und sollte dort bleiben. Außerdem dürften die Mittel, die eine Verlegung binden würden, besser angelegt und benötigt werden.
“ ….. Aktives Museum in Warteschleife
In der Warteschleife ist das andere Projekt in der Nachbarschaft: Der Kulturausschuss vertagte die Entscheidung über den Kreiszuschuss für die Erweiterung des Aktiven Museums, das das Obergeschoss des ehemaligen Hochbunkers, der auf den Mauern der von den Nazis zerstörten Synagoge steht, zusätzlich übernehmen kann. 180 000 Euro sollen Stadt und Kreis übernehmen, 420 000 Euro bezahlt das Land. Der Kreis tut sich noch mit der vertraglichen Situation schwer: Eigentümer des Gebäudes ist weder Stadt noch Kreis, sondern eine von Baufirmen getragene Investorengesellschaft.“
Quelle: Westfälische Rundschau online, 24.11.2015, http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/stiftung-will-fuer-philharmonie-in-siegen-bauen-id11319740.html#plx1135264190
Heute berichtet die WDR-Lokalzeit Südwestfalen über die DVD. Anschauen!
Interessant wäre natürlich auch die Angabe (sowohl hier als auch in der Wikipedia), welche Archivalien für diese Auskunft benutzt wurden. So werden die Belege in der primärquellenkritischen deutschen Wikipedia ggf. nicht lange bestehen (hoffen wir das Beste, in letzter Zeit scheint der Wind sich etwas zu drehen).
Für das Archiv selber sind genaue Signaturangaben natürlich auch deshalb von Vorteil, weil diese Recherchierenden bereits etwas mehr auf die Archivalien vorbereitet und diese dann auch schon (bei entsprechendem Vorwissen) selbstständig im Findbuch suchen können.
Insgesamt ein gutes Format, danke dafür!, welches sowohl der freien Enzyklopädie als auch dem Kreisarchiv hilft. Hier bedarf es viel mehr Kooperation in Deutschland.
Nur zur Verdeutlichung: es handelte sich um keine eigene Recherche des Kreisarchivs. Dem Benutzer wurden Auszuge aus unserer Landräte-Dokumentation zur Verfügung gestellt.
FolgendenQuellen wurden ausgewertet:
1) Wolfgang Friedrich von Schenck:
Güthling, Wilhelm: Die Landräte des Kreises Siegen von 1817 bis 1919, in: Siegerland (47) 1970, S. 35-43
Walther Hubatsch (Hrsg.): Grundriß zur deutschen Verwaltungsgeschichte 1815-1945, Bd. 8: Westfalen, Marburg 1980, S. 303
Irle, Lothar: Siegerländer Persönlichkeiten- und Geschlechterlexikon, Siegen 1974, S. 285-286
Romeyk, Horst: Die leitenden staatlichen und kommunalen Verwaltungsbeamten der Rheinprovinz 1816 – 1945, Düsseldorf 1994, S. 716 – 717
Wegmann, Dietrich: Die leitenden staatlichen Verwaltungsbeamten der Provinz Westfalen 1815-1918, Münster 1969, S. 324-325
Siegener Zeitung 30.5.1973
Noch auswerten:
Schindlmayr, Norbert: Zur preußischen Personalpolitik in der Rheinprovinz. Eine Untersuchung über die Anstellung der höheren Regierungsbeamten und der Landräte in den Regierungsbezirken Koblenz und Trier zwischen 1815 und 1848, Diss. Phil., Köln 1969 [gemäß Register]
Weber, Georg (Bearb.): Festschrift zur 100-Jahrfeier des Kultur- und Gewerbevereins für den Kreis Siegen, Siegen 1933
Deutsches Geschlechterbuch Bd. 95, S. 291f. [Bild: Bd. 28, 1951]
Kruse, Hans: Das Siegerland unter preußischer Herrschaft 1815-1915
Nachruf in einer Siegener Zeitung Januar 1848
2) Karl Roth:
Irle, Lothar: Siegerländer Persönlichkeiten- und Geschlechterlexikon, Siegen 1974, S. 274
Landkreistag Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Dokumentation über die Landräte und Oberkreisdirektoren in Nordrhein-Westfalen 1945 – 1991 stammen, Düsseldorf 1992, S. 497.
Siegerländer Heimatkalender 1981, S. 46
Noch auswerten:
Aus dem Siegerland 3. Jg. Heft 5 Mai 1953, 17. Jg. Heft 2 Febr. 1967
Siegener Zeitung 7.12.1954, 21,2,1962, 21.2.1967
3) Willi Kettner:
Irle, Lothar: Siegerländer Persönlichkeiten- und Geschlechterlexikon, Siegen 1974, S.173
Kreis Siegen-Wittgenstein, Akten zur Verleihung des Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland 1978-1979 (17.8.1979)
Landkreistag Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Dokumentation über die Landräte und Oberkreisdirektoren in Nordrhein-Westfalen 1945 – 1991 stammen, Düsseldorf 1992, S. 390.
Siegerländer Heimatkalender 1991, S. 36 [mit Bild]
Siegener Zeitung 30.5.1973, 8.5.1990
Noch auswerten:
Siegener Zeitung 7.4.1961, 14.2.1963, 14.2.1973
Zu Karl Roth gibt es noch weitere Informationen (mit Quellenangabe):
http://akteureundtaeterimnsinsiegenundwittgenstein.blogsport.de/a-bis-z/gesamtverzeichnis/2/#roth8
Vielen Dank für die Ergänzung! Hatte ich übersehen. Mal schauen, ob es in die Wikipedia einfließt …..
“ Aktives Museum: Mues will Kreis überzeugen: (08.41 Uhr)
Die Erweiterung des Aktiven Museums Südwestfalen soll noch im Dezember beschlossen werden. Siegens Bürgermeister Steffen Mues hofft, bis dahin den Kreis überzeugen zu können, sich ebenfalls finanziell zu beteiligen. Der Kulturausschuss des Kreises Siegen-Wittgenstein hatte sich noch nicht entschieden. Er glaubt, für das Projekt seien noch mehr Fördergelder möglich. Mues sagte, alle Fördermöglichkeiten seien geprüft worden. Er hofft, dass der Siegener Stadtrat und der Kreistag im Dezember dem Antrag zustimmen. Sonst würden 420.000 Euro Fördersumme vom Land im kommenden Jahr verfallen. Grundsätzlich seien sich Stadt und Kreis einig, dass die Museumserweiterung ein gutes und wichtiges Projekt ist. Das Aktive Museum Südwestfalen dokumentiert die regionale NS-Geschichte, insbesondere der jüdischen Gemeinde, und ist auch für viele Schulen Anlaufstelle.“
Quelle: WDR, Lokalnachrichten Südwestfalen, 27.11.15, http://www1.wdr.de/studio/siegen/nrwinfos/nachrichten/studios151166.html
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 17.11. – 30.11.15 | siwiarchiv.de
Wurden diese Rätsel inzwischen gelöst? Sonst sei an dieser Stelle erwähnt, daß neben den baulichen Veränderungen (Nürnberger Haus, Neugestaltung des Vorplatzes, Entfernen des Kopfsteinpflasters) der Schlüssel zur Datierung im Zeitungskiosk liegen könnte – vorausgesetzt natürlich, man bekommt ein bißchen mehr zu sehen, wenn man diese Stelle so hochaufgelöst neu einscannt, wie es irgend geht. Vielleicht läßt sich eine Zeitung, eine Zeitschrift oder ein Romanheft genauer erkennen. – Beim oberen Foto verdeckt der rechtsstehende Herr leider ein Plakat, dessen Überschrift mit T beginnt und mit A endet (das kann natürlich alles mögliche sein, aber es kann auch etwas ganz besonderes sein …). Lassen sich die beiden Geschäfte neben der Stadtsparkasse identifizieren? Auf der Karosserie des mittleren Taxis spiegelt sich außerdem ein markantes Gebäude, aber das ist wohl der Bahnhof? – Außerdem: ist überhaupt sicher, daß beide Fotos zum gleichen Zeitpunkt aufgenommen wurden? Sieht nicht so aus?
Lieber Sven H.,
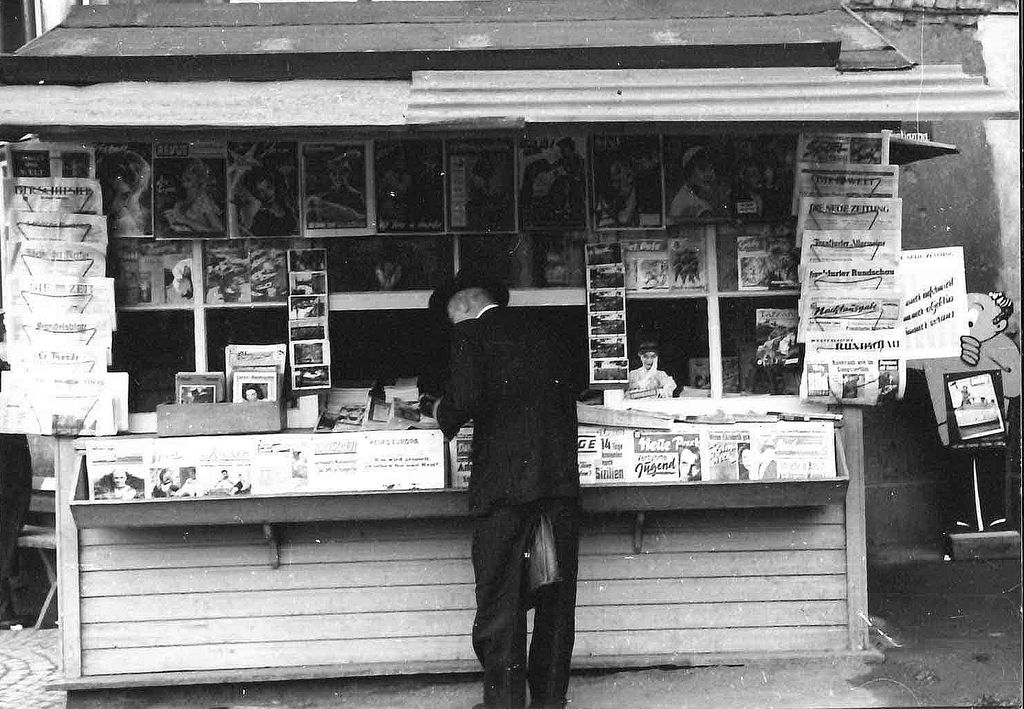
nein das Rätsel wurde noch nicht gelöst. Aber wenn es Ihnen gelingt diese Zeitungen zu datieren, dann sind wir vielleicht noch ein Stück weiter:
Leider gab die Vorlage nicht mehr her.
Hey, ein anderes Foto, das offensichtlich unmittelbar vor oder nach dem zweiten Foto aufgenommen wurde – das ist doch eine tolle Fundgrube! Viele Details sind leider nicht zu erkennen, aber es gäbe hier mehrere Lösungsansätze. Lassen sich die Postkarten identifizieren und datieren? Durch die Designs der vielen Zeitungs- und Illustrierten-Logos – die ja oft auch Änderungen unterworfen waren – ließe sich eventuell ein Zeitfenster eingrenzen („Bild“, „Frankfurter Nachtausgabe“, „Westfälische Rundschau“, „Frankfurter Rundschau“, „Frankfurter Allgemeine“, „Die Neue Zeitung“, „Die Welt“, „Der Schlesier“, „Rheinischer Merkur“, „Die ZEIT“, „Handelsblatt“, „Le Monde“, „Neue Post“). Auch die Tatsache, daß hier einige Zeitungen überhaupt zu sehen sind, grenzt den Zeitraum ein – so gab es den Titel der „Frankfurter Nachtausgabe“ erst ab 1951 (https://www.ub.uni-frankfurt.de/wertvoll/ffmztg4.html), die „Bild-Zeitung“ erschien lt. Wikipedia erstmals am 24.06.1952 (Schlagzeile: „[???]raub wie im Gangsterfilm“), und „Die Neue Zeitung“ (rechts) erschien lt. Wikipedia bundesweit nur bis September 1953 (danach nur in Berlin, wo sie im März 1955 eingestellt wurde). Das allein grenzt das Aufnahmedatum des Fotos bereits auf 1952/1953 ein! (Oder 1952-1955, falls „Die Neue Zeitung“ in ihrer auf Berlin beschränkten Ausgabe dennoch in Siegen erhältlich war.) Die „Neue Post“ mit der Schlagzeile „Verführte Jugend“ ist nicht sonderlich aussagekräftig; der abgebildete Herr daneben ist nicht zu erkennen, oder? „Die ZEIT“ am linken Rand wäre mit Hilfe des Online-Archivs auf zeit.de am schnellsten zu datieren gewesen, aber leider kann man außer dem Logo nichts sehen. Comic-Experten wüßten sicherlich sofort, welche Serien im rechten Bereich am Fenster hängen, leider ist es keine „Micky Maus“ … Am vielversprechendsten scheinen die oben links nebeneinander aushängenden Ausgaben der „Revue“ und des „Stern“ zu sein; letzterer hieß in den 1950er Jahren noch „Der Stern“ und hatte ein größeres Stern-Logo. Man müßte jetzt eigentlich nur noch die „Revue“- und „Stern“-Jahrgänge 1952 und 1953 nach dem jeweiligen Cover durchsehen. Neben den ursprünglichen Verlagen und normalen Bibliotheken könnten ebay und zvab.com möglicherweise helfen; bei der Suche wären wohl die Wintermonate auszuklammern, vgl. die belaubten Bäume gegenüber dem Bahnhof (nach Hochsommer sieht es auch nicht gerade aus). – Last but not least: gibt es noch andere Fotos aus derselben Serie, die zeitgleich aufgenommen worden sein dürften und auf denen wichtige Details zu sehen sind?
Nachtrag: Rechts neben den rechten Postkarten hängen zwei Ausgaben der Romanheftserie „Pete – Eine Zeitschrift für die Jugend“, die ab 1951 erschien.
Ich tippe auf den Seiteneingang der Bismarckschule
Richtig! Das ging aber schnell ……
Vermutlich wohnte in diesem Haus der Wärter der Breitenbachtalsperre bei Hilchenbach.
Richtig! Auch hier ging es schnell. Wenn jetzt noch der Architekt ermittelt wird, dann können wir uns auf die weiteren schönen Bilder konzentrieren.
P.S.: Das Bild vom 3.12. wurde noch nicht aufgelöst ……
Hallo,
ich vermute den Kreuztaler Architekten „Meckel“.
Noch einen schönen Sonntag
Cornelia Becker-Bartscherer
Kreishaus Siegen ehem. Seitenflügel, vorne vorgebauter Sitzungssaal, später Ausländeramt
Korrekt! Sollte aber auch für Sie nicht schwierig gewesen sein?
Kreishaus Siegen, ehem. Seitenflügel vor der Erweiterung von 6 Achsen zum späteren Hochaus hin und Aufstockung um eine Etage, daher kürzer als bekannt und nur EG und 4 Etagen, vorne Übergang zum alten Kreishaus, das dem Hochhaus weichen musste.
Richtig, vielen Dank für Ihre ergänzenden Erläuterungen!
Der Gebäudestruktur nach muss es sich um eine Molkerei handeln.
Wenn es sich um eine Molkerei handelt, wo stand denn diese?
1957 dürfte die Molkerei in Siegen- Geisweid gestanden haben.
Weder Molkerei noch Siegen-Geisweid. Also Weiterraten!
Es könnte sich um das Diakonissenhaus Haus Friedenshort in Freudenberg handeln. Baubeginn war dort 1955/56.
Korrekt! S. dazu http://www.siwiarchiv.de/?p=627
Eventuell steht das Modell in Zusammenhang mit Plänen um die Errichtung der Heilstätte Hengsbach, Siegen.
Pläne um die Errichtung (…) ist natürlich gut vorsichtig ausgedrückt, aber ich glaube nicht, dass es sich um die Heilstätte Hengsbach handelt.
An der rechten Seite ist ein Teich oder See, oder?
Welches Krankenhaus -denn etwas in der Richtung scheint mir das Modell auch darzustellen- hat/ hatte nur einen See/ Teich?! – Ich weiß es nicht?
Grüße aus Berlin
Dagmar Spies
Wer hat den nun Recht: die Expertin für die Heilstätte Hengsbach oder der versierte Regionalhistoriker? Was meinen die übrigen Leserinnen und Leser?
Pingback: siwiarchiv-Adventskalender 2015/10 | siwiarchiv.de
Das ist die „Heilstätte auf der Hengsbach“, 1952 im Juli war nach den entsprechenden Beschlüssen der Kreistags- und Kreisausschüsse dann im Juli Baubeginn, Oktober 1953 Fertigstellung der Heilstätte, des Schwestern- und des Ärztehauses.
Lungenheilstätte Hengsbach! Wg. den Staublungen der Bergleute und damals noch relartiv häufigen TBC-Erkrankungen. Fast autark oben links war das Brunnenhaus für die Wasserversorgung, unterhalb eine eigene Kläranlage! Dazwischen ein Minigolfplatz, ein Luxus zu damaliger Zeit !
Gefällt mir · Antworten · 1 · 9 Min · Bearbeitet
Es handelt sich tatsächlich um ein Modell der Lungenheilstätte Hengsbach! Vielen Dank fürs Mitraten und die weitergehenden Informationen!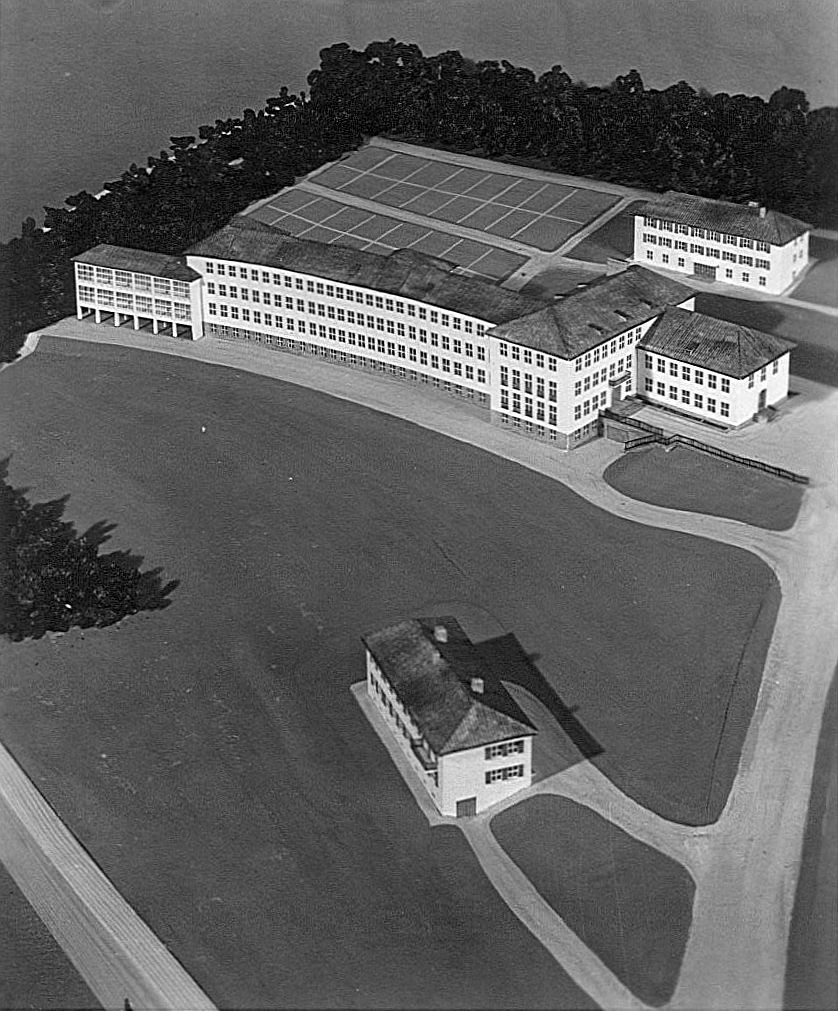
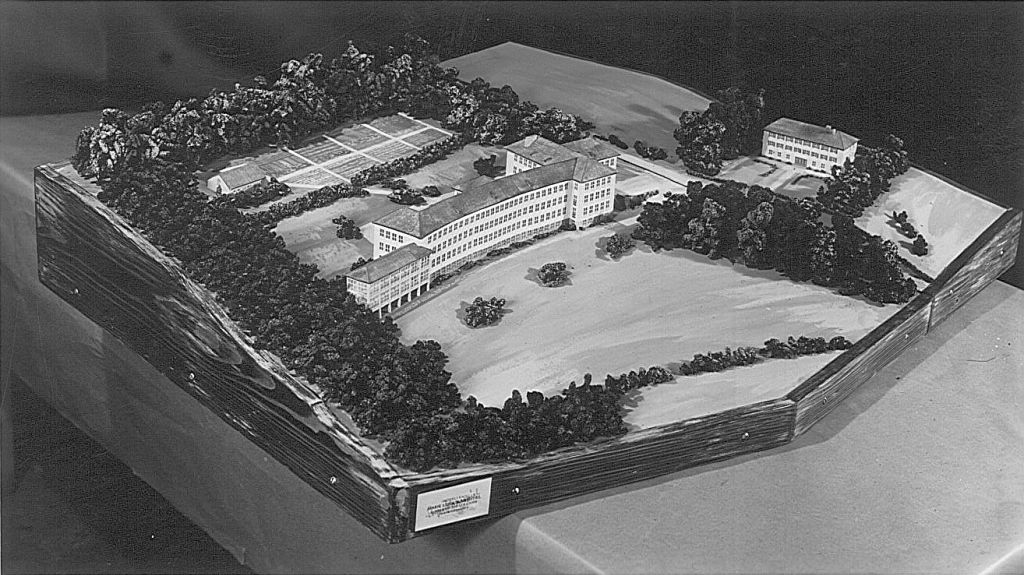
Als Danke schön 2 weitere Bilder:
Danke für die tollen Bilder :-)
Nachtrag II: Bei dem vorderen „Pete“-Heft, dessen Cover zu sehen ist, handelt es sich defintiv um „Eine schreckliche Erfindung“ – Heft Nr. 42 von 1953, vgl. Abbildung und Angaben auf http://www.detlef-heinsohn.de/hefte-pete.htm (etwas weiter unten). Links dahinter dürfte „Der Bund der Gerechten“ – Heft Nr. 41 stecken, vgl. dieselbe Abbildung auf derselben Seite. Nähere Angaben zu den Erscheinungstagen stehen dort nicht, aber da „Pete“ lt. Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Pete_%28Zeitschrift%29) am 8. Oktober 1951 startete und lt. http://www.detlef-heinsohn.de/hefte-pete.htm (das steht dort zu Beginn der Vorstellung der Heftserie) vierzehntägig erschien, ergibt sich für Heft Nr. 42 der 4. Mai 1953 (bei dieser Rechnung liegt der Jahreswechsel 1952/1953 tatsächlich zwischen den Ausgaben 33 und 34, wie es in der Liste auf derselben Seite auch nahegelegt wird). Es steht also schon mal fest, daß dieses Foto an oder nach diesem Datum aufgenommen worden ist, vermutlich in den ersten beiden Maiwochen?
Lieber Sven H., vielen Dank für die Datierung! Toll, was Sie alles in so kurzer Zeit ermittelt haben. Weitere Bilder liegen zwar vor, aber enthalten, wenn ich es recht sehe, keine Einzelheiten, die Ihre Ergebnisse noch präzisieren könnten. Wenn gewünscht, reiche ich diese Bilder aber gerne nach. Allerdings wird dies wohl erst zwischen den Jahren geschehen können.
Nix zu danken, so was macht Spaß. :o) Nachtrag III: Auch wenn die Erwähnung der „Micky Maus“ weiter oben eigentlich augenzwinkernd gemeint war, so ist sie tatsächlich ebenfalls zu finden, gleich links von den linken Postkarten. Es ist Heft 5/1953, vgl. http://coa.inducks.org/issue.php?c=de%2FMM1953-05 (man erkennt die schrägen Streifen der Tapete). Die „Micky Maus“ erschien damals monatlich und ein exakter Veröffentlichungstermin dürfte wohl kaum noch festzustellen sein – der stünde doch wohl sonst im Inducks? Immerhin verdichten sich damit die Hinweise auf den Mai. Links daneben hängt übrigens das „Micky Maus Sonderheft“ Nr. 4 („Im Land des Riesen“ – http://coa.inducks.org/issue.php?c=de%2FMMSH++4), lt. Inducks bereits am 15. April 1953 erschienen.
Nachtrag IV: Da wir in unserer Bibliothek „Die Neue Zeitung“ auf Mikrofilm haben und nun ein überschauberes Zeitfenster – Mai 1953 – offen zu stehen schien, habe ich versucht, die beiden auf dem Foto unterhalb des „Die Neue Zeitung“-Logos erkennbaren zweizeiligen Schlagzeilen auf einer Ausgabe wiederzufinden. Habe den gesamten Mai und mit wachsender Verzweiflung auch den Juni durchgesehen, aber nirgends war auf einer Titelseite in der linken Schlagzeile die zweite Zeile leicht länger als die erste und in der rechten Schlagzeile die erste Zeile bedeutend länger als die zweite. Dann fiel der Groschen, der Mikrofilm spulte ab dem 1. Mai langsam zurück … und siehe da: die auf dem Foto abgebildete „Die Neue Zeitung“-Ausgabe datiert vom 29. April 1953. Zum einen stimmen die Proportionen der Schlagzeilen zweifelsfrei überein, zum anderen befindet sich auf der unteren Hälfte der Titelseite ein Artikel über „Frankfurter Bankräuber vor dem Schwurgericht“ zu „einem der schwersten Banküberfälle in Deutschland“ am 16. August 1952 in Frankfurt-Bockenheim, bei dem zwei Angestellte getötet und ein dritter schwer verletzt wurde (vgl. „Bankraub wie im Gangsterfilm“ in der „Bild-Zeitung“). Das wär’s dann, oder? – Den Scan der Titelseite schicke ich Ihnen per Mail …
Chapeau!
Bei dem Gebäude handelt es sich um das 1952 eingeweihte ehemalige Alten- und Pflegeheim am Weidenauer Tiergarten. Wie das Gebäude heute genutzt wird, kann ich leider nicht sagen (vielleicht als Studentenwohnheim?).
Pingback: siwiarchiv-Adventskalender 2015/13 | siwiarchiv.de
Beides ist richtig (geraten).
Pingback: siwiarchiv-Adventskalender 2015/14 | siwiarchiv.de
Die Architekten waren Hoffmann und Bernshausen, die den Zuschlag für den Bau nach dem Gewinn eines Architektenwettbewerbs erhielten. Weitere Informationen zu dem Bau des Alters- und Pflegeheims in einem Beitrag von Sigrid Rapp-Ridder auf siwiarchiv
http://www.siwiarchiv.de/?p=10038
Pingback: siwiarchiv-Adventskalender 2015/15 | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 1.12. – 14.12.2015 | siwiarchiv.de
Korrekt! Danke fürs Mitmachen.
Architekt seitens des damaligen Kreises Siegen war Herbert Kienzler.
Kienzler hat wohl mehr als Architekt denn als Kreisbaurat dem Architektenwettbewerb vorgesessen.
Pingback: siwiarchiv-Adventskalender 2015/20 | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Adventskalender 2015/21 | siwiarchiv.de
Turnhalle am BK Wittgenstein?
Leider nein. Das Gebäude befindet sich im Siegerland.
Übrigens, es handelt sich auch nicht um das Hallenbad in Siegen-Weidenau, wie in der geschlossenen Facebook-Gruppe „Siegerland in alten und neuen Bildern“ vermutet wurde.
In der genannten Facebook-Gruppe wird vermutet, dass das Gebäude in Kreuztal steht bzw. stand. Wenn ja, welche Funktion hatte es?
Tipps vom Christkind: Das Gebäude steht nicht in Kreuztal, aber es hat etwas mit Flüssigkeiten zu tun.
Letzter Tipp: Das Gebäude steht in Hilchenbach.
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 15.12.2015 – 28.12.2015 | siwiarchiv.de
Auf der Homepage des Siegerländer Heimat- und Geschichtsvereins findet sich folgende, erfreuliche Nachricht: „Aufgrund der großen Nachfrage ist das Sonderheft „Hauberg“ der ZS Siegerland als Heft 2/2015 bereits vergriffen!“ Gratulation!
Pingback: ARCHIVAR 4 (2015) online | siwiarchiv.de
Lieber Herr Wolf, für die Gratulation sagen wir herzlichen Dank!
Mit besten Wünschen für das neue Jahr 2016
Cornelia Becker-Bartscherer
Was hier geschehen soll, ist schlichtweg ein Skandal. Kann und darf man so mit einem uralten, historischen Ortskern umgehen, wie man ihn im weiten Umkreis wohl nicht noch einmal findet. Zur Erinnerung und Information derer, die nicht die erforderliche Ortskenntnis haben: Da steht an der Hauptstraße „Schneidersch Hus“, ein prachtvolles, denkmalgeschütztes Gebäude von 1750, ehemals Gasthof für durchreisende Fuhrtleute und Posthalterei (um 1800), von seinen Besitzern liebevoll gepflegt. Gleich gegenüber, direkt vor der Kirche, das Schleifenbaumsche Haus, auch im Privatbesitz, anno 1731/32 auf Anordnung des Fürstenhauses als Kirchspielschule erbaut. Dann, im Herzen des Ortskernes, die schöne alte Kirche aus der Mitte des 13.Jahrhunderts, im spätromanisch-frühgotischen Stil errichtet. Sie verfügt über ein geschichtsträchtiges Innenleben und besitzt Glocken aus den Jahren 1512 und 1588. In unmittelbarer Nähe finden wir das älteste Pfarrhaus Nordrhein-Westfalens, erbaut 1608, ein bildschönes Baudenkmal von besonderem historischen Wert. Nur wenige Schritte davon entfernt steht die alte Pfarrscheune von 1736. Unmittelbar gegenüber im malerischen Winkel der alte Pfarrweiher mit dem Pfarrbackes, für den der damalige Pfarrer im Jahre 1750 die Baugenehmigung erhielt.
Diesem einmaligen historischen Ortskern will man nun an den Kragen.
Offenbar wurden hier Angstrechnungen erstellt, um den Menschen des Kirchspiels zu erklären, warum man Pfarrhaus und Kirche aufgeben muss.
Tatsache ist aber, dass kaum Kosten auf die Kirchengemeinde zukommen würden, da für solch wertvolle und erhaltenswürdige Bausubstanz genügend Fördermittel zur Verfügung stehen, um die sich offensichtlich niemand bemüht hat. Wie sonst konnte man den Menschen erzählen, dass auf die Gemeinde möglicherweise eine sechsstellige Summe zukommen würde?
Die verantwortlichen Damen und Herren sind hier dringends gefordert die offenbar übereilten Beschlüsse zu überdenken, um den sonst drohenden Raubbau an Kultur und Historie zu vermeiden. Oberholzklau muss erhalten bleiben ! ! ! !
Pingback: Literaturhinweis: Jürgen Bellers „Siegen als geistige Lebensform | siwiarchiv.de
Es ist immer wieder verblüffend zu sehen, welch denkwürdige, in der Heimatpresse eifrig gelobte Novitäten die Siegener Lokalhistoriographie hervorbringt. Der vorliegende Fall betrifft ein „Büchlein“ (S. 7), das, wie es aussieht, seinen Verfasser und Gegenstand vor dem Leser ängstlich zu verbergen sucht; Einband und Titelblatt geben darüber keine Auskunft!
Den Namen des Autors enthüllen die beiden Herausgeber – der Stadtarchivar und der Leiter der Geschichtswerkstatt Siegen – erst in ihrem Vorwort. Sie stellen Tobias Gerhardus als einen Mann der „freien Wirtschaft“ aus dem „Nachbarkreis Altenkirchen“ vor (S. 8). Wer die Ohren spitzt, erfährt: Gerhardus war ‒ nach Besuch der Philosophischen Fakultät Siegen ‒ Praktikant im Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein und bekam, obschon bildungshistorischer Laie, den Auftrag, einen „Zeitstrahl“, eine „kurze Chronik“ des „Lӱz“ zu erarbeiten; daraus erwuchs das besagte „Büchlein“. Gerhardus ist Jungunionist, Ratsherr, Kreistagsabgeordneter, CDU-Stadt-, Kreis- und Bezirksvorstandsmitglied und, wie die Spatzen von den Westerwälder Dächern pfeifen, auf dem Sprung, über kurz oder lang in den Landtag von Rheinland-Pfalz einzuziehen. Es scheint, als wollten die Herausgeber den unbedarften Rezipienten an der Nase herumführen.
Den Umschlag vorn ziert ein Zitat: „Die zeitgemäße Ausbildung des weiblichen Geschlechts“. Wer zu lesen beginnt, bemerkt rasch, dass das Buch nicht hält, was es verspricht; es handelt nicht von „Bildung“ oder (beruflicher) „Ausbildung“, von Weiblichkeitsbild, „Philosophie“ und Alltag einer höheren Mädchenschule. Den Umschlag hinten dominiert ein Text über Ziel und Zweck der „Frauenschule“, die ihre Zöglinge auf die Rolle der „Hausfrau, Mutter und Staatsbürgerin“ vorbereiten sollte; doch gab es am Siegener Lyzeum, von einer flüchtigen Episode 1920/23 abgesehen, einen solchen Frauenschulzweig gar nicht. Die Herausgeber ihrerseits akzentuieren die baugeschichtlichen Früchte des Buches (S. 7). Wer nun erwartet, er erfahre Neues über die Architektur preußischer (Straf-, Kasernen-, Kranken- und) Lehranstalten oder die Erziehungsideale verflossener Zeiten, die, in Stein gesetzt, am „Lӱz“ zu bewundern sind, sieht sich arg enttäuscht.
Die Herausgeber betonen (S. 7), sie hätten, als Tobias Gerhardus Kontakt mit ihnen aufnahm, „spontan“ entschieden, das Manuskript zu publizieren. Gewiss, auf Intuition und „Bauchgefühl“ zu vertrauen, erspart Zeit und Mühe (und ist modisch); bisweilen hilft aber, den Verstand und ein wenig Sorgfalt walten zu lassen. Die „bedeutsame Ausarbeitung“ (S. 7), welche die Editoren dem staunenden Publikum präsentieren, ist, bei Licht betrachtet, Blendwerk und Mogelpackung.
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 29.12.2015 – 11.1.2016 | siwiarchiv.de
Gute Idee. Immerhin vereint dieses Titelfoto damit die Archive im Kreis Siegen-Wittgenstein – was ja auch Siwiarchiv macht. Und es macht deutlich, wie individuell und eigen es in den einzelnen Archiven im Landkreis aussieht.
Danke für die Meinung! In der geschlossenen Facebook-Gruppe „Archivfragen“ oszilliert die Meinung zurzeit zwischen „langweilig“ und „interessant“. Wir sind auf weitere Einschätzungen gespannt.
In jedem Fall besser als die leere, von Geisterhand bewegte Rollregalanlage – damit assoziiert ein Archivfremder vermutlich nicht viel. Die Fotocollage zeigt ein reales Bild des kommunalen Archivwesens: Es sind Unterlagen vorhanden, die in verschiedenen Stadien magazintechnischer Aufbereitung gezeigt werden. Echtes Archivleben eben! Daumen hoch ;-)
Danke für den Kommentar! Ich habe ja vorher nicht gefragt und bis jetzt nicht „Negatives“ zum alten Titelbild gehört. Daher auch dafür: danke!
Der Kommentar war auch nicht negativ in Bezug auf das alte Bild gemeint, das ich schon ansprechend fand. Aber als Archivar sieht man die Dinge ja auch mit entsprechendem Vorwissen, was mir erst im Vergleich aufgefallen ist. Insofern: Gut (alt) und besser (neu).
Pingback: siwiarchiv wird 4 Jahre alt | siwiarchiv.de
Pingback: Flucht, Migration und Geisteswissenschaften. Resümee zur Blogparade #refhum | Krosworldia
Pingback: Flucht, Migration und Geisteswissenschaften. Resümee zur Blogparade #refhum | Krosworldia
hallo zusammen , der name siegerland wurde gewählt weil die frau von otto albers aus dem siegerland stammte.
ich hab 1966 als moses auf der siegerland angefangen .
Goodmorning.
My name is Regina Woods.
I am born in Ireland in 1968.
My father was working on the Siegerlander and I am looking for him.
Please if anybody could help me on this.
He called himself charlie.
Wich is not a German name.
He was working as a cook.
Please if there is anybody that could help me.
With kind regards.
Pingback: 4 Frachtschiffe trugen den Namen „Siegerland“ | siwiarchiv.de
Pingback: „Jüdische Soldaten des 1. Weltkriegs aus der Synagogengemeinde Siegen“ | siwiarchiv.de
Der 2.500. Unterzeichner der Petition kommt aus Siegen. Danke an alle Unterzeichnenden von hier! Diejenigen die noch nicht gezeichnet haben, können dies gerne noch nachholen.
Pingback: Frachtschiffe „Siegerland“ der Reederei Otto Albers | siwiarchiv.de
Pingback: Vortrag „Jüdische Soldaten des Ersten Weltkriegs aus der Synagogengemeinde Siegen“ | siwiarchiv.de
Die Flasche könnte für den OKD Forster zur Verarbschiedung gewesen sein.
Reifezeit von 1975-1999 = Amtszeit im Kreis Siegen, später Siegen-Wittgenstein. Der Emanzipationsgehalt für das Wittgensteiner Bergvolk könnte auf die Zusammenlegung der Kreise Siegen und Wittgenstein anspielen, der „Beitrag zur Völkerverständigung“ eventuell auf Spandau und Emek Hefer.
Alles sehr gut hergeleitet – aber leider nicht richtig. Ich verweise auf die Lesungen …. :
Das könnte für Karl-Heinz Haepp gewesen sein, der sich lange Jahre mit der Ergänzung unserer Kreis-Bezeichnung mit dem Zusatz Wittgenstein eingesetzt hat. Bekanntlich hat das ja nach der Zusammenlegung der Kreise ein wenig gedauert.
Die Person ist richtig, die Begründung aber zu allgemein. Übrigens den konkreten Anlass findet man auch auf der Homepage des Kreises: http://www.siegen-wittgenstein.de/ .
Dann präziser: Das Wappen wurde durch die schwarz-silbernen Balken aus dem alten Wittgensteiner Wappen ergänzt.
Richtig! Zum Wappen: http://www.siwiarchiv.de/?p=7739 und http://www.siwiarchiv.de/?p=9954 .
Karl Heinz Happ gibt via E-Mail folgende Ergänzungen: “ ….. Erwähnenswert ist sicherlich noch, dass mit der Aufnahme der Wittgensteiner Pfähle der Nassauische Löwe „nach hinten“ rücken musste, weil er sonst -wie früher- aus dem Wappen „herausgeschaut“ hätte, was die Münsteraner Heraldiker nicht für richtig hielten.
Festhalten sollte man auch, dass die Flasche von Anne Bade ?? überreicht worden ist; …..“
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 26.1. – 8.2.2016 | siwiarchiv.de
Ein Reaktion auf Twitter:
Mehr Informationen jetzt unter http://archivamt.hypotheses.org/3158
Vielen Dank für den ergänzenden Hinweis!
Pingback: Vortrag „Die Fachwerkwohnhäuser der Arbeiter der Siegerländer Eisenindustrie“ | siwiarchiv.de
Zum Thema ist ebenfalls online greifbar:
Buchholz, Matthias: Stichprobenverfahren bei massenhaft gleichförmigen Einzelfallakten : eine Fallstudie am Beispiel von Sozialhilfeakten. In: Historical Social Research 27 (2002), 2/3, pp. 100-223. URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-31255
Pingback: Stolpersteinverlegung für Otto Bäcker | siwiarchiv.de
Vielen Dank für den Beitrag zu Otto Bäcker und die online Veröffentlichung
der Broschüre zum 2. Mai 1933 im Siegerland.
An besagtem Tag war ein weiterer Gewerkschafter und Sozialdemokrat
im Gewerkschaftshaus anwesend Ernst Bruch. Auch er wurde schwer geschlagen und verstarb infolge dieser Misshandlungen 1942.
Bisher gab es in der regionalen Literatur und Erinnerung keinen Hinweis auf ihn.
Ernst Bruch
Ernst Paul Bruch wurde im Jahre 1891 in Weidenau als Sohn des Schankwirts
Wilhelm Bruch und der Emilie geborene Klein geboren.
Er heiratete im Jahre 1913 Anna Katharina Margarethe Jung aus Siegen,
das Ehepaar wohnte im Kirchweg 30.
Während des 1. Weltkriegs war Ernst Bruch Soldat in einem Infanterieregiment.
Nach dem Tode seiner Ehefrau heiratete Ernst Bruch 1923 die Schneiderin Bertha Hoffmann aus Banfe. Diese Ehe wurde geschieden.
Seine dritte Ehe ging er 1929 mit Auguste Martha Maria Knauf ein.
In den zwanziger Jahren trat Ernst Bruch in die SPD ein und wurde Mitglied einer der Freien Gewerkschaften die im ADGB organisiert waren.
Als Sozialdemokrat und Gewerkschafter war sein Eintritt in das von Sozialdemokraten dominierte, in Reaktion auf rechtsextreme Putschversuche entstandene Reichsbanner Schwarz–Rot–Gold ein Zeichen seiner politischen Überzeugung.
Wir dürfen davon ausgehen, dass Ernst Bruch nach seiner Partei- und Organisationszugehörigkeit ein Gegner des Nationalsozialismus war.
In den wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu Beginn der 30er Jahre wurde der Heizungsmonteur Ernst Bruch Hausmeister im Gewerkschaftshaus der sozialdemokratisch orientierten ADGB–Gewerkschaften in der Siegener Sandstraße. Hier hatte er mit seiner Familie eine kleine Dienstwohnung.
Als die Nazis am 2. Mai 1933 die Gewerkschaftshäuser in Deutschland stürmten und damit die Gewerkschaften endgültig zerschlugen, wurde auch das Haus in der Siegener Sandstraße verwüstet. Die anwesenden Gewerkschaftsmitglieder, darunter auch Ernst Bruch, wurden durch das SA-Kommando Odendahl schwer misshandelt.
Im Gerichtsverfahren gegen das „Rollkommando Odendahl“ wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit 1948 schilderten die zu diesem Zeitpunkt noch lebenden Zeugen den Hergang der Ereignisse.
Zeuge Peter Müller: „Auch der Hausmeister Bruch, der inzwischen verstorben ist, wurde an diesem Tage von der SA schwer misshandelt. Er war seit dieser
Zeit bis zu seinem Tode kränklich.“
Das Gericht stellte fest: „Der Hausmeister Bruch wurde so geschlagen, dass sein Körper blutige und blutunterlaufene Stellen aufwies. Er klagte auch über Nierenbeschwerden…“
Die Nationalsozialisten beschlagnahmten das Gewerkschaftshaus. Es fanden dort weitere Misshandlungen von politischen Gegnern statt.
Ernst Bruch verlor seinen Arbeitsplatz und damit die Existenzgrundlage für sich und seine Familie.
Als Gegner des Nationalsozialismus fand er erst 1937 wieder Arbeit bei der Heeresstandortlohnstelle, er wurde dort als Heizer beschäftigt.
Doch Aufgrund der schweren Misshandlungen erkrankte er dauerhaft und erleidet einige Jahre später einen Schlaganfall.
Ernst Bruch verstarb am 4.2.1942 an den Folgen der Misshandlungen vom
2. Mai 1933 im Alter von 50 Jahren.
Torsten Thomas
VVN-BdA Siegerland – Wittgenstein
Vielen Dank für diese wichtige Ergänzung! Welche Quellen wurden für die Recherche genutzt?
Bei den Angaben zur Familie Bruch habe ich die Unterlagen der Standesämter Siegen und Weidenau im Stadtarchiv Siegen genutzt.
Alle anderen Angaben enstammen der Entschädigungsakte
LAV NRW Abteilung Westfalen, Regierung Arnsberg, Wiedergutmachung
Nr. 26878 Ernst Bruch,
Hier wird leider statt des ursprünglich verlinkten Videos eine Fernsehshow von ProSieben angezeigt, die so gar nichts mit Latène-Ofen zu tun hat. Es wäre wohl ratsam, diesen Link zu entfernen.
Danke für den Hinweis!
Hallo Torsten, tolle Arbeit. Eine Frage bleibt: warum nicht den Text in das Regionale Personenlexikon einpflegen?
Regionales Personenlexikon oder Aktives Gedenkbuch?
Der Text soll in das Aktive Gedenkbuch, die Fassung wird dafür gerade überarbeitet und es wird bestimmt nicht mehr lange dauern.
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 8.2. – 22.2.2016 | siwiarchiv.de
Pingback: „Jüdische Soldaten des Ersten Weltkriegs aus der Synagogengemeinde Siegen“ | siwiarchiv.de
Pingback: Was ist Kultur? Versuche einer Definition #KultDef 3
Link zu einem Beitrag in der WDR-Lokalzeit Südwestfalen zur Gestaltung des Herrengarten-Geländes: http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit-suedwestfalen/video-zoff-um-den-herrengarten-siegen-100.html
Pingback: Zum 7. Jahrestag des Archiveinsturzes in Köln | siwiarchiv.de
Zur Resonanz siehe Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach 2/2016, S. 16: http://www.hilchenbach.de/doc.cfm?seite=443&urlDoc=pfaddownloads/443downloads/abb1602.pdf
Pingback: Ausstellungseröffnung „Diesterweg populär“ | siwiarchiv.de
Foto 3 zeigt Straßen- und Güter-Schienenverkehr vereint an Koch´s Ecke.-über Koblenzer Str. bis zur Eintracht.
Stimmt! Aber gesucht ist dies leider nicht.
Bild 1: vorne rechts ist ein „Auto“ in das Bild hineinmontiert.Das Auto kommt offensichtlich von links (Koblenzer Straße), wie hat es sich auf die Kreuzung gemogelt, wenn der Linksabbiegerverkehr aus der Frankfurter Straße freie Fahrt hat?
Stimmt! Übrigens, auch scheint das Auto verkleinert worden zu sein …..
Fein beobachtet! Aber welchen Typ stellt denn dieses ‚Spielzeugauto‘ dar? Kleine Korrektur: Der Linksabbiegerverkehr kommt aus der Spandauer Straße, damals Wilhelmstraße. Zur Datierung: Die Bilder 1 und 2 dürften kurz nach 1963 aufgenommen sein. Damals gab es nach Bau der Spandauer Brücke eine Neuordnung der Verkehrsregelung in der Unterstadt mit Einführung des “amerikanischen Abbiegens“, man beachte das Schild im Vordergrund; diese neuartige Verkehrsführung verursachte dem deutschen Automobilisten viel Unbehagen, was zu täglichen Blechschäden an Kochs Ecke führte. Bild 3 dürfte 1969 aufgenommen sein wg. des eingerüsteten Hotels Koch im Hintergrund; die Neueröffnung nach der Aufstockung war wohl 1970.
Vielen Dank für die Datierungshinweise!
Die Achenbach-Ausstellung hätte ich noch mit dem Ehrenbürgerbrief der Stadt Siegen für den Reichskanzler Adolf Hitler ergänzen können. Die Ehrenbürgerschaft wurde im Stadtrat am 1. April 1933 gegen 4 Stimmen der SPD-Abgeordneten beschlossen. Den Wettbewerb für die Ausgestaltung der Ehrenbürgerkassette gewann der heimische Künstler Hermann Kuhmichel. Den Text für den Brief schrieb Museumsdirektor Dr. Kruse. Die Ausgestaltung des Ehrenbürgerbriefs sowie das Abschreiben des Kruse-Textes übernahm Hans Achenbach für 300 RM. Zur Übergabe des Ehrenbürgerbriefs reisten der Gauinspektor Heriinglake und Gauleiter Wagner im Novemeber 1934 nach Berlin. Eine Übergabe schlug fehl, weil der „Kanzler wegen starker Inanspruchnahme“ verhindert war. So schickte OB Fißmer den Ehrenbürgerbrief am 14. Dezember 1934 per Post zum Reichskanzler.
StaSi, 2. Registratur Nr. 368 (Angabe wahrscheinlich veraltet)
Danke für die Ergänzung!
Pingback: Beamtenkartei in der Datenbank Nassau-Oranien | siwiarchiv.de
Hallo,
rechts hinter den Taxen sind zwei Geschäfte, in einem habe ich meine Ausbildung (1967) gemacht: Grete Füllengraben Miederwaren, habe im Netz nachgeschaut, Frau Füllengraben hat das Geschäft eröffnet am 01.03.1958. Also muss das Bild mit den Taxen nach 1958 entstanden sein. Daneben ist noch die Sparkassenpassage. Der ganze Häuserkomplex, so wie mir bekannt ist, gehörte der Bundesbahn bzw. der Eisenbahnerwohnungsgenossenschaft (heißt heute anders) . Diese hat heute ihren Sitz in Weidenau und die müssten ja noch wissen, wann die Passage gebaut worden ist?
Vielen Dank für den hilfreichen Hinweis!
Einem E-Mail-Hinweis folgend hier nun weitere Literatur zu Hans Achenbach:
1) Schwarz, Kirsten: Hans Achenbach – das künstlerische Werk, in: Siegerland, 2009, H.1, S. 64ff
2) Löw, Wilhelm: Hans und Hanna Achenbach – in: Siegerland. Bd 30, 1953, S. 31-38.
3) Heifer, Otto: Von der Landschaft zum Proträt.Der künstlerische Weg des Malers Hans Achenbach, in: Siegener Zeitung Jg. 121 Nr. 213, 11.9.1943
4) Paul Niehaus: Atelierbesuch bei Hans Achenbach. Das Lebenswerk eines Sechzigers, in: Westfalenpost/siegenerländer Zeitung Jg. 6, Nr 116 v. 22.5.1951
6) Alfred Becker und Kirsten Schwarz: Beschreibung der Bleistiftzeichnungen von Hans Achenbach für „Mai“ und „Oktober“, Siegerland Bd. 86 H 2 (2009), Seite 153ff
7) Alfred Becker und Kirsten Schwarz: Beschreibung des Kalenderbildes von Hans Achenbach für den Monat Januar, Siegerland Bd. 86 H 2 (2009), Seite 158ff
8) Alfred Becker und Kirsten Schwarz: Die Kalenderbilder des Siegerländer Malers Hans Achenbach, Siegerland Bd. 85 H 2 (2008),Seite 167ff
9) Alfred Becker und Kirsten Schwarz: Die Kalenderbilder des Siegerländer Malers Hans Achenbach, Siegerland Bd. 85 H 1 (2008), 94ff
10) Erika Falkson: Kinder und einfache Menschen gemalt. Zum 100. Geburtstag von Hanna Achenbach-Junemann, Siegerland Bd. 69 H 3-4 (1992), Seite 79ff
11) Ursula Blanchebarbe: Bilder vom bäuerlichen Leben geprägt. Erinnerung zum 100. Geburtstag von Hans Achenbach, Siegerland Bd. 68 H 1-2 (1991), Seite 11ff
Zeitungsartikel (mit Hanna Achenbach-Junnemann):
1) Siegener Zeitung 14.12.1965, 3.3.1966, 24.12.1971, 31.8.1972
2) Westfälische Rundschau 1.2.1958, 2.3.1961, 1.12.1962, 2.3.1966
3) Westfalenpost 2.3.1961, 19.3.1963, 3.3.1966
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 23.2. – 7.3.2016 | siwiarchiv.de
¨Warum erwähnt mann nicht das Belgische Streitkräfte während praktisch ein halbes Jahrhundert dan einkwartiert wurden …
… weil dies eine Tafel ist, die an das Hauptdurchgangslager Wellersberg für Flüchtlinge und Vertriebene erinnert. Die Gedenkstätte für die belgischen Streitkräfte befindet sich auf dem Heidenberg;dort ist auch eine Tafel angebracht.
Danke für den Hinweis!
Das interessiert keinen mehr in Siegen.
Sohn eines Soldaten
Woran machen Sie das Desinteresse fest?
Hallo,
ist die Gedenktafel angebracht worden? Wenn ja, wo?
Die Tafel ist dort noch nicht angebracht. Auf den Artikel in der Westfälischen Rundschau v. 17.9.2015 wird verwiesen. Ferner empfiehlt sich eine Suche im Ratsinformationssystem der Stadt Siegen nach den Begriffen „Wellersberg“ und „Gedenktafel“
Pingback: Literaturhinweis: „Unbekannte Quellen: ‚Massenakten‘ des 20. Jahrhunderts“ Band 3 | siwiarchiv.de
Pingback: „Becher-Häuser“ in Netphen-Grissenbach | siwiarchiv.de
Unter dem Titel „Siegerländer Fachwerkhäuser und die Industriegeschichte“ befindet sich in den Siegener Beiträgen 18, 2013, S. 128-147 ein Artikel zu dem Thema. Der geneigte Leser findet darin die „wahre“ Geschichte der Siegerländer Fachwerkhäuser und viele aufgeworfene Fragen.
Danke für die Ergänzung!
Pingback: 68. Westfälischer Archivtag in Lünen. Abstracts: | siwiarchiv.de
Pingback: „Zeitzeugen auf Zelluloid“ zur Filmsammlung Apelt: | siwiarchiv.de
Ab sofort: Buchung und Reservierung von Gruppenführungen durch die Ausstellung!
Für die Ausstellung „Siegen an der ‚Heimatfront‘. 1914-1918: Weltkriegsalltag in der Provinz“, die vom 17. April bis 19. Juni 2016 im Siegerlandmuseum im Oberen Schloss gezeigt wird, können ab sofort auch Gruppenführungen gebucht werden! Für Rückfragen und Reservierungen steht Herr Christian Brachthäuser vom Stadtarchiv Siegen unter der Rufnummer 0271 / 404-3090 oder per Mail unter c.brachthaeuser@siegen.de zur Verfügung.
Die Veranstalter (Geschichtswerkstatt Siegen e.V. und Stadtarchiv Siegen) weisen aus gegebenem Anlass darauf hin, dass alle Gruppen und Schulklassen unabhängig von einer getätigten Buchung den Eintrittspreis direkt an der Museumskasse zu entrichten haben. Der ermäßigte Eintrittspreis für Kinder, Jugendliche, Studenten bis 26 Jahre sowie Besitzer/innen der Jugendleiterkarte (JuLeiKa) und des Schwerbehindertenausweises beträgt in Gruppen ab 10 Personen 1,00 € pro Person, für Erwachsene 2,50 € pro Person. Zusätzlich zu dem ermäßigten Museumseintritt wird eine Pauschale für die bestellten Führungen erhoben, die bar bei der jeweiligen Ausstellungsführerin bzw. bei dem jeweiligen Ausstellungsführer zu bezahlen ist. Das Honorar für Führungen von Schulklassen beträgt 30,00 €, für Erwachsenengruppen 50,00 €.
Aus organisatorischen Gründen können im Rahmen der Öffnungszeiten des Siegerlandmuseums im Oberen Schloss (dienstags bis sonntags 10.00 – 17.00 Uhr, Montag geschlossen) maximal vier Führungen pro Tag angeboten werden. Die Sonderöffnungszeiten zu Ostern und Pfingsten sind auf der Website des Siegerlandmuseums unter http://www.siegerlandmuseum.de zu entnehmen.
Pingback: Ausstellung „Siegen an der ‚Heimatfront‘. 1914-1918“. Führungen | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 8.3. – 21.3.2016 | siwiarchiv.de
Pingback: Fernsehtipp „Die Fürsten zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg“ | siwiarchiv.de
Neues zum Stand der Dinge in Oberholzklau findet sich heute im Magazin freudenberg-online.de: http://freudenberg-online.com/index.php/8-aktuelle-nachrichten/3190-historische-gebaeude-in-not
Irgendwie ist die Sache für mich nicht schlüssig:
Ich ging davon aus, dass die Unterlagen nur hinsichtlich ihres Inhalts zu prüfen sind, ein zeitlicher Aspekt („Unterlagen, die vor dem TT.MM.JJJJ entstanden sind…“) ist dem IFG nicht zu entnehmen oder?
Was bedeutete das für vor dem 1.1.06 geschlossene Akten, die bis zu weitere 30 Jahre in der Behördenregistratur oder im Zwischenarchiv verbleiben?
Wie Sie richtig ausführen müsste noch genauer als bisher das genaue Zugangsjahr in den Erschliessungsdaten vermerkt werden, um überhaupt prüfen zu können, ob ein Zugang nach IFG ermöglicht werden kann (Bei einigen früheren amtl. Akzessionen ist mir das nicht möglich).
Soll das nun auch bedeuten, dass Unterlagen, die die eigene Person betreffen gem. BDSG auch nur dann eingesehen werden dürfen, wenn sie vor Errichtung des BDSG abgegeben wurden?
Wie siehts mit Schutzfristen aus? Gelten die dann auch nicht je nach aktueller Rechtslage (im BArchG ist ja wohl z. B. ggf. eine Absenkung 30 auf 10 Jahre nach Tod bzw. von 110 auf 100 Jahre nach Geburt peplant), sondern ausgehend vom Abgabezeitpunkt und welche Fristen hier galten?
*nach der Errichtung des BDSG
Pingback: Informationsfreiheitsgesetz-Archivgesetz-Datenschutzgesetz | VdA-blog.de
Pingback: Informationsfreiheitsgesetze und Archivrecht | Archivalia
Bericht in der Zeitung der Welt: NRW hat kein Geld mehr für den Denkmalschutz
zur Info:
http://www.welt.de/kultur/kunst-und-architektur/article114433249/NRW-hat-kein-Geld-mehr-fuer-den-Denkmalschutz.html
Es handelt sich um ein Artikel aus dem Jahr 2013. Selbst wenn das Land NRW kein bzw. weniger Geld für den Denkmalschutz zur Verfügung stellt, blieben noch der Bund, der Landschaftsverband Westfalen-Lippe, die Kommune, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, …..
Pingback: Technikmuseum Freudenberg – Museums-Momente für Menschen mit Demenz | siwiarchiv.de
Die Lösung lautet Kreishaus Siegen, Koblenzer Straße. Die Umrisse der Gebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite sind mir sehr vertraut. Um den Erhalt von einem der Gebäude habe ich mich sehr bemüht. Einen schönen Abend.
Christian Welter
Gratulation! Ich glaube, dass erwähnte Gebäude war hier auch bereits Thema: http://www.siwiarchiv.de/?p=9190 .
Das ist richtig.
Pingback: Markierungen 03/31/2016 - Snippets
Gerade in der Mittagspause kam der Hinweis von einer Kollegin, ob es sich um Kunst-Wittgenstein handeln könnte ……
Pingback: Linktipp: Wohnhaus Heinrich Flender, Erich-Pachnicke-Straße 12, Siegen | siwiarchiv.de
Könnte es sich um Banfe handeln mit Blickrichtung über den Ort hinweg auf Auerbachtal (heute mit Fa. WKW bebaut), Gr. und Kl. Alertsberg und Spreitzkopf?
Da war lag ich im ersten Versuch daneben….
Nach nochmaliger Betrachtung und Beratung mit Stefan Leipelt ist es ziemlich sicher der Blick über Laasphe (links die Walmdächer Bahnhofstraße, rechts Altstadt) Richtung Gennernbach.
Standort des Fotografen könnte Kalteborn gewesen sein.
Vielen Dank für die Hinweise!
Pingback: Suchanfrage: Freudenberger Stadtbrand vor 350 Jahren | siwiarchiv.de
Das Foto ist ca. 100 Jahre alt und man erkennt eine ganze Reihe Häuser im Tal. Deshalb vermute ich mal, dass das Foto über die Stadt Laasphe selber aufgenommen wurde. Weiter vermute ich, dass der Fotograf im Süden der Stadt (Buhlberg?) stand und in Richtung Nord-Nordost d. h. Puderbach (Rote Hardt, Stein, Hermannsberg) fotografiert hat.
kann leider dieses Jahr nicht dabei sein. Freue mich auf das nächste Mal
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 22.3 – 4.4.2016 | siwiarchiv.de
Bei den Herren direkt neben Karl Althaus dürfte es sich höchstwahrscheinlich um Folke Rogard (1899-1973) gehandelt haben, von 1949 bis 1970 Präsident des Weltschachbundes FIDE (Fédération Internationale des Echecs); ihm zur Seite (am ganz rechten Bildrand mit Brille) Ludwig Schneider (1907-1975), von 1969 bis 1975 Präsident des Deutschen Schachbundes (DSB).
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich würde mich freuen, wenn Sie mirt die Folge 22 (Thielicke) gegen Rechnung zusenden würden.
Im Voraus danke ich Ihnen herzlich!
Pingback: Eröffnung der Ausstellung „Siegen an der ‚Heimatfront‘ – 1914-1918 – Weltkriegsalltag in der Provinz“ | siwiarchiv.de
Pingback: „Geschichte machen“ – Bilder einer Ausstellungseröffnung | siwiarchiv.de
Pingback: Ausstellungstipp: „Das Bauhaus. Alles ist Design“ | siwiarchiv.de
Nachfrage: Ist das eine Karte vom Kreis Siegen oder vom Regierungsbezirk Arnsberg?
In der alten Titelaufnahme der ULB Münster steht: „1 Kt. auf 6 Bl. im Schuber“. Offensichtlich wurden 6 Einzelkarten des Regierungsbezirks beschnitten und zusammengeklebt (deshalb auch sechsmal der Besitzerstempel). „Kreis Siegen“ ist die stehengebliebene Beschriftung des unteren mittleren Blattes und für das Ganze natürlich irreführend.
P.K.
Danke für die Antwort! War leider einige Tage nur sporadisch online.
Wer soll das Museum betreiben?
Was würde der laufende Betrieb kosten?
Wie hoch wären die Investitionen?
Wäre das Museum auch auf einer Teilfläche möglich?
Das sind die wesentlichen Fragen, die sich der Siegerländer so stellt, und die stellt er sich seit einem halben Jahrhundert und schafft es nicht, gleichzeitig für die Idee eines Industriemuseums eine Stiftung oder ähnliches zu gründen, die heute weit über eine Millionen Euro Startkapital haben könnte.
Auch wurde es versäumt, sich intensiv darum zu bemühen, einen der Standorte des LWL-Industriemuseums, Westfälisches Landesmusuem für Industriekultur, in das Siegerland zu holen.
Jetzt ein Industriemuseum im Siegerland aufzubauen, wird ungleich schwerer als früher, auch wenn geeignetes Gelände und Gebäude durchaus vorhanden sind. Ich drücke mal meine Hoffnung aus, dass es noch gelingt.
Für die Diskussion ist es vielleicht hilfreich einen Blick auf die Sitzung des Kreiskulturausschuss vom 29.6.2010 zu werfen. Dort wurde die Errichtung einer Dokumentationsstelle Wirtschaftsgeschichte diskutiert: Vorlage und Niederschrift.
Zum Vorschlag Günter Dicks s. a. Artikel in der Westfälischen Rundschau v. 1.4.2016.
Auch ohne das Industriemuseum in Hilchenbach gibt es im Siegerland und
angrenzenden Gebieten ein reiches montangeschichtliches Erbe. Aber wer
kennt es? Ein erstes zartes Pflänzchen könnt die Eisenstraße Südwestfalen sein. Den Tourismusverband SI muss man hier jedoch zum Kampfplatz tragen. Der ist eher für Büffel in Wittgensteiner Wäldern zu haben.
Erste Informationen zu dieser Ausstellung gibt ein Artikel in der Westfälischen Rundschau von heute: http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/auswirkungen-des-ersten-weltkrieges-im-siegerland-id11725351.html
Die Idee eines Siegerländer Industriemuseums ist in Anbetracht der einmaligen historischen Landschaft befürwortenswert, aber die Umsetzung organisatorisch und finanziell nicht praktikabel. Zehn- und hunderttausende Besucher pro Jahr, die notwendig sind, um Gebäudekomplexe wie das ehemalige Hammerwerk Carl Vorländer GmbH pädagogisch wertvoll zu nutzen und die Bausubstanz auch die nächsten 50 Jahre nach neuen (Sicherheits-)Standards zu erhalten, sind leider nicht zu akquirieren. Statt sich einen solchen „Klotz“ ans Bein zu binden, sollten Engagement und spärlich vorhandene monetäre Mittel lieber dazu genutzt werden, bereits Vorhandenes zu unterstützen. Museen, Vereine, zahlreiche Ehrenamtler, die Universität Siegen, die Archive, die LWL-Archäologie für Westfalen etc. zeigen durch Forschungen, Ausstellungen, Publikationen, Exkursionen etc., dass die Region historisch und kulturell blühen kann und genügend Potential besitzt. Diese Breite an Interessen und Schwerpunkten gilt es zu fördern. Schon heute scheitern zahlreiche Projekte an ein paar Hundert Euro, sodass sich die Frage nach einem größeren Museum leider erübrigt.
Sehr nützlich – hierauf wird beim Aufbau des kooperativen Archivs des Städtischen Musikvereins zu Düsseldorf e. V. gegr. 1818 zurückzukommen bzw. zurückzugreifen sein.
Danke! Schön, wenn wir helfen konnten.
Foto zum Workshop:

Pingback: Jetzt: Eröffnung der Ausstellung zum 1. Weltkrieg in Siegen | siwiarchiv.de
Pingback: Verzeichnis der Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte 1918/19 in Westfalen und Lippe | Archivalia
Pingback: VHS-Lesekurs „Handschriften des 19. und 20. Jahrhunderts“ Teil I | siwiarchiv.de
Pingback: Buchvorstellung „Die Revolution 1918/19 in Westfalen und Lippe“ | siwiarchiv.de
Wenn man sich hier so einige Kommentare akademisch ausgebildeter Historiker durchliest, muß man wohl erkennen, daß im „Siegerland“ ( besser bald nur noch als Südsauerland bekannt) das erneut in die Diskussion gebrachte Montanindustriemuseum weniger ein „finanzieller Klotz“ , als vielmehr ein „geistiger Klotz am Bein“ darstellt.
Dies wird allein schon dadurch klar, wenn man bedenkt, daß der Vorsitzende des Fördervereins Siegerlandmuseum (Ulf Stötzel – lt. Pressemitteilung der Stadt Siegen vom 29.1.2016 ) allein über 60.000 Euro aus seiner offenbar gut gefüllten Vereinskasse für die Entwicklung eines tischgroßen 3D-Druckers der Uni-Siegen zur Verfügung stellt, damit man sich später an einem Modell der Bergstadt Siegen mit einigen „sinnigen Lämpchen und Videos“ ergötzen kann, dann weiß man, woran es hier wirklich mangelt.
Genauso unverständlich das Negieren des Verbandes Siegerländer Metallindustrieller e. V. (VDSM), der eigentlich doch ein großes Interesse an einem solchen Industriemuseum entwickeln müßte , aber offenbar befindet sich die Siegerländer Metallindustrie kurz vor dem Konkurs oder der Verabschiedung in die Billiglohnländer.
Dr. Plaum hat hier sicher einen guten Hinweis auf die bisher versäumte Einrichtung einer Förderstiftung für ein auch von ihm seit Jahrzehnten gewünschtes Siegerländer Industriemuseum gegeben. Allerdings taucht da aber wohl die Frage auf, warum hat er als namhaftes Mitglied diese Fördervereins den „großen Vorsitzenden“ nicht schon längst zur Gründung einer solchen Stiftung veranlassen können ?
Dieser „Förderverein“ scheint es also im Grunde auch gar nicht zu wollen und ist mit den diversen Exponaten im Oberen Schloß vollauf zufrieden.
Ich wäre z.B. bereit, trotz meiner bescheidenen Vermögensverhältnisse mind. 20.000,- € in eine solche Förderstiftung einzuzahlen, jedoch braucht es für Gründung und Weiterführung einer derartigen zweckgebundenen Stiftung einige Siegerländer Persönlichkeiten die den Vorteil eines solchen aktiven Montanindustrie-Museums für die Region voll erkannt haben und auch bereits sind sich persönlich für die Verwirklichung eines solchen Projektes wirklich intensiv einzusetzen. Aber wie bisher festgestellt , ist dergleichen nicht zu finden.
Fazit:
Die letzte Chance an historischer Stelle ein Siegerländer Industriemuseum zu etablieren, wird wie Jahrzehnte zuvor, sicher somit wieder einmal nicht genutzt werden. Die Gebäude des Allenbacher Hammerwerkes werden abgerissen, so wie das bereits mit allen anderen Siegerländer Industriekulturgütern zuvor geschehen ist und /oder einem „Hedge-Fonds“ zur Etablierung eines „Outlet-Centers“ oder dergl. überlassen. Die historische Wasserzuführung wird zwecks Straßenverbreiterung oder erforderlicher Parkplätze zugeschüttet . Warum also nicht dabei einige der umstehenden überalterten, kostenintensiven Fachwerkhäuser ( lt. Poggel -“Klotz am Bein“) gleichzeitig mit entsorgen ? Brauch doch niemand , also weg damit für die „Neue Zeit“. Industriekultur kann man sich doch auch woanders ansehen. Das ist dann zwar keine Siegerländer Kultur, aber was macht das schon ?
Sehr geehrter Herr Dick, in meinem Kommentar steht deutlich „Die Idee eines Siegerländer Industriemuseums ist in Anbetracht der einmaligen historischen Landschaft befürwortenswert, aber die Umsetzung organisatorisch und finanziell nicht praktikabel.“ Ihre Aussagen „Warum also nicht dabei einige der umstehenden überalterten, kostenintensiven Fachwerkhäuser (lt. Poggel –‚Klotz am Bein‘) gleichzeitig mit entsorgen ? Brauch doch niemand , also weg damit für die ‚Neue Zeit‘“ haben keinen Bezug zu meiner Argumentation. Ich befürworte ein Museum und den Erhalt historischer Substanz, schätze aber die finanziellen und organisatorischen Rahmenbedingungen, die ein „aktives Montanindustrie-Museum“ in den Gebäuden des Allenbacher Hammerwerkes mit sich bringt, realistisch ein. Egal ob mit Blick auf die Liegenschaft, das Personal oder die Dauer- und Sonderausstellungen – es gilt langfristig und konzeptionell zu planen. Da reichen zum einen ein paar hundert Tausend Euro schnell nicht aus, zum anderen mangelt es am engagierten Nachwuchs, wie z. B. der Altersdurchschnitt in Heimat-/Geschichtsvereinen etc. beweist. Hier gilt es auch anzusetzen.
Weitere Bilder aus der Weltkriegsausstellung findet man auf der Seite der Siegener Geschichtswerkstatt. Ebenfalls dort zu finden die Termine der öffentlichen Führungen durch die sehenswerte Ausstellung.
Pingback: VHS-Lesekurs „Handschriften des 19. und 20. Jahrhunderts“ Teil II | siwiarchiv.de
Diesen Wunsch via Twitter nehmen wir gerne auf:
In Zeiten, in denen das Archivgut in für uns weit entfernten Archiven in verschiedenen Großstädten Westfalens gelagert wird, ist es für die interssierte Bevölkerung und die Vereine der Landgemeinden ein Desiderat, eigene Archivstrukturen vor Ort aufzubauen. Hier verwahren wir demnächst fachgerecht und professionell mehrere tausend Dokumente und Originale unser Dorf-, Kirchen- und Vereinsgeschichte, die wir nicht an Dritte weitergeben werden. Dazu war das Seminar in Siegen sehr hifreich. Archive – dezentralisiert euch!
Eine Ergänzung scheint hier angebracht: Per Archivgesetz NRW (§ 10) sind Kommunen verpflichtet ein Archiv zu unterhalten, so dass das öffentliche Archivgut i. d. R. im Verwaltungssitz auch der Landgemeinden benutzbar sein sollte. Die notwendige, ergänzende Überlieferung zur Dorf- und Vereinsgeschichte kann jedoch aufgrund mangelnder Ressourcen von kleinen Kommunalarchiven nur in den seltensten Fällen archivfachlich befriedigend wahrgenommen werden – so dass eine vertrauensvolle Kooperations zwischen Vereinsarchiven und Kommunalarchiven hier Abhilfe schaffen kann. Archive – arbeitet zusammen!
Ich möchte dem Nutzer „archivar“ zustimmen und Folgendes ergänzen. Wenn Landgemeinden nicht in der Lage sind, ihre Archive selbst zu betreiben, gibt es immer noch die Möglichkeit der kommunalen Zusammenarbeit. Solange sich Gemeinden aber hinreißen lassen, die Sorge um den schriftlichen Niederschlag ihrer Geschichte dem – wenn auch achtbaren – Wirken Privater und privatrechtlicher Organisationen zu überlassen, ist die Identifizierung mit der eigenen Heimat und Geschichte offenbar nicht recht entwickelt. Gerade kleinere Kommunen müssen aufpassen, dass sich ihre Vorstellungswelt hinsichtlich der eigenen historischen Identität nich in den Kategorien von Zimelienmuseen erschöpft. Die Führung eines ordentlichen Archivs ohne archivarisches Fachpersonal ist ohne erhebliche Risiken für eine sinnvolle Bestandsbildung und die Wahrung der wesentlichen Entstehungs- und Nutzungskontexte nicht möglich.
Hinzugefügt werden könnte noch: Die ehemalige Landgemeinde Elsoff ist seit 1975 ein Stadtteil von Bad Berleburg. Das dortige Stadtarchiv ist somit für die kommunalen Unterlagen zuständig und dürfte auch aus der Elsoffer Dorfperspektive kaum zu den „weit entfernten Archiven in verschiedenen Großstädten Westfalens“ gehören. Und auch für die Hinterlassenschaften der Dorfkirche wäre in Berleburg gesorgt (Archiv der Ev. Kirchengemeinde Wittgenstein). Wo liegt also das Problem für die „interessierte Bevölkerung“ dieses Stadtteils? Weit entfernte Archive kämen erst ins Spiel, wenn im Dorf staatliches Schriftgut auftauchen würde (z.B. im Nachlass eines zufällig in Elsoff wohnhaft gewesenen Amtsträgers, der einst dienstliche Akten mit nach Hause genommen hatte) – ein möglicher aber doch eher unwahrscheinlicher Fall.
Niemand wird behaupten wollen, dass das Provenienzprinzip für Archivbenutzer rundum beglückend wäre. Trotzdem kann Anarchie keine Alternative sein!
Ergänzend sei nach auf Folgendes hingewiesen:
„Als „Quantensprung für die Erforschung der heimischen Geschichte“ bezeichnet Kreiskulturreferent Wolfgang Suttner die Übergabe von 132 Mikrofilmen an das Stadtarchiv Bad Berleburg. Auf den Filmen befinden sich historische Dokumente aus dem Archiv des Altkreises Wittgenstein. Die Originale der Dokumente liegen im Landesarchiv in Münster. Die Übergabe ist das Ergebnis einer Kooperation von Land-, Kreis- und Stadtarchiv. Das Landesarchiv in Münster hat rund 340.000 Aufnahmen im Auftrag des Kreisarchivs angefertigt und so Duplikate von den geschichtsträchtigen Unterlagen erstellt, die Interessierte ab sofort im Stadtarchiv in Bad Berleburg einsehen können.
Die Mikrofilme übergaben (am Freitag, 19. Januar 2007) Dr. Johannes Burkhardt, Referent des Landesarchivs NRW, Abt. Staatsarchiv Münster, und Kreisarchivar Thomas Wolf bei einem Besuchstermin im Bad Berleburger Stadtarchiv an Bürgermeister Bernd Fuhrmann und Stadtarchivarin Rikarde Riedesel.
Der vollständige, durch ein Findbuch (Inhaltsverzeichnis über einen Archivbestand) erschlossene und über 1900 Akten umfassende Archivbestand des ehemaligen Kreises Wittgenstein steht damit Forschern nun wieder vor Ort zur Verfügung. Der Bestand umfasst die historische Überlieferung des Landratsamtes, des Kreisausschusses und des Versicherungsamtes des Altkreises Wittgenstein. Die Aufzeichnungen beginnen mit dem Jahr 1805 und reichen bis in das Jahr 1938. Die Unterlagen enthalten darüber hinaus viele Informationen, die Aufschluss über die damaligen Lebensverhältnisse in Wittgenstein geben. So enthalten die Mikrofilme beispielsweise Angaben zur Kirchen- und Schulgeschichte in den einzelnen Ortschaften.
Bernd Fuhrmann, Bürgermeister von Bad Berleburg, zeigt sich hoch zufrieden über das Gelingen dieser Kooperation. Trotz kommunaler Sparzwänge sei mit diesem Projekt der Service sowohl für die Berleburger Lokalforschung als auch der Wittgensteiner Regionalforscher entscheidend verbessert worden.
Zufrieden mit der gelungenen Kooperation sind auch die drei beteiligten Archive und können sich deshalb vorstellen, zukünftig auch bei weiteren Projekten zusammen zu arbeiten.
Dr. Johannes Burkhardt übergab im Rahmen des Besuchstermins zudem ein gebrauchtes Gerät, mit dem die Mikrofilme gelesen werden können. Das Staatsarchiv Münster stellt das Lesegerät dem Stadtarchiv kostenlos zur Verfügung.“
Quelle: Pressemitteilung des KReises Siegen-Wittgenstein, Januar 2007
Vielen Dank an archivar für die Eindrücke vom Tag der Eröffnung. Die Fotos vermitteln einen nachhaltigen Eindruck von der Ausstellung und zeigen, dass sich die Mühen der Ausstellungsmacher gelohnt haben. Allen Interessierten an der Geschichte Siegens und des Siegerlandes sei der Besuch des Museums wärmstens empfohlen, damit auch in Zukunft historische Ausstellungen vor Ort möglich sind.
Pingback: Zeitzeugen zur jüngeren LYZ-Geschichte gesucht | siwiarchiv.de
Pingback: LWL fördert Museen und Heimatstuben im Kreis Siegen-Wittgenstein | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 19.4. – 2.5.2016 | siwiarchiv.de
Pingback: VHS-Lesekurs „Handschriften des 19. und 20. Jahrhunderts“ Teil III | siwiarchiv.de
Pingback: 2 Videos zur Ausstellung zum „ungeplanten Siegen“ | siwiarchiv.de
Weitere Online-Tipps zum Lesen alter Handschriften gibt die Westfälische Geselllschaft für Genealogie und Familienbforschung: http://www.genealogy.net/vereine/wggf/?Basiswissen:Alte_Handschriften_lesen .
Freudenberg-online zur nächsten Runde im Streit um das denkmalwerte Ensemble: http://freudenberg-online.com/index.php/nachrichten/freudenberg-und-umgebung/144-naechste-runde-im-streit-um-pfarrhaus-und-scheune
Das Archivgesetz regelt klar die Zuständigkeit der Kommunalarchive. Das Stadtarchiv Bad Berleburg hat immer eine offene Tür für Fragen und Belange der Vereins- und Dorfüberlieferung. Die Kooperationen mit den Vereinen ist sehr positiv und Abgaben an das Stadtarchiv erfolgen gerade wegen der professionellen Unterbringung (Raumklima, Entsäuerung, Lagerung) und Bereitstellung für Interessierte Nutzer. Dazu kann ich nur einladen.
Die Archivlandschaft ist vielfältig, dies resultiert aus der Entstehung der Überlieferung, die eng mit den Verwaltungsgeschichte verbunden ist. Hier ist das Stadtarchiv gern behilflich, die verschiedenen Facetten kennen zu lernen. Kooperation war und wird hier bei allen groß geschrieben.
Rikarde Riedesel, Stadtarchiv Bad Berleburg
Pingback: #ArchivesRock on International Archives Day 2016 | Ask Archivists
Pingback: Vortrag: Chr. Brachthäuser: Fronterlebnis und Krankenfürsorge: Der Vereinslazarettzug T3 | siwiarchiv.de
Ein Buch, ein Bericht, den man nicht mehr liegen lassen kann, bis man es komplett gelesen hat !
Pingback: Über 1000 „Arbeiter- und Soldatenräte“ in Westfalen und Lippe | siwiarchiv.de
Schrifttafeln und Leseübungen findet man auch auf der Homepage des Bundes für deutsche Schrift und Sprache e.V.:
1) http://www.bfds.de/bfds.php?s=abc-tafeln
2) http://www.bfds.de/bfds.php?s=neue-leseuebung
via ZVAB-Blog
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 3.5. – 16.5.2016 | siwiarchiv.de
s. a. Wilfried Reininghaus: Quellen zur Revolution 1918/19 in Westfalen. Bericht über ein Projekt der Historischen Kommission für Westfalen, in Archivpflege in Westfalen und Lippe 84 (2016), S. 46 – 58 [S. 47: Aufruf des Vaterländischen Frauenvereins und der Frauenhilfe Laasphe zum Frauenwahlrecht zu einer Versammlung am 3. Januar 1919 (Quelle: LAV NRW W, Plakatsammlung 2441r) und S. 54 Zeitungsausschnitt Wittgensteiner Kreisblatt 28. Dezember 1918: Tagesordnung der Versammlung der Arbeiter-, Soldaten- und Bauerräte; darunter: Anzeige für eine Volksversammlung (Quelle: LAV NRW W, Plakatsammlung 2441v)]
Der Peak am 4.5.2016: Offenbar hat der VHS-Lesekurs riesiges Interesse hervorgerufen. Das sollte Archiven zu denken geben, denn Nutzung ist auch an entsprechende Lesekenntnisse gebunden. Kooperationen scheinen hier derzeit der pragmatische Weg zu sein.
Dann schreibe ich demnächst nur noch über Lesekurse. ;-) Ich kann mir diesen erfolgreichen Tag nicht erklären – auch nicht mit dem Artikel über den Lesekurs. Jedenfalls gab es keine nennenswerten Spam-Aktivitäten an diesem Tag.
Unabhängig von der Statistik-Auslegung stimme ich der grundsätzlichen Einschätzung der Lesekurse zu. Kürzlich fand sich im ZVAB-Blog der dazu passende Eintrag „Buch in Fraktur, ein Mängelexemplar?“. Er wirft ja fast die Frage auf, ob man zukünftig auch Frakturschrift unterrichten sollte …..
Meine Erfahrung mit Schulklassen ist: Fraktur kennen und können Schülerinnen/Schüler heutzutage nur noch im Ausnahmefall. Die Frage ist m.E. keine. Sie ergibt sich aus dem Fortschreiten der Zeit und der Entwicklung neuer Druck- und Schreibschriften, Altes und damit Unbekanntes muss also zukünftig neu in den Kanon des Paläographieunterrichts.
Pingback: Sonderführung durch die Ausstellung „Siegen an der Heimatfront 1914-1918: | siwiarchiv.de
Pingback: Mobile private Krankenfürsorge im 1. Weltkrieg | siwiarchiv.de
Pingback: Ausstellung zu Siegfried Vogt in Freudenberg | siwiarchiv.de
Noch bis zum 31.5. ist ein Beitrag der WDR-Lokalzeit Südwestfalen v. 24.5.2016 zur Ausstellung online: http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit-suedwestfalen/video-abitur–und-dann-an-die-front-100~.html
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 17.5. – 30.5.2016 | siwiarchiv.de
Pingback: Projekt „Zeit.Raum Siegen“ online | siwiarchiv.de
Pingback: Siegerland-Flughafen – Filmfund im „Hohen Meer“ | siwiarchiv.de
„Der Klang von Archiven“ – mit Akten rascheln und Magazintüren zuschmeißen… Erinnert mich ein bisschen an Böhmermanns Geekchester, http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2650876/Geekchester—The-Hurts.
Es ein schmaler Grad zwischen witzigem Klischee-Bruch und … naja, die ersten Reaktion aus meinem nichtarchivischen Umfeld gingen in Richtung „das passt ja zu Archivaren wie die Faust aufs Auge“.
Danke, dass Sie Ihre Bedenken hier formulieren! Ich würde es sehr begrüßen, wenn Sie die Reaktionen aus Ihrem Umfeld nach dem Getwittere auch hier als Kommentar einstellen. Denn es ist m. E. ein Versuch wert, der auch scheitern darf.
Übrigens: Für den Fall, dass ein Archiv, eine Kollegin oder Kollege nicht soweit gehen will, bleiben ja immer noch die Klassiker: Verweise auf Bestände, Archivgut, Persönlichkeiten, Historische Begebenheiten, …..
Übermorgen wünsche ich jedenfalls Allen, die teilnehmen und/oder mitverfolgen viel Spaß(!).
Solche Klassiker reichen doch schon vollkommen aus (wer mehr möchte, gerne natürlich) – und sie werden z.B. auch beim ISG Frankfurt am 9.6. zum Tragen kommen…
siwiarchiv wird selbstverständlich auch nicht nur Geräusche posten ……
Aber Geräusch und auch Lärm rücken ja immer mehr in den Fokus von Kunst und Wissenschaft. Soundscaping und die historische Lärmforschung als „Spezialität“ der Umweltgeschichte sollen hier als Schlagworte reichen.
Ein weiterer Grund, warum man sich mit den Geräuschen der Archive auseinandersetzen kann, ist ein „Kundengruppe“ für die Archive, die wir gerne vergessen – nämlich diejenigen, deren Sehvermögen eingegrenzt ist. Wie wollen wir Ihnen sonst Archivisches vbermitteln?
Ich finde es sehr progressiv seitens Ihres Archivträgers, dass er Ihnen Rückendeckung für Ihr Engagement in den Bereichen „Lärmforschung“ und „Blinde ins Archiv“ gewährt. Vielleicht berichten Sie an dieser Stelle über Ihre Erfahrungen aus dem heutigen Tag der Archive? Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
So progressiv ist dies gar nicht. Mit Heiner Stahl lehrt gerade ein Vertreter der historischen Lärmforschung gerade an der Universität Siegen, so dass es bereits zwanglose Gespräche über ein gemeinsames Projekt gegeben hat, die das Interesse des Archivs geweckt haben – vor allem haben sie die Frage hervorgerufen, welche Audioquellen hätten wir denn (Antwort: i. d.R. keine).
Vor dem Hintergrund des „Jedermann-Rechts“ im NRW-Archivgesetz erscheint es mir auch nicht eben progressiv, sich Gedanken darüber zu machen, welche Nutzergruppen denn bei zunehmender Erleichterung des Archivzugangs auf Archive zukommen könnten. Seheingeschränkte sind da nur ein Gruppe (s. bspw. auch die Diskussion über „Leichte Sprache“ auf Archivalia)
Pingback: Internationaler Archivtag 2016 - Berliner Archive - Blog der Berliner Archivarinnen und Archivare
Pingback: „Archives, Harmony and Friendship“/Archive, Harmonie und Freundschaft – auch in Greven #IAD16 #archivesrock | archivamtblog
Die biografische Datenbank zu Gewerkschaftsfunktionären in Konzentrationslagern 1933-1945 der Friedrich-Ebert-Stiftung enthält folgende Hinweise zu Otto Bäcker:
Name, Vorname:
Bäcker, Otto
Geburtsdatum: 27.11.1887, Geburtsort: Siegen
Sterbedatum: 03.1945
Sterbeort: Konzentrationslager Dachau / Überlingen
Partei vor 1933: SPD
Funktionen vor 1933: Gewerkschaftsfunktionär Deutscher Eisenbahnerverband Siegen ab 1920; Geschäftsführer Deutscher Eisenbahnerverband / Einheitsverband der Eisenbahner Deutschlands Siegen 1923-1933; Stadtverordneter Siegen 1929-1933
Konzentrationslager: Buchenwald 1944; Dachau / Überlingen 1945
Quelle:
Verein Arbeiterpresse (Hrsg.): Handbuch des Vereins Arbeiterpresse, Berlin 1927, S. 552
Enderle, August: Die Einheitsgewerkschaften, Bd. 1, Düsseldorf 1959, S. 155
DGB-Archiv im Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung: Ehrentafel für während des Dritten Reichs ermordete Gewerkschaftsmitglieder, o.O. o. J., S. 6 (Archivalie)
DGB-Archiv im Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung: Erschlagen, hingerichtet, in den Tod getrieben, Bonn 1995, S. 39
Röll, Wolfgang: Sozialdemokraten im Konzentrationslager Buchenwald 1937-1945, Göttingen 2000, S. 270.
Pingback: Zur Doppelschwänzigkeit des Löwen im Kreiswappen | siwiarchiv.de
In der geschlossenen Facebook-Gruppe „Stadt Siegen in alten und neuen Bildern“ findet sich der Hinweis, daß dieses Kunstwerk von Hermann Manskopf und Six Stiner entworfen und angefertigt wurde.
Gestatten Sie, verehrter Kollege, einige höfliche Nachfragen:
Wann wird es analog zu https://archivalia.hypotheses.org/57107 historische Literatur zur Geschichte von Stadt, Land und Kreis Siegen online geben, kostenlos und nachnutzbar?
Wann werden Fotos aus dem Kreisarchiv Siegen bzw. anderen Archiven des Landkreises unter CC-BY(-SA) nachnutzbar zur Verfügung stehen?
Wann werden historische Bilder unter CC0 zur Verfügung stehen?
Wann wird Siwiarchiv unter freier Lizenz nachnutzbar sein?
Vielen Dank für den Hinweis auf das Olper Projekt und für die daraus resultierenden Nachfragen!
1) Der Kreis hat keine eigene Publikationsreihe, so können wir nichts online stellen. Die älteren Publikationen, die in Frage kämen, „Siegerland“ und „Wittgenstein“, werden von heimatgeschichtlichen Vereinen in eigener Regie herausgegeben. Es entzieht sich meiner Kenntnis, ob dort entsprechende Planungen bestehen.
2) Über ein solches Projekt haben wir noch nicht gesprochen. Ihre Anregung greife aber gerne auf und wir werden dies im Herbst auf unserer Arbeitskreissitzung besprechen.
3) s. 2)
4) Es ist der Bequemlichkeit des inhaltlichen Admin geschuldet, dass eine differenzierts CC-Lizenzen-Vergabe für die Einträge bis jetzt nicht bzw. nur sehr selten erfolgt ist. Bei redaktionell eigenen Einträgen wird zunftig darauf geachtet – hoffentlich.
Besten Dank für die Antworten. Gestatten Sie bitte 2 Nachfragen:
Ist analog zu https://de.wikisource.org/wiki/Schw%C3%A4bisch_Gm%C3%BCnd vorgesehen, gemeinfreie Werke (die darf jeder digitalisieren) zu Siegen und dem Siegerland nachzuweisen und, falls noch nicht geschehen, ins Netz zu stellen?
Wird sich Siwiarchiv dereinst auch am #gemeinfreitag beteiligen?
Gerne doch.
1) Ich beobachte Wikisource ja mit größtem Wohlwollen. Leider fehlen mir dazu die Ressourcen, aber ich hätte da eine Idee ……
2) Dereinst sicherlich.
Was Wikisource angeht, so dürfte die Zahl der gemeinfreien Bücher und Schriften so überschaubar sein, dass die Archivierenden des Kreises in Verbindung mit der Schwarmintelligenz der in Wikisource Wirkenden ein solches Projekt meines Erachtens leicht stemmen könnten.
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 31.5. – 13.6.2016 | siwiarchiv.de
Pingback: Neumarkt-Sankt Veit - Ortsgeschichte – [tipp] Vereinsarchive
Pingback: Der Rahmen für etwas ganz Besonderes… | siwiarchiv.de
Pingback: Film- und Tondokumente im Archiv | siwiarchiv.de
Pingback: Das Kabinett hat dem Entwurf für ein neues Bundesarchivgesetz zugestimmt | Archivalia
Pingback: Freudenberg im Zeitgeschehen 1/2016 erschienen | siwiarchiv.de
Pingback: Linktipp: Don´t throw film away! | siwiarchiv.de
Hinzuweisen wäre für die westfälische Perspektive auch auf meine Publikation: https://www.lwl.org/LWL/Kultur/HistorischeKommission/publikationen/2005/displaced-persons sowie für das benachbarte Rheinland http://www.brauweiler-kreis.de/geschichte-im-westen/geschichte-im-westen-2003-2/
Darin enthaltene Statistiken sind in der Regel für Westfalen bzw. NRW gemacht und beinhalten damit auch Siegener Zahlen (auch wenn sie in den Veröffentlichungen wegen des abweichenden regionalen Zuschnitts ungenannt bleiben); somit können mit beiden Publikationen auch die Signaturen des Quellenmaterials (in der Regel aus dem UN-Archiv New York, NARA Washington D.C. und National Archives (früher: Public Record Office) Kew/London gefunden werden.
Sofern DP-Lager in Siegen länger als bis 1946 bestanden, lohnt auch eine Recherche im Landesarchiv NRW, Abt. Rheinland (vor allem Bestand NW 0067: http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/bestand.jsp?archivNr=185&tektId=5803&expandId=5790).
Falls es im Siegerland auch Beispiele gab, wo Deutsche ihre Privathäuser räumen mussten, ist auch noch folgender Aufsatz interessant: Stefan Schröder, DP-Lager in requirierten deutschen Straßenzügen, Vierteln und Ortschaften. Ein Beitrag zur Systematisierung dieser Sonderform der Unterbringung von Displaced Persons, in: Sabine Mecking/Stefan Schröder (Hrsg.), Kontrapunkt. Vergangenheitsdiskurse und Gegenwartsverständnis, Festschrift für Wolfgang Jacobmeyer zum 65. Geburtstag, Essen 2005, S. 113-126.
Vielen Dank für die weiteren Hinweise! Wäre schön, wenn Ihr Band bald in der digitalen Reihe der Historischen Kommission erscheinen könnte.
Dazu bin ich noch nicht gefragt worden. Aus meiner Sicht spricht – bis auf nötige Urheberrechtsklärungen der enthaltenen Abbildungen – nichts dagegen.
An dieser Stelle sei eine kurze Notiz wiedergegeben, die Johann Jakob Hahnenstein (1774-1854) 1844 rückblickend in das Kalendarium des Oranien-Nassauischen Adreß-Calenders auf das Jahr 1803 schrieb:
„1816 hatten wir ein sehr großes naß jahr was man seit 1740 nicht erlebt haben will. 1740 soll es dem Sagen nach nur Mangel an Fuder des Viehes gefehlt haben. 1816 fehlte es aber an Menschen nahrungs mittel 4 Pfund Brod wurde zu 40 xer oder 20 Albus bezahlt, und war manchmal keines zu haben. Das Nähere des großen Mangel ist in meiner geschriebenen Cronik alles von Tage zu Tage aufgeschrieben und zu lesen
Emmerichenhain 1844
Jacob Hahnenstein“
Leider ist mir nichts über die erwähnte Chronik bekannt.
Vielen Dank für die Ergänzung!
Kein Eintrag für J. J. Hahnenstein im „Deutschen Biographischen Index“, keine Erwähnung in der „Nassauischen Biographie“ (2. erw. Aufl.). Dank des online verfügbaren Inhaltsverzeichnisses lassen sich 3-4 Seiten Informationen über ihn ermitteln in:
Peter J. Lau, Meine Ahnen der Familien Lau und Caesar, Frankfurt a. M. 2012, darin S. 43 – 45 oder 46: Johannes Jakob Hahnenstein (1774-1854). Das Buch ist in einigen Bibliotheken nachgewiesen, Kopien per Fernleihe also leicht bestellbar.
Das HHStA Wiesbaden hat zwei Handschriften von Hahnenstein (Bestand 1098, Nr. 394 und 395): Hausbuch des J. J. H. (um 1800, also zu früh) und das zeitlich in Frage kommende Mess- und Gewannbuch von Emmerichenhain („Abschrift von J. J. H.“). Letzteres „enthält auch: Einträge über Landwirtschaft …“. Ob diese mit der gewissen Chronik gemeint sind, läßt sich natürlich aus der Ferne nicht sagen.
Pingback: Neu in der Bibliothek des Kreisarchivs: | siwiarchiv.de
Pingback: Lagerbuch des Ortsteils Wahlbach (1779) | siwiarchiv.de
Weitere Links zum Thema:
1) Filmerbe in Gefahr
2) kinematheken.info. Nachrichten über Archive, Filme und Politik
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 14.6. – 27.6.2016 | siwiarchiv.de
Pingback: Erfolgreiche Internetpräsentation des Stadtarchivs Siegen | siwiarchiv.de
Vielleicht ist eine Recherche im Bestand I. HA Rep. 89 (Geheimes Zivilkabinett) des Geheimen Staatsarchiv preußischer Kulturbesitz in Berlin erfolgreich dort finden sich unter den Nr. 16593 – 16595 „Zeitungsberichte“ der Regierung in Arnsberg von 1816 bis 1819 sowie unter den Nr 16241 bis16245 „Zeitungsberichte“ der Koblenzer Regierung.
Hier noch eine vielleicht nicht unwichtige Ergänzung! Bei der Durchsicht des „Heimat-Jahrbuchs des Kreises Altenkirchen (Westerwald) und der angrenzenden Gemeinden 2016“ fiel mir der Beitrag von Anka Seelbach: „1816 – Das Jahr ohne Sommer“ ins Auge (S. 90-92). Auf den beiden Druckseiten zwar nicht viel Text, aber dafür weitere Literaturangaben (vorwiegend Bezug nehmend auf ältere Aufsätze im genannten Heimat-Jahrbuch). Leider kein Verweis auf Primärquellen in den Archiven, aber immerhin eine weitere Fundstelle in der Literatur, um bei diesem Thema die regionale „Wahrnehmungsebene“ oder „Überlieferungskultur“ zu berücksichtigen.
1) Vielen Dank für den Hinweis!
2) Eventuell wäre eine quantitative Analyse der regionalen, kirchlichen Tauf-, Ehe- und Sterbebücher für die Jahre 1810 – 1820 interessant.
3) Zur Anregung weiterer regionaler Aspekte mag ein Blick auf das Programm einer im Oktober in Hohenheim stattfindende Tagung mit südwestdeutschem Schwerpunkt dienen: http://www.uni-stuttgart.de/hi/lg/news/Tagung_in_Hohenheim_21.-23.10.2016x_1816_-_Das_Jahr_ohne_Sommer/?__locale=de
Auszug aus der Niederschrift der Kulturausschusssitzung vom 20.6.16:
“ …. Archäologische Ausgrabungsstätte Gerhardseifen in Siegen-Niederschelden
Beratungsverlauf:
Arno Wied definiert die Ausgrabungsstätte Gerhardseifen als ein Bodendenkmal von europaweiter Bedeutung. Er verweist auf das ausliegende Gutachten Der Weg des Eisens aus dem Jahr 2013 sowie auf den Sachstandsbericht im Kreistag (Vorlage 268/2013) und erklärt, es zeichneten sich
inzwischen Umsetzungsentwicklungen ab. So solle die Fundstelle erneut geöffnet und konserviert und vor Ort ein Dokumentationszentrum eingerichtet werden. Die Kosten dafür beliefen sich auf zirka 220.000,- € und sollen aus Mitteln der NRW-Stiftung, einem Denkmalschutzsonderprogramm des Bundes sowie im Wege des Sponsorings durch heimische Unternehmen – hier sei die IHK eingebunden – aufgebracht werden. Zu dann eventuell noch offenen finanziellen Fragen würden Stadt Siegen und Kreis Siegen-Wittgenstein Lösungen erarbeiten, sollte dies erforderlich sein. Darüber hinaus sei die Ausweisung eines archäologischen Wanderwegs vorgesehen, der verschiedene historische Ausgrabungsstätten in der Region miteinander verbinde. So solle die Ausgrabungsstätte Gerhardseifen, die 2012 in die Denkmalschutzliste der Stadt Siegen aufgenommen wurde, wissenschaftlich und touristisch erschlossen werden. In diesem Zusammenhang dankt Arno Wied den örtlichen Heimatvereinen und Waldgenossenschaften, ohne deren großes Engagement das Bisherige nicht hätte erreicht werden können und
auch die geschilderten Planungen nicht umsetzbar seien.
Bernd Brandemann bezeichnet das Bodendenkmal Gerhardseifen als ein Ausgrabungsprojekt der Superlative, da hier die Eisenerzeugung aus drei verschiedenen Epochen an ein und demselben Ort erlebbar werde. Vor diesem Hintergrund sei der Antrag auf Fördermittel der NRW-Stiftung
offensiv zu formulieren, denn dort „wartet man geradezu auf Anträge aus Westfalen“.
Otto Marburger weist auf die Nekropole in Birkefehl hin. Unter der Überschrift Der Weg des Eisens und im Kontext des bevorstehenden 200-jährigen Jubiläums der Kreise Siegen und Wittgenstein könne auch diese Stätte aus der Keltenzeit in die Planungen einbezogen werden.
Winfried Schwarz erklärt, mit Blick auf einen möglichen Finanzierungsbeitrages des Kreises erwarte der Kulturausschuss zu gegebener Zeit eine ergänzende Beschlussvorlage.“
Quelle: Kreistagsinformationssystem, Link: https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz110/sdnetrim/Lh0LgvGcu9To9Sm0Nl.Ha.GWq8Tq8Sj1Kg1HauCWqBZo5Ok9LkyIduGWt9Vs4Qp0Oe.Oa1CXuCWn4Oi0Lg-IbvDauHTp8To1Ok0HbwHau8Vt6Pi6Km0GbyGar8Um5Pm4KezJezIWtFUn5Qn4OfyGauDWu8WGJ/Oeffentliche_Protokollunterlagen_Kulturausschuss_20.06.2016.pdf
Es handelt sich um das Gebäude Erzweg 3 in Burbach:
Lösungsweg:
1. Das Fenster ist auffallend schlicht. Die Funktion steht im Vordergrund.
2. Es ist Teil einer Steinmauer.
3. Es hat keine Fensterläden (damit auch kein Heimatschtuzstil)
4.Daher handelt es sich um den Bauhausstil.
5. Gebäude im Bauhausstil sind im Siegerland sehr selten.
6. Mir sind eigentlich nur zwei Gebäude bekannt.
7. Ein Fotovergleich auf google brachte den Beweis.
Mit freundlichen Grüßen aus der
Fachwerkstadt Freudenberg
Detlef Köppen
Das „Vorbild“ steht in Weimar.
Detlef Köppen
Korrekt! Es ist allerdings nicht verwunderlich, dass Sie dieses Rätsel lösen konnten ;-).

Zwei Fragen hätte ich allerdings noch:
1) Wie sind Sie auf das Weimarer Vorbild gestoßen, und
2) Welches Bauhaus-Gebäude sind Ihnen denn noch bekannt?
Weitere Informationen zu beiden Gebäuden findet man in diesem siwiarchiv-Eintrag.
Das Bild zeigt den Zustand des Gebäudes im Juni 2016:
Bauhausstil-Gebäude stehen in Weimar oder Dessau.
Bei der Eingabe Bauhaus und Weimar wurden neben einigen Großgebäuden auch das Haus Horn aufgezeigt. Der gemittelte Dachaufbau lässt das Vorbild erkennen.
Detlef Köppen
Admin: Kommentar auf Wunsch des Autoren gelöscht!
Am Samstag, 9. Juli 2016, erschien in der Beilage „Heimatland“ der Siegener Zeitung der Artikel „Leben zwischen den Systemen. Adolf Wurmbach wurde vor 125 Jahren geboren“ von Traute Fries, die auch auf die hier geführte Diskussion eingeht. Darin kann Fries der hier von Opfermann geäußerten Einschätzung Wurmbachs nicht folgen.
Interessant ist die quantitaive Auswertung der Publikationstätigkeit zwischen 1935 und Frühjahr 1945:
„Siegener Zeitung“ bis zum 1. April 1943: 500 Gedichte, Sprüche, Kurzgeschichten
„National-Zeitung“ incl Beilage „Volkstum und Heimat“ bis Frühjahr 1945: 160 Beiträge (52 Beiträge unter dem Titel „Us dr Dorfküüeze“
„Siegerland“ 1935 – 1942: 40 Beiträge
„Siegerländer Heimatkalender“ bis 1943/44: 42 Beiträge.
Ferner verweist Fries auf die besondere Beziehung Wurmbach zum Haus Vorländer/Rothmaler: “ …. 1942 widmete Wurmbach aus Dankbarkeit und Verehrungseine mehr als 80 Gedichte umfassende Sammlung „Bergwerk muss glühen“ Johannes Rothmaler, der ein montanwissenschaftliches Studium absolvierte und vor seiner Tätigkeit im Verlagswesen im Bergbau beschäftigt war. ….“
Schließlich streift Fries den Verbleib der Bibliothek von Adolf Wurmbach: “ …. Große Sorgen bereitete Wurmbach der Gedanke hinsichtlich des Umgangs mit seinem Nachlass, so ist dem Brief an seinem jüdischen Freund Hugo Herrmann zu entnehmen, den er drei Tage vor seinem Tod diktierte. Seine private Bilbiothek wollte er der Öffentlichkeit zugänglich machen. Sie umfasste etwa 3.500 Bücher und ging in 70 Kartons verpackt an die Universität Siegen. Der Bereich Germanistik hatte keinerlei Interesse am Siegerländer Schriftsteller und hat ihn aus der Sicht der Verfasserin verkannt. Nach jahrelangem Hin und Her landeten die Bücher bei der Stadt Siegen, die 1977 im Torhaus des Siegerlandmuseums die „Wurmbach-Bibliothek“ eröffnete. Aus Sicherheitsgründen wurde der Nachlass bereits vor Jahren in den Wellersbergbunker ausgelagert.“
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 28.6. – 11.7.2017 | siwiarchiv.de
Pingback: Bauernunruhen in der Grafschaft Sayn-Wittgenstein-Wittgenstein 1696-1806 – online | siwiarchiv.de
Medienresonanz zu den Ernst-Briefen:
wirSiegen.de, 9.7.2016
Siegerlandkurier, 9.7.2016: http://www.siegerlandkurier.de/siegen/ernst-briefe-6557082.html
Siegener Wochenanzeiger, 13.7.2016: Artikel (PDF)
WDR-Beitrag, 13.7.2016: http://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/deutscher-krieg-briefe-ernst-100~.html
Pingback: „Interne Arbeiten zur Wahrung der gesetzlichen Kernaufgaben“ | Archivalia
Die Karte ist vor dem 1.4.1944 entstanden, da die Grenzänderung der
Kreisgrenze im Norden des Ortes Büschergrund noch nicht berücksichtigt wurde.
Vielen Dank für den Hinweis zur Datierung! Wir waren von einer Entstehung in den 50er Jahren ausgegangen u. a. wg der Verwaltungsgliederung im heutigen Siegener Norden. Die noch nicht von den Talsperren betroffenen Orte z. B. Nauholz bei Netphen etc. dienten als erste zeitliche Orientierung.
Ich würde die Karte ebenfalls in die 50er Jahre datieren. Grund: Im Bereich Littfeld / Burgholdinghausen ist eine Kleinsiedlung eingezeichnet. Sie ist erst 1952/53 entstanden. Ich vermute, dass die Grenzänderungen in Büschergrund schlichtweg vergessen wurden zu übernehmen.
Vielen Dank für den Hinweis! Jetzt haben wir einen zeitlichen Korridor, in dem die Karte entstanden sein muss.
s. a. Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin:
Ober-Examinationskommission bzw.Prüfungskommission für höhere Verwaltungsbeamte, I. HA Rep. 125 Nr. 4178 (Einzelne Prüfungen, R, Rumohr, von, Regierungsreferendar, Osnabrück ), 1929
Pingback: Sonderführungen durch die aktuelle Ausstellung zur Geschichte der Brandbekämpfung | siwiarchiv.de
Der eingezeichnete Bahnabschnitt Heinsberg (OE) – Röspe + Bahnhof (SiWi) wurde 1945 endgültig stillgelegt. Also Karte vor 1945 entstanden oder – mit Blick auf die anderen Kommentare – später mit veralteten Informationen erstellt.
Weitere Karten aus dem Sieger- und Sauerland befinden sich digitalisiert in den Beständen der Harold B. Lee Library der Brigham Young University (USA): „German Maps (Topographische Karte 1:25,000): A set of topographic maps of pre-World War II Germany, originally printed by the German government, and confiscated by the British and U. S. military after the war. Most of these maps are reprints by the British Geographical Section, General Staff, or the U. S. Army Map Service.”
https://lib.byu.edu/collections/
z. B. http://contentdm.lib.byu.edu/cdm/search/mode/any/field/all/collection/GermanyMaps/searchterm/Siegen
Vielen Dank für das weitere Indiz zur Datierung der Karte! Ebenfalls danke schön für den weiteren Quellenhinweis!
Pingback: Vortrags-Video „Die Filmsammlung Herbert Appelt. | siwiarchiv.de
Medienresonanz zu den Ernst-Briefen:
27.7.: Westfälische Rundschau/Westfalenpost
Die Familie wurde nicht mit der Freusburg, sondern mit einem Burgsitz zu Freusburg und dazugehörigen Lehen belehnt.
Freundliche Grüsse
Karl Heinz Gerhards
Vielen Dank für die Präzisierung!
Pingback: Zeit.Raum Siegen – 3D-Druck der Nicolaikirche | siwiarchiv.de
In der Stadtmauer unterhalb der Martinikirche war früher ein
Podest eingelassen auf der eine Figur stand.
Frage: 1. wen stellte diese Figur dar ?
2. warum hat man die Figur entfernt ?
3. wo ist die Figur geblieben ?
Ich habe mal an einer Führung teilgenommen bei der die Renovierung
und Baumaßnahmen in der Innenstadt erläutert wurden. Der Bauleiter
der die Führung machte konnte mir diese Fragen nicht beantworten.
Im Voraus herzlichen Dank für eine Antwort.
1) Dort stand m. E. nur ein Bär.
2) Der Bär stand und steht für die Partnerschaft von Stadt Siegen und Kreis Siegen-Wittgenstein mit dem Berliner Bezirk Spandau.
3) Nach der Sanierung der Stadtmauer und der Statue steht der Bär wieder dort – s http://siegen-zu-neuen-ufern.de/aktuelles/der-berliner-bar-kehrt-zuruck/ und http://siegen-zu-neuen-ufern.de/aktuelles/der-berliner-bar-steht-wieder-am-kolner-tor/
Lieber Herr Hentschel,
bei der genannten Figur wird es sich um die 1957 vom Siegener Bildhauer Hermann Kuhmichel geschaffene Plastik „Die Ausschauende“ gehandelt haben. Das Kunstwerk sollte an das Schicksal der Kriegsgefangenen erinnern, aber auch als Symbol der Hoffnung auf eine Heimkehr und auf Weltfrieden verstanden werden. Am 16. Dezember 1953, also zur 13. Wiederkehr der Zerstörung Siegens am 16. Dezember 1944, wurde „Die Ausschauende“ zunächst im Rathaus aufgestellt, um hiernach Ende März 1959 an den Aufgang zur Martinikirche platziert zu werden. Im Dezember 1959 gelangte die Plastik dann an ihren heutigen Platz – an die Gedenkstätte für die Opfer von Krieg und Gewalt beim Dicken Turm des Unteren Schlosses.
Viele Grüße, Christian Brachthäuser
Den Zahlenverdreher in der Datumsangabe bitte ich zu entschuldigen. Die „Ausschauende“ wurde natürlich 16. Dezember 1957 aufgestellt (nicht 1953).
Gruß, CB
Danke für die Berichtigung!
Nicht „F. W.“, sondern „F. M.“! Auflösung der Initialen laut KALLIOPE: Franz Maria (demnach eindeutig katholisch). Dort Nachweis zweier Briefe Simmersbachs von 1869 aus Dortmund an Justus von Liebig im Bestand der Bayerischen Staatsbibliothek.
Lebensdaten nach dem Deutschen Biographischen Index: 1841-1910.
Vielleicht ein Hinweis auf die Herkunft: „Das Bergwerksfeld Ernestus [Lennestadt] wurde durch das Bergamt Siegen im Oktober 1854 auf Eisenerz und Schwefelkies an Jacob Simmersbach aus Altenhundem verliehen.“ (Wikipedia bei „Ernestus“).
Einem genealogischen Forumbeitrag zufolge (https://groups.google.com/forum/#!topic/alt.talk.royalty/RWTANPfs1aQ) war F. M. Simmersbach (Sohn Jacobs) ein Urenkel der Schwester Goethes.
Mal sehen, ob sich noch mehr ergibt.
Danke für die Korrektur und Ergänzung!
Auch in der Archivdatenbank des Landesarchivs Sachsen-Anhalt findet sich ein Hinweis auf ein Personalakte, genauer Elevenakte Simmersbachs, des Oberbergamtes Halle,: http://recherche.lha.sachsen-anhalt.de/Query/detail.aspx?ID=1498898 . Leider „fehlt“ dieser Aktenband.
1) In Toni Pierenkempers „Die westfälischen Schwerindustriellen 1852-1913: Soziale Struktur und unternehmerischer Erfolg“ (Göttingen 1979, S. 237) findet sich ein Franz Simmersbach (1841 – 1910) als Direktor der Zeche Centrum in Wattenscheid.
2) Die bereits erwähnte Personalakte in Münster wurde von 1858 bis 1863 geführt. Sie weist als Geburtsdatum den 11.12.1841 aus. Simmersbach wird als Bergexpektant bezeichnet. Der Aktenband enthält:
„Zulassung als Bergwerksbeflissener; Lebenslauf; Zeugnisse; Beschäftigungsnachweise;
Tentamen; Ausbildung des Expektanten; Tätigkeit als Fahrbursche im Arnsberger Revier
(Bergamt Siegen); Gesuch um Entlassung aus dem Staatsdienst.“
Peter Kunzmann weist auf folgenden Nachruf Simmersbachs in der Zeitschrift „Stahl und Eisen“ 30. Jg. (1910) Nr. 5, S. 224 hin: „Stahl und Eisen“, S. 224 (PDF)
Nachtrag:
Abitur in Siegen 1858. Im Jahr zuvor hatte Louis Ernst (siehe http://www.siwiarchiv.de/?p=12559) die Realschule absolviert. Ein Klassenkamerad von Franz Simmersbach war der spätere Unternehmer und Reichstagsabgeordnete Hermann Müllensiefen, de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Müllensiefen. (Quelle: Hans Kruse, Geschichte des höheren Schulwesens in Siegen, Siegen 1936, Schülerliste S. 66*)
Heute auf WDR 5 „Zeitzeichen“: Adolf Busch
http://www1.wdr.de/mediathek/audio/zeitzeichen/index.html
Danke für den Link!
Auch BR Klassik und
DeutschlandradioKultur erinnern heute an Adolf Busch.
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 26.7. – 8.8.2016 | siwiarchiv.de
Pingback: Heute vor 480 Jahren: Caspar Olivean, Wittgensteiner Reformator, geboren | siwiarchiv.de
Pingback: Jung-Stilling-Dokumentation. 3 Ausschnitte online | siwiarchiv.de
Die Westfalenpost greift heute den Artikel von Paul Riedesel auf und stellt die Auswanderungsgeschichte vor: http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-bad-berleburg-bad-laasphe-und-erndtebrueck/amerikaner-berichtet-ueber-vorfahren-aus-wunderthausen-id12102099.html .
Pingback: Aus der Briefkopfsammlung des Kreisarchivs II | siwiarchiv.de
Zur Kostenpflichtigkeit des Angebotes äußert sich Archivalia wie gewohnt deutlich: http://archivalia.hypotheses.org/58578 .
Pingback: Vor 95 Jahren: Fritz Heinrich (1921 – 1959) | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 9.8. – 22.8.2016 | siwiarchiv.de
2 Ergänzungen:
1) Fritz Heinrich war Mitglied der Bundesversammlung 1954.
Quelle::
Martin Schumacher: M.d.B. – Die Volksvertretung 1946–1972, http://www.kgparl.de/online-volksvertretung/online-mdb.html (22.8.2016)
2) Fritz Heinrich besuchte die Volksschule in Feudingen von 1927 bis 1931 und wechselte dann nach Laasphe, wo er die Volksschule von 1931 bis 1935 besuchte.
Quelle: Amtliches Handbuch des Deutschen Bundestages, Darmstadt 1954, Band 1, S. 241
Das Stadtarchiv Bad Laasphe beantwortete die Fragen nach dem Vorhandensein einer Personalakte sowie den Funktionen Heinrichs im Laaspher Rat wie folgt: “ …. es gibt … eine …. Personalakte von Herrn Fritz Heinrich, der mit Wirkung vom 01. April 1946 als Bürogehilfe bei der Stadt- und Amtsverwaltung Laasphe eingestellt worden war. Dieses Beschäftigungsverhältnis hat er zum 31. Mai 1948 gekündigt.
Seit dem 17. Oktober 1948 bis zu seinem Tod war er Ratsmitglied. Außerdem war er in der Zeit vom 21. Dezember 1951 bis zum 28. Oktober 1954 stellvertretender Bürgermeister und seit dem 28. November 1958 bis zu seinem Tod Bürgermeister der Stadt Laasphe. In der Wahlzeit 1948/1952 gehörte er folgenden Ausschüssen an: Wohlfahrtsausschuss (ab 04.11.1948), Verwaltungs- und Finanzausschuss, Wirtschaftsausschuss sowie Wohnungsausschuss (ab 08.03.1949). In der Wahlzeit 1952/1956 war Mitglied des Hauptausschusses (ab 18.11.1952) und des Verbandsausschusses des Gesamtschulverbandes (ab 19.02.1953). Seit dem 19. November 1956 bis zu seinem Tod war er auch Vorsitzender des Hauptausschusses. ….“
Auch Wittgensteiner Akten waren und sind bunt – ein Beispiel aus einer Akte der Wirtschaftsförderung des Kreises Siegen Wittgenstein (2.16.1./64):
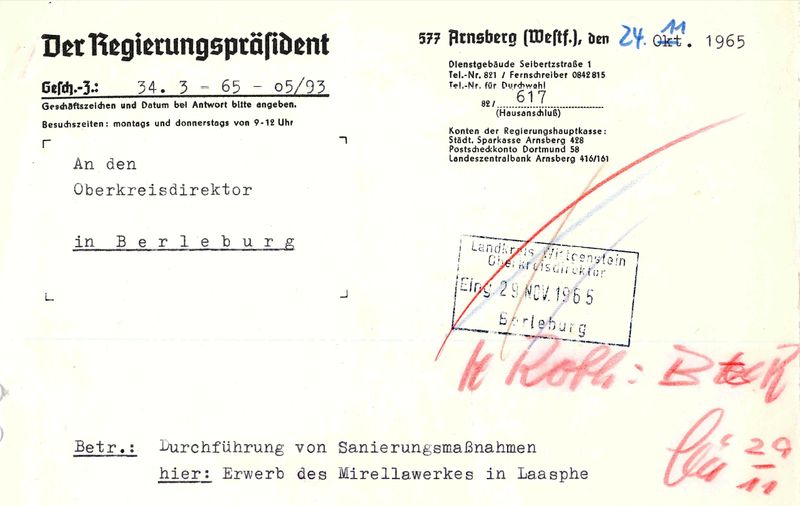
Zu Felix Fechenbach s. auch hier: http://www.geschichtswerkstatt-siegen.de/2016/02/08/felix-fechenbach/
Das Geburtsjahr von Dr. Dr. Karl Neuhaus war nach den vorliegenden Dokumenten eindeutig : 22.07.1910 !!
Siehe hierzu
– Urteil der großen Strafkammer des Landgerichts Siegen vom 15.12.1953
– Vernehmung von Neuhaus durch die Staatsanwaltschaft beim
Kammergericht Bonn am 11.08.1972
– Lebenslauf als Anhang zur Dissertation von Karl Neuhaus
(Tag der mündlichen Prüfung 22.07.1940 )
Vielen Dank für die Berichtigung! In der Einleitung des Eintrages wurde bemerkt, dass es sich um den damals aktuellen regionalen Forschungsstand handelte. Ich verweise auf folgenden weiteren Eintrag auf siwiarchiv, der bereits das richtige Geburtsdatum enthält: http://www.siwiarchiv.de/?p=7450 . Beide Einträge hatten und haben zum Ziel, dass man sich intensiver mit der Biographie des Neuhaus beschäftigt.
Bei meinen Recherchen über Dr. Karl Neuhaus, den ich damals als Lehrer
sehr geschätzt habe, bin ich auch auf ein Foto gestoßen, das ich Ihnen gern zur verfügung stellen kann.
Vielen Dank für das freundliche Angebot! Ich habe Ihnen einen E-Mail dazu gesendet.
Pingback: Depositum Ernst im Stadtarchiv | siwiarchiv.de
Ließe sich die Aussage auch so formulieren: „Große Teile des Nachlasses befinden sich in Privatbesitz und stehen – mit Ausnahme der im Archiv deponierten Kriegserinnerungen – der Öffentlichkeit nicht zur Einsichtnahme zur Verfügung“? Das wäre, sofern die großen Nachlassteile das öffentliche Wirken des Kommunalpolitikers, Parlamentariers und Schuldirektors Ernst betreffen sollten, diskussionswürdig. Aber eine solche Diskussion will ich hier natürlich nicht anstoßen.
Nein, verehrter Kollege Kunzmann, die Aussage lässt sich nicht so formulieren, denn – mea culpa – der Teufel liegt im Detail, es hätte heißen müssen „Große Teile des Familiennachlasses […]“. Dieser besteht im Wesentlichen aus Aufzeichnungen des Sohnes und des Enkels von Louis Ernst, von letzterem ist lediglich ein weiteres Original enthalten.
Pingback: Vor 30 Jahren: Visionen für ein neues Siegufer | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 23.8. – 5.9.2016 | siwiarchiv.de
Pingback: »Religion macht Geschichte« – Start des 25. Geschichtswettbewerbs | siwiarchiv.de
Pingback: Vereinsarchive als Faktor der Überlieferungsbildung | archivamtblog
Tolles Model und spannendes Video!
Pingback: Moderne Aktenkunde erschienen | Archivalia
Es könnte sich um ein Klimagerät / Luftentfeuchter handeln.
1) Was meinen Sie mit Klimagerät?
2) Entscheiden Sie sich bitte! :-)
Jetzt kann ich nur raten: Ich entscheide mich für den Luftentfeuchter.
Gratulation! Die Antwort ist korrekt.
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 6.9. – 19.9.2016 | siwiarchiv.de
Selten ist ein leeres Rednerpult besser abgebildet worden! Am 16.02.2017 wird es auf Fälle besetzt sein, das hat der Referent zugesichert. Also Termin bitte notieren.
Gibt es überhaupt Quellen, in denen die Schusterschlacht in Netphen erwähnt wird? Der o. a. erste Oktobersonntag 1584 fiel auf den 7. Oktober. 1584 galt ja schon der Gregorianische Kalender, oder?
Tilmann Güthing gehörte von 1868 bis 1873 dem westfälischen Provinziallandtag an. Die Protokolle sind hier online einsehbar: http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/bestand.jsp?archivNr=400&tektId=4&expandId=2.
Da scheint ein „Blick ins Netpherland“ 52 ratsam. Denn hat Heinz Stötzel Schusterschlacht (1584) behandelt.
Die Entwendung der Infotafel ist sehr Schade.
Die Gleichsetzung von einer „physisch gestörten Person“
mit einem „Arschloch“ wie auf dem gelben Schild auf dem Foto
GEHT ABER GAR NICHT!
Schade das darunter auch noch die Adresse von Siwiarchiv
angegeben ist.
Ich hoffe, der Schild wird umgehend entfernt!
Erste Informationen zur deutschen Tankstellengeschichte finden sich online hier: http://www.geschichtsspuren.de/artikel/verkehrsgeschichte/138-tankstellengeschichte.html und hier: http://www.spiegel.de/einestages/vergessene-orte-als-volltanken-noch-spass-machte-a-946782.html (2008)
Der Unterschied zwischen physisch und psychisch sollte doch wohl bei Ihrem Bildungsgrad bekannt sein. Waren Sie hier mal wieder zu schnell beim Schreiben ?
Der Begriff psychisch gestörte Person ist , wenn Sie genau beim Aufkleber hinsehen, wohlweislich in Anführungszeichen gesetzt .
Wie belieben Sie als akademisch gebildete Person diese „gestörten Zeitgenossen“ denn anders zu bezeichnen ?
Wenn zu diesem im Grunde verabscheuungswürdigen Vorfall nur ein solcher Kommentar abgegeben wird, dann wird mir als der offenbar eigentliche „Straftäter“ ( Tatbestand : „Anstiftung zu Diebstahl und Vandalismus“ sowie angeblicher Verunglimpfung „psychisch gestörter Personen“) bewußt was für mich in Zukunft zu tun bleibt.
Die Verwechslung von psychisch und physisch hätte mir wirklich
nicht passieren dürfen, da gebe ich ihnen Recht.
Dies aber nicht aufgrund meines nicht akademischen Bildungsstandes
sondern aus meiner langjährigen Arbeit mit psychisch erkrankten
Menschen und von diesen ist ganz sicher niemand ein A….loch
und auch keiner würde das Plakat entfernen oder zerstören.
Ich verurteile diesen Diebstahl genau wie sie, wehre mich aber
gegen die erwähnte Gleichsetzung und die damit verbundene
Verunglimpfung psychisch erkrankter Menschen.
Sie haben offenbar übersehen, daß die Bezeichnung „psychisch gestörte Person“ sich ausschießlich auf den Täter bezieht und keine allgemeine Gleichstellung psychisch erkrankter Personen mit der Bezeichnung A-Löcher darstellt !
Dieser verstörte Täter ist aber sowohl das eine wie das andere, je nachdem wie „gewählt“ man sich da ausdrücken möchte. ! Ich hoffe doch, daß Sie das so akzeptieren .
Übrigens habe ich bei meinem verständlichen Ärger auch einen Grammatikfehler auf dem Aufkleber platziert. Es muß nicht „psysisch“ , sondern richtigerweise „psychisch“ heißen. Bitte das zu entschuldigen, aber ich bewege mich recht selten in diesem Umfeld.
1) Vielen Dank für die Diskussion!
2) siwiarchiv hat als archivisches Weblog auch die Aufgabe, den Umgang mit im weitesten Sinne erinnungspolitischen Aktivitäten im Kreisgebiet zu dokumentieren. Eine inhaltliche Zustimmung zum Gezeigten ist daraus nicht abzuleiten.
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 20.09 – 3.10.2016 | siwiarchiv.de
Pingback: Adel und Frömmigkeit im 18. Jahrhundert in Wittgenstein | siwiarchiv.de
Links zu den „Reden“:
1) Tabea Rössner (Die Grünen): http://tabea-roessner.de/2016/09/23/bundestagsrede-zum-bundesarchivgesetz-am-22-september-2016/
2) Sigrid Hupach (Die Linke): http://www.sigrid-hupach.de/nc/aktuell/ mit Link zur Rede als PDF
Links zur Diskussion im Netz über die Novellierung des Bundesarchivgesetzes:
1) Arne Semsrott, „Geheimdienste noch geheimer: Novelle des Archivgesetzes schwächt Informationsfreiheit“, auf netzpolitik.org, 6.10.2016, Link: https://netzpolitik.org/2016/geheimdienste-noch-geheimer-novelle-des-archivgesetzes-schwaecht-informationsfreiheit/
2) s. a. Kommentar von Klaus Graf: https://archivalia.hypotheses.org/59718
Auf detektor.fm findet sich ein Interview mit Arne Semsrott vom 11.10.2016: https://detektor.fm/politik/wer-nicht-fragt-bleibt-dumm-bundesarchiv-gesetz-novelle
Weitere Kommentar zur Novellierung des Bundesarchivgesetzes: https://netzwerkrecherche.org/blog/netzwerk-recherche-gegen-bnd-klausel-bei-der-akteneinsicht/
Toll! Danke an Autor und Archivar!
„Die Stadt Siegen beschafft für Verwaltung, Schulen sowie Hausdruckerei ausschließlich Papier mit dem Blauen Engel. Dafür erhielt sie heute im Bundesumweltministerium die Auszeichnung „Recyclingpapierfreundlichste Stadt 2016.
Im Rahmen des Papieratlas-Städtewettbewerbs würdigten die Initiative Pro Recyclingpapier (IPR) und ihre Kooperationspartner den vorbildhaften Beitrag zur Ressourcenschonung. …..“
Quelle: Pressemitteilung der Stadt Siegen, 11.10.2016, Link: http://www.siegen.de/willkommen/detailansicht-news/news/siegen-ist-recyclingpapierfreundlichste-stadt-2016/
Hallo liebe Archivare, vielen Dank für die schönen Bilder. Da kamen manche Kindheitserinnerungen auf. Leider musste ich feststellen, dass die Bilder Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 18, 24, 27 mit Sicherheit seitenverkehrt sind. Die Bilder Nr 7, 15, 20 sind möglicherweise seitenverkehrt. Alle anderen sind richtig rum :-) Wäre schön, wenn die Fehler korrigiert würden. Vielen Dank für ihre Mühe.
Nach erfolgter Korrektur können sie meinen Kommentar gerne löschen :-)
Vielen Dank für die Korrekturen! Leider kann ich die Bilder nicht mehr entsprechend bearbeiten, so dass Ihr Kommentar stehen bleiben muss. Ein Kopieren via copy and paste ist ja möglich und jede Bildbearbeitung erlaubt dann die Korrektur.
Hallo, vielen Dank für ihre schnelle Antwort. Dass jeder, der die Bilder herunter lädt, sie leicht korrigieren kann, ist schon klar. Es wäre nur schade, dass wenn jemand, der ein seitenverkehrtes Bild online sieht zwar etwas vertrautes sieht, aber gleichzeitig vewirrt ist, weil da etwas nicht stimmt. Dass mein erster Kommentar mit dem Hinweis auf die Fehler stehen bleibt, ist ansich nicht schlimm, aber es hätte nach erfolgter Korrektur keine Gültigkeit mehr :-) MfG
1) s. a. den Eintrag „Steinhauer über den Entwurf zum Bundesarchivgesetz“ in Archivalia, 14.10.2016, Link: http://archivalia.hypotheses.org/59989
2) “ …. Ralf Jacob, Vorsitzender des Verbandes deutscher Archivarinnen und Archivare, sieht durch den geplanten neuen Paragraphen „einen bedenklichen Eingriff in die Möglichkeit der demokratischen Kontrolle der Nachrichtendienste.“
Jacob: „Hier werden weitere Hemmnisse für die Bürger, Wissenschaft und Presse aufgebaut und das Wirken der Nachrichtendienste der demokratischen Kontrolle teilweise entzogen.“ …..“, Quelle: Bild.de, 14.10.16, Link: http://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/frecher-geheimdienst-gesetz-entwurf-48265034.bild.html
Schließe mich meinem Vor-Kommentator an. Tolle Dokumente.
Danke und weiter so.
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 4.10. – 17.10.2016 | siwiarchiv.de
Schon mal vormerken: Am 19. Januar 2017 gibt es im Rahmen des Siegener Forums vom Autor Jakob Saß einen Vortrag zum Thema: „Vom Bäcker zum KZ-Kommandanten: Die „erstaunliche“ SS-Karriere des Hachenburgers Adolf Haas“.
Ort: Stadtarchiv Siegen, Markt 25, 57072 Siegen
Beginn: 18.30 Uhr
Pingback: Südwestfalen entscheidet sich für DiPS.kommunal | archivamtblog
Ausder Erfahrung wissenschaftlich wie auch genealogisch arbeitender Forscher ist die Verwirklichung der angestebten Änderungen, weil längst überfällig, nur zu begrüßen. Derartige Änderungen sind aber auch für die Archivgesetze der Länder unerlässlich und müssen bis in die Archive der Kreise und Kommunen durchschlagen. Ein (schlechtes) Beispiel: Die im Archiv der Hansestadt Lübeck befindlichen Standesamtsregister sind nicht einsehbar! Auch nicht die Register. Für Anfragen ist ein Formular auszufüllen. Archivmitarbeiter suchen und erstellen gegen viertelstündig berechnete Gebühr dann Kopien. Benutzerfreundlichkeit???
Ein Link zur Aufzeichnung der Anhörung, den schriftlichen Statements der Sachversändigen findet sich auf der Seite des Verbandes deutscher Archivarinnen und Archivare. Dort wird auch über die Novellierung diskutiert: http://www.vda-blog.de/index.php/2016/10/20/oeffentliche-anhoerung-zur-novellierung-des-bundesarchivgesetzes/
Das Interesse und die Bemühungen für die regionale Geschichte sind sehr löblich, der methodische Ansatz aber leider unbefriedigend. Neben der anmutenden Beliebigkeit der ausgesuchten Bauwerke und deren Überbleibsel wurde das Problem der fehlenden Gleichzeitigkeit ja schon selbst genannt. Verschiedene Epochen und Kulturen in einen Topf werfen und schauen, was dabei herauskommt, hat den Beigeschmack von Kaffeesatzleserei.
Was des Weiteren nicht beachtet wird: Geometrisch betrachtet stellt die Erde ein Rotationsellipsoid dar. Jegliche durch künstliche Verebnung entstandene Karte ist ein Kompromiss zwischen Winkeltreue, Längentreue und Flächentreue. Selbst die abschnittsweise Verebnung durch Meridianstreifen bleibt fehlerbehaftet. Wenn Winkelspielereien betrieben werden, müssten diese am ehesten auf absolut winkeltreuen Seekarten erfolgen. Nur da wird’s mit den beliebten Wallburgen schwierig…
Als Autor der Homepage nehme ich gerne zu den drei Kritikpunkten Stellung.
Punkt 1 („anmutende Beliebigkeit der ausgesuchten Bauwerke“)
Alle keltischen Burgen Wittgensteins und des direkten Umfeldes wurden berücksichtigt. Vor allem die geometrischen Konstellationen direkt benachbarter Anlagen sind dargestellt.
Die Auswahl der Kirchen erfogte aufgrund der Bedeutung oder der direkten Nachbarschaft der Anlagen. Der Grund für die Bedeutung ist jeweils dargelegt.
Punkt 2 („verschiedene Epochen in einen Topf…“)
Auf einer Homepage-Seite werden isoliert die geometrischen Abhängigkeiten von benachbarten Kirchen untersucht (Elsofftal), auf anderen Seiten isoliert die Beziehungen von Burgen – im Ergebnis mit den gleichen Gesetzmäßigkeiten. Erst auf einer zweiten Stufe erfolgt die Kombination von alten Kirchen und keltischen Burgen – wieder mit den gleichen Regelhaftigkeiten.
Punkt 3 („Rotationsellipsoid Erde“)
Messungen über größere Entfernungen sind grundsätzlich fehlerträchtig und daher problematisch. Daher konzentrieren sich die Messungen des untersuchten Raumes auf eng beieinander liegende Objekte mit kurzen Distanzen. Die Toleranzabweichung ist erläutert.
Pingback: Literaturhinweis: Peter Vitt: Raiffeisen-Genossenschaft Attendorn 1916- 2016 | siwiarchiv.de
Ist den Wittgensteiner Esoterik-Freunden schon aufgefallen, dass sie sich ziemlich genau auf der gleichen geographischen Breite wie Stonehenge befinden? (Berleburg 51°3′, Stonehenge 51°10′) Wenn die Druiden zur Tag- und Nachtgleiche auf ihren Hirschfellen im Steinkreis saßen, sahen sie die Sonne exakt über dem Wittgensteiner Land aufgehen. Daher der Spruch „Ex oriente lux“. Heute läßt sich das nicht mehr gut beobachten, weil inzwischen der Kölner Dom (50°56′) im Weg steht. Wunder über Wunder!
Pingback: Vortrag „Kirchenbau im Erzbistum Paderborn in den 50er und 60er Jahren im 20. Jahrhundert | siwiarchiv.de
Wird der Vortrag publiziert werden? Wenn ja, wo?
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 18.10. – 31.10.2016 | siwiarchiv.de
s. a. derwesten.de, 30.10.2016: http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-siegen-kreuztal-netphen-hilchenbach-und-freudenberg/aus-der-baeuerlichen-wird-raiffeisen-id12314735.html
s.a. derwesten.de, 1.11.16: http://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-bad-berleburg-bad-laasphe-und-erndtebrueck/erinnerung-ist-eine-form-der-begegnung-id12322761.html
1. „Alle keltischen Burgen Wittgensteins und des direkten Umfeldes wurden berücksichtigt.“ – viele Wallburgen sind nicht datiert. Statt in keltischer Zeit landen sie womöglich auf einmal im frühen Mittelalter und damit im Kontext ganz anderer Kulturgruppen. Gleiches gilt für die These „Sakrale Raumordnung im Wittgensteiner Land“ – überwiegend ist die Bedeutung von Wallburgen noch gar nicht richtig erforscht. Inwieweit sie sakralen Zwecken dienten, bleibt zu erforschen. Und warum überhaupt Wittgensteiner Land – sie streifen doch auch das Hochsauerland mit Wormbach? Eine „hochgradig strukturierte Sakraltopographie“ und ein „System geodätischer, geometrischer und astronomischer Beziehungen“ macht vor modernen Ländergrenzen halt? Oder liegt es daran, dass TIM-online nur NRW basiert ist und sie deshalb nicht nach Hessen schauen?
2. „Vor allem die geometrischen Konstellationen direkt benachbarter Anlagen sind dargestellt.
Die Auswahl der Kirchen erfogte aufgrund der Bedeutung oder der direkten Nachbarschaft der Anlagen. Der Grund für die Bedeutung ist jeweils dargelegt.“ – Als Grund für die Bedeutung wird meistens Ihr gemessener Winkel angegeben. Aber das ist ja nicht der Grund, warum sie dieses oder jene Bauwerk ausgewählt haben. Warum z. B. nicht die Kirche Schwarzenau, Kapelle Altertshausen oder Christianseck? Wenn Gründe geliefert werden dann z. B. „Der Wilzenberg bei Schmallenberg ist der ‚heilige Berg des Sauerlandes‘ und ebenfalls Wallfahrtsort.“ Derartige Zitate sind unwissenschaftlich und es wird nicht deutlich, wer die Bedeutung, die sie bemessen, begründet – „die“ Kelten, „die“ Christen, die HSK-Tourismusbranche…? Für wen und warum ist die Kirche in Raumland bedeutend? Ich finde keinerlei Begründung.
Wie gesagt, super, dass sich mit Geschichte auseinander gesetzt wird und auch mal andere Überlegungen angestellt werden, aber methodisch ist es leider nicht haltbar. Nur weil bestimmte Zahlen schön ausschauen, kann man keine unterschiedlichen Kontexte, die zumal noch hunderte bis tausende Jahre auseinanderliegen können, in einen Topf werfen.
Die Frage ist doch, ob sich all die methodenkritische Mühe bei etwas lohnt, das sowieso niemand (außer den Vefechtern solcher Hypothesen selbst) für wissenschaftlich fundiert hält. Aber natürlich führt es auch zu nichts, sich über dieses Hobby lustig zu machen (Asche auf mein Haupt!). „Auch mal andere Überlegungen“ anzustellen, mag ja „super“ sein. Überlegungen aber, die seit ungefähr hundert Jahren (ausgehend von England) herumgeistern, sind so „anders“ längst nicht mehr. Unhöflich ausgedrückt: Schnee von gestern, nach dem außerhalb der New-Age-Anhängerschaft kein Hahn mehr kräht.
Im übrigen überraschen die Wittgensteiner „Forschungsergebnisse“ keineswegs. Wer auf der Landkarte Muster sucht, findet sie auch. Auf die mehr oder weniger keltischen Stätten kommt es dabei gar nicht an. Mit dem gleichen Erfolg lassen sich die Positionen von McDonald’s-Filialen oder öffentlichen Bedürfnisanstalten untersuchen. Man kann aber auch gleich eine Tüte Erbsen ausschütten und die Winkel der Verbindungslinien messen. 30°-Winkel und ihre Vielfachen tauchen zwangsläufig mit höherer Wahrscheinlichkeit auf als viele andere. Mit Geographie, Archäologie, Geschichte und sonstigen Realien hat das Phänomen nichts zu tun.
“ …. [Dr. Manuel Zeiler] ist in der Außenstelle Olpe des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe in der Archäologie-Abteilung tätig und untersucht weiterhin vor allem die Wallburgen auf ihre Anordnung. ….“ in: Westfälische Rundschau, 12.10.2016 (Link s.o.). Ob Zeiler New-Age-Anhänger ist oder sich nur mit alten Hüten beschäftigt, muss wohl noch geklärt werden, oder?
Wenn Sie so fragen: Nein, es muß nichts geklärt werden, was nicht behauptet worden war. Niemand beanstandet,dass sich Herr Dr. Zeiler, um den es hier überhaupt nicht ging, für die Thematik interessiert. Dass er die vorgelegten Hypothesen der (Zitat WAZ:) „Hobby-Forscher“ für bare Münze nehmen würde, läßt sich aus dem Zeitungsartikel nicht ablesen. Im Gegenteil: „Diese Untersuchungen stehen immer noch an ihrem Anfang und bilden ein weites Feld“. Ich glaube nicht, dass Herr Dr. Zeiler mit dem „weiten Feld“ die Niederungen esoterischer Phantastereien meint.
Mir ging es ja auch nicht so sehr um Zeiler, sondern um die Rolle der Wallburgen, die – leider kein alter Hut – offsichtlich noch der Bearbeitung harrt:
“ …. Ungeklärt ist auch die Rolle der vielen Wallburgen [im Siegerland].
Hier besteht noch viel Forschungsbedarf, der mit dem seit 2008 von der DFG geförderten interdisziplinär ausgerichteten Forschungsprojekt zum „Frühes Eisen
im Mittelgebirgsraum“ nachgekommen wird. ….“ in: Jennifer Garner, Der latènezeitliche Verhüttungsplatz in
Siegen-Niederschelden „Wartestraße“, in Metalla Nr. 17 Heft 1/2 (2010), Bochum, S. 91.
Vorweg: Mit Esoterik haben die Untersuchungen überhaupt nichts zu tun. Grundlage ist im Gegenteil (knallharte) Geometrie und Mathematik, die keinerlei Abweichung zulässt.
Dr. Zeiler interessiert sich für die Beziehungen der keltischen Burgen untereinander, eine Verquickung von Ringwallanlagen und alten Kirchen lehnt er kategorisch ab. Er ist im übrigen auf einem guten Wege, die kultische Bedeutung der keltischen Bauwerke zu beweisen. Es ist noch nicht allzu lange her, da wurden diesbezügliche Überlegungen ins Lächerliche gezogen.
Selbstverständlich gibt es auch Archäologen, die sich für keltische Landvermessung interessieren oder darüber hinaus sie detailliert untersuchen. Ein prominentes Beispiel ist Professor d´Aujourd´hui aus der Schweiz, mit dem ich korrespondiere.
Er stellt Forderungen an den Nachweis eines Vermessungssystems:
Orientierung, z. B. an den Haupthimmelsrichtungen
ein orthogonales System,
ein antikes Maß.
Die Punkte 1 und 2 sind bei der Anordnung der Bauwerke Wittgensteins und des direkten Umfeldes gegeben, an Punkt 3 arbeite ich. Hierzu gibt es aber schon gute Ansatzpunkte im hessischen Bereich (Burg Eisenberg, Burg Christenberg, Burg Rimberg). Die Verbindungen Kirche Bromskirchen-Kirche Frohnhausen (N-S-Richtung) und Elsoff-Birkenbringhausen (W-O-Richtung) schneiden sich exakt rechtwinklig auf dem Eisenberg bei Battenberg. Die Abweichung von den Haupthimmelsrichtungen ist minimal. Basislinie ist die Strecke Burg Eisenberg-Burg Christenberg mit einem exakten Winkel von 41° von der W-O-Richtung. Für die umliegenden Kirchen sind vielfach 30°-Winkel nachzuweisen. Wie richtig vermutet, scheitert eine kartographische Darstellung am nicht vorhandenen TIM-Online-System für Hessen.
Professor d´Aujourd´hui hält es im übrigen „für wahrscheinlich, dass es christliche Kirchen gibt, die auf antike Spuren zurückgehen“.
Um es noch einmal ganz deutlich zu formulieren: Alle keltischen Burgen Wittgensteins und des direkten Umfeldes wurden berücksichtigt, mit dem Wilzenberg, Burg Kahle, dem Hofkühlberg, Burg Obernau, Burg Rittershausen, Burg Rimberg und Burg Eisenberg auch direkt benachbarte Anlagen außerhalb Wittgensteins. Auch nahezu alle alten Kirchen Wittgensteins sind erfasst. Die Bauwerke in Schwarzenau und Christianseck sind jung, die Kapelle Alertshausen ist als sakrales Bauwerk im Elsofftal sehr wohl berücksichtigt. Ich habe eine Viezahl weiterer geometrischer Bezüge gespeichert, die im Rahmen einer Homepage unmöglich zu präsentieren sind.
Wissenschaftliches Arbeiten bedeutet für mich:
eine Hypothese aufstellen, Gesetzmäßigkeiten und Regelhaftigkeiten feststellen, die für jeden nach- und überprüfbar darzustellen, größmögliche Genauigkeit walten zu lassen und vor allem bei frappierenden Gesetzmäßigkeiten weitere Untersuchungen anzustellen, um zu verifizieren oder zu falsifizieren. Zum Abschluss: Viel Erfolg beim Versuch
fünf Erbsen (sinnbildlich für die benachbarten sakralen Bauwerke im Elsofftal) so auszustreuen, dass alle über 30°-Winkel erfasst werden (bitte absolut exakt), drei weitere daneben (für die Konstellation Kirche Wingeshausen-Burg Aue-Kirche Berghausen), so dass ebenfalls 30°-Winkel zustande kommen und zwei Abstände auf den Millimeter identisch sind.
Leider keine Antwort auf die Frage, wer welchen Bauwerken wann welche Bedeutung zuspricht. In dieser Hinsicht keine Nachprüfbarkeit gegeben und somit unwissenschaftlich. Es bleibt: Bauwerke werden ausgewählt, weil sie ein schönes Winkelmaß bilden, wie sie datieren, welchen Kontext sie besitzen scheint egal. Das ist schade.
s. a. Siegener Zeitung, 31.10.2016: http://www.siegener-zeitung.de/siegener-zeitung/Der-Traum-vom-Denkmal-da9acbee-fa82-45e0-b327-9ea47d9fb13a-ds
Die Berliner Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung (BBF) bietet eine Archivdatenbank – http://bbf.dipf.de/kataloge/archivdatenbank/hans.pl – an, die u. a. Personalkarteikarten für Volksschullehrer in Preußen enthält. Dort ist sowohl für Ernst Dieckmann – http://bbf.dipf.de/hans/VLK/VLK-0016/vlk-0016-0053.jpg – als auch für Dorothea Rieke eine Karteikarte vorhanden: http://bbf.dipf.de/hans/VLK/VLK-0016/vlk-0016-0403.jpg .
Am Labor für technische Datenverarbeitung und Informationstechnik der FH Köln, Campus Gummersbach, gab es 2010 folgendes, regional relevantes Forschungsprojekt: „Topologische Aspekte von Wallburgsystemen“. Informationen dazu sind unter diesem Link downloadbar: http://tdi.gm.fh-koeln.de/dlbrowser/%3EAllgemein%3EInfos%20zu%20Projekten%3EWallburgen .
In der aktuellen Wittgenstein-Bibliographie von A. Krüger finden sich folgende Literaturhinweise zum Suchwort „Wallburg“:
Böttger, Hermann: Ausgrabungen an den Wallburgen bei Afholderbach, Aue, Laasphe und Niedernetphen, In: Siegerland, 1932, Heft 3 und 4, Seiten 42-45
Böttger, Hermann: Die Wallburgen und die Anfänge der Eisenindustrie im Siegerland Grund der Ausgrabungen 1932, In: Heimatland, Beilage zur Siegener Zeitung, Nr. 5, Jg. 8, 1933, S. 74-80
Born, Ernst: Uf der Wuhnige (Wallburg Aue), Wittg. Bd. 32/1968/H. 4/S. 197-198
Kraemer, Adolf: Die Wallburgen und „Burg-Berge“ in Wittgenstein
DschW. 1927/H. 2/S. 54-56
Kraemer, Adolf: Fundstücke aus Wittgensteiner Wallburgen im Museum zu Siegen, DschW. 1938 /Nr. 8/S. 57-58
Radenbach, Hans-Günter: Die eisenzeitliche Siedlungskammer südlich der Wallburg bei Aue, Wittg. Bd. 46/1982/H. 4/S. 131-139
Vitt, Fritz Was unsere Wallburgen erzählen, WHB 38/S. 7-14
Tang, Jürgen Die Wallburg „Burg“, ChronikHesselbach S. 41-43
Herrn Poggels letztem Kommentar ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Nur noch eine ergänzende Frage an Herrn Grebe, bevor ich mich zurückziehe: Was nutzt es Ihrer Hypothese, wenn Sie auf Karten einer Mittelgebirgslandschaft irgendwelche schönen Winkel einzeichnen können, die mit den im dreidimensionalen Gelände vorzufindenden Beziehungen unterschiedlich hoch gelegener Objekte nichts zu tun haben? Oder wollen Sie andeuten, die „alten Kelten“ hätten das Land aus der Vogelperspektive vermessen und anhand solcher Projektionen, quasi am Schreibtisch, den Raum geordnet? Dann könnten Sie freilich auch gleich die prähistorischen Besucher aus dem All ins Spiel bringen, die uns Erdlingen solche „Satellitenkarten“ als Gastgeschenk mitbrachten.
Babylonier, Ägypter, Griechen, Etrusker, Römer – alle haben auf hohem Niveau vermessen, nicht nur im Flachland.
Die Kelten pflegten enge Kontakte zu Griechen und Etruskern.
In den letzten drei Jahrzehnten hat sich die Einschätzung bzgl. der Kelten dank fächerübergreifender Studien stark gewandelt. Inzwischen stuft man sie als hohe Kultur mit teilweise überragenden Fähigkeiten ein.
Das ist eine vielsagender Epilog! Ich wünsche weiterhin fröhliches Forschen.
s. dazu derwesten.de, 3.11.2016
Den 1. 6. 1817? Als beide Kreise zum Amtsbezirk Arnsberg kamen und somit in die Provinz Westfalen zugewiesen wurden.
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 1.11. – 14.11.16 | siwiarchiv.de
„Wenn ich es richtig begriffen habe, gehörten die beiden Grafschaften Wittgenstein sofort nach der preußischen Inbesitznahme im Juli 1816 zum Regierungsbezirk Arnsberg.
Digitalisiert liegt vor:
„Patent wegen Besitzergreifung des Herzogthums Westfalen und der Grafschaften Wittgenstein-Berleburg und Wittgenstein-Wittgenstein“, Arnsberg 15.7.1816
in: Amtsblatt für die Provinz Westfalen vom 20.7.1816, Nr. 53, S.305-310.
http://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/hd/periodical/pageview/1056067
Demzufolge wurden die Wittgensteins „der hiesigen Kgl. Regierung … unterstellt“, was sich eigentlich nur auf Arnsberg beziehen kann, da das Patent von Vincke dort (und nicht in Münster) ausgestellt worden war.
Die Verordnung betr. den Übergang des Kreises Siegen von Koblenz nach Arnsberg finden Sie im Koblenzer Amtsblatt vom 9.6.1817:
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10014781_00195.html
Leider sind die Arnsberger Amtsblätter erst ab 1821 digitalisiert, und die UB besitzt die ersten Jahrgänge auch nicht im Original. Im Stadtarchiv Siegen sind sie aber, soweit ich mich entsinne, vorhanden. Vielleicht könnte man die für unsere Kreisgeschichte relevanten amtlichen Mitteilungen von 1816/17 dort einmal heraussuchen und für Siwiarchiv scannen.“
Pingback: Sendetipp zur Wittgensteier Radiogeschichte | siwiarchiv.de
Dieser irritierende Eintrag erfordert ein Bekennerschreiben. Bei dem Text des „Anonymus“ handelte es sich um eine persönliche E-Mail an den Administrator, die versehentlich fast komplett hier eingestellt worden ist. Ausgereicht hätte der Link zum Patent von 1816, falls eine amtliche Bestätigung des in der Zeittafel genannten Termins nötig gewesen wäre. Ich war mir nicht sicher, ob ich den Einwand von Herrn Sigg richtig verstanden hatte, deshalb wollte ich ihn nicht kommentieren.
Pingback: Glaspavillon für Nachbau des ersten Motoromnibusses der Welt feierlich eingeweiht | siwiarchiv.de
Pingback: Film: „Abiturientia 1914 Siegen“ | siwiarchiv.de
Der Übergang an Preußen ist wahrlich nicht einfach, da verliert man schnell den Überblick.
1. Preußen war zunächst einmal mehr an Sachsen als an irgendwelchen Territorien im Westen (u.a. am „Siegerland“) interessiert.
2. Im Verhältnis zu Wittgenstein gestaltete sich die Besitzergreifung des Gebietes des späteren Kreises Siegen umständlicher und zeitaufwendiger. Im Dezember 1813 gelangte zwar Wilhelm Friedrich Fürst zu Oranien-Nassau, der spätere König der Niederlande wieder in Besitz seiner Erblande mit den Fürstentümern Hadamar, Dillenburg, Diez und Siegen, trat diese aber bereits am 31. Mai 1815 im Gebietstausch gegen das Großherzogtum Luxemburg an Preußen ab. Preußen wiederum überschrieb am gleichen Tage die ehemaligen Fürstentümer Dillenburg, Diez, Hadamar vollständig sowie den Freien- und Hickengrund (Ämter Burbach und Neunkirchen) und einige Ortschaften der Ämter Siegen, Netphen und Irmgarteichen – insgesamt eine Bevölkerung von 12.000 Einwohnern – an das Herzogtum Nassau (nicht an das Großherzogtum Niederrhein wie oben angegeben!) . Gleichzeitig verpflichtete sich der Herzog von Nassau, die an ihn abgetretenen Ämter und Gemeinden später im Tausch gegen die Grafschaft Katzenelnbogen, welche Preußen zwischenzeitlich von Hessen zu erwerben beabsichtigte, zurückzugeben.
Lit.: Achenbach, Kreis Siegen, S. 31; Kruse, Das Siegerland, S. 271-273 (mit Nennung der einzelnen Ortschaften); Gesetz-Sammlung f.d. Königlichen Preußischen Staaten 1918, S. 31; Karte für das 12.000 Seelen-Gebiet bei Dango, Wilnsdorf, S. 270.
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 15.11. – 28.11.16 | siwiarchiv.de
Pingback: Vorankündigung: Buchveröffentlichung zum 400. Jubiläum der Siegener Ritter- und Kriegsschule | siwiarchiv.de
Zur Geschichte des Kunstdepots in Siegen sind auch folgende Archivalien des Kölner Stadtarchivs einzusehen:
1) Bestellsignatur: Acc. 229 (412 Konservator), 435
Laufzeit: 1945 – 1952
Titel: Kunstschutz ab 1. Mai 1945
Enthält: u.a. Berichte über Besichtigung der Depots in Siegen, Runkel, Schadeck und Heldburg. – Sicherungsarbeiten an Baudenkmälern. – Schutz privater Kunstsammlungen. – Protokoll der Besprechung der Denkmalpfleger und einzelner Museumsdirektoren Nordwestdeutschlands in Bünde am 16.2.1946. – Niederschriften über Tagungen der „Arbeitsgemeinschaft der Rhein. Museen“ am 8.3. und 24.5.1946. – Gründung eines baugeschichtlichen Seminars an der Staatlichen Ingenieurschule für Bauwesen, Dormagen. – Erfassung der Kriegsschäden an Denkmalbauten. – Kunstgutrückführung aus Schloß Dyck.
2) Bestellsignatur: Acc. 229 (412 Konservator), 437
Laufzeit: 1945 – 1953
Titel: Schriftwechsel mit der Militärregierung, dem Provinzialkonservator der Rheinprovinz, der Archivverwaltung beim OP der Nordrheinprovinz über Bergungen, Rückführung von Kunstgegenständen etc. nach dem Kriege. – Listen des Kunstgutes auf Schloß Runkel und Burg Schadeck. – Protokoll über eine Besprechung mit der Militärregierung am 25.1.1946. – Liste der Bergungsorte. – Kunstguttransport von Siegen und Crottorf nach Marburg.
3) Bestellsignatur: Acc. 229 (412 Konservator), 467
Laufzeit: 1944 – 1958
Titel: Bergung und Rückführung von Kunstwerken aus Siegen.
4) Bestellsignatur: Acc. 93 (411 Verwaltung der Museen), A 259
Laufzeit: 1946 – 1947
Titel: Auslagerungen von Kunstgut in Museumsdepots: Schloß Alfter, Dyck, Ehrenbreitstein, Schloß Frens, Gaibach, Amorbach, Geilnau, Gudenau, Schloß Harff, Hohenzollern, Tübingen, Schloß Kuckuckstein, Langenau, Siegen, Marburg, Nordkirchen, Oberaudorf, Unterdiessen, Hochbunker Vingst. –
Enthält: Rückführung des Gitters aus dem Kloster Heisterbach nach Köln. – Liste der auf der Festung Ehrenbreitstein befindlichen Bilder des Wallraf-Richartz-Museums. – Presseausschnitte über die Tübinger Ausstellung. – Bericht des württembergischen Landeskonservators Rieth über die Verlegung der Bilder von Hohenzollern nach Tübingen. Beschlagnahme von Schloß Frens durch die Militärregierung (7.8.46). Schriftwechsel mit Fritz Fremersdorf über die Unterbringung von Museumsgut und die Stellenbesetzung an Kölner Museen. – Rückführung der Kunstsammlungen aus der amerikanischen Zone. – Liste der Museumsdepots der Hansestadt Köln.
5) Bestellsignatur: Acc. 177 (4110 Wallraf-Richartz-Museum), A 354
Laufzeit: 1944 – 1948
Titel: Unterbringung, Betreuung und Rückführung der Gemälde aus dem Bergungsort Siegen; Korrespondenz und Berichte.
via Digitaler Lesesaal des Stadtarchiv Köln
Die noch auf der Agenda des Kreisarchivars stehende Auswertung des an vorletzter Stelle genannten Buches (Kruse) kann jeder selbst vornehmen:
http://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/urn/urn:nbn:de:hbz:6:1-23769
Darin S. 273-274: Abdruck von Schencks Bewerbung um die Stelle des Kreisdirektors vom 2.8.1815.
Pingback: Superspannend: Landräte im Adventskalender | Archivalia
Einige Bilder sind seitenverkehrt.
Danke für den Hinweis! Leider können die Bilder nicht einfach gedreht werden. Steht aber auf der to-do-Liste.
Wie der Heimatverein Holzhausen uns unterrichtete, handelt es sich bei dem Bild nicht um eine Gasstätte in Burbach-Holzhausen, sondern um wohl um eine in Laasphe-Holzhausen.
Pingback: siwiarchiv-Adventskalender 2016/5 | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Adventskalender 2016/5 | siwiarchiv.de
Der volle Wortlaut des Antrages ist jetzt auf der Homepge der SPD Neunkirchen einsehbar: http://www.spd-neunkirchen-siegerland.de/aktuelles/294-unsere-neunkircher-spd-sorgt-sich-um-den-erhalt-dokumentation-und-sicherung-von-unterlagen-zur-mannigfaltigen-geschichte-in-unserer-gemeinde-neunkirchen.html .
Könnte das Gebäude der Bezirksregierung Arnsberg im Hermelsbacher Weg 15 sein. Dort ist der Standort Siegen für die Arbeitsschutzverwaltung.
Nein. Aber ein guter Ansatz!
Am Unteren Schloss in siegen, hat Platz gefunden in einem der acht neuen Seminarräume der Universität.
Ich bin jetzt einmal pingelig: in welchem Seminarraum?
In dem rechten Schlossflügel 1. Etage. Der Seminarraum, wenn man rechts durch die Glastür geht.
Gratulation! Sie haben das Rätsel gelöst – es handelt sich um den Seminarraum US-A 134/1.
Die archivische Überlieferung bis 2007 befindet sich im Landesarchiv NRW, Abt. Westfalen, in Münster – s. http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/bestand.jsp?archivNr=1&tektId=1444&expandId=1436
Pingback: Aloys Sonntag (1913 – 1979), Siegener Architekt | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Adventskalender 2016/11 | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 29.11.16 – 12.12.16 | siwiarchiv.de
Pingback: Grünes Licht für Bundesarchivgesetz (?) | siwiarchiv.de
Mein Bruder Dr.Georg Braumann hat viele Orginale von Saenger-ebenso ich:Elisabeth Kleinwächter.
Der Vorsitzende des 4fachwerk-Vereins ist geradezu Fan der alten Siegerländer Meister (02734 / 7223). Vielleicht könnte zu einem späteren
Zeitpunkt (frühestens 2018)eine neue überarbeitete Ausstellung zu Sänger geben.
Online zu finden ist auch:
Adolf Henze: Handschriften-Lesebuch. Eine Anleitung, Leipzig 1854: http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/172624/5/0/
Pingback: Vor 45 Jahren: Fertigstellung der A 45 im Siegerland | siwiarchiv.de
Auch der Innenausschuss des Bundestages hat am 14.12.2016 über das Archivgesetz nicht öffentlich beraten und einen Beschluss gefasst, von dem lediglich folgendes bekannt ist:
Pingback: GehDenken, 16.12.16 | siwiarchiv.de
Medienecho: Westfälische Rundschau, 16.12.2016: http://www.wp.de/staedte/siegerland/puppenstube-eisenbahn-im-kulturbahnhof-kreuztal-id209007001.html
Eine Anfrage an die Stadt Siegen als untere Denkmalbehörde könnte hier
hilfreich sein.
Danke für den Hinweis! Haben wir bereits gemacht.
Das gesuchte Gebäude befindet sich ganz in der Nähe des Kreishauses, genauer gesagt Koblenzer Straße 136, gegenüber der Siegerlandhalle. Es handelt sich um den Sitz des AWO-Kreisverbands Siegen-Wittgenstein/Olpe.
Allseits ein schönes Weihnachtsfest!
Danke für den Hinweis! Aus urlaubtstechnischen Gründen hatte ich keine Gelegenheit dorthin zu gehen, denn dies wäre mein erster Weg gewesen.
Das Stadtarchiv Siegen verabschiedet sich in die Weihnachtsfeiertage mit dem an dieser Stelle sicherlich angebrachten Hinweis auf die üppigen Öffnungszeiten „zwischen den Jahren“. Wir empfangen Besucher in der Zeit vom 27. bis zum 30. Dezember zu den bekannten Öffnungszeiten, Gelegenheit auch für alle von unserer Sommerschließungsperiode Enttäuschten Versäumtes – nach verdauter Printe – nachzuholen.
Wir wünschen allen unseren Besuchern ruhige und besinnliche Feiertage und freuen uns auf regen Besuch im Jahr 2017.
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 13.12. – 26.12.2016 | siwiarchiv.de
Wann wird denn
https://stadtarchivkoblenz.wordpress.com/
in die Blogroll aufgenommen?
Und
https://archivtag.hypotheses.org/ ??
Und
https://www.archiv.uni-leipzig.de/archivblog/ ??
Und
https://archivlinz.hypotheses.org/ ??
Ist „archivamtbllog“ Absicht?
Man kann sicher gute Gründe finden
https://archiveowl.wordpress.com/
wegzulassen, wie in der Siwiarchiv-Blogroll. Aber den Menschen draußen im Lande soll mit diesem Kommentar signalisiert werden, dass es noch ein weiteres obkures Archivblog gibt.
https://archivblogbrandenburg.wordpress.com/ ist offenbar eingegangen.
Aus dem Ausbildungsbereich dagegen lebendig:
http://fhvr-aub-blog.de/
Reines Tagungsblog:
https://lvrafz.hypotheses.org/
Davon abgesehen: Siwiarchiv führt die vollständigste Blogroll der Archivblogs in Deutschland. Glückwunsch!
Bei Österreich müssten Salzburg (inaktiv) und Schottenstift noch dazu, beide bei Hypotheses.
Schweiz: Staatsarchiv Basel
http://blog.staatsarchiv-bs.ch/
Evtl. auch
https://zeitfenster1916.ch/
Danke für das Lob und die Ergänzungen, die ich mit zwei Ausnahmen eingearbeitet habe! Eigentlich ist ja nicht die primäre Aufgabe von siwiarchiv eine deutsch(sprachige) Archiv-Blogroll zu führen und aktuell zu halten, aber wenn wir die vollständigste Auflistung sind, führen wir diese gerne weiter. Ergänzende Hinweise sind natürlich willkommen.
Pingback: „Archivar“ 4 (2016) online | siwiarchiv.de
Pingback: Literaturhinweis: „Zeugnisse von der ‚Heimatfront‘“ | siwiarchiv.de
Seit gestern ist der Artikel „Demenz des historischen Gedächtnisses“ von Rudolf Neumaier in der Süddeutschen Zeitung zur Novellierung des Bundesarchivgesetz online: http://www.sueddeutsche.de/kultur/bundesarchivgesetz-demenz-des-historischen-gedaechtnisses-1.3318238
Der Artikel kann hier als PDF gelesen werden: http://www.vda.archiv.net/aktuelles/meldung/457.html .
In der öffentlichen Niederschrift der Sitzung des Rates der Gemeinde Neunkirchen vom 8.12.2016 finden sich auf S. 3 folgenden Ausführungen zum zum Archivarbeits-Antrag: “ …. BM Baumann informiert über die eingegangenen Anträge zu den Themen „Archivarbeit“ und „Ausbau der Beleuchtung entlang der K 23“. Zur Archivarbeit berichtet GVR Flick kurz über die Historie und die seinerzeit aus Kostengründen erfolgte Zurückstellung des Projektes. Zu beiden Anträgen wird in der nächsten HFA [Anm.: Haupt- und Finanzausschuss]-Sitzung [Anm.: 26.1.2017] berichtet. ….“
Link zur Niederschrift: https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz080/sdnetrim/Lh0LgvGcu9To9Sm0Nl.HayIYu8Tq8Sj1Kg1HauCWqBZo5Ok7KiyIhuGWsGSv4Ql0Oe-GczCXuCWn4Oi0Lg-IbvDauHTp8To1Ok0HbwHau8Vt6Pi6Km0GJ/Oeffentliche_Niederschrift_Rat_08.12.2016.pdf
Übrigens vor fast genau drei Jahren war der Neunkirchener Bahnhof als Unterbringung für ein Gemeindearchiv in Rede: http://www.siegener-zeitung.de/siegener-zeitung/Alter-Bahnhof-wechselt-den-Besitzer-8d6ba9d0-7088-4474-9ea7-61c643d5e891-ds .
Im Bestand R 8034-III (Reichslandbund-Pressearchiv, Personalia) des Berliner Bundesarchivs befinden sich unter Nr. 433 Artikel zu Landrat Schroeder aus den Jahren 1910 – 1911.
„Darf der Staat seine Spuren löschen?“ – ein weitere Bezahl-Artikel von Frank Bösch und Eva Schlotheuber in der FAZ von heute zur Novellierung des Bundesarchivgesetzes: http://plus.faz.net/evr-editions/2017-01-06/41679/307109.html
Das Kulturmagazin perlentaucher.de paraphrasiert den Bericht wie folgt: “ …. Auch in der FAZ kommt das geplante neue Bundesarchivgesetz … nicht gut an. Die Historiker Frank Bösch und Eva Schlotheuber fürchten einmal, dass künftig wichtige Akten zu schnell geschreddert werden. Andere Dokumente, etwa von Bundeskanzlern, landen bei Stiftungen. „Der Gesetzentwurf sieht zudem neue Sonderregelungen für die Nachrichtendienste vor. Diese sollen Akten nur dann an das Bundesarchiv übergeben, wenn ‚überwiegende Gründe des Nachrichtenzugangs oder schutzwürdige Interessen der bei ihnen beschäftigten Personen einer Abgabe nicht mehr entgegenstehen‘. Wann das der Fall ist, entscheiden nach diesem Entwurf die Geheimdienste selbst. Eine zumindest nachträgliche demokratische Kontrolle ihrer Arbeit ist so schwerlich möglich. Die Selbstsicht der Behörde auf die eigene Tätigkeit wird zum Leitmotiv erhoben. Kann oder, besser gesagt, will sich eine Gesellschaft das leisten?“ …..“
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 27.12.2016 – 9.1.2017 | siwiarchiv.de
Pingback: „Vom Bäcker zum KZ-Kommandanten: Die „erstaunliche“ SS-Karriere des Hachenburgers Adolf Haas“ | siwiarchiv.de
Die Beitrag „Gelöschtes Gedächtnis? Kritik am neuen Bundesarchivgesetz“ von Christiane Habermalz für die Sendung „Zeitfragen“ des DeutschlandradiosKultur vom 11.1.2017 kann hier angehört werden: http://www.deutschlandradiokultur.de/kritik-am-neuen-bundesarchivgesetz-geloeschtes-gedaechtnis.976.de.html?dram:article_id=376115
Wer wie ich absolut keine Ahnung von Militärgeschichte hat, wird mit der naiven Google-Bildsuche nach „gekreuzte Kanonen“ sofort fündig:
http://images.delcampe.com/img_large/auction/000/305/123/787_001.jpg
Demnach handelt es sich um die Hälfte eines französischen Koppelschlosses.
Für „boucle de ceinturon“ + artillerie erhält man auch noch zahlreiche weitere Beispiele auf französischen Web-Seiten. Dieses Bildmotiv war anscheinend während des Zweiten Kaiserrreichs (1852-1870) gebräuchlich.
Pingback: Open Data – Digitale Geobasisdaten NRW | Archivalia
Der Film wird hier kommentiert: https://archivalia.hypotheses.org/62343
Pingback: Blogparade: siwiarchiv wird 5 Jahre alt | Archivalia
Auch google reiht sich in die Schar der Gratulanten ein:

;-)
Glückwünsche aus den Niederlanden:
Pingback: Sicherung der Bibliothek Adolf Wurmbachs | siwiarchiv.de
Pingback: Vortrag zu Hedwig Jung-Danielewicz – Für Kurzentschlossene. | siwiarchiv.de
Pingback: Vortrag zu Hedwig Jung-Danielewicz – Für Kurzentschlossene. | siwiarchiv.de
Pingback: Bundesarchivgesetz in 2. und 3. Lesung morgen im Bundestag | Archivalia
Pingback: Vorarbeiten für eine noch zu schreibende Biographie Adolf Wurmbachs | siwiarchiv.de
Pingback: Vorarbeiten für eine noch zu schreibende Biographie Adolf Wurmbachs | siwiarchiv.de
Links zur heutigen Debatte um das Bundesarchivgesetz:
1) Entschliessungsantrag der GRÜNEN zum Gesetzesentwurf: https://www.gruene-adressen.de/docs/EA_BundesarchivG_F9-17.pdf
2) „Geheimdienst-Akten für immer unter Verschluss? Bundestag entscheidet – Chef des Bundesarchivs: „Misstrauensbeweis“, Bild, 18.1.17, mit Interview des Bundesarchivpräsidenten zum Gesetzesentwurf: http://www.bild.de/politik/inland/bnd/akten-fuer-immer-unter-verschluss-49843472.bild.html
Ergebnis der gestrigen Bundestagsberatungen:
Link zum einem Video der Laudatio von Hannelore Kraft, Ministerpräsidentin des Landes NRW, auf Rudolf Biermann, 18.1.2017: https://youtu.be/PHrqgyPhrKI
Pingback: Tagungsband zu den Detmolder Sommergesprächen 2015 erschienen | siwiarchiv.de
Die damalige Entscheidung des Kommunalpolitiker Rudolf Biermann, sich dem öffentlichen Widerspruch gegen die Namensgebung für das Flick-Gymnasium anzuschließen, ist natürlich wertzuschätzen. Sie zog dann nach sich, dass endlich der Weg frei für die kommunalparlementarische Mehrheit zur Löschung eines Namens frei werden konnte, der Kreuztal im weiten Rund zum schlechten Witz der „Vergangenheitsbewältigung“ gemacht hatte.
Wenn Biermann neben anderem auch dafür jetzt geehrt wird, ist das ebenfalls wertzuschätzen. Leider aber geraten in den zahlreichen öffentlichen Verweisen auf die Ehrung die Hauptakteure aus dem Blick. Das war seit 1981 und beginnend mit der Theatergruppe des Ev. Gymnasiums in Weidenau eine große Zahl von Menschen aus der Region jenseits parlamentarischer Aktivitäten. Aus den Kommunalparlamenten war jahrzehntelang nichts gekommen und kam lange auch weiter nichts. Die genannten und andere Schüler, die verschiedenen Bürgerinitiativen, die Verfasser von erklärenden Schriften und öffentlichen Erklärungen, die Organisatoren vieler öffentlicher Veranstaltungen, die Gesellschaft für Christlich-jüdische Zusammenarbeit (und unter all diesen auch das eine oder andere Parteimitglied) mussten in nahezu dreißig Jahren ihrer Aktivität viel Ausdauer, Kraft und Zeit aufbringen, um in der parlamentarischen Szene nach schmerzhaften Niederlagen am Ende eine hinreichende Unterstützung für diese Umbenennung zu bewirken. Auf Geschichte kommt die Laudatorin mit keinem Wort. Sie musste sich ja auch kurz fassen, denn es waren ja weitere gute Taten zur Begründung der Ehrung zu benennen. Leider beschränkte sie sich bei Nennung von Flick auf den Kriegsverbrecher. Dabei hätte es wenig Zeit gekostet, den Nach-NS-Flick, das Symbol für Korruption in Politik und Gesellschaft, mit einzubeziehen. Den damaligen Hauptakteuren war das immer wichtig gewesen. Diese Defizite sind dann schon ein etwas schade.
Da im Zusammenhang mit der verdienten Ehrung von Herrn Biermann
die Umbennenung des Friedrich-Flick-Gymnasium in den Beiträgen hier
so zahlreich Erwähnung findet, sollte nicht vergessen werden, das es immer noch eine öffentliche Ehrung von Friedrich Flick im Siegerland gibt.
In der Gemeinde Burbach gibt es noch immer eine Friedrich-Flick-Straße.
2010 beantragte die damalige Ratsfraktion der Grünen eine Umbenennung.
Diese wurde mit der Mehrheit von CDU und FDP abgelehnt.
Zitat BM Ewers (CDU) aus der Siegener Zeitung vom 30.6.2010:
„…wir haben hier nicht über die moralische Integrität einer Person zu entscheiden“.
Nicht unweit der Friedrich-Flick-Straße befindet sich noch eine Straße die nach einem weiteren Waffenschmied Hitlers benannt ist, die Ernst-Heinkel-Straße.
Beide Straßenenamen gehören endlich entfernt!
Weitere Informationen zum 27.1.2017 in Kreuztal:
Gedenken an drei Orten der Stadt
Am 27. Januar 2017 gedenken die Kreuztaler Bürgerinnen und Bürger an die Opfer des Nazi-Terrors.
Zunächst wird im Gedenken an die Genossen Ernst Schweisfurth und Robert König um 14 Uhr an der Ausbildungswerkstatt von ThyssenKrupp in Eichen eine Gedenktafel enthüllt. Die zwei Männer waren im Eichener Walzwerk im Werkschutz tätig und wurden wegen ihrer Hilfe für Zwangsarbeiter in den Konzentrationslagern Neuengamme und Sachsenhausen ermordet.
Um 15.30 Uhr findet am Fred-Meier-Platz die jährliche Gedenkstunde mit Kranzniederlegung statt. Dieter Pfau wird dort der Hauptredner sein. Die Einaldung des Bürgermeisters finden Sie unten im Downloadbereich.
Um 16.30 Uhr hält Frau Dr. Anne Sudrow in der Kapellenschule Littfeld einen Vortrag zur Schuhprüfstrecke im KZ Sachsenhausen, auf der Ernst Schweisfurth umkam. Frau Sudrow arbeitet am Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam und hat über die Verbindungen der deutschen Schuhindustrie zur SS geforscht.
Die Veranstaltungen finden in Kooperation der Stadt Kreuztal, ThyssenKrupp, der SPD-Stadtverbände Kreuztal und Hilchenbach, der Gesellschaft für christlich jüdische Zusammenarbeit und des VVN-BdA Siegerland-Wittgenstein statt.
Quelle SPD Kreuztal
http://www.spd-kreuztal.de/fr_aktuelles.php?id=161
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 10.1. – 23.1.2017 | siwiarchiv.de
Weitere Informationen zur Biographie Schreys finden hier: http://akteure-und-taeter-im-ns-in-siegen-und-wittgenstein.de/verzeichnis/gesamtverzeichnis-l-z/#schreiber7
Und hier wäre mein Artikel zur Blogparade: https://fam03pf.tumblr.com/post/156365150963/siwiarchiv-blogparade-zum-5-jährigen
Lieber Patrick, vielen Dank für den ersten Beitrag zu unserer Blogparade! Es ist eine sehr charmanate Idee, ein inaktives Blog mit neuem Leben zu füllen. Kooperativ sollte dies gelingen. ;-)
Auch Archivalia verweist auf das „Plädoyer“ Frischmuths: http://archivalia.hypotheses.org/62680
In der Tat, eine schöne Idee, ein inaktives Blog wiederzubeleben – schade, dass es eingeschlafen ist! Ich stimme voll zu, dass einr Wiederbelebung mit dem richtigen Themenmix nichts im Wege stehen dürfte :)
Die Liste ist noch nicht vollständig. Es fehlen zum Beispiel noch die Stolpersteien in Netphen: http://www.siwiarchiv.de/?p=3185
Stimmt! Diese Liste fehlt – noch (?) – in der Wikipedia-Zusammenstellung zu Stolpersteine in NRW.
Im Januar 2017 hat der WDR intensiv zu Straßennamen in NRW recherchiert, u.a. mit folgendem Ergebnis: “ …. Trotz der zahlreichen Diskussionen um die Ehrwürdigkeit Hindenburgs, gibt es allein in NRW heute noch 65 Straßen und Plätze, die seinen Namen tragen. ……“
Eine interaktive Karte mit problematischen Straßennamen verweist für das Kreisgebiet auf die Friedrich-Flick-Str. in Burbach, auf Hermann-Löns-Str. in Erndtebrück, Kreuztal, Netphen, Siegen, und Wilnsdorf, auf den Hindenburgplatz in Neunkirchen, die Hindenburgstr. in Burbach, Hilchenbach und Siegen und auf die Lothar-Irle-Str. in Siegen.
Link zur Quelle: http://www1.wdr.de/wissen/strassennamen-historisch100.html
Pingback: Ausstellungseröffnung „Front und „Heimatfront. Regionale Aspekte des Ersten Weltkriegs“ | siwiarchiv.de
Pingback: Erweiterungen auf siwiarchiv II: Statistik | siwiarchiv.de
Pingback: Hörtipp: Gebrüder-Busch-Gedenkstätte | siwiarchiv.de
Danke für die Transparenz und die ausführlichen Statistiken, die zeigen, dass sich siwiarchiv einen ganz eigenen Leserkreis erschlossen hat! Ein Proargument für die Nutzung von Social Media durch Archive!
vielleicht die Personalakten der Kreisverwaltung?
Sie waren wohl der erste der am Samstag auf siwiarchiv geschaut hat. Selbstverständlich ist die Antwort richtig!
Pingback: 5 Jahre siwiarchiv – Beitrag des Stadtarchivs Greven zur Blogparade | archivamtblog
Der Beitrag des Stadtarchivs Greven zur Blogparade ist soeben unter http://archivamt.hypotheses.org/4648 veröffentlicht worden.
Auch an dieser Stelle: Herzlichen Glückwunsch, siwiarchiv
Es wäre schade, wenn das Stadtarchiv Greven sich aus der Blogwelt zurückziehen würde, insbesondere auch deswegen vielen Dank für die klare Empfehlung an andere Archive!
Ob das Stadtarchiv Greven weiter bloggt, wird sich zeigen. Vielleicht kann das nach einem Stellenwechsel auch nicht die erste Priorität sein. Ich selbst bin aber für das Bloggen weiterhin offen und sicherlich auch tätig.
Warum in die Ferne schweifen … Ein kleiner Bestand „Schmeißer“ liegt auch hier am Ort vor: Stadtarchiv Siegen Best. Sammlungen Nr. 58. Darin „Bericht über Besichtigungsreise der Bergbausachverständigenkommission in das beschädigte Bergbaugebiet Nordfrankreichs, Versailles 26. September 1919“ (mit einem an die Familie gerichteten Zusatz) sowie ms. Nachruf auf Schmeißer (Autor vermtl. Dr. Kruse)
Danke für die Präzisierung!
Ein bisschen Fernweh sei doch erlaubt, wenn man bedenkt, dass Schmeißer offensichtlich Zeitgenosse von Goldräuschen bzw. deren Auswirkungen in Südafrika, Australien und in Amerika war – dort lässt sogar Jack London grüßen ;-). Selbst die Reise nach Spitzbergen scheint eine Reaktion auf die dortige Kohleförderung zu sein ….
Schmeißer nahm als Berghauptmann für die östlichen Provinzen des preussischen Staates an der Besichtigungsreise in das beschädigte Bergbaugebiet Nordfrankreichs teil, die fand vom 23. – 25. September 1919 stattfand; u. a. folgende Orte wurden besucht: Versailles, Arras, Lievin, Lens, Bethune, Carvin, Eisenwerk Mingles, Corrierers, Drocourt, Dourge
Der an die Familie gerichtete Zusatz vom 8.10.1919 enthält neben persönlichen Eindrücken auch einen Hinweis auf eine weitere Tätigkeit Schmeißers während des Ersten Weltkriegs: “ …. Im Spätherbst 1914 musste ich auf Anordnung der Obersten Heeresleitung einen Plan zur Lahmlegung des polnischen und oberschlesischen Steinkohlbergbaus entwerfen für den Fall, dass der Einbruch der heranflutenden russischen Heere erfolgen sollte. ….“
Für weiterführende literarische Recherchen seien an dieser Stelle auch die zahlreichen Publikationen von Karl Schmeißer genannt, die zum Bestand der Wissenschaftlichen Bibliothek zur Regionalgeschichte im Stadtarchiv Siegen gehören und im Lesesaal eingesehen werden können:
„Der Goldbergbau in der südafrikanischen Republik Transvaal und seine Bedeutung für die deutsche Maschinenindustrie“ (vorgetragen in der Sitzung des Berliner Bezirksvereines vom 21. Februar 1894, zugl. Sonderabdruck aus der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure 38, Berlin 1894)
„Reisebeobachtungen in Süd-Afrika“ (Vortrag gehalten von Herrn Berg-Rath Schmeisser am 13. Juli 1894 im Bezirks-Verein des Vereins deutscher Ingenieure zu Siegen, zugl. Separat-Abdruck der Süd-Afrikanischen Wochenschrift 1894)
„Ueber Vorkommen und Gewinnung der nutzbaren Mineralien in der Südafrikanischen Republik (Transvaal) unter besonderer Berücksichtigung des Goldbergbaues.“ Berlin 1895
„Reisebeobachtungen in den Goldländern Australasiens (10. Oktober 1896, Sonderabdruck aus d. Verhandlungen d. Gesellsch. f. Erdkunde zu Berlin Nr. 8/1896)
„Die Goldlagerstätten und der gegenwärtige Stand des Goldbergbaues in Australasien“ (Vortrag, gehalten in der Abteilung Berlin-Charlottenburg der Deutschen Kolonial-Gesellschaft, zugl. Deutsche Kolonial-Gesellschaft, Abt. Berlin-Charlottenburg, Verhandlungen 1896/97, Heft 4, Berlin 1897)
„Geographische, wirtschaftliche und volksgeschichtliche Verhältnisse der südafrikanischen Republik, sowie deren Beziehungen zu England (Vortrag, gehalten in der Abt. Berlin-Charlottenburg der Deutschen Kolonial-Gesellschaft, zugl. Abt. Berlin-Charlottenburg der Deutschen Kolonial-Gesellschaft, Verhandlungen 1900/01, Heft 1, Berlin 1900)
„Die Geschichte der Geologie und des Montanwesens in den 200 Jahren des preussischen Königreichs, sowie die Entwickelung und die ferneren Ziele der Geologischen Landesanstalt und Berg-Akademie) (Separatabdruck aus dem Jahrbuch der königl. preuss. geologischen Landesanstalt für 1901)
„Eine Reise nach Skandinavien und Spitzbergen 1910. Vortrag gehalten am 25. Oktober 1910 von Berghauptmann Schmeßer zu Breslau“ [Breslau 1910]
„Rede des Berghauptmanns Schmeißer gehalten in der Festsitzung des Oberbergamts zu Breslau am 21. Sept. 1911 aus Anlaß der Einweihung des Oberbergamts-Neubaus am Kaiser-Wilhelm-Platz (Breslau 1911)
Danke für die Ergänzungen!
Ist in der Bibliothek des Stadtarchivs auch folgender Aufsatz Schmeißers vorhanden:
„Ueber die Gewinnungs- und Absatzgebiete der wichtigeren nutzbaren mineralischen Bodenschätze Rheinland-Westfalens und Nassau“, in: Archiv für Eisenbahnwesen 11 (1888), S. 442 – 456, 630 – 655? Wenn nicht, so kann er in den Sammlungen der ULB Münster online eingesehen werden.
Ebenfalls für die Region relevant – und bevor Kollege Kunzmann zuschlägt – ist folgende Veröffentlichung Schmeißers:
„Über das Unterdevon des Siegerlandes und die darin aufsetzenden Gänge, unter Berücksichtigung der Gebirgsbildung und der genetischen Verhältnisse der Gänge“, in: Jahrbuch d. Preuß. Geolog. Landesanst. 1882, Berlin 1883, S. 48 – 148.
Wenn ich es richtig sehe, fehlt bei den Publikationen Schmeißers auch das von ihm herausgegebene Buch „Oberschlesien und der Genfer Schiedsspruch“, Berlin 1925, das am Osteuropa-Institut in Breslau entstand.
Besten Dank für die Info!
Leider sind bis auf die genannten bibliografischen Nachweise keine weiteren Veröffentlichungen aus der Feder Schmeißers in den Beständen des Stadtarchivs nebst angeschlossener Bibliothek zu ermitteln gewesen.
Kollege Kunzmann wird hier nicht mehr „
zuzuschlagen“, wenn die gelegentlichen bibliographischen Anmerkungen vom Kollegen Wolf so empfunden worden sind. Schon John Rambo mußte einsehen: „Ich bin entbehrlich.“Entschuldigung für den Tippfehler.
1) Tippfehler sind im Blog immer verzeihlich.
2) Zuschlagen habe ich durchaus nicht negativ empfunden. Ihnen stehen ja durchaus größere bibliographische Möglichkeiten zur Verfügung als dem Kreisarchiv, so dass ich sogar gehofft hatte, dass Sie „zuschlagen“. Entschuldigen Sie, dass die saloppe Äußerung missverständlich war.
3) Generell betrachte ich alle sachlichen Ergänzungen zu diesem Eintrag als Erkenntnisgewinn. Im Rahmen eines einwöchigen Praktikums einer Schülerin der 9. Klasse war nicht mehr möglich als dieser Eintrag, der die schnell greifbaren und auffinbaren biographischen Quellen zusemmenstellen sollte.
Zudem handelte sich insgesamt um ein Zufallsprodukt. Denn im Blog der Berliner Archive wurde auf den Catalogus professorum der TU Berlin hingewiesen. Ein Test in der einfachen Suche mit dem Wort „Siegen“ ergab drei Treffer, die aber noch nicht online eingesehen werden konnten. Die Suche über die Option „Karte“ führte zu Karl Schmeißer [off topic: – ein Problem, das m.E. geändert werden sollte. Klaus Graf weist auf Archivalia auch auf die fehlenden Quellennachweise bei den einzelnen Einträgen hin. Vielleicht kann man da ja etwas ändern].
Bei der Reise nach Skandinavien und Spitzbergen handelt es sich um eine Exkursion des Internationalen Geologenkongresses, der 1910 in Stockholm stattfand. Die erwähnte Publikation ist ein Sonderdruck aus der Schlesischen Zeitung.
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 24.1. – 7.2.2017 | siwiarchiv.de
Die Staatsarbeit ist nun in der Bibliothek des Kreisarchivs einsehbar.
Aus Heinz Fischer (Bearb.): Schülerverzeichnisse von 1580 – 1936, S. 68, beigebunden in: Hans Kruse: Geschichte des höhern Schulwesens in Siegen. Festschrift zum 400jährigen Jubiläum des Realgymnasiums in Siegen. Siegen 1936, geht hervor, daß Schmeißer evangelisch war und sein Abitur an Ostern 1875 abgelegt hat. Ferner scheint er mit dem Gedanken gespielt zu haben, den Beruf des Vaters anzunehmen und Medizin zu studieren.
Interessenten an noch mehr Karriere-Details sollten dann nicht versäumen, Das „Abiturienten-Zeugniss der Reife für den Zögling der Realschule I. Ordnung zu Siegen Carl Schmeißer“ im Stadtarchiv Siegen einzusehen (Best. Schulen Nr.65 / 245).
Die gesamte Familie Schmeißer in der Löhrstraße 441 samt Eltern 2 Schwestern, 3 Brüdern, drei als „Schüler“ bezeichneten Mitbewohnern (offensichtlich „Kostgänger“), einem Knecht und zwei Mägden findet sich natürlich in der „Liste sämtlicher Civil-Einwohner im Magistrats-Bezirks Siegen“ (Stadtarchiv Siegen, Best. Stadt Siegen C, Nr. 417).
Ernst Schmeißer als Bruder von Karl ist bekannt und findet sich in Irle, Lothar: Siegerländer Persönlichkeiten und ihre Geschlechter–Lexikon, Siegen 1974, S.292-293 . Heißt der andere Bruder zufälligerweise Heinrich? Denn dann könnte es sich um Heinrich Schmeßer handeln, der an der Berliner Bauakademie von 1872 bis 1875 studierte und die Akademie am 3.7.1875 verlies. Diese Information verdanke ich der o.e. erwähnten Antwort des Archivs der TU Berlin (Sig.: 111-1, Matrikel der Studenten und Gasthörer, Band I Bauakademie 1868 – 1875, S. 83).
Im Nachgang zum Eintrag und den bisherigen Kommentaren recherchiert das Kreisarchiv nach Matrikelunterlagen Schmeißers bei den in Frage kommenden Universitätsarchiven (s.o.). Gestern bereits traf die Antwort des Archivs der TU Berlin ein: Leider lisind die Matrikelunterlagen der Berliner Bergakademie nicht dort nicht erhalten. Allerdings wurde auf folgende s verwiesen:
„- aus der Hochschulgeschichtlichen Sammlung eine Akteneinheit zur Königlichen Bergakademie mit einem Auszug aus dem Berichte Schmeisser´s zur Zusammenarbeit der Geologischen Landesanstalt und der Bergakademie und Stellungnahme gegen die Eingliederung der Bergakademie in die Technische Hochschule Berlin vom 14. Dezember 1905 (Sign. 709 -136)
– und eine Kurzbiographie in: Hugo Strunz, Von der Bergakademie zur Technischen Universität Berlin, 1770 bis 1970, hrsggb. von Förderer der Berliner Fakultät für Bergbau und Hüttenwesen e. V., 1970 (Sign. 813 -37).“
Auch das Universitätsarchiv Bonn hat bereits gestern die Anfrage beantwortet (Az.: 521-0121/17):
Im Immatrikulationsalbum der Universität Bonn findet sich die Eintragung Karl Schmeißers am 26.April 1874 (Signatur: Univ. Bonn Archiv AB-08 Immatrikulationsbuch 1872-1880).
Außerdem geht aus dem Studentenverzeichnis hervor, dass er vom genannten Immatrikulationsdatum bis zum 30.September 1874 an der Universität im Fach Naturwissenschaften eingeschrieben war (Signatur: Univ. Bonn Archiv/Bb/PVSV – SS1876-SS1878).
Hoppala, wie geht denn das? Sein Reifezeugnis wurde erst am 24.03.1875 ausgestellt.
Danke! Bin ebenfalls ein wenig irritiert gewesen und hätte vorsichtig via E-.Mail prüfen lassen, ob mich mich bei Kruse nicht verlesen habe. Im Nachruf Kruses auf Schmeißer (Siegerland, Bd 8 (1926). S.21) findet sich allerdings als Abitur-Datum Ostern 1874 ……
Die Überprüfung im Bonner Universitätsarchiv hat den 26. April 1876 als Immatrikulationsdatum ergeben. Danke für die Klärung nach Bonn!
In den Immatrikulationsunterlagen der Bergakademie Clausthal findet sich kein Hinweis auf Karl Schmeißer (Email: Archiv der TU Clausthal, 11.2.2017).
Aus der Anwesensheitsliste des Deutschen Kolonialkongresses 1910 geht hervor, dass Karl Schmeißer verheiratet war.
https://paperspast.natlib.govt.nz/newspapers/DTN18960604.2.6
Danke für den Fund zur Australien-Reise Schmeißers!
Weitere Presseberichte aus Neuseeland finden sich, wenn man „Schmeisser“ in die Suchmaske der genannten Seite eingibt: https://paperspast.natlib.govt.nz/newspapers?query=Schmeisser
Einige australische Presseberichte zu „Karl“ + „Schmeisser“ finden sich hier: http://trove.nla.gov.au/newspaper/result?q=karl+schmeisser
Weitaus mehr Treffer bietet die bloße Suche nach „Schmeißer“: http://trove.nla.gov.au/newspaper/result?q=Schmeisser&sortby=
Pingback: Vereinsarchiv des Heimatvereins Elsoff | siwiarchiv.de
Pingback: Vor 150 Jahren: Wahl zum Reichstag des Norddeutschen Bundes | siwiarchiv.de
In der Haupt- und Finanzausschusssitzung der Gemeinde Neunkirchen vom 26. Januar 2017 wurde unter dem TOP 2 „Haushalt 2017″ auch über das Gemeindearchiv gesprochen: “ …. Es wird von mehreren Seiten des Ausschusses das Thema Archiv angesprochen. Hier zeige man sich froh, dass nun endlich mit den Planungen zur Umsetzung begonnen werde. Über die entsprechenden Haushaltsmittel werde man dann im kommenden Haushalt 2018 beraten. ….“
Quelle: Sitzungsniederschrift v. 8.2.2017, S. 3, Link: https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz080/sdnetrim/Lh0LgvGcu9To9Sm0Nl.HayIYu8Tq8Sj1Kg1HauCWqBZo5Ok7KiyIhuGWt9Vs4Ql0Oe-GczCXuCWn4Oi0Lg-IbvDauHTp8To1Ok0HbwHau8Vt6Pi6Km0GJ/Oeffentliche_Niederschrift_Haupt-_und_Finanzausschuss_26.01.2017.pdf
Es scheint, als habe siwiarchiv eine Fehlmeldung ungeprüft weitergeleitet. Die Schrift „Dimensionen der Verstrickung“ ist keine Dissertation, sondern eine Auftragsarbeit, die Anfang des Jahres zur 200-Jahr-Feier der Bezirksregierung Arnsberg erschien. Wer möchte, kann sie (für 10,- Euro Schutzgebühr) beim Autor und bei der Pressestelle der Bezirksregierung bestellen oder im CAB-Bücherstudio und in der Buchhandlung Sonja Vieth in Arnsberg erwerben.
Die „Fehl“information stammt von der Homepage der Bezirksregierung Arnsberg – s. Link am Ende des Eintrages – und wurde tatsächlich ungeprüft übernommen.
Zum Hintergrund der Studie findet sich auf S. 4 folgendes: “ …. Im Rahmen eines 3-jährigen Forschungsprojektes in Kooperation mit der Universität Münster, dem Staatsarchiv NRW (Abteilung Westfalen) sowie der Arnsberger Bezirksregierung, …..“
Pingback: Richard Steuber (1887 – 1964) – und wer ist noch zu erkennen? | siwiarchiv.de
Zu Steuber: Ein Blick in die Adressbücher aus den Jahren vor und nach dem Ersten Weltkrieg lohnt.
Quasi als Beleg hier ein Blick in das entsprechende Buch für das Jahr 1925:
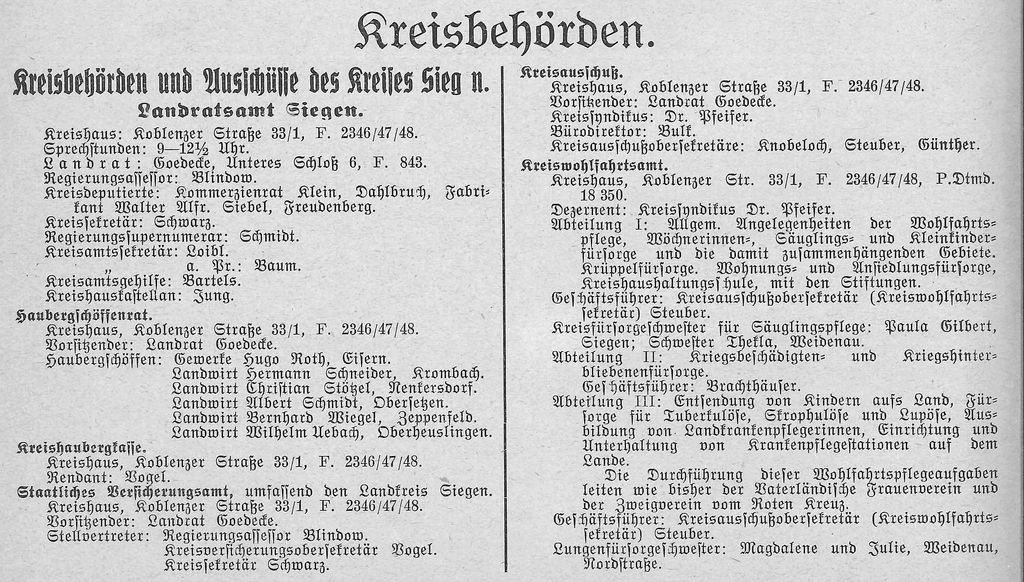
Spekulativ: Vielleicht zeigt das Bild den Vorsitzenden des Kreisausschusses (Landrat Bourwieg) ihm Kreise seiner Mitarbeiter: Bulk, Kerbelech, Steuber und Groos.
Meinen Sie vielleicht Walter Groos? Link: http://akteureundtaeterimnsinsiegenundwittgenstein.blogsport.de/a-bis-z/gesamtverzeichnis/#groos3
Bei Bulk könnte es sich um Karl Bulk (*9.1.1865) handeln, der beim Kreis vom 10.2.1888 bis zum 31.3.1930, zuletzt als Kreisausschusssekretär, beschäftigt war. Dies würde den Aufnahmezeitpunkt des Bildes zwischen 1923 (Groos) und 1930 eingrenzen.
Eine Personalakte der dann noch fehlenden Mitarbeiterin Kerbelech konnte nicht ermittelt werden.
Offenbar kommt nicht alles an, was abgeschickt wird.
Also noch einmal mein erster Kommentar, der sich unmittelbar auf Steuber bezog. Es lohnt ein Blick in die Adressbücher aus den Jahren vor und nach dem Ersten Weltkrieg. Dort wird Steuber mehrfach in seinen Funktionen erwähnt.
Korrektur zum Kommentar von 7:33: ihm = im
Lieber Herr Plaum,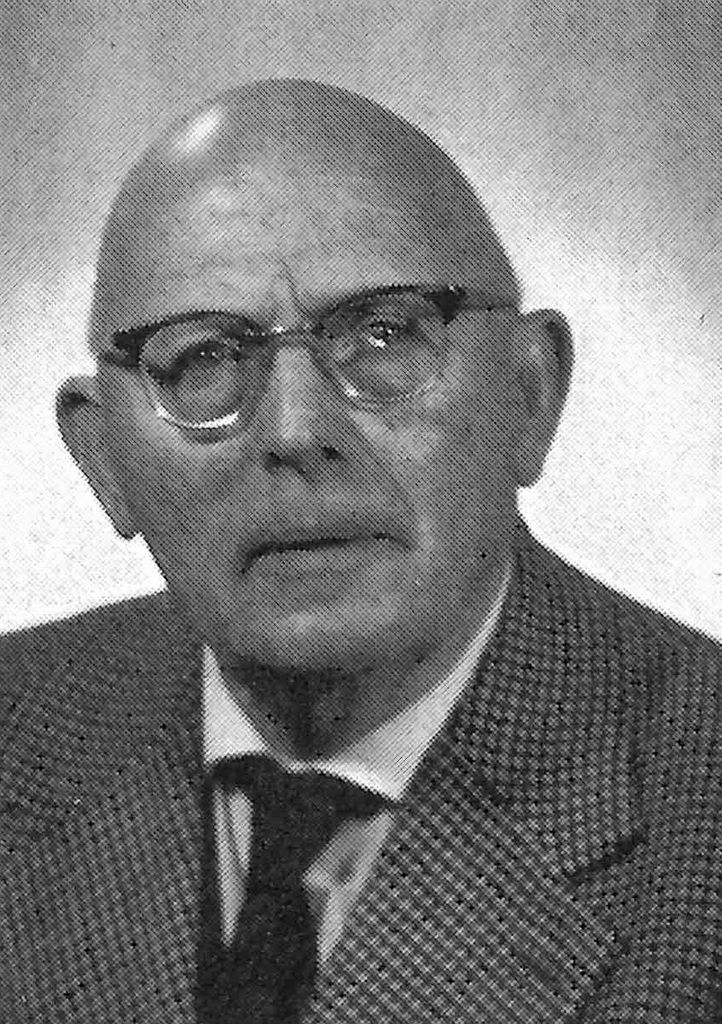
da sind Sie im Spam-Filter hängengeblieben. Entschuldigen Sie die etwas späte Freischaltung. Nicht nur ein Blick in die Adressbücher lohnt sich, auch ein Blick in die im Kreisarchiv vorhandene Personalakte (2.14.1./103).
Um die Bildindentifikation zu erleichtern, füge ich ein Bild Steubers aus dem Siegerländer Heimatkalender von 1965 bei:
Pingback: Richard Steuber (1887 – 1964) – und wer ist noch zu erkennen? | siwiarchiv.de
Pingback: Online-Erschließung der Juden- und Dissidentenregister (JuWel) in Westfalen und Lippe | siwiarchiv.de
Pingback: 1968: Revolution in den Schulen!? | siwiarchiv.de
s. hierzu Hendrik Schulz´Bericht in der Westfalenpost v. 17.2.2017: http://www.wp.de/staedte/siegerland/wie-der-zweite-weltkrieg-bis-in-heutige-generationen-wirkt-id209645163.html
Zur Vorstellung des Projekts schreibt die Siegener Zeitung am 16.2.2017: “ ….. Das belebte Dorfarchiv in Elsoff stellte Georg Braun vor, dies soll ja in einem Nebengebäude der Michel-Mühle eingerichtet werden. Wie der gesamte alte Dorfkern steckt auch dieses Gebäude, um das Jahr 1770 herum errichtet, voll mit Geschichte, erläuterte Georg Braun. Hier sollen Originaldokumente über das Dorf ein festes Zuhause finden. Das Dorfarchiv könnte ebenso über LEADER gefördert werden. …..“ Link: http://www.siegener-zeitung.de/siegener-zeitung/Erstes-Projekt-kann-bereits-loslegen-4c49599f-c778-4843-af18-b76cc539ec2c-ds
Die Karten hat Guido Schneider für seinen Beitrag „Untergegangene Siedlungen in Wittgenstein“, in: Wittgenstein Bd. 61/1997/H. 2/S. 42-43, erstellt hat. Frdl. Hinweis von Guido Schneider in der geschlossenen Facebook-Gruppe „Wittgensteiner Heimatgeschicgte und Historische Fakten“, Link: https://www.facebook.com/groups/827252654052187/ .
Pingback: Einer von vielen – und doch ganz speziell | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 7.2. – 20.2.2017 | siwiarchiv.de
Drei Bemerkungen zum Online-Artikel auf der Website http://www.stadtarchiv-siegen.de:
1) Die Hintergrundinfomationen zum Format gleich in der Einleitung hemmen den Lesefluss. Ich würde sie in eine separate Infobox verschieben
2) Die paralell statfindende Vitrinen-Präsentation im Lesesaal halte ich für eine sehr schöne Idee.
3) Warum findet sich der „detaillierte Bericht“ mit sämtlichen Bildern versteckt in einem PDF-Format und nicht gleich im Online-Artikel?
Zur Siedlungs- und Wüstungsgeschichte Wittgensteins weist die hier bereits, mehrfach vorgestellte Bibliographie des Wittgensteiner Heimatvereins auf folgende Literatur hin:
Bauer, Eberhard: Von untergegangenen Siedlungen im Berleburger Raum. Ein Bericht über die Dissertation von Klaus Deppe: „Methoden und Ergebnisse siedlungsgeografischer Forschungen im Wittgensteiner Land. Dargestellt an vier Wüstungen. Münster 1968, Wittgenstein. Blätter des Wittgensteiner Heimatvereins e. V. Bd. 33/1969/H. 2/S. 63-66
Benkert, Wilhelm: Wirtschaftsgeographische Verhältnisse, Volksdichte und Siedlungskunde der Ederkopf-Winterberg Plattform, Dissertation Marburg 1911, 89 Seiten
Bergmann, Rudolf: Die Wüstung Volpershusen bei Banfe, Heimatbuch Banfetal, S. 49-53
Böttger, Hermann: Grundfragen der frühen Besiedlung Wittgensteins und des Siegerlandes, in: Westfälische Forschungen, Band 8, Münster 1955, Seiten 198-205
Deppe, Klaus: Wüstungen der Gemarkung Berghausen, 800 Jahre Berghausen, Rückblick und Erinnerung 1973, S. 55-69
Deppe, Klaus: Die Wüstungen Schwarzenau und Dambach (Betr. Girkhausen) 750 Jahre Girkhausen 1970, S. 76-91
Dohle, Wilhelm: Von untergegangenen Orten (Wüstungen) im Raum der ehemals Mainzer Vogtei Elsoff, Wittgenstein. Blätter des Wittgensteiner Heimatvereins e. V. Bd. 23/1959/H. 3/S. 137-141
Dohle, Wilhelm: Von untergegangenen Wittgensteiner Siedlungen, Wittgensteiner Heimatbuch I 1965, S. 184-195
Hartnack, Wilhelm: Orts-Wüstungen Wittgensteins, Wittgenstein. Blätter des Wittgensteiner Heimatvereins e. V. Bd. 23/1959/H. 1/S. 13-28
Hinsberg, Georg: Raubritter, Wüstungen und Stadtmauern, Wittgensteiner Heimatbuch 1938/S. 34-38
Homrighausen, Klaus: Vom Wüstfallen bis zur Neubesiedlung Diedenshausens, Dorfbuch Diedenhausen 1997, S. 67-82
Homrighausen, Klaus: Die Neubesiedlung Wunderthausens nach 1500, Wunderthausen. Mehr als 700 Jahre bewegte Geschichte, 2006,, S. 26-43
Kätelhön(auch „Kaetelhoen“), Ernst: Zur Siedlungskunde des oberen Lahngebiets, Dissertation Marburg 1907, 82 Seiten
Laumann, Hartmut: Älteste Besiedlungsgeschichte Wittgensteins, Dorflesebuch 525 Jahre Birkelbach 1475-2000 S. 63-70
Pez, Hans: Die Wüstung Dornhof, Wittgensteiner Heimatbuch 1938 S. 66-69 (vgl. Saßmannshausen)
Radenbach, Hans Werner: Abriss der Siedlungsgeschichte des oberen Edertals, Wittgenstein. Blätter des Wittgensteiner Heimatvereins e. V. Bd. 57/1993/H. 2/S. 76-77
Thielicke, Eduard: Die Besiedlung Wittgensteins, Mitteilungen des Vereins für Geschichte und Volkskunde Wittgensteins. Jg. 3/H. 1/S. 1-9
Vitt, Fritz: Aus der Siedlungsgeschichte Wittgensteins, Wittgensteiner Heimatbuch 1938 S. 19-23
Weitzel, Edith: Vor genau 500 Jahren gründeten mehrere Bürger aus Offdilln, Roßbach, Weidelbach und Ewersbach das Dorf Birkelbach bei Erndtebrück: Wiederbesiedlung einer Wüstung im Wittgensteiner Land, In: Heimat an Lahn und Dill, Bd. 333 (1997), S. 1, Ill., Zugl. „Hinterländer Anzeiger“ 158 (1997) Nr. 63 vom 15.3.1997, S. 29
Wied, Werner: Beiträge zur Gründung und früheren Geschichte der wittgensteinischen Siedlungen auf dem Rothaarkamm, Wittgenstein. Blätter des Wittgensteiner Heimatvereins e. V. Bd. 57/1993/H. 1/S. 2-16
Wied, Werner: Wüstungszeit-Niedergang-Neubesiedlung, Erndtebrück – ein Heimatbuch des oberen Edertals I, 1977/S. 135-145
Ich ergänze dann noch 3.:
http://akteureundtaeterimnsinsiegenundwittgenstein.blogsport.de/
Lieber Herr Räth,
vielen Dank für Ihr Feedback und Ihre konstruktiven Anregungen! Gerne greifen wir diese gegebenenfalls bei der Erarbeitung und Gestaltung zukünftiger Onlinetexte auf, müssen jedoch zu bedenken geben, dass wir als Dienststelle der städtischen Verwaltung an die redaktionellen Rahmenbedingungen der Öffentlichkeitsarbeit gebunden sind. Warum wir im Übrigen auch aus einem anderen Grund auf das PDF-Format zurückgreifen, erklärt sich durch die positive Resonanz vieler virtueller Archivgäste, die es offenbar schätzen, parallel Ausdrucke unserer „Klicks in die Vergangenheit“ für den privaten Gebrauch zu erstellen.
Mit besten Grüßen aus dem Stadtarchiv Siegen,
Christian Brachthäuser
„Das Aktive Gedenkbuch für die Opfer des Nationalsozialismus im Kreis Siegen-Wittgenstein führt auch die im Kreisgebiete bis 1945 ermordeten bzw. verstorbenen Zwangsarbeiter auf.“:
leider nur einen Teil, viele fehlen noch. Die Arbeiten mussten unterbrochen werden.
Ulrich F. Opfermann
Das Staatsarchiv in Wroclaw informiert mit Schreiben vom 13.02.2017 (Az:
OII.6344.117.2017), dass im Bestand „Höheres Bergamt in Wrocław (Oberbergamt zu Breslau)“ keine Informationen zu Karl Schmeisser gefunden wurden.
Lieber Herr Brachthäuser, die Idee zur historischen Aufarbeitung des Siegener Geschäftsleben finde ich sehr gut. Es wäre schön, wenn noch eine Dokumentation ehemaliger Siegener Verlage und Buchhandlungen folgen würde.
Mit besten Grüßen,
Matthias Dickel
Hallo Herr Dickel,
eine sehr gute Idee, besten Dank für den Hinweis und Ihre freundliche Rückmeldung! Im Idealfall sollten solche Dokumentationen natürlich mit Primärquellen und Fotografien aus den Beständen des Stadtarchivs Siegen belegbar sein. Mal schauen, ob und was die Sammlungsbestände zu dem Thema hergeben…
Viele Grüße,
Christian Brachthäuser
Jens Bemme wünscht sich als Beitrag zur #siwiarchiv5 – wohl vor allem – von den regionalarchivischen Weblogs ein Blogparade zur Radfahrgeschichte: http://jensbemme.de/2017/01/meine-forschungsfragen/ . Vielen Dank für diese Idee!
Das historische Radfahrerwissen der regionalen Radfahrerbünde und lokalen Radfahrvereine vor 1933 bietet jede Menge Stoff für die Heimatforschung, Technik- und Mobilitätsgeschichte. Wie hießen all die Radfahrervereine, wie kooperierten sie vor Ort oder gab es vor allem Konkurrenz? Wer war wann dort Mitglied? Wann begannen wo auch die Frauen Rad zu fahren? Wie hießen die Publikationen und Protagonisten der Szene vor Ort und in den Ländern?
Eine Übersicht aller historischen Radfahrvereine ist eine Herausforderung für das Jubiläumsjahr 2017 #200JahreFahrrad: http://jensbemme.de/2017/02/wetten-das-es-uns-2017-gelingt-alle-alten-radfahrvereine-zu-sammeln/.
Insofern: Ich wünsche uns jede Menge Open Access für das alte Radrahrerwissen – in der Wikipedia, in Digitalen Sammlungen und in Artikeln.
Das also war mein Großvater ???
Ich fürchte ja.
s. zu Dr. Robert Krämer auch den Eintrag im Regionalen Personenlexikon zum Nationalsozialismus in den Altkreisen Siegen und Wittgenstein: http://akteureundtaeterimnsinsiegenundwittgenstein.blogsport.de/a-bis-z/gesamtverzeichnis/#kraemer4
Ich danke !!! Könnt ihr eigentlich auch Bilder gebrauchen ??? habe noch eine ganze Menge.
Ja gerne! Ich melde mich am Mittwoch via E-Mail bei Ihnen.
Thomas Wolf
Kreisarchiv Siegen-Wittegenstein
Hu, ich hab’s noch geschafft, meine Gedanken zu einem niedersächsischen Archivblog niederzucshreiben: http://blog.wobintosh.de/post/20170227_blogparade-siwiarchiv/
Pingback: #siwiarchiv5 | Archivalia
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik Februar 2017 | siwiarchiv.de
Pingback: Stadtarchiv Siegen seit 10 Jahren im KrönchenCenter | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 21.2. – 6.3.2017 | siwiarchiv.de
Pingback: Gemeinsames Hören: „Jenseits der Zentren. Radio in Wittgenstein und im Hinterland“ in Bad Laasphe | siwiarchiv.de
Pingback: Auftaktveranstaltung „Bergwerksrealität und Phantasien aus der Welt unter Tage“ | siwiarchiv.de
Der heutige Dia-Vortrag „Siegen wie es früher einmal war“ und auch die Wiederholungstermine am 17. und 24. März 2017 sind ausverkauft.
Zu Fritz Melchior s. Eintrag im Regionalen Personenlexikon zum Nationalsozialismus in den Altkreisen Siegen und Wittgenstein: http://akteureundtaeterimnsinsiegenundwittgenstein.blogsport.de/a-bis-z/gesamtverzeichnis/#melchior
Pingback: Vortrag „200 Jahre Altkreis Siegen“ | siwiarchiv.de
Wieso 110 Jahre?
Ich würde jetzt gerne schreiben, dass ich die Aufmerksamkeit der siwiarchiv-Lesenden auf die Probe stellen wollte. ;-) Danke für den Hinweis!
Pingback: Warum bloggen wir und bewerben damit ein Portal, das es noch gar nicht gibt? | Weimar – Wege zur Demokratie
Wie das so ist mit Geburtstagen: Sie stehen im Kalender und dann vergisst man doch, pünktlich zu gratulieren! Hier ein leider verspäteter Beitrag des Bundesarchivs: https://blogweimar.hypotheses.org/283
In die Diskussion um das Verkehrskonzept für das Gelände um das Neunkirchener Rathaus floßen laut Siegener Zeitung vom 18.3.2017 auch Überlegungen zur Unterbringung des Gemeindearchivs ein: “ …. Eine damit verbundene Idee sei beispielsweise, das Bürgerbüro zurück in das Rathaus zu holen und auch für die Bibliothek neue Räumlichkeiten zu finden, vielleicht im Gebäude Kölner Straße 166. Dort könnte auch das Gemeindearchiv eine Heimat finden. …..“
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 7.3. – 20.3.2017 | siwiarchiv.de
Pingback: Ausstellung: „genius loci – 2 Siegener im Zarenland“ | siwiarchiv.de
Pingback: Ausstellung „200 Jahre Todestag von Johann Heinrich Jung-Stilling (1740 bis 1817)“ | siwiarchiv.de
Gerne komme ich der Bitte nach, in einem Blog-Kommentar an meine „Begegnung“ mit Jung-Stilling“ zu erinnern, die ich in meiner alten Wahlheimat Hückeswagen im Bergischen Land hatte. Da er etwas umfangreicher geworden ist, habe ich ihn auf meine Homepage gestellt. Hier der Link dazu.
http://norbert-bangert.de/?p=44
Betr.: Suche nach bedeutender Persönlichkeit.
Eine weit über Deutschland bedeutsame Persönlichkeit war und ist auch heute noch in Bezug auf die demokratische Gesellschaftsform der
Jurist (Naturrechtler, Volkssouverenität), Theologe, Staatsphilosoph und Politikwissenschaftler
Johannes Althusius (1567 – 1638), geb. in Diedenshausen, Grafschaft Wittgenstein
Stimmt! Da gebe ich Ihnen recht, dass Johannes Althusius fehlt.
Mit Blick auf das 200jährige Kreisjubiläum habe ich Persönlichkeiten für die Aktion „20 Beste“ bevorzugt, deren Biographie in diesem Zeitraum begann bzw. endete. Es gibt, wie Sie sicher bemerkt haben, nur 2 Ausnahmen: Peter Paul Rubens, um ihn kommt man nicht herum, und Johannes Bonemilch, quasi meine Referenz an das Lutherjahr. Zudem hatte ich den Ehrgeiz alle Kommunen im Kreisgiet zu berücksichtigen. Auch galt es, wenn möglich, Frauen zu berücksichtigen.
Lieber Herr Wecker, Sie haben übrigens den 2.000 Kommentar auf siwiarchiv verfasst. Vielen herzlichen Dank dafür!
Pingback: Vortrag: „Wie die Reformation in das Siegerland kam“ | siwiarchiv.de
Ernst Wecker weist auf den fehlenden Johannes Althusius hin: http://www.siwiarchiv.de/?p=13150#comment-54201
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik März 2017 | siwiarchiv.de
Pingback: Eröffnung der Abteilung Stadtgeschichte „Vom Mittelalter bis heute – 790 Jahre Stadt Siegen“ | siwiarchiv.de
Pingback: Vortrag „Ruhr-Sieg-Strecke in den 60er Jahren“ | siwiarchiv.de
Pingback: Radiobeitrag zur Wittgensteiner Radiogeschichte für Publikumspreis nominiert | siwiarchiv.de
s. a. Siegener Zeitung v. 31.3.2017 zur Ausstellungseröffnung: http://www.siegener-zeitung.de/siegener-zeitung/Erstaunlich-viele-Gemeinsamkeiten-432aae6c-4fde-4ad7-a2b4-6456e29a7140-ds
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 21.3. – 3.4.2017 | siwiarchiv.de
Pingback: Hans Sandkuhl, Landrat des Kreises Wittgenstein (1946 – 1948) | siwiarchiv.de
Pingback: Brückenerneuerung zur Ginsburg | siwiarchiv.de
In der geschlossenen Facebook-Gruppe „Siegerland in alten und neuen Bilder“ schreibt Günter Dick dazu: „Ich glaube,daß ich die Frage nach dem Standort mit Hilfe von „Google-Earth“ beantworten konnte. Habe heute Frau Siewert informiert. Es ist die Hagener Str. mit Blick nach Süd kurz hinter Krombach in Richtung Eichen. Die rechte Werkhalle existiert nicht mehr, ist Parkplatz . Die linken Werkhallen sind heute das große Logistikcenter der Krombacher Brauerei. Die mäanderförmige Verlauf der Littfe am linken Bildrand kann man auch heute noch beim „google-Foto“ gut erkennen und mit Brücke und Zufahrtsweg schräg zur B 517 nachvollziehen. Geklärt werden sollte m.E. einmal was aus dem am unteren Bildrand noch sichtbaren Doppelgiebel-Fachwerkhaus, das offenbar links neben der heutigen Krombachhalle stand, geworden ist. ….“ Mit freundlicher Erlaubnis von Günter Dick! Vielen Dank dafür!
Die schnelle Einordnung des Fotos hat mich überrascht und gefreut. Aber: Bei näherer Betrachtung des Fotos mit den Hinweisen von Herrn Dick kann ich seiner Meinung nicht folgen. Folgende Gründe sprechen dagegen:
1. Wenn es sich um die von Herrn Dick vermutete Ansicht handeln würde, wäre in der Bildmitte links der Hauptstraße die Krombacher Mühle mit entsprechenden Anlagen wie Gräben und Mühlenteich zu sehen. Das ist nicht der Fall. Die Mühle wurde 1982 abgerissen.
2. Ebenso verhält es sich mit dem Industrie-/Bürogebäude rechts: Dick vermutet es an dem Standort des heutigen Parkplatzes gegenüber der Brauerei. Dies war aber bis in die 1980er Jahre der Standort des Gasthauses Krombacher Hof. Ein Industriegebäude stand dort nicht.
3. Für den vermuteten Blick von Krombach nach Eichen fehlt mir die Bebauung von Eichen im Hintergrund. Wenn die Aufnahme tatsächlich aus den 50er/60er Jahren stammen sollte, müssten auf der rechten Seite der Hauptstraße schon einzelne Gebäude gestanden haben.
4. Insgesamt erscheint mir das Tal zu breit und flach für das Littfetal.
Leider habe ich momentan auch keinen Vorschlag für eine Alternative. Blick von Krombach Richtung Eichen ist def. nicht richtig.
Ich habe ja geschrieben, daß ich glaube es gefunden zu haben. Glaube ist aber nicht Wissen ! Es ist ja erfreulich, daß es noch weitere Intressenten gibt, die sich um Aufkärung der Suchanfrage bemühen. Die Einwände von Herrn Panthöver sind nachvollziehbar, aber könnte es evtl. nicht sein, daß der Standort der Industriehalle (Pfeil) etwas weiter südlich gewesen ist. Dort verläuft auch etwas diagonal im Bild der Weg von Stendenbach bis auf die B 517. Die Brücke über den Bach (Littfe) und der topographische Verlauf des Baches könnten mit dem alten Foto doch eigentlich übereinstimmen. Wenn das aber ebenfalls verworfen wird, kann wohl etwas mit dem Vermerk -Littfeld- auf dem alten Firmengelände-Foto nicht stimmen.
Sehr geehrter Herr Dick, der Platz, den Sie nun mit dem Pfeil markiert haben, war der Standort der Krombacher Mühle. Auf dem Foto ist kein Mühlengebäude, kein Teich u.ä. zu sehen. Außerdem fehlt auf der rechten Straßenseite weiterhin jegliche Bebauung, die dort mit wenigstens einzelnen Häusern hätte vorhanden sein müssen.
Ich glaube, wir sollten uns gedanklich einmal in die weniger industrialisierten Täler des südlichen Siegerlandes begeben. Und: Es kann auch sein, dass das Bild Seitenverkehr wiedergegeben ist. Müsste man einmal spiegeln.
@ Herr Wolf: Wie kann ich hier Abbildungen einbinden? Ich wollte einen Kartenausschnitt hochladen.
Vielen Dank für die Hinweise und Gedanken zu dem Foto. Nach unseren bisherigen Recherchen und Rücksprachen mit Ortskundigen handelt es sich hier wohl gar nicht um Kreuztal.
Möglich ist, dass das Bild versehentlich in das Konvolut der Luftbilder beim damaligen Ankauf gelangt ist und einen ganz anderen Ort im Siegerland zeigt.
Das Bild habe ich mir jetzt mehrmals angesehen. Was mich wundert, ist dass ganz am rechten unteren Rand ein Berg(?), der sehr steil zu sein scheint, sichtbar ist.
Der ganze Rest des Geländes ist flach. Im Siegerland ist mir nicht eine einzige Stelle bekannt, an der man so weit ins Flachland schauen kann.
Ich vermute, dass es weder Kreuztal noch Krombach ist. Sogar irgendein anderer Ort im Siegerland ist meiner Ansicht nach mehr als nur fraglich.
Werte Frau Degenhardt, das ist kein steiler Berg, sondern da zweigt schräg nach rechts ein Weg mit Baumbestand ab. Das wird deutlicher, wenn man das Foto mit einem PC-Bildbearbeitungsprogramm entsprechend aufhellt. Selbst wenn es nun nicht die richtige Stelle sein sollte, die ich versuchte mit „Google-Earth“ zu finden , so sind die topographischen Gegegebenheiten an diesem Ort ( Wegekreuzung + Brücke und Bachverlauf ) zumindest sehr ähnlich. Über ältere Katasterpläne könnte sich ja hier das Kreuztaler Stadtarchiv rel. einfach Klarheit verschaffen, wenn man dort noch nicht mit einer ablehnenden Beurteilung ganz sicher sein sollte.
Werter Herr Panthöfer, wenn Sie das alte Foto vergrößern, sehen Sie hinter der Werkhalle noch vor dem Abzweig nach Stendenbach, mehrere alte Gebäude die durchaus die Mühle gewesen sein könnten. Aber ich vermisse eben auch hier einen Bachzulauf oder Teich, denn ohne Wasser lief da früher wohl nichts. Vielleicht war aber diese Wasserzufuhr um ca. 1958 (angen. Aufnahmedatum, – da in dem Jahr weitere Luftbilder von Gewerbeanlagen, vor allem auch in Siegen u. Weidenau, entstanden ) schon längst eingeebnet. Auf der rechten Straßenseite sind aber sehr wohl auch 2 Wohnhäuser erkennbar.
Die Vergrößerung sende ich einmal an Herrn Wolf, da er hier nur die Bilder einstellen kann.Sehr geehrter Herr Dick,
auch dieser Standort ist für die Krombacher Mühle nicht zutreffend. Schauen Sie sich einmal hist. Karten an. Es handelt sich hier meiner Meinung nach nicht um Krombach und das Littfetal.
Werter Herr Panthöfer, am 12.4. haben Sie aber geschrieben, daß an der von mir mit Pfeil gekennzeichneten Stelle die ehem. Krombacher Mühle (Abbruch 1982) gestanden haben soll und sie da auf der alten Luftbildaufnahme aber keine entsprechenden Gebäude erkennen könnten. Nach Aufhellung des Fotos lassen sich dort aber sehr wohl Gebäude erkennen auch entlang der linken und rechten Straßenseite.
Sehr geehrter Herr Dick, ich empfehle Ihnen, sich in die historischen Begenbenheiten vor Ort einzuarbeiten. Google earth kann nicht das Maß der Dinge sein. Wenn Sie sich einmal eine hist. Karte – die es auch im Internet unter geoportal.nrw. gibt – anschauen, werden Sie sehen, dass die Mühle an einer anderen Stelle stand. Ich möchte das hier nicht weiter ausführen, denn es führt in der Sache nicht weiter.
Pingback: Untersuchung zu Siegerländer Erinnerungsorten mit dem Studienpreis der Kreises ausgeszeichnet | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 4.4. – 17.4.2017 | siwiarchiv.de
Zwei weitere Einträge zum Ofen-Experiment sind erschienen:
1) https://www.lwl-archaeologie.de/blog/achtung-experiment-teil-2
2) http://www.lwl-archaeologie.de/blog/achtung-experiment-3
Zugseile bzw. Stabilisierungsseile einer Drehregalanlage aus Stahl?
Leider nein! Vielen Dank fürs Mitmachen!
Tipp meiner Freundin: kabel zur datenübertragung.
Leider auch nicht – und es wird etwas kälter. Auch Ihnen beiden vielen Dank fürs Mitmachen!
Siegel-Faden? Leider keine Ahnung, wie das richtig heißt.
Leider nein, kein Siegelfaden ….. Vielen Dank für das Mitmrätseln!
Befestigungsstrick für Ausstellungstafeln
Gratulation! Dies ist die richtige Antwort! Es ist ein Teil unseres Ausstellungssystems.
Drahtseile fürs Verplomben?
Wir verplomben nichts bei uns…. Trotzdem: Danke für diese Antwort!
Stahlseilaufhängung für Bilder…
Zu späz – leider! Die erste richtige Antwort ist im Spamordner gelandet …. Trotzdem danke für die korrekte Antwort!
Nach meiner Meinung fehlt das mittlerweile verstorbene Künstlerpaar Bernd und Hilla Becher (https://de.wikipedia.org/wiki/Bernd_und_Hilla_Becher), deren Kunst in der Region verwurzelt war. Im Vergleich zur verhaltenen regionalen Wahrnehmung sind diese Künstler international hoch angesehen. Die internationale Fotokunst wurde durch dieses Paar nachhaltig beeinflusst. Warum sich unsere Region im Gegensatz hierzu so sehr mit Rubens identifiziert ist mir nicht klar. Antwerpen darf im Gegnsatz zu Siegen mit Recht behaupten mit dem Schaffen von Rubens in Verbindung gebracht zu werden. Rubens ist in Siegen nur unter unglücklichen Umständen zur Welt gekommen.
Vielen Dank für die Kritik, lieber Herr Welter! Es zeigt Ihr Interesse an dieser Mitmachaktion zum 200jährigen Kreisgeburtstag.
Bei der Auswahl der 20 besten Persönlichkeiten aus Siegen Wittgenstein wurden folgende Auswahlkriterien berücksichtigt:
1) die Anzahl von 20 Persönlichkeiten sollte nicht überschritten werden.
2) nach Möglichkeit sollten Frauen berücksichtigt werden. Mit nur drei Frauen habe ich allerdings eine annäherd paritätische Aufstellung leider sehr deutlich verfehlt.
3) Vielfältige Lebensbereiche sollten berücksichtigt werden (z. B. Kunst/Kultur, Wissenschaft, Forschung, Sport, Religion)
4) Die Persönlichkeiten sollten verstorben sein.
5) Die Persönlichkeiten sollten innerhalb der 200 Jahre gelebt haben. Durchbrochen wurde dieses Prinzip bei Peter Paul Rubens und Johannes Bonemilch.
6) Nach Möglichkeit sollten alle Ortschaften des Kreisgebiets berücksichtigt werden. Leider konnte fand sich niemand für die Gemeinde Neunkirchen.
Gerade die Beschränkung auf 20 Personen führt dazu, dass wichtige Personen nicht ausgewählt werden konnten. Dies war uns von Beginn an bewusst.
Zu Bernd und Hilla Becher ist zu sagen, dass die beiden zum meinem Leidwesen tatsächlich fehlen. Als bedeutender Vertreter der modernen Kunst aus dem Kreisgebiet wurde Otto Piene aus Bad Laasphe berücksichtigt.
Johannes Althusius, dessen Fehlen ebenfalls bereits angemerkt wurde, lebte ebenso wie Graf Casimir zu Sayn-Wittgenstein Berleburg nicht in den 200 Jahren. Auch das Fehlen von Dieter Bogatzki wurde telefonisch bereits angemerkt. Als Vertreter für den Bereich Sport findet sich Artur Reichmann in der Liste.
Auf fehlende Persönlichkeiten kann gerne hier in den Kommentaren hingewiesen werden.
Pingback: Vor 70 Jahren: Erste Landtagswahlen in der Britischen Besatzungszone | siwiarchiv.de
Pingback: Kulturausschuss berät heute die Archivarbeit in der Gemeinde Neunkirchen | siwiarchiv.de
Pingback: Buchvorstellung „Historisches Handbuch der jüdischen Gemeinschaften in Westfalen und Lippe | siwiarchiv.de
Die Siegener Zeitung (Print) meldet heute, dass der Kulturausschuss der Gemeinde Neunkirchen einstimmig dem Beschlussvorschlag der Verwaltung gefolgt ist. Ein neuer Anlauf beginnt also. Erfreulich!
Pingback: Westfalen News #44 | Westfalenlob
Pingback: Literaturtipp: „Unsichtbar. Vietnamesisch-Deutsche Wirklichkeiten“ | siwiarchiv.de
Pingback: Video „Die Wassersäulenmaschine der Grube Guldenhardt bei Herdorf“ | siwiarchiv.de
Pingback: Video: Markus Jung „Glocken der Nikolaikirche zu Siegen“ | siwiarchiv.de
Abstimmung zum 200-jährigen Kreisjubiläum:
Wer ist der berühmteste Siegen-Wittgensteiner / „Rechenkünstler und Meistermaler“ , Leserbrief des Deutschen Frauenring e.V. Ortsring Siegen, 28.4.2017:
Uns ist bei der Ausschreibung der Abstimmung über berühmte Siegerländerinnen und Sie-gerländer mit großer Verwunderung aufgefallen, dass der weibliche Anteil im Ausschrei-bungstitel völlig fehlt und dass es auch nur die geringe Anzahl von drei Siegerländerinnen gibt, die es anscheinend wert sind, in das Eliteverzeichnis aufgenommen zu werden. Hier stellt sich uns die Frage, welche Kriterien der Auswahl zugrunde gelegen haben, denn es hat durchaus noch weitere Frauen von Format mit historischer Bedeutung gegeben. Wir erinnern an Maria Rubens, die sich mit all ihrer Kraft und ihrem Vermögen für die Freilassung ihres Mannes eingesetzt hat (so dass P.P. Rubens dadurch überhaupt erst hier geboren werden konnte) oder an Juliane zu Stolberg-Wernigerode, die „Stammmutter Europas“, (160 Enkel und Urenkel), die sich engagiert für die medizinische Versorgung der Bevölkerung einsetzte. Erwähnen möchten wir auch die Pazifistin und Berufsschullehrerin Hedwig Heinzerling, die nicht nur die Volkshochschule Siegen gründete, sondern auch den Deutschen Frauenring in Siegen etablierte.
Weitere Namen herausragender Siegenerinnen finden sich in einer Schrift, die von der Uni-versität Siegen zu berühmten Frauen im Siegerland verfasst wurde. Zu diesem Thema gibt es auch eine Stadtführung der Gesellschaft für Stadtmarketing. Wir finden, es wäre durchaus denkbar gewesen, in der Ausschreibung mit gleichem Anteil 10 Frauen und 10 Männern zu präsentieren, gerade weil Frauen in früheren Jahren weniger Chancen zur Teilhabe an Bil-dungsangeboten hatten.
Weiterhin weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass in allen öffentlichen Bereichen die weibli-che Form in Titeln und Anreden, besser noch in jeglichen Texten, mit bedacht werden sollte. Auch im 21. Jahrhundert ist es noch wichtig, dass Mädchen und Frauen sich angesprochen und akzeptiert fühlen und dass sie weibliche Modelle kennen lernen, an denen sie sich orien-tieren und die sie als Vorbild zu eigenem Engagement nutzen können.
Mit freundlichen Grüßen
Gabriele Fleschenberg / Vorstandsvorsitzende
Hildegard David / Öffentlichkeitsarbeit
Der Leserbrief erschien heute in der Siegener Zeitung (Print).
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik April 2017 | siwiarchiv.de
Telefonisch wurde auch das Fehlen des Siegener Geigers Adolf Busch angemerkt.
Im Sept / Okt 1877 wanderte ein Hermann WEIRICH, *1837, katholisch, samt Frau Maria Schneck u. Sohn Johann nach Süd-Brasilien aus. Die Familie soll aus Siegen, Westfalen, stammen. Sie waren Passagiere des englischen Dampfers Copernicus. Weitere Passagieren waren Personen bzw. Familien mit Nachnamen Neise (oder Weise), Bier, Wamann, Flian (?) u. Marchand.
Vielen Dank für die Information, Herr Schmidt! Aus welcher Quelle haben Sie sie gewinnen können?
Ab 1887 waren die Familien Buchholz, Pulverfabrikanten aus Krommenohl (heute eingemeindet nach Marienheide) Besitzer der Germania Brauerei in Wissen Sieg.
Carl Adolf August Schmeisser (geb. 1855-1924 in Siegen) war mit Emil Peters Schwester Eugenie verheiratet, im Aufsichtsrat der Brauerei ab 1910 seine Frau b.z.w. Herr Berghauptmann Schmeiser (Breslau) als Vertreter bis 1922 und ab 1922, Dr. Kurt Schmeisser (1889-1958) ihr gemeinsamer Sohn,
welcher bis 1958 im Aufsichtsrat war.
Vielen Dank für die Information, Herr Rolland!
Pingback: Richard Steuber (1887 – 1964) – Verwaltungsbeamter und Rotkreuzfunktionär | siwiarchiv.de
Zu den Personen Karl Born und Alfred Dörner haben wir bisher keine Informationen. Sind die beiden Namen jemanden bekannt?
Über weitere Angaben würden wir uns freuen.
Danke.
Torsten Thomas
Vielleicht handelt es sich um den hier genannten Alfred Dörner: http://aktives-gedenkbuch.de/index.php/Detail/Object/Show/object_id/22 ?
Alfred Dörner (1902-1992) war der christliche Ehemann von Ilse Dörner (1904-1982) geb. Jacobi, deren Eltern Sigismund Jacobi und Klara geb. Sternheim am 27.07.1942 nach Theresienstadt deportiert und am 21.07.1943 bzw. am 05.12.1942 ermordet wurden.
Im Sterberegister Arfeld ist der am 25.06.1830 am Nervenfieber verstorbene Christ Georg Knebel als „Einwohner und Schlosser-Meister im Zoden-Haus“ aufgeführt.
Vielen Dank für den Hinweis!
… man müsste weitere Eintragungen des Verfasssers dieser Ahnenliste sehen!
Hier der Eintrag in der Namenliste zum Enkel des Gesuchten:
Archivalia weist zurecht daraufhin, dass die Literaturliste nicht die aktuelle 3. Auflage aus dem Jahr 2014 der „Praktischen Archivkunde“ enthält.
Kann es nicht ein „Ack(e)rer“ sein, also ein Ackersmann, Landwirt?
Ja! Das stimmt. Das ck ist allerdings gewöhnungsbedürftig.
Nachtrag:
Geburtseintrag des Christian Knebel *28.02.1861 in Arfeld
Vater: „Carl Johann Knebel, Ackersmann in Zodehaus“
Die alte Berufsbezeichnung für Buchhalter war noch in der 2. Hälfte 19 Jahrh. „Casierer“. Könnte das evtl. hier passen ??? MIr ist diese Bezeichnung bei meinen Recherchen zu Jan Livien van der Haegen,-Kreuztal (1839 -1913) aufgefallen.
Ich denke, A. Sassmannshausen hat den Nagel auf den Kopf getroffen. „Ackerer“, klar, wenn man’s mal weiß, ist es eigentlich nachvollziehbar. Ich war von dem „k“ fehlgeleitet.
Danke an alle Miträtsler, mein Bekannter freut sich sehr über die Hilfe.
Ein niedersächsischer Archivkollege weist in der geschlossenen Facebook-Gruppe „Archivfragen“ darauf hin, dass sowohl der Sterbebucheintrag Christ. Knebels vom 25.6.1830 als auch dessen Traubucheintrag vom 20.12.1815 (bei in der Evangelischen Kirche Arfeld) via ancestry.com online eingesehen werden können.
In der Gruppe gab es auch den Hinweis auf die Lesart „Actuar“ …..
Pingback: „Die Kugeln flogen und pfiffen derart um den Kopf herum…“ | siwiarchiv.de
Danke. Ich denke, das k ist wirklich ein k, wenn man sieht, wie das große K bei Knebel geschrieben ist, ist das analog zum kleinen k in Ackerer – dieses Etwas neben dem Buchstaban ist wohl eben kein i-Strich (wie zunächst geglaubt) noch ein u-Strich, sondern das Kennzeichen des Schreibers für ein k – genau wie beim großen K.
Danke für den Hinweis!
Nachreichen möchte ich noch die Quellenangabe zum abgebildeten Zeitungsartikel auf der Facebookseite der VVN:
Westfalen Post vom 9.5.1947
Torsten Thomas
Kommentar Günter Dick, St. Augustin via Facebook , 12.5.2017 [Danke für die Erlaubnis dies hier zu posten!]:
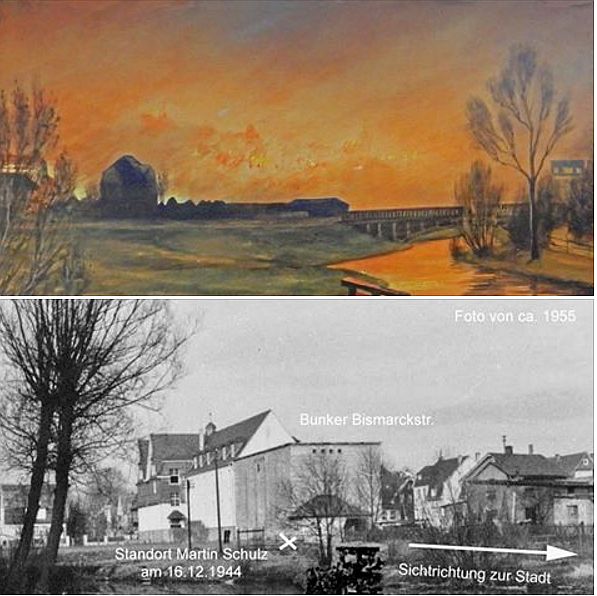
Das Bild wurde im vorzüglichen Bildband „Siegen vor und nach der Zerstörung“ auf Seite 58 von den Herausgeber- Autoren mitveröffentlicht.
Die Ortsbeschreibung ist hier aber leider nicht richtig wiedergegeben worden.
Es handelt sich hier keinesfalls um die Eisenbahnbrücke und dem dahinter liegenden Stadtbad , sondern um die im März 1945 beim Rückzug der „ Wehrmacht“ gesprengte sog. „Weiße Brücke“, die vom Ende der heutigen Bismarckstr. ins Charlottental führte.
Die gemauerte Steinbrücke hatte ganz besondere Konstruktionsmerkmale, die Martin Schulz sehr genau wiedergegeben hat. Das links im Vordergrund stehende dunkle Gebäude ist heute noch dort vorhanden. Ebenso kann der Sichtstandort noch sehr genau lokalisiert werden allein durch das im Vordergrund in der Wiese damals noch vorhandene Schütz für den ehem. Obergraben zur Sieghütte und dem angedeuteten Siegwehr beim Waldhaus.
Das Gemälde ist so hervorragend, daß man beim genauen Betrachten die Silhouette der Nikolaikirche selbst mit Krönchen und dem Oberen Schloß im Meer der Flammen angedeutet noch erkennen kann.
Entgegen der Beschreibung sollte es wohl auch jedem Betrachter einleuchtend sein, daß Martin Schulz ein solch hervorragendes Aquarell, selbst bei einem feuerleuchtendem Himmel, nicht am 16.12.1944 vor Ort, bis in die späten Abendstunden hinein, hat fertigstellen können.
Eine offizielle Berichtigung hielten aber leider weder der Herausgeber ( SHGV ) noch die Regionalpresse SZ und WP für notwendig, bzw. für sinnvoll. Sicher sind das ja auch nur „Peanuts“, die aber leider später drohen den nachfolgenden Generationen als unumstößliche „akademische Historiker-Weisheiten“ überliefert zu werden .
Dieser Bildband ( Herausgeber Siegerländer Heimat-u.Geschichtsverein e.V.) kann man übrigens vorbehaltlos jedem nur sehr empfehlen. Die vielen beeindruckenden historisch wertvollen Dia-Fotos von Erich Koch-Siegen (1914-1986), zeigen jedem überdeutlich ….. wohin politische Überheblichkeit und Massenverdummung unweigerlich hinführt.
Pingback: Landtagswahl 1947 im Landkreis Siegen | siwiarchiv.de
Pingback: Landtagswahl in NRW – „Archiv“ in den Wahlprogrammen der Parteien | Archivalia
Pingback: 2. VHS-Lesekurs zur Paläographie des 19. und 20. Jhdts. II. Teil | siwiarchiv.de
Kann man mal die Quelle benennen, aus der hervorgeht, dass das („Siegerländer“ !) Kartoffelbrot im Jahr 1816 ‚erfunden‘ wurde.
Da wir uns bereits im Zusammenhang mit einen kurzfristigen Publikationsprojekt die gleiche Frage gestellt haben, habe ich die Frage an den Heimatbund als Ausrichter der angekündigten Veranstaltung gerne weitergeleitet.
Wenn man wüßte, worauf Herr Burwitz hinaus will …
Ist denn das „Siegerländer [!] Kartoffelbrot“ nicht identisch mit dem gemeinen europäischen Kartoffelbrot, das lange vor 1816 „erfunden“ worden war?
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 2.5. – 15.5.2017 | siwiarchiv.de
Top, lieber Herr Kunzmann, natürlich, das gemeine europäische Kartoffelbrot wurde schon viel früher ‚erfunden‘. Aber das Artikelchen suggeriert doch, dass das „Siegerländer“ Kartoffelbrot, das echte, vulgo „Riewekooche“ in der Hungerkrise vor 200 Jahren geboren wurde. Also, welcher Gontermann. Harr, Müncker oder Flender oder auch Frau gleichen Namens hat das Wunderwerk zuerst gebacken?
Wenn man nur wüsste …
„Ungeliebte Kartoffel“? Im Zeitungsbericht von Bürgermeister Trainer für November 1816 kann nachgelesen werden, „bis auf diesen Tag sind nur allein in hiesiger Stadt 2961 Karren Cartoffeln eingebracht worden“. Da müssen ziemlich viel ungeliebte Kartoffelfelder bestellt worden sein, in einem Jahr, in dem fast nichts gewachsen ist und Anfang November aufgrund der Witterung noch immer „Cartoffeln im Felde stehen“.
Wenn man nur wüsste …
„Wir können uns heute gar nicht mehr vorstellen, wie die Menschen damals gelebt haben“, sagt der Vorsitzende des Heimatbundes und lädt ein, die Zeit vor rund 200 Jahren wieder lebendig werden zu lassen.
„Wenn man nur wüsste“ …
Fragen über Fragen.
Pingback: Ausstellungseröffnung „200 Jahre rheinische und westfälische Kreise“ | siwiarchiv.de
… Und die Fragen nehmen kein Ende. Waren die witterungsbedingt unreif geernteten Kartoffeln denn überhaupt zum Backen geeignet oder meist nur als Viehfutter brauchbar? Zu klären wäre auch, ob in den 1816/17 im Siegerland bewährten Notrezepten für Ersatzbrote ausdrücklich von „Kartoffeln“ die Rede war oder ob Synonyme verwendet wurden, die ebenso gut oder noch wahrscheinlicher auf die Topinambur hindeuten (Erdbirne, Erdapfel u.a.). Die Terminologie der beiden Nutzpflanzen ist ja alles andere als eindeutig. Topinambur-Brot war nun allerdings auch keine Siegerländer Erfindung und ist ebenfalls schon vor 1816 belegt. Eine auf soliden Quellen basierende Kulturgeschichte des „Riewekooche“ darf mit Spannung erwartet werden.
Pingback: Aus dem Fotoarchiv des Kreisarchivs: Fotokunst II | siwiarchiv.de
Wenn die Siegener FeministInnen auf eine Formalie „ausdrücklich hinweisen“, sollte ihnen doch wenigstens auffallen, dass sie drei Sätze vorher selbst gegen ihre Forderung verstoßen haben: Oder hatte Juliane zu Stolberg-Wernigerode etwa nur männliche Enkel und Urenkel, aber keine Enkelinnen und Urenkelinnen? Aufschlussreich ist auch, dass die emanzipierten Damen anscheinend Gebärfreudigkeit für ein Kriterium weiblicher Größe halten. Gern würde man(n) die Frauen ja besser verstehen, aber sie machen es einem nicht immer leicht …
Wenn Juliane zu Stolberg-Wernigerode nur im Jubiläumszeitraum geboren worden wäre, dann wäre sie sicher auf meiner ersten Auswahlliste gelandet. Allerdings hätte ich „Bauchschmerzen“ wegen der „Gebärfähigkeit“ gehabt. Kirstin Bromberg weist aber auf pädagogische Verdienste (u. a. Beteiligung an der Leitung von Stift Keppel), auf die Unterstützung des niederländischen Freiheitskampfes und auf naturmedizinischen Kenntisse, die wohl auf freizügig weitergab, hin (in: Frauenrat der Universität-Gesamthochschule Siegen (Hrsg): Auf den Spuren der Siegerinnen. Materialien zu einem Stadtrundgang „Frauen in der Geschichte Siegens“, Band I Frauen im Siegerland, Siegen1996, S. 6-8).
Pingback: 2. VHS-Lesekurs zur Paläographie des 19. und 20. Jhdts. III. Teil | siwiarchiv.de
Pingback: Eine kurze Geschichte des Altkreises Siegen | siwiarchiv.de
“ …. Die Abstimmung über den „Größten“ Siegen-Wittgensteiner ging am 19. Mai zu Ende. Unten finden Sie das Ergebnis. Welche Namen sich hinter den Fragezeichen der ersten drei Plätze befinden, wird am Samstag, 8. Juli 2017, im Rahmen des „Tags der offenen Tür“ im Kreishaus bekannt gegeben:
Platz 1:
44% – ???
Platz 2:
33.7% – ???
Platz 3:
6.8% – ???
Platz 4: 4.1% – Adolph Diesterweg
Platz 5: 3.9% – Ernst Menne
Platz 6: 3.1% – Peter Paul Rubens
Platz 7: 1.3% – Wilhelm Münker
Platz 8: 0.4% – Carl Kraemer “
Quelle: Kreis Siegen-Wittgenstein, Aktionsseite
Pingback: Linktipp: Projekt der LWL-Archäologie zur eisenzeitlichen Metallurgie im LWL-Freilichtmuseum Hagen II | siwiarchiv.de
Pingback: Viel Interesse am Vortrag über die ehemalige Deuzer Landärztin Dr. Tony Riecke | siwiarchiv.de
Pingback: Wie finde ich Informationen über Archive im Netz? | Archivalia
Die Liste der deutschen Archive auf der Internetseite der Archivschule Marburg ist inzwischen ersetzt worden durch einen Link auf das Archivportal D. Damit geraten alle früher gelisteten Archive, die noch nicht im Archivportal D vertreten sind, leider aus dem Fokus.
Danke für den Hinweis!
Über die Integration der Daten des Ardey-Archivverzeichnisses sollte die Übersicht von Archiven in Deutschland im Archivportal-D aber weitgehend vollständig sein; nachgewiesen sind über 2.500 Einrichtungen. Falls Archive fehlen, wären wir für einen Hinweis dankbar.
Danke auch für diesen Hinweis!
Wie so oft ist eine ungenaue Fragestellung nicht hilfreich. Portale können eine Google-Websuche im Einzelfall ergänzen, wenn es nicht einmal eine Visitenkarte zum Archiv im Netz gibt. Ansonsten gibt es allenfalls regionalen Ersatz für das Minerva-Handbuch von 1974, Auszüge:
https://books.google.de/books?id=pgDnBQAAQBAJ
Eine Retrodigitalisierung dieser und anderer Literatur über Archive wäre wünschenswert. Das Konzept Linked Open Data scheitert derzeit an der erbärmlichen Einstellung vieler auch großer Archive, für die Permalinks nicht relevant sind.
Es muss darauf ankommen, zentral möglichst viele aussagekräftige dezentrale Daten zu Archiven verfügbar zu machen.
Archive findet man auch in lobid-organisations
http://lobid.org/organisations
Hintergrund: https://bibcast.openbiblio.eu/ein-umfassendes-verzeichnis-deutscher-informationseinrichtungen/
lobid-Datenquelle für Archive ist ISIL. Seit 2014 ist das Hochschularchiv der RWTH dort vertreten:
https://archive20.hypotheses.org/1093
Unverständlich ist es, wieso es nicht eine Verknüpfung mit der GND gibt und wieso GND-AKS nicht schneller ausgebaut wird:
http://beacon.findbuch.de/seemore/gnd-aks?format=sources&id=7855952-2
Die BEACON-Technologie leistet im Prinzip die gewünschte Verknüpfung dezentraler Informationen über eine Schlüsselnummer (mit zugehörigem Normdatensatz).
Internationaler als die GND ist natürlich Wikidata:
https://www.wikidata.org/wiki/Q1622060
Welche Informationen könnten so zusammengeführt werden? Einige Beispiele:
Archivportale wie
http://www.archive-in-bayern.de/cgi-bin/cgi-local/archive-in-bayern/archivdetail.cgi?ID=289&templ=vorlage_einzeltreffer
Stadtbuch-Projekt
http://www.stadtbuecher.de/archive/stadtarchiv-gadebusch/
Handschriftencensus
http://www.handschriftencensus.de/hss/Altenburg_(Thuer)
RISM
http://de.rism.info/fr/einzelinformationen/noerdlingen-stadtarchiv-und-stadtbibliothek.html
Lieber Kollege Dr. Graf, nun will ich ein wenig mehr auf die Vorgeschichte des von Ihnen als „merkwürdig“ bezeichneten Eintrages eingehen. Vielleicht wird dann die Zielrichtung etwas klarer. Das von mir erwähnte Gespräch hatte eigentlich einen ganz anderen Zweck, nämlich die Organisation einer hier auch regelmäßig beworbenen Veranstaltung des Kreisarchivs. Im Laufe des Gesprächs wurde gesagt, dass es ja schwierig sei. Informationen über Archive zu recherchieren. Ich hatte den Eindruck, dass die google-Suchen wenig erfolgreich waren. Zur Beantwortung dieser sehr allgemeinen Frage kam ich auf die Idee, die derzeit vorhandene Portalstruktur in Deutschland (und Europa) möglichst knapp vorzustellen.
In 2 geschlossenen Facebook-Gruppen, die sich der Geschichte der beiden Altkreise Siegen und Wittgenstein widmen, habe [ich] diesen Eintrag geteilt und auch um Kritik /Anregungen gebeten. Bis jetzt liegen dort nur 2 positive Reaktion vor. Ein weitere Mal wurde der Facebook-Eintrag geteilt.
Es wäre m. E. kontraproduktiv, da offensichtlich die gegebene Information ausreicht, in diesem Zusammenhang die von Ihnen angesprochenen, wünschenswerten Verbesserungen der Portale gleich mit anzusprechen. Gleiches gilt auch für die Retrodigitalisierung der einschlägigen Literatur.
Meiner Meinung nach ist es nicht die Aufgabe von siwiarchiv, sich an der deutschen Archivportallandschaft abzuarbeiten. Wenn dieser Eintrag aber dazu einen Beitrag leistet, dann um so besser.
Hoppla, da stolpert man nicht nur über die eigenwillige Grammatik, da stößt auch der Inhalt auf: „2 geschlossene Facebook-Gruppen, die sich der Geschichte der beiden Altkreise Siegen und Wittgenstein widmen“. Was sind das denn für Geheimbünde? Elite-Historiker, deren kostbaren Früchte der Erkenntnis dem Plebs der Zunft verwehrt bleiben sollen? Oder eine Art Siwi-Ku-Klux-Klan, der alle Einsichten wissenschaftlichen Tuns in geheimen Sitzungen massakriert? Wo und wann wird der Schleier dieses Mysteriums gelüftet?
Danke für den Korrekturhinweis, da ist mir wohl ein Wort abhanden gekommen! Nein, bei den Facebook-Gruppen handelt es sich nicht um Geheimbünde. Jede/r auf Facebook-Angemeldete kann dort beitreten. Bei den Mitgliedern handelt es sich im weitesten Sinne um an der Geschichte der jeweiligen Region Interessierte.
Das ist schon interessant und doch eingeschränkt durch die Voraussetzung bei facebook gemeldet zu sein.
Wie kann sich jemand, der – aus welchen Gründen auch immer – nicht bei facebook ist, sich bei den beiden Gruppen sinnvoll einbringen? Gibt es noch andere, (mehr) sinnvolle Zugänge?
Es ist tatsächlich leider so, dass man bei Facebook (FB) angemeldet sein muss, um bei FB „mitzumischen“. Eine andere Möglichkeit, gerade an geschlossenen FB-Gruppen teilzunehmen, ist mir nicht bekannt. Dies gilt auch für alle übrigen Netzwerke: Das Nutzen geschlossener Bereiche ist nur bei Anmeldung möglich …..
Um im Web 2.0 sichtbar zu sein, halte ich ein öffentliches Blog für die beste Möglichkeit: um
a) Erfahrungen zu sammeln und
b) die Möglichkeit zu eröffen, in anderen sozialen Netzwerken sichtbar zu werden, ohne dort angemeldet zu sein.
M.W. erlauben es die gängigen Blogplattformen, dass die einzelenen Einträge in die Netzwerke durch die Leserschaft geteilt werden können. siwiarchiv erlaubt derzeit das Teilen der Einträge in Facebook, Twitter und in google+.
Ich bleibe bei meiner Kritik. Es ist völlig daneben allgemein von „Informationen über Archive“ zu sprechen, ohne zu sagen, was das denn für Informationen sein sollen. Und dass erbärmlich viele Archive keine anständige Website besitzen, daran ändert auch der Hinweis auf Portale nichts.
Lieber Kollege Graf, schade, dass die weitere Information Ihnen offensichtlich nicht genügt. Ich bin nicht auf den berechtigten Hinweis der fehlenden Archivwebseiten eingegangen, da ich den Eindruck habe, dass die meisten öffentlichen Archive, die in den Portalen vertreten sind, auch über einige Webseiten verfügen bzw. über die Webseiten ihrer Trägerinstitution zu erreichen sind.
Für Hessen und Niedersachsen würde ich noch die jeweilige Arcinsys-Instanz (https://arcinsys.hessen.de/ und https://www.arcinsys.niedersachsen.de) ergänzen.
Auch bei Archiven, die keine Bestände in Arcinsys verzeichnet haben, sind oft allgemeine Informationen hinterlegt. Arcinsys Niedersachsen hat das frühere Archivportal Niedersachsen ersetzt.
Demnächst wird wohl auch Arcinsys Schleswig-Holstein zu ergänzen sein.
Danke für die Ergänzung! Als dezidiert nordrhein-westfälisches Archivweblog habe ich der Einfachheit halber nur „unser“ Landesportal erwähnt.
Für das Kreisgebiet wäre neben dem hessischen Portal auch das rheinland-pfälischen Pendant zu erwähnen: https://www.landeshauptarchiv.de/index.php?id=593&tx_lhaarchivportal2010_pi1%5BshowList%5D=1&tx_lhaarchivportal2010_pi1%5BcountryId%5D=1&no_cache=1
Dankeschön für den Artikel:“ Adolf Achenbach (1825 – 1903) – Im Schatten des Bruders“
Aus Siegerländer Sicht kann man dieser Auffassung sein. Hört man sich dagegen in Clausthal-Zellerfeld um, sieht der Vergleich schon ganz anders aus. Achenbach hat sich um den Harzer Bergbau und die Oberharzer Wasserwirtschaft sehr verdient gemacht. Er sorgte nicht nur für den Fortbestand des Bergbaus in der Region sondern auch für das Weiterleben der Berakademie Clausthal, denn bereits 1879 war die Schließung vom Preußischen Landtag beantragt worden. Hiebei half ihm jedoch sein Bruder Dr. Heinrich Achenbach. 1900 wurde ihm der Titel ‚Wirklich Geheimer Rat‘ verliehen mit dem Prädikakat ‚Exzellenz‘.
Geboren wurde Adolph Achenbach aber schon am 25. Januar 1825 in Saarbrücken!
Vielen Dank für die freundliche Reaktion! In der Tat lohnt sich vielleicht auch ein intensiverer Blick auf Adolf Achenbach. Der verlinkte Wikipedia-Eintrag und der ebenfalls verlinkte Artikel im Portal „Rheinische Geschichte“ geben ja Hinweise auf weitere online verfügbare Quellen und gedruckte Literatur.
Irles Siegerländer Persönlichkeitenlexikon (Siegen 1974, S. 14) weist nur zwei Zeitungsartikel zu Adolf Achenbach aus: Rhein-Zeitung v. 7.6.1961 und Westfälische Rundschau v. 22.7.1961. Aber das Siegener Stadtarchiv verwahrt den Nachlass seines Bruders Heinrich. In diesem Nachlass befinden Briefwechsel (?) zwischen Heinrich und Adolf Achenbach.
Pingback: siwiarchiv-Statistik vom 16.5. – 29.5.2017 | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik Mai 2017 | siwiarchiv.de
Pingback: 1. Archivcamp in Duisburg, 19.6.2017, hier: Werbung I | siwiarchiv.de
Pingback: 1. Archivcamp in Duisburg, 19.6.2017, hier: Werbung I | siwiarchiv.de
Für die katholischen Kirchenarchive gilt:
http://www.katholische-archive.de
Vielen Dank für die Ergänzung!
Es ist überhaupt fraglich, ob das Jung-Stilling-Bild, das im Rathaussaal hing, wirklich Jung-Stilling darstellt.
Soviel mir bekannt ist, hat Jung-Stilling nur ein einziges Porträt von ihm als übereinstimmend mit seinem tatsächlichen Aussehen anerkannt, und das ist das Bild von Lips aus dem Jahr 1801. Es ist in der Biographie von Professor Merk (in der 4. Auflage auf S. 53) wiedergegeben.
Vielen Dank für den Hinweis! Dann wäre die Frage, um welches Bild es sich denn dann gehandelt haben mag?
Pingback: Eine kurze Geschichte des Altkreises Wittgenstein. | siwiarchiv.de
Pingback: Kurze Chronik des Kreises Siegen-Wittgenstein 1975 – heute | siwiarchiv.de
Pingback: Kurze Chronik des Kreises Siegen-Wittgenstein 1975 – heute | siwiarchiv.de
Anlässlich des Historischen Marktes auf der Ginsburg am vergangenen Pfingstfest hat der Heimatbund Siegerland-Wittgenstein Broschüre zu den „Duffeln“ erstellt, die neben regionalen Kartoffelrezepten auch folgende
“ … Geschichte der Kartoffel in unserer Region“ enthält: „Nach der Entdeckung Amerikas um 1500 brachten die Spanier als erste die Pflanze von Peru und Chile mit nach Europa. Sie bezeichneten sie als „Trüffeln der Inkas“.
Johannes Matthäus (1563-1621), bis 1621 Professor der Arzneikunde in Herborn, pflanzte die erste Kartoffel, die er um 1615 aus England erhielt, in der Grafschaft Nassau. Er betrachtete sie als Zierpflanze und stellte sie in einem großen Blumentopf zur Schau vor das Fenster.
Johann Heinrich Jung-Stillung aus Grund berichtete in „Der Volkslehrer“ von 1784, dass seine Großeltern um 1716 etliche Kartoffeln von Wieder-täufern erhalten haben, vermutlich aus Lohe bei Kredenbach.
In Wittgenstein wurden 1726 zum ersten Mal Kartoffeln im Feld angebaut. 1765 und 1771 haben zehntpflichtige Bauern in Richstein und Winges-hausen Kartoffeln an den Grafen abgeliefert. Davon wurden auch etwa 50 – 60 Scheffel an das Kloster Grafschaft verkauft.
Friedrich der Große war es Mitte des 18. Jahrhunderts, der die Kartoffel in Preußen zum Volksnahrungsmittel machte. Damit begann der Siegeszug der Kartoffel auch in unserer Region. Dies könnte zumindest der Ursprung des Reibekuchenbrotes sein, das aus Frankreich vielleicht bedingt durch die Truppenbewegungen von Napoleon nach Nassau und somit in das Siegerland kam.
Im März 1805 wurde vorgeschlagen, die Keime der Kartoffel auszu-schneiden und diese als Setzkartoffel zu benutzen.
Durch einen Vulkanausbruch im April 1815 wurde eine globale Klimaver-änderung in Nordamerika und Europa hervorgerufen. Es kam zu Missernten und einer schlimmen Hungersnot. Wahrscheinlich ist es, dass in den darauf folgenden Hungerjahren 1816/17 die Kartoffel zum Hauptnahrungsmittel wurde und deshalb auch Reibekuchen gebacken und vielfältige andere Rezepte mit Kartoffeln ausprobiert wurden. ….“
Und inwiefern hilft die Fleißarbeit der Heimatbündler nun Herrn Burwitz bei seiner eingangs aufgeworfenen Suchanfrage nach der Quelle weiter?
Bei Jung-Stilling hätte man noch mehr finden können als den aus dem Zusammenhang gerissenen (und wohl nur irgendwo in der Sekundärliteratur aufgeschnappten) Hinweis auf die Wiedertäufer. Im „Volkslehrer“ (1784, 8. Stück, Seiten 484-500) widmete er sich ausführlich diesem Gemüse. (Zu dessen Anbau durch seine Großeltern ab 1716 siehe dort S. 486.) Auf der letzten Seite (500) empfahl er die Kartoffel dann auch zum Brotbacken.
Ergänzend läßt sich ein ganzseitiger Beitrag zur „Bereitung des Mehles von Kartoffeln“ in den Dillenburgischen Intelligenz-Nachrichten, 41. Stück vom 16.10.1790, Sp. 663-664 anführen.
Ob der Heimatbund etwas für „wahrscheinlich“ hält, ist irrelevant, solange er dafür keine Begründung gibt. (Oder kommt die nach den drei Pünktchen noch?) Die hier aufgeworfene Frage nach Quellenbelegen für die Kartoffelnutzung 1816/17 in den Kreisen Siegen und Wittgenstein bleibt trotz der Publikation des Heimatbundes aktuell.
In Dieter Pfaus „Kreisgründungen Siegen & Wittgenstein. 1816-17 im Jahr ohne Sommer“, Siegen 2017 – Herausgeber ist übrigens der Heimatbund Siegerland-Wittgenstein -, verweist auf S. 10-11 auf das Kartoffelbrotpatent des Fürsten Friedrich Carl zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, bestätigt von der Regierung in Arnsberg am 14. Oktober 1817.
Das Patent ermöglichte die Verringerung der Herstellungskosten von Kartoffelbrot.
In Dieter Wessinghages „Die Hohe Schule zu Herborn und ihre Medizinische Fakultät 1584-1817-1984, Stuttgart 1984, findet sich auf S. 35 (Eintrag zu Johannes Matthaeus) folgendes: “ …. Die Westerwaldbauern begannen erst um 1730 mit dem Anbau dieser aus der Neuen Welt stammenden Pflanze [Anm.: Gemeint ist die Kartoffel]. So kam es, daß seinerzeit die Knolle höchstens auf den Tisch der Adligen kam. ….“
Fazit: Eine Forschungsarbeit in den Adelsarchiven (Nassau-Siegen, Oranien-Nassau, Sayn-Wittgenstein-Berleburg, Sayn-Wittgenstein-Hohenstein) scheint zur Klärung der aufgeworfenen Frage wohl unumgänglich.
Wo ist denn besagte Schrift zu den Kreisgründungen zu erhalten? Emsiges Googeln erbringt nur den Hinweis auf den abgelaufenen ‚Historischen Markt‘ auf der Ginsburg. Kann der am Jahr ohne Sommer 1816 (!) Interessierte die Schrift auch ohne Ginsburg-Besuch erwerben? Warum hat siwiarchiv uns das Werk vorenthalten?
1) Erhältlich wird diese Schrift bei der Geschäftsstelle des Heimatbundes Siegerland-Wittgenstein sein.
1a) Wenn ich es recht sehe, wird das Stadtarchiv Siegen ein Belegexemplar erhalten.
1b) Spätestens im Rahmen des Schriftentauschs wird es allen Archiven im Kreisgebiet bei unserer nächsten Arbeitskreissitzung zugänglich gemacht.
2) „siwiarchiv“ kann leider nicht alles ….. Die Vorstellung der Schrift war für heute vorgesehen gewesen. In Anbetracht der Diskussion um das Kartoffelbrot erschien mir der Hinweis allerdings angezeigt.
Aus den Lebenserinnerungen des Siegener Landrentmeisters Johann Adolf Schenck:
„Das Jahr 1816 war im Allgemeinen ein trauriges Jahr, denn es regnete unaufhörlich, alle Flüsse, Rhein, Main, Mosel, Lahn und Sieg überschritten nicht selten ihre Ufer. Die Ernte der Frucht und besonders der Kartoffeln war so gering, daß sie kaum das tägliche Bedürfnis bis Ende 1816 liefern konnte. Im Monat November wurde noch Frucht, Hafer und Roggen vom Felde gefahren, es war aber keine Frucht mehr, sondern nur Stroh und dies zum Theil schon verfault. […] An meinem Tische aß man nur Schwarzbrod, das wir mit dem Mehl der Erbsen, Dicken Bohnen und Linsen vermischen und backen ließen.“
(Siegerländer Heimatkalender1932, S. 61. Ich spare mir ausnahmsweise die kompletten bibliographischen Angaben.)
Vielleicht könnten die Vertreter der Kartoffelbrot-Jubiläums-Theorie doch endlich , wie es hier vor fast vier Wochen ernsthaft erbeten wurde, Quellen für die angebliche „Erfindung“ des heute beliebten und beim Bäcker erhältlichen Siegerländer Kartoffelbrotes vor exakt 200 Jahren offenlegen – oder aber sich anderenfalls dazu bekennen, dass ihnen die historischen Fakten eigentlich egal sind und sie nur einen Anlass zum Feiern gesucht haben. Geschichtsklitterung ist nicht verboten, aber man sollte dann wenigstens zu ihr stehen und die Phantasieprodukte nicht noch gedruckt für die Nachwelt konservieren.
Meine Herren Archivar und Kunzmann, nutzen Sie doch bitte den im deutschen Sprachraum üblichen Begriff Täufer anstelle von Wiedertäufer. Oder beziehen Sie damit irgendeine Position? Folgen Sie Reformatoren oder Reformatorinnen des 16. Jahrhunderts? Oder übersetzten Sie nur Anabaptists aus dem Englischen?
Tut mir leid, ich wollte Ihre Gefühle nicht verletzen. „Wiedertäufer“ steht wörtlich in dem erwähnten und 1784 im deutschen Sprachraum erschienenen Text von Jung-Stilling. Wenn ich mal wieder in die Verlegenheit komme, den Begriff zu zitieren, setze ich ihn in Gänsefüßchen und füge eine Fußnote mit der politisch korrekten Version hinzu. Die müßte dann natürlich lauten „Täuferinnen und Täufer“, sonst beschweren sich anschließend wieder die Frauenfunktionärinnen.
Lieber Herr Plaum,
1) vielen Dank für den Hinweis!
2) Es handelt sich lediglich um ein Zitat aus der Broschüre des Heimatbundes, und von daher nicht um meinen Sprachgebrauch.
Pingback: Historischer Markt auf der Ginsburg 2017. Fotoimpressionen | siwiarchiv.de
Pingback: #archivestourism on International Archives Day 2017 | Ask Archivists
siwiarchiv nimmt mit einer Reise durch touristische Blog-Einträge teil: einfach auf Twitter @siwiarchiv folgen!
Pingback: Karte der Haupttouristenwege im Sieger-, Sauer- und Wittgensteiner Land | siwiarchiv.de
Im gestrigen Vortrag zur Geschichte des (Alt-)Kreises Siegen wies Bernd Plaum u. a. auf die erfolgreiche Beteiligung des Kreises Siegen-Wittgenstein an der „Zukunftsinitiative Montanregion“ des Landes Nordrhein-Westfalen im Jahr 1987 hin. Dies ist sicher in der Chronik zu ergänzen.
Pingback: Kurze Chronik des Kreises Siegen-Wittgenstein 1975 – heute | siwiarchiv.de
Pingback: Festakt „50 Jahre Gillerbergheim“, 24.8.2012 | siwiarchiv.de
Pingback: Broschüre „50 Jahre Gillerbergheim/Jugendwaldheim Gillerberg – eine Bilderreise“ | siwiarchiv.de
Pingback: 50 Jahre Schulwaldheim Gillerberg/Gillerbergheim | siwiarchiv.de
Pingback: Historische Frauen auf Stromkasten in Siegen | siwiarchiv.de
Pingback: Heute vor 200 Jahren: 1. Fahrradfahrt | siwiarchiv.de
In dem Einwohnerbuch der Stadt Siegen 1940 fand ich unter Stadt Siegen –> Sportvereine (Abschnitt VI) folgenden Eintrag:
Radfahrerverein „Schwalbe“ 01 – Über Berg und Tal
Vorsitzender: Dietrich Hahn, Adolf-Hitler-Straße 3/1, Fernruf 3318
Anmerkung: Adolf-Hitler-Straße war und ist wieder die Sandstraße
01 bedeutet wohl 1901
Vielen Dank für diesen Hinweis!
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 30.5. – 12.6.2017 | siwiarchiv.de
Weitere Hinweise zum frühen Radsport im Siegerland:
1) 1894 Erstes Radrennen zur Kronprinzeneiche vom Hilchenbacher Radfahrerclub „Glück auf 1888“ (Quelle: Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein, Bestand 5.4. (Kreiszeitleiste) Nr. 619)
2) Walter Klein (geb. 1905) betrieb in Siegens Welterstraße eine Möbelherstellung mit Innenausbau. Von Jugend auf huldigte er dem Radrennsport als Kunstradfahrer. Er war langjähriger Vorsitzender des Radfahrvereins „Über Berg und Tal“ 1898 Siegen und über 20 Jahre Mitglied im Bund Deutscher Radfahrer. Nach dem 2. Weltkrieg diente er bis 1952 als Bezirksrennfahrwart und Bezirkskunstfahrwart sowie lange Zeit als Bezirksvorsitzender. Er organisierte eine internationale Etappenfahrt Wiesbaden-Siegen-Wiesbaden und war Mitglied der Ehrengilde im BDR und lange Zeit auch in der Ehrengilde.
Quelle: Siegerländer Heimatkalender 1990, S.34
3) Mit „Dünnwällersch“ Otto (Otto Karl Jakob) hat Burbach eines seiner letzten Originale verloren. Bei keinem Fest, bei keiner Feier fehlte der älteste Feuerwehrmann der Großgemeinde. Auch sportlich sorgte er für Schlagzeilen. 1919 begann er seine aktive Laufbahn im Radfahrverein „Burbach 1910“. Seit über 50 Jahren stand er der Waldgenossenschaft Eichener Hauberg vor, im Löschzug Burbach war er 76 Jahre Mitglied. Besonders stolz war Onkel Otto über seine historische Uniform mit Pickelhaube, die er noch mit 90 Jahren beim Maibaumfest trug.
Quelle: Siegerländer Heimatkalender 1995,S.36
Das sind wertvolle Hinweise, danke! Gleich noch als Ergänzungen hier die direkten Links der Einzelseiten des Jahrbuchs der dt. Radfahrer-Vereine 1897 in Wikisource, wo die Korrektur der Volltexterkennung möglich ist. Unterstützung ist dabei willkommen.
RV Berleburg: https://de.wikisource.org/wiki/Seite:Jahrbuch_der_deutschen_Radfahrer-Vereine_1897.pdf/304
Erndtebrück. RV Wittgenstein 1894: https://de.wikisource.org/wiki/Seite:Jahrbuch_der_deutschen_Radfahrer-Vereine_1897.pdf/306
Laasphe i. Wfl. RV ,Wittgenstein‘: https://de.wikisource.org/wiki/Seite:Jahrbuch_der_deutschen_Radfahrer-Vereine_1897.pdf/308
Niederschelden a. Sieg. RC (B) sowie Siegerländer RV (B): https://de.wikisource.org/wiki/Seite:Jahrbuch_der_deutschen_Radfahrer-Vereine_1897.pdf/309
Hilchenbach. Siegerländer RC Glückauf.: https://de.wikisource.org/wiki/Seite:Jahrbuch_der_deutschen_Radfahrer-Vereine_1897.pdf/307
Pingback: Siegener Landrat in der Ausstellung zur Geschichte der Kreise in NRW | siwiarchiv.de
Pingback: Archivisches Sammlungsgut: Werbemittel V | siwiarchiv.de
Einwohnerbuch Stadt Siegen 1963/1964
II. Teil der Stadt Siegen=> Sportvereine (Sektion VI) -> Seite 16
Radfahrer
Radfahrverein „Schwalbe“ 01, Vereinslokal : Gasthof Klein, Koblenzer Straße. Zusammenkünfte: jeden Montagabend. Übungsstunden: jeden Sonnabendnachmittag von 16-18 Uhr. Vorsitzender: Wilhelm Hahn-Dietrich, Bergstr. 1/1 , Fernruf 32189
R.V. Über Berg und Tal, 1898, Vorsitzende: Walter Klein, 59 Siegen, Welterstraße 40
Vielen Dank für die Ergänzung! Wäre interessant, ob es noch alte Vereinsunterlagen gibt …..
Zur Siegerländer Radfahrgeschichte ist auch der Beitrag „Als noch die Radfahrkarte benötigt wurde“ von Heinz Bensberg heranzuziehen: http://heinz-bensberg.de/html/radfahrkarte.html
Pingback: Archive im Koalitionsvertag NRW – Fehlanzeige! | siwiarchiv.de
Pingback: Vortrag: „Abstrakt, Figurativ, Konzeptuell | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 13.6. – 26.6.2017 | siwiarchiv.de
Sehr geehrte Damen und Herren!
Herzlichen Dank für Ihre gute Arbeit.
Bei dem Papiermüller Johann Henrich NEUSER, *08.03.1772 Rudersdorf ,
handelt es sich um einen direkten Vorfahren von mir.
Er war verheiratet mit M.Elisabeth Schneider, die am 25.10.1824 verstarb.
Im Dez 1824 gab J.Henrich Neuser in der Frankfurter Ober-Post-Amts-Zeitung
eine Suchanzeige zu seinem Sohn auf , der die Papiermühle übernehmen sollte.
Zu finden unter:
———
Frankfurter Ober-Post-Amts-Zeitung: 1825,1/6
https://books.google.de/books?id=RYhDAAAAcAAJ
1825
(245), Johannes Neuser von Rudersdorf, im Königlich Preußischen Kreise Siegen, Regierungsbezirk Arnsberg ist im August 1822 als Papiermacher-Gesell auf …
———-
Es würde mich interessieren, aus welchen Jahren seine dortigen
Papiere hergestellt/ bzw. benutzt worden sind.
Mit freundlichem Gruß
Uwe KOLOSSA
Vielen Dank für die Ergänzung! Die Unterlagen stammen aus dem Bestand 1.1.10. (Kreis Siegen, Landratsamt, Schenkung Stadtarchiv, Verzeichnis A) des Kreisarchivs Siegen -Wittgenstein, dessen Überlieferung im Jahr 1814 beginnt.
In Hans-Dirk Joostens Buch „Mühlen und Müller im Siegerland“, Münster 1996, findet sich folgendes zur Papiermühle in Rudersdorf (S. 255): “ …. An ihrer [Anm.: gemeint ist die ehemalige Ölmühle in Rudersodorf] Stelle wurde 1821 eine Papiermühle durch Heinrich Neuser errichtet, die sich möglicherweise aufgrund der Wasserverhältnisse, des Standortnachteils und der Konkurrenz durch Oechelhaeuser in Siegen nicht sehr lange hält. ….“
Pingback: Literaturhinweis: „Film- und Tondokumente im Archiv | siwiarchiv.de
Offenheit
Innovation
Vernetzung
Kommunikation.
Mit diesen vier Zielen, die zum Abschluss von „Offene Archive“ (19. bis 20. Juni 2017, Landesarchiv NRW) nochmals dezidiert die Ziele der Konferenz umrissen haben, endete vor wenigen Tagen die vierte Ausgabe der gleichnamigen Konferenzreihe. Bei den ca. 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern kam besonders das erstmals in dieser Form veranstaltete archivische BarCamp („ArchivCamp“) positiv an, eine ergebnisoffene Tagungsform, deren Inhalt und Ablauf von den Teilnehmenden selbst festgelegt wird.
Seitens des Organisationsteams wurden bereits während und kurz nach Abschluss von „Offene Archive“ Zusammenfassungen der ArchivCamp-Sektionen sowie erste Berichte zur Konferenz im Blog Archive 2.0 zur Verfügung gestellt:
Tagungsbericht 19.6.
Bericht Archivcamp 19.6./Teil 1
Bericht Archivcamp 19.6./Teil 2
Tagungsbericht 20.6.
Es finden sich außerdem (ebenfalls im Blog) fotografische Eindrücke unter den folgenden Links:
Start
Archivcamp 1
Archivcamp 2
Archivcamp 3
Archivcamp 4
Konferenz (2. Tag)
Die Tweets zu den bei „Offene Archive“ genutzten Schlagworten (Hashtags) #archive20 und #archivcamp sind in einem Storify zusammengefasst.
via Marburger Archivliste
Pingback: Vortrag „Der Freudenberger Uhrmacher Johann Peter Stahlschmidt“ | siwiarchiv.de
Pingback: Open-air-Ausstellung zum 125. Geburtstag von Walter Krämer | siwiarchiv.de
Pingback: Juden in Westfalen und Lippe (JuWeL): ein Online-Projekt, bei dem Mitmachen erwünscht ist! | siwiarchiv.de
Auch in Langenholdinghausen gab es einen Radfahrerverein.
Ernst-Otto Ohrndorf, Langenholdinghausen, Band 3, Siegen 1998, Seite 583 f.
Der Radfahrerverein „All Heil“ wurde 1907 gegründet. Im Buch ist die Satzung des Vereins abgedruckt. Interessant ist § 3 in dem festgelegt wurde,
das auch weibliche Personen ab dem 16. Lebensjahr Mitglied werden konnten.
“ Über die Aktivitäten des Vereins im Einzelnen und die Dauer seines Bestehens ist nichts näheres bekannt.“
Pingback: Von wilden Mädchen, Paul McCartney und viel Kultur | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik Juni 2017 | siwiarchiv.de
Der Verein 4fachwerk Mittendrin-Museum entwickelt gerade einen Uhrmacher-Rundweg durch den historischen Stadtkern Alter Flecken
Freudenberg. Der erste Rundgang findet am 15.07.2017 statt.
Zur Rezeption des Fürsten Wittgenstein s. a. den UFA-Film „Preußische Liebesgeschichte“ (1938): https://de.wikipedia.org/wiki/Preu%C3%9Fische_Liebesgeschichte . Es müsste noch recherchiert werden, ob der Film 1950 auch in Wittgensteiner Kinos gezeigt wurde und wie ggf. die Reaktionen ausfielen.
Einige Anmerkungen:
Die Rückversetzung des Oberstudiendirektors Dr. Kurt Müller in eine Studienratsstelle nach dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums von April 1933 hat mit „Mobbing“ nichts zu tun. Das Gesetz erlaubte Entlassung, Zurruhesetzung und Versetzung in ein anderes/niederes Amt von unliebsamen, dem neuen System nicht angepassten Beamten. (S. 22f.)
Die Jahreszahl 1935 (S. 23) in der Chronik von Herrn Wolf ist nicht korrekt. 1935 war die ältere Tochter der Familie Frank, Ruth (Jg. 1912), bereits verheiratet. Sie hatte das Lyz ohne Abschluss verlassen. Tochter Inge (Jg. 1922) schied im November 1938 im Rahmen der Verordnung vom 14.11.1938 des Reichserziehungsministers Bernhard Rust aus. Darin heißt es, es könne „keinem deutschen Lehrer und keiner deutschen Lehrerin mehr zugemutet werden, an jüdische Schulkinder Unterricht zu erteilen. Auch versteht es sich von selbst, dass es für deutsche Schüler und Schülerinnen unerträglich ist, mit Juden in einem Klassenraum zu sitzen. Soweit es noch nicht geschehen sein sollte, sind alle zur Zeit eine deutsche Schule besuchenden (jüdischen) Schüler und Schülerinnen sofort zu entlassen“.
Inge Frank absolvierte von Februar 1939 bis Ende Juli 1940 einen Kurs für Kinderpflege im israelitischen Kinderheim in Köln, Lützowstraße. Details dazu sind im Internet unter http://www.lebensgeschichten.net nachzulesen. Darin ist leider die falsche Jahreszahl 1935 enthalten. Bisher habe ich nicht herausbekommen, was mit der jüngeren Cousine von Inge, Doris Salomon (Jg. 1926), aus Geisweid nach November 1938 geschah. Sie wurde als einziges jüdisches Kind aus der Geisweider Schule (Schulleiter Walter Nehm war Antisemit) entlassen. Nachdem ihre Mutter Jenny Salomon 1941 verstarb, lebte Doris in der Familie des Onkels Samuel Frank und wurde gemeinsam mit ihr Ende April 1942 nach Zamosc deportiert.
Meines Erachtens hätte die mutige Haltung der Oberstudienrätin Annemarie Schaefer (1887-1948), die als stellvertretende Schulleiterin während des Kriegseinsatzes von Dr. Rohdich in der Zeit vom 3. Nov. 1941 bis 13. Juli 1944 die Verantwortung hatte, erwähnt werden müssen. Sie forderte Ilse Meyer (Enkeltochter des vormaligen Kreismedizinalrates Dr. Arthur Sueßmann, nach den Rassegesetzen als Halbjüdin eingeordnet) auf, einfach weiter am Schulunterricht teilzunehmen, als sie 1943 aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen die Schule verlassen sollte. Bei Rückkehr Rohdichs von der Front im Sommer 1944 musste sie dann die Schule verlassen. Annemarie Schaefer wurde nach dem Krieg Stiftsoberin in Stift Keppel.
Zwei Anmerkungen zum Beitrag von Raimund Hellwig. Er schreibt: „1983 erschütterte die erste große Stahlkrise das Siegerland. Plötzlich gab es die konkrete Gefahr, dass der Stahlstandort Geisweid mit damals noch über 10.000 Mitarbeitern geschlossen werden könnte.“ Das stimmt nicht. In Geisweid waren noch nie so viele Menschen beschäftigt. Als ich 1962 dort anfing, waren es rd. 6.000 Mitarbeiter. Mir liegen die Belegschaftszahlen vor.
Die Werksgruppe Siegen mit den Werken Geisweid und Niederschelden beschäftigte 1983 insgesamt 4.570 Arbeiter und Angestellte, davon 3.914 Mitarbeiter in Geisweid und 656 in Niederschelden, darüber hinaus waren rd. 300 Angestellte in der Hauptverwaltung in Geisweid tätig. Woher hat R. Hellwig die Zahl? Auch der Hinweis, dass Helmut Wahl die Fa. Philips in Eiserfeld aufgekauft habe, kommt wohl nicht hin. Das müsste Horst Wahl gewesen sein.
Vielen Dank für die korrigierenden Hinweise!
1) In der von mir zu verantwortenden Chronik fällt der Begriff „Mobbing“ nicht im Zusammenhang mit der vorläufigen Versetzung Dr. Müllers auf der Grundlage des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufbeamtentums vom April 1934. Eine biographische Forschung über Müller ist allerdings eine sehr lohnenswerte Arbeit, die sicher Klarheit in die Siegener Vorgänge bringen wird.
2) Das Jahr 1935 für das Verlassen der jüdischen Schülerin Inge Frank fand sich in der Chronik von Tobias Gerhardus als auch im erwähnten lebengeschichtlichen Online-Angebot der NS-Gedenkstätten in NRW und wurde daher übernommen.
3) In der 2015 von Tobias Gerhardus vorgelegten umfangreichen Schulgeschichte wird eine Aufarbeitung der Schicksale aller jüdischen Schülerinnen des Lyzeums als Manko festgestellt. Sie ist bis heute nicht erfolgt.
Pingback: Walter Krämer ist der „Größte“ Siegen-Wittgensteiner | siwiarchiv.de
Medienreaktionen zur Abstimmung:
1) WDR, 9.7.2017
2) Westfälische Rundschau, 10.7.2017
Nachtrag (14:14 Uhr):
3) Focus-online, Nordrhein-Westfalen, 8.7.2017
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 27.6.2017 – 10.7.2017 | siwiarchiv.de
Nachtrag:
Eberhard Bauer gehörte 1991 dem ersten Vorstand des Bad Laaspher Freundeskreises für christlich-jüdische Zusammenarbeit an (Link).
Pingback: Sparkasse Burbach-Neunkirchen unterstützt Ausstellung zur „Alten Vogtei“ | siwiarchiv.de
Heute findet sich in der Siegener Zeitung ein Leserbrief zum Artikel „Walter Krämer auf Platz 1“ (Siegener Zeitung vom 10. Juli):
„Beim Lesen diese Beitrags stellt sich mir die Frage: Wohin driftet unser Land? Da wird ein Walter Krämer – ein überzeugter fanatischer Kommunist und aktiver Kämpfer der „Roten Ruhr-Armee“, deren erklärtes Ziel ein deutscher Sowjet-Staat war – zum „größten“ Siegen-Wittgensteiner erklärt, nur weil er in der KZ-Haft Mithäftlingen, darunter vor allem Gesinnungsgenossen, medizinische Nothilfe hat angedeihen lassen.
Was kommt als Nächstes: Ernst Thälmann als Ehrenbürger der Stadt Siegen? Wohin führt es am Ende , Menschen zu ehren, deren radikales Denken und Handeln sich nicht im Mindesten von dem der Nazis unterschieden hat? Sind wir auf dem Weg in einen Links-Staat?“
Die Formulierung „nur weil er in der KZ-Haft Mithäftlingen, darunter vor allem Gesinnungsgenossen, medizinische Nothilfe hat angedeihen lassen.“ – aber nicht nur diese – erfordert einen ehr flüchtigen Blick in die Quellen.
Grundsätzlich gilt für die Hilfeleistung Krämers in Buchenwald folgende Feststellung: “ … Wer im Lager geholfen hatte, hatte dies nicht als Kommunist getan, sondern als Mensch, der sich das Gefühl für Recht und Würde bewahrt hatte, im Gegensatz zu denen, die es schändeten. ….“ (aus: Ernst Wiechert: Der Totenwald, ein Erlebnisbericht (1946), Frankfurt/Berlin 1963, S. 132).
Folgende Hinweise lassen es als Beispiele aus der großen Anzahl von Berichten zumindentens fragwürdig erscheinen, dass die Behandlung der „Gesinnungsgenossen“ im Zentrum des Handelns von Walter Krämer gestanden hat:
1) “ …. Im März 1939 setzte er [gemeint ist Walter Krämer] eine eine Schutzimpfung aller Häftlinge gegen Typhus durch, indem er die SS davon überzeugt hatte, daß eine Epidemie auch auf die Wachmannschaften übergreifen würde. 1940 und 1941 wurde diese Impfung wiederholt, seit Anfang 1942 wurden alle Zugänge geimpft. … (aus: Klaus Dietermann/Karl Prümm: Walter Krämer. Von Siegen nach Buchenwald, Siegen 1991, S.81).
2) “ …. Und dort [Buchenwald] erhielt er [Fritz Unger] von dem Genossen Walter Krämer, Landtagsabgeordneter aus Kassel, den ersten Parteiauftrag.
Zwei jüdische Kinder waren aus Block 8 zu holen.
Walter Krämer sah den Genossen Fritz Unger an und sagte: „ Ich verlaß mich auf Dich. Du weißt , was auf dem Spiele steht. Kannst du das machen?“
…. Frage ihn heute, den Unger-Fritz, und er erzählt dir ruhig und nüchtern: „Es war nicht leicht. Aber ich hab´s geschafft. Ich hab mitgeholfen, die beiden Kinder zu retten. Das eine war der Seppel Graf aus Offenbach a. M. und der andere, das war der Noah Dreister. Die beiden haben wir auf Block 7 versteckt. Monatelang.“ (aus: Fritz Unger „Und weil der Mensch ein Mensch ist …..“, Hrsg. Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft – Bezirksvorstand Karl-Marx-Stadt, (o. J.), S. 8
3) “ …. Selbst SS-Aufsehern ließ er [Walter Krämer] seine medizinischen Kenntnisse zukommen, so heilte er z. B. den gefürchteten Lagerkommandanten Koch von dessen Syphilis. Dieses Wissen, so wird vermutet, war Anlass ihn und seinen besten Freund und Stellverteter im Lager, Karl Peix, erschießen zu lassen. …..“ Quelle: Aktives Gedenkbuch für die Opfer des Nationalsozialismus im Kreis Siegen-Wittgenstein, Eintrag Walter Krämer
Eine Ergänzung zur Beteiligung Walter Krämers an der Roten-Ruhr Armee: „…. Er beteiligte sich aktiv beim Kapp-Putsch als Mitglied der Roten Ruhr-Armee. Nach kurzer Mitgliedschaft in der USPD trat er 1920 der KPD bei. Er war 1923 in Siegen deren 2. Vorsitzender. Mit 14 weiteren Genossen wurde er noch im selben Jahr verhaftet und 1925 im Leipziger Sprengstoffprozess zu drei Jahren und sechs Monaten Haft wegen Vorbereitung zum Hochverrat verurteilt. Mit seinen Genossen saß er die Haftzeit zum großen Teil in Cottbus ab. Wegen schwerer Krankheit seiner Frau wurde er 1927 freigelassen. ….“ (Quelle: http://aktives-gedenkbuch.de/index.php/Detail/Object/Show/object_id/376). Dies ist also bekannt und wird keineswegs verschwiegen. Mehr noch findet sich in Klaus Dietermann/Karl Prümm: Walter Krämer. Von Siegen nach Buchenwald, Siegen 1991, S. 71: “ ….. Zahlreiche Anekdoten der KPD-Überlieferung ranken sich um die enormen Körperkräfte Walter Krämers. Er, der unbequeme, der Rebell, hat diese beserkerhaften Kräfte sicher zum Einsatz gebracht im Kampf mit den kaiserlichen Offizieren der MArine 1918, in der „roten Armee“ an der Ruhr, in den Saalschlachten und Straßenkämpfen mit der SA in denletzten Jahren der Weimarer Republik, und die Intensität und Totalität des körperhaften Engagements prägte auch seine Tätigkeit als Revierkapo in Buchenwald. ….“
Ich würde Walter Krämer gerne mit einer eigenen Briefmarke Individuell ehren vergleichbar denen, die zum Jubiläum „200 Jahre Kreise Siegen-Wittgenstein“ mit großem Erfolg verausgabt worden sind. Ebenfalls in Betracht käme eine sog. Pluskarte Individuell, das ist eine Ansichtskarte mit auf der Anschriftenseite aufgedruckter Briefmarke. Für die Gestaltung der Ansichtskarte könnte ein Wettbewerb, z.B. in den heimischen Schulen, erfolgen. Der von einer Jury oder der Öffentlichkeit in einer Abstimmung prämierte Siegerentwurf im Ansichtskartenformat 16,2 x 11,4 cm ziert anschließend die Walter-Krämer-Pluskarte. Die Deutsche Post Philatelie könnte hierzu einen passenden Walter-Krämer-Sonderstempel herausgeben und nach Siegen mitbringen.
Finde ich Mitstreiter für meine Idee?
Pingback: Mosaiksteine runden Geschichte Siegens ab | siwiarchiv.de
Der Leserbrief von Gerd Reißfelder in der SZ vom 12. Juli 2017 hat mich veranlasst, hierauf eine Erwiderung zu schreiben, die am 17. Juli 2017 in der Siegener Zeitung als Leserbrief veröffentlicht worden ist.
Das Siegerland kann m.E. stolz darauf sein, im Rahmen der regionalen Erinnerungskultur auf einen Widerstandskämpfer in der NS-Zeit wie Walter Krämer verweisen zu können.
Dies haben auch Siegens Bürgermeister Steffen Mues und der Ex-Landrat Paul Breuer, beide CDU-Mitglieder, erkannt, die sich maßgeblich für die in 2014 erfolgte Bezeichnung des Vorplatzes des Kreisklinikums in Siegen-Weidenau als „Walter-Krämer-Platz“ eingesetzt haben.
Walter Krämer ist im Bewusstsein der hiesigen Bevölkerung längst noch nicht als bedeutender Siegerländer verankert. Daran wird wohl auch das aktuelle Abstimmungsergebnis bei der Wahl zum größten Siegen-Wittgensteiner zunächst nichts ändern.
Arthur Radvansky, ein 2009 verstorbener Jude aus Prag, der für die „Aktion Sühnezeichen“ bei Grabpflegearbeiten auf dem Jüdischen Friedhof in Prag und bei Vorträgen in den Siegerländer Schulen viele Jahre lang Jugendlichen aus dem Siegerland über seine leidvollen Erfahrungen, u.a. in den Konzentrationslagern Buchenwald und Auschwitz, in der NS-Zeit berichtet hat, war ein Zeitzeuge, den Walter Krämer im KZ Buchenwald zweimal operiert hat und dem er dadurch das Leben gerettet hat. Durch seine Aussagen über das Verhalten des KZ-Häftlings Walter Krämer als „Arzt von Buchenwald“ hat er dazu beigetragen, dass dieser von der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem im Jahr 2000 posthum als „Gerechter unter den Völkern“ ausgezeichnet worden ist. Wer – wie ich – einmal die Gelegenheit hatte, sich mit Artur Radvansky während einer Studienfahrt nach Auschwitz über Walter Krämer zu unterhalten, wird dieses Gespräch zeitlebens nicht vergessen und sich auch nach dem Tod dieses Zeitzeugen für ein ehrenhaftes Gedenken an Walter Krämer als gebürtigen Siegener einsetzen.
Als Briefmarkensammler würde ich Walter Krämer gerne nachträglich zum 125. Geburtstag noch mit einer eigenen Briefmarke Individuell ehren, vergleichbar denen, die zum Jubiläum „200 Jahre Kreise Siegen-Wittgenstein“ mit großem Erfolg verausgabt worden sind. Ebenfalls in Betracht käme eine sog. Pluskarte Individuell, das ist eine Ansichtskarte mit auf der Anschriftenseite aufgedruckter Briefmarke. Für die Gestaltung der Ansichtskarte könnte ein Wettbewerb, z.B. in den heimischen Schulen, erfolgen. Der von einer Jury oder der Öffentlichkeit in einer Abstimmung prämierte Siegerentwurf im Ansichtskartenformat 16,2 x 11,4 cm würde anschließend die Walter-Krämer-Pluskarte zieren. Die Deutsche Post Philatelie könnte hierzu einen passenden Walter-Krämer-Sonderstempel herausgeben und nach Siegen mitbringen.
Ich sehe mich als mit beiden Füßen auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehenden Bürger dieses Staates. Ich bin dankbar dafür, mir eine eigene Meinung nicht nur bilden, sondern diese auch, ohne Repressalien befürchten zu müssen, öffentlich kundtun zu können.
Ideologisch bedingte Blindheit auf dem rechten oder linken Auge und stereotype Kriterien behindern, ja verhindern eine ausgewogene Würdigung des Einzelfalles, wenn es um die Frage geht, ob eine Person für eine öffentliche Ehrung in Betracht kommt. Im übrigen ist jede Ehrung nur ein Kind ihrer Zeit und muss sich immer eine kritische Hinterfragung durch zukünftige Generationen unter Berücksichtigung neu hinzugekommener Erkenntnisse gefallen lassen.
Übrigens käme nach meinen bisherigen Erkenntnissen aus meinen heimatgeschichtlichen Forschungen über das Leben von Dr. Tony Riecke (1907 – 1989), einer langjährigen Deuzer Landärztin, die Mitglied in der NSDAP und ihren Untergliederungen war, für sie wegen ihrer unbestrittenen Verdienste in über 50 Jahren als Hausärztin ebenfalls eine Ehrung durch die Benennung einer Straße oder eines Platzes nach ihr in Betracht, z.B. in der Nähe ihrer damaligen Arztpraxis im Umfeld des ehemaligen Deuzer Bahnhofs. Einen Gedenkstein gibt es dort ja bereits. Und noch gibt es genügend Zeitzeugen, die sogar fest davon überzeugt sind, dass Dr. Tony Riecke ihnen durch ihre zutreffenden Diagnosen einmal das Leben gerettet hat.
Wilfried Lerchstein, Heideweg 8, 57250 Netphen-Grissenbach
Folgende Hinweise erfolgten per E-Mail:
“ … [I]n der Bildmitte sieht man Herrn Hans-Jürgen Beineke, ehem. KT-Mitglied, ehem. Landrat/stellv. LR.
Der zweite Herr von rechts ist Herr Kreisdirektor Volker Behnsen.
Der Herr ganz links könnte Herr Stadtverordneter Prof. Dr. Karl-Heinz Ostholthoff, Stadt Siegen, sein (VWL-Professor an der Uni-GH Siegen). ….“
Es verwundert doch sehr, wie Herr Lerchstein vorschlägt, Dr. Tony Riecke mit der Benennung einer Straße oder eines Platzes zu ehren. Wie in den Ausführungen korrekt angegeben, war Riecke während des NS Mitglied der NSDAP und weiterer NS-Organisationen. Laut dem Regionalen Personenlexikon zum Nationalsozialismus in den Altkreisen Siegen und Wittgenstein war sie Untergaugruppenführerin in der NS-Frauenschaft, Mitglied im BDM, Mitglied im Nationalsozialistischen Deutschen Ärztebund. Sie engagierte sich in den Organisationen, in denen sie Mitglied war. Dies legt eine Mitgliedschaft aus politischer Überzeugung nahe und geht über ein passives „Mitläufertum“ hinaus.
Es ist absolut inakzeptabel, eine solche Person, die sich während eines Teils ihres Lebens für die Unterstützung einer rassistischen und menschenverachtenden Diktatur engagiert hat, mit der Benennung einer Straße oder eines Platzes zu ehren. Diese Ehrungen sollten Persönlichkeiten vorbehalten bleiben, die eine absolut reine Weste haben und mit ihrer gesamten Persönlichkeit und ihrem gesamten Lebenslauf als Vorbild dienen. Bei Frau Dr. Riecke kann ich dies nicht sehen, auch wenn sie nach dem Krieg eine engagierte Landärztin gewesen sein soll. Das genügt für eine Ehrung nicht.
Der Herr ganz links ist der ehem. Landrat des Kreises Siegen, Wilhelm Kettner!
Ich danke Herrn Panthöfer für seine Meinungsäußerung. Vor Beginn meiner Recherchen zum Leben von Dr. Tony Riecke hätte ich wahrscheinlich ähnlich Stellung bezogen. Je mehr ich über sie in Erfahrung gebracht habe, um so differentierter stellte sich jedoch für mich die Beurteilung dieser Ärztin dar. Ihr 1934 in Meschede 85-jährig verstorbener Großvater Dr. Emil Scholand, in dessen Haushalt sie viele Jahre ihrer Kindheit und Jugend verbracht hat, hat sie maßgeblich bei der Berufswahl beeinflusst. Er war in Meschede ebenfalls 52 Jahre lang Landarzt. Er war die zweite Persönlichkeit, die zum Ehrenbürger der Stadt Meschede gewählt worden ist. Wie hätte dieser Mann sich verhalten, wenn er zwei Generationen später geboren worden wäre, war mein erster Gedanke. Von der Wesensart her lagen er und seine Enkelin wohl sehr nahe beieinander. In meiner Abhandlung über Dr. Tony Riecke ist nachzulesen: „Aus Überzeugung trat Dr. Riecke 1933 als Mitglied Nr. 3.902.800 in die NSDAP ein und gehörte seit 1935 dem Nationalsozialistischen Deutschen Ärztebund (NSDÄB) an. Sie war seit 1937 in Deuz die Ortsleiterin der NS-Frauenschaft und seit 1938 Untergaugruppenführerin im Bund Deutscher Mädel (BDM). Während des 2. Weltkriegs war sie die verantwortliche Ärztin für die Kriegsgefangenen und zivilen Zwangsarbeitskräfte in verschiedenen Betrieben (u. a. Siegas in Rudersdorf und Walzengießerei Hermann Irle in Deuz). 1947 erfolgte ihre Entnazifizierung in der geringst belasteten Kategorie „Mitläuferin“, zunächst mit und 1948 dann ohne Vermögenssperre. (Regionales Personenlexikon zum Nationalsozialismus in den Altkreisen Siegen und Wittgenstein; URL: http://akteureundtaeterimnsinsiegenundwittgenstein.blogsport.de/a-bis-z/gesamtverzeichnis/2/#riecke )
Über diese Zeit berichtete sie: “Als einziges, stets vorhandenes Vitaminmittel benutzte ich Wiesenkraut und Kartoffelpresssaft, vor allem in den Gefangenenlagern. Kein kriegsgefangenes Kind hatte ernsthafte Gesundheitsstörungen.“ Eine aus Salchendorf stammende Frau erinnerte sich daran, dass Dr. Riecke ihre Mutter um Essen für die Zwangsarbeiterkinder gebeten und auch etwas erhalten hat. Im Aktiven Gedenkbuch für die Opfer des Nationalsozialismus im Kreis Siegen-Wittgenstein ist bis dato auch kein im Zuständigkeitsbereich von Dr. Riecke verstorbenes Kind von Zwangsarbeitern aufgeführt. (URL: http://aktives-gedenkbuch.de/index.php/Search/Index?search=Kind)“
Mir war natürlich bewusst, dass ich mit meiner Anregung eine kontroverse Diskussion in der Öffentlichkeit anstoßen würde. Das war aber auch beabsichtigt. Eine pauschale Beurteilung von Dr. Riecke nur nach den bisherigen Aktenunterlagen aus der NS-Zeit greift meines Erachtens einfach zu kurz. Ich würde es daher sehr begrüßen, wenn von dritter Seite noch weitere Informationen über ihr Verhalten in der NS-Zeit zusammengetragen werden.
Werner Schulte gab den Hinweis:
v.l.n.r.: Willi Kettner, Hans Mohn, Hans-Jürgen Beinecke, Siegfried Förster, Volker Behnsen, Karl-Heinz Forster
Vielen Dank für die Liste! Wenige Ergänzungen zu den Personen:
1) Willi Kettner
2) Hans Mohn, Stadtdirektor in Siegen von 1975 – 1985
3) Siegfried Förster, Bürgermeister der Stadt Siegen in den 70er Jahren
4) Volker Behnsen (1933 – 2017), Kreisdirektor des Kreises Siegen(-Wittgenstein), 1972 – 1992
@ alle: Vielen Dank für die Hinweise!
Pingback: Neue stadtgeschichtliche Sammlung des Siegerlandmuseums im Oberen Schloss | siwiarchiv.de
Pingback: Vom Werden des Gemeindearchivs Neunkirchen | siwiarchiv.de
Pingback: Verlängerung: Ausstellung „125 Jahre Turnverein Allenbach in Bildern, Dokumenten und Requisiten“ | siwiarchiv.de
Pingback: Kreisarchiv bittet um Mithilfe 2 | siwiarchiv.de
Pingback: Dr. Dr. Karl Neuhaus – (k)ein Mann des 20. Juli/2 | siwiarchiv.de
Hinter Vitt steht meiner Meinung nach Werner Möhl damals DGB-Kreisvorsitzender
Werner Möhl war auch Landrat von Wittgenstein.
Danke für die Hinweise! Zu Landrat Werner Möhl liegen dem Kreisarchiv folgende Informationen vor. Das Bild mag erklären, warum wir ihn nicht erhannt haben: Lebenslauf Möhl (PDF).
Auf Nachfrage teilt das Archiv des Liberalismus heute via Facebook mit:
“ ….[B]ei dem Herren (2.v.l.) handelt es sich definitiv nicht um Horst-Ludwig Riemer. Dieser hatte u.a seinen Haarscheitel immer auf der anderen Seite. ….
Leider konnten wir auch nicht ermitteln, wer die besagte Person ist…..“
Diether Denecke ist der gesuchte Minister: https://de.wikipedia.org/wiki/Diether_Deneke . Vielen Dank in die geschlossene Facebook-Gruppe „Archivfragen“!
Guten Tag, wir haben damals zusammen in der Familie einen Kelimteppich erstellt, bzw. 2, der lag eine Zeitlang bei uns in den Zimmern. Er hatte dieses großflächige Muster. Das dicke Garn wurde mit einer großen Nadel entweder unter oder über das vorgegebene Muster gezogen. Zum Schluss hat meine Mutter die Rückseite mit einem stabilen Tuch versehen, damit es hält. Die Teppiche sind ca. 30 – 40 cm breit und ca. 1 m lang. So eine Art Läufer. Wenn Sie interessiert sind, melden Sie sich bitte. Mit freundlichen Grüßen Hannelore Gerstmann
Pingback: Kreisarchiv bittet um Mithilfe 3 | siwiarchiv.de
Die Aufstellung der Personen stimmt aber nicht mit der Bezeichnung „v.l.“ überein, „v.r.“ ist richtig – oder muss das Bild gespiegelt werden?
Danke! Beschriftung ist geändert worden …..
Pingback: Kreisarchiv bittet um Mithilfe 3 | siwiarchiv.de
Pingback: Aus dem Fotoarchiv des Kreises: Bau der Obernautalsperre | siwiarchiv.de
Zum Leserbrief „Wohin driftet das Land?“ (Siegener Zeitung vom 12. Juli) – s. o. – erschien heute in der Siegenr Zeitung ein weiterer Leserbrief:
„Herrn Reißfelders Geschichtsverständnis offenbart klaffende Lücken in der Kenntnis der historischen Entwicklung unseres Landes. Der Autor stört sich an einer Mehrheitsentscheidung, durch die – in Zeiten eines europäischen Rechtsrucks – der kommunistisch motivierte Humanist Walter Krämer zum größten Sohn Siegen-Wittgensteins gewählt wurde. Hierbei versucht Reißfelder, Krämers Kampf in der Roten Ruhrarmee 1920 zu skandalisieren. Herr Reißfelder missdeutet die Rote Ruhrarmee als eine Moskauer Einflussagentur, die einen „deutschen Sowjet-Staat“ zu errichten suchte. Die Rote Ruhrarmee war jedoch ein Zusammenschluss sozialdemokratischer, linkssozialistischer, kommunistischer und in christlichen Gewerkschaften organisierter Arbeiter zur Abwehr eines Militärputschversuches, der aus Deutschland einen autoritären Ständestaat machen wollte. Die Einheit der arbeitenden Menschen rettete die Republik.
Das Wirken des Kommunisten Krämer steht für diese demokratiefördernde Einheit von 1920, welche fatalerweise in den Schicksalsjahren 1932 und 1933 fehlte. Das Ausbleiben eines vergleichbaren Zusammengehens in der Endphase der Weimarer Republik führte letztendlich dazu, dass die Nazis Menschen in Konzentrationslagern quälen konnten, und zwar nicht nur Krämers „Gesinnungsgenossen“, wie sich Herr Reißfelder despektierlich und pietätlos ausdrückt. Wer diese historische Lehre der deutschen Geschichte ignoriert, sollte sparsam mit hysterischen Zukunftsprognosen umgehen.
Erinnert sei noch daran, dass in Siegen mit Namen wie Hindenburg und Fissmer nach wie vor Personen eine öffentliche Ehrung erfahren, die – anders als Krämer – den Nazis den Weg bereiteten oder diese unterstützten.
Hermann Hoffmann, Herdorf“
Das Foto wurde anlässlich der Inbetriebnahme der Obernautalsperre am 07.11.1972 gemacht.
Von links: Herrmann Schmidt (Landrat Kreis Siegen), Diether Deneke (Landwirtschaftsminister NRW), Werner Möhl (Landrat Kreis Wittgenstein), Hans-Georg Vitt (MdL) und Karlheinz Forster (Kreisdirektor Altkreis Siegen).
Die Herren stehen vor dem Schieberhaus am Fuße des Dammes.
Ich war damals auch dabei, aber Achtjährige durften nicht mit aufs Foto…
Vielen Dank für die Beschreibung des Anlasses!
Gerne. War ja quasi ein Heimspiel für mich…
Ich denke mal, zwischen 1967 und 1972. Ich kenne aber keine der anderen Personen.
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 11.7. – 24.7.2017 | siwiarchiv.de
Ein Blick auf die Ausstellungsvitrine erlaubt dieses Video auf youtube: https://youtu.be/HxkE_TGmKBs
Ein Blick in die Ausstellung erlaubt dieses Video auf youtube: https://youtu.be/6ZdRA9l7FQE
Ein Teil der Gäste macht einen „undeutschen“ Eindruck.
Es könnte sich um eine Delegation aus dem Partnerkreis Emek Hefer handeln. Dazu könnte es beim Kreis Vergleichsfotos geben.
Die etwas im Hintergrund stehende Dame könnte auch eine
Übersetzerin gewesen sein.
Pingback: Heinz Kuhbier, Siegener Oberkreisdirektor von 1964-1972 – ein Lebenslauf | siwiarchiv.de
Pingback: Kreisarchiv bittet um Mithilfe 4 | siwiarchiv.de
Guten Tag, ich muss an meinen Kommentar zu „Mithilfe 3“ erinnern, auch hier wieder links und rechts bei der Bildunterschirft vertauscht – oder? Und im Text darunter Althaus neben Forster (1.v.l., lt. Bildbeschriftung): Wo ist nun Althaus: beim Bild ist Althaus 1.v.l., laut Text aber zweiter 2.v.r., aber Forster ist tatsächlich 1.v.r. (ihn erkennen wir aus früheren Fotos) und Althaus wo?. Vielleicht ist dieser kleine Fehler ja auch strukturell bedingt und in den Unterlagen so vorgegeben, dann ist er auch aus archivischer Sicht dauerhaft erhaltenswert!
… und wer ist eigentlich die Frau (1.v.l.)?
1) Vielen Dank für den Hinweis! Die Bildunterschrift wurde entsprechend geändert.
2) „Neben“ im Text des Eintrages ist im Sinne von „zugleich mit“ zu verstehen. Ich bitte die dadurch entstandene Irritation zu entschuldigen.
3) Gerne darf auch die Frau im Hintergrund 1. v.l. identifiziert werden …..
Pingback: Kreisarchiv bittet um Mithilfe 4 | siwiarchiv.de
Pingback: Kreisarchiv bittet um Mithilfe 4 | siwiarchiv.de
Es handelt sich wohl um:
Hans Eitel Plato Eustach Graf von Görtz-Wrisberg, geb. 17. Dez. 1856, gest. 6. Nov. 1914), verh. am 14.10.1902 in London mit Augusta Giller, geb. Kassel, 13. Juni 1865 – gest. Eisenbach, 2. Okt .1942).
Zu Eustach Graf von Görtz-Wrisberg liegt eine Prüfungsakte im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin vor: I. HA Rep. 125, Nr. 1636
(Ober-Examinationskommission bzw. Prüfungskommission für höhere Verwaltungsbeamte >> 02 Prüfungswesen >> 02.02 Einzelne Prüfungen, A – Z >> 02.02.07 Einzelne Prüfungen, G), Laufzeit:1885).
Der Herr links von Herrn Forster ist Dr. Diether Posser.
Der Herr mit der Augenklappe müßte auch zum Kabinett Kühn gehören. Er ist auf einem Foto zu sehen in dem Buch „Portrait einer Stadt Hüttental“.
Rechts neben Karl Althaus müßte Werner Figgen sein (Arbeits- und Sozialminister)
Vielen Dank für die Hinweise! Ein Blick in das Bildarchiv des Landtags bestätigen die Angaben. Damit kann man den Zeitpunkt der Bildaufnahme zwischen Sept. 1968 (Einttritt Possers in die Landesregierung) und Dez. 1974 (Ende der Amtszeit Karl Althaus) vermuten.
Wenn der Herr mit der Augenklappe Kabinettsmitglied war, dann könnte es sich um Josef Neuberger oder um Fritz Kassmann handeln …..
Hallo;
Hinweis: dieser Link funktioniert nicht:
http://www.siwiarchiv.de/2013/08/sommerwettbewerb-eine-archivische-bildergeschichte/.
Danke für den Hinweis! Link wurde entsprechend aktualisiert. Der Grund für das ins Leere laufen ist eine geänderte Konfiguration der Permalinks.
Pingback: Kreisarchiv erhält Bücher zur Kreisgeschichte. | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik Juli 2017 | siwiarchiv.de
Weitere Personen aus der Region, die in Auschwitz-Birkenau umgebracht wurden, finden sich in den „Sterbebüchern von Auschwitz. Fragmente. Namensverzeichnis A-Z, hrsg. vom Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau, Red. Jerzy Debski u.a., München u.a. 1995“. Einfach nach Nachnamen oder nach Ortsnamen suchen. Unter dem Suchbegriff „Berleburg“ werden z.B. etliche Personen nachgewiesen.
Pingback: Kreisarchiv bittet um Mithilfe 5 | siwiarchiv.de
Die Aufnahme wurde im damals neuen Kreishaus im Sitzungssaal (heute Raum 1317) aufgenommen. Der zweite Herr von rechts könnte (!) Kreisdirektor Volker Behnsen sein, allerdings deutet das Wappen auf der Krawatte eher auf einen Vertreter der Stadt Siegen. Rechts neben Forster könnte (!) der Siegener Bürgermeister Hans Reinhardt sein, obwohl ich den nur mit Brille kenne.
Bei den Bezirksbürgermeistern aus Spandau hätten wir aufgrund der zeitlichen Eingrenzung die Wahl zwischen Herbert Kleusberg oder
WalterWerner Salomon.Auf den Tag genau 4 Jahre und 5 Monate später ist es sicher an der Zeit, eine kleine Korrektur anzubringen: Der Spandauer Bezirksbürgermeister Salomon hieß Werner, nicht Walter. Ob er der Herr mit dem Berliner Bären auf Revers und Krawatte ist, würde eine Anfrage beim Bezirksamt Spandau / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sicher unschwer ergeben, zumal diese Abteilung ohnehin für die Pflege der Städtepartnerschaften zuständig ist. Nur Mut, lieber Herr Wolf, die Berliner beißen nicht (wenn sie auch manchmal knurren).
Danke für den Hinweis auf den Flüchtigkeitsfehler bei Werner Salomon! Ein Blick in die europeana lässt die Vermutung zu, dass es sich um Herbert Kleusberg handelt: https://www.europeana.eu/en/item/2022037/11088_B44074EA_F21E_4769_9070_8799358D18ED . Kleusberg war wohl Brillenträger, Salomon wohl eher nicht.
Na ich weiß nicht … Gesichtsvergleiche waren noch nie meine Stärke. Wenn das Bild genau 1979 entstand: Das war Kleusbergs letztes Amtsjahr vor der Pensionierung. Er war 65 Jahre alt, Salomon 53. Altersschätzungen sind aber auch nicht meine Stärke. Für Salomon könnte sprechen, dass er vielleicht einen Antrittsbesuch in der Partnerstadt Siegen absolvieren wollte. Und nachgewiesener Brillenträger war er auf jeden Fall in späteren Lebensjahren. Aber womöglich ist der Herr noch jemand ganz anderes gewesen (Stellvertreter?). Wie gesagt, die Spandauer können sicher problemlos helfen und unseren müßigen Spekulationen ein Ende setzen.
Danke für die Hinweise! Im Bildarchiv des Landtages NRW liegen Bilder von Hans Reinhardt, die ihn ohne Brille zeigen und Ihre Vermutung stützen. Wenn es also Reinhardt ist, dann dürfte die Aufnahme wohl zwischen 1979 (in diesem Jahr ist Reinhardt erster
OberbBürgermeister der Stadt Siegen geworden) und 1983 (dem Todesjahr Hermann Schmidts) entstanden sein.Es ist definitiv Hans Reinhardt. Das Foto könnte ihn aber auch in seiner Zeit als Landtagsabgeordneter bzw. als Beigeordneter der Stadt Siegen zeigen. Dann hätte er bei diesem Termin den Bürgermeister Friedemann Keßler vertreten. Oberbürgermeister der Stadt war Reinhardt übrigens nie. Diesen Titel trug meines Wissens zuletzt Friedemann Keßler.
Vielen Dank für die Korrektur! Reinhardt war der erste erste Bürgermeister!
Gefühlt der Allererste…
Ja, die Eingrenzung von Herrn Wolf passt schon. Das „neue“ Kreishaus wurde nach meiner Erinnerung 1978 bezogen.
Zwischen den Köpfen von Hans Reinhardt und Karl-Heinz Forster ist der Stadtverordnete Horst Hellmann zu sehen.
Danke für die Information!
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 25.7. – 7.8.2017 | siwiarchiv.de
Für Traditionalisten ist die analoge Fassung natürlich im Stadtarchiv Siegen einzusehen, in verschiedenen Ausgaben u.a. auch bebildert (Mehrwert!).
Vielen Dank für die Information! Es wird doch sicherlich noch mehr im Stadtarchiv zum Kriegerdenkmal geben: Akten, Protokolle der Stadtverordnetenversammlung, Zeitungsberichte und Fotos?
Eigentlich hatte ich das Digitalisat wegen des passenden Termins und wegen der Tatsache eingestellt, dass dies nicht, wie sonst auf siwiarchiv üblich, den Beständen der Landesbibliothek in Münster entnommen wurde, sondern vielmehr dem rheinischen Pendant in Düsseldorf. Also: es lohnt auch ein Blick in die dortigen digitalen Bestände, um sich ggf. für einen Archivbesuch vorzubereiten.
Pingback: Theaterhinweis: „GLUT. Siegfried von Arabien“ Nibelungenfestspiele Worms | siwiarchiv.de
Pingback: Aktuelle Bestandsliste des Kreisarchivs Siegen-Wittgenstein online | siwiarchiv.de
Pingback: Kreisarchiv bittet um Mithilfe 6 | siwiarchiv.de
Zwischen Vomhof und Forster ist Kreisdirektor Volker Behnsen zu sehen. Der Herr rechts von Forster kommt mir sehr als Kreistagsmitglied aus meiner Erinnerung. Vielleicht Hans Berner, seinerzeit m. W. auch mal stellvertretender Landrat?
Zwischen Kettner und Vomhof ist angeschnitten das Profil von Hans-Jürgen Beineke, Kreistagsmitglied, erkennbar.
Vielen Dank für die Informationen! In einer geschlossenen Facebook-Gruppe erfolgte übrigens bereits die Bestätigung, dass es sich bei dem Mann rechts neben Forster um Hans Berner, der von 1961 bis 1994 dem Siegener Kreistag angehörte, handelt. Von 1975 bis 1984 war er, wie Sie richtig schreiben, stellvertretender Landrat des Kreises Siegen(-Wittgenstein).
Pingback: Matthias Plaga-Verse: „Gehorche der Obrigkeit und laß die andern über sie streiten.“ | siwiarchiv.de
Pingback: Heute vor 68 Jahren: 1. Bundestagswahl in den Kreises Siegen und Wittgenstein | siwiarchiv.de
Pingback: Heute vor 68 Jahren: 1. Bundestagswahl in den Kreisen Siegen und Wittgenstein | siwiarchiv.de
Pingback: Kreisarchiv bittet um Mithilfe 7 | siwiarchiv.de
Pingback: Kreisarchiv bittet um Mithilfe 7 | siwiarchiv.de
Würde auf Blefa oder Schäferwerke tippen. Beides Hersteller von Getränkebehältern b.z.w Fässern wie man Sie im Hintergrund sieht. Personen sind mir leider nicht bekannt
Ja, ich tippe auf die Schäfer-Werke GmbH auf dem Pfannenberg. Ich denke, die Person rechts von Forster ist der geschäftsführende Gesellschafter Theo Schäfer, Herr Forster pflegte stets einen sehr guten Kontakt zu ihm (bis heute). Der Logik folgend wäre dann die Person links ein angestellter Geschäftsführer oder Prokurist. Von der Statur und dem Alter her könnte das auch Theo’s Bruder Gerhard Schäfer sein, aber ich finde, die Gesichtszüge passen nicht.
s. a. Pressemitteilung der Universität Siegen, 17.8.2017:
„Blick auf das Bundeskanzleramt
….
Die Bundesregierung lässt die NS-Vergangenheit zentraler Behörden in Deutschland erforschen und fördert zu diesem Zweck zehn Projekte. Eines der Forschungsprojekte ist an der Universität Siegen angesiedelt und richtet den Blick auf das Bundeskanzleramt. Die Historiker Professorin Dr. Angela Schwarz und Dr. Heiner Stahl analysieren in den kommenden Jahren die Praktiken des Bundeskanzleramts in der Nachkriegszeit – ein Thema, das noch nie systematisch untersucht worden ist. Der Titel ihres Projekts lautet: „Kontaktzone Bonn: Praktiken öffentlicher Kommunikation und Verlautbarung in der frühen bundesrepublikanischen Mediendemokratie (1949-1969)“. Das Forschungsprojekt wird mit 250.000 Euro gefördert.
„Es ist ein Trugschluss zu denken, dass mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 die Stunde Null begann“, sagt Projektleiterin Prof. Schwarz. Im Bundeskanzleramt als Schaltzentrale der Regierung habe man sich – wie in anderen Bundesämtern und Regierungsstellen – nach 1949 nicht zwangsläufig völlig von der NS-Zeit abgekehrt. Es habe zum einen gewisse personelle Kontinuitäten gegeben. Zum anderen hätten Akteure gewisse Praktiken zuvor über Jahre und Jahrzehnte eingeübt. „Strukturen und Verfahren, die unter dem NS-Regime angewandt worden waren, sind nach 1949 nicht einfach verschwunden“, erklärt Prof. Schwarz. Das beginne etwa bei bewährten Formen der Kontaktaufnahme, ginge über Netzwerkpflege und Informationsübermittlungen bis hin zur Einbindung der PressevertreterInnen bei Gala-Dinners oder Reisen. Auf der anderen Seite standen die JournalistInnen als Empfänger, die die angebotenen Informationen wiederum innerhalb ihrer Rahmenbedingungen umzusetzen hatten. Dieses Wechselspiel zwischen einem sich etablierenden Bundeskanzleramt und der sich in der Demokratie neu formierenden Presse steht im Mittelpunkt des Forschungsprojekts der Uni Siegen.
Prof. Schwarz möchte dabei außerdem untersuchen, wie der Westen die Presse- und Medienlandschaft im Zeitraum von 1949 bis 1969 beeinflusst hat – es geht sozusagen um die „mediale Westbindung“. Das Forscherteam analysiert zum Beispiel, wie sich neue Erkenntnisse aus Massenpsychologie und Werbetechniken auf die Nachkriegsmedien auswirkten. „Mich freut besonders, dass die Universität Siegen neben finanziell und personell gut ausgestatteten Institutionen mit ihrem Antrag Erfolg hatte“, sagt Schwarz.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters hatte das Forschungsprogramm ausgeschrieben. Insgesamt stehen Fördermittel in Höhe von 4 Millionen Euro für den Zeitraum 2017 bis 2020 zur Verfügung. Die Auswahl der Projektanträge erfolgte auf der Grundlage des Votums einer siebenköpfigen Expertenkommission aus unabhängigen WissenschaftlerInnen, die die Kulturstaatsministerin berufen hatte. Wegen der ressortübergreifenden Bedeutung des Bundeskanzleramts wird es zu dessen Geschichte gleich zwei Forschungsprojekte geben – eines von der Universität Siegen und ein weiteres vom Institut für Zeitgeschichte in München gemeinsam mit dem Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam.
Kontakt
Univ.-Prof. Dr. Angela Schwarz
Geschichte – Neuere und Neueste Geschichte, Universität Siegen
Telefon: 0271 740-4606 (-4502 Sekretariat)
E-Mail: schwarz@geschichte.uni-siegen.de„
Es lohnt sich ein Blick in die Unternehmensgeschichte der Schäfer-Werke im Internet. Da gibt es einen Button „Unternehmensgeschichte“ oder so ähnlich, da findet man alte Aufnahmen der Brüder Schäfer und kann sie mit den Herren links und rechts von Forster vergleichen.
Pingback: Wittgenstein 2 (2017) erschienen | siwiarchiv.de
@Elke Hofmann
@Reinhard Kämpfer
Vielen Dank für die Hinweise! Beim ersten Betrachten des Bildes habe ich zunächst direkt an die Blefa-Werke in Kreuztal gedacht – aus archivischen Gründen liegen diese mir etwas näher.
In der Facebook-Gruppe „Siegerland in alten und neuen Bildern“ wurde allerdings Ihre Vermutung, dass es sich um die Neunkirchener Schäfer-Werke handelt, bestätigt.
Die Firmenegeschichte – da sind Sie mir zuvor gekommen, Herr Kämpfer – kann man unter diesem Link einsehen: https://www.ssi-schaefer.com/resource/blob/12740/204c6b8c740bd82ceb0644702c95e4a3/broschuere-deutsch–75-jahre-ssi-schaefer-jubilaeumsbroschuere-2012–dam-download-de-1714–data.pdf . Zur Identifikation der Personen ist sie m. E. leider nur bedingt hilfreich.
Sie können auch Frau Annette Pritz, Referat Landrat, befragen. Sie war ja sehr lange Jahre Sekretärin und persönliche Referentin von Herrn Forster und hat sicherlich so manchen Termin auch persönlich begleitet.
Das Foto mit den vier Schäfer-Brüdern habe ich unter folgendem Link gefunden:
http://www.schaefer-werke.de/de/ueber-uns/geschichte/
Zumindest bei Theo Schäfer ist eine deutliche Übereinstimmung festzustellen. Bei Gerhard Schäfer bin ich mir auch nicht sicher, zumal die Familienmitglieder ja nicht so gut miteinander harmoniert haben.
Ich würde mich in der nächsten Zeit gerne mit Ihnen treffen habe einiges an Bilder gefunden
Pingback: Heute: Eine archivische Hilfsaktion II. | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 8.8. – 21.8.2017 | siwiarchiv.de
Pingback: Kreisarchiv bittet um Mithilfe 8 | siwiarchiv.de
Pingback: Kreisarchiv bittet um Mithilfe 8 | siwiarchiv.de
Beim Schulleiter handelt es sich m.E. um Dieter Reinschmidt.
Stimmt! s. z. B. hier: Pressemittlung der Kreisverwaltung zur Verabschiedung Reinschmidts als Leiter der Sprengstofftechnischen Lehrgänge, 13.12.2016
OStD Dieter Reinschmidt, BK Technik, Einweihung eines neuen Elektrotechnik Labors.
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik August 2017 | siwiarchiv.de
Pingback: 2. Wittgensteiner Museumsnacht | siwiarchiv.de
Pingback: Publikation zur Reformation im Netpherland | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 22.8. – 4.9.2017 | siwiarchiv.de
Pingback: „Spaß mit Flaggen“ II | siwiarchiv.de
Die in der Miszelle erwähnte Schrift J. J. Vorländers „Die Waldwirthschaft im Wiehen-Gebirge“ (https://books.google.de/books?id=pJ5XAAAAcAAJ) enthält auch ein Gutachten seines Bruders Friedrich, Stifts-Oberförster in Allenbach/Keppel und ehemals Kreis-Haubergs-Oberförster. Für forstgeschichtlich interessierte Siegerländer also nicht ganz uninteressant.
Danke für den Hinweis! Vermutlich war Johann Jakob Vorländer (geb. 1773) der Vater der beiden: https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction.action?detailid=v5751153 . Dem steht allerdings Lothar Irles Angabe (Persönlichkeitenlexikon, S. 356) entgegen, dass Johann Jacob (geb. 1752 in Oberndorf, Vater herrschaftlicher Jäger und von 1785 bis 1815 Stiftsjäger zu Stift Keppel) der Vater der beiden war.
Hans Rudolf Lavater weist in seinem Blog – http://www.hr-lavater.ch/2017/09/10/leitfaden-papier-und-wasserzeichen/ – am 10.9.2017 auf folgende Online-Publikation hin: Neil Harris : Paper and Watermarks as Bibliographical Evidence, Lyon 2017, 157 S. → http://ihl.enssib.fr/en/paper-and-watermarks-as-bibliographical-evidence (PDF). Netterweise bebildert er seinen Beitrag mit einem der obigen Bilder. Danke!
Die Lebensdaten des Vaters „1752-1823“ finden Bestätigung bei Wilhelm Hartnack, Stift Keppel im Siegerland 1239-1951, Band 3, S. 420.
Die Genealogie ist wegen der Vornamenvergabe etwas verwirrend. Johann Henrich Vorländer (um 1709 – 1786) war zweimal verheiratet. Sohn aus erster Ehe: Johann Henrich (1746-1825); Sohn aus zweiter Ehe: Johann Jacob (1752-1823). Johann Henrich d. J. hatte einen Sohn Johann Jacob (1773-1831); Johann Jacob d. Ä. hatte die Söhne Johann Jacob und Friedrich. Der in der Hessischen Verzeichnung genannte J.J.V. war also ein Halbcousin (falls es das Wort geben sollte) des Geodäten und Haubergs-Oberförsters.
2. von rechts ist Hans Berner, ehem. Vors. des Seniorenbeirats Siegen
Danke für die Ergänzung zur Person Berners!
Da der o.g. Autor Dr.-Ing. e.h. Albert Pfitzer (2. Juli 1882 – 30. Juni 1948) bereits mehr als 70 Jahre tot ist, habe ich dessen grundlegenden Beitrag aus der nur über US-Proxy zugänglichen Digitalisierung der ZfV von 1913 vom HathiTrust (https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015067173610) ins Internet Archive transferiert: https://archive.org/details/pfitzer_rheinisch-westf-kataster_zfv-1913.
Vielen Dank für diese Information und die Transferierung!
Pingback: „Schusterschlacht“ lockte am Wochenende viele Besucher nach Netphen | siwiarchiv.de
Das Stadtarchiv Hilchenbach verweist völlig zu Recht auf die Archive der Siegener Zeitung und des Mindener Tageblatt zur Erforschung der Biographie J.J. Vorländers.
Dieser Tage ist auch das Standerdwerk über Jung-Stilling neu erschienen:
Gerhard Merk:
Jung-Stilling. Ein Umriß seines Lebens, 5. Auflage.
Siegen (Jung-Stilling-Gesellschaft) 2017
Online zu bestellen bei der Adresse:
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/buchshop.htm
Danke für den Hinweis!
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 5.9. – 18.9.2017 | siwiarchiv.de
Jost Schmid-Lanter, Zentralbibliothek Zürich, weist zu Recht auf seinem ebenfalls online greifbaren Aufsatz hin: „A previously unknown likeness of the St. Gallen Globe: New speculations about his origins“, in: Journal of International Map Collector´Society, Spring 2016 No. 144, S. 12 – 21, Link: https://www.zb.uzh.ch/Medien/spezialsammlungen/karten/b_imcos_ausgabe_144_low_res.pdf
Den Wissensstand zum Globus bis zum Jahr 2009 scheint wohl diese Publikation zu dokumentieren:
Martina Rohrbach, Beat Gnädinger (Hg.): Der Zürcher Globus
Projekt Globus-Replik 2007–2009, Dokumentation, Link: https://staatsarchiv.zh.ch/internet/justiz_inneres/sta/de/ueber_uns/veroeffentlichungen/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/download.spooler.download.1282816347217.pdf/Globus_Doku_1_0.pdf
Pingback: Präsentation zur Geschichte der Siegener Nikolaikirche | siwiarchiv.de
Pingback: Fotoeindrücke von der Ausstellung »Deutsche aus Russland.“ | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 19.9. – 2.10.2017 | siwiarchiv.de
Pingback: Bilder des LYZ – Aus der Fotosammlung des Kreisarchivs 1 | siwiarchiv.de
Pingback: Bilder des LYZ 1 – Aus der Fotosammlung des Kreisarchivs | siwiarchiv.de
Kann man weitere der historischen Photographien hier auf der Website sehen?
Ja, nicht umsonst befindet sich im Titel die Ziffer 1. ;-)
Meine Tante, die Schwester meines Vaters, war im „Gänseaquarium“ , so nannte man damals auch das Lyzeum, als Putzfrau beschäftigt. Ich habe sie dort bei ihrer Arbeit nur einmal besucht. Da war ich so 5 Jahre alt. Heute bin ich 73. Vor 20 Jahren als gebürtiger und dort gelebter Siegener nach Tschechien ausgewandert. Habe nicht nur E-Mail, auch Skype.Nodda.
Pingback: Bilder des LYZ 2 – Aus der Fotosammlung des Kreisarchivs | siwiarchiv.de
Pingback: Bilder des LYZ 3 – Aus der Fotosammlung des Kreisarchivs | siwiarchiv.de
Pingback: Vortrag „700 Jahre urkundliche Ersterwähnung der Nikolaikirche“ | siwiarchiv.de
Pingback: Bilder des LYZ 4 – Aus der Fotosammlung des Kreisarchivs | siwiarchiv.de
Pingback: Bildes des LYZ 5 – Aus der Fotosammlung des Kreisarchivs | siwiarchiv.de
Pingback: Bilder des LYZ 6 – Aus der Fotosammlung des Kreisarchivs | siwiarchiv.de
Pingback: Bilder des LYZ 6 – Aus der Fotosammlung des Kreisarchivs | siwiarchiv.de
Pingback: Bilder des LYZ 5 – Aus der Fotosammlung des Kreisarchivs | siwiarchiv.de
Pingback: Bilder des LYZ 5 – Aus der Fotosammlung des Kreisarchivs | siwiarchiv.de
Pingback: Bilder des LYZ 6 – Aus der Fotosammlung des Kreisarchivs | siwiarchiv.de
Pingback: Bilder des LYZ 4 – Aus der Fotosammlung des Kreisarchivs | siwiarchiv.de
Pingback: Bilder des LYZ 5 – Aus der Fotosammlung des Kreisarchivs | siwiarchiv.de
Pingback: Bilder des LYZ 6 – Aus der Fotosammlung des Kreisarchivs | siwiarchiv.de
Pingback: Bilder des LYZ 3 – Aus der Fotosammlung des Kreisarchivs | siwiarchiv.de
Hallo,
zu der HFG-SI (Historische feuerwehrgruppe Siegen) habe ich jede Menge Bilder, die ich selbst gemacht habe.
Ich war zur Gründung des vereins selbst im vorläufigen Vorstand, habe die Satzung geschrieben und war möglichst bei jedem Event dabei, obwohl ich selbst nie Feuerwehrmann war.
Falls Interesse an der sehr umfangreichen Sammlung besteht, dann erbitte ich Kontakt unter derhinterlegten EMail Adresse.
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 3.10. – 16.10.2017 | siwiarchiv.de
Anlässlich dieser sogenannten „kleinen wissenschaftlichen Sensation“ wäre eine Erinnerung an die schon früher in Fellinghausen durchgeführten analogen Experimente nicht verkehrt. Siehe dazu die detaillierten Ausführungen von Alfred Becker:
http://siegerlaender-hauberg.info/index.php/lateneofen
Wir sollten wohl auch den „Pionier“ der Siegerländer Verhüttungsexperimente nicht unerwähnt lassen: Otto Krasa – s. http://www.siwiarchiv.de/?p=9762 .
In der geschlossenen Facebook-Gruppe „Stadt Siegen in alten und neuen Bildern“ findet sich eine Postkarte, die auch die hier abgebildete Innenansicht zeigt.
Pingback: Von der Bestandsliste zur Beständeübersicht | siwiarchiv.de
Pingback: Kommunalarchivisches Statement zur Bestandserhaltung | Archivalia
Pingback: Forschungsdesiderate zur Geschichte der Reformation im Siegerland und Wittgenstein | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 17.10. – 30.10.2017 | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik Oktober 2017 | siwiarchiv.de
Hallo zusammen. Ich bin im Besitz eines Bildes, gemalt von H.? Achenbach, gemalt wurde die Eremitage. Leider kann ich die Signatur nicht richtig lesen, würde aber gerne mehr über das Bild erfahren. Weiß jemand an wen ich mich wenden könnte? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß
Pingback: Ankündigung einer Publikation zur Geschichte des Fürstlichen Archivs in Bad Laasphe | siwiarchiv.de
Pingback: Literaturhinweis: Frank Lüdke/Norbert Schmidt: „Pietismus – Neupietismus – Evangelikalismus. | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 31.10. – 13.11.2017 | siwiarchiv.de
Pingback: Sind lokale Medienarchive Teil des digitalen Gedächtnis der Regionen? | siwiarchiv.de
Zur Sütterlinschrift erreicht uns folgender Literaturhinweis:
Bettina Irina Reimers: Ludwig Sütterlins Konzept einer Schrift – Methode und Praxis des Schreibenlernens, in: Reh, Sabine/Wilde, Denise (Hrsg.): Die Materialität des Schreiben- und Lesenlernens. Zur Geschichte
schulischer Unterweisungspraktiken seit der Mitte des 18. Jahrhunderts. Bad Heilbrunn/Obb 2016, S. 231 – 256.
Danke an PK!
Pingback: „Der Maler und die Ärztin“ – In Freudenberg werden Werke von Carl Jung-Dörfler gezeigt | siwiarchiv.de
Pingback: Dissertation zur südwestfälischen Orgellandschaft online: | siwiarchiv.de
Pingback: DVD-Neuerscheinung: „Frommes Siegerland – Der Segen des Herrn macht reich“ | siwiarchiv.de
Pingback: Vorbereitungen für Anne-Frank-Ausstellung laufen: | siwiarchiv.de
Pingback: 14 Filme aus der Region als große Siegerland Filmedition | siwiarchiv.de
Pingback: 14 Filme aus der Region als große Siegerland Filmedition | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 14.11. – 27.11.17 | siwiarchiv.de
Pingback: „Der Maler und die Ärztin“ – erfolgreich eröffnet | siwiarchiv.de
Pingback: Vortrag: Das „gemuurde Hus“ auf der Hammerhütte | siwiarchiv.de
Pingback: Vom Nachwuchsorchester zur Südwestfälischen Philharmonie. | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Adventskalender 2017/1 | siwiarchiv.de
Ich erinnere mich daran, dass der Ankauf der Bilder durch den Kreis Siegen-Wittgenstein eine ausgesprochen schwierige Angelegenheit war. Die Tochter von Otto Arnold hatte ursprünglich vor, die Bildrechte in die USA zu verkaufen. Mein geschätzter Chef Horst Schneider hat sich unendlich Mühe gegeben, die Bilder im Siegerland zu behalten.
Nun ja, das waren halt gewiefte Verhandler. Wer mit seinen astronomischen Forderungen in der ganzen Region vor die Wand läuft, bringt mal eben einen potenten Ami ins Spiel. Dann wird schon einer weich …
Dann sollten wir uns nun freuen, dass die Bilder seit 3 Jahren gemeinfrei sind.
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik November 2017 | siwiarchiv.de
Pingback: Linktipp: Bankgebäude Bahnhofstrasse, Siegen | siwiarchiv.de
Pingback: Lesung anlässlich der Ausstellung von Carl Jung-Dörfler-Werken | siwiarchiv.de
Der Adventskalender findet auch in diesem Jahr wieder überregional Beachtung:
1) http://blog.bibliothekarisch.de/blog/2017/12/01/mehr-oder-minder-bibliothekarische-adventskalender-2017/comment-page-1/#comment-3504
2) http://archivalia.hypotheses.org/68915
Offensichtlich haben nur das Aachener Uniarchiv und siwiarchiv einen Adventskalender.
Pingback: Jetzt: Historisch wie archivisch interessante Kreiskulturausschusssitzung | siwiarchiv.de
Pingback: Hilchenbach: Sitzung des regionalen Archivarbeitskreises | siwiarchiv.de
Eine Anmerkung zu Punkt 4:
Das etwas irreführend als „Dokumentationsstelle“ bezeichnete Unternehmen wird sicherlich jeder begrüßen – warum aber muss es unbedingt exklusiv beim Kreisarchiv angesiedelt sein und das dortige Raumangebot schmälern? Die erste Konzeption ist 10 Jahre alt; inzwischen gibt es „Zeit.Raum Siegen“ mit anscheinend ganz ähnlichen Motiven, nur eben bisher lokal statt regional orientiert. Was spricht dagegen, den Horizont des schon bestehenden Projektes einfach zu erweitern und als neuen Kooperationspartner das Kreisarchiv mit ins Boot zu holen? Soweit Präsentationen in einem „Schauraum“ angeboten werden sollen, wären dafür räumlich das Siegerlandmuseum und geschichtsdidaktisch die Uni prädestiniert, nicht das Kreisarchiv. Dieses könnte sich auf die fachhistorische Zuarbeit konzentrieren, womit die bereits für die „Dok.-Stelle“ vorgesehene Archivmitarbeiterin gut ausgelastet wäre und sich nicht von den pädagogischen und logistischen Aspekten, für welche die anderen Partner zuständig sind, ablenken lassen müsste.
Ich würde es sehr begrüßen, wenn dieser Gedankengang in die politischen Diskussion Einzug findet. Denn die Errichtung der Dokumentationsstelle ist ein Beschluss der Kreistages, den die Verwaltung ja zunächst einmal umzusetzen hat.
Ich konnte nur eine PDF-Datei mit 2 nicht aufeinander folgenden Seiten öffnen. Soll das nur eine Leseprobe sein oder wurde versehentlich nicht der gesamte Text als PDF-Datei zur Verfügung gestellt?
Danke für den Hinweis und entschuldigen Sie, dass ich nicht explizit auf die Leseprobe hingewiesen habe!
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 28.11 – 9.12.2017 | siwiarchiv.de
Zu Adolf Haas gibt es einen neuen Artikel auf Spiegel-Online.
http://www.spiegel.de/einestages/bergen-belsen-kz-kommandant-adolf-haas-und-die-kunst-der-haeftlinge-a-1181222.html
Dr Artikel ist von Jacob Saß, dem oben genannten Referenten.
Danke für den Hinweis!
Wie sieht es vom damaligen Aufnahmeort dort heute aus?
Wäre es nicht eine Herausforderung für den Heimatbund Siegen-Wittgenstein, die Geschichtswerkstatt Siegen oder einen
örtlichen Heimatverein? Die Uni Siegen wollte doch das
regionalgeschichtliche Wissen generieren. Hier könnte ein Anfang sein.
Die reich illustrierte 67 Seiten starke Broschüre („Buch“ wäre eine Übertreibung), die das Stadtarchiv Hachenburg 2016 vorlegte, ist ein autobiografischer Einstieg ins Thema gewesen, sicher durch den lokalen Bezug auch für manchen Hachenburger und Siegerländer Leser. Dafür ist dem Verfasser zu danken.
Es geht aber leider nicht ohne ein paar Anmerkungen zu dieser Schrift und ihrer Präsentation. Als ihr Autor im Rahmen des Siegener Forums vor einiger Zeit seine Forschung darstellte, war ihm die Mitteilung wichtig, Adolf Haas sei kein Antisemit gewesen. Dazu kam Widerspruch aus dem Auditorium. Das wiederholte sich dann, wie das Internet ausweist, auch andernorts, in Celle: http://www.bunteshaus.de/index.php/news/467-der-kz-kommandant-adolf-haas-war-ein-ns-moerder.
Die Reaktion des Autors auf die Kritik überzeugt nicht, auch nicht, wenn er dazu übergegangen ist, Haas nicht als einen „radikalen“ Antisemiten zu sehen.
Adolf Haas beantragte ausweislich seiner NSDAP-Nr. 760.610 bereits 1930 die Mitgliedschaft in einer Partei, die permanent den zu diesem Zeitpunkt militantesten Antisemitismus im deutschen Parteienspektrum demonstrierte. Es wäre lebensfremd anzunehmen, dieses herausragende Merkmal seiner Partei habe er nicht recht bemerkt oder es wäre ihm irgendwie gleichgültig gewesen. Der Sichtweise eine militante Praxis folgen zu lassen, war unter den Bedingungen des Verfassungsstaats und noch starker Gegenkräfte zum Faschismus zu diesem Zeitpunkt eher schwierig. Die allmähliche Radikalisierung des modernen Antisemitismus bis schließlich hin zu den Massenverbrechen musste erst noch in Gang kommen. Haas ging diese Entwicklung Schritt für Schritt mit. Ein Widerspruch ist nicht bekannt, zu keinem Zeitpunkt und würde kein bisschen ins Bild dieses Paradenazis hineinpassen.
Wenn das frühe Bekenntnis von Haas zu seiner Partei ein Bekenntnis auch zum Antisemitismus war, was heißt das dann?
Der „moderne Antisemitismus“ geht – so die Rassismusforschung – bei „den Juden“ von der Fiktion einer geschlossenen, homogenen ethnisch-biologischen und ethnisch-kulturellen Bevölkerungsgruppe („Volksgruppe“, „Volk“) aus. In einer Hierarchie der „Völker“ seien diese Juden – kenne man einen, kenne man alle – ganz unten einzuordnen. Ganz oben: als arischer Antipode, eine ebenso homogene „deutsche Volksgemeinschaft“, die Oberguten.
Das ist ganz ohne den körperlichen Übergriff auf die vielleicht verhasste, vielleicht aber auch nur einfach als gefährlich, störend oder sonstwie abgelehnte Gruppe die radikale Verneinung der Gleichheitsvorstellung und der daraus abgeleiteten Menschenrechte. Und das soll noch nicht radikal sein? „Radikal“ werde der Antisemit erst, wenn er Schaum vor dem Mund habe oder zum Totschläger greife?
Sollte es wirklich so sein, dass der Autor Jakob Saß Antisemitismus es für akzeptabel hält, wenn Antisemiten unterhalb solcher Grenzen bleiben? Akzeptanz für Antisemitismus, Diskursfähigkeit zugestanden, nur „radikal“ soll er nicht sein? Ich gehe mal davon aus, dass Saß das nicht so sieht, dass er einfach nur ohne große Überlegung in eine übliche ideologische Falle hineingelaufen ist, in die Extremismus/Radikalismus-Falle.
Sie setzt das Böse mit „Radikalismus“ gleich, versetzt es an politische Ränder und verortet das Gute in einer angeblich ideologiefreien gesellschaftlichen und politischen Mitte. Er sei, sagt Jakob Saß in Entgegnung der Celler Kritik, jemand, „der Faschismus, Rassismus, Antisemitismus und sonstige radikalen Ideologien ablehnt“. Auch „radikalen“ Humanismus? Auch „radikale“ Aufklärung? Auch eine „radikale“ Praxis der Menschenrechte?
Bei der allüberall aufgestellten Falle handelt es sich um Politikmodell auf Schülerniveau (Wolfgang Wippermann), also für die Schule. Seine pädagogische und mediale Verbreitung scheint im Kontext seiner politischen Nützlichkeit zu stehen, sein Erklärungswert ist gleich Null.
Im Fall Haas beweist sich das durch die justizielle Perspektive. Die fragte nicht nach dem Grad persönlicher „Radikalität“ von Akteuren (sehr, mittel, wenig), sondern war sachorientiert. In den 1960er Jahren ging es in Wien um die Verfahrenseröffnung zu Anton Burger, Adolf Eichmann, Adolf Haas usw. Die Justiz fragte schlicht nach „ihrer Mitwirkung … an der Endlösung der Juden/Jüdinnenfrage u. Mitschuld am organisierten Massenmord“ (https://collections.ushmm.org/findingaids/RG-17.003M_01_fnd_de.pdf).
Und noch ein Punkt: in dem Online-Beitrag von Sass heißt es, „so entwickelte sich in Bergen-Belsen ein eingeschränktes kulturelles Leben.“ Innerhalb der Opfergemeinschaft, weil vereinzelt Opfer etwa Täter porträtieren mussten? Oder innerhalb gar einer auf diese Weise gegebenen Opfer-Täter-Gemeinschaft? Nein, Täter bedienten sich ihrer Opfer auch zu „kulturellen“ Zwecken, in Bergen-Belsen, in Auschwitz, in Buchenwald und an anderen Vernichtungsorten. Das als „kulturelles Leben“ einzuordnen, geht völlig daneben.
Ist eigentlich bekannt, dass es auch in Siegen in diesen Jahren einen „Republikanischen Club“ gab (der sich in der damals in der Burgstraße existierenden Gaststätte traf)?
In der regionalen Literatur erscheint der „Republikanische Club“ m. W. nur (?) in Verbindung mit dem Schülerinnenstreik am Lyzeum. Eine eigenständige Publiaktion ist mir nicht bekannt und wäre daher – auch in Anbetracht des Jubiläums – lohnenswert. Vielleicht auch in einem größeren Zusammenhang – NPD-Parteitag in Siegen 1968, Sit-in auf der Haardter Kreuzung in (Siegen-)Weidenau, ……
Eventuell liefert diese Literatur bereits weitere Hinweise: http://www.karl-heupel.de/?p=1599
Der „Republikanische Club“ begegnete mir an zwei Orten:
– in Gesprächen in der ersten Hälfte der 1970er Jahre (ich kam 1972 nach Siegen) mit damaligen Akteuren aus SPD und DKP und deren Umfeld. Inzwischen gab es wohl einen Riss in der ursprünglichen Gemeinsamkeit.
– in einem längeren Gespräch mit einer Kollegin viele Jahre später, die damals als Noch-Schülerin mit Leuten aus der Szene gut bekannt war.
Vielen Dank für diesen aufschlussreichen Beitrag!
Vielen Dank für die kritische Würdigung der bisherigen Forschungsergebnisse! Bleibt zu hoffen, dass diese in die von Saß beabsichtigte Biographie – https://www.startnext.com/adolf-haas-biografie – Einzug findet.
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 10.12. – 23.12.2017 | siwiarchiv.de
Pingback: Landesarchiv NRW: Findmittel mit Digitalisaten der Luftbildplänen der Hansa Luftbild AG online | Archivalia
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik Dezember 2017 | siwiarchiv.de
Pingback: Fotoausstellung „Arbeit hinter Gittern“ | siwiarchiv.de
s. a. Karl-Heinz Büschemann, „Unternehmer ohne Skrupel“, in: Süddeutsche Zeitung, 28.12.2017
Pingback: siwiarchiv-Feiertagsstatistik: 24.12.17 – 6.1.2018 | siwiarchiv.de
Pingback: Bestand „Landesstelle Unna-Massen“ im DOMiD | siwiarchiv.de
Pingback: Förderbescheid für Wasserburg Hainchen | siwiarchiv.de
Pingback: Förderbescheid für Wasserburg Hainchen | siwiarchiv.de
Pingback: Siwiarchiv-Blogparade: „Zukunft der Archive – Archive der Zukunft“ | siwiarchiv.de
Hallo Herr Wolf,
ich habe vorn Reinhard Kämpfer von Ihrem Blog erfahren und würde mich freuen, in den E-Mail-Verteiler aufgenommen zu werden.
Viele Grüße
Henning Schneider
Pingback: Siwiarchiv Blogparade | Archivalia
Ich würde mich schämen, auf ein so aussagearmes, nicht mit naheliegenden Digitalisaten versehenes Findbuch zu verlinken.
Hallo Herr Schneider, Beiträge und Kommentar können Sie bequem mit einem RSS-Reader abonnieren. Links zu den beiden RSS-Feeds finden Sie am Seitenende. Den Reader müssen Sie bei sich installieren.
Lieber Kollege Dr. Graf, siwiarchiv stellt tatsächlich seinen Leserinnen und Leser unkommentiert Informationen zu veröffentlichten Findmitteln vor – im Vertrauen darauf, dass die Leserschaft sich selbst ein Bild vom Nutzen des Vorgestellten macht, indem sie z. B. das Findmittelvorwort lesen. Meist erfolgen die Veröffentlichungen auf siwiarchiv nicht grundlos. Es ist in der Tat so, dass Kommunalarchive Anfragen erhalten, die lediglich Abbildungen kommunaler Wappen zum Inhalt haben. Vor diesem Hintergrund mag selbst diese von Ihnen als bescheiden bewertete Information sowohl für die Kolleginnen und Kollegen in westfälischen Kommunalarchiven – sofern sie denn siwiarchiv lesen – , als auch für deren potentiellen Nutzerinnen und Nutzer hilfreich sein.
Welchen Ideen gibt es für die #ArchivZukunft? S. z. B.
Pingback: Eröffnung der Ausstellung „Arbeit hinter Gittern“ | siwiarchiv.de
Pingback: Heute vor 196 Jahren: Adolf Kreutz geboren | siwiarchiv.de
Aufgrund der Malerei oberhalb des Fensters sowie des Daches würde ich das Bild im Schweizer Raum verorten. Wenn die Ortsangabe Krombach stimmen sollte: Es gibt ein Krombach bei Herisau, Kanton Appenzell Ausserrhoden. Vielleicht gibt es in der Google Bildersuche etwas dazu…
Brunnen gibt es dort einige: http://www.herisau.ch/de/herisau/portrait/sehenswuerdigkeiten/welcome.php?action=showobject&object_id=236
Vielen Dank für diesen gut begründeten Lösungsansatz!
Pingback: Jubiläumsfoto 50 Jahre Geisweider Eisenwerke (1846-1896) im Stadtarchiv Siegen | siwiarchiv.de
Zur Geschichte des Landgerichtsgefängnisses Siegen ist der Bestand „Landgerichtsgefängnis / Justizvollzugsanstalt Siegen“ (Signatur : Q 925) des Landesarchivs NRW, Abt. Westfalen, auszuwerten, denn er enthält 90 Akten in18 Kartons (Generalakten und Gefangenenpersonalakten) mit einer Laufzeit von 1925 bis 2003. Im Kartenbestand des Landesarchivs NRW, Abt. Westfalen, befinden sich Baupläne von Massnahmen der 70er und 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts.
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 7.1. – 20.1.2018 | siwiarchiv.de
Pingback: Kultur-News KW 03-2018 | Kultur - Geschichte(n) - Digital
Wenn es mal eine Wohnung im Schloss zu vermieten ist bin ich dabei.
Pingback: Neuauflage der Informationsschrift über das Internatsmuseum Stift Keppel | siwiarchiv.de
In der gesschlossenen Facebook-Gruppe wurde am Wochenende ein Bild des Radfahrvereins „Flottweg“ Kreuztal(-Eichen) 1913 gepostet.
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik Januar 2018 | siwiarchiv.de
Das zweibändige Werk wurde auch dem Stadtarchiv Siegen als Belegexemplar überlassen und kann hier ab sofort im Lesesaal eingesehen werden!
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 21.1. – 4.2.2018 | siwiarchiv.de
Pingback: De fellrath: Schenkung an das Kreisarchiv | siwiarchiv.de
Gut, recherchierter Artikel. Nicht zu vergessen, dass der Zugang zum lebenswichtigen Holz nur einigen wenigen Erben vorbehalten war. Ein Grund warum Förster und Jäger seit jeher von den einfachen Leuten verhasst waren. Sie glaubten daran, dass Gott den Wald für alle Menschen hat wachsen lassen und sahen in ihrer Not nur selten ein fürs Brennholzsammeln bestraft werden zu sollen.
Pingback: Linktipp: Bundesarchiv: Noch keine Reaktion der Witwe von Altkanzler Dr. Helmut Kohl | siwiarchiv.de
Pingback: Zukunft der Kommunalarchive – Kommunalarchive der Zukunft | archivamtblog
Mein Beitrag mit dem Titel „Zukunft der Kommunalarchive – Kommunalarchive der Zukunft“ ist soeben im Archivamtblog erschienen unter https://archivamt.hypotheses.org/5985
Pingback: Tagungsband zum 85. Deutschen Archivtag in Karlsruhe 2015 erschienen | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 4.2 – 17.2.18 | siwiarchiv.de
Eine Aufstellung der einschlägigen Akten von Kirchenbauten des Architekturbüros Sonntag im Erzbistumsarchiv Paderborn: http://www.siwiarchiv.de/wp-content/uploads/2018/02/SonntagsBauwerk.pdf
Oben im Text hat sich offenbar ein Fehler eingeschlichen. Unter den Arbeiten von A. Sonntag wird auch ein Wohnbau für Herrn Barich aufgeführt. Bei Herrn Barich handelt es sich um Dr. h.c. Karl Barich, der von 1954 bis 1970 Vorsitzender des Vorstandes der Stahlwerke Südwestfalen, anschließend bis 1975 Vorsitzender des Aufsichtsrates war. „Die Villa im Bungalowstil“ ist mithin Dienstwohnung dieses Unternehmens und nicht der Birlenbacher Hütte!
Danke für die Korrektur! Die Angaben stammten aus der Datenbank der Denkmalpflege, wenn ich mich recht erinnere ……
Ergänzung zu den Kirchenbauten:
Dortmund, Maria Heimsuchung (Do-Bodelschwingh), 1975-1977, Gemeindezentrum mit integrierter Kirche und Turm, vgl. Paul Montag u.a. (Hgg.), Die katholische Kirche in Dortmund, Paderborn 2006, S. 344-345.
Danke für die Ergänzung! eine ausführliche Bearbeitung der Bauten des Architekturbüros Sonntag steht noch aus und jeder weitere Hinweis ist daher hilfreich. Interessant wären auch die Industriebauten Sonntag kennen zu lernen.
Pingback: Sonderschau „Der Bergbau in der „Landeskrone“ | siwiarchiv.de
Anm. des Administratoren:
Dieser anonyme Kommentar wurde als Spam gewertet und daher gelöscht. Auf Punkt 9 der im Editorial genannten Grundregeln von siwiarchiv wird eindringlich und letztmalig hingewiesen.
Pingback: Blogparade: Archivpolitik der Zukunft – Zukunft der Archivpolitik | Jens Crueger
Habe einen Beitrag zur Archivpolitik der Zukunft beigesteuert: http://ceterum-censeo.net/?p=2509
Vielen Dank für diesen ebenso wichtigen wie anregenden Beitrag zur Blogparade! Er nimmt sich mit der Archivpolitik eines der wichtigsten archivischen Arbeitsfelder an, denen sich die Archive bzw. Archivierende in Zukunft widmen müssen – um im Verteil“kampf“ der Kulturinstitutionen gehört zu werden.
Pingback: Linktipp: „Ein Autogramm aus der Vergangenheit. | siwiarchiv.de
Pingback: Blogparade #ArchivZukunft: Preserve your Voice! Talk to an Archivist. – Stadtarchiv Darmstadt
Es wäre schön, wenn Artikel, die aus fremder Feder stammen und unter dem Label „Stadtarchiv Siegen“ hier eingestellt werden, letzterem vor Veröffentlichung einmal vorgelegt würden. Man könnte dann die gröbsten Fehler ausmerzen!
Anm. des Administrators:
1) Für das Einstellen ohne Rücksprache entschuldige ich mich.
2) Dem Eintrag ist m. E. allerdings deutlich zu entnehmen, dass es sich nicht (!) um einen redaktionellen Eintrag des Stadtarchivs handelt, sondern lediglich um einen „Linktipp“. Damit ist deutlich, dass Fehler nicht vom Stadtarchiv zu verantworten sind.
Auch von mir kommt kurz vor Schluss noch ein Beitrag zur Anforderung der gleichberechtigenden Öffnung von Archiven: https://dablog.hypotheses.org/338
Alle guten Dinge sind drei – vielen Dank für diesen Beitrag, der alle zukünftigen archivischen Baustellen – jenseits der Technik – darstellt und erläutert! Einer Zusammenfassung der Blogparade vorgreifend würde ich sagen, dass die 3 bis jetzt vorliegenden Beiträge zur Blogparade ein beachtliches Bild der archivischen Zukunft zeichnen.
Meine Dinosaurier-Generation ist (sicher zum Leidwesen der Blogparadeure) noch nicht restlos ausgestorben. Es wäre also aus Pietätsgründen nett, wenn der Unfehlbarkeitsanspruch der Bloggerszene in der Öffentlichkeit vorerst noch etwas weniger offensiv artikuliert werden könnte. Habt ein bißchen Geduld! In absehbarer Zeit wird es keine Störenfriede mehr geben, und diese konstruktivistisch verhunzte Welt gehört euch ganz allein.
Nebenbei: Die Idee des simultanen Säuglingspflege- und Archivarbeitsraumes ist einfach genial! Wenn sich der Sprößling nach dem Stillen über die Archivalien erbricht, kommt endlich mal Leben in die Bude.
Sehr geehrter Herr Kunzmann,
in meinem Beitrag gehe ich auch für die Zukunft davon aus, dass Archivnutzung auch im Lesesaal stattfinden wird, in vielen Archiven auch teilweise noch mit nicht digitalisierten Akten & Co., die man anfassen kann. Sollte der Eindruck entstanden sein, Archivarinnen und Archivare würden das nicht vermissen, möchte ich widersprechen. Und Nutzerinnen und Nutzer als Störenfriede – das ist nicht mein Verständnis von heutiger und zukünftiger Archivarbeit, womit ich sicherlich nicht allein dastehe. Jedem Tierchen sein Pläsirchen – auch den Dinosauriern!
Wie aus dem Zusammenhang klar hervorgehen dürfte, meinte ich mit „Störenfrieden“ nicht die Archivnutzerinnen und -nutzer, sondern die (aus Ihrer Sicht letztendlich entbehrlichen) „Tierchen“, denen diese ganze Bloggerei suspekt ist.
Sie haben offensichtlich jeden einzelnen der Beiträge zur Blogparade nicht verstanden und darüber hinaus keine Ahnung von dem Auftrag, den Archive erfüllen. Es geht um ein Miteinander und Füreinander, auch mit und für Dinosaurier. Jedoch ohne Personen, die sich lieber in Problemen suhlen, statt gemeinsam Lösungen zu finden.
Nebenbei: Es gibt derzeit ja nicht einmal Arbeitsräume, in denen digitales Archivgut oder digital und analog vorhandene Findmittel mit Kind genutzt werden können. Eine verstärkte Digitalisierung von Archivgut zur Nutzung vom heimischen Arbeitsplatz wäre eine zusätzliche Unterstützung. Wie sie forschenden Müttern und Vätern das Verantwortungsbewusstsein für den Erhalt von Originalen absprechen ist außerdem äußerst fragwürdig.
Pingback: Vortrag: „Nationalsozialismus & Holocaust in der Siegener Erinnerungskultur“ | siwiarchiv.de
Siehe auch:
http://akteureundtaeterimnsinsiegenundwittgenstein.blogsport.de/
und
http://widerspruchundwiderstandimnsinsiwi.blogsport.de/
(dieses in Teilen noch in Arbeit)
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik Februar 2018 | siwiarchiv.de
Pingback: Heute vor 9 Jahren: Einsturz des Kölner Stadtarchivs | Archivalia
Pingback: Kultur-News KW 09-2018 | Kultur - Geschichte(n) - Digital
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 18.2.18 – 3.3.18 | siwiarchiv.de
Bitte noch Veranstaltungsort und Beginn ergänzen (Schwarze Schrift auf schwarzem Hintergrund ist nicht lesbar)
Danke für den Hinweis!
Zu diesem Artikel wurde siwiarchiv folgendes Bild Josef Stocks zur Verfügung gestellt:

siwiarchiv erreichte folgende Korrektur der oben genannten PDF-Datei „Lehrer3345″:
“ …[Reinhard] Lüster war nie VS-Lehrer in Birlenbach (….), er war bis zum Ausscheiden 1938 Leiter der „Wilhelm- und Augusta-Schule“, im Volksmund „Flurschule“, die in der Weidenauer Flurstraße war und später zur Bismarckschule wurde. Diese Schule besuchte auch das „Euthanasie“-Opfer Lina Althaus. Inge Frank war bis zum Wechsel ins Lyz dort ebenfalls Schülerin, s. Foto S. 22, Familie Frank aus Weidenau (K. Dietermann).
Lüster war der Lehrer, der beim Vorbeigehen mit Schulklassen beim Haus der Familie Frank, Untere Friedrichstraße 8/1, das Lied singen ließ: „Soldaten, Kameraden, hängt die Juden, stellt die Bonzen an die Wand!“, darin auch die Zeile: „Wenn das Judenblut vom Säbel spritzt, dann geht’s noch mal so gut!“. ….
Das Sterbedatum von Lüster habe ich von der Stadt Springe erhalten: 12. Januar 1962 in Siegen (51/1962).“
Auf die beiden Einträge zu Reinhard Lüster in der preußischen Lehrerdatenbank sei hier verwiesen:
1) BBF/DIPF/Archiv, Gutachterstelle des BIL – Preußische Volksschullehrerkartei, Regierungsbezirk Arnsberg, GUT LEHRER (Personalunterlagen von Lehrkräften), 12876: http://archivdatenbank.bbf.dipf.de/actaproweb/archive.xhtml?id=Vz++++++97f9a7c9-6953-4bcd-8e67-91e1531f3300#Vz______97f9a7c9-6953-4bcd-8e67-91e1531f3300
2) BBF/DIPF/Archiv, Gutachterstelle des BIL – Personalbögen der Lehrer höherer Schulen Preußens, GUT LEHRER (Personalunterlagen von Lehrkräften), 146512: http://archivdatenbank.bbf.dipf.de/actaproweb/archive.xhtml?id=Vz++++++4a11a6e3-a2a5-4958-9246-16875496eada#Vz______4a11a6e3-a2a5-4958-9246-16875496eada
Pingback: Rubens-Frühwerk im Siegerlandmuseum | siwiarchiv.de
Eine tolle Geschichte. „Neue Formate zur Vermittlung fern alter Vorurteile“. Oder: „Für diverse Vorurteile wird die Luft dünn.“ Das schlägt ein. Damit kann man für Furore sorgen und neue Wege der Kunstvermittlung asphaltieren. Hehre Ziele, die in dieser Wortwahl aber nur stereotype Klischees bedienen und die implizieren: Archive sind staubtrockene, spröde, altbackene „Aufbewahrungskästen“. Nur Museen dürfen nach dieser Lesart also Verve versprühen, den kulturellen Dialog fördern, Fachinformationen vermitteln oder „Formate für viele Zielgruppen“ anbieten – möglichst „[…] in unverkrampfter, freier Atmosphäre“. Frau Drews meint, nicht ganz zu Unrecht natürlich, ein Museum solle auch ein sozialer Ort sein. Allerdings: Sind Archive keine sozialen Orte? Eine eindimensionale Sichtweise, die angesichts der vielfältigen Herausforderungen, denen sich Archive zu stellen haben, Befremden hervorruft. Ja, auch Archive sind im 21. Jahrhundert angekommen, verbarrikadieren sich nicht in einem imaginären Elfenbeinturm (sind also keine „elitären Häuser“) und sind längst multifunktionale Dienstleister. Für Historiker, für Genealogen, für kooperierende Kulturinstitute, für Anfragen aus der Verwaltung und Politik, für Studierende und Schulklassen. Für alle Bürgerinnen und Bürger, für alle Besucherinnen und Besucher, die sich mit Fragen der regionalen und lokalen Geschichte beschäftigen und das ganze Spektrum individueller Interessen und Fragestellungen mitbringen. Wahrlich, ein Standardrezept dafür gibt es nicht, das hat augenscheinlich auch die Volontärin des Museums für Gegenwartskunst erkannt. Individuell werden auch in Archiven im Rahmen persönlicher Gespräche gewünschte Informationen zur Verfügung gestellt, Betrachtungsweisen ausgetauscht und Lösungsvorschläge unterbreitet. Als ob das ein Alleinstellungsmerkmal für Museen wäre! Man gestatte mir den Hinweis auf das Stadtarchiv Siegen, das als anerkannter „Bildungspartner NRW“ zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Schulen fördert, damit Kinder und Jugendliche – ganz unabhängig von ihrer sozialen Herkunft und kulturellen Prägung – von dem außerschulischen Lernort „Archiv“ profitieren können. Archivpädagogische Maßnahmen, Workshops und Seminare unterstreichen die generationsübergreifende, soziale Komponente des „Aufbewahrungskastens“. Dann die Veranstaltung des „Siegener Forums“, in dem Vorträge und Themen (übrigens auch zu kunstgeschichtlichen Aspekten) angeboten und zur Diskussion gestellt werden. Je nach thematischem Schwerpunkt werden sogar Personen angesprochen und zum Meinungsaustausch eingeladen, die bislang eher selten ein Archiv aufgesucht haben. Die Organisation und Realisierung von Ausstellungsprojekten. Das gemeinsam mit der Geschichtswerkstatt Siegen im Jahr 2016 erfolgreich im Siegerlandmuseum im Oberen Schloss konzipierte Projekt „Siegen an der ‚Heimatfront‘ 1914-1918: Weltkriegsalltag in der Provinz“ mit begleitendem Rahmenprogramm für Schülerinnen und Schüler, mit einem didaktischen Konzept, das alle Altersgruppen berücksichtigen sollte. Man lese und staune: auch Archive kauen keine Interpretationen vor, stellen sich bohrenden Fragen und verschließen nicht die Augen vor der gesellschaftlichen Entwicklung, ja sind in gewisser Hinsicht ja sogar ein Abbild des Wandels!
Übrigens steht das Stadtarchiv Siegen auch bei Fragen wie etwa zum Rubenspreis der Stadt Siegen zur Verfügung, nicht nur dem Museum für Gegenwartskunst und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dafür sind sie dann gut genug – die tristen „Aufbewahrungskästen“.
Pingback: Plattform matricula-online.eu macht Kirchenbücher digital einsehbar | siwiarchiv.de
Pingback: LWL verleiht seinen Karl-Zuhorn-Preis an Dr. Stephanie Menic | siwiarchiv.de
Pingback: Linktipp zu den 5 Leben des Peter Paul Rubens | siwiarchiv.de
Pingback: Großes siwiarchiv-Frühlingsrätsel – Bild 1: | siwiarchiv.de
Afholderbach
Es handelt sich leider nicht um Afholderbach in Netphen
Es handelt sich um Nauholz.
In dem Filmabend des Kreisarchivs Siegen-Wittgenstein fährt der VW durch den Ort.
Eschenbach
Erneut leider nein; allerdings -als kleiner Tipp – der Ortsname endet auf -bach.
In Sohlbach
Nein, der Ort befindet sich in einer anderen Siegerländer Kommune.
Trupbach
Auch diese Antwort ist leider falsch.
Es ist wahrscheinlich das Fachwerkhaus , daß vor ca. 20 Jahren in Hilchenbach nur als Gebälk versetzt werden mußte, um so für die Verbreiterung der B 508 Platz zu schaffen.
Es ist zumindestens die richtige Kommune …….
Allenbach
Diese Antwort kann ich nun endlich gelten lassen! Gratulation und viel Spaß bei den weiteren Bildern!
Kann man denn vom Archivar evtl. etwas mehr über dieses Haus erfahren ? Existiert es heute noch ,oder hat man es schon längst verfeuert ?
Leider kann ich aus terminlichen Gründen nichts Weiteres mitteilen. Aber evt. kann das Stadtarchiv Hilchenbach da weiterhelfen …… Übrigens, die Aufnahme stammt aus dem Jahr 1954.
Dreis-Tiefenbach ?
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 4.3. – 15.3.2018 | siwiarchiv.de
Weidenau, Formerstraße und Umgebung?
Tiefenbach , denke ich.
Das Brückengeländer hatte ich schon mal auf einem anderen Foto gesehen.
Das Haus rechts ist das Haus Bellmächersch
Es handelt sich um die Brücke über die Littfe in Eichen.
Gratulation! Dies ist die korrekte Antwort!
Das Gebäude steht in Littfeld, heute Altenberger Straße.
Kann leider gerade nicht im meine Liste schauen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Gebäude nicht in Littfeld steht.
Es dürfte sich um das repräsentative Wohngebäude des Eicher Hammers
in einem früheren Zustand handeln. Heute ist das Gebäude fachwerksichtig.
Auch hier gilt, dass ich gerade nicht in meine Liste schauen kann, allerdings meine ich mich zu erinnern, dass das Gebäude nicht in Kreuztal stand ……
Das Gebäude müsste in Obernetphen in der Lahnstr. stehen, ganz nah neben der Kath. Kirche.
Pingback: Linktipp: Diskussionsforum „Kommunalarchive und Wirtschaftsüberlieferung“ | siwiarchiv.de
https://archivalia.hypotheses.org/71168
Danke für den Link!
Vielleicht in Burbach, Ortsmitte?
Nicht im Süden des Siegerlandes wurde dieses Bild aufgenommen!
Kreuztal-Ferndorf (Ernsdorf)?
Wenn ich mich recht erinnere, befindet sich dieses Ensemble nicht im Norden des Siegerlandes ……
Neunkirchen Ortsmitte?
Niederdresselndorf
Das Haus stand in Rinsdorf.
Es wurde in der Mitte der 70er Jahre abgebrochen.
Im Hintergrund ist die Kapellenschule zu erkennen.
Da will ich nicht widersprechen – Gratulation! Vielen Dank für die weiteren Informationen!
Meiswinkel
Obernetphen
Ganz sicher Niederdresselndorf. Das Foto ist etwas größer abgebildet in
„Niederdresselndorf – Geschichte eines Dorfes“ . Herausgegeben vom Heimatverein Niederdresselndorf 2004.
Steht das Haus in Deuz?
Wenn ich mich recht erinnere, ist diese Antwort korrekt – Gratulation!
Vielen Dank für die Antwort! Aber nein ……
Stift Keppel Allenbach, Försterfamilien Brücher, Klein
Leider nein!
Das sieht nach Freudenberg aus. Eventuell in der Krottdorfer Str. da wo es Richtung Marktstr. runtergeht. Das könnte ein Bauernhof gewesen sein.
Würde auf einen Handwerksbertrieb in Form einer Korbmacherei o.ä. tippen.
Das Haus ist nicht im Stadtteil Freudenberg.
Also nach langen Nachdenken würde ich das Gebäude in Siegen-Eiserfeld verorten.
Hainer Brauhaus
Das Haus stand in Eiserfeld und wurde abgebrochen.
Es stand an der Eisentalstraße / Wilhelmstraße.
Das Haus sollte als Krankenhaus genutzt werden, wurde es aber wohl nie, da sein baulicher Zustand zu schlecht war.
(Quelle: Eiserfeld, Im grünen Kranz der Berge, Herausgegeben im Auftrag des Eiserfelder Heimatvereins 1992)
Ohne den Hinweis von Landvogt88 hätte ich das Haus nicht identifizieren können.
Die Antwort von Torsten ist korrekt. Heute wird das Gelände an der Eiserntalstraße / Ecke Wilhelmstraße als Parkplatz neben der Metzgerei Hennche (Stammhaus) genutzt bzw. liegt gegenüber der Bäckerei Cronrath.
Das Haus Stand in Helberhausen. Es wurde Anfang des Jahres 1979 abgebrochen.
Das Haus steht in Deuz. Es dürfte sich um das Haus mit dem Hausnamen „Wänersch“ handeln.
das seh ich auch so neunkirchen oder salchendorf
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 16.3. – 1.4.2018 | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik März 2018 | siwiarchiv.de
Pingback: Studienfahrt Frankfurt/Main: „Rubens. Kraft der Verwandlung“ | siwiarchiv.de
Warum wird nicht erwähnt, wer den Vortrag hält?
Stadt Freudenberg
Die Bürgermeisterin
Stadtarchiv
Sehr geehrter Herr Lerchstein!
Der vortragende Referent ist Herr Bernd Brandemann.
Er ist der Vorsitzende eines Arbeitskreises für Stadt- und Baugeschichte Freudenbergs im veranstaltenden Verein
4fachwerk e.V. dem Träger des Mittendrin-Museums im historischen Stadtkern Freudenberg.
Außer diesem Verein ist der Verein Frids e.V. durch eine besondere Stadtführung von Jugendlichen für Kinder und Jugendliche (Eltern und Omas incl.) in die Gesamtmaßnahme einbezogen. Dazu wird auf die
Berichterstattung des WDR FS Siegen verwiesen.
Mit freundlichen Grüßen aus der
Fachwerkstadt Freudenberg
I.A.
Detlef Köppen
Stadtarchivar
Stadt Freudenberg
Die Bürgermeisterin
Stadtarchiv
Mórer Platz 1
57258 Freudenberg
Weitere Hinweise gibt es auf der Facebook-Seite des
Europäischen Kultur- und Informationszentrum in Thüringen
Kontaktstelle für VIA REGIA – Kulturroute des Europarates
Bahnhofstraße 27 / 28
D-99084 Erfurt
http://www.via-regia.org
https://www.facebook.com/VIA.REGIA/posts/1888993131119481
Mit freundlichen Grüßen
I.A.
Detlef Köppen
Stadtarchivar
Pingback: Linktipp: Experiment zur keltische Verhüttungstechnologie des Siegerlandes geht weiter | siwiarchiv.de
Pingback: Literaturhinweis: Heinrich Imhof: „Hoffnung auf ein besseres Leben | siwiarchiv.de
Pingback: Stadtrundgang für Kinder | siwiarchiv.de
Pingback: Blogparade-Aufruf: "Das müsst ihr sehen: mein Kultur-Tipp"
Fundstelle in der WDR-Mediathek
Historische Stadtführung Freudenberg
Lokalzeit Südwestfalen | 10.04.2018 | Verfügbar bis 17.04.2018 | WDR
Vielen Dank für den Hinweis! Er ist zugleich der 2.500. Kommentar auf siwiarchiv.
Pingback: Archivarbeit in Gedenkstätten – Aufbau eines Gedenkstättenarchivs mit besonderer Berücksichtigung der Sammlungen | archivamtblog
Pingback: Neues (?) zur „Archivarbeit“ in der Gemeinde Neunkirchen | siwiarchiv.de
Pingback: Vom Zahnarzt zur Paläographie | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 2.4. – 15.4.2018 | siwiarchiv.de
Die Fotos mit Willy Brandt wurden gegenüber der Einmündung der L 718 (Friedrichshütte) in die Bundesstraße 62 gemacht. Aus Richtung L 718 in Richtung B 62 gesehen rechts, befand sich damals das „Hotel Fasanerie“ (ehem. Inhaber: Stähler), dessen Hauptgebäude bzw. ein damaliger Neubau mit Flachdach im Hintergrund der Fotos rechts zu sehen sind. Die Straßenschilder, vor denen Herr Brandt steht, waren damals im Vordergrund eines kleinen ehemaligen Steinbruchs montiert. Das Hotel war in dieser Zeit eines der besten in Wittgenstein. Ich kann mich an einen Besuch des Bundespräsidenten Lübke erinnern, der dort ebenfalls bewirtet wurde. Insofern ist es sehr wahrscheinlich, dass auch Willy Brandt im dortigen Hotel mit seinem „Tross“ eingekehrt ist. Ich kann gerne in den nächsten Tagen einmal dort vorbeifahren und den aktuellen Blickwinkel „einfangen“.
Einige Auswahlfotos von heute übersandt. :-)
Die alten Wegweiser sind nicht mehr vorhanden.
Pingback: Siegerländer Haubergswirtschaft im Landesinventar immatrielles Kulturerbe aufgenommen | siwiarchiv.de
Es war tatsächlich die Ecke, wo die Straße von Banfe kommend auf die B62 führt. Damals hieß das angesprochene Hotel „Hotel Fasanerie“, war die erste Adresse im Ort, nicht zuletzt wegen der 2-3 Tennisplätze, auf dem die Honorigen der Stadt spielten. Ich erinnere mich, dass im Vorfeld der Durchfahrt von Willy Brandt, seine Ankunft im Radio oder in der Zeitung angekündigt wurde. Ich wohnte damals auf der Amalienhütte in Niederlaasphe. Ich lugte an diesem Tag mit meiner Oma und Kissen unter den Ellenbogen aus dem Fenster in der 1.Etage. Wir sahen, wie er mit einem rabenschwarzen Wagen auf der B62 an unserem Haus vorbeifuhr. Leider habe ich ihn nicht auf dem Marktplatz (?) sprechen hören, da meine Eltern eher dem Gegenkandidaten, Kurt Georg Kiesinger zugeneigt waren. Den musste ich anhören dürfen…
Vielen Dank für die Erinnerung! Quasi als Trost folgt nun der Bericht der Westfalenpost vom 22. August 1969 über den Besuch Brandts in Laasphe:
„Urlaubsgebräunt stand gestern nachmittag Bundesaußenminister Willy Brandt auf dem Podium des Wilhelmplatzes in Laasphe. Tausend mögen es gewesen sein, die aus Laasphe und mit Omnibussen aus dem ganzen Wittgensteiner Land hergekommen waren und zum ersten Male einen sozialdemokratischen Parteivorsitzenden in Wittgenstein erleben konnten. Landrat Möhl hieß ihn mit einem Gastgeschenk willkommen, ebenso der Siegerländer Landrat und Bundestagsabgeordnete Hermann Schmidt.
Willy Brandt sagte seinen Zuhörern, was die SPD veranlasst habe, mit der CDU/CSU eine Koalition einzugehen. Er sprach auch davon, dass es hier vor vier Jahren dem heimischen Bundestagsabgeordneten, Prinz Botho, gelungen war, einen Direktsieg gegen den sozialdemokratischen Kandidaten zu erringen, und er meinte, das Wahlergebnis müsse diesmal umgekehrt laufen.
Nach dem Konzept des SPD-Vorsitzenden, das er in Laasphe während seiner halbstündigen Ansprache kurz ausbreitete, gehe es der SPD um folgende Wahlentscheidungen:
Ob die Wirtschaft stabil bleiben und Arbeitsplätze erhalten werden könnten.
Ob die notwendigen Reformen in Wirtschaft, Forschung, Verkehrswesen und Städtebau rasch durchgeführt werden könnten.
Ob unsere Jugend bessere und ausreichende Bildungsmöglichkeiten eröffnet werden könnten.
Ob der Staat für mehr Gerechtigkeit sorgen könne, beispielsweise durch eine Steuerreform und in der Vermögenspolitik.
Ob es mehr Demokratie bei uns geben könne.
Ob die Freundschaft zu den Nachbarvölkern und die Zusammenarbeit mit allen Staaten rasch weiter ausgeweitet werden könne.
Zum letzten Punkt machte der Außenminister auch einen Rechtfertigungsversuch gegenüber den Angriffen, die gegen die drei Moskaureisenden der SPD ausgerechnet zum Jahrestag der tragischen Geschehnisse in der Tschechoslowakei erhoben worden sind. Jede Gelegenheit, so meinte Willy Brandt, müsse willkommen und jeder Termin recht sein, wenn es darum geh, Spannungen abzubauen und in Moskau deutsche Interessen zu vertreten.
Nach der Ansprache, die nur ein einziges Mal von Beifall unterbrochen worden war, führ Willy Brandt und mit ihm eine größere Bonner Presseeskorte weiter nach Koblenz.“
Aktuelle Bilder finden sich hier:
Pingback: Paläographischer Lesekurs 2018.Tag 1. | siwiarchiv.de
Pingback: Paläographischer Lesekurs 2018. Tag 1. | siwiarchiv.de
Pingback: Wittgenstein Heft 1 / 2018 erschieben | siwiarchiv.de
Pingback: Heute vor 125 Jahren: Schauspieler Willy Busch geboren | siwiarchiv.de
Pingback: Paläographischer Lesekurs 2018. Tag 2. | siwiarchiv.de
Leider funktioniert der Link zum Artikel nicht.
Sorry, er funktioniert doch…
Pingback: Trailer für das bauhaus museum weimar | siwiarchiv.de
Pingback: Abschluss der Restaurierungsarbeiten am Antwerpener Selbstporträts von Peter Paul Rubens | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 16.4. – 29.4.2018 | siwiarchiv.de
Pingback: Paläographischer Lesekurs 2018. Tag 3. | siwiarchiv.de
Pingback: Willy Brandt in den Kreisen Siegen und Wittgenstein | siwiarchiv.de
Pingback: Willy Brandt in den Kreisen Siegen und Wittgenstein | siwiarchiv.de
Sehr schöne Bilder, aber ich glaube nicht, dass das zweite Bild in Erndtebrück aufgenommen wurde. Ich kenne das Alte Rathaus und da passt das Bild überhaupt nicht.
Danke für den Hinweis! Der Aufnahmeort wird nun sicher noch einmal überprüft werden.
Hallo, ich bin es noch mal.
Mein Vater, Gregor Leipelt, war damals dabei. Das zweite Foto wurde auf der Treppe des „Westfälischen Hofes“ in Erndtebrück aufgenommen. Das Gasthaus existiert heute noch.
Vielen Dank für die Verortung!
Pingback: Online: Verzeichnisse der evangelischen Gemeinden und Geistlichen in der Provinz Westfalen 1887 – 1919 | siwiarchiv.de
Zu Martin Schulz s. a.
1) Regionales Personenlexikon zum Nationalsozialismus in den Altkreisen Siegen und Wittgenstein: http://akteureundtaeterimnsinsiegenundwittgenstein.blogsport.de/a-bis-z/gesamtverzeichnis/2/#schulz
2) BBF/DIPF/Archiv, Gutachterstelle des BIL – Personalbögen der Lehrer höherer Schulen Preußens/BBF/DIPF/Archiv, Gutachterstelle des BIL – Personalkartei der Lehrer höherer Schulen Preußens, GUT LEHRER (Personalunterlagen von Lehrkräften), 165983
Promotion an der Universität Berlin 1880. Ein Digitalisat der 39seitigen Dissertation „Experimente über die Chinin-Wirkung insbesondere auf das gesunde menschliche Gehörorgan“ ist unter
digital.bib-bvb.de/publish/content/41/4562995.html
zu finden, darin auf der letzten Seite auch ein kurzer Lebenslauf mit Angaben zu Schulbildung und Studium.
Im Fürstlichen Archiv Berleburg liegt als Regest vor (Sign. Ber.Uk-2891):
„Befundbericht des Medizinalrates Dr. Guder in Laasphe über die Leiche seiner Durchlaucht, des Hochseligen Fürsten Albrecht II. zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg“.
Ein Nekrolog lässt sich ermitteln in: Münchener Medizinische Wochenschrift 73 (1926), S. 576-577 (anscheinend nicht digitalisiert, könnte man über Fernleihe bestellen).
Als Kreisphysikus müsste Paul Guder etliche Spuren in der Überlieferung des Wittgensteiner Landratsamtes hinterlassen haben (Mikrofilme davon, wenn ich mich nicht irre, im Stadtarchiv Berleburg).
Vielen Dank für die Hinweise! Da kann man ja jetzt weiterrecherchieren.
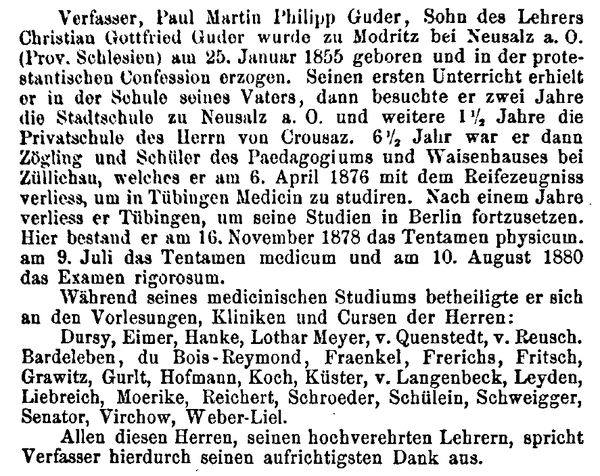
Ich habe mir die Dreistigkeit erlaubt, den Lebenslauf aus der Dissertation hier einzustellen:
Literatur zu Martin Schulz:
1) Kirsten Schwarz: Martin Schulz – ein Maler des Lichts, in Siegerland Bd. 89 Heft 1 (2012), S. 67 – 91
2) Siegerländer Heimtakalender 1970, S. 70
3) Vereins der ehemaligen Schüler des Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium (Hrsg.): 75 Jahre Höhere Schule in Weidenau. Festschrift zur 75-Jahr-Feier des Fürst Johann-Moritz-Gymnasiums Siegen-Weidenau, Siegen 1989, S. 2949, 59, 218, 219, 221, 224, 257
4) Nachrichtenblatt des Vereins der ehemaligen Schüler des Fürst-Johann-Moritz-Gymnasiums Hüttental II/1972, S. 10f
Zeitungsartikel:
Siegener Zeitung: Dez. 1932 („Die Kunstausstellung im Museum“), 26.5.1936, 12.2.1938, 19.1.1940, 31.5.1941 (?), 27.5.1943, 4.10.1946, 9.1.1951, 28.10.1959, 31.3.1960, 21.4.1964, 27.5.1968, 4.6.1968, 6.4.1972, 23.9.1978
Westfälische Rundschau: 21.1.1965,
Siegerländer Tageblatt: 3.12.1931
Link:
Archiv der bildenden Künste München, 05543 Martin Schulz, Matrikelbuch 1884-1920,
http://matrikel.adbk.de/matrikel/mb_1884-1920/jahr_1916/matrikel-05543
(Zugriff vom 07/05/18)
Nachtrag (gestern vergessen):
Die Universität Marburg selbst gibt für die Verleihung der Ehrensenatorenwürde das Datum 10.02.1923 an (nicht 1925). Die Ehrung erfolgte „als Anerkennung für die Zuweisung von wertvollem Sektionsmaterial und von Kranken mit seltenen Krankheitsbildern sowie für die Überlassung von wissenschaftlichen Werken an die Bibliothek“.
(www.uni-marburg.de/de/universitaet/profil/geschichte/ehrensenator-innen)
Es ist also denkbar, dass sich in der medizinhistorischen Sammlung der Uni Marburg (www.uni-marburg.de/fb20/museum-anatomicum) noch präpariertes Sektionsmaterial aus dem einstigen Besitz Guders befindet. Sollte Herr Bald Freude an solchen Konserven haben, wäre das vielleicht interessant.
Sehr geehrter Herr Kunzmann,
herzlichen Dank für ihre fundierten Hinweise, denen ich teilweise bereits nachgehen konnte. Nach Einsichtnahme in die Dissertation des Dr. Guder konnte ich eben den Nachruf in der Münchener Medizinischen Wochenschrift antiquarisch ermitteln, da mir eine Fernleihe zu aufwändig erschien. Insofern kann ich ihn jetzt auch digital zur Verfügung stellen:
„Paul Guder
Es erscheint mir nicht unbescheiden, wenn einmal an dieser Stelle auch über einen der tüchtigsten Aerzte aus der Zahl der praktischen Aerzte ein Nachruf veröffentlicht wird, wie es sonst nur bei hervorragenden Männern der Wissenschaft üblich ist. – Ein solcher, sich über das Niveau erhebender und hervorragender Mensch und Arzt war Paul Guder.
Paul Guder, der am 7. Dezember 1925 im 71. Lebensjahre starb, war, im Jahre 1881 approbiert, nach erfolgreicher Assistentenzeit, wo er Schüler von Flechsig und Binswanger war, an verschiedenen Heilanstalten tätig und ließ sich dann in Laasphe in Westfalen als praktischer Arzt nieder, wo er im folgenden Jahre zum Königl. Preußischen Kreisarzt für den Kreis Wittgenstein ernannt wurde. Sein ärztliches Arbeitsfeld war ein sehr umfangreiches und vielseitiges. Neben seiner großen allgemeinärztlichen Praxis, die ihn bis in die oft sehr weit entlegenen und schwer erreichbaren Dörfer des gebirgigen Wittgensteiner Landes (Sauerland) führte und an sein geburtshilfliches und chirurgisches Können und an seine diagnostische Begabung oft große Anforderungen stellte, hatte er einige Jahre später durch seine kassenärztliche Tätigkeit und durch sein Amt als Bahnarzt ein weiteres Gebiet, hier besonders für seine sozialen Bestrebungen, hinzugewonnen. Die Bevölkerung des Kreises Wittgenstein und der Stadt Laasphe hatte für ihre Bedürfnisse in Guder, dessen Arbeit von wirklich ärztlich humanem Geist durchdrungen war, einen verständnisvollen Berater. Er ließ seine dienstliche Stellung, seine wissenschaftlichen Bestrebungen und seine organisatorischen Fähigkeiten sich stets zum Nutzen der Bevölkerung auswirken, sei es in der Fürsorgetätigkeit, sei es für Schulen, sei es für die hygienischen Bedürfnisse der Gemeinden. In letzteren fehlte z.B. bei seinem Dienstantritt noch recht viel an hygienischen Einrichtungen: So sind auf seinen Antrag während seiner Dienstzeit allein 28 Wasserleitungen gebaut worden. Sein umfassendes Wissen, seine Kritik und seine Urteilskraft ließen ihn in der Verfolgung des einmal als richtig Erkannten nicht erlahmen; seine Erfahrung auf vielen Gebieten, seine stete wissenschaftliche Fortbildung machten ihn für Genossenschaften und Regierung zu einem anerkannten Gutachter.
Immer war Guder bemüht, sich wissenschaftlich weiterzubilden, er verblieb in Konnex mit der Wissenschaft; besonders pflegte er die Verbindung mit den Instituten und Kliniken der nahe gelegenen Universität Marburg. Diese Verbindung nutzte er zum Nutzen der Kranken. Guder war stets bemüht, seinen Kranken die Vorteile einer Krankenhausbehandlung zu verschaffen, und tat dies oft mit größter Energie und oft unter persönlichen Opfern. Er ließ Kranke aus den entlegensten Gebirgsdörfern in die Marburger Kliniken transportieren. Dieses Verhalten erkennt besonders rühmend der frühere hervorragende Direktor der chirurgischen Universitätsklinik in Marburg an. Herr Geheimrat Prof. Dr. Ernst Küster schreibt in seinem Buche: „Zwei Schlußjahre klinisch-chirurgischer Tätigkeit“ 1909 (Berlin, Aug. Hirschwald), als er auf S. 215 das weit ablehnendere Verhalten der Landbevölkerung gegen Operationen und die hierdurch veranlaßten Schwierigkeiten in der Behandlung verschleppter und zu spät operierter Fälle betont, daß gerade in der Ueberwindung solcher schwieriger Verhältnisse Guder eine nie erlahmende Energie, selbst unter persönlichen Opfern gezeigt habe, – Daß Guder die Ausführung von Operationen in seinem Hause und selbst in entlegenen Ortschaften, hier oft unter primitivsten Verhältnissen ermöglichte, ist bekannt: Die Aerzte der chirurgischen Klinik in Marburg waren ihm hierbei stets bereite Helfer. Ein ganz besonderes Verdienst hat sich Guder dadurch erworben, daß er den Kliniken der Universität Marburg Kranke zuwies und dem anatomischen und dem pathologischen Institut stets von seinen Sektionen reichliches Material zuschickte. Die Universität Marburg (Lahn) hat die großen Verdienste Guders um die Universität, um die medizinische Wissenschaft und die Kliniken dadurch anerkannt, daß sie ihn zum Ehrenbürger der Universität Marburg ernannte.
Guder hat sich verschiedentlich wissenschaftlich betätigt; er war früher Spezialist auf dem Gebiete der gerichtlichen Medizin. Sein im Jahre 1881 erschienenes Kompendium der gerichtlichen Medizin (Abels Medizin. Lehrbücher, Verlag Joh. Ambros.Barth, Leipzig) war früher ein viel gebrauchtes, durch seine klare Schreibweise und gute Dispostion ausgezeichnetes Buch. – Ein anderes von ihm bearbeitetes Gebiet betrifft den Zusammenhang zwischen Trauma und Tuberkulose (Vierteljschr. F. gerichtl. Med., 3. Folge VII, 1894). Die land- und forstwirtschaftlichen Unfälle im Kreise Wittgenstein hat er durch Franz Fischer 1901 in einer Dissertation zusammenstellen lassen. – Eine von Guder in Angriff genommene historische Darstellung auf dem Gebiete der Irrenanstalten ist leider nie zum Abschluß gekommen., obgleich er gerade auch anerkannter Fachmann durch seine irrenärztliche Tätigkeit war.
Guder stellte sich auch in den Dienst des ärztlichen Vereinswesens; er war für Zusammen-fassung und Zusammenschluß der Aerzte, um eine für den ganzen Stand nützliche Arbeitsgemeinschaft zu erzielen.
Die Hochhaltung kollegialer Gesinnung war einer seiner vornehmsten Bestrebungen. Infolgedessen war Guder eine weit über den Kreis seiner praktischen Tätigkeit nicht nur bei der Bevölkerung, sondern auch in großen Aerztekreisen bekannte und angesehene Persön-lichkeit. Er war Gründer und Vorsitzender des Aerztevereins des Kreises Wittgenstein und Ehrenmitglied des Marburger ärztlichen Vereins.
Guder war eine edle, in sich gefestigte, knorrige Persönlichkeit, unter deren rauher Außenschale sich eine Seele und ein anständiger Charakter dem Kundigen offenbarte. Eine solche Persönlichkeit wie Guder konnte sich abseits der Großstadt in einem uneingeschränkten Wirkungskreis voll entfalten. Mit Guder ist ein echter deutscher Mann dahingegangen, der auch in den schwersten Zeiten (im Kriege war er Leiter eines Vereinslazarettes) seiner Ueberzeugung treu blieb und sich mit seiner ganzen kräftigen Persönlichkeit für die Wiederaufrichtung des Volkes – hier durch stetiges Wirken und Werbearbeit beim einzelnen – einsetzte.
Paul Guder starb in Laasphe, nachdem er in der chirurgischen Universitätsklinik Marburg Heilung und Linderung seines Leidens vergeblich gesucht hatte. Er wurde unter großer Beteiligung der Bevölkerung, der Aerzteschaft, der Behörden, der Universität Marburg auf dem idyllischen Waldfriedhof bei Laasphe beigesetzt. Mit Guder ist einer der fleißigsten, pflichtgetreuesten Menschen und Aerzte dahingegangen.
Reinhardt – Leipzig“
…Ihre fundierten Hinweise…
Kohl-Witwe hat reagiert – Post auf dem in zwischen eingestellten Facebook-Kanal des VdA:
Pingback: Literaturhinweis: Roger P. Minert: Volkszählungen in Deutschland 1816 – 1916 | siwiarchiv.de
Link zum Wikipedia-Artikel über Dr. Paul Guder: https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Guder
Pingback: Online: „Das Siegthal“ – ein Reiseführer aus dem Jahr 1854 | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 30.4. – 13.5.2018 | siwiarchiv.de
Im Bildarchiv des Bundesarchivs können die „antikommunistischen Bildtafeln“ (s.o.) , die Achenbach gemeinsam mit Heinrich Hoffmann herausgegeben hatte, eingesehen werden: https://www.bild.bundesarchiv.de/dba/de/search/?channelid=dcx-channel-channel_barch_bilder&query=Robert+Achenbach&day=&month=&yearfrom=&yearto=&imageid=&title=&DC5Anlass=&DC5Verlag=&DC5TK50=&DC5Masstab=&farbe=&kostenfrei=&ausrichtung=&sort=DateImported+ASC&submit=
Abdruck des Achenbach-Gedichtes „Der aale Vedderan“ in Karl Koch: Siegener Kriegsdenkbuch 1914 – 1919. Tagebuchblätter aus dem Weltkriege. Erstes Buch: Heldentum, Siegen 1919, S. 16-17
Pingback: Zuwachs zur Plansammlung der SAG Geisweid | siwiarchiv.de
Pingback: Bereits 50.000 Datenätze im Projekt JuWeL (Juden und Dissidenten in Westfalen und Lippe) erfasst und recherchierbar | siwiarchiv.de
Bei dem „spannenden Exponat“, an dem sich die beiden Herren gerade ergötzen, handelt es sich um ein seinerzeit anscheinend in hoher Auflage unters Volk gebrachtes Porträt Hindenburgs „in Uniform mit Orden, Halbfigur / mit eigenhändiger Unterschrift und Vermerk ‚Möge unserm theuern Vaterlande der Geist von 1914 in hoffentlich langen Friedensjahren erhalten bleiben!'“ (https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction.action?detailid=v5148165)
Pfarrer Kuhlis Finger zeigt auf das Wort „Geist“, was wohl andeuten soll, dass man sich bei der Auswahl dieses Bildes durchaus etwas gedacht hat.
Pingback: 2. „Müsener Berggeschrey“ – Altbergbautagung | siwiarchiv.de
Wem die Auflösung des PDFs zu gering ist, der möge dem Hinweis dieses Tweets folgen:
Das Ende dieser „Kundfahrt“ wurde auch in österreichischen Zeitungen wahrgenommen (Kleine Volkszeitung, 7.6.1939, Bregenzer/Vorarlberger Tagblatt, Freitag, den 9.6.1939). Frage mich, ob auch italienische Zeitungen berichtet haben ……
s. a. Nachruf der Stadt Netphen, 18.5.2018: https://www.netphen.de/Quicknavigation/Startseite/Nachruf-Dr-phil-Alexander-Wollschl%C3%A4ger.php?object=tx,2267.1&ModID=7&FID=2267.2836.1&NavID=2267.47
Pingback: Fenstersturz in Bad Laasphe | Archivalia
Pingback: Umbenennung der Alfred-Fißmer-Anlage in Siegen | siwiarchiv.de
Pingback: Umbenennung der Alfred-Fißmer-Anlage in Siegen | siwiarchiv.de
Ein weiterer Grund, sich mit der Biographie Fissmers eingehend zu beschäftigen, sollte die Korrektur solcher Internetangebote sein:
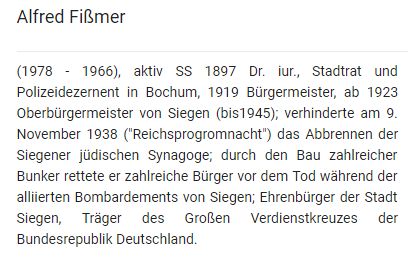
Quelle: Seite „Berühmte Bonner Burschenschafter und Bonner Alemannen“ des Vereins alter Bonner Alemannen e.V., Link: https://www.alemannia-bonn.de/geschichte/beruehmte-bonner-burschenschafter-und-bonner-alemannen/ , Aufruf: 26.5.2018
Die Burschenschaft wurde via E-Mail auf die Unrichtigkeiten (Geburtsjahr, Synagogenbrand – https://de.wikipedia.org/wiki/Synagoge_Siegen) hingewiesen.
Das Geburtsjahr ist im o. g. Eintrag korrigiert.
Im Zusammenhang mit dem Siegener Synagogenbrand bin ich auf ein Zitat aus dem Aufsatz Kurt Schildes „NS-Verbrechen „vor der Haustür“ – Novemberpogrome 1938 Vergleich der juristischen Aufarbeitung 1948 in Felsberg und Siegen“, in: Jahrbuch der Juristischen Zeitgeschichte (2011), Band 12, Seiten 91-116 aufmerksam geworden. Im Wikipedia-Artikel zu Fissmer – https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Fissmer – heißt es: „…..Von der Siegener Staatsanwaltschaft wurde Fissmer 1948 zu dem Novemberpogrom 1938 befragt; gegen ihn selbst lagen dabei keine entsprechenden Beschuldigungen vor. Er sagte aus, dass er von der Aktion nicht in Kenntnis gesetzt worden sei und erst am Vormittag des 10. November von dem Brand der Synagoge Siegen erfahren habe. Danach habe er in seiner Funktion als „Polizeiverwalter der Stadt Siegen“ Polizei und Feuerwehr verständigt. Aus der Befragung ging nicht hervor, ob Fissmer selbst vor Ort war.“ Als Quelle wird S. 106 des Aufsatzes genannt.
Die regionalhistorische Forschungen (Klaus Dietermann, Kurt Schilde [Siegener Beiträge 2003], Ulrich F. Opfermann) terminiert den Brand der Synagoge auf den späten Vormittag (ca. 12:00) und geht von einer Zerstörung der Synagoge bis auf die Grundmauern aus s. a. https://de.wikipedia.org/wiki/Synagoge_Siegen .
Der Eintrag ist nach wie vor grob unrichtig.
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 14.5. – 27.5.2018 | siwiarchiv.de
Heute erschienen in der Print-Ausgabe der Siegener Zeitung zwei Leserbriefe, die sich gegen eine Umbenennung aussprechen: „Ideologisch motiviert“ und „Vollkommen absurd“
Mit diesen Leserbriefen hat eine Diskussion begonnen, die in ihren ersten Beiträgen an lokalpatriotischer Kleinkariertheit nicht zu übertreffen ist. Hauptvorwurf gegen den offenbar in Netphen beheimateten Siegerländer Bürger, der den Wunsch nach einer Umbenennung äußert: Er komme ja doch aus Netphen. Wie könne er sich da erdreisten usw. Ein dorfgemeinschaftlicher Appell soll die ortsfremden Überlegungen fernhalten.
Na, ohne hier groß auf Fissmer (so schrieb er selbst sich, mit doppeltem „s“. Wer die Quellen kennt, der weiß das) eingehen zu wollen. In Netphen war Andreas Vomfell ein Zeit- und Amtsgenosse von Alfred Fissmer. Vomfell war Mitglied des Zentrums und anders als Fissmer ein NS-Opponent und Verteidiger der Weimarer Verfassung. Bei ihm fanden 1933 Hausdurchsuchungen durch die SA inklusive Übergriff gegen die Tochter statt. Vomfell wurde von den Nazis aus seinem Amt vertrieben.
Gerade von Netphen also lässt sich zur Zeitgeschichte etwas dazulernen: Es ging auch anders. Auch in den 1920er/30er Jahren musste man im Siegerland nicht zum Nazi werden.
Auch heute erschien ein Leserbrief zum Umbenennungsantrag im Print der Siegener Zeitung: „Name muss bleiben“.
Heute erschien in der Printausgabe der Siegener Zeitung ein Leserbrief – „Fass ohne Boden“ – , der auf den o. g. Bezug nimmt und kritisch auf die Finanzierung des Projekt blickt, das die Namensdiskussion auslöste.
Liege ich sehr falsch mit der Annahme, es handele sich bei den Leserbriefen quasi um inoffizielle Stellungnahmen des Siegener Kriegervereins? (Ich weiß, der hat sich irgendwann mal umbenannt.) Dass die beiden Autoren (Ex-Pressereferent + Schützenkönig) sich fürsorglich vor ihren alten Vereinskameraden Fissmer stellen, ist menschlich nachvollziehbar und ein Ausdruck von Loyalität. Die abstrusen Inhalte zu kommentieren, wäre Energieverschwendung. Man muss Prioritäten setzen.
Nachtrag zur Literatur:
Tobias Gerhardus: „Die zeitgemäße Ausbildung des weiblichen Geschlechts“. Zur Geschichte des Siegener Mädchengymnasiums.“ Sonderband der „Siegener Beiträge – Jahrbuch für regionale Geschichte“, Siegen 2015
In einem der Leserbriefe wird als postnationalsozialistischer Unterstützer und Leumundszeuge von Fissmer ein Wilhelm Langenbach genannt, der 1954 Fissmer lobte, weil dieser als Bunkerbauer „die Zeichen der Zeit rechtzeitig verstanden habe“, sprich, erkannt habe, dass Hitler Krieg bedeutete. So sagten es allerdings bereits vor 1933 die NS-Gegner. Sie warnten damit vor der völkischen Machtergreifung durch die NSDAP und Bundesgenossen. Während von Fissmer, der sich ihnen insofern hätte anschließen können, in dieser Richtung kein Wort überliefert ist, wohl aber, dass er mit der Kriegsvorbereitung nach 1933 umgehend anfing: Garnison, Kasernen, Wehrmachtsdepot, Bunker für die Volksgemeinschaft und manches mehr.
Leumundszeuge Langenbach dürfte darin nichts Schlimmes gesehen haben. Zu den NS-Gegnern gehörte er ebenso wenig wie Fissmer. Der städtische Fürsorgesekretär war seit den 1920er Jahren Mitglied der Deutschvölkischen Freiheitspartei, einer engen Nachbarin der NSDAP, im Stahlhelm und in der Gesellschaft Deutsche Freiheit des Antisemiten Reinhold Wulle. Obwohl erst 1936 in die NSDAP aufgenommen – ein Ehrenzutritt während der allgemeinen Aufnahmesperre –, erhielt er den Titel „Alter Parteigenosse“, eine Auszeichnung.
Fissmer als Dienstherrn störte das nun nicht. Langenbach war nicht der einzige Verfassungsfeind in städtischen Diensten. Unter Fissmers Augen recherchierte Langenbach nach „Asozialen“, das waren für ihn gern Kombinationen aus den Vorstellungswelten „Zigeuner“ und „Kommunist“. Die von Langenbach erarbeitete umfangreiche kommentierte Liste ging anschließend an die Rassenhygienische Forschungsstelle in Berlin. Die listete einschlägige rassische Risikoträger für ihre spätere Deportation auf. Die der als „Zigeuner“ Verfolgten führte nach Auschwitz.
Langenbach war ein Gegner der Beseitigung von „Asozialen“ und „Zigeunern“ auf dem Weg ihrer Sterilisierung. Er vertrat eine anderes Konzept. Er gab zu bedenken, „daß, selbst wenn die weitere Fruchtbarkeit solcher asozialer Schädlinge eingedämmt würde, sie selbst nach wie vor am Leben bleiben und noch auf Jahrzehnte hinaus der Gesamtheit zur Last fallen.“ (Volk und Rassse. Illustrierte Monatsschrift für deutsches Volkstum, H. 1, 1939)
Spätestens 1949 leitete er übrigens das Wiedergutmachungsamt der Stadt Siegen und erhielt noch wieder später für seine Leistungen das Bundesverdienstkreuz.
Leserbrief der VVN-BdA Siegerland-Wittgenstein, erschienen in der SZ und der WP am 30.5.2018
Es ist sehr zu begrüßen, das sich der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Siegen mit der Namensgebung der öffentlichen Grünanlage in der Oberstadt befassen wird und sich mit der Person und der Vita von Alfred Fissmer auseinandersetzten muss. Leider geschieht dies nicht aus Eigeninitiative der gewählten Ratsmitglieder und ihrer Gremien, sondern wieder einmal bedurfte es des Anstoßes von „Außen“ um sich mit einem belasteten Namensgeber im öffentlichen Raum zu befassen.
Es ist sinnvoll, sich vor Augen zu führen, was ein Straßenname, oder die Benennung einer öffentlichen Anlage eigentlich bedeutet. Straßennamen sind immer Teil der Erinnerungskultur einer Gesellschaft und somit identitätsstiftend, dies gilt auch für die regionale Erinnerungskultur. Straßennamen nach Personen sollten also nur in den Kanon der Erinnerung aufgenommen werden, wenn die Integrität der Person geeignet ist, als Vorbild für nachfolgende Generationen zu dienen. Die Ehrung einer Person im öffentlichen Raum, zum Beispiel durch einen Straßennamen, ist eine der höchsten, die eine Gesellschaft vergeben kann.
Wie verhält es sich nun im Fall der Fissmer-Anlage?
Der Namensgeber Alfred Fissmer war nach bisherigem Kenntnisstand immer deutschnational gesinnt, von dieser Gesinnung bis zur Mitgliedschaft in der NSDAP war es nicht weit, was sein Aufnahmeantrag von 1933 belegt, durch den Aufnahmestopp konnte er erst 1937 Parteimitglied werden. Er tritt aber 1933 als förderndes Mitglied der verbrecherischen SS bei.
Es sind diese beiden Mitgliedschaften, die ihn für eine Ehrung im öffentliche Raum ausschließen, gleich aus welchem Grund sie erfolgten, gleich welche Verdienste er sich auf anderen Gebieten erworben haben mag.
Es sollten keine Straßen oder Plätze nach Mitgliedern der NSDAP oder ihrer Untergliederungen benannt werden! Sie gehören nicht in den Kanon der
öffentlichen Erinnerung unserer Stadt und Region.
Keine Ehrung von Mitgliedern der NSDAP im öffentlichen Raum!
Dieser Satz sollte eine allgemeingültige Handlungsmaxime sein.
Der Vorschlag, eine umfassende Biographie Fissmers durch MitarbeiterInnen des Stadtarchivs und der Universität Siegen erarbeiten zu lassen, um so eine Entscheidungsgrundlage zu erhalten ist ebenfalls zu begrüßen und diese Verfahrensweise sollte in Zukunft zum Standard der Universitätsstadt Siegen gehören und bestehende, nach Personen benannte Straßennamen, sollten entsprechend überprüft und gegebenenfalls umgewidmet werden. Ebenso sollte eine öffentliche Diskussion mit BürgerInnen und Organisationen angeregt werden.
VVN-BdA Siegerland-Wittgenstein
Ton und Inhalt des Gesprächs scheinen sich zu versachlichen, daher an diesem Ort aus der historiografischen Perspektive einige Anmerkungen zum Fall Fissmer und zu den Jahren vor 1933.
Der damalige OB hat in einem postnationalsozialistischen Narrativ, das seit den ausgehenden 1940er Jahren in der Erlebnisgeneration aufkam, eine Rolle als exemplarischer Vertreter einer lokalen „deutschnational“ oder auch „national-konservativ eingestellten Elite“. Mit diesen Zuschreibungen veredelt kann er dann im Grunde seines Herzens nur ein Gegner der Nazis gewesen sein. Und seine Anhänger und Unterstützer mit ihm.
Es ist gut zu verstehen, dass ein Bedürfnis nach einer solchen Ausdeutung auch dieses Akteurs der regionalen NS-Geschichte nach den Massenverbrechen und nach dem Weltkrieg aufkam, nur passt sie nicht auf das, was die Quellen und die Literatur mitteilen.
Einen Beleg dafür, dass Fissmer je Mitglied der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) war, gibt es nicht. Die einzigen Parteien, für die eine Mitgliedschaft belegbar ist, sind NSDAP und CDU.
„Deutschnational“ oder „national-konservativ“ ließe sich auch ohne Mitgliedschaft im Sinne starker Affinitäten zu dieser Partei und ihrem Umfeld verstehen. Was hieße das dann?
Es würde auf die Nähe zu einer politischen Formation hinauslaufen, die im heutigen Kreis Siegen-Wittgenstein in der Kaiserzeit aus der antisemitischen „christlich-sozialen Bewegung“ des aufgrund seines radikalen Antisemitismus und seiner oft tumultuarischen Auftritte weithin berüchtigten protestantischen Predigers Adolf Stoecker (daher auch: „Stoecker-Bewegung) hervorging. 1918 schloss sie sich dem explizit antisemitischen Teil der neu gegründeten völkischen DNVP an.
Das besondere Merkmal des christlich-sozialen Antisemitismus war seine antikapitalistische Tönung („Enteignung jüdischer Warenhäuser“, ehrbarer kerndeutscher Kaufmann vs. jüdischen Wucherer usw.), deren Demagogie der Sozialdemokratie die Wähler abspenstig machen sollte. Die christlich-soziale Mischung ethnisierte die soziale Frage und führte fort von ihr. So machte es später auch die NSDAP. Es ist also nachzuvollziehen, wenn der Siegener Chefredakteur des christlich-sozialen Parteiblatts, das keinen Tag ohne Beiträge gegen die jüdische Minderheit erschien, 1934 darauf bestand, dass die „Stoecker-Bewegung“ ein „Vorläufer des Nationalsozialismus“ gewesen sei.
Im Siegerland fanden sich die völkischen Vertreter rassistischer Ideologie, einer Revision der Kriegsergebnisse, der Verherrlichung des Militärs, einer Abkehr von der verhassten Weimarer Verfassung usw. im „vaterländischen Lager“ zusammen. Dort waren dann DNVP, NSDAP, Kriegervereine, Antisemitischer Schutz- und Trutzbund (Selbstbezeichnung: „Siegerländer Hakenkreuzer“), SA, Stahlhelm, Kriegervereine, Bismarckjugend etc. pp. vereint am Werk, der demokratischen Republik den Garaus zu machen.
Das führte naturgemäß zu Konflikten mit deren Verteidigern. Das waren im großen und ganzen die damaligen Vorläufer der heutigen Mitteparteien und, ja, die KPD.
Drei Beispiele aus den Jahren vor der Machtübergabe:
• 1924 lud Fissmer einige Monate nach dem Hitler-Ludendorff-Putsch am 9. November 1923 zu einem städtischen „Deutschen Tag“ des völkischen Lagers mit Ludendorff als führender Figur nach Siegen, die der preußische Innenminister als verfassungsfeindlich verbot. Bereits verboten war die NSDAP, die den völkischen Festtag wesentlich organisierte (und deren Siegener Abgeordneten die Ratsfraktion der DNVP als Hospitant aufgenommen hatte).
• 1927 waren einerseits Fissmers Aktivitäten zum Reichstreffen der völkischen „Bismarckjugend“ und andererseits dessen Passivität im Vorfeld der jährlichen Verfassungsfeier ein öffentliches Thema. Die Stadträte von Zentrum, SPD, KPD und DDP werteten in einem gemeinsamen Antrag sein Verhalten als verfassungsfeindlich. Ohne große Auswirkungen, die Republikaner waren im Siegerland eine Minderheit.
• Seit den 1920er Jahren waren unter Fissmer ausgemachte Verfassungsfeinde im öffentlichen Dienst der Stadt anzutreffen, Mitglieder von NS-Organisationen oder ihrer allernächsten Nachbarn. Als im November 1932 der Gewerkschafter und Stadtverordnete Willi Kollmann von der SPD zur KPD wechselte, musste der den städtischen Dienst verlassen. Das war der Fissmersche deutschnationale Toleranzbogen.
Um an dieser Stelle zu schließen, Zuschreibungen wie „deutschnational“, „national-konservativ“ oder auch die Verschönerung „Elite“ sind nicht geeignet, aus dem Antidemokraten einen Demokraten zu machen. Der war Fissmer bei aller Leutseligkeit im Gespräch mit dem „Mann von der Straße“, die ihm ebenfalls nachgesagt wird, weder vor noch nach 1933.
Die Vorlage wurde in der gestrigen Sitzung des Haupt -und Finanzausschusses einstimmig angenommen.
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik Mai 2018 | siwiarchiv.de
Über die Ausschusssitzung berichten die Medien:
1) Siegener Zeitung, 1.6.2018 (Print): „Einstiger OB polarisiert. Wegen Bürgerantrag: Zu Alfred Fissmer bahnt sich Grandsatzdebatte an“. Zwei Zitate seien erlaubt:
– “ …. Alle HFA-Mitglieder waren sich einig, erst einmal Leben und Werken des einstigen Oberbürgermeisters ….von den Profis vom Stadtarchiv und Universität Siegen wissenschaftlich aufarbeiten zu lassen. ….“
-“ ……Zu Alfred Fissmer bahnt sich eine Grundsatzdebatte an, die auch andere belastete“ Namen von Straßen und Plätzen ausstrahlen könnte (Hindenburg, Bonatz, Stoecker usw.)“
2) Westfalenpost Siegen, 1.6.2018, Hendrik Schulz „Siegener Politik diskutiert über die Person Alfred Fißmers“: Link: https://www.wp.de/staedte/siegerland/siegener-politik-diskutiert-ueber-die-person-alfred-fissmers-id214454337.html
1. Adolf Busch
2. Fritz Busch
3. Fritz Busch: Aus dem Leben eines Musikers. Rascher Verlag, Zürich 1949
Die Lösung aller drei Fragen ist korrekt! Gratulation!
Literatur zum Thema:
– Robert Krämer: Mosquitia und die Kolonie Neu-Dortmund. Eine Vorstellung an die Kolonialfreunde und Auswanderer Dortmund 1896, Link zur PDF-Publikation der Broschüre: http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:hebis:30-1117686
– Gustav Meinecke: Siedelung in den Tropen. Eine Mahnung und Warnung. in: Koloniales Jahrbuch. Beiträge und Mitteilungen aus dem Gebiete der Kolonialwissenschaft und Kolonialpraxis, 11 Jg. Berlin 1899, S. 228 – 234
Genealogischer Fund:
19.9.1897 Helene Becker heiratete in Hilchenbach Wilhelm Feldmann aus Honduras.
In der heutigen Siegener Zeitung (Print) findet sich ein weiterer Leserbrief einer ehemaligen Sekretärin der Siegener Stadtverwaltung, die den OB persönlich erlebt hat, zum Thema: „Integrer Mann“.
Heute erschien in der Siegener Zeitung (Print) der unmittlebar auf den Bericht der Zeitzeugin bezugnehmender Leserbrief „Beeindruckend“
Die Siegener Zeitung veröffentlicht heute einen Nachruf auf Helene Wildenberg, die u. a. seit 1939 als Sekretärin des Leiter der Schutzpolizei näheren Kontakt zu Fissmer hatte.
In der Westfalenpost erschien am 2.6. der Leserbrief „Scheindebatte um Fißmer-Anlage“: https://www.wp.de/staedte/siegerland/scheindebatte-um-fissmer-anlage-id214454131.html
Das Blog dortmund-postkolonial gibt folgende Informationen:
“ …. Kolonie Neu-Dortmund in Honduras
Für ein paar Jahre geriet Honduras in den speziellen Dortmunder Blick. Der vom Postdienst freigestellte Dortmunder Lehrer Krämer warb für die Gründung der Kolonie „Neu-Dortmund“ am Tocomacho an der Miskitoküste Honduras. Eine erste Gruppe Dortmunder wanderte vor 1895 aus. 1896 kehrte Krämer zurück und beschrieb Honduras in einer Reihe von Veranstaltungen als eine Art “Schlaraffenland“. Weitere Dortmunder wanderten aus und bemerkten eine gewisse kognitive Dissonanz zwischen Phantasie und Realität. Krämer wurde 1898 zunächst in einem groß angelegten Prozeß mit ca. 50 Zeugen und unter Beteiligung von Gutachtern vor dem Dortmunder Amtsgericht wegen „Verleitung zur Auswanderung unter Vorspiegelung falscher Tatsachen“ verurteilt, allerdings im Jahre 1900 vor dem Landgericht Bochum wieder freigesprochen. 1907 taucht er im Reichstagswahlkampf als kolonialer Wahlredner auf Seiten der Nationalliberalen Partei wieder auf. ….“
Link: http://www.dortmund-postkolonial.de/?page_id=1061
Aufgrund einer Recherche des Wuppertaler Stadtarchivs konnte das vermutliche Sterbejahr von Wilhem Noss (1966 in Wermelskirchen) ermittelt werden. Leider wurde im zu untersuchenden Zeitraum 2 Personen mit dem Namen Karl Gräve ermittelt, so dass hier zu nächst nicht weiter geforscht werden kann.
Die Recherche des Archivs des Deutschen Archäologischen Institus verlief ergebnislos.
Vielen Dank an beide Kolleginnen!
Dr. Hellmuth Polakowsky berichtet in den „Mittheilungen der kaiserlich-königlichen Geographischen Gesellschaft in Wien“, Wien 1897, S. 548 – 552, über das „Kolonialisierungsvorhaben“, u. a. mit Hinweisen auf die Berichterstattung in der Dortmunder Presse – Link zur PDF via ANNO erstellt.
Pingback: Ausstellung: „#mehralsdagegen. Schüler(protest)bewegungen 1968ff.“ in Lemgo | siwiarchiv.de
In der Westfalenpost erschien heute der Leserbrief „Von Neubauten und einem Fißmer-Schild“: https://www.wp.de/staedte/siegerland/von-neubauten-und-einem-fissmer-schild-id214510165.html
Guten Morgen aus Büschergrund,
gerade lese ich von der Lesung heute Abend und frage mich, ob die öffentlich ist. Da ich aktuell auch bei meinen eigenen Familienforschungen Verbindungen zur Familie Breitenbach nachgehe (genauer gesagt, einer Verbindung zu August Breitenbach (Walzengießerei Roland), dessen Haushälterin -meine Großtante- seine Cousine gewesen sein soll) , wäre das für mich sehr interessant.
Vielen Dank für eine Rückmeldung.
Es grüßt freundlich,
Christoph Reifenberger
Die Veranstaltung hat am 10. Januar 2014 stattgefunden. Die Veranstaltungen der familienkundlichen Arbeitsgemeinschaft des Siegerländer Heimat- und Geschichtsvereins sind öffentlich. Wegen Ihrer genealogischen Forschungen empfehle ich Ihnen mit de Gerhard Moisel, Haus der Kirche, Burgstr. 21, 57072 Siegen, Kontakt aufzunehmen. Moisel fungiert als Ansprechpartner der genannten Arbeitsgemeinschaft.
Danke für die Info. Da hab ich mich wohl vom Tagesdatum oben auf der Website irritieren lassen.
Guten Tag,
dieses Buch interessiert mich sehr.
Wo kann ich es erwerben.
Freunndliche Grüße
s. o.: “ …. Zur Bestellung e-mail an den Autor: H.Imhof@gmx.de ….“
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 28.5. – 10.6.2018 | siwiarchiv.de
Pingback: Nachfolgeregelung und Fortführung der Arbeit des Stadtarchivs Hilchenbach | siwiarchiv.de
Heute erschien in der Siegener Zeitung ein Leserbrief zur Debatte: „NSDAP-Bürgermeister“, u. a. mit dem Vorschlag den.Platz nach dem Siegener Landrat Heinrich Otto zu benennen.
s. Steffen Schwab, „Nur noch ein „halber“ Archivar für Hilchenbachs Stadtarchiv“, in: Westfälische Rundschau (Print), 13.6.2018, Link: https://www.wp.de/staedte/siegerland/nur-noch-ein-halber-archivar-fuer-hilchenbachs-stadtarchiv-id214562511.html
Pingback: Lesung „Hoffnung auf eine besseres Leben“ | siwiarchiv.de
Heute erschien in der Siegener Zeitung (Print) der Artikel mit der m. E. unpassenden Schlagzeile“Offene Tür kommt zu den Akten. Stadtarchiv wird künftig nicht mehr den gewohnten Service leisten können. Nachfolger wird nur mit halber Stelle als Archivar arbeiten“.
>>Lesung „Hoffnung auf eine besseres Leben“<<
heißt es nicht "einem besseres Leben"… man kann sich ja an allem gewöhnen, sogar am Dativ… bitte korrigieren!
Danke für den Hinweis auf den Tippfehler! Ich denke, auch die jetzige Fassung wird Ihr Grammatikempfinden nicht beleidigen …..
Ich war erstaunt, dass über einen der bekanntesten Forstmänner Wittgensteins noch nichts im Netz zu finden war. Bei den Recherchen zu Louis Reuß bin ich auf eine Irritation gestoßen, die bisher noch nicht zu beseitigen war: Wied berichtet, Reuß sei am 10.10.1812 geboren. Ein Urenkel von Reuß gibt 1982 das gleiche Geburtsdatum bei der Überreichung des Portraits an die Rentkammer an. Auf dem Denkmal ist jedoch das Geburtsjahr 1813 (!) in Bronze gegossen. Die Personalakte Reuß war im Archiv bisher nicht auffindbar. Leider führte auch die Suche über Archion noch nicht zur Auffindung des relevanten Taufbuches.
Die Sterburkunde Reuß´ könnte darüber Auskunft geben, sowie die Geburtsurkunde der Kinder oder die Heiratsurkunde der Eheleute Reuß….
Vielleicht findet sich auch hier etwas: Naumann, Gerhard: Forstgeschichte der ehemaligen Grafschaft Sayn-Wittgenstein-Hohenstein bis 1900. Mit einem Überblick über die Entwicklung im 20. Jahrhundert. Göttingen 1970.
Gerhard Naumanns Dissertation empfiehlt sich auf jeden Fall für die vertiefte Lektüre zur Wittgensteiner Forstgeschichte und geht natürlich auch auf Reuß ein. Um dessen Geburtsjahr zu verifizieren, müsste dann aber doch auf amtliche Dokumente zurückgegriffen werden; in solchen Zweifelsfällen ist Sekundärliteratur nicht beweiskräftig.
Über eine Digitalisierung der unveröffentlichten Denkschrift von 1868 könnten ja die Wittgensteiner Archivare einmal nachdenken (vielleicht mit Unterstützung des Kreisarchivars). Vorab kann zum gleichen Thema auf einen veröffentlichten Beitrag Reuß‘ „Aus der Correspondenz“ (1868) hingewiesen werden, in:
Aus dem Walde 2 (1869), S. 103-119.
books.google.de/books?id=07kCAAAAYAAJ
Diesen Briefauszug nahm Ludwig Jäger zum Anlass für seinen Artikel „Über den früheren Zustand der fürstl. Sayn-Wittgenstein-Hohensteinischen Waldungen …“ in:
Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung N.F. 46 (1870), S. 237-242.
books.google.de/books?id=sYZAAAAAcAAJ
Eine erste sehr knappe Erklärung Reuß‘ brachte das August-Heft der AFJZ (S. 328): „Herr Forstdirector Jäger in Laasphe hat sich im Juni-Hefte dieser Blätter über die Bewirthschaftung der fürstlich Wittgenstein’schen Forsten in einer Weise ausgelassen, die mich zu einer Entgegnung unabweislich verpflichtet. Dieselbe liegt druckfertig da. Angesichts der hereinbrechenden Katastrophe aber [dt.-frz. Krieg], und beherrscht von dem Eindrucke des furchtbar ernsten Moments halte ich es für angemessen, die Sache für jetzt ruhen zu lassen.“
In der Dezember-Ausgabe (S. 482) ging er in „Reuß contra Jäger“ dann etwas ausführlicher auf das Ärgernis ein und kündigte das Erscheinen seiner (inzwischen auf 40 Seiten angewachsenen) Verteidigungsschrift als Separat-Druck an (siehe Lit.-Verz. im Wikipedia-Eintrag).
Lesenswert ist auch die von Wilhelm Hartnack aus dem Nachlass veröffentlichte und interessant kommentierte „Bemerkenswerte Geburtstagsrede des Forstrats Reuß“ in:
Wittgenstein 26 (1962), S. 36-39
Eine informative Kurzbiographie des fachlich versierten aber menschlich wohl sehr problematischen Ludwig Jäger in:
Biographien bedeutender hessischer Forstleute, Wiesbaden 1990, S. 357-364.
(Kleine Anmerkung am Rande: Bei dem vom Administrator hier eingestellten Wikipedia-Artikel handelt es sich um eine „alte Version“, die durch eine geringfügig aktualisierte ersetzt worden ist.)
Pingback: Buchprojekt zur Geschichte des Siegerlands und Wittgensteins im 19. Jahrhundert | siwiarchiv.de
In der heutigen Siegener Zeitung (Print) erschien der Leserbrief „An Albert Speer gedacht“, der sich u. a. auch mit der Namensgebung der Fißmer-Anlage auseinanadersetzt.
Pingback: Willy Brandt in Siegen 1965 | siwiarchiv.de
Herzlichen Dank für die Hinweise der Herren Wolf und Kunzmann. Die Dissertation von G. Naumann werde ich im Hinblick auf Reuß gerne noch auswerten. Die „Geburtstagsrede“ von Reuß 1868 auf dem Friedrichshammer ist tatsächlich lesenswert und bringt, neben dem, was zwischen den Zeilen zu lesen ist, ja letztlich auf den Punkt, dass die Entwicklung eines Waldes immer ein Projekt über mehrere Generationen hin ist. Hinsichtlich der Irritation bezgl. des Geburtsjahres von Reuß läuft eine Anfrage im Gemeindebüro Harzgerode.
Während das „Wittgensteiner Kreisblatt“ in Berleburg die Einweihung des Denkmals am 12.Juli 1910 mit keiner Zeile erwähnt, schreibt die damals in Laasphe erscheinende „Wittgensteiner Zeitung“ in ihrer Ausgabe vom Samstag, 16.Juli 1910:
„Aus Laasphe und Umgegend.
Laasphe, 15. Juli. (Gedenkfeier für Oberforstrat Reuß)
Dem ehrenden Andenken eines um unser Fürstliches Haus hochverdienten Mannes galt eine würdige und seltene Feier, die am verflossenen Dienstag, in der Nähe von Schloß Wittgenstein, auf der sog. Alteburg, im herrlichen Waldesgrün unter dem Schatten mächtiger Buchen und umflossen vom hellsten Sonnenschein vor sich ging. In dankbarer Anerkennung der bleibenden Verdienste des in den Jahren 1857 bis 1872 hier wirkenden Oberforstrats Louis Reuß hatten Se. Durchlaucht Fürst Ludwig in hochherziger Weise beschlossen, dem Verstorbenen ein bleibendes Denkmal durch Aufstellen eines würdigen Gedenksteines zu errichten. In Gegenwart Sr. Durchlaucht des Fürsten, Ihrer Durchlaucht der Fürstin, sowie des ganzen Fürstlichen Hauses, ferner zweier als Gäste geladenen Söhne und einer Tochter und Enkelin des zu Ehrenden, sowie der höheren Verwaltungsbeamten und des Forstpersonals wie zahlreicher Zuschauer fand am genannten Tage nachmittags 1 ½ Uhr die weihevolle Feier statt. Nachdem zu Beginn derselben Se. Durchlaucht der Erbprinz in einer kurzen Ansprache das weitausschauende Wirken und die unvergänglichen Verdienste des Oberforstrats Reuß betont und den Denkstein der Fürstlichen Verwaltung übergeben hatte, fiel die Hülle und die Marburger Jägerkapelle intonierte das Lied „Wer hat dich du schöner Wald“, während Se. Durchlaucht der Erbprinz einen Eichenkranz am Sockel niederlegte. Den Blicken der Zuschauer präsentierte sich nun der in seiner Schlichtheit edel wirkende Gedenkstein. In die nach Osten gerichtete polierte Vorderseite eines mächtigen Syenitblocks ist das in Bronze gegossene wohlgetroffene Relief-Brustbild des Oberforstrats Reuß, umrahmt von einem Eichenkranz, eingelassen. Darunter stehen die Worte: „Oberforstrat Louis Reuß 1857-1872.“ Der Gesamteindruck ist höchst wirkungsvoll, die Ausführung von künstlerischer Vollendung und das Ganze dem grünen Waldrahmen vorzüglich angepaßt. – Nachdem die Musik geendet, trat Herr Kammerdirektor Dr. Mertens vor, übernahm das Denkmal als Vertreter der Fürstlichen Verwaltung und legte ebenfalls einen Kranz nieder. Seine Ansprache endete mit einem begeistert aufgenommenen Hoch auf Se. Durchlaucht den Fürsten und das Fürstliche Haus. Hierauf hielt Herr Forstrat Rühm eine längere Rede, in welcher er das segensreiche Wirken des Oberforstrats Reuß hervorhob. Nachdem die Musik nochmals gespielt hatte, auch noch ein dritter Kranz, gestiftet von einem in Oesterreich lebenden dritten Sohn des Verewigten, Herrn Oberforstrat Dr. Herm. Reuß, der leider nicht anwesend sein konnte, am Denkmal niedergelegt worden war, war die eindrucksvolle Feier zu Ende. Nach der Einweihungsfeier fand Hoftafel für die geladenen Gäste und die höheren Fürstlichen Beamten statt, zu der die Jägerkapelle die Tafelmusik stellte, während sich die Forstbeamten zum Festessen im Kurhaus versammelten und hier noch manche Stunde fröhlich vereint blieben.“
Pingback: Siegener Beiträge – Jahrbuch für regionale Geschichte 22/2017-2018 erschienen | siwiarchiv.de
Pingback: Siegener Beiträge – Jahrbuch für regionale Geschichte 22/2017-2018 erschienen | siwiarchiv.de
Wie in Zeitschrift „Siegerland“, Bd. 91/Heft 1, 2014, S. 164-166 von mir beschrieben, liegt im LWL -Freilichtmuseum seit 1968 auch noch das Haus Fuchs aus Weidenau, (ehem ) Untere Friedrichstr. 7. und harrt dort auf den Wiederaufbau.
Hof Stöcker aus Burgholdinghausen ist mit Foto u.a. auch beschrieben von Stefan Baumeier in “ Westfälische Bauernhäuser-Vor Bagger und Raupe gerettet-„. Westfalen Verlag 1983- Seite 228. Foto des Hauses kann dem Archivar zur Verfügung gestellt werden, wenn er es nicht irgendwo anders finden kann.
Zur Rolle des OB zwischen 1933 und 1945
1.
Mit Antritt der Regierung Hitler aus NSDAP, DNVP und Stahlhelm begannen 1933 in Siegen im “Braunen Haus”, der früheren Alten Försterei, die systematischen Folterungen von politischen Gegnern durch SA und SS. Die Opfer wurden im Anschluss vor die Türe gesetzt und schleppten sich durch die Stadt nach Hause. Es handelte sich um öffentlich wahrnehmbare und wahrgenommene Vorgänge. “Es reden”, wie der katholische Pfarrer Wilhelm Ochse von der Mariengemeinde in einer schriftlichen Stellungnahme an Alfred Fissmer feststellte, “schon die Kinder über diese Dinge.“
Was waren „diese Dinge“? Dazu nur ein kurzer Auszug aus einer längeren Schilderung eines Zeitzeugen:
Der Siegener Elektriker Erich Schutz wurde von einem SA-Kommando ins Braune Haus verschleppt und dort mit Gummiknüppeln und Gewehrkolben schwer misshandelt. Die Gallenblase riss, sie musste später entfernt werden. Es wurden ihm schwere Darmverletzungen zugefügt. Der Siegener Arzt Dr. Walter Nöll verweigerte ebenso die Behandlung von Erich Schutz wie der Siegener SS-Arzt Dr. Ferdinand Pahl, der ihm statt Behandlung etwas Morphium gegen die Schmerzen gab. Pfarrer Ochse sorgte dann dafür, dass Schutz im katholischen Marienhospital aufgenommen wurde. Von dort konnte er erst mehr als ein halbes Jahr später entlassen werden. Bis 1938 blieb er arbeitsunfähig.
Die Polizei war zum Zeitpunkt der Ereignisse noch nicht zentralstaatlich, sondern kommunal, und in Siegen war Alfred Fissmer nicht nur Chef der Verwaltung, sondern auch der Polizei. In die Polizei eingegliedert waren seit Februar 1933 auch die SA und die SS als Teil der SA. Fissmer wusste von den Vorgängen im Braunen Haus. Er wusste, wen er förderte, als er 1933 Förderndes Mitglied der SS wurde.
Das oben zitierte Schreiben von Ochse an Fissmer war an den Polizeichef gerichtet. Ochse forderte Fissmer dazu auf, die Folterungen abzustellen. Fissmer schwieg. Später warf er Ochse vor, die NS-Bewegung verächtlich zu machen. Das war ein Straftatbestand des “Heimtückegesetzes”. Weil er es wiederholt verletzt habe, wurde Ochse 1935 festgenommen und von einem Sondergericht zu acht Monaten Gefängnis verurteilt.
2.
1933 wurde der bei der städtischen Sparkasse tätige Stadtinspektor Friedrich Vetter auf Fissmers Initiative nach dem NS-Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums zwangspensioniert. Vetter hatte nachdrücklich finanzielle Unregelmäßigkeiten gegenüber höheren Instanzen beklagt. Davon ließ er auch nach seiner Entlassung nicht ab und verbreitete seine Angaben in der städtischen Bevölkerung. Es folgten Hausdurchsuchungen, eine Verurteilung zu neun Monaten Gefängnis und eine weitere zu fünf Monaten und anschließender Internierung als „geisteskrank“ in der Heilanstalt Eickelborn, wo er ein Jahr und vier Monate verbrachte. Als die beiden entscheidenden Triebkräfte seiner Verfolgung betrachtete er den OB und den Gauinspektor Walter Heringlake, dessen umfangreicher Arisierungserfolg viele Städter nicht überraschte und später ein Überprüfungsverfahren durch die Partei auslöste.
3.
Nach Aussage des jüdischen Siegeners Hugo Herrmann wurden bereits am Vormittag des 9. November 1938 zahlreiche begüterte Männer aus der jüdischen Gemeinde, so auch er, festgenommen. Sie wurden in Siegen im Polizeigefängnis festgehalten, bevor sie nach dem Pogrom – in Siegen am Mittag des 10. November – in das KZ Sachsenhausen deportiert wurden, um ihren Familien ihre Immobilien und Geschäfte abzupressen. Die reichszentralen Pogrom-Aufforderungen zu diesem Zweck gegen die jüdische Minderheit ergingen in der Nacht des 9. November, und der Befehl des Gestapochefs Heinrich Müller “etwa 20-30.000” jüdische Männer festzunehmen, folgte ihnen erst in dieser Nacht um 23.55 h.
Mit anderen Worten, wenn die Angaben des Zeitzeugen stimmen, dann kann es sich bei der Siegener Aktion nur um einen vorzeitigen und für die Region untypischen lokalen Festnahmealleingang gehandelt haben. Das wäre insofern nichts grundsätzlich Ungewöhnliches, als untere NS-Behörden sich oft proaktiv und nach oben impulssetzend verhielten, so bei anderen Themen auch im heutigen Kreisgebiet. Auszugehen ist bei den Siegener Festnahmen, dass sie auf Fissmers persönliche Initiative oder doch jedenfalls nicht ohne Absprache der Siegener Polizei mit ihrem höchsten Vorgesetzten, auf keinen Fall aber an ihm vorbei erfolgten.
Was Hugo Herrmann angeht, so konnte er sich nach der KZ-Entlassung und dem Verlust des größten Teils seines Vermögens 1939 durch Flucht nach Palästina retten. Dass Fissmer als Fluchthelfer aufgetreten wäre, ist nicht bekannt und würde wenig zu ihm gepasst haben. Den billigen Erwerb des Grundstücks der ausgebrannten Synagoge von der jüdischen Gemeinde bewertete er “als eine wertvolle Ergänzung unseres Besitzes”.
Für die in der aktuellen Diskussion vorgetragene Aussage, Fissmer habe gelegentlich Menschen aus der jüdischen Minderheit unterstützt und sie geschützt, würde der Verifizierung, sprich konkreter Belege – Namen, Zeitpunkte, Anlässe –, bedürfen, um sie ernst nehmen zu können. Die gibt es bislang nicht. Fissmer selbst hat sich dazu nie geäußert, auch nicht in seinem Entnazifizierungsverfahren, als das “Untragbar” des ersten Durchgangs (Stadtausschuss) angesichts drohenden Pensionsverlusts solche Verweise dringlich gemacht hatte.
4.
Aussagen zu Hilfe für Verfolgte durch Nichtverfolgte finden sich immer wieder vor allem in den regionalen Entnazifizierungs- und Entschädigungsakten. Beide Quellenkategorien sind inzwischen in einem hohen Maß recherchiert und ausgewertet worden. Aussagen über angebliche oder nachgewiesene Unterstützungsleistungen durch Fissmer für aus politischen, rassischen, sozialen oder religiösen Motiven Verfolgte liegen dort bislang nicht vor, wohl aber Aussagen gegen ihn. Pauschale Behauptungen, wie sie in der politischen Diskussion seit dem Regimeende dennoch auftreten, führen nicht weiter.
Verifizierende Belege und die Einordnung von Vorgängen in die jeweiligen zeitlichen Kontexte:
Das sollte in allen Fragen gelten. Dass Fissmer ein “NS-Gegner” gewesen sei, der „die Nazis wie die Pest gehasst“ habe, wie man aus „vertraulichem“ Umgang mit ihm wisse, kann man behaupten, wie man alles behaupten kann. Allerdings ist es eine Behauptung ohne Basis, ohne Beweiskraft. Die würde sich an Handlungen festmachen lassen müssen und dazu wiederum genügen ein paar Sätze gegen einen obsolet gewordenen Nero-Befehl in der allerletzten Stunde vor dem großen Kollaps nicht, wie sie in einem Beitrag behauptet wurden.
Was reale NS-Gegner (und NS-Verfolgte) als solche ausweist, lässt sich an den Fällen Hugo Herrmann, Wilhelm Ochse, Erich Schutz, Friedrich Vetter oder Andreas Vomfell erkennen. Es ist schon erforderlich, in einem Spektrum der Verhaltensweisen und Entscheidungsoptionen klärende Unterscheidungen zu treffen und Abgrenzungen vorzunehmen, wenn das Wort vom “NS-Gegner” nicht eine Hülse diffusen Inhalts und ohne eine nachvollziehbare Aussage sein soll.
Ebenfalls nicht weiter, vielmehr zurück in die entlastenden Narrative der fünfziger Jahre führen völkisch inspirierte Vergemeinschaftungsversuche, die “den” Siegenern, Netphenern oder Siegerländern in pauschaler Vereinheitlichung kollektiv diese oder jene Sichtweise auf die regionalen NS-Akteure unterstellen und ihre Adressaten auf diesem Weg zu vereinnahmen suchen. Offenkundig gingen und gehen durch die Zeiten die Meinungen in der Siegener und Siegerländer Bevölkerung zur NS-Bewegung, zu deren Wegbereitern und zum etablierten NS-Regime sach-, interessen- und persönlichkeitsbezogen weit auseinander.
(Quellenangaben auf kurzem Weg: siehe die Verweise in den entsprechenden Artikeln der Personenverzeichnisse der VVN-BdA)
Ich rate nur zur Frage 1: Die steht in Siegen an der Leimbachstraße.
Den Standort muss ich selbst noch prüfen ;-).
Ich denke, die Reithalle stand in der Schemscheid und wurde um 1929 eröffnet.
So früh war die Eröffnung nicht …..
Da lag ich leider um 1 Jahr zu früh.
Wo oder wie kann ich denn hier ein Bild dieser Halle von 1937 einstellen?
… oder soll ich es in Facebook unter „Stadt Siegen in alten und neuen Bildern“ einstellen?
Hier finden Sie die Kontaktdaten für siwiarchiv: http://www.siwiarchiv.de/kontakt-impressum/ . Das Bild stelle ich dann als Kommentar zum Eintrag ein.
Dieses Foto von 1937 hat Manfred Knoche vor einiger Zeit aus einem Beitrag in facebook extrahiert.
Links unten erkennt man die Gebäude und ihre Lage.
Zusätzlich ein Bild zur Lage der Halle aus der Karte von 1939.
Vielen Dank für die beiden Ergänzungen!
Das denke ich auch. Zumindest war hier nach 1933 mindestens eines der großen Reitturniere, bei denen Wehrmachtsoffiziere in Uniform mitritten und die Kreisleitung Hof hielt. Josef Balogh hatte hier in verschiedenster Hinsicht mitorganisiert…
Es war in der Tat nach 1933 – aber wann?
Im Eintrachtpark. Von der Stadt Siegen zwischen 1959 und 1961 erbaut. Die Johanneskirche wurde dafür im Herbst 1958 in den Stadtteil Achenbach verlegt.
Leider nein.
Pingback: Reinhard, Hans und Ulf Lüster – Vater und Söhne im Nationalsozialismus | siwiarchiv.de
Pingback: Willy Brandt in Siegen-Geisweid 1961 | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 11.6. – 24.6.2018 | siwiarchiv.de
Pingback: Siegener Beiträge – Jahrbuch für regionale Geschichte 22/2017-2018 erschienen | siwiarchiv.de
Pingback: Siegener Beiträge – Jahrbuch für regionale Geschichte 22/2017-2018 erschienen | siwiarchiv.de
Die Siegerlandhalle stand „Auf der Schemscheid“ und wurde wahrscheinlich zwischen 1933 und 1939 eröffnet.
Die Sportfreunde Siegen nutzten den Stadtplatz wohl von 1923-1957 als Spielstätte. Im 2. Weltkrieg wurde der Platz u.a. für Reitturniere genutzt.
Die Errichtung einer Reithalle/Sporthalle könnte auch im Zusammenhang mit der Machtübernahme durch die NSDAP im Jahre 1933 zu tun haben. Die Vereine wurden eingegliedert in deren Strukturen. Es galt Sport vor Politik. U.a wurde im Laufe der Jahre reichlich Geld in den Bau von Sportstätten und Hallen investiert.
Jetzt fehlt nur noch das richtige Datum …..!
Pingback: Wilnsdorfer MuseumsMomente feiern erstes Jubiläum | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik Juni 2018 | siwiarchiv.de
Diese Siegerlandhalle wurde am 27. April 1938 eröffnet:
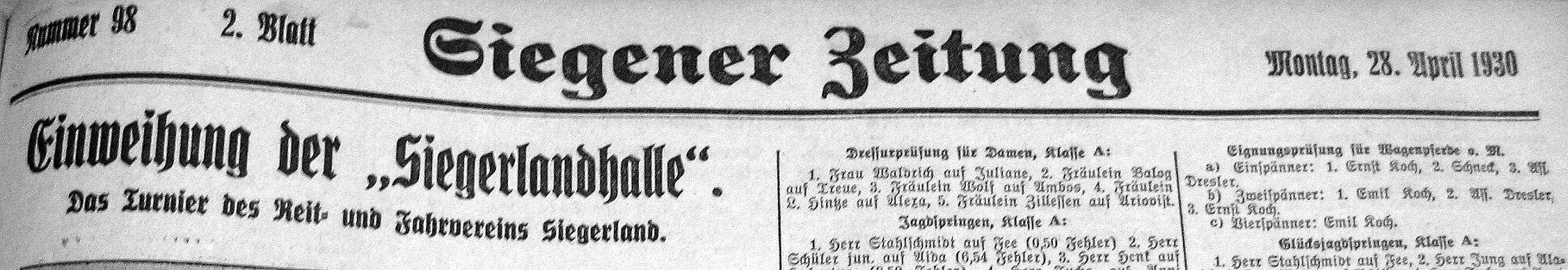
Da lag ich mit meiner Einschätzung ja goldrichtig ;-)
Ich lese: Montag, 28. April 1930, nicht 1938.
Der 28. April 1938 war ein Donnerstag.
Danke für den Hinweis auf den Tippfehler meinerseits: 1930 ist korrekt!
Es lautete ja auch „Fotorätsel“ ! ;-)
Pingback: „Zeitspuren“-Linktipp: Karte des Kreises Siegen vom Juli 1817 | siwiarchiv.de
Im Kurzkommentar der „Zeitspuren“-Bearbeiter zu dieser Karte heißt es:
„Auffallend ist die Nicht-Verzeichnung des Amtes Ferndorf, die für eine unzureichende Ortskenntnis des Zeichners spricht – möglicherweise handelte es sich um einen ungeprüften ‚Schnellschuss‘.“
Bevor womöglich die Aussage in das projektierte Monumentalwerk zur Kreisgeschichte übernommen und damit ihrerseits als „Schnellschuss“ konserviert wird, könnten die Autoren noch tiefer in die verwirrende Siegerländer Verwaltungsgeschichte eintauchen. Der Zeichner Friedrich Carl Padberg, spätestens seit 1823 als Kataster-Geometer bei der Arnsberger Regierung nachgewiesen, war vermutlich auch 1817 nicht bloß irgendein Hobby-Kartograph mit unzureichenden Ortskenntnissen. Wenn er ein „Amt Ferndorf“ nicht verzeichnete, könnte das schlichtweg daran gelegen haben, dass es ein solches (im Sinne von „Gerichtsbezirk“) 1817 nicht gegeben hatte. Das alte Amtsgericht Ferndorf-Krombach existierte zu dieser Zeit längst nicht mehr. (Dass der Volksmund den Begriff „Amt“ vielleicht synonym für die Bürgermeisterei Ferndorf benutzte, kann ja sein).
Bei der Karte handelt es sich sicherlich um keinen „Schnellschuss“, denn die Karte des Amtes Hilchenbach von 1815 (Henning, Wirtschaftsgeschichte des Hilchenbacher Raumes, S. 141) kennt eine ähnliche Einteilung. Dort reicht das Amt Hilchenbach auch von Lützel bis Osthelden in Ost-West-Ausrichtung. Vom Amt bzw. von der Bürgermeisterei Ferndorf keine Spur. Welche Verwaltungsreformen waren für die Zusammenlegung von Hilchenbach und Ferndorf zwischen 1813 und 1817 verantwortlich, als die Einteilung in „Bürgermeistereien“ erfolgte.
Auf der Grundlage der westfälischen „Landgemeinde-Ordnung“ (1841) wurde 1844 das Amt Ferndorf neu gebildet. Von 1815 an handelte es sich um die Bürgermeisterei Ferndorf im Amt Hilchenbach ….. Wenn ich Wikipedia richtig verstehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Amt_Ferndorf
Wilhelm Güthling, Der Kreis Siegen im Jahre 1817, in: Siegerland 44 (1967), S. 1-16: Als Anlage III bringt Güthling ein „Verzeichnis der zum Kreise Siegen gehörigen Städte und Ämter und der darin angestellten und fungierenden Behörden 1816, zusammengestellt aus Archivalien des Staatsarchivs Koblenz“. Genannt werden (neben dem Stadtbezirk Siegen) genau die 6 Ämter, die auch in Padbergs Karte ausgewiesen sind. Ferndorf findet man in Anlage II im Verzeichnis der 11 Bürgermeistereien.
Damit nicht erst ein falscher Eindruck entsteht: Es geht hier nicht um Spitzfindigkeiten von Zaungästen, mit denen das literarische Großprojekt miesgemacht werden soll. Lieber schon jetzt alles Auffällige ansprechen, als die beiden Bearbeiter (w/m) einfach später in die Messer der Rezensenten laufen zu lassen.
Genau das ist der Sinn und Zweck der Verlinkung hier auf siwiarchiv! Allerdings wird sicher auch gerne ein Lob genommen. ;-)
Frau Strautz und Herr Pfau wissen, dass ich ihnen auch ohne öffentliche Bauchpinselung gewogen bin und ihre Bemühungen für dieses durchaus problematische Auftragswerk keineswegs gering schätze. Gern spreche ich dem Administrator ein besonderes Lob für alles Lobenswerte bei Siwiarchiv aus :-) :-) :-)
Wenn Sie einen Beitrag kritisch kommentieren, wissen wir Ihre Aufmerksamkeit zu honorieren ;-)
Der „Zeitspuren-Bearbeiter“ dankt Peter Kunzmann für diesen wichtigen Hinweis und Bernd Plaum für seine ergänzenden Anmerkungen. Damit ist zugleich der von siwi-archiv dankenswerter Weise ermöglichte Meinungsaustausch über die „Ereignistafel“ eröffnet, die im Rahmen des Forschungs- und Buchprojekts „Zeitspuren in Siegerland und Wittgenstein. Das lange 19. Jahrhundert“ präsentiert wird. Zu diesem Meinungsaustausch sind sach- und fachkundige ebenso wie allgemein heimat- oder regionalgeschichtlich Interessierte herzlich eingeladen. Sachliche Unrichtigkeiten werden, wie in diesem Fall, möglichst zeitnah korrigiert. Friedrich Carl Padberg hat sich bei der Erstellung dieser Karte nicht an der zu dieser Zeit noch üblichen Verwaltungsgliederung nach Bürgermeistereibezirken, sondern an der 1817 geltenden Einteilung der Gerichtsbezirke orientiert. Wer würde behaupten wollen, dass diese Aufgabe einem „Hobby-Kartographen“ erteilt worden wäre? :-)
Woran sich Padberg auch immer orientiert haben mag, an den Gerichtsbezirken vielleicht doch nicht! So klagten die Einwohner Hilchenbachs 1815 darüber, dass das ehemalige Justizamt „in das unbedeutende Dorf Obernetphen“ verlegt worden war. Sie baten 1825 erneut, die Verlegung des Gerichts wieder rückgängig zu machen? (Vgl. dazu: Mahrenholz/Klein, Zur Geschichte des Amtsgerichts Hilchenbach, in: Recht im südlichen Westfalen, Siegen 1983, S. 138-19, hier: 145-146 ). Nach dieser Erkenntnis hätte Padberg die Grenzlinie zwischen Netphen und Hilchenbach weglassen können, was er aber nicht getan hat.
Anderersets: Bereits 1775 wurde das alte Gericht Ferndorf/Krombach nicht wieder neu errichtet, sondern zwischen den Justizämtern Freudenberg und Hilchenbach aufgeteilt (s. Weller, Das Gericht Ferndorf und Krombach, in: Ebd., S. 150-156). Danach wurde der ehemalige Gerichtsbezirk Ferndorf/Krombach von Hilchenbach aus betreut. Diesen Sachverhalt wiederum bildet Padberg ab, aber warum bezeichnet er die eingezeichneten Verwaltungsbezirke als „Amt“ und nicht als „Gerichtsbezirk“ wie es in anderen zeitgenössischen Karten durchaus vorkam?
Vielleicht ist die Verwendung des Begriffes „Amt“ für „Gerichtsbezirk“ zeitgenössisch gewesen. Im Amtsblatt der königlichen Regierung Arnsberg aus dem Jahr 1839 fand sich bei einer einfachen google-Suche nach „Amt Hilchenbach“ eben diese Verwendung – s. Link: https://books.google.de/books?id=1PtOAAAAcAAJ&pg=RA2-PA62&dq=amt+hilchenbach+1839&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjCn5Xw9IXcAhUm8IMKHS5UAkwQ6AEIKDAA#v=onepage&q=amt%20hilchenbach%201839&f=false
Suchbegriffe in Google und Lemma in Wikipedia sagen uns nicht alles! Ein genauer Blick in das Original offenbart uns folgendes: Dort steht nämlich „J.Amt Hilchenbach“, was nichts anderes bedeutet als Justiz-Amt Hilchenbach. Das Gebiet des Justizamtes (=Gerichtsbezirk) ist nicht unbedingt identisch mit dem Amtsbezirk (=Verwaltungsbezirk). Es fand also schon eine sprachliche Unterscheidung statt.
1) Zum Quellenwert von google und Wikipedia muss hier nichts ausgeführt werden – außer dass dort Richtung ermittelt werden kann, in die die vertiefende Recherche gehen sollte.
2) Meine These ist ja, dass die Verwaltungsbezirke ab 1815ff Bürgermeistereien hießen – s. u. Güthling 1967 – , die Justizbezirke (Justiz-)Ämter. Padberg hat nun offensichtlich für die Beschriftung der Karte die Justizbezirke ausgewählt, evt. ohne dabei besonders akkurat gearbeitet zu haben. Belege für diese möglicherweise rasche Arbeit sind ja hier bereits genannt worden und führen eigentlich auch zu der Frage, warum die Karte überhaupt angefertigt wurde.
Auffällig ist, dass die Dörfer Beienbach und Grissenbach im Amt Netphen gar nicht eingezeichnet sind. Auch ist Wilgersdorf als Wilgersbach bezeichnet. M. E. alles durchaus ein Zeichen mangelnder Sorgfalt.
Und wieder muss ich den mir unbekannten Herrn Padberg in Schutz nehmen. Als guter Preuße (wenn er denn einer war) wird er wohl so sorgfältig, wie es ihm die gegebenen Voraussetzungen erlaubten, gearbeitet haben. Offensichtlich kannte er aber das Siegerland nicht persönlich, was aus fehlenden Dörfern und zahlreichen Falschschreibungen zu schließen ist. Welche Vorlage(n) er für seine Zeichnung benutzte und in welchem Zusammenhang diese entstand, wäre sicherlich interessant zu klären. Damit kann man sich ja einmal beschäftigen. Hier ging es zunächst nur um die „Ämter“, und da scheint er nichts falsch gemacht zu haben.
Es wird wohl Zeit sich Friedrich Carl Padberg genauer zu widmen. Beim googlen wird man zumindestens auf das Amtsblatt für den Regierungsbezirk Arnsberg aus dem Jahr 1823 verwiesen, dass belegt, das Padberg als „Obergeometer-Gehülfe für Arnsberg“ angestellt war.
Das hessische Archivinformationssystem weist folgende Angaben aus, die Friedrich Carl Padberg zu beziehen scheinen:
1) „Topograph beim Landesvermessungsgeschäft im Herzogtum Westfalen
08.11.1815 Geometer II. Klasse aus Arnsberg
08.11.1815 Patent
zuständig für Bereich Westfalen
Quelle: K. Rößling (Bibl. H 969/50)
Hess. Ghz.-Ztg. 1815, Nr. 148, S. 1448 “
Quelle: HStAD Bestand S 1 Nr. NACHWEIS1
2) „F. A. Padberg [?] wird Geometer in Arnsberg, 1811
Archivalie 1944 vernichtet “
Quelle: HStAD Bestand E 1 L Nr. NACHWEIS
3) “ Padberg, Friedrich
aus Küstelberg
bei Geometer Padberg
1815 Prüfung Geometer 1. Klasse (Herzogtum Westfalen) “
Quelle: HStAD Bestand G 31 P Nr. 818
Sehr schön für den Anfang! Erschwert wird die Recherche dadurch, dass im Westfälischen außer „unserem“ Friedrich Carl gleichzeitig auch ein Berufskollege Franz Anton tätig war. Die Nennung von „Geometer Padberg“ ist also nicht eindeutig. Bei Franz Anton P. handelt es sich möglicherweise um den am 18.2.1793 in Wenholthausen (heute Hochsauerlandkreis) Geborenen, gest. 13.6.1869 in Unna. Für Friedrich Carl wird in einem anderen Amtsblatt der Wohnort Bochum angegeben. Weitermachen!
Vielleicht findet sich ja ein Kartenliebhaber oder eine Kartenliebhaberin, die hier weiterrecherchiert ……
Die beiden Padbergs habe ich ja durchaus wahrgenommen und diese erschweren ein wenig die weitere Suche …..
Padberg hat aber auch sehr präzise gearbeitet: Er wusste z.B. das Sohlbach zum Gerichtsbezirk des Justizamts Siegen gehörte und nicht zum Justizamt Hilchenbach.
Pingback: Siegener Schülerinnenstreik 1969 in Lemgoer Ausstellung | siwiarchiv.de
Um das „wilde Brainstorming“ zu einem vorläufigen Ende zu bringen, hier ein Zwischenergebnis: Was hat Padberg gezeichnet? Den neuen preußischen Kreis Siegen mit seinen historischen Bezügen: die beiden südlichen Ämter Burbach und Neunkirchen und, das hat offenbar für Verwirrung gesorgt, das ehemalige Fürstentum Siegen mit seinen vier Ämtern Hilchenbach, Freudenbgerg, Netphen und Siegen. Diese Ämter waren nicht nur Verwaltungsbezirke sondern zugleich auch Justizbezirke. Der Amtmann war Verwaltungschef und erstinstanzlicher Richter in einer Person. Die Trennung von Verwaltung und Justiz auch auf der untersten Ebene gehörte zu einer Hauptforderungen während der Märzrevolution 1848 und fand erst später ihre Vollendung. Padberg hat in den aktuellen Umriss „Kreis Siegen“ die alten Verwaltungsstrukturen (von vor 1800 und/ oder von 1813-1815) eingezeichnet
Welchen konkreten Auftrag Padberg veranlasst hat, die Karte zu zeichnen, kann ja noch erforscht werden.
Ein launiges und nachdenkliches Wortspiel zum Schluss: past is present, damals wie heute.
Nach der vorläufigen Beendigung des Brainstormings ist die andere noch offene und manche Gemüter bewegende Frage am besten dorthin zu verweisen, wo sie am ehesten beantwortet werden könnte.
Warum enthält die Karte so viele Fehler bei den Ortsnamen und unterschlägt manche Dörfer? Welche Vorlage(n) hat also Padberg (der ja selbst keine „Feldarbeit“ im Kreis Siegen leistete) kopiert und bearbeitet? Ein Vergleich mit den älteren Exponaten in der Kartensammlung des Siegener Stadtarchivs sollte doch unschwer zu einem Ergebnis führen, zumal der frühere Stadtarchivar Güthling sicherlich viel Material zu seinen Kartographie-Studien hinterlassen haben wird. (Hat er seinen Plan, die Padbergsche Karte nachzudrucken, eigentlich verwirklicht? Sind irgendwelche Ausarbeitungen von ihm dazu erhalten?) Die ursprüngliche Kartenaufnahme dürfte zu einer Zeit erfolgt sein, als der eingezeichnete Galgen bei Trupbach noch in Betrieb war. Bis wann wurden eigentlich im Siegerland Hinrichtungen öffentlich vollzogen?
Die Karte hat Güthling für den Siegerländer Heimatverein 1970 herausgegeben. Zwei Jahre zuvor erschien eine Karte des Fürstentums Siegen.
Zum Galgen: Der ist in der Padbergschen Karte schon weit nach Trupbach verschoben, denn eigentlich lag er noch auf der Siegener Gemarkung, oberhalb des Weges nach Trupbach, vgl. dazu die Fürstentumskarte, genutzt worden ist der Galgen wohl nie, vgl. meine Diss., S. 151. Dort auch eine grobe Einschätzung des Zeitraums für letzte Hinrichtungen im Fürstentum Siegen, die m.W. noch alle in Netphen stattfanden. Die eingezeichneten Galgen und ihr Einsatzzeitraum geben also keine hinreichenden Hinweise zur Datierung der ursprünglichen Kartenaufnahme. Ich gehe davon aus, dass sie zwischen 1815 und Anfang 1817 geschah und die abschließende Zeichnung durch Padberg, wie in der Karte eingetragen, im Juli des Jahres erfolgte. So, jetzt wäre auch dieses Detail geklärt. Die Geschichte der Kartographie und des Vermessungswesen, sowie ein systematischer Vergleich mit anderen zeitgenössischen Karten (hoffentlich ebenso fehlerhaft, aber mit Erklärungen für die zeichnerischen Ungenauigkeiten) dürfte vielleicht weiterhelfen, um die noch offenen Fragen zu beantworten.
Die Herausgabe der Karte durch den Siegerländer Heimatverein 1970 wurde durch eine kurze Ankündigung im „Siegerland“ begleitet; dort heißt es zur Karte, dass diese von“Westfalen beauftragt“ worden sei. Für den Kartenforscher bedeutet dies wohl eine Durchsicht der Bestände des Arnsberger Regierungspräsidenten, vllt. sogar des westfälischen Oberpräsidenten im Landesarchiv in Münster, um den Entstehungszusammenhang der Karte zu ermitteln.
Allerdings sollte man vorher im Bestand „Kreis Siegen, Landratsamt“ den Aktenband „Anfertigung eines Situationsplans vom Kreis Siegen“ (1816) auswerten; der Band kann im Stadtarchiv Siegen verfilmt eingesehen werden …..
Herrn Wolfs lobens- und dankenswerter Hinweis auf die Akte des Königlichen Landratsamtes Siegen Nr. 1 „Anfertigung eines Situationsplans vom Kreis Siegen (1816)“ verhilft zwar zu keinen weiteren Aufschlüssen über die von Friedrich Carl Padberg gezeichnete Kreis-Karte, aber dennoch zu interessanten Neuigkeiten und Fragen. Leider wird die Entdeckerfreude, wie so oft, durch das ganz unbefriedigende Ergebnis der Mikroverfilmung getrübt, wodurch die volle Ausschöpfung des Informationsgehaltes anhand dieses Ersatzmediums nicht möglich ist.
In der nur neunseitigen, anscheinend nicht ganz vollständigen Akte geht es um eine Karte des Kreises Siegen, die ziemlich genau ein Jahr vor der Padbergschen entstand. Auslöser war hier ein Rundschreiben der Regierung Koblenz vom 21. Juni 1816, in welchem die Kreiskommissare (die Vorgänger der Landräte) zur Ablieferung von Karten ihrer Kreise aufgefordert wurden. In Siegen wandte sich deshalb Kreiskommissar Wolfgang von Schenck Anfang Juli [vorliegender Entwurf undatiert] gleichlautend an den Amtsvorsteher Dilthey in Burbach und an den Rat Dunker in Neunkirchen:
„Von der Königlichen Regierung zu Coblenz habe ich den Auftrag erhalten, von dem mir anvertrauten Kreise sobald als thunlich einen vollständigen Situationsplan anfertigen zu lassen. Von dem hiesigen Fürstenthum ist derselbe bereits verfertiget. Es fehlet mir derselbe nun noch von dem Amte Burbach (Neunkirchen). Der Herr Landmesser Weiß von hier hat daher den Auftrag von mir erhalten den Situationsplan von dem Amte Burbach (Neunkirchen) ebenwohl anzufertigen. Derselbe wird sich in der Absicht dort einfinden. Ich ersuche daher den Herrn pp. [also Dilthey bzw. Dunker] denselben in der Vollziehung seines Auftrags möglichst zu unterstützen, und ihm insonderheit durch die dasigen Forstbedienten mit den nöthigen Notizen über die Kreis- und Gemeindegrenzen und sonstigen für ihn nöthigen Nachrichten an Hand gehen zu lassen.“
Die Aufforderung an Landmesser Thomas Weiß zu Brauersdorf (Amt Netphen), sich wegen Entgegennahme des Auftrages „künftigen Montag den 8. dieses [Monats] Vormittags bey mir einzufinden“, war am 6. Juli abgegangen.
Ein im Konzept vorliegendes Schreiben v. Schencks vom 20. November 1816 („abgesendet d. 22ten Nov.“) gibt Auskunft über die Erledigung des Auftrages:
„K[öniglicher] Regierung habe ich die Ehre gehabt mittelst meines unterth[äni]g[en] Berichtes vom 4ten Oktober d. J. das für Hochdieselbe bestimmte Exemplar des von H[errn] Landmesser Weiß verfertigten Situationsplanes von dem Kreise Siegen zu übersenden. H. Landmesser Weiß hat mir nunmehr auch das für die hiesige Kreis-Commissions-Registratur bestimmte Ex[em]p[lar] übergeben und damit zugleich die hier in dupl[icate] anliegende Gebühren-Rechnung überreicht.“
Fazit also: Im Sommer 1816 hatte Thomas Weiß eine Karte von Burbach/Neunkirchen angefertigt, die mit einer schon vorliegenden und vom Kreiskommissar für brauchbar befundenen Karte des übrigen Kreisgebiets vereinigt wurde. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass letztere zuvor auch schon von Weiß gezeichnet worden war, was sonst sicher explizit erwähnt worden wäre. Der Auftrag an den Brauersdorfer Geometer lautete, den von ihm selbst produzierten Burbacher/Neunkirchener Teil „demnächst mit der bereits von dem Fürstenthum Siegen existierenden Karte […] in ein Ganzes zu bringen“ (Notiz v. Schencks vom 1.8.1816). Ein Exemplar der Gesamtkarte ging Anfang Oktober 1816 nach Koblenz, ein zweites überließ Weiß im November der Siegener Kreisbehörde. Das erste Ex. könnte von der Regierung Koblenz nach dem Übergang des Kreises Siegen in den Regierungsbezirk Arnsberg zusammen mit den Akten dorthin abgegeben worden und somit später im Landesarchivs Münster gelandet sein, oder es verblieb an Ort und Stelle und gelangte (wenn es nicht verloren ging) ins Landesarchiv Koblenz. Das zweite Ex. hätte zusammen mit der alten landrätlichen Registratur, wenn alles rechtens gelaufen ist, auf jeden Fall seinen Weg nach Münster finden müssen. Ein Digitalisat dieser Weiß’schen (evtl. nicht namentlich signierten) Kreiskarte bietet anscheinend weder Münster noch Koblenz an, was aber nichts zu besagen hat. Es ist nicht auszuschließen, dass Recherchen vor Ort in den jeweiligen (noch) nicht digitalisierten Beständen Erfolg haben. Ein solcher ist den „Zeitspuren“-Autoren zu wünschen.
Aus dem Amtsblatt der Kgl. Regierung zu Koblenz (Nr. 44 vom 8.12.1816, S. 356) ist zu erfahren: „Der Landmesser Thomas Weiß zu Brauersdorf ist [am 29. Oktober d. J.] in dieser Eigenschaft für den hiesigen Regierungs-Bezirk bestätigt und verpflichtet worden“. Das dürfte dafür sprechen, dass man in Koblenz mit seiner kürzlich eingereichten Kartierungs-Arbeit zufrieden gewesen war.
Zur Würdigung Thomas Weiss‘ (1778-1861) siehe auch die Ausführungen Wilhelm Güthlings in: Geschichte des Netpherland, Netphen 1967, S. 275-277. Einige digitalisiert zugängliche Karten von seiner Hand aus dem Münsteraner Bestand sind mit Angabe der Autorschaft verzeichnet und somit über das Archivportal leicht auffindbar. Für Freunde des Siegener Tiergartens besonders attraktiv: Eine Serie von Aufnahmen des Domänenguts Charlottenthal 1818/19 (Karten-Nummern 5845 bis 5849 und 6426).
Vielen Dank für die Auswertung des Aktenbandes!
Da der Beruf des Geometers hier mit mehreren persönlichen Beispielen vorgestellt wurde, sei ein diesbezüglicher Blick in den Nachbarkreis Olpe erlaubt. Nach dem Übergang an Preußen, der im Falle des Kreises Siegen mit einer kurzzeitigen Zugehörigkeit zum Regierungsbezirk Koblenz in der Rheinprovinz und der endgültigen Zuordnung zu Arnsberg und der Provinz Westfalen verbunden war, begannen 1819 auch hier die Arbeiten am neuen, preußischen Grundkataster. Davon zu unterscheiden ist die im südwestfälischen Raum zwischen 1836 und 1842 durch das Militär und entsprechend ausgebildete Offiziere durchgeführte preußische Uraufnahme. Das Grundkataster bildete die Grundlage für spätere, nunmehr sehr genaue Kreiskarten. Im Kreis Olpe waren bis 1832 hauptsächlich drei Beamte mit diesen Vermessungsarbeiten beschäftigt, unter ihnen Gustav Stachelscheid aus Drolshagen. Er stammte aus der Familie des dortigen Bürgermeisters, der seinen drei Söhnen neben dem obligatorischen Besuch der Volksschule persönlich Privatunterricht erteilt hatte. Sein jüngerer Bruder Carl war später Amtmann in Drolshagen und in den Revolutionsmonaten 1848/49 Abgeordneter im Landtag in Berlin. Aus erhalten gebliebenen Unterlagen (Lebenslauf und Personalfragebogen) ist zu entnehmen, dass der ältere Bruder Gustav bei der Musterung fürs Militär wegen „Brustschwäche mit begleitendem Bluthusten als definitiv untauglich“ ausgemustert worden war. Er begann seine berufliche Laufbahn 1820 als „Kataster-Gehülfe“ und legte sein Feldmesser-Examen im April 1821 ab. Danach arbeitete er zunächst mehrere Monate als selbständiger Geometer, bis er 1822 von der Bezirksregierung Arnsberg als Kataster-Geometer fest angestellt wurde. Kurz vor Abschluss der Vermessungsarbeiten für das Grundkataster wurde er 1831 mit Nachvermessungsarbeiten im Kreis Siegen beauftragt. Nachdem das für seine Genauigkeit noch heute bewunderte preußische Grundkataster erstellt war, wechselte Gustav Stachelscheid im Mai 1837 erst auf die Stelle eines Steuerkalkulators im Kreis Meschede, bevor er als solcher dann ab dem September 1838 im Kreis Olpe tätig war. Der Berufswechsel lag nahe, da das Grundkataster bekanntlich die Basis der Grundsteuer-Erhebung bildete. (Vgl. zu diesem Beispiel Pfau, 200 Jahre Geschichte des Kreises Olpe, S. 34 f.)
Das Olper Beispiel weist auf den nicht auf ein Kreisgebiet beschränkt gebliebenen Einsatz von Vermessungsfachleuten und natürlich auf die Anfänge eines neuen Typus technischer Fachbeamten hin – auf deren Arbeitsergebnisse heutige Vermessungs- und Liegenschaftsbeamte nicht selten noch zurückgreifen (müssen).
Sobald das Thema der ersten Kreiskarten im Forschungsprojekt auf die Tagesordnung rückt, wollen wir die wertvollen Tipps und Anregungen von Peter Kunzmann, Bernd Plaum, Wilfried Lerchstein und Thomas Wolf gerne aufgreifen. Insbesondere die Hinweise auf Akten- und Literaturfunde werden dabei sehr hilfreich sein.
Nur noch ein letzter Gedanke kurz nach Toresschluss: Könnte es sich bei der Karte um eine Prüfungsarbeit gehandelt haben? Die Examinierung junger Feldmesser schloss zweifellos auch den Nachweis der Befähigung zum Kartenzeichnen ein. Ist nur so eine spontane Idee …
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 25.6. – 8.7.2018 | siwiarchiv.de
Pingback: Fortführung der Arbeit des Stadtarchivs Hilchenbach | siwiarchiv.de
Pingback: „Zeitspuren“-Linktipp: Karte des Kreises Wittgenstein aus dem Jahr 1820 | siwiarchiv.de
Pingback: 32. Sitzung des regionalen Archivarbeitskreises in Bad Berleburg | siwiarchiv.de
Link zur Rezension des Buches durch Ulrich Schneider in: „informationen“ Nr. 87, Wissenschaftliche Zeitschrift des Studienkreises Deutscher Widerstand 1933-1945 , 2018, S. 42: https://www.widerstand-1933-1945.de/resource/system/3_1530029478.pdf
Prima! Noch besser, wenn aktiv mit historischen Inhalten gearbeitet. Gerade mein Windows10 Nokia stillgelegt, weil keine Apps mehr unterstützt. Jetzt Freude auf Archivschnitzeltest mit neuem Android #DOSENFISCHEREI #GEOCACHING #ARCHIV
Pingback: Freudenberg: Aufstellung einer Gedenktafel für die Opfer der Hexen- und Hexerverfolgung | siwiarchiv.de
Heute ein Bericht in der Westfälischen Rundschau über den scheidenden Archivaren: https://www.wp.de/staedte/siegerland/archivar-reinhard-gaemlich-ein-leben-voller-geschichte-n-id214823885.html
Ich finde, Kommunen sollten sich ihre Archive mit angemessener Personalausstattung leisten. Es ist doch ein Armutszeugnis, wie eine wichtige Kommune des Kreises hier um Stunden feilscht.
Pingback: Architektur 1960+, Brutalismus im Kreisgebiet: Ehem. Hauptschule Freudenberg | siwiarchiv.de
Ich gebe Herrn Graf insofern recht, dass man ein Archiv, wenn man eins einrichtet, auch richtig ausstatten muss, insbesondere auch in Hinblick auf Digitalisierung und elektronische Langzeitarchivierung. Allerdings sollte man auch von den vielen kleinen Gemeinden in den ländlichen Kreisen wie z.B. Siegen-Wittgenstein, im Hochsauerlandkreis, aber z.B. auch im Oberbergischen Kreis, nicht zu viel erwarten. Hilchenbach hat laut Wikipedia gerade mal 15.000 Einwohner, die Finanzkreaft der Gemeinde ist also vermutlich eher übersichtlich (oder bringt die Siemag soviel Gewerbesteuer?). Vielleicht muss man in diesen Kreisen irgendwann doch mal über Kreiszentralarchive nachdenken. Das ist sicherlich für die lokale Forschung nicht optimal und entfernt das Archiv emotional und im Wortsinne interessierten Bürgerinnen und Bürgern, andererseits muss man sich auch fragen, ob ein kleines, u.U. schlecht untergebrachtes und nur mit ein paar Stunden von irgendeiner Verwaltungskraft ohne Fachausbildung betreutes Gemeindearchiv, das dann auch nur dementsprechende eingeschränkte Öffnungszeiten hat, wirklich besser ist als ein zentrales Archiv mit einer angemessenen personellen und finanziellen Ausstattung und einem vernünftigen Magazin.
Der Kommunalpolitik kann man nur den Besuch des Rheinischen Archivtages in Frechen empfehlen, der heute in die Endrunde geht. Der Servicegedanke beginnt im Kopf. Hier hat gestern ein berufstätiger Nutzer zahlreicher öffentlicher Archive geschildert, wo er sich in der Nutzung behindert fühlt und was er sich zukünftig für seine Archivbenutzung wünscht. Dazu gehören auf jeden Fall verlängerte Öffnungszeiten, und zwar möglichst an allen Tagen und bis in den frühen Abend hinein. Das wird man tatsächlich in Hilchenbach nicht leisten können. Ein Verbund im Sine eines Kreiszentralarchives wäre vielleicht tatsächlich die praktikabelste Lösung…
Liebe Frau Schmidt-Czaja, öffnet man damit nicht die Büchse der Pandora, indem man den klammen Kommunen einen Vorwand liefert, ihre Archive dicht zu machen? Die Stärke der ‚kleinen‘ Archive (Einmann-, Einefrau-Archive) liegt doch eben darin, dass diese ortsnah, die Archivare/innen resp. Archivverantwortlichen idR im Ort verwurzelt sind, mit der Geschichte ihrer Kommunen und mit ihren Verwaltungen bestens vertraut sind. Man muss nicht nur den beachtlichen Verzeichnungsstand in Hilchenbach heranziehen, um zu beurteilen, dass ein Kreiszentralarchiv (personelle Ausstattung?) zu solchen Leistungen kaum in der Lage ist. Kurzfristig mögen mehr Nutzer zu verlängerten Öffnungszeiten kommen, langfristig bleiben diese aus, wenn der Verzeichnungsstandard nicht mehr den Ansprüchen genügen kann. Sollte man nicht eher alle Kräfte bündeln, damit auch kleine Kommunen in die Lage versetzt werden, fachlich gut besetzte und eingerichtete Archive zu haben. Die Frage nach den Öffnungszeiten regelt sich dann von alleine …
Lieber Herr Burwitz, Sie haben sicher nicht ganz unrecht, allerdings muss es ja nicht zwangsläufig ein Kreiszentralarchiv sein. Denkbar wären ja auch „Archivehen“, in denen Gemeinden eine/n Archivar/in und ein Archiv gemeinsam finanzieren. Grundsätzlich gehe ich einfach davon aus, dass Kooperationen hier ein vermutlich nicht perfektes, aber doch besseres Gesamtergebnis erzielen, da man dabei Ressourcen bündeln kann, die sonst in der Breite verpuffen, ganz abgesehen davon, dass ausgebildete Fachkräfte in der Regel nicht nur 10h / Woche arbeiten wollen (man muss natürlich dafür sorgen, dass hier dann nicht zusätzlich versucht wird, Geld einzusparen, dann kann das Modell natürlich nicht funktionieren). Die Kräfte zu bündeln, wäre sicher schön nur…wessen Kräfte will man hier bündeln? Die Landgemeinden schaffen es ja teilweise schon kaum, die „klassischen“ archivischen Arbeitsfelder abzudecken, wie sollen hier Probleme wie die Digitale Langzeitarchivierung bewältigt werden, die noch weitergehende Kosten verursachen?
@alle: Zunächst vielen Dank für die bisherigen Beiträge – so macht siwiarchiv besonders Spaß!
Neben der klassischen, hier in die Diskussion eingebrachten Lösung der Probleme durch ein Kreiszentralarchiv Warendorfer oder Viersener Prägung, die bisher nicht die Linie des Kreisarchivs ist und auch noch nicht politisch diskutiert wurde, gäbe es noch die sich in Dormagen herauskristallisierende Lösung eines dezentralen Kreiszentralarchivs; dort wird das Archiv des Rhein-Kreises Neuss zukünftig das Archiv der Gemeinde Jüchen betreuen. Die Archivalien bleiben in Jüchen und werden dort von einer Mitarbeiter/in des Kreisarchivs betreut ……. Diese Lösung umgeht die umständlichen Fahrten der Nutzerinnen und Nutzer an den Ort des klassischen Zentralarchivs und stellt eine archivfachliche Bearbeitung des Archivgutes und der Betreuung der Nutzenden sicher. Finanziell wird die Gemeinde entlastet, allerdings fallen auf Kreisseite Kosten, die sicher nicht durch eine spezifizierte Kreisumlage abgefedert werden.
Nun genug der unterschiedlichsten Kooperationslösungen – s. dazu auch die 2. Arbeitskreissitzung des diesjährigen Westfälischen Archivtages in Greven: https://archivamt.hypotheses.org/6257. Denn der Kern des Problems – die fehlende Akzeptanz für die archivische Aufgabenerledigung bei Archivträgern – wird m. E. dadurch nur gelindert – und dies wäre schon positiv. Die Lösung der Probleme ist die Beantwortung der Frage: wie wird die Akzeptanz für Archive in der Gesellschaft erhöht? Denn nur mit einer erhöhten Akzeptanz wird eine archivfachliche Besetzung kleiner Kommunalarchive erreicht werden können; die Gründe, die für diese „Maximal“forderung sprechen, hat Kollege Burwitz formuliert. Archive – und in diesem das Stadtarchiv Hilchenbach – haben das Ihrige getan. Wir müssen also „Verbündete“ finden und diese aktivieren …..
Liebe Frau Dr. Schmidt-Czaja, Kollege Burwitz hat ja schon einmal die hier auch bei mir vorherrschenden „Bauchschmerzen“ bezüglich eines Kreiszentralarchivs dargelegt. Allerdings würde ich gerne auch auf den Aspekt der „Kundenwünsche“ eingehen. Richten sich diese nicht eigentlich an den Archivträger und nicht an die Archive? Fotografieren im Lesesaal, 100%-Digitalisierung, 24/7-Öffnung ….. Diese verständlichen Wünsche können wir Archive nicht ansatzweise, nicht einmal durch „praktikable“ Lösungen erfüllen. Wenn dies gewünscht wird, dann müssen Archive mit ihren Kunden kooperieren. Dann können eventuell alle Wünsche wahr werden: fachlichen Ansprüchen genügende, dezentrale Kommunalarchive mit umfangreichen Öffnungszeiten (Lesesaal wie digital) und hoher Digitalisierungsrate.
Ort, an dem ein paar Jahre später eine neue, eine emanzipatorische Pädagogik in die Praxis umgesetzt werden sollte. Zwei Sorten Innovation, die wohl nicht so gut zusammenpassten.
Pingback: Linktipp zur Bewertung von Einzelfallakten der Kriegsgefangenenentschädigung | archivamtblog
Pingback: Linktipp: Ofenexperiment geht in die heiße Phase | siwiarchiv.de
Pingback: „Zeitspuren“-Linktipp: Kreis Wittgenstein im Gewerbeadressbuch von 1838 | siwiarchiv.de
Pingback: NRW: Landtag lädt Schulklassen zur Zeitreise ein | siwiarchiv.de
s. dazu Westfälische Rundschau, 18.7.2018: https://www.wp.de/staedte/siegerland/die-gruenen-wollen-gedenktafel-fuer-opfer-der-hexenverfolgung-id214868975.html
Pingback: 20. Juli 1944: Beteiligte und Betroffene aus dem Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein | siwiarchiv.de
Pingback: 20. Juli 1944: Beteiligte und Betroffene aus dem Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein | siwiarchiv.de
Pingback: Kultur-News KW 29-2018 | Kultur - Geschichte(n) - Digital
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 9.7. – 22.7.2018 | siwiarchiv.de
Pingback: Architektur 1960+, Brutalismus im Kreisgebiet: Landgericht Siegen | siwiarchiv.de
Zu Robert Krämer s. a. Eintrag im „Regionalen Personenlexikon zum Nationalsozialismus in den Altkreisen Siegen und Wittgenstein“, Aufruf: 24.7.2018
Dort auch Link zur Homepage des Schützenvereins Berleburg (mit Bild Krämers auf der Seite „Schützenkönige„) sowie Hinweis auf die Karteikarte zu Robert Krämer im Bundesarchiv Berlin, Bestand 3.100 (NSDAP-Zentralkartei).
Zu Karl Wilhem Jötten s. a. Seite „Karl Wilhelm Jötten“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 30. Dezember 2017, 08:28 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Karl_Wilhelm_J%C3%B6tten&oldid=172408952 (Abgerufen: 24. Juli 2018, 07:55 UTC)
Pingback: „Zeitspuren“-Linktipp: Bekanntmachung der Familiennamen der Juden 1846 | siwiarchiv.de
Pingback: Ausstellung: „Walter Helsper (1927-1992). Arbeiten aus Privatbesitz“ | siwiarchiv.de
Zu klären ist, ob Achenbach den Prolog zum Historischen Schlossfeste in Heidelberg 1913 verfasst hat – denn s. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/schlossfeste1913/0015
Schön, dass es zu dieser Ausstellung im Siegerland-Museum kam – war eigentlich lange überfällig. Eine Komponente der oben angesprochenen unbürgerlichen Lebensweise, die sich selten um Konventionen geschert habe, war Walters politisches Interesse. Ein Beispiel: Nachdem am 11. September 1974 der Pinochet-CIA-Putsch in Chile mit den bekannten Folgen stattgefunden hatte und wir linken Studenten vom SHB an der Gesamthochschule Siegen das auf dem Titelbild unserer Zeitschrift thematisieren wollte, stellte er uns dazu ohne große Worte eine Zeichnung zur Verfügung. Sie würde sicher gut in diese Ausstellung gepasst haben, gehört aber wohl auch zu den untergegangenen Werken des Künstlers.
Ich nutze die Gelegenheit, auf einen weiteren Siegerländer bildenden Künstler aufmerksam zu machen, der in den 1920er Jahren international an ganz großen Ausstellungen teilnehmen durfte und im Siegerland bis heute vollständig unbekannt ist: Adolf Küthe.(http://widerspruchundwiderstandimnsinsiwi.blogsport.de/verzeichnis/biografische-skizzen/#kuethe). Auch auf ihn sollte der Blick der Siegerländer Ausstellungsmacher an den zwei Orten, die es dafür gibt, einmal fallen.
Zum politischen Engagement Helspers reichte U. Opfermann folgendes Bild nach:

Beitrag Helspers (re.) zu einer umfangreichen Malaktion Siegerländer bildender Künstler 1981 zur Rakenten und Marschflugkörperstationierung. Quelle: Privatbesitz
Das ist das Warmwasserfreibad Buschhütten.
Hallo Jan,
Dein Antwort kam zu einer Uhrzeit, wo man sich normalerweise noch im Tiefschlaf befindet „02:20“! ;-)
Buschhütten, richtig.
Gruß Olaf
@Jan, @Olaf Böhm
Danke fürs Mitmachen – egal um wieviel Uhr!
Aber: Wann wurde denn das Bild ausgenommen? Eventuell hilft ja auch gezieltes Raten ;-)
Das Foto wurde um 1958 aufgenommen.
Warum?
Ich glaube einige Autos auf dem Parkplatz erkennen zu können, welche aus den 50er Jahren stammen.
DAF, VW Käfer, Opel Record …
… Ford Taunus etc.
Zur Restaurierung des Weimarer Haus am Horn, das zum Landhaus Ilse inspirierte: s. https://www.restauro.de/am-allerersten-haus-der-moderne/
Zum Landhaus Ilse s.a. die Borschüre“100 Jahre Bauhaus im Westen“, S. 25, Link zur PDF: https://www.lwl-kultur.de/media/filer_public/78/40/7840f8b8-99da-47ba-829d-ce2b1d3ce198/sonderheft_bauhaus.pdf
… oder die Aufnahme ist zum 25-jährigen Bestehen des Warmwasser-Freibades entstanden.
s. a. Manfred Zabel: Anwalt der Hungernden und Flüchtlinge. Früherer Landrat Fritz Fries erster Regierungspräsident nach 1945, in; Siegerland Band 68, Heft 3-4 / 1991, S. 84 – 86
@archivar
Des Rätsels Lösung? :)
Alles richtig!
Das Bild des Freibades Buschhütten stammt aus einer Sammlung des Kreisbaurats Kienzler. Die Bilder sind zwischen 1955 und 1959 entstanden. Das hier gezeigte Luftbild ist leider ohne Datum.
Die Badeanstalt wurde 1927 gebaut und 1949 renoviert (Quelle: Homepage des TVG Buschhütten.)
Es muss wohl ein Korrektur vorgenommen werden. Das Bild wurde vermutlich erst 1970 aufgenommen – als Beleg wird der Durchgang (mit Dusche) zur Liegewiese rechts zwischen den Schwimmbecken angeführt, der wohl zu dieser Zeit entstanden ist.
Ergänzende Informationen zum Dissertationsprojekt:
„An nicht wenigen Archivarskarrieren im 20. Jh. wird deutlich, dass die Entnazifizierung kaum Spuren in der deutschen Archivwissenschaft hinterließ. Obwohl Kontinuitäten nach 1945 keine Ausnahmen waren und bis in höchste Ämter führen konnten, entstand lange Zeit keine systematische historische Forschung zur Geschichte des Archivwesens (der institutionalisierten Archivlandschaft) oder der Archivwissenschaft (als wissenschaftlicher Disziplin) des „Dritten Reichs“. Von der Geschichtswissenschaft vernachlässigt und von Archivaren nur akzidentiell betrieben, kam es erst Mitte der 1990er Jahre zur Publikation von Pionierstudien, die seitdem um meist deskriptive Arbeiten zu isolierten Teilaspekten der NS-Archivgeschichte ergänzt wurden. Eine übergreifende Arbeit stellt hingegen ein Forschungsdesiderat dar. In der projektierten Dissertation soll dieses Defizit angegangen und disziplinhistorische Forschung geleistet werden, auch um durch Fachgeschichte zum besseren Verständnis der archivwissenschaftlichen Disziplin beizutragen. Der Untersuchungszeitraum (~1920-1950) ergibt sich in erster Linie dadurch, dass auch in diesem Kontext weder 1933 noch 1945 tiefgreifende Zäsuren darstellen. Unter Berücksichtigung einer Binnenperiodisierung des „Dritten Reichs“ sollen deshalb Entwicklungen aufgezeigt werden, welche die Archivwissenschaft maßgeblich beeinflussten. Spannungsfelder innerhalb des Archivwesens werden ebenso untersucht wie Kooperationen archivwissenschaftlicher Einrichtungen mit staatlichen und parastaatlichen Organisationen. Für letztere sind vielfältige Verflechtungen während des Zweiten Weltkriegs, die von Kooperation bis Partizipation reichten, offensichtliche Beispiele. Die Archivwissenschaft darf bei diesem Vorgehen allerdings nicht als monolithische Einheit verstanden werden. Stattdessen muss ihre personelle Zusammensetzung ebenso untersucht werden wie die Konstituierung fachinterner „Denkkollektive“, da hier eventuelle rassistisch-expansionistische Radikalisierungstendenzen ausgemacht werden können. Um diese Lücke in der Forschung zu schließen, wird ein spezifischer institutionsgeschichtlicher Ansatz gewählt, der sich durch prosopographische Untersuchungen ergänzen lässt. Statt den Blick ausschließlich auf organisatorische Strukturen und deren Entwicklung zu beschränken, sollen institutionelle Rahmenbedingungen vielmehr dahingehend betrachtet werden, welchen Einfluss deren Veränderungen auf die in diesen „Arbeits- und Kommunikationszusammenhängen“ ausgeübten Tätigkeiten hatten. Deshalb werden unter Institutionen nicht in erster Linie Behörden oder Organisationen verstanden, sondern auch wissenschaftliche Tagungen, Fachzeitschriften und Ausbildungswege. Wechselwirkungen innerhalb der Disziplin lassen sich damit ebenso erkennen wie zwischen den „Ressourcenensembles“ Wissenschaft und Politik. [Februar 2013]“
Link: http://www.wsu.geschichte.uni-freiburg.de/personen/Tobias-Winter
Pingback: „Zeitspuren“-Linktipp: Bericht über das Stahlpuddeln zu Lohe, 1855 | siwiarchiv.de
Pingback: Nur noch Sprechstunden am Mittwoch im Stadtarchiv Hilchenbach | siwiarchiv.de
Pingback: Stadtarchive haben eine zu kleine Lobby: Nur noch Sprechstunden am Mittwoch im Stadtarchiv Hilchenbach | Archivalia
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik Juli 2018 | siwiarchiv.de
Gestern in der Print-Ausgabe der Siegener Zeitung:

Pingback: Architektur 1960+, Brutalismus im Kreisgebiet: Landgericht Siegen | siwiarchiv.de
Pingback: Linktipp: ANNO – AustriaN Newspapers Online – | siwiarchiv.de
Pingback: Architektur 1960+, Brutalismus im Kreisgebiet: Siegtalbrücke | siwiarchiv.de
Pingback: Linktipp zur Biographie von Fritz Fries (1887 – 1967) | siwiarchiv.de
Bei den beiden Fotos handelt es sich um Aufnahmen der Breitenbachtalsperre bei Allenbach. Die Fotos zeigen das Umfeld der Staumauer noch recht frisch erbaut / noch im Bau befindlich. Daher schätze ich die Fotos auf ca. 1956 (Fertigstellung).
1) Die Frage ist korrekt beantwortet.
2) Leider ist das Aufnahmedatum noch nicht richtig. Aber eines der Bilder zeigt ein Gebäude, nach dem hier auf siwiarchiv schon einmal – vergeblich – gesucht wurde – im Adventskalender 2015.
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 23.7. – 5.8.2018 | siwiarchiv.de
Ist es die Wasseraufbereitungsanlage oberhalb der Breitenbachtalsperre?
Ja! Richtig – nach 3 Jahren …..
Pingback: Siegener Schülerinnenstreik 1969 in Lemgoer Ausstellung – eine Bildergalerie | siwiarchiv.de
Pingback: „Zeitspuren“-Linktipp: Portal des Rahrbacher Tunnels von Jacob Scheiner 1862 | siwiarchiv.de
Für die Gestaltung des Begleitprogramms suchen die Veranstalter Betroffene und/oder Angehörige, die vor dem interessierten Publikum von ihren Erfahrungen berichten.
Dies kann nicht ernstlich gemeint sein.
15 jährige Jugendliche (im Jahre 1945) wären heute 88 Jahre alt.
Solche Personen liegen heute meistens in Pflegeheimen.
Diese Maßnahme kommt rund 20 Jahre zu spät.
Gehen wir einmal davon aus, dass die Aufarbeitung sehr spät erfolgt, dann wäre hier auch der Platz einmal über die Gründe nachzudenken …….
Pingback: Andreas Vomfell, Amtmann und Bürgermeister in Netphen von 1921 bis 1933 | siwiarchiv.de
Wilfried Lerchstein weist gerade zurecht auf den Siegerländer Heimatkalender 1972, S. 39 (mit Bild) hin.
Pingback: Architektur 1960+, Brutalismus im Kreisgebiet: Erlöserkirche, Siegen-Winchenbach | siwiarchiv.de
Pingback: Architektur 1960+, Brutalismus im Kreisgebiet: Erlöserkirche, Siegen-Winchenbach | siwiarchiv.de
Pingback: Heute: Laurentiustag – der Schutzpatron der Archivierenden. | siwiarchiv.de
Pingback: Heute: Laurentiustag – der Schutzpatron der Archivierenden | Archivalia
Stimmt ja nicht ganz: Gemeinhin gilt er als Schutzpatron der Bibliithekarinnen und Bibliothekare.
Pingback: Aus der Fotosammlung des Kreisarchivs: Ein Sommerfreizeittipp und ein -rätsel. Teil 3. | siwiarchiv.de
Es handelt sich um Teile des Ortes Krombach und die Anlagen der Krombacher Brauerei. Warum das Foto im Kontext der Sommerfreizeittipps erscheint? Der örtliche Verschönerungsverein gab 1929 eine 31 Seiten umfassende Broschüre unter dem Titel „Sommerfrische Krombach im Siegerland“ heraus und versuchte, den Ort als touristisches Ziel im nördlichen Siegerland zu etablieren. Im anschließenden Anzeigenteil spricht die Hasbrauerei den Erholungssuchenden direkt an: „Versuchen Sie Krombacher Pilsener Krombacher Spezial-Export. Sie werden sich von der vorzüglichen Güte und Bekömmlichkeit selbst überzeugen!“
Heute strömen die Besucher weniger wegen der Sommerfrische nach Krombach. Ziel von mittlerweile schätzungsweise 100.000 Besuchern jährlich ist die Braustube (Krombacher Erlebniswelt) der Brauerei – ein Sommerfreizeit-Geheimtipp!
Archivierende meist kleinerer Archive betreuen ja meist auch (Präsenz-)Bilbliotheken und beschäftigen sich ja auch mit „alten Büchern“.
Die Verehrung als Schutzpatron der Bibliothekare rührt – zumindestens laut Wikipedia – von der vermögensverwaltenden Tätigkeit Laurentius´ her. Dies ist ja heute immer noch einer der Hauptaufgaben der Bibliotheken, oder?
Ok, ich muss wieder etwas schwieriger werden ……. :-/
Ich glaube, Herr Bonin hatte zuletzt sein Architekturbüro in Siegen, Melanchthonstraße. Dort ist jetzt das Christofferhaus. Ein architektonisch beeindruckendes Haus!
Herr Bonin wohnte in der Melanchtonstr, früher Bergstr, und hatte sein Büro in Siegen Spandauer Str. im Allianzhaus. Sein Wohnhaus existiert noch. Es steht von unten kommend 2 Häuser vor dem Christofferhaus.
Walter Bonin hatte in Siegen an verschiedenen Stellen
seine Büros, unter anderem Bahnhofstraße, Fürst – Johann-Moritz Straße und auch an der Weidenauer Straße.
Habe im Architekturbüro Bonin meine Lehre gemacht.
Danke für die Informationen!
Pingback: Linktipp: Ofenexperiment beendet | siwiarchiv.de
Zur Erläuterung des Projekts s. WDR.de v. 13.8.2018: “ …. „Ich habe auch Leute in Siegen-Wittgenstein kennengelernt, deren Brüder oder Onkel verschwunden sind“, sagt Heiko Ullrich, Chefarzt für Psychiatrie im Kreisklinikum. „Man machte sich Gedanken darüber: Was ist da überhaupt passiert?“
Ullrich sucht für die Ausstellung Angehörige von Menschen, bei denen „die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, dass die Nationalsozialisten sie in diesen Tötungsanstalten umgebracht haben.“ …..“
Link: https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/siegen-nationalsozialismus-euthanasie-100.html
Pingback: „Zeitspuren“- Linktipp: Urkundenbuch zur Spendensammlung für die Kaiserlinde auf dem Kindelsberg 1878 | siwiarchiv.de
Wer sich für die Linde unabhängig vom Kaiser interessiert, findet einen interessanten Bericht aus neuerer Zeit hier:
Alfred Becker u. Martin Sorg, Sanierung der Kaiserlinde auf dem Kindelsberg, in:
Siegerland 84 (2007), S. 75-83
Die Umbenennung der Hindenburgstraße ist eine gute Idee und ich hoffe, dass der Rat der Stadt Hilchenbach sich mit dem Thema erneut beschäftigen muss
und den Straßennamen einzieht.
Der Antrag zur Umbenennung ist direkt mit dem Vorschlag eines neuen Namens verbunden Paul-Benfer-Straße.
Wie viele Lehrer war auch Paul Benfer Mitglied der NSDAP, Mitgliedsnummer
5490101, die Aufnahme erfolgte am 1.5.1937. Bereits am 1.5.1933 wurde er Mitglied im NSLB.
Mit diesen beiden Mitgliedschaften ist er meiner Meinung nach nicht geeignet
eine Ehrung im öffentlichen Raum in Form eines Straßennamens zu bekommen.
http://akteureundtaeterimnsinsiegenundwittgenstein.blogsport.de/a-bis-z/gesamtverzeichnis/#benfer3
Vielen Dank für den Hinweis: Hier noch der Link zu BBF/DIPF/Archiv, Gutachterstelle des BIL – Preußische Volksschullehrerkartei
Regierungsbezirk Arnsberg, GUT LEHRER (Personalunterlagen von Lehrkräften), 16717 (Paul Benfer)
Eine bessere Auflösung der Archivalien wäre wünschenswert.
Pingback: Architektur 1960+, Brutalismus im Kreisgebiet: Hüttentalstraße | siwiarchiv.de
Pingback: Architektur 1960+, Brutalismus im Kreisgebiet: Hüttentalstraße | siwiarchiv.de
Die PDF zum Urkundenbuch „Kaiserlinde auf dem Kindelsberg“ hat jetzt die gewünschte hohe Auflösung. Ich wünsche ein informatives und erfolgreiches Stöbern ;-)
Pingback: Aus der Fotosammlung des Kreisarchivs: Ein Sommerfreizeittipp und ein -rätsel. Teil 4. | siwiarchiv.de
Ich weiß natürlich nicht, zu welchem Anlass der frühere Landrat die Figur
„Schutzmann mit Blumenstrauß“ (eigene Bezeichnung) erhielt. Ich habe sie aus Anlass meines 25-jährigen Dienstjubiläums als Kriminalbeamter vom Personalrat der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein erhalten. Als man sie mir zum 40. Dienstjubiläum noch einmal überreichen wollte, habe ich höflich abgelehnt, weil ich die Erstvergabe nicht entwerten wollte. Zu den Jubiläen möchte ich noch folgende Anekdote nachreichen: Es war damals in der Behörde üblich, dass man sich sein Buchgeschenk im Wert von DM 20,- selbst aussuchte, es einpacken ließ und dann der Verwaltung zusandte, um es dann, quasi als Überraschung vom Oberkreisdirektor, später vom Landrat überreicht zu bekommen. Mein Buch kostete damals etwa DM 21,90. Natürlich wurden mir DM 20,- erstattet. Die Mehrkosten von DM 1,90 waren nach 25 Jahren offenbar untragbar. :-)
Danke für die Bestätigung meiner geheim gehegten Vermutung, dass die Figur (u.a.[?]) als Geschenk für Dienstjubiläen von Polizisten verwendet wurde!
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 6.8. – 19.8.18 | siwiarchiv.de
Es handelt sich um die frühere Schellenschmiede in Hilchenbach-Grund.
Sie musste der Straße weichen und steht jetzt im LWL-Freilichtmuseum
in Hagen
Es handelt sich leider nicht um die Schellenschmiede in Hilchenbach-Grund. Bild der Schmiede s. hier.
Ein Literaturhinweis zur Geschichte des Bades – via Facebook:
„Erinnerungen ans alte Hallenbad“, in: Mitteilungsblatt 13 der Ehemaligen u. Förderer des Löhrtor-Gymnasiums“, Januar 1967, S. 34 – 35
Zur Geschichte der HTS s. a. Matthias Opitz: Die Hüttentalstraße (HTS), in: Zeit.Raum-Siegen [Wiki], Link: https://wiki.zeitraum-siegen.de/orte/hts_-_huettentalstrasse (Aufruf 20.8.2018)
Wirklich schwierig. Der Herr Archivar könnte einen Tipp geben.
Ich tippe auf eine Schmiede im Altkreis Wittgenstein. Für einen Backes erscheint mir das Gebäude zu groß. Aber wer weiß….
Da brauche ich nicht mehr viele Tipps geben ……. ;-)
Wie kommt man bei der Schmiede auf Wittgenstein.
Ist dies am Fachwerk erkennbar?
Ich würde ja sagen gut geraten; denn das Kennzeichen des PKW ist ja nicht erkennbar …… :-)
Der quergestellte Stall-/Scheunenanbau links ist eher untypisch für das Siegerland. Daher meine Vermutung Wittgenstein. Das vermutete Schmiedegebäude scheint heute nicht mehr zu existieren. Kurz hatte ich Rinthe vermutet. Aber die dortige Schmiede sah anders aus.
Dann sind jetzt wohl die Wittgenstein-Kenner am Zug …..
Pingback: „Zeitspuren“-Linktipp: Hofprediger Adolf Stoecker, Foto um 1875 | siwiarchiv.de
Mevrouw,
U zoekt fotomateriaal uit “ der belgischen Besatzung aus dem Zeitraum 1942 – 2003 “ …???
Mag ik u erop wijzen dat er :
primo: in 1942 nog om voorhand liggende redenen nog geen bezetting kon zijn …
secundo : dat de “ Besatzung “ reeds in 1952 , ook om voor de hand liggende redenen werd opgeheven en er op dat ogenblik überhaupt geen “ Besatzung“ meer was…
tertio: vanaf 1952 waren de in de Bundesrepublik gelegerde buitenlandse troepen – dus ook de Belgische – daar gestationeerd in het kader van de Nato, waarvan de Bundesrepubliek een gewaardeerde partner was en nog steeds is.
Die Skulptur stammt von Gertrud Vogd-Giebeler, gebürtig aus Siegen, lebt heute in Berlin.
leider verstehe ich nicht so gut Flämisch, daher schreibe ich in Deutsch und hoffe, dass Sie mich verstehen. Sie hatten gestern auf Siwiarchiv ein Kommentar gemacht. Die Besatzung bestand bis ca. 1950. Danach waren die Truppen als Verbündete der Nato in Deutschland – das ist absolut richtig.
Dennoch habe ich „Besatzung“ geschrieben, weil es so für viele verständlich ist. „Stationierung“ wäre wohl der bessere Begriff gewesen …
Pingback: „Wittgenstein“ Heft 2 (2018) erschienen | siwiarchiv.de
Pingback: „Wittgenstein“ Heft 2 (2018) erschienen | siwiarchiv.de
Archivalia hat bereits 2010 auf eine interessante Publikation Rosas – ein Rechtschreibebuch – hingewiesen: https://archivalia.hypotheses.org/15096
Stimmt !! Die Geschichte hat Ihre Rechte ! Danke .
MVDK
Pingback: Aus der Fotosammlung des Kreisarchivs: Letzter Teil des Sommerrätsels | siwiarchiv.de
Das war damals die „Realschule der Stadt Siegen“ in Eiserfeld am Hengsberg, als Datum schätze ich 1955.
Ein paar weitere Informationen dazu:
Die damalige Amtsrealschule Eiserfeld wurde am 27. April 1953 als erste Realschule im heutigen Siegener Stadtgebiet eröffnet. Zunächst war die Amtsrealschule in der Wilhelmstraße zu finden. Bald jedoch war das dortige Schulgebäude zu klein.
So wurde die Schule am 27. Juni in die Straße „Am Hengsberg“ umgesiedelt. Außerdem bekam sie einen klangvolleren Namen: Schneider-Davids-Schule.
Von Beginn an fehlte es an Raum. 1957 gab es 6 Klassen mit jeweils 40 – 50 Schülern, aber weder Fachräume für Naturwissenschaften, Kunst, Musik und Werken noch eine Turnhalle.
Seit 1965 hatte die Schule regen Zulauf, so dass bald Raum- und Lehrermangel herrschten.
Im März 1963 wurde die Turnhalle errichtet.
Die Schule erhielt einen neuen Namen: Realschule der Stadt Eiserfeld.
Mitte der siebziger Jahre wurden acht provisorische Pavillons errichtet.
1977/78 wurden endlich naturwissenschaftliche Fachräume geschaffen.
1984 ließ der damalige Schulleiter Kroitzsch das unter der Turnhalle gelegene Lehrschwimmbecken zu einem Kunst- und Werkraum umbauen.
Dreizehn Jahre später wurden die Pavillons durch zwei große Container auf dem Schulhof ersetzt. Auch der Name wandelte sich noch einmal: Realschule am Hengsberg.
2003 wurde der Neubau fertiggestellt und eingeweiht, passend zum 50jährigen Jubiläum unserer Schule.
Danke für die korrekte, ausführliche Antwort! Allerdings stimmt die zeitliche Einordnung nicht mit den Angaben in unserer Sammlung überein …….
Am 30. Oktober 1951 wurde der Grundstein gelegt, da habe ich noch einen (tonlosen) Film von.
In den Folgejahren entstand der Anbau ganz links im Foto und im März 1963 wurde die Turnhalle errichtet, die hier im aktuellen Foto noch nicht zu sehen ist.
Allerdings erkennt man links die ersten Schachtarbeiten dazu, und deshalb korrigiere ich meine erste Schätzung zur Datierung des Fotos jetzt auf 1962/63.
Da bin ich jetzt ganz bei Ihnen! Die in unseren Unterlagen vorhandene Angabe „ca. 1959“ halte ich für nur noch schwer haltbar -angesichts der Baugeschichte.
Pingback: Architektur 1960+, Brutalismus im Kreisgebiet: Christuskirche, Siegen-Dautenbach | siwiarchiv.de
Pingback: Architektur 1960+, Brutalismus im Kreisgebiet: Christuskirche, Siegen-Dautenbach | siwiarchiv.de
Ich hab mal ein paar Bilder auf Faceboock hinterlassen mfg David de Voghel
Super vielen Dank. Auf welcher Facebook Seite?
Hallo, mein Vater war bei dem Belgischen Millitair in Siegen stationiert.
Er had noch viele Bilder und informationen ueber seine zeit dort.
Spaeter sind wir nach Soest gezogen. Er ist bis zur Rente beim Millitair geblieben.
Er ist 1929 geb. also er wird bald 90.
Wir versuchen alle informationen und bilder die er gesammelt hat zu ordnen und auf dvd ’s zu brennen.
Lieben Gruss
Hallo Frau Vandewalle,
Vielen herzlichen Dank hierfür. Falls ich behilflich sein kann, lassen Sie mich dies bitte wissen. U.A. Werde ich bald in Soest sein. Ich könnte auch das Einscannen übernehmen. Freundliche Grüße aus Köln nach Soest
Hallo Herr Burion ,
Mein Vater und ich arbeiten schon lange an dieser DVD.
Er bekommt zwischendurch immer wieder neue informationen.
Wir wuerden uns sehr freuen Sie persoenlich kennenzulernen.
Geben Sie mir kurz vorher bescheid wenn Sie in Soest sind dann kann ich ein treffen organisieren.
Pingback: Ausstrahlung des zweiten Fernsehprogramms im Siegerland | siwiarchiv.de
Da kann ich noch etwas zu beitragen: Mein Vater war immer ein Technik-Freak, gab es etwas Neues, musste er es haben. So hatte er sich zur Fußball-WM 1954 einen Fernssher angeschafft. Es war ein Gerät von Graetz mit ~47 cm Bildschirm-Diagonale. Nach dem Einschalten dauerte es knapp 2 Minuten, bis die Röhren aufgeheizt waren und ein Bild kam. Das Problem war aber, einen Sender zu empfangen, in Siegen gab es noch keinen Umsetzer. Das ARD – Programm konnte von Siegen aus vom Sender Koblenz (Kanal 6) empfangen werden. In der Tallage brauchte man dazu eine hohe Antenne (bei uns 4 m mit abgespanntem Mast; der beim Sturm einmal sogar abgerissen wurde). Da das Signal aus Koblenz sehr schwach war, musste zusätzliich noch ein Röhrenverstärker vorgeschaltet werden. Von der WM 1954 (ich damals 5 Jahre alt) kann ich mich nur noch an das Endspiel erinnern. Unser Wohnzimmer war voll mit allen Verwandten und Bekannten. Soweit ich weiß, gab es damals in Siegen insgesamt nur ca. 6 TV-Geräte. Ich erinnere mich noch an das Funkhaus Schwunck in der Kölnerstr., die einen hatten und Elektro-Happe am Kölner Tor (heute Bäckerei Schneider), von denen mein Vater den Fernseher auch bekommen hatte und die eine gleich hohe Antenne hatten wie, wie wir. Das „normale“ Fernsehprogramm begann damals um 17:00 mit der Kinderstunde, für uns damals das Größte. Bis zum Abendprogramm um 20:00 war danach Sendepause. Aber allein das häufig ausgestrahlte Testbild anzuschauen, war schon sensationell. Später konnte man das 1. Programm vom Giersbergsender empfangen. Als um 1967 dann das 2. Programm vom Häusling-Umsetzer ausagestrahlt wurde, benötigte man eine zusätzliche UHF-Antenne, eine 2. Antennenleitung und für die alten TV-Geräte einen zusätzlichen UHF-Tuner, den man oben aufs Gerät stellte. Übrigens gab es Ende der 70er Jahre in Siegen noch die Möglichkeit 2 belgische Programme (flämisch und wallonisch) zu empfangen, vom Umsetzer auf dem Fischbacherberg. Der Sender war für die Angehörigen der belg. Streitkräfte eingerichtet worden und konnte nur mit einer zusätzlichen UHF-Antenne empfangen werden, welche allerdings vertikal ausgerichtet werden musste. – Es waren damals schon abenteurliche Fernsehzeiten, als es noch kein Kabel, keinen Satellit und kein IPTV gab.
Danke für diesen inhaltsreichen Kommentar!
Nachträge:
1) Zum Umfang der Zwangsarbeit bei Dango & Dienenthal s. Opfermann, Ulrich [Friedrich]: Heimat, Fremde. „Ausländereinsatz“ im Siegerland, 1939 bis 1945: wie er ablief und was ihm vorausging, Siegen 1991, S. 47 [weitere Erwähnungen der Firma im Text]
2) s. a. Eintrag „Anna Sahirna“, im Aktiven Gedenkbuch für die Opfer des Nationalsozialismus im Kreis Siegen-Wittgenstein, Link: http://aktives-gedenkbuch.de/index.php/Detail/Object/Show/object_id/809 (Aufruf 27.8.2018)
3) Einen anderen Aspekt der Firmengeschichte während des Nationalsozialismus – der ebenfalls nicht im Interview angesprochen wird – beleuchtet der Eintrag „Paul Eberhard Henrich“, in: „Widerspruch und Widerstand. Opposition gegen den Nationalsozialismus in den Altkreisen Siegen und Wittgenstein“ , Link: http://widerspruchundwiderstandimnsinsiwi.blogsport.de/verzeichnis/biografische-skizzen/#henrich3 (Aufruf: 27.8.2018)
Backhaus Alertshausen!!
Damt ist auch dieses Sommerätsel gelöst. Zum Beweis s.:
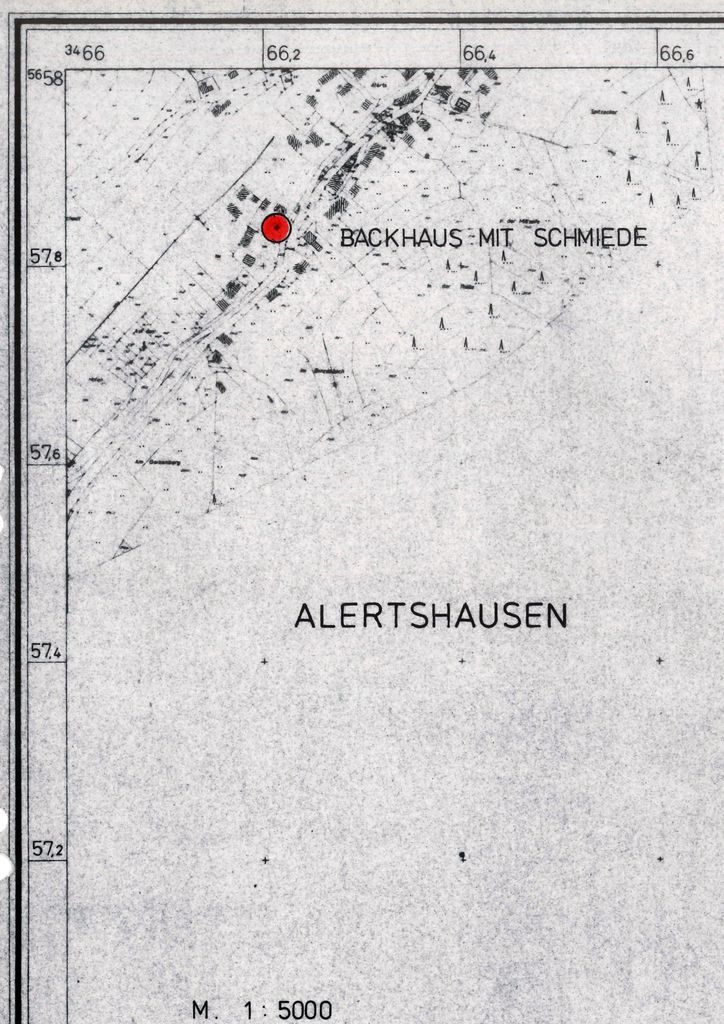
Backhaus der Familie Freitag in Alertshausen
Pingback: „Zeitspuren“-Linktipp: Fotos der Industriellen-Familie Dresler in Kreuztal um 1900 | siwiarchiv.de
Stadt Freudenberg
Die Bürgermeisterin
Stadtarchiv
Sehr geehrter Herr Burion!
Ihr Buchprojekt erstreckt sich auf die „10. Provinz“.
Dazu gehört dann auch das Tanklager Olpe, welches
am Grissemert bzw. in Büschergrund lag.
Post kommt!
Mit freundlichen Grüßen
I.A.
Detlef Köppen
Stadtarchivar
I.A.
Detlef Köppen
Stadtarchivar
Pingback: „Germania“-Denkmal soll an das Obere Schloss in Siegen versetzt werden | siwiarchiv.de
Ein Kommentar von heute morgen befindet sich zurzeit in einer persönlichkeitsrechtlichen Prüfung.
Herrn Thomas Wolf
Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein
Postadresse: Koblenzer Str. 73, 57072 Siegen
Sehr geehrter Herr Wolf,
durch den Eintrag vom 29. Aug. 2018 um 10:12Uhr fühle ich mich durch solch unbelegten Anschuldigungen gegenüber meinem Vater in meiner freien Persönlichkeitsentfaltung und meinen Persönlichkeitsrechten angegriffen. Ich möchte, daß dieser Eintrag dauerhaft gelöscht wird.
Vielen Dank, auch für Ihre Information.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfram Vogt
Das Backhaus stand an exakt dieser Stelle in Alertshausen:
https://www.google.com/maps/place/51%C2%B003'16.7%22N+8%C2%B031'01.7%22E/@51.0546259,8.5165635,18z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x47bb8a1817c876a3:0x17f857dce812ebe4!2sAlertshausen,+57319+Bad+Berleburg,+Deutschland!3b1!8m2!3d51.0556901!4d8.5182043!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d51.0546249!4d8.5171297
Vielen Dank für die präzise Lokalisierung!
Pingback: Architektur 1960+, Brutalismus im Kreisgebiet: Löhrtorbad, Siegen (1967) | siwiarchiv.de
Pingback: Architektur 1960+, Brutalismus im Kreisgebiet: Löhrtorbad, Siegen (1967) | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 20.8. – 1.9.2018 | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik August 2018 | siwiarchiv.de
Pingback: “Zeitspuren”-Linktipp: Hauptkatalog der Düsseldorfer Industrieausstellung 1902 mit Siegerländer Unternehmen | siwiarchiv.de
Die Internetseite von Herrn Karl Heupel hat auch noch einige Interessante
Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus im Siegerland.
Der Schwerpunkt der Seite widmet sich dem Bergbau.
http://heupel.hostingkunde.de/medien/krieg_im_siegerland/index.htm
Die Datenbank zur Dokumentarfilmgeschichte der Uni Hamburg gibt zwar keinen Hinweis zm Verbleib des Films, aber wenigstens weitere Informationen zum Film:
1) Kamera: Hans Wunsch
2) Inhalt + neue Literatur:
„Industrielles und kulturelles Aufblühen einer Stadt im Siegener Land.“ (Katalog der Kultur- und Dokumentarfilme aus der Bundesrepublik Deutschland 1954-1959, S. 132)
„Das Werden der Eisenstadt Weidenau im Siegerland aus dem ersten Anfängen heraus (alte Hammerwerke usw.) bis zur Stadtwerdung 1955.“ (Filmkatalog. Nachweisung der deutschsprachigen Lehr- und Aufklärungsfilme des Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesens und der Bautechnik, 1957, Film Nr. 24)
Pingback: Online-Informationen zur Geschichte des Nationalsozialismus in Darmstadt – Stadtarchiv Darmstadt
Pingback: Nach Chemnitz: Stellt Online-Informationsquellen zur lokalen/regionalen NS-Geschichte bereit! | Archivalia
Pingback: Förderprogramm Heimat-Schecks: Bereits zehn Projekte konnten finanziell unterstützt werden | siwiarchiv.de
Pingback: “Zeitspuren”-Linktipp: Video “Abiturientia Siegen 1914” | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 2.9. – 15.9.2018 | siwiarchiv.de
Eine erste Rezension liegt nun vor: https://archivalia.hypotheses.org/80444 .
Siegfried Vogt beantragte am 18. Juni 1937 die Aufnahme in die NSDAP. Die Mitgliedschaft erfolgte rückwirkend zum 1. Mai 1937 – Mitgliedsnummer: 5817265 (Quelle: Bundesarchiv Berlin, NSDAP-Gaukartei | BArch R 9361-IX KARTEI / 46160521; Bundesarchiv Berlin, NSDAP-Zentralkartei | BArch R 9361-VIII KARTEI / 24281192).
Das im Bundesarchiv Berlin vorhandene Wehrstammblatt (Signatur: VBS 1009 ZA VI 0673 Blatt 35) vom 6. Oktober 1939 gibt weitere zusätzliche Informationen:
1) Otto Adolf Hermann lauteten die weiteren Vornamen Vogts
2) Seine Eltern waren Otto Carl Vogt, Kaufmann, und Margarete geb. Pape
3) Er besaß zwei Schwestern (1915 und 1922 geboren).
4) Der Geburtsname von Vogts Frau lautete Winckler.
5) Vogt besaß die Mittlere Reife.
6) Am 15. Mai 1936 trat er dem Nationalsozialistischem Kraftfahrkorps (NSKK) bei.
Das ist richtig,
jedoch kann ich mit diesem unkommentierten statement eigentlich nicht so recht etwas anfangen.
nur zur info:
Wann wer von dieser Generation und in welchem Umfang bei dem Regime „mitgemischt“ hat, kann ich nicht werten, da ich zu der Generation gehöre, von der der „begnadete Helmut Kohl“ von der „Gnade der späten Geburt“ sprach.
Ich weiß aus Gesprächen im Familien- und Freundeskreis meiner Eltern, daß eine Parteimitgliedschaft irgendwelcher Art, die Voraussetzung für die Vergabe des Hugo-Göpfert – Preises war und nachträglich an der Parteimitgliedschaft „gefeilt“ wurde, eine Empfehlung, mit entsprechendem Nachdruck.
Aus gewissen, Ihnen nicht unbekannten Gründen musste der eigentliche Blogeintrag mit weiteren Fakten angereichert werden. Die Fakten selbst bestreiten Sie ja selbst nicht und stellen als solche keinerlei „Vorwurf“ da.
Pingback: In Memoriam Klaus Dietermann | siwiarchiv.de
Ich finde es toll, wenn alte Dinge erhalten und geschützt werden. Aber wie leider so oft, die Gräber der “ Reichen “ sind protzig, aus langlebigem Material und deshalb heute noch erhalten. Aber wo bleibt der “ arme Schlucker „, der kaum Geld für ein Begräbniss hat, geschweige denn für einen Grabstein. Da bleibt nix von übrig. Eines sollten wir dabei aber nicht vergessen……ohne die einfachen Arbeiter, die sich die “ Finger “ dreckig gemacht haben, für wenig Geld, ohne diese Menschen, würde es keinen “ Reichen “ geben. Denn……..wen sollten sie sonst ausbeuten ????? AUSNAHMEN bestätigen die Regel. Trotzdem ist der “ einfache Arbeiter “ nicht vergessen, denn……..er ist in unseren Herzen und Gedanken.
Pingback: Jahresbericht 2017 des Landesarchivs NRW erschienen | siwiarchiv.de
Ist Ihnen der Name Claus Kowallik ein Begriff ?
War er der Gründer dieses Museums ?
Man kann ihn als solchen bezeichnen: „Konzeption und Realisierung dieser Begegnungsstätte lagen in der Hand von Claus Kowallik, Anzhausen, dem Kulturberater der Gemeinde Wilnsdorf.“ (Einladung zur Museumseröffnung am 14. Mai 1993). Claus Kowallik ist am 23.03.2018 verstorben. Vielleicht kann die Museumsleiterin mehr zu seiner Person sagen.
Können Sie mir sagen, ob Frau Kowallik oder einer seiner Brüder noch lebt ?
Dazu kann ich nichts sagen. Ich verweise auf die Todesanzeige vom 26.03.2018 in der Siegener Zeitung; auch im Internet zu finden.
Sehr beeindruckend die Museumsmomente !
Was für eine wunderbare Idee !
Pingback: Sachthematisches Online-Inventar zur Geschichte der Juden in Westfalen | Archivalia
Ich muss den Vorkommentator dringend korrigieren: nicht 1974, sondern 1973 fand der Putsch statt.
Und nicht ein Bild zeichnete Walter Helsper zum Thema, sondern gleich einen ganzen Zyklus. Der ging dann an die Chile-Solidarität. Es geht also fehl, ihn auf einen nur auf sich selbst bezogenen unpolitischen „Freak“ zu sehen. Zeitweise gehörte er auch einer Partei an. In der Nachfolge, ließe sich sagen, von Adolf Küthe. Also von jenem bildenden Künstler, der in seiner Heimat immer noch vollständig vergessen ist, obwohl er eine Bekanntheit repräsentiert, die über das Siegerlandmuseum sehr weit hinausgeht.
Liest sich alles etwas geheimnisvoll, soll es auch. Es gibt eben auch in diesem Landstrich noch einiges zu entdecken.
700 Jahrfeier Siegen, 1924
Siegbrücke, im Hintergrund das Untere Schloß
Es handelt sich nicht um die Siegbrücke. Auch wurde die Aufnahme nicht 1924 gemacht. Die Begründung liefert der Kommentar von Torsten Thomas.
Die Mauer im Hintergrnd dürfte ein Teil der Stadtmauer sein, damit scheidet die Hindenburgbrücke aus. Auf der Mauer ist Schnee zu erkennen, damit scheidet auch die 700 Jahrfeier aus, den diese fand nicht im Winter statt. Aufgrund der Kleidung der Menschen würde ich die Aufnahme in die 50er Jahre datieren.
Vor der Mauer steht eine einzelne Person, vermutlich ein Redner. Auch eine Fahne ist erkennbar.
Alles korrekt. Aber um welche Stadtmauer handelt es sich? Und warum stehen da Redner auf der Brücke?
meine Vermutung: Es handelt sich nicht um Siegen.
Eröffnung der Eisenbahnlinie Niederschelden aus dem Jahre 1856.
Das Foto wurde in Berleburg aufgenommen. Mit einem Kran wird der Bär aufgestellt und die Brücke ist die Bärenbrücke über die Odeborn.
Keine Ahnung, welches Jahr das war. Auf jedem Fall erst nach dem zweiten Weltkrieg.
Ist weder Berleburg noch Bärenbrücke.
Stefan Leipelt hat recht:
Das Bild zeigt die Einweihung der heutigen „Bärenbrücke“ über die Odeborn in Berleburg im Verlauf der Poststraße bei der Einweihung am 26.1.1955.
Der bronzene Bär des Künstlers Wolfgang Kreutter kam nach 1956 dazu.
Nachzulesen bei Heinz Strickhausen in „Wittgenstein“ August 2018, Seite 94 ff.
Somit korrekt gelöst!
Pingback: Online: Sechs Inventare des Urkundenarchivs der Fürsten von Hatzfeldt-Wildenburg zu Schönstein/Sieg | Archivalia
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 17.9. – 29.9.2018 | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik September 2018 | siwiarchiv.de
Pingback: Rückblick: 88. Deutscher Archivtag in Rostock | siwiarchiv.de
Pingback: Rückblick: 88. Deutscher Archivtag in Rostock | Archivalia
Pingback: Ausstellung: Aquarelle von Martin Schulz | siwiarchiv.de
Pingback: Kunstwerk Karl Jung-Dörflers hält Einzug ins Museum Wilnsdorf | siwiarchiv.de
Das Schöne an solchen realistischen Gemälden aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg liegt darin, dass sie einen farbigen Kontrapunkt zur Schwarzweißfotografie bieten.
Es wäre interessant zu wissen, unter welchen Bedingungen die vom NS-Regime verfolgte und 1942 ermordete Jung-Danielewicz das Gemälde verkauft hat / verkaufen musste. Sie wurde im November 1942 nach Minsk deportiert. Aufgrund der zahlreichen Fälle von NS-Raubkunst, die in den vergangenen Jahren öffentlich wurden, sollte man bei Gemäldeverkäufen aus dieser Zeit immer besonders gut hinschauen.
Pingback: Kultur-News KW 41-2018 - Kultur - Geschichte(n) - Digital
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 1.10. – 13.10.2018 | siwiarchiv.de
Pingback: Systeminterne Langzeitspeicherung ist keine Archivierung! | Archivalia
Pingback: Ausstellung „Ein Blick in die Vergangenheit – 370 Jahre Westfälischer Frieden“ | siwiarchiv.de
Pingback: Vortrag: „Es begann in Biedenkopf und Laasphe“ | siwiarchiv.de
Pingback: Neuerscheinung: Tagungsband Deutscher Archivtag Wolfsburg | siwiarchiv.de
Linktipp zum aktuellen Stand in Sachen Jugendstilbad: http://projektplus.de/jugendstilbad-in-siegen/
Am Kampen ?
Guter Hinweis Frau Perol -Schneider, aber beide schräg gegenüberliegende Villen neben und gegenüber dem Kaisergarten, haben zwar einen ähnlichen Baustil, aber es fehlen doch die gravierenden Bauteile (z.B. Dachkonstruktion, seitl. Rund- Erker), die man sicher bei evtl. Umbauten oder Nachkriegsrestaurierungen sicher nicht entfernt oder alles so abgeändert hätte. Es sei denn, Sie haben noch ein Foto von einem Haus „Am Kampen“, das heute gar nicht mehr existiert. Trotzdem vielen Dank !
Bei der Stadt Siegen gibt es eine Inventarisationsliste.
Diese wurde durch die LWL-Denkmalpflege erstellt.
Sie beinhaltet Objekte, die evtl. später ein Denkmal sein
könnten. Sie beinhalten eine Gebäudebeschreibung
anhand von Bauelementen. Dazu gibt es eine Alterseinschätzung.
Mit diesem Arbeitsinstrument, welches für Siegen erst ca. 1990
erstellt wurde, könnte der Standort eingegrenzt werden.
Siegen hat sich halt entwickelt.
Vielen Dank für den Hinweis! Dies würde allerdings 2 Dinge voraussetzen:
1) Das Gebäude stand 1990 noch.
2) Das Gebäude wurde damals (schon) als denkmalswürdig erachtet.
Einige Fragen.
– Wenn man schon die These von der angeblichen früheren „Prächtigkeit“ der Stadt Siegen mit einem Zitat untermauern möchte: Muss man dann als ersten und einzigen Bürgen ausgerechnet jemanden wie Fritz Mielert bemühen? (U.a. Autor des Machwerks „Bunte Bilder aus dem größten aller Kriege. Ernstes und Heiteres für das deutsche Volk“ 1915, folgerichtig später Funktionär der Reichsschrifttumskammer)
– Läßt sich aus den Lobpreisungen eines 1879 geborenen Schlesiers irgend etwas quellenmäßig Gesichertes über das frühere architektonische Bild Siegens ableiten? (Z.B. „blendend weiße“ Häusermassen im Mittelalter)
– Wie fügen sich in das des „hellsten Zujubelns werte“ Wunschbild die Schilderungen auswärtiger Augenzeugen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts ein, die es für nötig hielten, auf die Schmutzigkeit der Stadt zu jener Zeit hinzuweisen?
– Ist es nötig, die „meisten anderen Städte mit ähnlichem Schicksal“ (massiven Kriegszerstörungen) pauschal zu diskreditieren, um die angebliche „Erfolgsgeschichte“ der eigenen Stadt um so mehr herauszustreichen?
– Sind all die Durch- und Zugereisten, die Siegen als Ganzes (abgesehen von einzelnen ansehnlichen Vorzeigepunkten) ganz und gar nicht mit einem „nachhaltig schönen Stadtbild“ assoziieren, nun allesamt Banausen und Geschmacksverirrte, denen endlich mal die Augen geöffnet werden müssen?
– Wäre es nicht eine angemessenere Ausgangsbasis für die Arbeit an der zukünftigen „Stadtbildqualität“, die „Leistung des Wiederaufbaus“ in Siegen und an vielen anderen vergleichbaren Orten ganz nüchtern darin zu sehen, dass aus dem Ruinenfeld schnell eine für ihre Bürger wieder funktionierende Stadt erschaffen wurde, was unter den gegebenen Voraussetzungen und Dringlichkeiten keine ästhetische Prioritätensetzung erlaubt hatte?
Pingback: Standort gesucht (2), eines Siegener Gebäudes, das von Peter Weller | siwiarchiv.de
Das Haus sieht aus wie die „Gelbe Villa“ in Kirchen, Bahnhofstraße 14
Danke für den Hinweis! Die Strassenfront der Kirchener „Gelben VIlla“ sieht wirklich aus, wie auf dem vorliegenden Bild.
In der geschlossenen Facebook-Gruppe „Stadt Siegen in alten und neuen Bildern“ wurde darauf hingewiesen, dass das Gebäude in der Kirchener Bahnhofhofstr. 14 in der Denkmalliste der Stadt Kirchen eingetragen ist: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Kulturdenkm%C3%A4ler_in_Kirchen_(Sieg) . Vielen Dank für den Hinweis!
Pingback: Unterlagen zur Jugend- und Protestkultur der 60er Jahre in der Region gesucht | siwiarchiv.de
Pingback: Standort gesucht (3), eines Siegener Gebäudes, das von Peter Weller | siwiarchiv.de
Errichtungszeitraum ca. 1905-1915 (engl. Landhausstil).
Danke für den Hinweis! In der geschlossenen Facebook-Gruppe „Stadt Siegen in alten und neuen Bildern“ wurde bisher unterschiedlich Standorte diskutiert: Netphen-Deuz (wohl eher nicht), Siegen, Freudenberger Str. /Nähe Hermelsbacher Weg oder Siegen, Rosterberg …..
Bisher wurde lediglich das Haus Waldrich am Siegener Giersberg vorgeschlagen. Allerdings scheint es sich nicht um dieses Gebäude zu handeln.
Pingback: Standort gesucht (4), eines Siegener Gebäudes, das von Peter Weller | siwiarchiv.de
Die Villa Waldrich im Hohler Weg scheint nicht nur richtig zu sein, sondern sie ist es wirklich nicht !!! Die Archiv- Bezeichnung „Haus in Siegen“ muß bei diesem gesuchten Gebäude auch nicht unbedingt stimmen, wie bereits das Ergebnis beim Gebäude Nr. 1.01 gezeigt hat. Hier wurde z.B. von Frau Ursula Schleifenbaum der richtige Hinweis gegeben. Das gesuchte Haus befindet sich in Betzdorf-Kirchen, in der Bahnhofstr. 14 (Gelbe Villa).
die villa steht in der tiergartenstrasse 99—bis heut nur leicht veraendert—
liebe gruesse Lars Bohn
Ja das stimmt ! Glückwunsch Herr Bohn. ! Wie sind Sie darauf gekommen ? Hätte ich bei meiner google – Suche aber auch finden müssen . Das ist nun schon der 2. Treffer durch diese Suchaktion. Vielen Dank !!!
ich intressiere mich sehr fuer baugeschichte–und das haus war mir schon einmal aufgefallen
ich selbst sammle alte aufnahmen von haeusern des siegerlandes—der zeit um 1910–meist aufgenommen von wanderfotographen—und meist stehen die bewohner davor—bisher hab ich ueber 100 orginale gesammelt ungefaher 10 habe ich auch noch nicht zuordnen koennen–ich kann ihnen gern mal beispiele mailen—
Lieber Herr Bohn, leider findet man Sie nicht im Interet-Tel.-Verzeichnis. Es wäre ja nett, wenn Sie mich einmal kontaktieren würden.
unglaublich
seit 1892 steht die germania an dieser stelle—
ich hoffe das die meisten personen im stadtrat geschichtsbewusst und vernuenftig abstimmen–und auch die denkmalbehoerde eine umstellung ablehnt
Pingback: CD-Hinweis: Eberhard Katz | siwiarchiv.de
Ein aktuelles Bild, das freundlicherweise vom Heimatverein Kirchen (Eberhard Graf) zur Verfügung gestellt wurde:

Eindruck von der Rubensohn-Ausstellung:

Video zur Vitrinenausstellung:
Eberhard Katz war der jüngere Bruder des ersten Ehemannes meiner Mutter, Helmut Katz (1919-1945). Er wurde 1954 mein Pate. Nachdem es mich beruflich ins Rheinland verschlug, habe ich ihn und seine Familie oft in Rösrath besucht. Es war mir eine Ehre, ihm zu seinem 90. Geburtstag, den er ja selbst nicht mehr feiern konnte, einen kleinen Artikel in der Wikipedia zu widmen. Da gehörte er schon längst hin.
Pingback: Standort gesucht (5), eines Siegener Gebäudes, das von Peter Weller | siwiarchiv.de
Hinweis:
Der SHGV-Archivar hat damals dieses Foto Nr. 1.12 mit Wohnhaus Karl Hermann Klingspor, Siegen- Kirchweg 4 und dann verbessert mit Waldstr.13 A
gekennzeichnet. Alle Angaben sind aber falsch. Die heute noch vorhandene Villa Klingspor (Inh. Naxos-Werke) ehem. Waldstr. 13 A, heute > „Am Stadtwald “ steht neben der Verwaltungs- Fachschule am Fischbacherberg. Diese Haus 1.12 muß nach dem Blick auf den Dicken Turm (li.) in der ehemaligen Feldstr. (heute Ernst Bach Str. ) gestanden haben und auch einen ganz anderen Besitzer/Erbauer gehabt haben. Auf bisher gesichteten alten Postkartenansichten vom Fischbacherberg konnte ich diese Villa aber nicht mehr zu lokalisieren. Sie ist offenbar im Krieg zerstört worden . Es wäre ja schön, wenn es noch jemand gibt, der Fotos besitzt, wonach der ehemalige Standort noch genauer sichtbar gemacht werden könnte.
Ist im Hintergrund der Dicke Turm zu sehen??? Das Haus könnte am Wellersberg sein???
Liebe Frau Schleifenbaum, da waren Sie offenbar nur eine Minute zu spät dran, aber vielen Dank für Ihre emsige Mithilfe. Zu Ihrem erfolgreichen Tipp zum Foto 1.01 , wäre es sicher ganz interessant einmal zu wissen, wie Sie das Haus denn gefunden haben. Kannten Sie es evtl. über die Caritas ???
Da Peter Weller auch Betzdorfer Raum tätig war – habe ich bei Google – alte Häuser 1910 – Bilder eingegeben.
Es dauerte etwas – dann erschien dieses „Neue Bild“. Ich bin dann auch ziemlich hartnäckig. Macht Freude – diese Sucherei.
Mein erster Gedanke war: Graf-Luckner-Straße mit Blick auf den Güterweg links im Hintergrund. Allerdings passen die aktuellen Häuser wohl nicht dazu.
Ihr Hinweis ist gar nicht mal so falsch, denn Peter Weller hat in der ehemaligen Weidenauer Burgstr. ( heute Graf Luckner Str.) allein zwei weitere Privathäuser fotografiert. (Villa von Paul Breitenbach , Haus Nr. 16 u. Hebamme Heß , Nr. 20 ) Bei diesem Foto mit Hintergrund Kolonie-Siedlung, steht wohl das Haus in der Luckner Str. Nr. 23 in Verdacht, aber dem Gebäude fehlen doch einige gravierende Merkmale (z.B. die Gauben ). Aber selbst, wenn man das Foto spiegelbildlich betrachtet und der Erker auf der rechten Seite liegt, stimmt es kaum mit der Hintergrund-Siedlung überein. Aber besten Dank für Ihren Hinweis ! Werde ihn sicher im Blick behalten und evtl .einmal mit dem heutigen Besitzer sprechen, vielleicht hat man ja da in den letzten 100 Jahren so einiges umgebaut.
Das Gebäude befindet sich laut Thomas Bartolosch in Betzdorf, Bismarck
Bahnhofstr. 28. Ich hatte Dr. Bartolosch angeschrieben, nachdem ein Gebäude in Kirchen identifiziert werden konnte. Fotografischen Beleg reiche ich morgen nach.Aktuelles Bild des Gebäudes in der Betzdorfer Bismarck

Bahnhofstr. 28, das Dr. Bartolosch freundlicherweise fotografiert hat:Heureka ! Das ist der 3. Treffer der Serie. Danke !
Aber bei „google earth“ wird die Bahnhofstr. Nr. 28 so nicht sichtbar, auch wenn leider nur die Dachansichten zu sehen sind. Entweder irrt sich google mit der Haus-Nr. oder Herr Dr. Bartolosch , was aber eigentlich recht unwahrscheinlich ist, da er doch selbst Betzdorfer ist.
Die Verwechslung ist mein Fehler gewesen.
Pingback: Standort gesucht (6), eines Siegener Gebäudes, das von Peter Weller | siwiarchiv.de
Pingback: Standort gesucht (7), eines Siegener Gebäudes, das von Peter Weller | siwiarchiv.de
das haus stand/steht in der ernstbachstrasse 18—nur das kellegeschoss ueberstand den weltkrieg—-ich sammle siegerlaender ansichtskarten und eine meiner karten zeigt die ernstbachstrasse und laesst auf die genaue lage schliessen —das haus im heimatschutzstil um1910 gebaut hatte auch auf der rueckseite zum talgrund hin einen doppelrisalit wie auf der strassenseite—ich kann ihnen gern die ansichtskarte mailen—lieb gruesse
lars Bohn
die aufanhmen von peter weller stammen ja vermutlich aus der zeit um 1935–
1928 damals unter der adresse feldstrasse 18 gehoerte das haus dem komerzienrath karl hentschel in kassel—einem mitglied der dort bekannten industriellenfamile—vermutlich durch zahlungsschwierigkeiten an diesen eigentuemer gelangt–zur miete wohnt dort 1928 der dipl ing.otto favorke
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 14.10. – 27.10.2018 | siwiarchiv.de
Pingback: Standort gesucht (8), eines Siegener Gebäudes, das von Peter Weller | siwiarchiv.de
In der geschlossenen Facebook-Gruppe „Stadt Siegen in alten und neuen Bilder“ wurde folgender Standort vorgeschlagen: Siegen, Ecke Knopsstrasse / Oberlinstrasse.
Das Gebäude Knopsstr. 1 hat eine gewisse Ähnlichkeit, aber durch ein Foto von Peter Weller ( Archiv Nr. 1.15 ) mit Blick in die Knopsstr. ist links noch die Hausecke von Haus Nr. 1 zu sehen.
Es ist auf der Giebelseite kein Fachwerk vorhanden, sondern es ist das verschieferte Mansardendach schon damals so vorhanden gewesen , wie heute. Somit muß, auch nach meiner Rücksprache mit der heutigen Hausbewohnerin Frau Anke Finger, davon ausgegangen werden, daß es nicht das gesuchte Wohnhaus sein kann. Es hätte sonst sicher vieles gut gepaßt, zumal ja auch der Fotograf damals um ca. 1912 fast genau an der gleichen Stelle ein Foto von der Knopsstr. aufgenommen hat. Die Vermutung liegt somit nahe, daß es sich bei dem gesuchten Gebäude vielleicht auch um ein Haus im Betzdorfer Raum handeln kann, da ja bereits schon einige der gesuchten Gebäude dort aufgedeckt wurden, obwohl sie vom damaligen SHGV-Archivar fälschlicherweise als „Haus in Siegen“ gekennzeichnet wurden. Aufgefunden werden kann das wohl nur durch interessierte Einheimiische, da von dieser Region keine 3D-Satellittenaufnahmen bei google–earth vorliegen.
Günter Dick gibt hierzu folgende Rechercheergebnisse:
„Es ist hier nur zu vermuten, daß das Foto , wenn es denn wirklich in Weidenau gemacht wurde, das Haus Müller in der Ferndorfstr. 13 (ehem. Haus Nr. 45) in Schneppenkauten gewesen sein könnte..Das Türmchen ist heute hinter hohem Baumbewuchs verdeckt. Der Feldweg der parallel zur heutigen Weidenauer Str. verlief, wurde bei Anlage der Ferndorfstr. eingeebnet und das Gebäude in weiten Teilen schon vor 1910 umgebaut.:
> Traufe von Dach u. Turm auf gleiche Höhe, – Anbau auf der Nordseite entfernt, – Hauseingang auf Südseite zur Ferndorfstr. hin verlegt, – Ziegelfassade erhielt hellen Verputz , – Giebel auf der Ostseite erhielt oben eine Abflachung, – Für die Verlegung des Hauseinganges spricht, daß an der ehem. Stelle die Ziegelumrandung der Haustür erhalten blieb .
Eine Ansichtspostkarte von ca. 1910 zeigt aber das Haus schon in seiner heutigen Form., von zahlreichen Gebäuden umgeben. Das Gebäude und das Foto müßte dann u.U. schon um die Jahrhundertwende entstanden sein, wo die gesamte Umgebung noch unbebaut war.
Leider ist im Archiv des Siegener Bauamtes in Geisweid die alte Bauakte zur Ferndorfstr. 13 (45) nicht mehr aufzufinden, so daß auch der Erstbesitzer und Bauherr der Villa (noch) unbekannt bleibt. ( vermutlich waren es Personen aus der naheliegenden Fa. Schmidt + Melmer) – Der älteste Sohn des Firmengründers Karl Schmidt – Robert, erbaute eine ähnlich aussehende Villa in unmittelbarer Nachbarschaft in der Ferndorfstr. 32, – Abriß erfolgte ca. 1975 für Erweiterungsbau des FJM-Gymnasiums )
Nach den vorliegenden Erkenntnissen sind aber Zweifel an der Richtigkeit der Annahmen sicher nicht ganz von der Hand zu weisen.
Es ist nur schade, dass Peter Weller damals seine Kamera nicht etwas weiter nach links ausgerichtet hat, denn dann hätte man anhand der dann sichtbaren ehem. Oberen Friedrichstr. ( Weidenauer Str.) die Örtlichkeit heute besser lokalisieren können, aber das war ihm offensichtlich gar nicht wichtig, Hauptsache er hatte die „Architektur im Kasten.“.
„
Neben der Graf-Luckner Str. 23 wurde auch Siegen, Harkortstr. 5, in der der geschlossenen Facebookgruppe „Stadt Siegen in alten und neuen Bildern vorgeschlagen.
Zusammenstellung der bisherigen Ergebnisse:
1) Siegerländer Heimat- und Geschichtsverein, Archiv Peter Weller, Nr. 1.01: Kirchen, Bahnhofstraße 14
2) Siegerländer Heimat- und Geschichtsverein, Archiv Peter Weller, Nr. 1.02: [Siegen-Weidenau, Graf-Luckner Str. 23; Siegen, Harkortstr. 5]
3) Siegerländer Heimat- und Geschichtsverein, Archiv Peter Weller, Nr. 1.03: Betzdorf, Bismarckstr. 28
4) Siegerländer Heimat- und Geschichtsverein, Archiv Peter Weller, Nr. 1.08: Siegen, Tiergartenstr. 99
5) Siegerländer Heimat- und Geschichtsverein, Archiv Peter Weller, Nr. 1.12: Siegen, Ernst-Bach-Str. 18; Siegen, Am Stadtwald 11/13]
6) Siegerländer Heimat- und Geschichtsverein, Archiv Peter Weller, Nr. 2.03: [Siegen, Ecke Knopsstrasse / Oberlinstrasse]
7) Siegerländer Heimat- und Geschichtsverein, Archiv Peter Weller, Nr. 4.12
8) Siegerländer Heimat- und Geschichtsverein, Archiv Peter Weller, Nr. 4.18: Es ist hier nur zu vermuten, daß das Foto , wenn es denn wirklich in Weidenau gemacht wurde, das Haus Müller in der Ferndorfstr. 13 (ehem. Haus Nr. 45) in Schneppenkauten gewesen sein könnte..Das Türmchen ist heute hinter hohem Baumbewuchs verdeckt. Der Feldweg der parallel zur heutigen Weidenauer Str. verlief, wurde bei Anlage der Ferndorfstr. eingeebnet und das Gebäude in weiten Teilen schon vor 1910 umgebaut.:
> Traufe von Dach u. Turm auf gleiche Höhe, – Anbau auf der Nordseite entfernt, – Hauseingang auf Südseite zur Ferndorfstr. hin verlegt, – Ziegelfassade erhielt hellen Verputz , – Giebel auf der Ostseite erhielt oben eine Abflachung, – Für die Verlegung des Hauseinganges spricht, daß an der ehem. Stelle die Ziegelumrandung der Haustür erhalten blieb .
Eine Ansichtspostkarte von ca. 1910 zeigt aber das Haus schon in seiner heutigen Form., von zahlreichen Gebäuden umgeben. Das Gebäude und das Foto müßte dann u.U. schon um die Jahrhundertwende entstanden sein, wo die gesamte Umgebung noch unbebaut war.
Leider ist im Archiv des Siegener Bauamtes in Geisweid die alte Bauakte zur Ferndorfstr. 13 (45) nicht mehr aufzufinden, so daß auch der Erstbesitzer und Bauherr der Villa (noch) unbekannt bleibt. ( vermutlich waren es Personen aus der naheliegenden Fa. Schmidt + Melmer) – Der älteste Sohn des Firmengründers Karl Schmidt – Robert, erbaute eine ähnlich aussehende Villa in unmittelbarer Nachbarschaft in der Ferndorfstr. 32, – Abriß erfolgte ca. 1975 für Erweiterungsbau des FJM-Gymnasiums )
Nach den vorliegenden Erkenntnissen sind aber Zweifel an der Richtigkeit der Annahmen sicher nicht ganz von der Hand zu weisen.
Es ist nur schade, dass Peter Weller damals seine Kamera nicht etwas weiter nach links ausgerichtet hat, denn dann hätte man anhand der dann sichtbaren ehem. Oberen Friedrichstr. ( Weidenauer Str.) die Örtlichkeit heute besser lokalisieren können, aber das war ihm offensichtlich gar nicht wichtig, Hauptsache er hatte die „Architektur im Kasten.“.
Thomas Bartolosch schreibt dazu: , außerdem ein Foto mit beiden Krupp’schen Gebäuden in schlechter Qualität (bei Regen aus dem Auto durch die Windschutzscheibe …):
, außerdem ein Foto mit beiden Krupp’schen Gebäuden in schlechter Qualität (bei Regen aus dem Auto durch die Windschutzscheibe …):  ..
.. .
.
„Das Wohnhaus auf dem Weller-Bild-Nr. 1.02 habe ich inzwischen ebenfalls identifizieren können. Es handelt sich um eines von zwei Krupp’schen Wohnhäuser im Betzdorfer Stadtteil Hohenbetzdorf, und zwar in der Nähe des Schützenplatzes. Das Haus befindet sich an der Martin-Luther-Straße 28 (das andere hat die Nr. 26). Das Haus wurde, anders als das daneben stehende, gut erhaltene Krupp’sche Wohnhaus, im Zweiten Weltkrieg bombengeschädigt und nach dem Krieg in modifizierter Weise wieder aufgebaut, so dass man es kaum wieder erkennt, zumindest nicht auf den ersten Blick hin, vor allem wegen einer veränderten Dachform. Allerdings lassen sich fotografische Beleg finden. Ich füge Ihnen bei ein Foto von heute, in etwa vom gleichen Standort aus aufgenommen
Das nächste Foto zeigt das Gebäude wiederum von der Martin-Luther-Straße aus, allerdings mit anderer Draufsicht:
Sie sehen das fragliche Gebäude von der Rückfront, leider nur aus einer Perspektive, weil ich sonst das entsprechende Grundstück bzw. den Garten des Hauses hätte betreten müssen, was ich nicht wollte. Man erkennt – zur Orientierung – vorne Teile der Rückfront des anderen, gut erhaltenen Krupp’schen Wohnhauses: .
.
Peter Weller hat die Rückfront oder -ansicht beider Häuser selbst fotografisch im Bild festgehalten, was mir eine Hilfe zur Identifizierung des einen Hauses war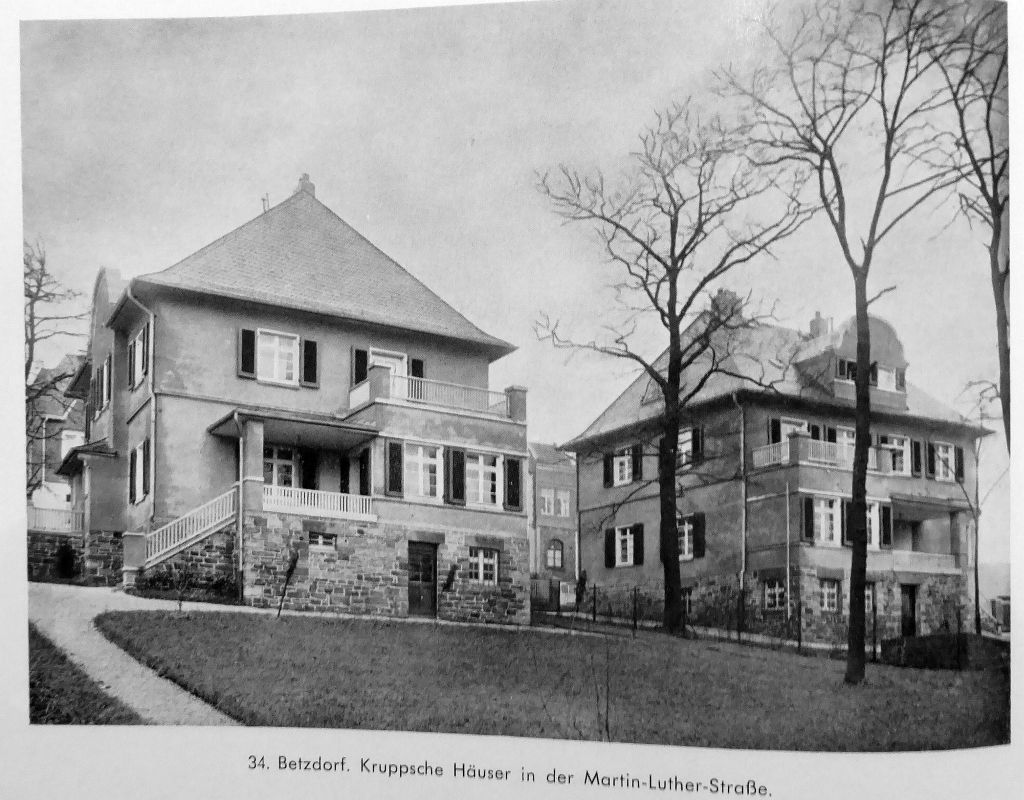 .
.
Diese Aufnahme ist erschienen in:
Das alte Betzdorf in Lichtbildern von Peter Weller. Im Auftrage der Stadt Betzdorf hrsg. v. Wilhelm Güthling, Betzdorf 1963 (aus Anlass der Verleihung der Stadtrechte an Betzdorf zehn Jahre zuvor).
Das kleine Heft ohne Seitenangaben zeigt zum Foto-Nr. 34 folgende Bildunterschrift: Betzdorf. Kruppsche Häuser in der Martin-Luther-Straße …. . Es gibt eine ganze Reihe von Zeichen, die das Haus als solches erkennen lassen, doch darauf in allen Einzelheiten eingehen zu wollen, würde eindeutig zu weit führen..“
Das erste und das dritte Foto müssten getauscht werden. Jedenfalls zeigt das dritte Foto das Krupp’sche Wohnhaus heute von dem Standort des Fotografen Peter Weller damals.
Danke für die Korrektur!
Die Korrektur ist inzwischen vorgenommen worden, Danke an Archivar Wolf!
T.B.
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik Oktober 2018 | siwiarchiv.de
Pingback: Sparkasse Siegen und Bürgerverein Hilchenbach unterstützen die Angebote in der Wilhelmsburg | siwiarchiv.de
Sehr interessanter Beitrag, sehr gut beschrieben.
Pingback: Namensumbenennung der Hindenburgstraße in Hilchenbach | siwiarchiv.de
Meine Schwester hat ein Gemäldem: Matterhorn“ signiert mit S G Vogt. Ist näheres zu dem Gemälde bekannt?
Könnten Sie uns Fotografien des Bildes und der Signatur senden? Eventuell können wir dann etwas zu diesem Gemälde sagen.
Nachdem ein privater Mailaustausch mir dazu Anlass gibt, komme ich noch wieder öffentlich auf Alfred Fissmer mit ein paar zusätzlichen Feststellungen zurück.
Die Annahme trat auf, dass die in Berlin in den vormaligen BDC-Beständen (Bundesarchiv Berlin, Best. 3.100 (NSDAP-Zentralkartei) befindlichen Unterlagen noch nicht ausgewertet seien. Das ist unzutreffend, es geschah bereits vor etwa zwei Jahrzehnten. Leider aber sind die Ergebnisse dieser Auswertung, die etwa Eingang in einen Bericht der Westfälischen Rundschau und in mein 2001 erschienenes Buch Siegerland und Wittgenstein im Nationalsozialismus. Personen, Daten, Literatur fanden, immer noch nicht recht in die öffentliche Überlieferung eingegangen.
Vor allem gilt das für Eintrittsgesuch von Fissmer in die Nazi-Partei kurz nach der Machtübergabe. Mit Datum vom 1.5.1933 wurde er unter der Mitgliedsnummer 3.128.057 in die Ortsgruppe Siegen-Altstadt aufgenommen. Das stieß in der Ortsgruppe nicht nur auf Zustimmung, die Meinungen waren gespalten und ein Teil der Ortsgruppe versuchte, die Sache rückgängig zu machen.
Fissmer war zwar – wiewohl bis dahin nach den bis heute geltenden Annahmen parteilos – in den Weimarer Jahren ein entschiedener und gegenüber der sozialdemokratisch geführten preußischen Regierung konfliktbereiter Parteigänger des verfassungsfeindlichen gegnerischen „vaterländischen Lagers“ gewesen, hatte aber in diesem parteiübergreifenden Rechtsbündnis mit DNVP, NSDAP, Kriegervereinen usw. die NSDAP nicht besonders bevorzugt. Darauf kamen Gegner, die er in dieser Partei hatte, zurück und bewirkten, dass mit Datum vom 26.10.1934 seine Mitgliedschaft widerrufen wurde. Die Gauleitung war auf seiner Seite gewesen. Erst 1937 nach Ablauf der 1933 (gegen „Märzgefallene“ gerichteten) vierjährigen Aufnahmesperre konnte auf einen erneuten Antrag hin aufgenommen werden. Neue Parteinummer: Nr. 5.889.595.
Es gab, wie sich denken lässt, auch in der Nazi-Partei Rivalitäten und unterschiedliche Interessen und Einschätzungen. Dass sie keine homogene Größe war, ist ja in der Zeitgeschichtsforschung unbestritten. Das war sie wie überall auch im Siegerland.
Immerhin aber war es Fissmer schon 1933 gelungen, in die Förderorganisation für die SS aufgenommen zu werden. Die Reichsorganisationsleitung gab der „FM-Organisation“, wie sie hieß, „für den Bestand der Schutzstaffel größte Bedeutung“. Sie dürfe in ihrer Arbeit durch keine andere Dienststelle gestört werden (1943).
Das nach dem Ende des Regimes aufgekommene Fissmer-Narrativ stellt seinen Protagonisten als langjährigen und verdienstvollen Amtsträger dar, der irgendwie unpolitisch-konservativ gewesen sei, also der politischen Mitte zuzuordnen, eine honorige lokale Größe, durch Jovialität auch populär („volkstümlich“).
Zeitzeugen mindestens seiner frühen Parteimitgliedschaft, die es gegeben haben müsste, weil es ja in der NS-Altstadtgruppe diesen Konflikt gab, meldeten sich zu keinem Zeitpunkt. Das muss nicht überraschen.
Was dann aber schon etwas überrascht, ist eine sehr viel jüngere Gedächtnislücke. Als 2005 eine viel beachtete Ausstellung „Kriegsende 1945 in Siegen“ im früheren Kaufhof-Gebäude stattfand, zu der ein Ausstellungsbuch („Kriegsende 1945 in Siegen. Dokumentation der Ausstellung“) erschien, fehlten sowohl in der Ausstellung als auch in dem Begleitbuch im Fissmer-Kapitel der frühe Eintritt in die NSDAP wie auch die SS-Fördermitgliedschaft.
Ich gehe davon aus, dass das Team, das Ausstellung und Buch verantwortete, seriös und gründlich in Archiven und Literatur recherchierte. Das heißt, dass es m. E. ist auszuschließen ist, dass die beiden hier in Rede stehenden Sachverhalte in diesem Kreis unbekannt waren, dass sie vielmehr bewusst verschwiegen wurden. Man könnte auch sagen, ersetzt wurden, nämlich durch einen angeblichen „ersten Machtkampf“ 1933 von Fissmer gegen die NSDAP. Den dieser gewonnen habe. Ob bzw. wie der einen politischen Inhalt gehabt haben könnte, dazu nichts. Unter den gegebenen Bedingungen. Von einem zweiten oder weiteren Machtkämpfen ist dann nicht weiter die Rede.
Fissmer sei „zeitweise“ NS-„skeptisch“ gewesen. Belege selbst zu einem solchen absoluten Minimum an Distanz fehlen. Gesichert lässt sich sagen, dass von Fissmer durch die Jahrzehnte (Weimar/NS-Regime/BRD) kein abwertendes Wort zur NSDAP, ihrer Politik und ihrer Anhängerschaft überliefert ist.
Mit anderen Worten, es wurde 2005 einmal mehr am Überleben jenes entlastenden Narrativs gebosselt, das m. E. exemplarisch für Gang und Form der „Bewältigung“ der Nazizeit steht und das in der „großen“ Historiografie inzwischen kräftig unter Druck geraten war.
Ich nutze die Gelegenheit auf einen von Fissmers Zeitgenossen, ebenfalls eine zeitgeschichtlich interessante Figur, zu verweisen, der dem freundlichen Fissmer-Narrativ viel Unterstützung zukommen ließ und bis heute von Fissmer-Unterstützern dafür in Anspruch genommen wird, den damaligen SPD-Regierungspräsidenten Carl Friedrich Fries, einen klassischen „Wanderer zwischen den Welten“(http://widerspruchundwiderstandimnsinsiwi.blogsport.de/verzeichnis/biografische-skizzen/#fries1, http://akteureundtaeterimnsinsiegenundwittgenstein.blogsport.de/a-bis-z/gesamtverzeichnis/#fries3).
Fissmer hatte seine Position ja selbst und sicherlich ohne Erklärungsnot auf den Punkt gebracht. Wörtlich bei der Feststunde anläßlich des 25. Dienstjubiläums als Bürgermeister im August 1944: „Ich bin ein getreuer Gefolgsmann des Führers“ (Mitschrift der Ansprache in seiner Personalakte, Stadtarchiv Siegen, D 525; veröffentlicht in Nationalzeitung 18.8.44). Aber sogar solche eindeutigen Bekundungen lassen sich natürlich, wenn es gewollt wird, schönreden und ins Gegenteil verkehren. Etwa so: „Im Herzen war er ein glühender NS-Gegner, mußte aber nach dem 20. Juli Loyalität heucheln, um von sich abzulenken und weiter im Geheimen das gehasste Regime bekämpfen zu können.“ Blödsinn, aber wie alle Verschwörungstheorien nicht zu widerlegen. Es ist nun mal so: Die Herren Fissmer, Flick usw. haben nach wie vor ihre treuen Fangemeinden, die sich in ihrer Anhänglichkeit durch Fakten und Argumente nicht beeindrucken lassen. C’est la vie (leider).
Zu Fritz Fries kann auf eine interessante Akte im Nachlass Bruno Jenners verwiesen werden (RWN 0110, Landesarchiv NRW/Abt. Rheinland), die neben Dokumenten zum „Disziplinarverfahren gegen den Regierungspräsidenten von Arnsberg, Fritz Fries“ auch solche zu seinem – milde ausgedrückt – etwas seltsamen Verhältnis zur Siegener Gestapo enthält.
Auf der Facebook-Seite der Westfalenpost Siegen wird dieser Antrag bereits diskutiert:
Pingback: Blogparade: "Kultur ist für mich ..." - Aufruf #KultDef
Konzeption allgemein, Abgrenzung zu den kommunalen Archiven und die berühmte Handhabe mit Nachlassfragen werden da spannend werden
Beratung der SPD Neunkirchen/Siegerland durch das Archiv der sozialen Demokratie wäre hier sicherlich angeraten. Andere Frage: Warum das Ganze nicht in Zusammenarbeit mit dem Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein planen und dort magazinieren und darüber sowohl Fachlichkeit als auch Benutzbarkeit gewährleisten? Die Ehrenamtler, Praktikanten und Studierenden, von denen die Rede ist, könnten dann die nötigen archivfachlichen Arbeiten unter Anleitung erledigen. So wäre allen Seiten bestens gedient.
Ich saß in Duisburg im Landesarchiv und las dort die Mitteilung von Peter Kunzmann, so dass Gelegenheit war, die Akte gleich mal kommen zu lassen (Danke für den Hinweis!).
Es handelt sich dabei um einen von zwei nicht so umfangreichen Bänden eines kleinen Nachlasses von Hans Bruno Jenner, 1945-46 Stellvertreter von Fries in Arnsberg (Regierungsvizepräsident), ab 1946 bis 1949 Ministerialdirektor im Innenministerium in Düsseldorf. Er hatte damals eine Akte „Fall Fries“ angelegt. Leider fehlen, wie sich zeigte, einige Seiten.
Fries stand mindestens seit Juni 1946 stark unter Druck. Gerüchte liefen im Siegerland um. Er war von anderen Sozialdemokraten beschuldigt worden, mit „Stimmungsberichten“ der Gestapo zugearbeitet zu haben. Dafür sei er mit Zigaretten und Fleisch- und Buttermarken entgolten worden. Mit dem für ihn zuständigen Gestapo-Beamten Bültmann habe er Geschenke ausgetauscht. Ausweislich seines Parteiabzeichens am Revers, das die Sprecher häufiger bzw. „täglich“ gesehen hätten, gingen sie von einer Mitgliedschaft von Fries in der NSDAP aus. Davon habe er auch geschäftlich Vorteile gehabt. Es gab weitere Hinweise und einige pikante Angaben, auf die ich nicht eingehen muss.
An Fries’ Seite jedenfalls stand Alfred Fissmer, der ihn mit einer umfangreichen Stellungnahme entlastete. Dabei bekundete Fissmer auch, „bei mir wurden alle Neuigkeiten [aus der regionalen NSDAP] abgeladen, genau wie alle Zwistigkeiten unter den Parteimitgliedern“.
Diese Selbstbeschreibung Fissmers vom August 1946 sollte eigentlich vollständig genügen zu beschreiben, wie man in seiner Partei das städtische Oberhaupt sah. Zu einem Partei-„Skeptiker“ wären diese Gesprächspartner kaum mit ihren Neuigkeiten und Zwistigkeiten gekommen.
Es sei denn ein Betrachter geht davon aus, dass die Nazis in ihrer Partei irgendwie und eigentlich nur eine Minderheit darstellten. Genau das aber ist der Inhalt jenes Entlastungsnarrativs, das nach kurzem Schreck seit der zweiten Hälfte der 1940er Jahre aufkam und bis heute entgegen allem besseren Wissen/aufgrund besseren Wissens schweigend gepflegt werden kann. Diese Vorstellungswelt ist es, die in dem gelegentlichn Wort vom „Fliegenschiss“ Ausdruck findet.
Als Arbeitsort u.a. auch für ein solches SIWI-Archiv wäre m.E. das derzeit dem Verfall preisgegebene, unter Denkmalschutz gestellte sog. „Hüttenmeisterhaus“ in Lohe-Kredenbach gut geeignet. Eine solche gemeinwohlorientierte Verwendung des 300 Jahre alten Fachwerkgebäudes (ehem .Arbeiter-Gemeinschaftshaus der ehem Loher Hütte) , könnte dann auch als Anlaß genommen werden, den bisher uneinsichtigen Privatbesitzer des Siegerländer Kulturerbes einem Enteignungsverfahren durch die Kommune Kreuztal und evtl. auch dem Land NRW zu unterziehen.
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 28.10. – 9.11.2018 | siwiarchiv.de
Pingback: Wohin mit den regionalen Künstlernachlässen? | siwiarchiv.de
Pingback: Kultur-News KW 45-2018 News von Museen, Ausstellungen, Geschichte
Pingback: Kultur-News KW 45-2018 News von Museen, Ausstellungen, Geschichte
Pingback: Heute vor 100 Jahren: Frauenwahlrecht | siwiarchiv.de
In der heutigen Print-Ausgabe der Westfälischen Rundschau findet sich im Bericht über Parteitag folgendes zur Errichtung des regionalen SPD-Archivs: “ …. Unter anderem nimmt die Versammlung einen Antrag des Gemeindeverbandes Neunblirchen an, zeitnah ein Archiv der SPD in Siegen-Wittgenstein anzulegen, imn dem zentral wichtige Dokumente gesammelt werden sollen.
Sie wisse selbst sehr genau, wie schwierig es sein könne, über Personen und Aktionen zu recherchieren, untersützt Traute Fries das Vorhaben und erinnert daran, dass sich der Verein „Geschichte der Arbeiterbewegung“ im Juni aufgelöst habe. Umso wichtiger sei die Einrichtungeiner solchen Sammelstelle ….“ Der Beschluss erfolgte laut Siegener Zeitung von Heute (Print) einstimmig.
Links zu regionalen Beispielen:
1) Hamburg: http://www.kuenstlernachlaesse.de/
2) Brandenburg: https://private-kuenstlernachlaesse-brandenburg.de/
3) Bezirk Schwaben (Bayern): https://www.bezirk-schwaben.de/bezirk-schwaben/aktuelles-presse/pressemeldungen/kuenstlernachlaesse-aus-schwaben-finden-eine-neue-heimat-im-weiherhof-des-klosters-oberschoenenfeld
Link zum Bundesverband Künstlernachlässe: https://www.bundesverband-kuenstlernachlaesse.de/
Weitere Hinweise zum Thema finden sich auf Archivalia.
Literatur zu Ludwig Heupel:
Das Wandgemälde von Ludwig Heupel im Sitzungssaal des Rathauses in Siegener Ztg. Jg 94, Nr 300 v. 22.12.1916.
Professor Ludwig Heupel-Siegen zum 60. Geburtstag in Siegener Ztg. Jg 102, Nr 142 v. 19.6.1924
Die wechselvolle Geschichte eines Bildes. Wie Ludwig Heupels „Eisenhammer“ in d. Siegener Rathaussaal kam in Siegener Ztg. Jg 115, Nr 142 v. 22.6.1937
Professor Ludwig Heupel, Siegen. Zum 75. Geburtstag d. Künstlers in Siegener Ztg. Jg 117, Nr 140 v. 19.6.1939.
Akademieprofessor Ludwig Heupel-Siegen 80 Jahre alt in Siegener Ztg. Jg 122, Nr 142 v. 20.6.1944
Ludwig Heupel-Siegen in Siegerland. Bd 30, 1953, S. 63-73.
Eine stetige Quelle des Glücksempfindens. Vor 100 Jahren wurde d. Maler Ludwig Heupel-Siegen geboren in Unser Heimatland. Jg 32, 1964, S. 90/91
Ludwig Heupel-Siegen 1864-1945. Ausstellung z. 100. Wiederkehr seines Geburtstages im Museum zu Siegen in Siegerland Bd 41, 1964, S. 31/32
„Malen galt dem Siegerländer als Spielerei“. Der berühmte Siegener Maler Ludwig Heupel wurde in der Höhstr. 17 geboren – in: Unser Heimatland. Jg 34, 1966, S. 77/78.
Dass es auch anders ginge zeigt: https://archivamt.hypotheses.org/3876
ja ,da kann ich mich noch erinnern , ausserdem wurde auch mal ein golfplatz in volkholz geplant ,es wurden viele sachen angeschoben aber nie verwirklicht.
Regionale Parteiarchive sollten archivfachlich geleitet oder betreut werden!
1968: ‚Revolutionäre Verhältnisse‘ oder ‚laues Protest-Lüftchen‘ im Siegerland?
Die erstaunlichen Einschätzungen des Siegener Kreisarchivars Wolf::
„Das Jahr 1968, als im Siegerland etwas in Bewegung kam“ (WP/WR)
https://www.google.de/search?rlz=1C2AOHY_deDE723DE723&source=hp&ei=dXrtW8PuM4LdwQL5kYjwBw&q=1968+in+Siegen&oq=1968+in+Siegen&gs_l=psy-ab.3…46388.53409.0.54375.14.14.0.0.0.0.774.2384.0j6j2j1j6-1.10.0….0…1.1.64.psy-ab..4.9.2047…0j38j0i131k1j0i22i30k1.0.EXEAbhO_jSI
(Online-Link vom 10. Oktober 2018)
———————————————————————————————-
Leserbrief zu den Einschätzungen von Kreisarchivar Thomas Wolf über das Jahr 1968 und die „68er“ Protestbewegung in
Siegen:“1968: Eine Chance, etwas zu ändern‘‘ in der WP/WR vom 11. Oktober:
Das ist eine erstaunliche Einschätzung, die Kreisarchivar Thomas Wolf über die Verhältnisse von 1968 in Siegen verbreitet hat. Siegen und eine ‘‘68er‘‘-Protestbewegung, von der man sich fragen muss: wo war diese vor 50 Jahren auszumachen? Wo gab es Szenen, die beim NPD-Landesparteitag am 16. November 1968 an „die große Protestkultur“ erinnerten? Wodurch kam diese von Wolf so bezeichnete „große Protestkultur“ zum Ausdruck? Dass eine überschaubare Zahl von Demonstranten Parteitagsdelegierte und den NPD-Vorsitzenden Adolf von Thadden am Zugang zur Siegerlandhalle behinderte und es dabei an den Absperrungen zu Rangeleien und Polizeieinsätzen kam?
Was hatte der vom Kreisarchivar bemühte „68er-Geist“ mit dem NPD-Landesparteitag zu tun? Was überhaupt mit dem „Tanz für die Jugend“? Wo kam das Siegerland „in einer Breite in Bewegung“, bei der „vielleicht nicht die große Revolution stattgefunden“ hat? Was war denn dann? Protest am Mädchen-Lyzeum um die Ablösung einer autoritären Schulleiterin, als sei das ein bundesweit bedeutsames Ereignis? Sollen mit solchen Vergleichen Ereignisse in einer Region historisch aufgewertet werden? In der Auseinandersetzung mit den ‘‘68ern‘‘ hat Jürgen Habermas die studentischen Proteste, ihre Ziele und Aktionen, die mancherorts in Schülerkreise hineinreichten, seinerzeit als „Scheinrevolution und ihre Kinder“ bezeichnet. In Siegen war das, was ‘‘68er“-Protest genannt werden könnte, selbst zu Zeiten der APO-Proteste gegen die Bonner Notstandsgesetze, im Mai ’68, nicht mal als ‚laues‘ Protest-Lüftchen auszumachen.
Bei der Europäischen Bewegung, deren Sprecher ich damals war, hatte bereits im Vorfeld des Parteitages nicht nur der Parteien- und Wahlforscher Hans-Dieter Klingemann die Ursachen für das Aufkommen der NPD thematisiert, die von 1966 bis 1968 in sieben Landtage eingezogen war. Von dem Sozialforscher wurde dies vor allem der ersten wirtschaftlichen Rezession der Nachkriegszeit zugeschrieben, auch der Großen Koalition, von 1966-1969, einer Konstellation, die die politischen Einstellungen beeinflusste. Interessiert hat sich für diese Bestimmungsgründe und wie damit umgegangen werden kann, bei den Protesten gegen den NPD-Parteitag kaum jemand vor Ort. Und: Der mit Antisemitismus gepaarte Rechtsextremismus war bei den ’68ern‘ kein bestimmendes Thema, eher ein „blinder Flecken“, wie es der Politologe Wolfgang Kraushaar, ein Kenner der 68er-Verhältnisse, in einer Beschreibung über die ’68er‘-Protestbewegung und die APO benannt hat.
Karl-Jürgen Reusch
Siegen/14. Nov. 2018
Anmerkung: Der Leserbrief musste wegen einer maximal möglichen Zeilen-Vorgabe in Lokalausgaben der Zeitungstitel Westfalenpost/Westfälische Rundschau gekürzt werden. Daher blieb im Leserbrief der Satz unberücksichtigt: „Zur Auseinandersetzung mit dem NPD-Landesparteitag gehörte auch die gewerkschaftliche Protest-Kundgebung auf dem Weidenauer Bismarckplatz mit IG-Metall-Vize Eugen Loderer, der sich mit markigen Sprüchen gegen die NPD verbreitete.“ Die DGB-Kundgebung gegen den NPD-Parteitag stand nicht in einem unmittelbaren und organisatorischen Zusammenhang mit „68er“-Protestaktionen. KJR
Pingback: DVD-Neuerscheinung: “Siegerland zwischen Gegenwart und Zukunft” | siwiarchiv.de
Pingback: Ausstellung Otto Piene in Düsseldorf | siwiarchiv.de
Es ist schon schlimm, wenn die SPD in Siegen-Wittgenstein einstimmig Beschlüsse fasst,von deren Umsetzung sie keine realistische Vorstellung hat.
Eine archivfachliche Beratung durch die Friedrich-Ebert-Stiftung (AdsD)
wäre wohl nötig. Alternativ käme das Kreisarchiv SI dafür in Betracht.
Wenn es ein Gemeindearchiv Neunkirchen gäbe, wäre dies der
natürliche Ansprechpartner.
Das Stadtarchiv Siegen hat bereits in den 1990er Jahren allen ‚großen‘ in der Stadt vertretenen Parteien das Angebot gemacht, Parteiarchive auf Depositalvertragsbasis einzurichten. Die Reaktion war gleich null, nämlich keine Antwort. Einziger mündlicher Kommentar eines Kommunalpolitikers (sinngemäß): „Wir lassen uns doch nicht in einem öffentlichen Archiv in die Karten schauen!“ Da ist der Tellerrand noch in ziemlicher Entfernung.
Pingback: Architektur 1960+, Brutalismus im Kreisgebiet: Rathaus, Siegen-Geisweid | siwiarchiv.de
Pingback: Architektur 1960+, Brutalismus im Kreisgebiet: Rathaus, Siegen-Geisweid | siwiarchiv.de
In der heutigen Print-Ausgabe der Siegener Zeitung erschien ein Leserbrief, der Hindenburg nicht als Steigbügelhalters Hitlers, sondern als dessen „beharrlichen Widersacher“ anspricht – Ergebnis einer Analyse des Verhaltens Hindenburgs zwischen Frühjahr 1932 und Frühjahr 1933.
Pingback: “Denkmalpflege in Westfalen-Lippe”, Heft 2018/2, online einsehbar | siwiarchiv.de
Hindenburgstraße in Hilchenbach wird nicht umbenannt – s. Westfälische Rundschau heute: https://www.wp.de/staedte/siegerland/hindenburgstrasse-in-hilchenbach-behaelt-ihren-namen-id215848631.html .
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 10.11. – 22.11.2018 | siwiarchiv.de
In der heutigen Ausgabe der Siegener Zeitung findet sich ein Artikel zur Diskussion im Hilchenbacher Hauptausschuss über die Umbenennung der Hindenburgstraße. Wolfgang Ruth, einer der Antragssteller zur Umbennunng, äußert sein Unverständnis über die Entscheidung in einem Leserbrief in der heutigen Westfälischen Rundschau.
Sehr geehrter Herr Gummersbach,
mit Interesse habe ich Ihre Artikel über die SiegerLänder Industrie im Netz gefunden. Speziell geht’s um die Siegener aktiengesellschaft sag in geisweid. Mein Großvater Karl Weber war dort viele Jahre in leitender Funktion beschäftigt. Für meine Ahnenforschung suche ich nachweiterem Material. Ich habe die Hoffnung, dass Sie mir über den beruflichen Werdegang meines Opas etwas Archivmaterial zukommen lassen könnten
Mit freundlichen Grüßen
Ralf Weber
Verbindung via E-Mail herrgestellt.
Pingback: Vortrag “Wissenswertes und Interessantes zum Barbara-Tag” | siwiarchiv.de
Pingback: Literaturempfehlung: Helge Kleifeld: “Archive und Demokratie | siwiarchiv.de
Ich möchte diesen Kommentar nur zum Thema Mädchenrevolte kommentieren. Sie sagen: „Protest am Mädchen-Lyzeum um die Ablösung einer autoritären Schulleiterin, als sei das ein bundesweit bedeutsames Ereignis?“ und werten damit ein nicht nur für hunderte von Schülerinnen des Mädchengymnasiums (sic!) höchst wichtiges Ereignis ab, an dem sich rund 80 Prozent der Schülerinnen aktiv beteiligt haben, sondern Sie unterschätzen auch die Bedeutung dieses Streiks für die Entwicklung im Land. Die Ereignisse wurden bundesweit wahrgenommen, auch wenn die Lesart der damaligen Zeit diese war: Mädchen sind an sich unpolitisch und haben eigentlich keine wichtigen Themen, also werden die bösen Jungs sie wohl dazu verführt haben. Erstaunlich, dass Sie heute noch in diese Kerbe hauen! Eine autoritäre Direktorin abzulösen ist ein Meisterstück. Der Streik war eine vorbildliche Lektion in Sachen Demokratie, weil wir uns erstmals zusammengeschlossen und klar ausgedrückt haben, dann konsequent handelten. Wo sonst hat es das gegeben? Ich durfte vor zwei Jahren mit etlichen Zeitzeuginnen darüber sprechen. Wir alle zehren heute noch von dieser bundesweit einzigartigen Aktion.
Pingback: Demokratische Defizite der öffentlichen Archive im politischen System der Bundesrepublik Deutschland | Archivalia
Das frei online zugängliche erste Kapitel ist die Antrittsvorlesung von C.K. an der FH Potsdam. Nach der Lektüre kann ich es nicht erwarten, beim Buchhändler endlich mein persönliches Exemplar zu erhalten, um weiterlesen zu können.
Pingback: “Praktische Archivkunde” ist in 4. aktualisierter Auflage erschienen | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Adventskalender 2018/2 | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik November 2018 | siwiarchiv.de
Das Buch „Siegerländer Kultur, Wirtschaft, Gemeinwesen – Eine Chronik“ steht schon seit Jahren in meinem Bücherschrank. Der Zusammenhang mit dem Goldenen Buch des Kreises ist mir aber erst jetzt durch diesen Artikel in siwiarchiv bewusst geworden.
Pingback: siwiarchiv-Adventskalender 2018/5: | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 23.11. – 5.12.2018 | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Adventskalender 2018/6: | siwiarchiv.de
Heute mittag führte WDR 3 ein Interview mit Dr. Jürgen Bacia, dem Leiter des Archivs für alternatives Schriftgut: https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr3/wdr3-kultur-am-mittag/audio-das-alternative-archiv-afas-vor-dem-aus-100.html
Danke für den Hinweis, ein ganz interessantes Archiv.
Einfach mal Siegen als Suchbegriff im Katalog eingeben.
Torsten Thomas
Wer das afas unterstützen möchte: Das afas bittet auf seiner Homepage – s. Eintrag – um Schreiben an die Fraktionsvorsitzenden im Landtag, die sich für den Erhalt aussprechen.
Pingback: siwiarchiv-Adventskalender 2018/7: | siwiarchiv.de
Finanzielles Aus für das AFAS? Frank Bischoff, Landesarchiv NRW, im Gespräch im Deutschlandfunk am 7.12.2018:
mp3
Nachtrag: Link zum Volltext des Interviews von Frank Bischoff im DLF.
In welcher Drucksache finde ich den Streichungsantrag der Regierungsfraktionen? Ich konnte leider das Dokument finden, zu viele einzelne PDFs.
Es dürfte keinen Streichungsantrag geben. Im zu verabschiedenden Haushaltsentwurf sind keine Mittel für das afas mehr vorgesehen.
Links zu Beiträgen in der archivischen Blogosphäre:
1) https://www.augias.net/2018/12/06/8906/
2) https://archivalia.hypotheses.org/92784
Pingback: “Wittgenstein” 3/2018 erschienen | siwiarchiv.de
Nachdem die Siegener Zeitung den Leserbrief Wolfgang Ruth von Ende November (s.o.) veröffentlicht hatte, sind in der heutigen Print-Ausgabe der Siegener Zeitung 2 Leserbriefe zum Thema erschienen: “ ´Mythos´verwundert“ – eher Hindenburg-kritisch, und „Gescheitert“, die Beibehaltung des Straßennamens befürwortend …….
Weitere Reaktionen zur Situation des afas in Duisburg:
1) Das Uniarchiv Köln weist auf seiner Homepage auf die Problematik hin: https://www.portal.uni-koeln.de/aktuelles.html
2) Das Blog „Global Notes“ der des amerikanischen Archivverbandes SAA nennt die Notlage der Duisburger Kolleginnen zur Kenntnis: https://iaartsaa.wordpress.com/2018/12/09/weekly-news-roundup-december-8-2018/
3) Das Duisburger Blog „Amore e rabbia“ berichtet ebenfalls: http://helmut-loeven.de/2018/12/afas-meldet-gefahr-im-verzug/
4) Der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU e. V.) rief alle auf, sich für den Erhalt des archiv für alternatives schrifttum (afas e. V.) einzusetzen: http://www.infopartisan.net/BBU%20PM%20PDF%2009.12.2018%20afas%20mit%20Foto.pdf.
5) Die NRZ berichtet heute online zur Schließung: “ …. Die CDU-Fraktion erklärte indes auf Nachfrage der Redaktion, es solle am heutigen Dienstagvormittag fraktionsintern noch einmal über den Änderungsantrag beraten werden. Zu 90 Prozent könne davon ausgegangen werden, dass der Antrag zurückgenommen werde. Demnach besteht Hoffnung für das Afas. In der dritten und letzten Lesung am Mittwoch, 12. Dezember, werde der Landeshaushalt für 2019 dann endgültig in Düsseldorf beschlossen. …. Eine Sprecherin der FDP-Fraktion formulierte die Begründung für die Streichung der Gelder wie folgt: „Aus einem wirtschaftlichen Umgang heraus wollen wir die archivierungswürdigen Inhalte des Afas ins Landesarchiv umsiedeln.“ ….“
Pingback: siwiarchiv-Adventskalender 2018/11 | siwiarchiv.de
Antrag der SPD-Landtagsfraktion zur Finanzierung des afas:
Patrick Bahners: „Spardiktat – nein danke! Das Duisburger Archiv des Protestes ist bedroht.“, FAZ, Feuilleton, 11.12.2018: “ …. Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft hatte im Haushaltsplan für 2019 für das AFAS 220 000 Euro vorgesehen. Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen kann sich zugutehalten, dass der Kulturetat von 46,7 auf 49,3 Millionen Euro steigt. Im Kulturausschuss blieb der Etatansatz unangetastet. Erst im Haushaltsausschuss schlugen Abgeordnete der Regierungsfraktionen CDU und FDP vor, die Unterstützung des AFAS zu beenden. Im Paket mit Änderungen anderer Ressortetats wurde der Antrag angenommen, mit den Stimmen der Opposition. …..“
CDU-FDP Antrag zur Finanzierung des afas im kommenden Jahr liegt vor – aus der Begründung: „Die Förderung des Landes für das Archiv für alternatives Schrifttum soll auch im kommenden Jahr letztmalig fortgeführt werden. Das Archiv wird damit in die Lage versetzt, die Planungen der kommenden Jahre so anzupassen, dass der Wegfall der freiwilligen Förderung des Landes kompensiert werden kann. Zusätzlich wird das federführende Ministerium damit beauftragt, ein Konzept zur Verlagerung von landeshistorisch bedeutsamen Archivgütern in beispielsweise das Landesarchiv NRW zu erarbeiten und dem Fördermittelempfänger die Verlagerung der Archivgüter anzubieten.“
Link: https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-4548.pdf
Nachtrag (18.12.2018):
“ …. Die Landesregierung will die Zuschüsse für ein besonderes Archiv in Duisburg nun wenigstens vorerst weiter zahlen. Das wurde am Mittwoch (12.12.2018) im Landtag beschlossen. Zuvor hatte es gegen Streichungspläne seitens des Landes zahlreiche Proteste gegeben. …. Weil es so etwas sonst nirgends gibt, schrieb sogar der Verband deutscher Archivare einen offenen Brief. Die Duisburger Einrichtung sei unverzichtbar. Wer die Gelder streiche, nehme seine Vernichtung in Kauf.
Der Protest hat allerdings nur einen Aufschub gebracht. „Die Förderung des Landes für das Archiv für alternatives Schrifttum soll auch im kommenden Jahr letztmalig fortgeführt werden“, heißt es in dem am Mittwoch beschlossenen Antrag von CDU und FDP. …..“
Quelle: WDR, NAchrichten Rheinland, 12.12.18
Pingback: siwiarchiv-Adventskalender 2018/12 | siwiarchiv.de
Pingback: AFAS Duisburg für 2019 gerettet, Finanzierung ab 2020 offen | Archivalia
Pingback: 7 Fragen zur Archivarbeit in der Gemeinde Neunkirchen/Siegerland | siwiarchiv.de
Pingback: “Zeitspuren”-Linktipp: Karten der Ämter des Kreises Siegen aus der Übergangszeit an Preußen 1815–1816 | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Adventskalender 2018/15 | siwiarchiv.de
Pingback: Ein Streifzug durch die 200-jährige Geschichte des Kirchenkreises Siegen | siwiarchiv.de
In einem Nachlass tauchte vor einigen Wochen eine handschriftliche Mitgliederliste des Kyffhäuserbundes Siegen auf. Die Liste umfasst die Jahre 1958,1959 und 1960. Sie enthält Namen und Vornamen der Mitglieder, Geburtsdatum und Adresse, das Eintrittsjahr in den Bund und ob das Mitglied eine Ehrung für langjährige Mitgliedschaft erhalten hat.
Die Liste ist alphabetisch geordnet. In dieser Liste ist auch Alfred Fissmer aufgeführt. Eintrittsjahr 1920, geehrt für 25jährige Mitgliedschaft.
Pingback: siwiarchiv-Adventskalender 2018/16 | siwiarchiv.de
Pingback: Kultur-News KW 50-2018 News von Museen, Ausstellungen, Geschichte
Am 14.12.2018 erschienen zwei weitere Leserbriefe zum Thema: „Immense Schuld“ bezog sich auf den Leserbrief „Beharrlicher Widersacher“ vom 21.11.2018 und betont Hindenburgs Beteiligung an der „Dolchstoßlegende“; „Mensch seiner Zeit“ weist auf die Verdienste (?) Hindenburgs hin – “ … allem die Ostpreußen, waren ihm damals dankbar, dass er 1914 Ostpreußen vor der russischen Dampfwalze bewahrt hatte. ……“ – und weist – wie der Leserbrief „Gescheitert“ v. 10.12.2018 – auf ebenfalls andere Straßenbenennungen (Theodor Heuss, Konrad Adenauer, Thomas Dehler) hin, die ebenfalls zu kritisch zu sehen seien.
Pingback: siwiarchiv-Adventskalender 2018/17 | siwiarchiv.de
Warum werden in dem Zusammenhang immer wieder diejenigen Waldgenossen als angebliche Pfleger des Kulturerbes hervorgehoben, die den Wald zum Selbstbedienungsladen für billigen Brennstoff degradieren? Sofern keinen Sachzwängen (wie sie in verflossenen Jahrhunderten bestanden) Vorrang gewährt werden muss, ist eine für so mannigfache konstruktive Zwecke verwendbare Ressource wie das Holz zu kostbar, um sie einfach in Flammen aufgehen zu lassen – bloß damit ein paar durch ererbten Grundbesitz privilegierte Genossen sich am Luxus offener Kamine ergötzen können. Wälder zu verbrennen ist in der heutigen Zeit eine Form von Verschwendung und Raubbau, die weder etwas mit dem Konzept der historischen Haubergswirtschaft zu tun hat noch mit ökologischer Verantwortung oder dem, wofür gewöhnlich der irrlichternde Begriff „Nachhaltigkeit“ steht. Gegen kurzsichtigen Egoismus ist kein Kraut gewachsen; er ist nun einmal menschlich – die Gesellschaft muss dafür aber nicht auch noch Lob aussprechen oder solche Gesinnung gar zum lebenden Kulturerbe stilisieren. Das führt zu Geschichtsfälschung. Die traditionelle Haubergswirtschaft diente nicht vorrangig der Brennholzversorgung privater Haushalte, sondern der Ressourcensicherung für die regionalen Gewerbe und somit dem Gemeinwohl.
Pingback: siwiarchiv-Adventskalender 2018/18 | siwiarchiv.de
habe ja Heuteam 18.12. was veröffentlicht
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 6.12. – 18.12.2018 | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Adventskalender 2018/19: | siwiarchiv.de
Das waren noch Zeiten !!!
Trotzdem Allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neu Jahr 2019 !!!
Pingback: siwiarchiv-Adventskalender 2018/20: | siwiarchiv.de
Pingback: “Zeitspuren”-Linktipp: Adressbuch für die Provinz Westfalen von 1829 | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Adventskalender 2018/21: | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Adventskalender 2018/22: | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Adventskalender 2018/23: | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Adventskalender 2018/24: | siwiarchiv.de
Schön, dass man sich in Deutschland manchmal noch darauf besinnt, wie schön die deutsche Sprache klingt !
Entschuldigung, wenn Ihnen den Eintrag nicht gefällt. Aber ich fand, dass das Bild sehr gut zu diesem amerikanischen Weihnachtsklassiker passt. Ein deutsches Lied ist mir leider nicht eingefallen. Falls es Sie tröstet, der Baum stand im Siegerland und auch die Sängerin lebt seit geraumer im Siegerland.
Pingback: “Zeitspuren”-Linktipp: Karte des Kreises Wittgenstein von 1837 | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 19.12. – 31.12.2018 | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik Dezember 2018 | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Jahresstatistik 2018 | siwiarchiv.de
Pingback: “Zeitspuren”-Linktipp: Thomas C. Banfield über das Siegerland (1846, 1848) | siwiarchiv.de
Am 5.1.2019 erschien in der Print-Ausgabe der Siegener Zeitung ein Interview mit Alma Siedhoffs Sohn Joost.
Looking for records for Leopold Louis Linnemann and his sister Hermine and brothers August and Ernst. They immigrated to the U.S. via New Orleans in the late 1860’s. Would like to find out if the place where they were born or lived is still standing.
Heinrich Imhof doesn´t mentioned a Linnemann emigrating from the Wittgenstein county to America. So where were the Linnemanns born?
Perhaps meant: Leopold Louis Linnemann, born 1843 in Herford (at the edge of Westphalia quite opposite to Wittgenstein). Source: http://www.ancestry.com.
Many families from the so-called „Ravensberg area“, including the Linnemanns from Gohfeld (near Herford), took part in emigration and seem to have settled in Missouri (St. Louis County). See Michael Rosenkötter, From Westphalia into the World, Beckum 2nd ed. 2003 (Linnemann mentioned p. 71).
Further reading: http://www.european-migration.de/euromig/hf/migrat/emigrat/brause50.htm.
I recommend to contact the „Arbeitsgemeinschaft für Genealogie im Historischen Verein für die Grafschaft Ravensberg“, via
http://www.hv-ravensberg.de/ag-genealogie.html
Pingback: Vortrag „Die Familien Schreiber im Siegerland“ | siwiarchiv.de
Es heißt in der Ankündigung, das Verfahren 1987-1991 in Siegen, sei „das einzige Verfahren vor einem deutschen Strafgericht“ gewesen, „das die Verfolgung und Vernichtung von Sinti und Roma durch das Naziregime“ behandelt habe.
Das ist unzutreffend. Um die Sache gründlich anzugehen:
Zu berücksichtigen wäre
● erstens, dass es zum einen alliierte Verfahren mit alliiertem Personal (Nürnberger Prozesse plus Nachfolgeprozesse) und zum anderen mit deutschem Personal in den verschiedenen Zonen (Spruchgerichtsverfahren) gab, was hier unbeachtet bleiben soll, und
● zweitens dass es zwei sehr unterschiedlich gebaute deutsche Staaten gab mit deutlich unterschiedlichem Umgang mit NS-Straftätern. In den deutschen NS-Prozessen (West) gab es insgesamt etwas mehr als 6.500 rechtskräftige Urteile und in den deutschen NS-Prozessen (Ost) 12.890 Urteile (bei sehr viel geringerer Bevölkerungszahl und geringerer Nazi-Dichte, erst recht aber geringerer Nazijuristen-Dichte pro Flächeneinheit).
Was nun Verfolgung und Vernichtung der europäischen Roma-Minderheit angeht, stand jedoch hier wie dort nur eine minimale Zahl von Angeklagten vor Gericht. In der BRD gab es zwei deutsche Verfahren, die beide mit einer Verurteilung endeten, und in der DDR, wenn ich die Literaturangaben richtig entschlüsselte, sechs deutsche Verfahren.
Offenbar wird in jedem Fall, dass es hier eine gewisse Gemeinsamkeit in diesen beiden Staaten gab. Der niederländische Fachwissenschaftler und Strafrechtler Christiaan F. Rüter erklärt sie als in der gesamtdeutschen Bevölkerung vorhandene „mangelnde Affinität zu den Opfern“. Anders als jüdische NS-Verfolgte oder politisch Verfolgte hatten Roma hier wie dort ein zeitlich durchlaufendes Exklusionsproblem.
Beide BRD-Prozesse fanden vor dem Landgericht in Siegen statt (nicht mitgezählt: ein Revisionsverfahren in Köln). Sie endeten beide mit Verurteilungen.
Über das zweite Verfahren wird Herr Mehrer berichten. Hier ein paar Worte zu dem ersten, das nun inzwischen vollständig dem Vergessen anheimzufallen droht, obwohl es umfangreich aufgearbeitet werden konnte, einiges dazu erschien und vorgetragen wurde.
Er ereignete sich 1948/49 (Revision 1950) und steht für die für die BRD so typische Schlussstrich-Mentalität dieser Jahre (wie der anschließenden Jahrzehnte). Es ging um die Deportation von 134 Berleburger Sinti-Nachfahren, mehrheitlich Kinder, nach Auschwitz-Birkenau, von denen acht der Deportierten überlebten.
Es müsse doch jetzt endlich einmal, forderte damals in der lokalen Prozessdiskussion das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Berleburg, „ein Schlussstrich unter die Vergangenheit gemacht“ werden. Eine Wittgensteiner Bürgerbewegung mit Ausläufern ins nördliche Siegerland forderte unterschiedslos Haftentlassung und Freispruch.
Diese Haltung teilte im Grunde auch das Gericht, denn in einem der Beschlüsse zur Amnestierung von Angeklagten hieß es – sprachlich schludrig, in der Sache aber klar – zu berücksichtigen sei, dass das gerade verabschiedete Straffreiheitsgesetz („Weihnachtsamnestie“) „hinter Jahre der Not, Sittenverwilderung und Rechtsverwirrung einen Schlussstein [so!] setzen wollte.“ Das sei ja die „staatspolitische Zielsetzung“. Sie „nötige“ dazu, das Straffreiheitsgesetz so auszulegen, dass „nicht die außergewöhnlichen Maßnahmen einer großzügigen Befriedigung [so!] und Versöhnung“ verwischt würden.
Wie bei den meisten regionalen NS-Prozessen war es nur durch Aktivitäten aus der Opfergruppe seit der Jahreswende 1945/46 (Anzeige jährt sich in diesen Tagen) überhaupt zu einem Prozess gekommen und nach ursprünglich 28 Tatverdächtigen blieben davon ganze sieben, von denen dann sechs verurteilt wurden. Die Strafen lagen mit einer Ausnahme zwischen sechs Monaten und anderthalb Jahren, also am unteren Rand des Strafrahmens. Drei Täter mussten die Strafe dank Amnestie erst gar nicht antreten, zwei Verbliebene sie nicht voll abbüßen (siehe oben, Amnestiebeschlüsse/Straffreiheitsgesetz u. a.). Die große Ausnahme war mit vier Jahren Haft der vormalige Landrat Otto Marloh als Haupttäter. Über etwas Untersuchungshaft hinaus saß aber auch er keinen Tag, da „krank“ und angeblich nicht haftfähig. Seine Gerichtskosten übernahm, nein, nicht die Kirche, sondern die Armenkasse. Marloh war ein in der Wolle gefärbter Obernazi. 1919 hatte er 29 Angehörige der republikanischen Volksmarinedivision erschießen lassen, als Geiseln. Und als das Naziregime in den letzten Zügen lag, noch den Befehl zu Erschießung eines US-Piloten gegeben. Die Tat von 1919 wurde reichsweit durch einen Prozess bekannt, der in allen Zeitungen gestanden hatte und mit einem Freispruch für Marloh endete. Einer der Beobachter im Gericht war Kurt Tucholsky gewesen. Über den Mordbefehl von 1945 konnte man sich die Region anhand der regionalen Presse informieren. Für den Täter ergab sich aus diesem allgemeinen Wissen nichts.
Urteil und Vollstreckung waren eine Absage der Strafverfolger an die Strafzwecke Schuldausgleich, Sühne und Vergeltung für begangenes Unrecht und damit typisch für die regionalen NS-Verfahren insgesamt.
Das erste der beiden Strafverfahren ist m. E. auch aufgrund dieser Kontexte schon eine Erinnerung wert.
Es ist dieses Verfahren, das m. W. tatsächlich auch einzigartig war, nämlich insofern es das einzige westdeutsche Verfahren war, in dem Täter vor Gericht standen und verurteilt wurden, weil sie lokal Betreiber einer Deportation nach Auschwitz waren.
Pingback: “Zeitspuren”-Linktipp: Das Siegerland auf den Gewerbeausstellungen 1844 und 1852 und auf der Pariser Weltausstellung 1855 | siwiarchiv.de
Pingback: “Zeitspuren” führen zu Wikipedia-Artikel | siwiarchiv.de
Pingback: Filmabend: Historisches Siegerland Teil 1 | siwiarchiv.de
Hallo.
Wenn möglich möchte ich via email über neue Beiträge oder veranstaltungstermine informiert werden.
Vielen Dank
Marion Höppner
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 1.1.2019 – 13.1.2019 | siwiarchiv.de
Die Übernahme und Archivierung der Mindener Schulakten ist vorbildlich und deshalb sollte die Masterarbeit von Vinzenz Lübben im Kreis der Kommunalarchive eine breite Verbreitung finden. Es ist leider in velen Kommunen noch so, dass die Schulen ihre Überlieferung den Kommunalarchiven nicht anbieten und die Zehnjahrespflicht der Finanzbehörden mit der eigenen Aufbewahrungspflicht verwechseln.
Die vergleichende Studie des Berliner Historikers Joachim Petzold „In Deiner Brust sind Deines Schicksals Sterne? Mindener Gymnasiasten und Dresdner Oberschüler im ersten Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkrieg“, Potsdam 1998, hätte ohne die bemerkenswerte Überlieferung im Kommunalarchiv Minden-Lübbecke nicht geschrieben werden können. Die Wilhelm-Fraenger-Gesellschaft, deren Tochtergesellschaft gGFFDmbH Potsdam diese Studie in ihrer Schriftenreihe als Band 5 veröffentlichte, hat deshalb auch gerne den Druck der Arbeit von Vinzenz Lübben finanziell unterstützt. http://www.fraenger.net
Pingback: Siwiarchiv-Blogparade: „#Archivpolitik“ | siwiarchiv.de
Ich unterstütze die Petition ausdrücklich. Als ehemaliger Sowi-Lehrer weiß ich, dass nicht wirtschaftliches, sondern historisch-politisches Wissen bei vielen Schülern fehlt.
Pingback: 7 Antworten zur Archivarbeit in der Gemeinde Neunkirchen/Siegerland – | siwiarchiv.de
Pingback: “Zeitspuren”-Linktipp: Zur Geschichte der Charlottenhütte Niederschelden | siwiarchiv.de
Herr Wolf, sprechen Sie mal Herrn Horst Jentsch in Gosenbach an. Er ist maßgeblich an der Chronik der Charlottenhütte in NS beteiligt gewesen..
Ich selbst könnte zu den Geisweider Eisenwerke einiges beitragen.
Auf der Suche nach Banfields Grabstätte in Bukarest konnte ich folgende Informationen erhalten (Ein Dank an Vlad Nastase von der Evangelischen Gemeinde Bukarest): Banfields Grab ist nicht mehr erhalten, da der alte evangelische Friedhof „am Ende des 19.Jahrhunderts“ aufgegeben werden musste. Alle Gebeine wurden in ein Massengrab auf dem neuen Friedhof überführt. Am 20. April 1912 hat der Neubestattungsgottesdienst stattgefunden. Allerdings hat sich der Eintrag Banfields im Sterbebuch der Gemeinde erhalten: Für den 12./24. November 1855 ist dort die Beisetzung vermerkt: „Ein englischer Obrist Namens Panfield“. Herr Wolf kann evt. den Scan hier hochladen.
Nette Überraschung. Danke!!! Und weiter so :-)
Gern habe ich den Scan der Sterbeurkunde hochgeladen:
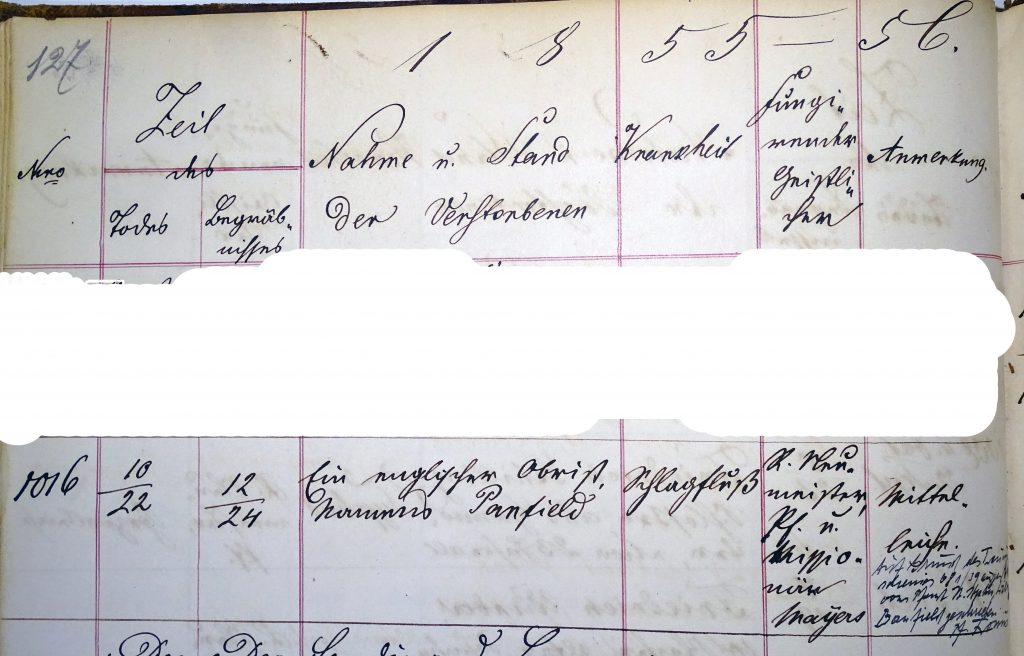
Pingback: Filmabend: Historisches Siegerland Teil 2: “Heimatbend Siegen” | siwiarchiv.de
Dazu auf kurzem Weg die hochakademische Information, dass es schon seit dem 1. Juli 1958 in – wie es heißt – „Deutschland“ – ein „Gleichberechtigungsgesetz“ gab und schon „zum 1. Juli 1977 eine umfassende Reform des Ehe- und Familienrechts vorgenommen (wird). In § 1356 steht unter Anderem: ‚Beide Ehegatten sind berechtigt, erwerbstätig zu sein.’ Folglich: „In Deutschland dürfen [nun] Ehefrauen eine Berufstätigkeit aufnehmen, ohne den Ehemann um Erlaubnis zu fragen“. (www.geschkult.fu-berlin.de)
Gut, „Deutschland“ ist die BRD, kann man sich ja denken. Und sonst?
Die DDR führte die Gleichberechtigung 1949 mit ihrer Gründung ein und gab ihr Verfassungsrang. Da hatte es sich mit der Nachfrage beim Ehemann. Wäre sie besser erst gar nicht gegründet worden, sondern „die Zone“ schon gleich der westlichen Wertegemeinschaft zugeführt worden, hätte es sich noch ein bisschen gezogen, für die Frauen, und die Männer hätten dazu etwas länger lachen können. ;-) Tscha.
Wissen Sie, ob diese beiden Verfahren im Landesarchiv NRW in Duisburg (?) zugänglich sind?
Mit freundlichen Grüßen,
Robert Parzer
Am 19. Januar 2019 erschien in der Print-Ausgabe der Siegener Zeitung der umfangreicher Bericht „Er nannte sich Éngel von Auschwitz´. Oberstaatsanwalt i. R. Klemens Mehrer referierte im Siegener Forum über den Prozess gegen den SS-Rottenführer Ernst-August König.“ über die Veranstaltung.
Die Petition ist bis heute 3.013mal unterschrieben worden.
Die zentrale archivische Überlieferung zu diesem Prozess ist im Landesarchiv NRW zu erwarten:
1) In der Abteilung Rheinland in Duisburg befindet sich die Überlieferung (Ermittlungsakten) der zuständigen Staatsanwaltschaft Köln – Zentralstelle für NS-Massenverbrechen Gerichte (Rep. 0118, Rep. 0158, Rep. 0267, Rep. 0434).
2) In der Abteilung Westfalen in Münster befindet sich die Überlieferung des Landgerichtes Siegen (Signatur Q 352), dort sind die Prozessakten zu erwarten.
In den Beständen des Berliner Bundesarchivs befindet sich im Bestand „Generalstaatsanwalt der DDR“ (DP 3) unter der Nr. 2251 ein einschlägiger Aktenband aus dem Jahr 1985, der sich u. a. mit deutsch-deutscher Rechtshilfe für das Ermittlungsverfahren gegen Ernst-August König beschäftigt. Dies legt wiederum eine Überprüfung des Bestände der Stasiunterlagenbehörde nahe.
Stichprobenartige Überprüfungen ergaben auch erfolgversprechende Funde in den überregionalen (Print-)Medien. Eine genauere Überprüfung dürfte auch hier einiges zu Tage fördern.
Ein Eindruck von der gestrigen Ausstellungseröffnung:

Passend zur Petition:
„Offener Brief der historischen Seminare der WWU an Minister des Landes NRW
Das Historische Seminar, sowie das Seminar für Alte Geschichte und das Seminar für Didaktik der Geschichte haben einen offenen Brief an den Herrn Ministerprasidenten Armin Laschet, sowie an Frau Ministerin für Schule und Bildung Yvonne Gebauer gesendet, um im Zuge der Rückkehr zu G9 den Geschichtsunterricht mehr in den Fokus der schulischen Bildung zu rücken.
Insbesondere der Bezug zu aktuellen Themen wie Zuwanderung, der Reflexion kultureller Werte und der Rolle des Geschichtsunterrichts im Integrationsprozesses.
Den vollständigen Text finden Sie hier„.
Quelle: Westfälische Wilhelms-Universität Münster, 23.1.2019
Pingback: “Zeitspuren”-Linktipp: Heinrich von Achenbach (1829–1899) | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 14.1. – 26.1.2019 | siwiarchiv.de
Ganz interessant, wenngleich keine Überraschung, dass es keine oder nahezu keine Prozessberichterstattung durch die Siegener Zeitung gab, was ja, wie ich hörte, auch Herr Mehrer so feststellte. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat er jemand von der Zeitung darauf angesprochen, um von dort zu hören, das Thema interessiere die Leserschaft nicht, daher die Nichtberichterstattung. Das stand natürlich in einem scharfen Gegensatz zu den fortlaufenden Prozessberichten der legendären Gerichtsreporterin Maria Anspach von der Westfälischen Rundschau, die aufmerksam verfolgt wurden.
Nein, „keine Leserinteresse“ ist eine billige Ausrede und zutiefst unglaubwürdig. Es war halt eine der zahlreichen Entscheidungen derer, die das redaktionelle Wort in der Zeitung sprachen und dies selbstverständlich im Sinne ihrer politischen Grundauffassung zu Fragen der Zeitgeschichte und dem Umgang damit. Da stand man eben anderswo als die WR.
Der Blick zurück belegt ja, dass da was zu verbergen und aus der Diskussion zu halten war. In Weimar war nichts zur Verteidigung des Verfassungsstaats gekommen, lieber hatte man schon in den 1920er Jahren die Verteidigungsreden von Hitler nach dem Putschversuch am 9. November 1923 publziert. Und nach dem Machtübergang auf die Nazis und ihre deutschnationalen Bündnispartner hatte die die „Heimatzeitung“ sich bereits im Mai 1933 zum „Organ des nationalsozialistischen deutschen Staates und des unter Adolf Hitlers Führung erwachten Volkes“ ausgerufen.
Das waren ungünstige Voraussetzungen für ein Interesse an Aufarbeitung. Als die Verbrechen mit dem Ende des Regimes endeten und vor Gericht verhandelt wurden, gehörte die Zeitung folglich eher zu den Bremsern. Als 1951 etwa ein Gruppenführer einer Volkssturmeinheit in Siegen vor Gericht stand, der in seiner Kompanie den Beinamen „der Henker“ hatte, sich bei Erschießungen vordrängte, auch „öfter Russen erschossen“ hatte und sich nun für die geradezu sadistisch vollzogene Mordtat an dem Betriebsleiter Ignaz Bruck einer Weidenauer Grube zu verantworten hatte, da erklärte die SZ ihn zu einem „Verführten“, also zu einem NS-Opfer, und zu einem „Werkzeug verbrecherischer Kräfte“. Mit einem Urteil müsse „vor allem endlich ein endgültiger Schlußstrich unter die Geschehnisse jener unseligen Zeit“ gezogen werden.
Immer noch gegen den Strich ging der Zeitung dann wohl der König-Prozess drei, vier Jahrzehnte später. Er fand deshalb so spät statt, weil in Jahrzehnten viel versäumt wurde. Die Bremser waren lange erfolgreich gewesen.
Zwei Artikel in der Siegener Zeitung sind bekannt:
– Siegener Zeitung, 29. November 1990: „Verhaftung von König abgelehnt; Oberstaatsanwalt: Drei Morde und Beihilfe zum Mord an Sinti und Roma“
– Siegener Zeitung, 25. Januar 1991: „König bleibt auf freiem Fuß. Verteidiger kündigten Revision gegen lebenslage Haftstrafe für ehemaligen Auschwitz-Blockführer an“
Diese Funde lassen eine Anfrage an das Archiv der Siegener Zeitung angezeigt erscheinen.
Heute habe ich weitere Artikel der Siegener Zeitung zum Prozess erhalten – danke an HWK:
– [ane]: „Als Soldat von der Ostfront ins KZ. Zeuge sagte gestern im NS-Verfahren aus. Zum Ende des Krieges ins Strafbataillon“, 23.10.1987
– [ane]: „Konkrete Aussage im Siegener NS-Verfahren – Als Knd Konzentrationslager erlebt“, 2.12.1987
– „Zeuge verweigerte die Aussage. Tumulte am Rande des NS-Verfahrens gegen ehemaligen SS-Rottenführer König“, 16.12.1987
– „Ich habe gesehen, wie er die Frau erschossen hat“. Zeugenaussage im Siegener NS-Verfahren – Zweifel wegen Erinnerungslücken“, 14.1.1988
– „Direktor des Museums in Auschwitz“, 8.3.1988
– „Zeugin bat Gericht um Bestrafung des Angeklagten. Nach vierwöchiger Pause im NS-Verfahren Kammer vor neuer Verhandlungsrunde“, 13.4.1988
Das Fundstück ist in den Broschüren von Hartmut Prange „Simon Grünewald – Lehrer, Prediger und Kantor in Siegen“ aus dem Jahr 2012 sowie bei Klaus Dietermann „Jüdische Soldaten des Ersten Weltkriegs aus der Synagogengemeinde Siegen“ aus dem Jahr 2016 enthalten. Die Broschüren sind für eine Schutzgebühr von 3,00 Euro bei der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Siegerland e. V. oder beim Aktiven Museum Südwestfalen e. V. zu erhalten.
“ … Auch der VdA sieht die Notwendigkeit eines ausreichenden Unterrichts im Fach Geschichte und befürwortet deshalb ebenfalls die Forderung des Lehrerverbandes. ….“
Verband deutscher Archivarinnen und Archivare, 25.1.2019
Diese Ausgabe des Enkels von Jung-Stilling ist textlich nicht „sauber“!
.
Allein die von Gustav Adolf Benrath (1931-2014) besorgte Ausgabe, bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft in Darmstadt in drei Auflagen erschienen, enthält den unverdorbenen Original-Text und genügt in allem den Maßstäben,
die man von einem solchen Werk heute erwartet.
Pingback: Netphen: Stadtarchiv – “Luxus” versus Kernaufgabe | siwiarchiv.de
Nicht Neunkirchen – Hilchenbach!
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik Januar 2019 | siwiarchiv.de
Pingback: Fernsehtipp: “Bauhausfrauen” – Film von Susanne Radelhof | siwiarchiv.de
Pingback: Fernsehtipp: “Lotte am Bauhaus” | siwiarchiv.de
Pingback: Frühere Synagoge in Bad Laasphe wird als Freundeskreis-Thema wichtiger | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 27.1. – 8.2.2019 | siwiarchiv.de
Pingback: Gedenken an die ermordeten Hilchenbacher Juden | siwiarchiv.de
Die Petition hat aktuell 4.009 Unterschriften
Pingback: Wer baute in Siegen Feuerspritzen? | siwiarchiv.de
Pingback: Bernhard Salzmann( 1886-1959) : Kämpfer für Westfalen | archivamtblog
besitze über 30 Exponate des Malers.überwiegend bleistift Zeichnungen aber auch einige Ölbilder.wo kann ich sie veräußern ?
habe schon zwei werke in siegen haus siel verkaufen können .
mein name ist auch im buch -die Ärztin und der maler vermerkt-
zwei Bieler des Buches besitze ich. näheres nach einem eventuellen Interesse
Pingback: Architektur 1960+, Brutalismus im Kreisgebiet: Freudenberg, Kirche St. Marien | siwiarchiv.de
Pingback: Architektur 1960+, Brutalismus im Kreisgebiet: Freudenberg, Kirche St. Marien | siwiarchiv.de
Pingback: Architektur 1960+, Brutalismus im Kreisgebiet: Freudenberg, Kirche St. Marien | siwiarchiv.de
Hallo Herr Berger,
nehemn sie doch bitte mal Kontakt zu mir auf
Thomas-Wilnsdorf@t-online.de
Grüße
Torsten Thomas
Thomas Lux, Lüneburg, rezensiert Keitel auf Archivalia, 13.2.2019: https://archivalia.hypotheses.org/97588
Pingback: “Appell an die Nachhaltigkeitsverantwortung der Politik | siwiarchiv.de
Pingback: Karl August Groos (1789-1861) – Ein Pfarrerleben in Zeiten des Umbruchs | blog.archiv.ekir.de
Pingback: Bogenbrücke im Dr.-Dudziak-Park ist wieder komplett | siwiarchiv.de
Pingback: Zehn Fragen zur Archivierung in Netphen – und | siwiarchiv.de
Als einen – zwar nicht gekennzeichneten – Beitrag zu dieser Blogparade darf man wohl auch den Beitrag „VDH und Bibliothekswesen: Für Erhalt von Merkels Facebook-Seite“ auf Archive 2.0. werten.
Folgender Eintrag auf der Facebook-Seite des Hessischen Landesarchivs vom 14.2.2019 zeigt zwei weitere Akteure in der kommunalen Archivpolitik (und so ist dies ein weiterer leider nicht gekennzeichneter Beitrag zur Blogparade):
Pingback: Zehn Fragen zur Archivierung in Netphen – und | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 9.2. – 21.2.2019 | siwiarchiv.de
Pingback: 100 Jahre Reichsarchiv und die Nachhaltigkeitsverantwortung der Politik | Weimar – Wege zur Demokratie
Was ist eigentlich aus der Verlegung geworden?
Der Artikel „Eine Verschlimmbesserung für etwa 50 Millionen Euro“ Olaf Przybillas in der Süddeutschen Zeitung kommentiert die Pläne noch einmal
via Archivalia
Pingback: Wanderausstellung „Mit Macht zur Wahl! 100 Jahre Frauenwahlrecht in Europa“ | siwiarchiv.de
Bei der Auswertung von „Unterlagen und Veröffentlichungen aus der damaligen Zeit“ ist einiges übersehen worden: Hedwig Heinzerling war „im heutigen Kreisgebiet“ nicht „die einzige Politikerin, die in der Weimarer Zeit ein politisches Mandat innehatte“, zur ersten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 17. März 1919 schrieb die große Heimatzeitung: „Auch die Anwesenheit von drei Frauen gibt der Versammlung das charakteristische Gepräge der neuen Zeit.“ Neben Frau Heinzerling (DDP) zogen nämlich Anna Hellmann (Zentrum) und Emmy Braun (SPD) in das Stadtparlament ein. Im Februar 1920 folgte mit der Nachrückerin Agnes Ax (DNVP) gar eine vierte Frau. Frau Heinzerling vertrat die DDP nur in der ersten Legislaturperiode im Stadtrat, 1924 wurde sie nicht wiedergewählt, kam aber im Juni 1929 noch einmal für eine kurze Zeit bis zu den Novemberwahlen als Nachrückerin zum Zuge. Anna Hellmann, Ehefrau von Kreisphysikus Dr. Hellmann, wurde hingegen in allen Kommunalwahlen der Weimarer Zeit wiedergewählt und legte erst im September 1933 aus Protest gegen die Auflösung des Wohlfahrtsausschusses ihr Mandat nieder. Agnes Ax blieb bis 1929 im Stadtrat, Emmy Braun nur die erste Wahlperiode.
In der Biografie von Hedwig Heinzerling sollte nicht ihre wichtige Funktion als Referentin der Kriegsamtnebenstelle unterschlagen werden. Ebenso gilt sie als die eigentliche Gründerin und erste Leiterin der Volkshochschule 1948, damals eine Kooperation von Stadt und Kreis.
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik Februar 2019 | siwiarchiv.de
Pingback: Kultur-News KW 09-2019 News von Museen, Ausstellungen, Geschichte
Pingback: Hilchenbach: Seit gestern neue Öffnungszeiten für Bücherei, Archiv und Museum | siwiarchiv.de
Pingback: Karl August Groos (1789-1861), evangelischer Pfarrer und Konsistorialrat in Koblenz | Stadtarchiv Koblenz
Gerhard Moisel in der Nachfolge von L. Irle und Dr.Roedig wird am 8 zum letzten Mal im Haus der Kirche einen Vortrag in der Ahnenkundlichen Versammlung des HV halten den Kreis, den Irle 1962 gegründet hat.
Dann ist Schluß, denn es hat sich kein Nachfolger dieses herausragenden Genealogen gefunden.
Dies ist bedauerlich. Vor dem Hintergrund des „Booms“ der Familienforschung stellt sich die Frage: löst sich die Arbeitsgemeinschaft auf? Oder brauchen die Vorträge „nur“ ein neues „Zuhause“?
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 22.2. – 6.3.2019 | siwiarchiv.de
Pingback: Wanderausstellung „Mit Macht zur Wahl! 100 Jahre Frauenwahlrecht in Europa“ | siwiarchiv.de
Es scheint schlecht zu stehen um die Archivierung – und das heißt das amtliche Gedächtnis – in Netphen. Wenn es gut stünde, wäre klar, wovon man redet; das ist es aber offensichtlich nicht. Denn die Antworten wie die Fragen werfen neue Fragen auf. Ein Beispiel: Pkt. 4: „eine elektronische Akte, die als digitale Schriftgutverwaltung genutzt wird“ = gemeint ist vermutlich ein E-Akten-System, also: elektronische Aktenführung. Geantwortet wird, dass eine „digitale Auflistung aller Archivdokumente“ vorhanden ist. Unklar: Geht es hier um Registratur- oder Archivgut? Also um ein Registraturprogramm (für die Unterlagen der laufenden Verwaltung) oder ein Archivinformationssystem (für archivwürdig bewertete Unterlagen im Archiv). Wohl eher ersteres, denn im Folgenden geht es ja um „elektronische Akten in den Fachanwendungen“. Nun enthält aber das als Beispiel angeführte Personenstandsregister nun gerade keine Akten – es ist ja ein Register.
Worum geht es also überhaupt? Vermutung der Kommentatorin: Es gibt keine vollständige Aktenführung auf Papier mehr, sondern diverse elektronische Anwendungen, File-Ablagen, E-Mail-Accounts etc. Eine offizielle und strukturierte E-Akten-Anwendung gibt es aber auch nicht. Wenn vom „Archiv“ die Rede ist, ist ein (sehr kleiner Alt-)Bestand von Papier-Unterlagen gemeint, der in ein paar Schränken verwahrt wird. Ob ordnungsgemäße Aussonderung von Unterlagen der Verwaltung (Anbietung an das zuständige Archiv nach Ablauf der Ausbewahrungsfrist, Übernahme der als archivwürdig bewerteten Unterlagen als Archivgut in das Archiv) stattfindet, ist unklar – vermutlich wohl nicht. Und das dürfte für die papiernen wie für die digitalen Unterlagen gelten.
Bei der Archivierung geht es um das Gedächtnis und die Geschichte einer Kommune – bis zum Ende des 20. Jahrhunderts vor allem dokumentiert in Papier-Unterlagen, danach zunehmend digital. Letzteres nimmt weniger Platz weg, aber alle anderen Aspekte einer Archivierung sind komplizierter als bei Papierunterlagen. Wenn ein so unklares Verständnis von Archivierung besteht, wie es die Antworten zum Ausdruck bringen, sieht es schlecht aus für das Gedächtnis der Stadt.
Pingback: “Siegerland” Band 95 / Heft 2 (2018) erschienen | siwiarchiv.de
Pingback: Wanderausstellung „Mit Macht zur Wahl! 100 Jahre Frauenwahlrecht in Europa“ | siwiarchiv.de
Pingback: “Mit Macht zur Wahl”. Ausstellungseröffnung in Siegen. | siwiarchiv.de
Pingback: Salzmann und Groos – 2 Beispiele für die Kooperation von Archivweblogs | Archive 2.0
Pingback: Warum #Archivpolitik? Was folgt aus der siwiarchiv-Blogparade: | siwiarchiv.de
Pingback: Warum #Archivpolitik? Was folgt aus der siwiarchiv-Blogparade: | siwiarchiv.de
Pingback: Viele Gäste bei Eröffnungsveranstaltung zur Ausstellung „Mit Macht zur Wahl! 100 Jahre Frauenwahlrecht“ | siwiarchiv.de
Pingback: Archivpolitik: Wo bleibt die Debatte? | Jens Crueger
Die meisten Archivblogs sind institutionell angebunden. Mit mehr privaten Blogs von Archivierenden ließe sich möglicherweise ein anderes Ergebnis erzielen. Ich kann verstehen, wenn Kolleg*innen nicht anfangen, auf den Plattformen ihrer Arbeitgebenden über Missstände zu schreiben, die sie vermutlich häufig selbst betreffen und ihre Vorgesetzten und/oder Trägereinrichtungen in Misskredit bringen – so wichtig und sinnvoll klare Worte und umfassende Informationen häufig auch wären, um z.B. die Öffentlichkeit für konkrete Probleme zu sensibilisieren.
Bei institutionellen Blogs erwarte ich auch keine investigative Aufdeckung von Missständen. Oft reicht die kommentarlose Dokumentation des politischen Diskurses, der in den Informationssystemen der jeweiligen politischen Gremien öffentlich ist.
Schließe mich Rebekka uneingeschränkt an. Es braucht mehr private Blogs und die kommentarlose Dokumentation politischen Diskurses bringt auch nur die wenigsten in Wallung. Wenn, dann müssen es zugespitzte Überschriften und klare Forderungen sein.
Wenn Archivierende bei institutionellen Blogs eine Konfrontation scheuen, dann ist dies nachvollziehbar. Aber wo sind denn die privaten Blogs? Scheuen Archivar*innen möglicherweise mwhrheitlich die Auseinandersetzung?
Mir fehlt schlichtweg die Zeit, mich mit einem eigenen Blog an entsprechenden Diskussionen zu beteiligen. Ich versuche zwar, so gut möglich, mich in entsprechenden Diskussionen zu Wort zu melden und scheue auch keine Konfrontation – aber als Dienstleister habe ich auch weniger Ängste, von irgendwem „auf den Deckel“ zu bekommen, wenn ich Kritik äußere. Ich kann ebenfalls verstehen, dass viele ArchivarInnen sich scheuen, öffentlich zu kritisieren – wobei auch ein nicht unerheblicher Teil des Fachkollegiums sich in Selbstmitleid aufgegeben zu haben scheint und lieber den Weg des geringsten Widerstandes gewählt hat. Schade drum – ich denke, dass wir mit einer stärkeren Lobby viel mehr erreichen könnten.
Sind also Scheu und mangelnde Ressourcen „Schuld“ daran, dass Archivar*innen keine Archivpolitik machen? Wenn dem so ist, dann müssen wir uns auch nicht über die ständig schwieriger werdenden Verhältnisse beschweren. Ich persönlich neige ja eher zu etwas (!) mutigeren Auftritten ….
Die notwendige „stärkere Lobby“ kann aber m. E. nicht nur aus der Archivwelt erwachsen. Hat jemand Ideen, wie wir auch hierzu unsere Nutzer*innen gewinnen können?
Ich meine, dass es eine nicht unerhebliche Zahl von Kolleg*innen gibt, die nach Feierabend sich einfach auch gerne anderen Themen widmen. Viel Engagement im VdA geschieht in der Arbeitszeit – die Gewerkschaften leiden auch unter sinkenden Mitgliedszahlen.
Der unarchivische Feierabend sei den Kolleg*innen ja von Herzen gegönnt. Selbst ich pflege das ein oder andere nicht archivische Hobby. Eintreten für begründete archivpolitische Ziele muss m. E. nicht die komplette Freizeit beanspruchen …… ;-)
Pingback: Ausstellung: “Bau[Spiel]Haus” | siwiarchiv.de
Aus das Stadtarchiv Koblenz hat einen Eintrag zu Groos verfasst: „Karl August Groos (1789-1861), evangelischer Pfarrer und Konsistorialrat in Koblenz„
Im Regionalteil Altenkirchen der Siegener Zeitung erschien am 18.3. ein Artikel über die Veranstaltung.
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 7.3. – 19.3.2019 | siwiarchiv.de
In der Arbeit von Traute Fries zur Geschichte der Deutschen Friedensgesellschaft in Siegen findet sich auch ein regionaler Bezug zu einem der genannten Autoren, Axel Rudolph, der unter dem Pseudonym Hermann Freyberg publizierte:
“ …. Axel Rudolph – eine schillernde Persönlichkeit
Im Schreiben des Westdeutschen Landesverbandes vom 5. Dezember 1929 an Fries kündigte Sekretär Bangel nach Klärung organisatorischer Fragen zum Druck von Plakaten und Handzetteln einen Referenten an, dessen Leben von den Nazis am 30. Oktober 1944 gewaltsam beendet wurde.
„[…] Axel Rudolph kommt bereits heute nachmittag hier an und wird mit dem Zug an Siegen 13.51 am Sonnabend über Siegen nach Unnau weiterfahren. Da wir die Autobusverbindungen dort nicht genau kennen, haben wir Herrn Strunk in Unnau gebeten, uns recht schnell mitzuteilen, wie er am besten von Siegen nach Unnau kommt. […] Zu den Rudolph-Versammlungen wollen wir nicht grosse Büchersendungen mitgeben, da wir nicht an einen grossen Besuch glauben. Ausserdem bekommen ja alle Vertrauensleute heute unseren Bücherkatalog zugestellt, sodass Bestellungen erledigt werden können.
Vertraulich! Axel Rudolph ist ein sehr armer Teufel, der schon lange Zeit erwerbslos ist. Er lebt von dem Einkommen seiner Reden und seiner Zeitungsartikel. Das[s] das nicht zu viel ist, brauche ich Ihnen ja nicht mehr zu sagen. Ich wollte das den einzelnen Gruppen nicht mitteilen, da ich nicht wusste[,] welche Leute davon das richtig verstehen. Wenn Sie es für erforderlich halten, es noch einigen davon mitzuteilen, dann tun Sie es nach Ihrem Ermessen.
Mit besten Grüssen für heute – Bangel“
Axel Rudolph wurde am 26. Dezember 1893 in Köln-Nippes geboren. Er war das einzige Kind dänisch/schwedischer Eltern. Er war deutscher Staatsbürger und arbeitete bis zum Einsatz als Kriegsfreiwilliger in Belgien und Frankreich als Bergarbeiter im Ruhrgebiet. 1915 geriet er an der Ostfront in Gefangenschaft. Auf Vermittlung von Elsa Brändström kam er 1917 in ein dänisches Internierungslager. 1919 gehörte er kurze Zeit dem Freikorps Schleswig-Holstein an. Wegen Verstoßes gegen das dänische Ausländerrecht handelte er sich verschiedene Haftstrafen (1920/1921) in Dänemark ein. 1921 heiratete Rudolph die Dänin Maria Stenbæk, die er während der Internierung kennen gelernt hatte. Bis 1924 lebte das Paar in Köln. Während dieser Zeit will Rudolph intensiv für dänische Zeitungen geschrieben und wohl auch wieder als Hauer im Ruhrgebiet gearbeitet haben. 1924 zog das Paar nach Garmisch. Die erste Tochter wurde geboren. Später lebte die Familie in Norddeutschland. Rudolph betätigte sich journalistisch und schloss sich der DFG in Schleswig-Holstein an. Nach der Geburt der zweiten Tochter (1929) wurde die Ehe 1930 geschieden. Zwischen 1926 und 1930 geriet Rudolph wegen krimineller Handlungen, wie Schuldigbleiben kleiner und kleinster Geldbeträge, unerlaubtes Ordentragen und Urkundenfälschung, in die Mühlen der Justiz.
Anfang Dezember 1929 kam Rudolph dann nach Hagen und wurde auf Versammlungstour ins Siegerland geschickt. Im Tagebuch der DFG heißt es: „Zwei Jahre China. Bedeutet die gelbe Rasse eine Gefahr für Europa?“ Diese Formulierung ließ die Vermutung zu, als habe sich Rudolph zwei Jahre in China aufgehalten, was nicht der Fall war. Der Anzeigentext beschränkte sich dann bewusst auf die Fragestellung „Ist die gelbe Rasse eine Gefahr für Europa?“
…..
Rudolph war nur sehr kurze Zeit für die DFG in Hagen tätig, das geht aus der polizeilichen Vernehmung vom 21. Februar 1930 hervor, die im Zusammenhang mit Landesverratsvorwürfen gegen Heinz Kraschutzki erfolgte. Rudolph gab an, für Kraschutzki Kurierdienste geleistet zu haben, die nicht rein pazifistischer Natur gewesen seien, „sondern schon […] mit Landesverrat zu bezeichnen waren“. Mit der polizeilichen Vernehmung distanzierte sich Rudolf von der DFG. Die wirtschaftliche Situation Rudolphs änderte sich 1932 als er einen Filmideenwettbewerb gewann. Er veröffentlichte bis 1943 teils unter Pseudonymen mehr als 50 Werke der Trivialliteratur, wie Abenteurer- und Kriminalromane. Am Ende wurden ihm Briefe, in denen er seine regimekritische Haltung zum Ausdruck brachte, zum Verhängnis. Wegen Wehrkraftzersetzung wurde Rudolph zum Tode verurteilt und starb unter dem Fallbeil im Zuchthaus Brandenburg-Görden.
…..“
Wie alt war der Junge Bruno Wiechert auf dem Foto?
Sprich: wann wurde das Foto gemacht?
Leider ist nur bekannt, dass das Bild vor dem 2. Weltkrieg aufgenommen wurde.
Pingback: Erfolgreiche Petition zum Geschichtsunterricht in NRW | siwiarchiv.de
Pingback: Archäologische Grabungen im Schlosspark abgeschlossen | siwiarchiv.de
Auf Twitter wurde gestern gemeldet, dass die Erfassung durch den Verein für Computergenealogie erfolgreich abgeschlossen wurde. Alle Achtung, das ging ja schnell!
Danke für den Hinweis auf das Buch von Wilfried Reininghaus zu den ersten Kommunalwahlen in Westfalen und in Lippe nach dem Untergang des Kaiserrreichs.
Leider suggeriert der Begleit(Klappen-?)text, diese Wahlen hätten „die Dominanz der alten Eliten“ beendet. Das dürfte auch für Westfalen-Lippe nicht gelten.
Die Ansetzung dieser Wahlen durch die SPD-geführte Reichsregierung waren eins der Mittel gewesen, mit denen die Revolution vorzeitig, nämlich vor der „Entmachtung der alten Eliten“, beendet wurde. Ein anderes Mittel war der Einsatz rechtsextremistischer (hier ist das Wort absolut am Platz) Freiwilligen-Regimenter nach dem bekannten Befehl von SPD-Wehrminister Noske gewesen. In diesen Kontext gehört dann etwa die Massenerschießung von Angehörigen der Volksmarinedivision 1919 durch den späteren Wittgensteiner Landrat Otto Marloh (hauptverantwortlich für die Deportation der Wittgensteiner Sinti-Nachfahren nach Auschwitz).
Das Siegerland und Wittgenstein sind ein ausgezeichnetes Beispiel für die Kontinuität der Altstrukturen in Politik, Militär/Militärtraditionen, Verwaltung, Rechtsprechung und weiten anderen Bereichen der Gesellschaft.
Ich erinnere an die Kontinuität der antisemitischen, generell fremdenfeindlichen, militaristischen und extrem antilinken Christlich-Sozialen in der Gestalt der DNVP im Siegerland und in Wittgenstein nach dem Ende der kaiserlichen Herrlichkeit und an deren Radikalisierung und das Überwechseln ihrer Wähler und eines Teils ihrer Funktionsträger zur NSDAP seit Ende der 1920er Jahre.
Statt eines möglicherweise 1919 ins Haus stehenden Bürgerkriegs folgte ein zielgerichtet vorbereiteter Weltkrieg. Und es folgten die ebenso zielgerichtet vorgenommenen faschistischen Massenverbrechen.
Es bleibt m. E. bei den Schlussfolgerungen, zu denen eine Mehrzahl der Historiker in Betrachtung der „Eliten“kontinuität in den vergangenen Jahrzehnten kam. Dazu nur drei Stimmen:
Sebastian Haffner:
„Die deutsche Revolution von 1918 war eine sozialdemokratische Revolution, die von den sozialdemokratischen Führern niedergeschlagen wurde – ein Vorgang, der in der Weltgeschichte kaum seinesgleichen hat.“ (1969)
Reinhard Rürup:
„Das Selbstverständnis der Weimarer Republik und ihrer Träger gründete sich nicht auf die Revolution, sondern auf deren Überwindung. Nicht nur die bürgerlich-demokratischen Kräfte, sondern auch die Sozialdemokraten distanzierten sich sehr rasch und eindeutig von der Revolution.“ (1993)
Joachim Käppner:
„Totenklage auf alles, was in Deutschland hätte sein können und niemals sein durfte: Hätte die Ebert-SPD die Massenbewegung genutzt, statt sie zu fürchten, das alte Militär zum Teufel gejagt, statt sich mit ihm zu verbünden, wäre die Republik 1933 wahrscheinlich nicht untergegangen oder wenigstens nicht den Nazis in die Hände gefallen – so der Gedankengang Haffners, und seiner Logik kann man sich schwer verschließen.“ (2018)
s.a. Mitteilung des Verbandes deutscher Archivarinnen und Archivare v. 26.3.2019
Wunderschöne Aufnahme.
Pingback: Kirchkartei Feudingen jetzt in Buchform erhältlich. | siwiarchiv.de
Danke für die Vorab“besprechung“! Es handelt sich sowohl um die Anzeige auf der Seite des herausgegenenden Verlags (s. Quellenagabe), als auch um den Klappentext.
Übrigens: ein Blick in die Literaturliste zeigt, dass die angegebenen Werke zur Geschichte der Weimarer Republik wohl nicht herangezogen wurden.
Klingt also so, als wäre eine ausführliche Rezension eine gute Idee.
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik März 2019 | siwiarchiv.de
„Die Ansetzung der Wahlen“: missverständlich. Muss natürlich heißen „Die Ansetzung von Wahlen“, also zuallererst von Wahlen zu einer „Nationalversammlung“, die die inzwischen von den Arbeitern selbstorganisierten Strukturen vor allem in den Betrieben, die auch die Alteigentumsverhältnisse zugunsten einer Neuordung infrage stellten, entlegitimieren und beseitigen sollte. Da war dann der Kniff mit den Wahlen nicht ganz erfolgreich. Es gibt immer noch Betriebsräte.
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 20.3. – 1.4.2019 | siwiarchiv.de
Ich würde gerne Einsicht in dieses Buch erhalten.
Einfach auf „Doktorarbeit“ im obigen Text klicken.
Dann erfolgt die Weiterleitung nach Münster; dort dann auf die Titelseite klicken und das Lesen des Buches ist online möglich. Die Seite in Münster erlaubt auch ein PDF-Download.
Ernst Bernhardt Schmidt*16.4.1870 Eisern
als Sohn des gewerken Gast Wirt und Brauereibesitzer
Wilhelm Schm. Eisern
Ehe evangel. Rödgen3.11.1867
Johanna Stadermann von Eichen
Schon der Großvater Johanns Schm. war MassebläserGewerke und Bierbrauer
in Eisern
Vielen Dank für die Ergänzungen, die die Autorenangaben der Deutschen Nationalbibliothek stützen!
Der eigentliche Dissertations-Druck liefert weitere (nicht in der Verlagsveröffentlichung enthaltene) Informationen.
Abitur: Gymnasium Attendorn. Fortsetzung der in Leipzig begonnenen Studien an der Universität Berlin, wo er auch promoviert wurde (öffentliche Disputation 22.9.1894). Als einer der drei „Opponenten“ wird ein gewisser „Albert Irle, Dr. phil.“ genannt, vielleicht ein Vertreter der Siegerländer Irle-Dynastie.
Für alle, die es interessiert (mich nicht):
„1908, also genau in dem Jahr, in dem die deutsche Nationalmannschaft ihr erstes Länderspiel bestritt, gründete der Eiserner Sprachenforscher Dr. Bernhard Schmidt einen Fußballverein.“ (https://tuseisern.de//fussball.html).
Übrigens sollte die Tatsache, dass die ULB Münster ein Werk aus ihrem Bestand digitalisiert hat, nicht als Lektüreempfehlung oder Gütesiegel mißverstanden werden. Mehrere sachkundige Rezensenten hielten Schmidts Dissertation für ziemlichen Schrott. Eine der Besprechungen endete mit dem Satz „… Wir können nicht umhin, zum Schluss unser Bedauern darüber auszusprechen, dass der sonst so stattliche Katalog trefflicher Werke, durch den sich der Niemeyersche Verlag um die germanistische Wissenschaft verdient gemacht hat, um eine so wenig erfreuliche Leistung, wie die eben angezeigte, vermehrt worden ist.“ (Gustav Hinz in: Zeitschrift für deutsche Philologie 29 (1897), S. 269-271)
Vielen Dank für die Ergänzungen!
Die Promotionsakte Schmidts befindet sich wohl im Universitätsarchiv der Humboldt-Universität Berlin, Bestand Phil. Fak. Promotionen bis 1945, Nr. 324 ( Laufzeit: 22. September – 13. Dezember 1894)
Sendung des Radios Graswurzelrevolution, Münster, vom 13. März 2019, zur Arbeit des Archivs für alternatives Schrifttum“ in Duisburg:
Link: https://www.nrwision.de/mediathek/radio-graswurzelrevolution-archiv-fuer-alternatives-schrifttum-in-duisburg-fairteilbar-in-muenster-190313/
via Archivalia, https://archivalia.hypotheses.org/98779
Pingback: “Hilchenbach sucht neuen Archivar” | siwiarchiv.de
Die Siegener Zeitung berichtete am 6.4. zur Personalsituation im Hilchenbacher Stadtarchiv:
„Das Hilchenbacher Stadtarchiv wird einen weiteren Rückschlag (sic!) verkraften müssen. ….. Pensionär Reinhard Gämlich, der seit den vergangenen Sommer noch mit einem Minijob aushilft, wird auch noch bis zum Ende des Jahres nicht ganz raus sein aus der Wilhelmsburg. Wie Fachbereichsleiter Hans-‚Jürgen Klein der SZ sagte, ist Gämlich seit April allerdings nicht mehr mit regelmäßigen Sprechzeiten zugegen – Ansprechpartner für die „Kundschaft“ ist nun der neue Archivar.“
Pingback: “Im Dienste der Naturwissenschaft und der schönen Künste” | siwiarchiv.de
Ich kannte eine Frl. Rübsamen in der Mittelstrasse in Weidenau. Vielleicht eine Tochter der Mundartdichterin ?
Wenn ich die derzeitige Quellenlage richtig interpretiere, waren Ewald und Rosa Rübsaamen kinderlos.
Leider fand die Schwester Emilie Auguste Rübsamen (1848-1922), die gemeinsam mit Schwester Rosa, Bruder Ewald und Mutter Mathilde geb. Franz nach dem Tod des Vaters 1891 nach Berlin zog, in der Beschreibung keine Erwähnung. Die drei Geschwister waren ledig. Die Schwestern unterstützen ihren Bruder bei seinen Forschungen. Seine besondere Neigung galt den Pflanzenmissbildungen und der Gallmückenlehre. Das Interesse dafür hatte seine Mutter geweckt. 1900 veröffentlichte Rosa Rübsamen in Berlin ihr 100 Seiten starkes Gedichtbändchen, das sie der Schwester Emilie widmete. Nach dem Tod des Bruders zogen Rosa und Emilie am 1. September 1919 von Metternich zurück ins Siegerland. Dreiviertel Jahr wohnten sie in Geisweid in der Unteren Kaiserstraße. Am 18. Mai 1920 zogen sie nach Hillnhütten bei Dahlbruch. Emilie starb am 21. März 1922 im Alter von 73 Jahren, Rosa folgte am 22. Sept. 1922. Dr. Hans Kruse verfasste einen Nachruf auf Rosa. Er gedachte ihrer in den folgenden Jahren mit Veröffentlichungen ihrer Gedichte und Beiträge im „Siegerländer Heimatkalender“ und in den „Siegerland“-Heften. Dazu gehört auch ihre Betrachtung „Us minner Haardter Kinnerzitt“
Ich bedauere, dass die Fotos der Geschwister, die mir das Stadtarchiv für meinen Aufsatz über Ewald Rücksamen zur Verfügung stellte, in der Ausstellung nicht gezeigt werden. Mein Aufsatz erschien am 22. April 2017 in „Heimatland“ der „Siegener Zeitung“ und wurde im Jahrbuch „Unser Heimatland“ 2017 veröffentlicht. Ich füge Rosas Gedicht „Frehjorschmorge“ bei
Frehjorschmorge
(aus dem Nachlass von Rosa Rübsamen, 1853-1922,
„Siegerland“, 1. H., Januar-März 1927))
D’r Wald hät ho d‘ Morge
Net länger schloafe konn;
Et scheen äm en d‘ Ouje
D‘ helle Frehjorschsonn;
Sin groae Newelkappe,
De nemmt s’m schwinn vam Koapp,
O derem da e Heedche
Met Palmepoase op.
Se stickt sin brungne Kerrel
Met freschem, hellem Gree,
On weabt och gäle Flenkern
We Sonnefearem nee.
Se wärmt sin kale Feße
On wescht d’r Schnee d’va,
On derem Schoh va Sammet
Met wisse Blome a.
D’r Wald, dä läßt sech botze,
Weiß net, we äm geschitt;
Hä hät och zom Bedänke
Vor lutter Lost känn Zitt.
Doch we d’m Fenk sin Brutleed
Itz klengt vor sinne Ohrn,
Wird äm z‘ Mot, als wäre
Och Bririgam no worn.
Pingback: “Im Dienste der Naturwissenschaft und der schönen Künste” | siwiarchiv.de
Vielen Dank für die Ergänzungen!
Eigentlich sollte der Eintrag ja nur auf die Ausstellung im Siegerlandmuseum aufmerksam machen; in den Informationen zur Ausstellung wird Emilie nicht erwähnt.
Wenn wir aber schon dabei sind, die einschlägige Literatur zu ermitteln, so möchte ich noch folgende Fundstücke nennen:
Schaffnit, E(rnst): Professor Ewald Rübsaamen [Nachruf], in: Zeitschrift für angewandte Entomologie, April 1928, S. S. 210 – 217
Böttger, Hermann: Auf den Hütten. Orts- und Industriegeschichte der Gemeinde Weidenau (Sieg), Siegen 1949, S. 240 [Hinweis auf das Gedicht „Os Jong“ Rosa Rübsaamens, das die Kinderjahre Ewald Rübsaamens schildert]
Pingback: Ausstellung »Die Bauhausbücher: ein europäisches Publikationsprojekt des Bauhauses 1924-1930« | siwiarchiv.de
Pingback: Ewald Rübsamen (Rübsaamen) – Zoologe, Maler und Zeichner | Stadtarchiv Koblenz
Pingback: Ausstellung „Anthonis van Dyck – Grafische Arbeiten aus dem Bestand des Siegerlandmuseums“ | siwiarchiv.de
Hallo, eine Frage, gibt es evtl. einen Stammtisch, aehnlich. wie Jahrgangstreffen der Schule, wo sich ehemalige Mitarbeiter treffen um ueber alte Zeiten zu reden? Sicher leben schon viele nicht mehr, aber ich war ca. von 65-70 dort beschaeftigt (Geisweid), damals Anfang 20, da koennten vielleicht noch ehemalige Kollegen leben.
Ich faende es schoen alte Zeiten aufleben zu lassen, ich habe mich dort wohlgefuehlt und war verbunden mit der Firma.Waere doch schoen, zu erfahren, was ist aus dem einen oder anderen geworden.
VGR.Moser
Danke für die interessante Mail. Ich bin nur erstaunt, dass man in Siegen nie von Ludwig von Siegen spricht. Er gilt als der Erfinder der „Manière Noire“, der sogenannten Schab- oder Schwarzkunst, Mezzotinto, eine Technik der Radierung. 3 seiner Originale konnte ich in der National-Bibliothek in Paris besichtigen.
Ludwig von Siegen ist in Köln geboren. In den einschlägigen biographischen Nachschlagewerken (Wikipedia, ADB) lässt sich kein Siegen-Bezug erkennen. Ob Werke in Siegerlandmuseum vorhanden sind, weiß ich nicht.
Grube Pfannenberg?
Leider nein?
Eiserfeld Kaiserschacht
Leider nein.
Eisernhardter Tiefbau
Auch nicht.
Grube Neue Hardt…ca 1963
Gratulation!
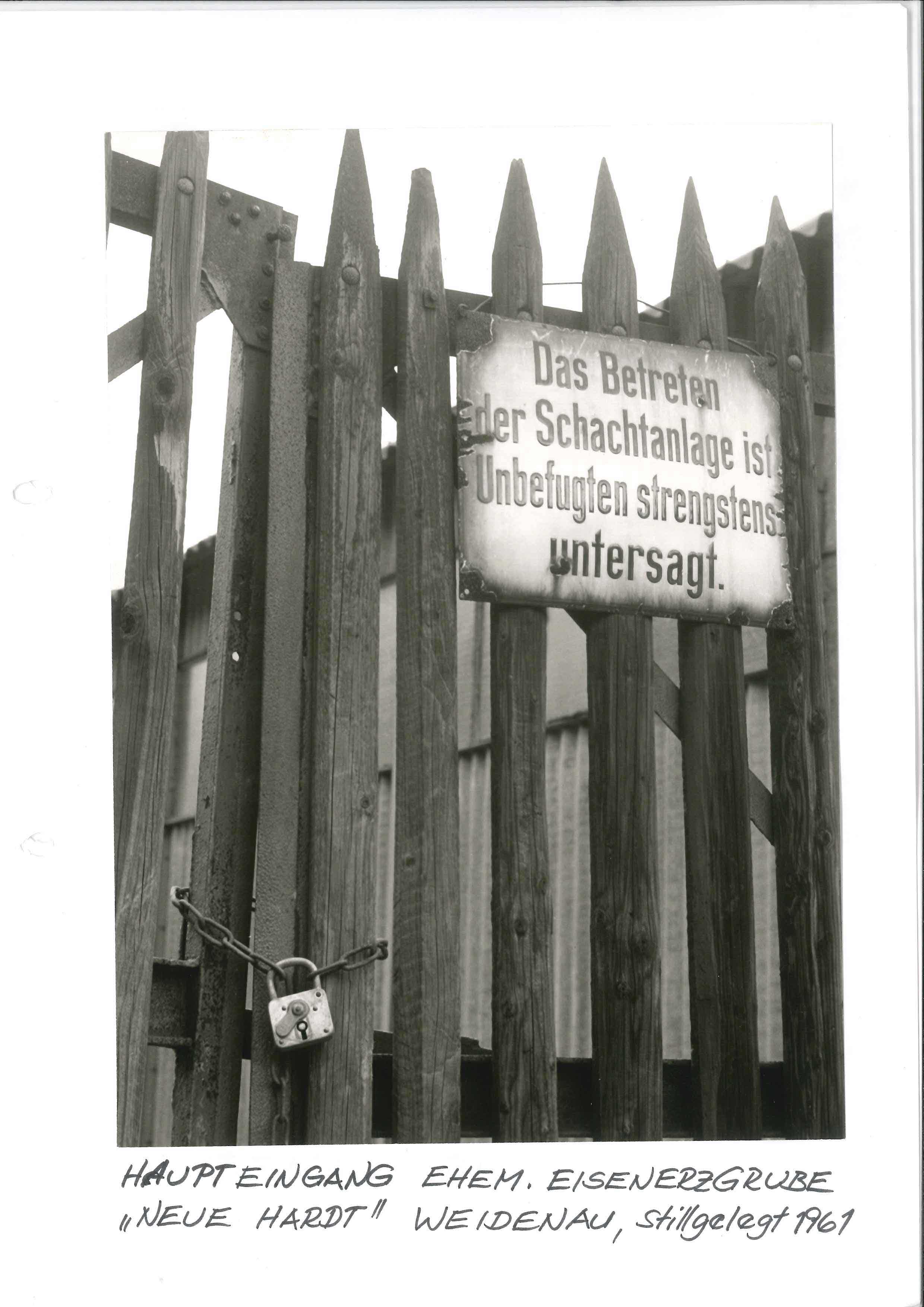
Es handelt sich tatsächlich im die Grube Neue Haardt – auch das Jahr lasse ich gelten:
Oh wie schön , da freue ich mich aber und bin
Gespannt …….
Ein Gruben oder Eisenbahn Buch wäre ja toll
Zu Ostern
Freundliche Grüße
Füsseberg
1965
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 2.4. – 14.4.2019 | siwiarchiv.de
Storch & Schöneberg, ca. 1941/42
Pingback: Wo könnte ein Gemeindearchiv in Neunkirchen untergebracht werden? | siwiarchiv.de
Es ist der Marktplatz mit der evangelischen Kirche im Hintergrund in Hilchenbach
Richtig erkannt:
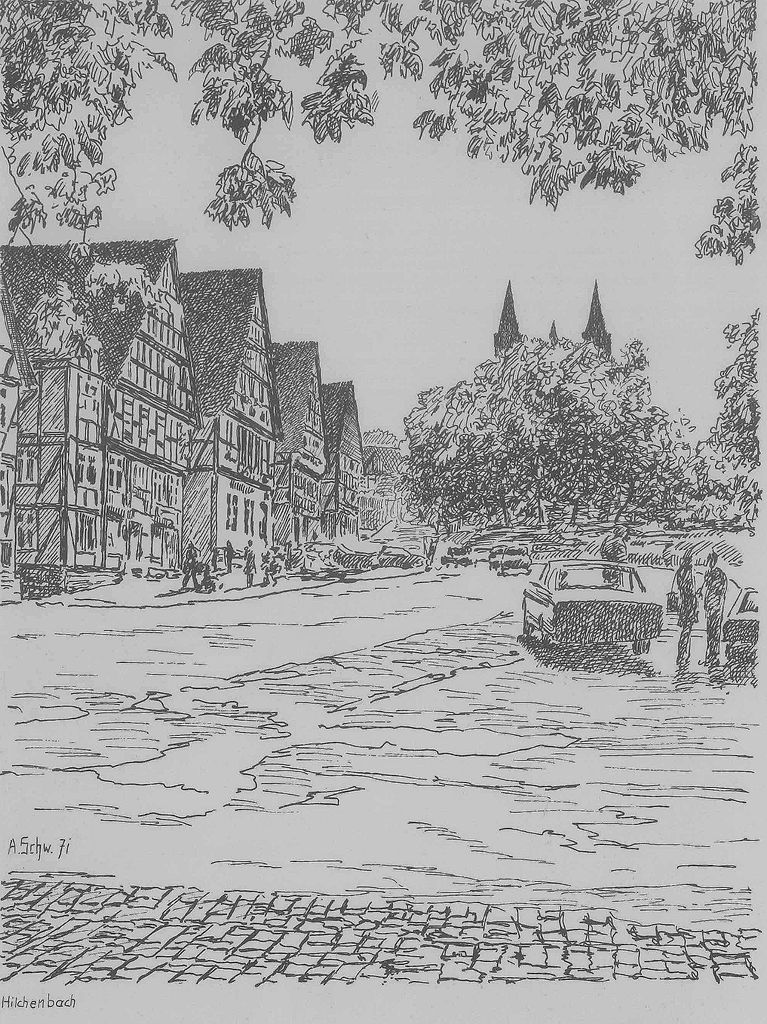
Kartierung der Schäden durch Luftangriff auf Siegen, Dez. 1944
Akten-/Rollwagen
Korrekt! Ein Rollwagen, der zwischen unsere Rollregalanlage fährt.
Rollregal
Aus den Unterlagen des Universitätsarchivs Leipzig geht hervor, dass Schmidt wohl im Sommersemester 1888 und im Wintersemester 1888/89 in Leipzig Philologie studiert hat. Für Sommersemester 1888 belegte Veranstaltungen zu Sophokles, Thukydides, Horaz und Livius sowie zur griechischen und lateinischen Grammatik (Quellen: UAL Rektor B 61, UAL Rep 01 16 07 C 50 Bd. 01, UAL Rektor M 38). Danke an das Universitätsarchiv Leipzig!
Drehen an der Kurbel einer Rollregalanlage
Forstbetriebskarte Grund/Lützel, Schlageinteilung nach der Güldenen Jahnordnung von 1718
… und Kredenbach/Lohe
Die Antworten sind leider nicht korrekt.
Kgl. Oberförsterei Hilchenbach, Bestandskarte, 1803
Die Antwort ist leider nicht korrekt.
In den personengeschiuchtlichen Dokumentationen des Siegener Stadtarchivs fanden sich 2 kleine ergänzende Quellenhinweise zu Rosa Rübsaamen:
1) Siegener Zeitung, 23.9.1922, Nachruf des Siegerlandmuseums (Autor: Dr. Hans Kruse)
2) Siegerländer Heimatkalender 1923, Gedichtabdruck
„Siegerländer Mundartbuch aus Eisern
Anfang April 1895 widmete die Siegener Zeitung der als Doktorarbeit von Bernhard Schmidt aus Eisern (Brauerei Schmidt) erschienen Schrift …… eine lange Besprechung. Dr. Jakob Heinzerling in Siegen hatte bereits 1871 eine ähnliche Arbeit veröffentlicht, dabei jedoch im wesentlichen auf das in Siegen gesprochene „Platt“ aufgebaut, während Bernhard Schmidt seiner Schrift vor allem die Eiserner Mundart zugrunde legte. Die Arbeits Schmidts wurde anhand zahlreicher Beispiele sehr positiv beurteilt.“
aus: Müller, Adolf: Eisern. Auf Erz und Eisen. Pulsierendes Leben in einem alten Siegerländer Gruben- und Hüttendorf, Siegen 1966, S. 290.
Urkataster von ca. 1836 / 1840 für das Amt Hilchenbach.
Leider nein – u. a. etwas zu alt.
ein letzter Versuch: Separation, Flurbereinigung, Amt Keppel, 1905
Leider nein – u.a. zu jung.
Noch ein Versuch:
Planung der Eisenbahnstrecke im Ferndorftal ca. 1860.
Zeitlich ist es nun beinahe korrekt, aber thematisch ist es leider nicht passend. Da war man hier schon ´mal näher dran.
Da keine weiteren Lösungsversuche eingegangen sind, erfolgt nun heute die Lösung des Karten-Rätsels. Waren die drei übrigen Rätsel wohl keine große Herausforderung, war dieses Rätsel schwer genug. Es handelt sich um folgende Karte des Forstamtes Hilchenbach:

Pingback: Literaturhinweis: “Universitätsgeschichte schreiben” | siwiarchiv.de
Wegen einer Recherche wurde die Archivdatenbank des Geheimen Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz überprüfte, die zu Schepp zwei Akten auswirft:
1) Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz
Findbuch: I. HA Rep. 77
Bestand: Ministerium des Innern
Überschrift: 09.18 Personalakten – S (1840 – 1934)
Bestellsignatur: I. HA Rep. 77, Personalakten Nr. 2387
Titel: Schepp, Ernst, Regierungsrat im Oberpräsidium Münster
Laufzeit: 1885-1901, 1920
2) Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz
Findbuch: I. HA Rep. 125
Bestand: Ober-Examinationskommission bzw. Prüfungskommission für höhere Verwaltungsbeamte
Überschrift: 02.02.20 Einzelne Prüfungen, Sch
Bestellsignatur: I. HA Rep. 125, Nr. 4478
Titel: Schepp, Ernst, Regierungsreferendar, Köslin
Laufzeit: 1885
Registratur-/Altsignatur: III c Specialia Nr. 284
Unklar ist, ob der erste Akenband mit GstA Berlin Rep. 77 Nr. 4434 oder
DZA Merseburg (?), Rep 89 H II Westfalen Nr. 1 Vol. 84 identisch ist.
In der Datenbank der niedersächsischen Archive wurden folgende Akten ermittelt:
1) NLA Stade, Rep. 72/172 Neuhaus Amtsgericht Neuhaus/Oste (1852-1973), Nr. 1355, Aufnahme und Eröffnung des Testaments der Eheleute Schepp, Ernst Rudolf, Landrat, und Therese, geborene Weismann, Neuhaus, 1893 – 1927
2) NLA Stade, Rep. 180 C Regierungspräsident Stade 1885-1978, Kommunalaufsicht, Nr. 2790, Versetzung der Landräte des Landkreises Neuhaus, 1889 – 1933
Enthält: Friedrich Wilhelm von Loebell 1889/90; Ernst Schepp 1894; Otto Heidborn 1905; Georg Frhr. von Schröder 1917; Eugen Naumann 1918/19; Erich Knöpfler 1932/33
Vielen Dank für diesen Hinweis auf die im neuen Heft „Wittgenstein“ erscheinenden Artikel. Allerdings ist das Heft momentan noch im Druck und insofern auch noch nicht ausgeliefert.
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 15.4. – 27.4.2019 | siwiarchiv.de
Pingback: Stellenausschreibung: Stadtarchiv Hilchenbach (50%) | siwiarchiv.de
Der Dokumentarfilm war 1000 Mal besser als dieser unsäglich schwülstige und kitschige Spielfilm Lotte am Bauhaus. Ich frage mich, warum immer Männer denken, sie könnten Filme über Frauen machen :-( – der Spielfilm war so klischeehaft, dass mir die Zähne weh taten.
Pingback: Ausstellung mit Baukasten von Alma Siedhoff-Buscher | siwiarchiv.de
Pingback: Vortrag und Buchpräsentation: Christian Brachthäuser: „Inventarium dero Closterbücher so zu Siegen“ – | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik April 2019 | siwiarchiv.de
Pingback: Newsletter 2018/12 – Verein für Computergenealogie e.V. (CompGen)
Das Heft 1/2019 wurde am Dienstag, 7. Mai versandt. Der Buchhandel in Bad Berleburg ist ebenfalls beliefert worden.
Gewohnt meinungsstark kommentiert Klaus Graf auf Archivalia die Schließung und weist zurecht auf die Einklagbarkeit einer Nutzung hin.
1. Johann Adam Ginsberg, * 1660 in Neunkirchen-Salchendorf. Er heiratete Maria (Schneider?), Heirat 1687, * 1670 in Neunkirchen-Salchendorf.
Kinder:
2. i. Johann Peter Ginsberg * 20.11.1687.
3. ii. Johannes Peter Ginsberg * 12.01.1690.
4. iii. Johann Henrich Ginsberg * 25.03.1692.
iv. Anna Katharina Ginsberg, * 25.03.1695 in Neunkirchen-Salchendorf.
v. Johann Peter Ginsberg, * 05.09.1697 in Neunkirchen-Salchendorf.
vi. Agnes Katharina Ginsberg, * 19.09.1700 in Neunkirchen-Salchendorf.
5. vii. Johann Henrich Ginsberg * 07.01.1706.
5. Johann Henrich Ginsberg, * 07.01.1706 in Neunkirchen-Salchendorf. Er heiratete Petronella ten Nuyl, Heirat 06.06.1734 in Zutphen, * 1710 in Zutphen.
Kinder:
i. Jan Hendrik van Kinsbergen, * 01.05.1735 in Doesburg, † 22.05.1819 in Apeldoorn.
Vielen Dank für die genealogischen Angaben! M.E. lohnt sich ein neuer regionaler Blick auf den Admiral
ich bin jetzt 70 Jahre und habe diese Schrift noch in der Schule gelernt. Das ist DEUTSCHES SCHRIFTGUT, es sollte wieder in der Schule gelernt werden.
Danke für den Kommentar! Da Kurrentschriften heute nicht mehr gebräucklich sind, halte ich eine Aufnahme dieser Schrift in den Lehrplan der Schulen für problematisch. Zur Vermittlung von Schreibschriften s. a. http://www.siwiarchiv.de/ausstellung-50-jahre-schulausgangsschrift/
Ergebnisse der „Archivkoalition“ in Deutschland bei der Europawahl:
Die Linke: 5,5 %
Tierschutzpartei: 1,4%
Piraten: 0,7%
Liebes Siwiarchiv,
das hat mich sehr gefreut, dass Ihr wieder bei einer Museums-Blogparade dabei seid, dieses Mal bei #DHMDemokratie!
Archive und Demokratie faszinieren mich. Schon eine schwere Entscheidung festzulegen, was archivierungswürdig und was nicht ist. Wie demokratisch ist das tatsächlich? Welche Kriterien gibt es dazu?
Das Archiv als Kontrollinstanz für Politiker ist spannend, jedoch tangiert es diese vermutlich nicht mehr, wohl aber die Rückblende für andere.
Vielen herzlichen Dank. Tatsächlich passte der Artikel in meinen Augen prima zu @gegenvergessen und warum in der Präambel der Gottesbezug steht. https://www.demokratiegeschichten.de/gott-im-grundgesetz-dhm-demokratie/
Merci und bis bald wieder!
herzlich,
Tanja von KULTUR – MUSEUM – TALK
Eine Reaktion via Twitter:
Eigentlich sehr Schade, dass die Sütterlinschrift als eine Alternativschrift vor mehr als 40 Jahren aus dem Lehrplan ausgefallen ist. Besonders bei Schulkindern mit vererbter Disgraphie wäre Sütterlin (Kurrentschrift) die ideale Ersatzmöglichkeit gewesen. Ich hatte vor gut 15 Jahren die Möglichkeit gehabt, solchen Schulkindern in der Tschechischen Republik die Sütterlinschrift anzulernen, wodurch sich im Nachhinein bei den 13 Knaben und Mädchen die normale Schreibschrift wesentlich verbesserte. Vielleicht wäre dies ein Tipp für die Bildungsminister, um etwaige Bildungslücken bei den Erst- bis Vierklasslern zu beseitigen.
Was spricht dagegen, dass Großeltern, wenn sie Kurrentschriften noch beherrschen, diese Tradition an ihre Enkelkinder weitergeben? Bitte nicht immer alles der Schule aufbürden! Bildung und Erziehung sollten in der Familie beginnen. Traurig ist aber, dass historische Hilfswissenschaften (wie die Schriftkunde) kaum noch zum universitären Pflichtprogramm angehender Geschichtslehrer gehören.
Es gab einen Giesser Namens Bachert , der wohl in Siegen gelernt und geheiratet hatte.,wohl vor 1767 .Vielleicht kann eine Beleuchtung mit 1000 Watt Strahler und danach Aufnahme mit einer Wärmebildkamera helfen , Jede grössere Feuerwehr hat so ein Gerät ,die Inschrift besser zu lesen.
Die 250 Exemplare der Erstauflage sind bereits vergriffen.
Über die aktuellen Sachstand gibt eine Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage einer AfD-Abgeordenten Aufschluss:
Und die Nachricht am Geburtstag von Walter Krämer, sehr schön!
Danke!
Herzlichen Dank für die Erwähnung des Artikels zu Ludwig Ferdinand zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg und vor allem vielen Dank für die umfangreiche Recherche zu weiteren Belegen seines Wirkens.
Bitte noch folgende Korrektur vornehmen: Der Artikel in der Wikipedia wurde ausgerechnet gestern Abend verschoben und befindet sich jetzt hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Ferdinand_zu_Sayn-Wittgenstein-Berleburg
MfG Dieter Bald
Habe aus dem Nachlass meiner Tante Kaffeegeschirr aus dem Hause Ida Hermann SIWI Porzellan erhalten. Wäre das etwas für Ihr Archiv ?
Nach meinen Recherchen ist sie als Jüdin wohl deportiert worden und hat einen Stolperstein in Siegen bekommen.
oder wer könnte Interesse haben ?
MfG Birgit Reuyß
Zur Förderung des städtischen Projektes durch die REGIONALE s. „REGIONALE 2025
Landrat übergibt ersten Stern an Projekt »Zeit.Raum Siegen«, Pressemitteilung des KReises Siegen-Wittgenstein v. 28.6.2019, Link: https://www.siegen-wittgenstein.de/Startseite/REGIONALE-2025-Landrat-%C3%BCbergibt-ersten-Stern-an-Projekt-Zeit-Raum-Siegen-.php?object=tx,2170.14&ModID=7&FID=2170.2209.1&NavID=2170.58
Moin.
Wer hat das Zuckerhaus aus Zucker gebaut?
Ich war vor zwei Wochen bei Ihnen in der Ausstellung.
Es hat mir sehr gut gefallen.
Zuständig für die Ausstellungsgestaltung – also auch für das Zuckerwürfelmodell – war laut freundlicher Mitteilung des Mauritshuis die Firma OPERA, Amsterdam, Link: https://opera-amsterdam.nl/ .
Danke schön!
Bis nächstes Jahr!
Wir bleiben dann zwei Wochen in Ihrem schönen Land.So freundliche Menschen… so tolle Radwege…
es grüßt aus Hamburg:Martina.
Um Missverständnissen vorzubeugen, die Ausstellung, die sich u. a. mit Johann Moritz auseinandersetzen wird, findet ab dem 5.4. 2020 im Siegerlandmuseum statt in Siegen statt: http://www.siegerlandmuseum.de/?post_type=portfolio&p=4922 . Das Siegerland ist m. W. nicht für seine tollen Radwege bekannt.
Hallo Martina,
nur um einem möglichen Missverständnis vorzubeugen: Ich war nicht an der Ausstellung beteiligt sondern habe Sie mir auch nur als Besucher angeschaut.
Aber es freut mich natürlich, wenn Sie die Ausstellung ebenfalls als gelungen und interessant empfunden haben, nächstes Jahr wird es vermutlich auch noch eine Ausstellung mit Bezug zu Johann Moritz in Siegen geben.
Jurypreis an ein historisches Projekt:
„…. Jury entschied über Vergabe der Preise
Der Zukunftspreis ist ein Ehrenamtspreis, den der Kreis Siegen-Wittgenstein regelmäßig unter wechselnden Schwerpunktthemen vergibt. Über die Preisträger hatte im Vorfeld eine Jury entschieden, zu der Landrat Andreas Müller, die stellvertretenden Landrätinnen Jutta Capito und Waltraud Schäfer, Karl-Ludwig Bade, stellvertretender Landrat, Annette Scholl, Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft- und Regionalentwicklung sowie Thiemo Rosenthal, Leiter des Referates für IT, Digitalisierung und Bevölkerungsschutz des Kreises Siegen-Wittgenstein, Steffen Löhr, Amt für IT und Digitalisierung des Kreises Siegen-Wittgenstein und Univ. Prof. Dr. Hildegard Schröteler von-Brandt, Universität Siegen, Department Architektur, entschieden.
Silbererzbergwerk des 18. Jahrhunderts virtuell befahrbar machen
Auf dem zweiten Platz landete der Verein Altenberg und Stahlberg e.V. aus Müsen. Die Gruppe hat begonnen, ober- und unterirdischen Anlagen des Müsener Reviers durch einen 3D-Laserscan für immer digital zu „konservieren“. Langfristiges Ziel ist es, ein Silbererzbergwerk des 18. Jahrhunderts in seiner Gesamtheit mit Abbauen, Stollen und Schächten zu erfassen und für die Öffentlichkeit virtuell befahrbar zu machen. „Durch das Projekt wird eindrucksvoll deutlich, welche Potentiale Digitalisierung für die Kultur und die Geschichte bietet“, sagte die stellvertretende Landrätin Jutta Capito bei der Würdigung des Preisträgers. Dieser erhält für den zweiten Platz ein Preisgeld von 1.500 Euro. …“
Quelle: Kreis Siegen-Wittgenstein, 3.7.2019, https://www.siegen-wittgenstein.de/Startseite/Dorfgemeinschaft-Arfeld-mit-Zukunftspreis-des-Kreises-ausgezeichnet-Zweiter-Platz-f%C3%BCr-Altenberg-Stahlberg-e-V-Dritter-Preistr%C3%A4ger-Gemeinschaftsvereine-Arfeld-Puderbach-und-Dorfgemeinschaft-Raumland.php?object=tx,2170.14&ModID=7&FID=2170.2212.1&NavID=2170.58
Teilnehmer der Delegation aus bei der Rückkehr im Siegerland
(Gebäude im Hintergrund, 19. / 20. Jh .errichtet)? Fw.-Kapelle
Der Bär könnte ein Geschenk aus Spandau sein.
Finde ich gut, und aber Der oder Die Vertreter/in aus meinem Ort hätte dochvorstellig werden können..
Sind bei den Arbeiten Flurnamen erschienen und deren Deutung? Falsche Bezeichnungen richtig gestellt worden
Gerade „auf der Wilte“ gab es noch im 18ten Jahrhundert keine genaue Grenzziehung der Fürstenthum Siegen gegenüber Burbach und dem Freien Grund, gewiß aber eingeflossen? bezws dem Schüler bekannt!
Zum Sachstand im Juni 2018 berichteten das archivamtblog und das Blog der Evangelischen Kirche im Rheinland.
Zur Chronologie des Relaunchs s. a. die Ausführungen von Dr. Bettina Joergens (LAV NRW) in der Aktuelle Stunde des Westfälischen Archivtags 2019: “ …. Es ging um die völlige Erneuerung von archive.nrw.de. Momentan sei der Zwischenstand noch nicht so weit, wie erhofft.
Positiv sei es, dass die Migration der Bestände gut funktionieren würde. Die Softwarehersteller werden unterstützt, es sei geplant, dass jedes Archiv eine eigene Startseite erhält, die im Nachhinein beliebig bearbeitet werden könne.
Im Februar erhielten sie die letzte Lieferung, Probleme wäre, dass das System noch nicht fehlerfrei laufen würde – Content Management System funktioniert noch nicht, Recherchefunktion funktioniert noch nicht wie gewünscht
Eine Fehlerliste würde den Nutzern noch zugeschickt werden.
Zur Beendigung des Projekts wurde eine externe Projektmanagerin eingestellt und eine Prüfungsstelle, die die Bemühungen kritisch beobachten werden.
Es kann noch kein letzentliches Veröffentlichungsdatum genannt werden. ….“
Das Bild zeigt den Skilift von Hilchenbach -Lützel.
Das Bild ist nach Neubau der 2 Liftanlage 1972 entstanden.
In die Wertung kommen Almut Menn und Wagener. Gratulation! Das Bild wurde 1981 für eine Diaserie des Kreismedienzentrums erstellt.
Skilift von Hilchenbach -Lützel
Im Winter
Beide zeitlich Angaben sind ja nicht unkorrekt Allerdings hätte ich gerne ein konkretes Jahr, da der Ort ja nicht sonderlich herausfordernd war. Das Raten kann beginnen…….
Das Bild zeigt den Skilift in Hilchenbach-Lützel im Jahr 1974.
Skilift Hilchenbach-Lützel / 1978
Die Schanze stand ja bis 2012. Da gibt es ja noch ein paar Jahre ……
Skilift Lützel in den Jahren 1975 – 1985
Richtige Zeitspanne. Gesucht ist das konkrete Jahr.
Skilift in Lützel im Jahr 1979
Wärmer ……
1981
Meiner Meinung nach stand die „alte Stadtkirche“ um 1845 an genau der selben Stelle wie heute (nur etwas kleiner), d.h. ebenso wie heute in der Schlossstraße.
Ich vermute, diese Kirche wurde nie gebaut. Die Vorgängerin der Berleburger Stadtkirche stand auf dem Goetheplatz und musste 1839 abgerissen werden. Der gezeigte Plan zeigt vermutlich einen Planentwurf für den gleichen Standort, der nie realisiert wurde. Erst 1859 entstand dann die jetzige Stadtkirche an der Schlossstraße
Dass es die Berleburger Stadtkirche (oder ein nicht realisierter Plan davon) war zunächst auch meine Vermutung. Sie trifft aber nicht zu. Es darf also weiter gerätselt werden! Die Kirche wurde gebaut, aber eben nicht in Bad Berleburg. Und noch ein Tipp: Es ist unklar, warum der Plan im Fürstlichen Archiv in Bad Berleburg vorhanden ist, oder anders: er wäre dort nicht zu erwarten gewesen.
Könnte es die Stadtkirche Darmstadt sein?
Touché! Es handelt sich tatsächlich um die Evangelische Stadtkirche in Darmstadt, die 1843/44 ‚runderneuert‘ wurde (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Stadtkirche_Darmstadt). Wie und warum der Plan nach Bad Berleburg, in die Fürstliche Rentkammer und dadurch ins Archiv gelangte, ist unklar, aufgrund der familiären und nachbarschaftlichen Beziehungen der Fürsten zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg zu den Landgrafen von Hessen-Darmstadt bzw. zum Großherzogtum Hessen aber auch keine Riesenüberraschung.
Nachtrag: Sobald wieder Findbücher im NRW-Archivportal hochgeladen werden können, wird auch in der Verzeichnungseinheit des Onlinefindbuch die Anonymität der Kirche aufgehoben sein …
Ah, wunderbar!
Ich bin über die „Bessungerthorstrasse“ links oben im Plan darauf gekommen…da kommt man dann recht bald auf Darmstadt. Der Blick in den Wikipedia-Artikel hat es dann bestätigt.
Ein schönes Rätsel (habe meinem Chef dann direkt auch gebeichtet, dass das während der Arbeitszeit einfach gelöst werden musste… ;-) )
Grüße aus Duisburg!
Gratulation! Dann wünsche ich bei den noch kommenden Rätseln weiterhin viel Erfolg!
Der Vollständigkeit halber hier auch der Artikel zur Darmstädter Stadtkirche aus dem Stadtlexikon Darmstadt: https://www.darmstadt-stadtlexikon.de/s/stadtkirche.html
Die Mention des Stadtarchivs auf Twitter war ja fast schon ein Wink mit dem Zaunpfahl ;)
der Plan zur Runderneuerung der Stadtkirche in Darmstadt. aus den Jashren 1843-1845
1976
Hallo und Guten Morgen,
dieses Bild müßte in Erndtebrück Anfang bis Mitte der 50er Jahre gemacht worden sein. Es zeigt entweder Wabrichstr. und die Gen. Häuser oder aber den Herrenseifen, mit Berlinerstr. und Blick auf den Steimel
Das Bild wurde nicht in Erndtebrück aufgenommen.
Diese Geschichte beeindruckt mich tief . Auch wenn das Geschehen mehr als 75 Jahre zurück liegt, lässt es mich nicht los. Deshalb engagiere ich mich im Aktiven Museum Südwestfalen, damit das furchtbare Unrecht nicht vergessen wird.
Ludwigsburg
Bad berleburg
Ludwigsburg
Bad berleburg
Gratulation! Die Antwort ist korrekt.
Das muß bzw. ist die „Ludwigsburg “ in Bad Berleburg sein.
1. Bornstraße in Geisweid mit blick auf die ehemaligen SAG Häuser ,2. Wäsche trocknen und Gartenanlage mit Sommergemüse
Korrekt. Gratulation! Übrigens, die SAG ist das zurzeit älteste deutsche Familienunternehmen.
das könnte von Erndtebrück Richtung Benfe sein
Blick vom Seebachtal Richtung Ebschloh
Die Beschriftung lautet leider anders.
Das könnte der Blick aus der Bärenbach sein und dann Richtung Dille
Die Beschriftung lautet leider anders.
Hallo, gibt es noch ein Foto von der Firma F. Meyer Siegen Weidenau neben der früheren Post. Da ist wohl jetzt ein Busbahnhof. Bei dieser Firma habe ich meine Büroaisbildung gemacht 1967?
Es empfiehlt sich eine Anfrage an das Stadtarchiv Siegen zu richten, das über eine ansehnliche Fotosammlung verfügt. Vielleicht ist auch die Facebook-Gruppe „Weidenau – gestern und heute“ hilfreich.
Auch die dortigen Vorschläge Puderbach und Oberndorf sind leider falsch
Bedaure, zumindest in den fotografischen Sammlungsbeständen des Stadtarchivs Siegen lässt sich keine Aufnahme des gesuchten Areals in Weidenau mit der Firma Meyer nachweisen.
In der Facebook-Gruppe „Unser Wittgenstein“ gingen bis jetzt folgende unrichtige Lösungsvorschläge ein: Neuastenberg, Bernshausen und Amtshausen/Leimstruth
Das Bild ziegt die Firma C. Koch in Berleburg (heutiger Rathausgarten)
Standort des Fotografen dürfte in etwa die heutige Tierarztpraxis Buttler sein.
Reste der Zaunanlage existieren noch vor der Jugendstilvilla Poststraße 44.
Korrekt!
Hof Klöckner in Obernetphen, 1960er Jahre
Genau! Gebäude wurde saniert.
Die Lösung ist korrekt!
Hof Klöckner in Obernetphen. Das Anwesen wurde saniert, steht aber noch.
Bauernhof Klöckner und Sägewerk Klein in Obernetphen, im Hintergrund Brauersdorfer Str.
Hof Klöckner, noch ohne Reithalle
Bauernhof Glöckner in Netphen
Niederdielfen, Siegener Straße, Richtung Feuersbacher Furt, links vor der Grün-Kurve, das Areal gehört wohl heute zu Siegenia, ca. 1954
Sehr richtig!
Anfang Niederdielfen von der Fa. Grün aus gesehen, auf der linken Seite
Pingback: Besuch der Germanna Foundation (Virginia) im Siegerland | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 2.7. – 18.7.2019 | siwiarchiv.de
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich weiß nicht, ob es Sie interessiert.
Mein Opa, der Bergmann Albert Otto Leicht ist bei dem Bau eines Schachtes auf
der Grube ums Leben gekommen. Das muß Ende der 1920er Jahre passiert sein. Er ist dann im Krankenhaus zu Kirchen verstorben.
Mit frdl. Grüßen
Marlene Lange
Bitte wg. der sprachlichen Form noch mal gegenlesen lassen. Das bietet sich immer an, wenn eine Reinschrift ins Netz gestellt oder sonstwie vorgelegt werden soll.
Bitte Herrn Kloth nicht unnötig heroisieren. Er war kein Widerständler und wurde es auch durch die kurzzeitige Routinefestnahme nicht.
Ein paar ungeordnete Anmerkungen:
0) Vielen Dank für die Kritik!
1) siwiarchiv versteht sich primär nicht als wissenschaftliches Publikationsorgan. Dafür gibt es im Kreisgebiet 3 historische Zeitschriften.
2) Unter dem Autorennamen „Praktikum Kreisarchiv“ erscheinen in der Regel Einträge auf siwiarchiv, die von Praktikant*innen, Schüler*innen oder Student*innen verfasst werden. Ziel ist es, das Publizieren in einem Weblog kennen zu lernen. Eine der wichtigsten Vorgaben des Bloggens ist es, authentisch zu bleiben. Daher werden stilistische Unzulänglichkeiten bewusst in Kauf genommen.
3) Solche Einträge werten in der Regel die vor Ort einsehbaren Quellen und Literatur sowie die online verfügbaren Daten aus.
4) Die Kritik an der Einschätzung Kloths mag ja berechtigt sein – und sollte bei zukünftigen Darstellungen Kloths berücksichtigt werden – , aber sie kommt zu früh. Denn für den Eintrag konnten weder die vorhandene Personalakte noch die umfangreiche Überlieferung des Mädchengymnasiums ausgewertet werden. Zudem entfiel ein Blick in der Protokolle der Siegener Stadtverordnetenversammlungen aus zeitlichen Gründen.
5) Einträge auf siwiarchiv verstehen sich oft genug als Anregungen zum Weiterforschen – so auch in diesem Fall. Das ein oder andere Mal haben Einträge auf siwiarchiv bereits zu Korrekturen an anderer Stelle geführt – so auch in diesem Fall!
Die Darstellung geht von einem Zusammenhang zwischen dem gescheiterten Attentat am 20. Juli und der Verhaftung von Kloth aus („200 Hinrichtungen“). Die Annahme ist sicher naheliegend, aber doch unzutreffend. Es war eine Festnahme im Rahmen der „Aktion Gewitter“. Sie wurde als eine Präventivmaßnahme, die mit vermuteten Putschvorbereitungen nichts zu tun hatte, seit Juli vorbereitet und fand auf der Basis von veralteten Listen aus der Zeit der unmittelbaren Kriegsvorbereitung 1939 statt. Sie zielte vor allem auf linke und katholische vormalige Mandatsträger. Eine Minderheit von Tausenden wurde dann in KZs festgehalten. Sehr viele als harmlos aber umgehend wieder auf freien Fuß gesetzt. Zu diesen gehörte Kloth.
Das bekannte Personenlexikon der VVN zu „Widerspruch und Widerstand“ wäre in dieser Hinsicht mal zu korrigieren.
Link zur Aktion Gewitter: https://de.wikipedia.org/wiki/Aktion_Gitter
PS:
Nicht nur das VVN/BdA-Lexikon auch der siwiarchiv-Beitrag „20. Juli 1944: Beteiligte und Betroffene aus dem Siegerland und Wittgenstein“.
Errare humanum est.
Der erwähnte Beitrag wurde ergänzt. Danke für den Korrekturhinweis!
Pingback: 20. Juli 1944: Beteiligte und Betroffene aus dem Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein | siwiarchiv.de
Pingback: 20. Juli 1944: Beteiligte und Betroffene aus dem Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein | siwiarchiv.de
Den Entstehungshintergrund hatte ich mir schon so vorgestellt. Den merkt man dem Beitrag sehr an. Bei allem Autorenstolz, den das Publizieren hervorrufen kann, sollte der Autor interessiert sein, nicht mit sprachlichen Schnitzern ins Bild zu treten, daher mein Gegenlesevorschlag.
Und was den Kontext angeht, so ist das auch deshalb schade, weil siwiarchiv, wie alle Leser wissen, für ein wirklich gutes Niveau steht.
Auch Neil Armstrong hatte westfälische Wurzel: https://www.compgen.de/2019/07/dies-ist-ein-kleiner-schritt-fuer-einen-menschen-aber-ein-gewaltiger-sprung-fuer-die-menschheit/?fbclid=IwAR0p0Uy7zNdet3zHPuV1OA8ij2gmEpQ8Z9mYqueXMSyoZAWwtfzAkcCROvI . Der in diesem Eintrag verlinkte Aufsatz widmet sich auch der Erinnerung in Ladbergen.
Pingback: Literaturhinweis: Bernd D. Plaum: “100 Jahre Jahre Jugendamt der Stadt Siegen” | siwiarchiv.de
Zu Beständeübersichten im digitalen Zeitalter s. jüngst: https://archivamt.hypotheses.org/11012
Ein solch sinnvolles Bildarchiv für den Kreis-Siegen-Wittgenstein , soll angeblich lt. Ausage von H. Thomas Wolf schon einmal hier betanden haben, es wurde aber u.a. aus Kostengründen wieder abgeschafft und auch nicht weiter verfolgt. Was im kleinen nicht gelingt wird auch auch auf Bundesebene scheitern, zumal es ja schon ein Bundesarchiv in Berlin u. Koblenz gibt .
Wie wäre es z.B. mit der Herrichtung u. Nutzung des Kredenbacher Hüttenmeisterhauses für ein derartiges „Kreis Bildarchiv“ , inkl. Digital-Foto Bestand mit möglichst einfachem PC-Zugang für das interessierte Publikum, ohne abschreckende Gebührenforderungen ???
Kommentar von Günter Dick, Sankt Augustin
Zur Präzisierung; Hier geht es offenkundig um den Erhalt der Fotokunst (!). Ein solches regionales Archiv hat bisher noch nicht bestanden.
Pingback: Sieger des siwiarchiv-Sommerrätsel 2019 | siwiarchiv.de
Die Pressemitteilung wurde auch in einem Marburger Anzeigenblatt veröffentlicht. Ich hoffe, dass damit das Interessen von zumindest ein paar Leser*innen geweckt wurde. :-)
„Alter Kämpfer“ = Mitgliedsnummer unter 100.000, darüber und vor 1933 beigetreten = „Alter Parteigenosse; Mitgl.-Nr. von Pfeifer = 1.009.574.
Wehmeier war zu diesem Zeitpunkt Deutscher Christ, also einer der NS-Anhänger unter den Siegerländer Pfarrern und kein irgendwie Oppositioneller.
Die Links Bertha Levi und Theresa Dornseiffer im text oben sind fehlerhaft
Links funktionieren wieder.
Danke für den Hinweis! Ist, soweit ich es sehe ein Problem des Aktiven Gedenkbuches …..
Armin Laschet, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen zum Haus der Landesgeschichte NRW, in einem Interview mit Christiane Hofmanns für die WELT am Sonntag, 14.7.2019:
“ …. WELT: Sie sprechen von 1700 Jahren jüdischer Geschichte in Nordrhein-Westfalen. Damals gab es das Bundesland noch gar nicht.
Laschet: Das neue Staatsgebilde Nordrhein-Westfalen wurde erst 1946 gegründet. Aber das Land, seine historischen Regionen, die Rheinprovinz, Westfalen und Lippe, haben eine bedeutend längere Geschichte. Jeder, der den Kölner Dom, Schloss Augustusburg oder Kloster Corvey anschaut, wer Musik von Beethoven oder Offenbach hört, wer Texte von Heinrich Heine, Friedrich Engels oder Annette von Droste-Hülshoff liest, weiß das. Ich finde es geradezu unentbehrlich, die geschichtlichen Wurzeln unseres Landes vor 1946 aufzuzeigen.
WELT: Wie wollen Sie in einer eher geschichtsvergessenen Zeit dieses Bewusstsein stärken?
Laschet: Insgesamt wollen wir das Geschichtsbewusstsein stärken. Für die Historie von Nordrhein-Westfalen wird es ein Haus der Landesgeschichte geben. Die Aufgabe dieses Museums soll sein, die Identität und das Selbstbewusstsein unseres Landes zu stärken. Wir müssen lernen, dass auch unser Land ein großes historisches Erbe hat.
WELT: Mit welchem Ziel?
Laschet: An der jüngeren Kulturgeschichte Nordrhein-Westfalens lässt sich etwa gut aufzeigen, dass die Künste auch zu einer Entwicklung zu einer liberalen Gesellschaft beitragen. Künstler wie Joseph Beuys, Pina Bausch und Karlheinz Stockhausen haben nicht nur die internationale Kultur geprägt, sondern auch Vorstellungen von Freiheit und Toleranz mitgestaltet.
….“
Link: https://www.welt.de/regionales/nrw/article196787547/Armin-Laschet-Wir-sollten-uns-nicht-verstecken.html
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 19.7.2019 – 31.7.2019 | siwiarchiv.de
Wenn Karl Reuter im März 1943 nach Warstein verlegt worden ist, kann er dort nicht 2 Jahre vorher am 17.3.1941 ermordet worden sein. Welche Jahresangabe muss geändert werden?
Die Verleihungen standen wohl unter keinem guten Stern. Einer missverständlichen Pressemitteilung folgte dies: “ …. Ursprünglich sollte zudem noch der Stein von Bertha Levi ersetzt werden, der im Winter durch einen Schneepflug versehentlich zerstört worden war. Da es dabei allerdings eine Namensverwechslung gab, muss dieser Stein vom Künstler Gunter Demnig nun erst nochmal neu angefertigt werden. ….“ (Quelle: Radio Siegen, 1.8.2019, 13:45)
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik Juli 2019 | siwiarchiv.de
Es ist jedesmal für mich ergreifend, wenn ich auf einen Soldatenfriedhof komme. Auf dem Futa-Paß bin ich auch schon gewesen, bei Neapel ist auch einer und am Gardasee, dann am Hartmannsweiler Kopf, . Es muß unserer Jugend begreiflich gemacht werden, daß es nie wieder Krieg geben darf.
Eine Anfrage an das Bundesarchiv Berlin ergab folgendes Ergebnis. Dort liegt im Bestand Slg BDC eine Karteikarte des NSLB zu Josef Kloth vor.
Demnach ist Kloth am 1.8.1933 dem NSLB (Ortsgruppe Hammerhütte, Kreis Siegen-Stadt, Mitgliedsnr. 233.507) beigetreten.Zuvor war er im Deutschen Philologenverband organisert.Kloth wohnt zu diesem Zeitpunkt am Marburgertor 17 in Siegen.
Ferner geht aus der Karte hervor, dass Kloth Luftschutzobmann war.
Lipperheide-Erwähnungen in der „Bibliographie zu Kleidung und Mode“ (Prof. Dr. Jutta Beder, Universität Paderborn, redaktionell überarbeitete und korrigierte Fassung 2019):
– Nienholdt, Eva: Katalog der Lipperheideschen Kostümbibliothek. Berlin 1965 (2. neubearb. Aufl.).
– Pflug, H. (Hrsg.): Antike Helme. Sammlung Lipperheide und andere Bestände des Antikenmuseums Berlin. In: Monographien des Römisch‐Germanischen Zentralmuseums 14. Mainz 1988.
– Rasche, Adelheid: Frieda Lipperheide 1840 ‐ 1896. Ein Leben für Textilkunst und Mode im 19. Jahrhundert Potsdam 1999.
– Rasche, Adelheid (Hrsg.): Varieté und Revue. Der Kostümbildner und Kostümsammler William Budzinski 1875 ‐ 1950. (Ausstellungs‐ und Sammlungskatalog der Kunstbibliothek, Lipperheidesche Kostümbibliothek). Berlin 1999.
– Frühe Modefotographie. Pariser Ateliers in der Lipperheideschen Kostümbibliothek. (Begleitheft zur gleichnamigen Ausstellung in der Kunstbibliothek). 1994.
– Wagner, Gretel (Hrsg.): Mode in alten Photographien: eine Bildersammlung. (Aus dem Besitz des Lipperheideschen Kostümbibliothek in der Kunstbibliothek der Stiftung Preußischer Kulturbesitz). Berlin 1979.
– Rasche, Adelheid (Hrsg.): Die Kultur der Kleider. Zum hundertjährigen Bestehen der Lipperheideschen Kostümbibliothek. Berlin 1999.
– Mit dem Buche tantzen. Die tanzgeschichtlichen Bestände vom 15. bis zum 18. Jahrhundert in der Lipperheideschen Kostümbibliothek. 1989.
Für einen Berufsstand war die neue Ordnung keinSeegen!!!
Die güldene Jahnordnung,und der Kampf der Rödger und Wilnsdorfer Pfarrer gegen diese Einführrung, und (ihre) angedrohte Klage bei der Reichsritterschaft.
Aus über 80 Seiten bestehen Schreiben in Münster , Fstthm.Oranien- Nassau 1A Nr.68 von1775-1781
Es handelt sich um einen regen Briefverkehr von Landräthen und Räthen der Regierungen in Dillenburg und Siegen über die Nutzung eines kleinen Grundstücks , irgendwo im Grenzgebiet des Wildebaches,aber im Stammland der Wilnsdorfer Ritterschaft.
Acte, die Rödger und Wilnsdorfer Pfarr- Hauberge betreffend.
„Es ist mit Genehmigung Fürstlicher Landesregierung nun hieraus verfügt worden, daß die Hauberge im Siegenischen nach der durch den Erfahrung bewährt gefundenen Verordnung der Naßau Katzenellnbogischen Policey Ordnung durchgehends in 16 Jähne oder Haue eingetheilet werden sollten. Man hat auch solches sowohl in Ansehung der herrschaftlichen als privat Hauberge zur Ausführung zu bringen.
Es legen die Pastoren Emmelius Rödgen und Gänsler Wilnsdorf in Ansehung der Willnsdorfer Pfarr Hauberge aus diesem Grunde Wiederspruch (ein) weil solches der Pfarrey nachteilig sei. Und es nicht zu leugnen daß die jetzigen Pfarrer dabei einigen Verlust leiden können“
So heißt die Antwort der fürstl Rentkammer vom 7. März 1775.betreffend der Rödger und
Wilnsdorfer Waldgrundstücke die in der Gemarkung Wilnsdorf liegen , oder besser liegen sollten, denn ein noch immer dort währender Grenzstreit, der1597 begann und 1612 eigentlich Bereinigt werden sollte, war in dem Niederwald wo daß kleine , gemeinsame Pfarrgrundstück lag, nahe der Mittelwildener Mark, immer noch nicht endgültig geklärt.
.Da daß „Pfarrstück“ unmittelbar neben dem „Herrn- Stück“ lag, darf man davon ausgehen, daß beide Grundstücke gewiß einst dem Adel gehörten und zur einer Wirtschaftsfläche eines der vergangenen Höfe im die verstreut im Wildetal lagen.
„Hauberg- Rebellen“
Da der evangelische Pastor Victor Emmelius, der den vereinigten Kirchspielen Rödgen und Wilnsdorf vorstand und auf Rödgen wohnte, nannte man ihn deshalb „den Rödger“ Er war von 1770 bis 1798 der Prediger in der evangelischen Vereinigung.
Dieser Zusammenschluß war eine Verordnung des Landesherren gewesen und galt auch so für die catholische Christen die ihre Zusammenlegung Wilnsdorf –Rödgen nannten. Seit 1769 war Pfarrer Michael Gensler ihr Seelsorger und wohnte bis 1776 im Wilnsdorfer Pfarrhaus, und so wurde er und die Nachfolger “ der Wilnsdorfer“ genannt.
Es ist aber noch ein weiterer Prediger zu nennen:Der ehemalige Jesuit Antonius Schnack, welcher1777 der cathol Gemeinde vorsteht, aber schon1780 nach Rotzenhahn im Oberwesterwald versetzt wird; Anlaß war gewiß seine Äußerrung wegen dem 16 jährigen Haubergumtrieb, der nun auch auf dem gemeinsamen Pfarr grundstück schon längst eingeführt werden sollte.
Es handelte sich um ein abseits gelegenes Waldgrundstück ,welches die Seelsorger und ihre Vorgänger in deren Bearbeitung des Kornabaues als ihre zusätzliche Jährliche Einahmequelle sahen, verbunden mit ihrem doch kargen Lohn, der immer noch in Naturalien bestand.
Noch heute besteht mitten im Staatswald bei Niederdielfen ein„simultanes Wald-Stück“ in einem Hochwald.
In Steine gesetzt ist auch„der Pfarrwald in der Breiten-bach“, was der evangelischen Gemeinde alleine gehört; ein Zugangsweg fehlt hier noch heute ebenso, wie zuvor zu allen gemeinsamen Grundstücken beider Konfessionen.
An den consoliedirten Haubergen in Wilnsdorf hatten die beiden Kirchengemeinden ebenfalls einen festgelegten Anteil, der nach einem „Schlüssel“ aufgeteilt, entsprechende Gelder zugute kamen. In den Jahren 1790-1808 ist eine Akte von über 200 Seiten angelegt worden, die weiteren Aufschluß über diese Einahmen in Wilnsdorf gibt.
So auch die Streitigkeiten wegen der Pfarreinkünfte in den beiden Kirchengemeinden, aus den Jahren 1744-1761.
Jahnordnung für ein Waldfeld
Am 11.1.1775 erschienen die Ehrn Pastores Emmelius und Gänsler, Oberförsterrey Assistent
Klein, Förster Stein von Willnsdorf, Forstjäger Opperman zu Wilgersdorf, von Seiten der Gemeinde Willnsdorf Heimberger Schütz, Johannes Euteneuer und Johann Jost Fries.
Amtsvogt Hofmann von Burbach hatte einen Vorschlag verlesen, nachdem er die betroffenen
Geistlichen verhört hatte, daß Diese, die ihnen vorgeschlagene Einrichtung(Jahnordnung), für
Nachteilig ihr Grundstück hielten, und dieses Stück Feld privat für die Pfarrer gelassen worden sei, ohne sie in die eine Hauverordnung einzubeziehen, da dies nicht machbar wäre
„Die Forstbediensten erklärten hierauf, wie dieser Vorschlag allerdings der Pfarr zum Vorteil gereiche, und auch die Pfarr zu Burbach völlig dabei entschädigt würde, gestaltend dieselbe soviel von Wilnsdorf erhielte, als zur ihrer Entschädigung erforderlich seyn.“
Die Wilnsdorfer Comparenten(Bezeugenden)ließen sich vernehmen, wenn keine andere Einrichtung in den Haubergen getroffen werde,(Hauordnung) würde ihrer Gemarkung dadurch ein Unersätzlicher Schaden entstehen. Unterzeichnet hatte dies Mitteilung Amtmann Bude von Burbach.
Siegen, Burbach, Hachenburg
Wo lag dieses Pfarrgrundstück? In der sehr Gut angefertigten Flurkarte von Wilnsdorf,
ein Anhang im Buch Wilnsdorf von Franz Dango, kann man dies Gebiet versuchen einzuordnen, kennt man den 1776 angefertigten Riß von Ruben Will. Auch in den verschiedensten ausgetauschten Schreiben der Amtleute und Bürger geben Hinweis auf den Ort, vor allem aber ein Grenzgang.
Aber auch eine Acte wo steht: Amtsvogt Hoffman, soll sich mit den Einwohnern auf den Layen Hain begeben, oder: haben die (Mittelwildener) Pfarrdienstleute auf dem Layen Hayn nahe dem Wildebach……….
Oder in einer Mitteilung:“Kann Ruben Will das Stück am Baudenberg nicht hauen“.
Am 3.51776 erschienen Johann Ruben Will von Wilnsdorf und gab an:“Daß er mit 3 anderen Consorten ein Stück Hauberg auf dem Layen Hain ,dieseits des Wildbach, so zur Pfarr zum Rödgen gehörte gegen Abgabung jährlicher Zinse besäße. Der Johann Martin Schneider und
Hermann Reichmann von der mittelsten Wilde ,die andere Halbscheid dieses Waldstückes ,so an die Pfarre zu Willnsdorf zinßbar seyn.Jener Besitz hätte übrigens aber beyde Stücke dieseits des Wildbach gelegen, hingegen aber demnach dieses Teritorium zwischen Hachenburg, Dillenburg und Siegen bisherr strittig gewesen sayn.“
So ist die Lage des Simultanen Grundstückes beschrieben , über deren Nutzung eigentlich sich die derzeitigen Inhaber einig waren und„friedlich Vereinten“ Da daß ganze Waldgebiet aber dem Huderecht unterstand, und dieses über die dort nicht vermessene Landesgrenze hinaus galt, entstanden darum aus den Freiengründer und Burbacher Bewohner viele Klagen
„im Niemandsland“
Bisher war bekannt das dort 1761 gehakt worden ist und man Heidloff gesät hatte und dieses auf diesem Grundstück mehrere Jahre .1773 hatte dort schon wieder das Haubergs- Korn gestanden. Der Niederwald ist also 3-4 Jahre zu früh gehauen worden .
Man hatte immer per Los entschieden welches die evangelische oder katholische Seite werden sollte. Man wollte und konnte mit der Tradition der schon immer geschehenen Feldarbeit mitten im Wald nicht brechen, vor allem fehlte die Feldfrucht im Pastorenhaushalt.
1776 ist Pfarrer Gänsler aber schon nicht mehr in Dienst;er ist nun Seelsorger in Rennerod.
Grenzgrundstück
„1761 Erschienen wir Vorsteher aus dieser gemeinte Ober und Mittel Wilden Johannes Schnell und Johann Eberth Jung zur Mittel Wilden daß der Ruben Will von Wilnß Dorff
kläg:wegen der Erben der mittleren Wilde daß Stücke auf dem Layen Hayn daß“ Herrn Stück“ ist obig Her, über dem Pfarrstück, daß ich aber vor 2 Jahren gehauen,,,,,,,,,“
Um die Zusammenlegung des Pfarr Stück und des Herrnstück das den Wilnsdorfer Erben gehört ,zu einer Schaar, Hau, oder Jahn darum geht es eigentlich, und um eine ordentliche “Huthbarmachung und Einfriedung“ , im Gebiet des „Drei Länder Ecks“ , ein zukünftiger Viehtrieb dort würde die Landesgrenze überschreiten.
Foppen der Bediensteten
In einem ausführlichen Brief 1775 der „Mittel Wildener Pfarrzinsleute „an die fürstliche Landesregierung schildern sie ihren Streit mit ihrem Rödger Kollegen Ruben Will,aus Wilnsdorf mit den sie ja den evangelischen Glauben gemeinsam haben, um das „Herrn-und Pfarrstück“
In einem anderen Schreiben heißt es: Der RubenWill hätte gelästert solange die Wildener ihn zum Grundstück mal hier mal da herfahren ließen. Noch nicht mal eine Fuhrt war vorhanden,
sie Ihn(Will) keinen Tritt durch den Wiesengrund machen lassen, bald hier mal da nach ihrem Gefallen den(Wilnsdorfer) Erben und ihm zu gestatten, daß Land betreten.
Auch der Landrath Trainer aus Siegen wird eingeschaltet, der Ruben Will zu seinen Amtsitz nach Siegen einbestellt. Dieser bestätigt seine willkürliche Bearbeitung. Mal hatte er Wald stehen lassen, mal mit Heidloff nach erfolgten Hauen beflanzt, gerade welches Gebiet nach
Losentscheid er zugesprochen bekam.
Zu Will ist zu sagen daß er ein Modell anfertigte. Der ehemalige Wilgersdorfer Schulmeister und jetziger Schreinermeister hat die vorliegende Karte doch recht schön gezeichnet.
Und so heißt es in der Will´schen Beschreibung des Bergwaldes:“ Auf dem Layen Hain, daß Willnsdorfer Pfarrstück genannt wie auch den Wilnsdorfer Erben gehörende Herrenstück.“
Am 17.10.1776 bekommt der Heimberger Reinschmidt zu Unterwilden vom Amt Burbach ein Schreiben. Er soll auf Kosten der Erben des herrschaftlichen Waldes, Feldmesser Erdmann veranlassen einen Riß anzufertigen wo dieses „Zankgebiet“sich befindet.
Erbauung der Wilnsdorfer Pfarrscheune in Wilnsdorf
3 Jahre im Amt ist nun Jesuit Anthon Schnack, zeitlicher catholischer Pastor zu Wilnsdorf;er läßt in seiner kurzen Anwesenheit Zeit eine 2 stöckige Scheune neue errichten, die vorherige hatte er in einem erbärmlichen Zustand angetroffen.
Holz dafür ist im gemeinsamen Pfarrwald auf dem „Höh wäldchen“ genug vorhanden. Aber es ist in der kurzen Amtszeit Schnack´s dort, wie auch in den Rödger Wäldern mal zu einem argen„Verwandtenstreit“ gekommen , den er der Landes Regierrung schildert. Wie er entäuscht ist über den zuvor liebenswerten Pfarrkollegen . 1780 ist er nach Rotzenhahn versetzt worden, gewiß über ein Tun in der Pfarrstückangelegenheit, was den studierten Amtleuten nun so gar nicht paste.
Eintracht aber herrschte bei den amtierende Seelsorger mit dem „Pfarrberg“ und seiner jährlichen Nutzung. Barsche Briefe wurden Beiden zugestellt, und unter anderem empfohlen ,sich in eine besser zahlende Gemeinde nach ihrer abgelaufenden Amtzeit versetzen zu lassen, denn von einer Pfarrbesoldung aus dem Pfarrvermögen eines Hauberges ist den beteiligten Beamten bisher noch nichts bekannt geworden, sie kannten nur die Stolgebühren, weiteres zu ihrer Besoldung war ihnen völlig unbekannt.
Seelsorger mit Hochschulabschluß
Im Juli 1779 hat das fürstliche Cosistorium in Dillenburg mittgeteilt:
Den Schaden haben die dermaligen Prediger selbst zu Tragen wegen dem Pfarr-Hauberg, und dem damit verbundenem Herrenhauberg und eine Regelung für ihre Nachfolger zu treffen ,für daß gemeine Wohl.
Gerügt wird ihr Protestieren gegen eine Neue Jahnordnung im Streitgebiet.
.“Beide Prediger sind noch nicht im mahl im Stande auf Fragen eine Anworth zu geben“
Pagenstecher Dillenburg, hatte Unterzeichnet.
Gewiß erbost schreibt Anthon Schnack zeitl. Kathol. Pastor zu Willnsdorf und Rötgen am 12.4.1780 an die hochfürstliche Landes Regierung und so direkt an den Landesfürsten und beschwert sich über den Verlust der zeitlichen Pastoren am gemeinsamen Kirchengut. Er zweifelt die Zuständigkeit des fürstlichen Forstamt an, und verweist darauf, es seien einstige Ritterschaftlichen Güther,( der Herren von Wilnsdorf Eigentum gewesen) und man solle diese ihre hergebrachte Arbeitsweise dort so zu belassen, wie diese vorgefunden wurden, „da sie weder Holz noch Kohle verkaufen können, also keinen Kreutzer Geld (dort so erwirtschaften)“
Nun beginnt ein reges Schreiben der Ämter. „Wie Kühn und unbefugt der Schnack die gemein-same Einrichtung vertritt“ Es heißt daß der Rödger (Emmelius) an dem Unfug
“darin keinen Teil hat“, die Reichsritterschaft in Nachfolge und Zuständigkeit ehemaliger Adelsgüter, so auch wegen „daß Herrenstück“; anzurufen. „Man muß ihn in die Schranken des Respekt verweisen“!!!
Schnack wird im May nach Siegen zitiert und Entschuldigt sich dort und führt an“ das er geglaubt hat, für die Hauberge sei das zuständige Forstamt, nicht aber die fürstliche Rentkammer, die mit Genehmigung Fürstlicher Landesregierung ersucht werden müßte, in dieserPfarrberg Angelegenheit“
Von da an hört man nichts mehr von dem Jesuiten Pfarrer, den es in die beiden kleinen armen vereinigten catholische Kirchspiele hinter der Kalteiche“,verschlagen hatte“
„eineStunde lang, eine halbe Stunde breit“
Im May Anfang 1781 wird nun wieder ein reger Schriftverkehr begonnen wegen ,der 16 jährigen Jahnordnung „Bey der auf Siegenischen Hoheit gelegenen Haubergen in der Gemeinde Willnsdorf.“ Die Grenze wird angesprochen zwischen dem Fürstenthum Siegen und den gemeinschaftlichen Grund Seel und Burbach, auch die strittigen an der Wildebach und dem Höhenweg,der noch nicht berichtigt ist.Schon 1768 und 1769 hatte dort der Littfelder Bergmeister Jung begonnen, die herrschaftlichen Lehngüter dort an der streitigen Grenze zu vermessen, er aber wegen seines hohen Alters*1711+1786 solch eine Zeichnung nicht mehr zustande gebracht hatte,
und wegen der hohen Kosten “daran nichts verdient habe“
Es ging auch um die Gerichtsbarkeit dort im Niemandsland, oder Discrict:“In der Längen -aussmessung beträgt er1 ½ Stunden und in der größten Breite 1/2 Std „Wegen der großen Landmasse, ein Stück von ziemlichen Belang. Hier hat Oberwilden ein Theil, sowohl Mittelwilden nebst Mahlmühle und die strittigen Erblehngüter und die Hauberge zuWillnsdorf nebst gleichen Theils der Gemeinden Oberwilden und Wirgendorf, Pfarreyen zum Rödgen, Willnsdorf, Burbach und Neunkirchen, die allen Aufgeführten zustehen.
Scheppe Seite
Wegen, dem Wegebau hat die dortigen Haubergsgemeinschaft an der „Scheppen Seite“ auf dem Weg von Wilnsdorf nach Burbach gehend eine Heidenstock gepflanzt, der von der freyengründer Seite umgehauen wurde und den dort auch zwischen Wilnsdorf und Oberwilden Tod aufgefunden Mann sich bemächtigt, und in den Freyen Grund gebracht hat.
Die Mittelwildener Mahlmühlen Erben, deren Mühle unmittelbar dieseitig der streitige Berg -gegend liegt gibt der Siegener Rentei jährliche Pacht.6Malter Kornabgaben, auch jährlich für ein Mühlenschwein10 Fl.15 alb. Gehben müssen Die Gemeinschaftliche Landes Herrschaften Seel und Burbach aber nichts darüber berichtet werden. (Es war die Wilnsdorfer Bannmühle)
Jeder Pfeil der Jagd von einem Jäger in diesem Gebiet wird als Frevel gewertet, nur unser Förster Stein „darf sich hier bedienen“ So schreibt der Landrat Trainer in Siegen
Grenzbesichtigung
Eine vor Ort vorgenommene Besichtigung soll die strittige Landesgrenze näher bringen.
Siegenischer Grenzgang gegen den gemeinschaftlichen Grund Seel und Burbach
Gegen der alten Stellsteinkaute auf der sogenannten Dautenbach gegen Rinsdorf, von da langs
dem Hilchenbachs Berg und durch das Hilchenbachs Gründchen hinunter bis an die Landstraße,
von da unter der Mittelwildener Mahlmühle her bis an den Mühlengraben, von da langs dem Mühlengraben hinauf bis an Metzlers Rücken oder das sogenannte Hummelnest.
Gränzgang des gemeinschaftlichen Grunds Seel und Burbach gegen Nassau- Siegen
Von der Dautenbach langs den Höhenweg hinauf bis auf die Altenbach an die Landstraße, von da über die Nonfelder unter der Hickenfohr her, hier durch an die Struth, von da langs dem Gosenberg hinauf bis an die Struth, von da langs den Gosenberg hinauf bis an die Ecke des Kalteicher Wald, von da langs den Wald hinunter bis an die Waldwießen, von da bis an den Metzlers Rücken oder das Hummelnest.
Mitten im Wald war die Feldarbeit unerwünscht
Im letzten Schreiben der 87 Seiten füllenden Seiten ,datiert am15.May1781,steht was Nassau-Dillenburg an die Fürstliche Kammer in Siegen mitteilt, heißt es:“In der nun zimlich ruhig und still liegendem Streitsache ist noch keine gemeinschaftliche Commission ernannt worden“
Schon 1777 Hätten sich die Räthe Trainer, Siegen und Hoffmann Dillenburg wegen dem „Pfarrberg“ versucht, in Güte den Streit beizulegen. Nun wollte man den Spezialisten die Grenzfestlegung übergeben, und ein Zustande kommen Vereinbaren. Der Bergmeister Jung soll über den strittigen Ort einen Riß besorgen lassen und über den Erfolg berichten.
So endete der Bericht über, ein kleines, unbekanntes, unwegsames, strittiges Gebiet, wo in einem bestimmten Rhythmus seit seiner Schenkung des ersten Patronatsherren Jahre lang von den neuen Eigentümer durch Los geteilt ,Korn oder Hardloff jedes Jahr ausgesät wurde.
Umgewandelt nach einer amtlichen Verfügung in einen Niederwald sollte daß ehemalige Feld- Stück 1797erstmals geschlagen und wie in einem Hau die weitere Arbeitsweise nach der Jahnordnung fortgeführt werden.
Eckhardt Behrendt, Oberdielfen
Pingback: Nassau-Oranischer Archivzweckbau in Dillenburg | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 1.8. – 13.8.2019 | siwiarchiv.de
1712 bereits wurde ein Archivzweckbau in Hannover errichtet. Danke für den Hinweis via Facebook nach Aurich!
Pingback: Jahresbericht 2018 des Landesarchivs NRW erschienen | siwiarchiv.de
Das soll quasi eigentlich keiner lesen oder? Heutzutage kann es eigentlich keinen anderen Grund mehr geben, sowas nicht online zu stellen. Es würde mich zwar interessieren aber nicht so sehr, dass ich es bestelle und Bäume dafür gefällt werden. Das Ding liegt ja digital vor, bevor es an die Druckerei geht.
Pingback: Wilnsdorf: Unterirdische Maschinenhalle kommt ans Licht | siwiarchiv.de
HoHoHooooo … wie albern. Der Tenor des geläufigen Meinungsdiktats hat sich in den Phrasen um Sascha Maurer und unzählige weitere Denunziationen via Medien-Spektrum, einen weiteren Bärendienst erwiesen: Die Anzahl von „Blindlingen“, die gemäß der erwünschten Medienhörigkeit, jeden offerierten „Dünnschiss“ geruchs- und geschmacksfrei inhalieren, durchkauen und runterschlucken, ist längst dem Wunschdenken der vermeintlichen Meinungslenker beizuordnen. Das diese Tatsache zu den bittersten „Pillen“ der manipulierenden Tenöre gehört, dürfte sich bislang über den Tellerrand herum gesprochen haben.
Pingback: Führung durch die Stahlarbeiter-Siedung Wenscht | siwiarchiv.de
Die Bildhauerin Gertrud Vogd-Giebeler lebt heute in Berlin.
Pingback: Literaturhinweis zur regionalen, kolonialen Geschichte | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 14.8. – 26.8.2019 | siwiarchiv.de
der link zur wp hilft leider nicht weiter, wenn man kein wp-abonnent ist.
ausstellungszeitraum und ggf. eigene website des veranstalters wären hier besser.
Danke für den Hinweis! Link wird hiermit gerne nachgeliefert: https://hexenwahn-laasphe.aspritos.de/
Pingback: Richtfest am Haus Stöcker im LWL-Freilichtmuseum Detmold | siwiarchiv.de
Das Haus stand nahe am “ Kleffweiher“ in Burgholdinghausen, auf dem ich als Kind Schlittschuhlaufen konnte. Es war mir ein vertrauter Anblick, und ich bin froh, daß es jetzt einen Platz im Freilichtmuseum Detmold gefunden hat. Es ist für mich ein Stück Heimat.Zu Beginn der 50er Jahre durfte ich als Schuljunge meinen Vater, den letzten Schmiedemeister in Littfeld, begleiten, wenn im Nachbarhaus wieder mal Pferde beschlagen und den Kühen die Klauen geschnitten werden mußten. Ein Besuch bei Stöckers gehörte dazu.
Danke für diese Erinnerung!
Pingback: Wittgenstein 2/2019 erschienen | siwiarchiv.de
Pingback: 100 Jahre Bauhaus – und auch in der Gemeinde Burbach wird gefeiert! | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik August 2019 | siwiarchiv.de
Pingback: Lehrer*innen zwischen 1933 bis 1945 im Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein – eine Überarbeitung. | siwiarchiv.de
Pingback: Lehrer*innen zwischen 1933 bis 1945 im Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein – eine Überarbeitung. | siwiarchiv.de
Pingback: Lehrer*innen zwischen 1933 bis 1945 im Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein – eine Überarbeitung. | siwiarchiv.de
Pingback: Lehrer*innen zwischen 1933 bis 1945 im Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein – eine Überarbeitung. | siwiarchiv.de
Die Hamburger Landeszentrale für politische Bildung hat Lehrer*innenbiographien bereits veröffentlicht:
– Hans-Peter de Lorent: Täterprofile. Die Verantwortlichen im Hamburger Bildungswesen unterm Hakenkreuz. Band 1, Hamburg 2016,
Download Täterprofile (6,8MB, 808 Seiten)
– Hans-Peter de Lorent: Täterprofile. Die Verantwortlichen im Hamburger Bildungswesen unterm Hakenkreuz und in der Zeit nach 1945. Band 2, Hamburg 2017, Download Täterprofile, Band 2 (13,6MB, 868 Seiten)
– Hans-Peter de Lorent: Täterprofile. Die Verantwortlichen im Hamburger Bildungswesen unterm Hakenkreuz und die Kontinuität bis in die Zeit nach 1945. Band 3, Hamburg 2019, Download Taeterprofile Band 3 (ca. 11 MB, 1024 Seiten)
Weitere regionale Litaratur:
Lehrer und Schule im Jahre 1933 : Dokumente, Kommentare / Klaus Klattenhoff, Friedrich Wißman
Oldenburg : Universität Oldenburg, Zentrum für pädagogische Berufspraxis, 1985
= Unter der Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus / Günter Heuzeroth ; Bd. 5
ISBN 3-8142-0134-5
Volksschullehrer und Nationalsozialismus : Oldenburgischer Landeslehrerverein und Nationalsozialistischer Lehrerbund in den Jahren der politischen und wirtschaftlichen Krise 1930 – 1933 / Hilke Günther-Arndt
Oldenburg : Holzberg, 1983
= Oldenburger Studien 24
ISBN 3-87358-180-9
Nationalsozialismus und Volksschule – Ostfriesland in der Umbruchphase des Jahres 1933 : schriftliche Hausarbeit für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen / Schweinsberg-Dette, Jutta
[Leer 1985]
Ein großes Kompliment für diese Brevier – vor allem die Geschichten aus meiner Heimat sind spannend und zugleich mit Humor bestückt, Gratulation für diese Mischung.
Wie würden Sie meinen Vorschlag „Veröffentlichung im Internet“ bewerten ??
Gerne von Ihnen zu hören.
Mit freundlichem Gruß
Hans-Peter Hüttenhain
Nach längerem Krankenhaus Aufenthalt mit Reha usw bin ich wieder da.
Es geht sich immer noch um meine Exponate bz. Bider von Jung – Dörfler.
Hast Du vielecht Interesse.
Zur Zeit käme nur eine Veröffentlichung auf der Homepage des
Herausgebers, der ARGE Freudenberger Heimatvereine in Betracht.
wenn am Krönchen beider Aufführung des „Klubbrandes“ ein Turmwächter erscheinen sollte ja dann ist etwas falsch gelaufen. Hoffentlich nicht!
Habe so auf Facebook immer diese Überschrift gewählt was die Gemeinde angeht.
50 Jahre Gemeinde Wilnsdorf
Sonntag am 8.9.019 Tag der offenen Tür
Ehrlich, wer war schon im Inneren unser Kappelenschule,dem Einod Oberdielfens
1910 während den Schulferien eingebaut ist nun eine Blechdecke eingebaut wiorden, aber nicht iergendeine, nein, so etwas einmalieges muß man gesehen haben
Als der Heimatverein m Mai 1984 gegründete wurde sagte unser erstes Ehrenmitglied Gerhard Daub, bei der ersten Zusammenkunft im Schulraum, das über dem Heraklit eine Stuckdecke sich befindet. Dem nachgegangen sah ich Sie, fühlte und kam zu der Erkemnntniss .das dies Blech sein mußte. Jahre später konnte ich auch das Datum der Instalation erfahren. Bis Heute geht es weiter mit Forschung, wer der Hersteller war. In dieser Zeit nach 19hundert „fand die Blechpest “ ihren Einzug in Wand und Dachabdeckung der Häuser, die der gegründete Heimatverein des Siegerlandes hart bekämpfte, da so etwas nicht ins Landschaftsbild passte.
von 13Uhr bis 1700 ist sie zu besichtigen
Nun die Einladung mit Beschreibung der Gemeinde Wilnsdorf.
1821 erbaut. Eingeschossiges Gebäude in riegellosem Eichenfachwerk. Turm mit geschweiftem, achteckigem Helm. Früher Unterricht im anschließenden Raum, heute Tagungsraum. 1997 wurde eine Blechdecke mit kreisförmigen Mustern entdeckt, die vermutlich um 1924 eingebaut wurde. Diese wurde restauriert und ist heute wieder sichtbar.
Woher diese Daten stammen?
in der offiziellen Vorstellung der Gemeinde heißt es 1911 Decke und 1935 eine Heraklitdecke eingezogen und so konnte man die Decke nicht mehr sehen. Nun dor war der NSVKindergarten zu der zeit und Heraklit, den gab es nicht und in den 60iger Jahren wurde die Kapellenschule damit ausgestattet
4!!!! Familien!!!!fanden in den einem Raum nach 45 dort Platz, dementsprechend abgeteilt wurde auf die feine Decke wegen den Befestigungen keine Rücksicht genommen sowie nach dem Abhängen und befeszigen derHeraklitplatten.Ich habe neugierig kuz nach Gründung desHV mal eine vorsichtig abgenommen und gesehen das wunderbare Stuckwerk mit meinem Ergebniss :Ds muß Blech sein.Geforscht das datum der Installation kam ich auf Winterferien 1910. Forsche übriegens noch weiter und fand eine Darstellung über die Blechpest im Siegerland,Eine Geschichte die ich gerne hier mal an Bildern gerne aufzeigen würde.
Bild könnte enthalten: Einfamilienhaus, Himmel und im Freien
und erschrekt Gestern was noch in Wilnsdorf geschiehtZeitreisende in Arrestzelle – Wilnsdorfer Komödienstadl oder historisches Bewusstsein?
Am Tag des Denkmals sollen am 8.09.2019 im Arrestgebäude in Wilnsdorf „Verhaftungen“ durch die „Interessengemeinschaft Polizei in der Weimarer Republik“ authentisch dargestellt werden. Der Besucher kann sich von der Darstellergruppe „verhaften“ und „einbuchten“ lassen. Wer so etwas braucht um sich in diese Weimarer Zeit zurückversetzen zu lassen ok, dann sollte er aber auch wissen, dass im „Arrest“ ab 1933 andersdenkende inhaftiert und gepeinigt wurden.
Ferdinand Heupel wurde aufgrund seiner Haltung und Äußerungen gegenüber der NSDAP von SA- Männern am 30.06.1933in Wilnsdorf festgenommen und nach dem Verhör im Arresthaus inhaftiert.
Diese Aufnahmestammt vom 21.07.1933 (drei Wochen später!). Zahlreiche Blutergüsse sind noch zu erkennen. Nachdem die SA Ferdinand Heupel „verhört“ hatte, waren auf Grund der Verletzungen einige Finger steif geblieben, so dass er den Beruf des Schneidermeisters aufgeben musste.
Eckhardt Behrendt Ja , das tut dann Weh und ist für mich ein ganz Neuer Aspekt und gilt Anzuzeigen. Meine Überlieferrungen aus „dem Rest“ und der habe ich eigentlich viele , aber nie aufgeschrieben gingen immer harmlos aus.
Gefällt mir
· Antworten · 13 Std.
Eckhardt Behrendt
Eckhardt Behrendt Ob zu Spät, ich würde die Sache stoppen und ja, wünschen das da Verständniß besteht.Immer wieder kommt Neues zu Tage(lieber Bergmann) und oft muß Geschichte ergänzt werden, wie nun in diesem Fall.Übriegens, habe nie von ich weiß was. geäussert wenn ch…Mehr anzeigen
Gefällt mir
· Antworten · 13 Std.
Eckhardt Behrendt
Eckhardt Behrendt Habe gerade alles gelesen und die Aufführrungen wären Klamauk
Gefällt mir
· Antworten · 13 Std.
Eckhardt Behrendt
Eckhardt Behrendt Die Bürgermeisterin wäre gewiß dankbar wüsste sie etwasIst ja so als in „DerPlötze“ etwas ablief.
Gefällt mir
· Antworten · 13 Std.
Karl Heupel
Karl Heupel Am 11.09.2009 stand dies auf der Homepage der Gemeinde Wilnsdorf: „120 Jahre lang, zwischen 1839 und 1959, kamen kleine und große „Bösewichte“für kurze Zeit in den Genuss eines Aufenthaltes im „Räst“, bevor sie zu ihrer Aburteilung nach Siegen überstel…Mehr anzeigen
Gefällt mir
· Antworten · 12 Std.
Karl Heupel
Karl Heupel Auszug aus der Homepage Gemeinde Wilnsdorf 7.9.2019: „120 Jahre lang, zwischen 1839 und 1959, wurden große und kleine „Bösewichte“, aber auch Verfolgte des NS-Regimes und einmal sogar zwei britische Bomberpiloten, für kurze Zeit im „Räst“ untergebracht und anschließend der Staatsanwaltschaft in Siegen überstellt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg….“
Gefällt mir
· Antworten · 11 Std.
Eckhardt Behrendt
Kommentieren …
Pingback: Internationale Tagung zum Altarbild “Kreuzabnahme” von Peter Paul Rubens | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 27.8. – 8.9.2019 | siwiarchiv.de
Pingback: Landhaus Ilse am Tag des offenen Denkmals 2019 | siwiarchiv.de
Nun, dann freue ich mich schon jetzt auf die aktuelle Print-Ausgabe.
P.K. schrieb:
Ist die genau Lage der ehemaligen Mühle eigentlich bekannt?
Die Mühle steht nach wie vor in Helgersdorf und ist als solche auch noch zu erkennen.
Bezüglich des Alters werde ich in absehbarer Zeit eine wissenschaftliche Datierung durchführen lassen.
Gerd Müller
Besitzer
Dank an Sie, Herr Müller, für den interessanten Nachtrag! Es ist immer erfreulich, wenn Themen in diesem Blog nicht als Eintagsfliegen verenden, sondern immer mal wieder, und sei es nach 5 Jahren, aufgegriffen werden. Auf die wissenschaftliche Untersuchung der (beneidenswerterweise???) in Ihrem Besitz befindlichen Mühle darf man gespannt sein. Sicher werden Sie das Publikum zu gegebener Zeit an den Ergebnissen teilhaben lassen. Frohes Schaffen! (Gibt es unter Müllern eigentlich auch einen Glück-Wunsch analog zu „Waidmannsheil“ oder „Glückauf“?)
Pingback: Geschichtswerkstatt “Frauen in Kreuztals Stadtgeschichte “ | siwiarchiv.de
Pingback: Tagungsband zum Rostocker Archivtag erschienen | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 9.9. – 21.9.2019 | siwiarchiv.de
Um der Wahrheit Genüge zu tun, sollte erwähnt werden, dass der Genannte lediglich von 2001 bis 2019 Stadtarchivar von Siegen war. Davor amtierte über drei Jahrzehnte der geschätzte Kollege Friedhelm Menk.
Danke für die Richtigstellung! Das passiert, wenn man eine Bildunterschrift bei der Vorbereitung des Eintrages ungeprüft in den Titel übernimmt ……
Zu Wilhelm Hartnack s. dessen Wikipedia-Eintrag als auch dessen Eintrag im regionalen Personenlexikon zum Nationalsozialismus in den Altkreisen Siegen und Wittgenstein . Danke für den Hinweis J.M.!
Pingback: Wer schuf diese Mädchen-Skulptur im Umfeld des Landhauses “Ilse” in Burbach? | siwiarchiv.de
Kuhmichel wäre nicht ausgeschlossen. Dessen kantigen Figuren in der Nazizeit folgten anschließend gerundete fließende Formen.
“Der labile Zustand der Weimarer Republik lässt zu, dass die Nationalsozialisten auch in unserer Region breite Zustimmung finden.”
Natürlich – höhere Gewalt sozusagen. Republikfeindliche Kräfte, die genau diese Labilität auch im Siegerland bewusst und über Jahre hinweg beförderten? Doch nicht bei uns. Man war ja anständig, nicht wahr?
Leute, so wird das nichts mit der Aufarbeitung.
Das Gebäude ist durch die Modernisierungsansprüche der wechselnden Bewohner durchgreifend verändert worden, so dass der Bauhaus-Charakter heute deutlich weniger erkennbar ist.
Ja, leider. Die überlieferten Postkarten zeigen dies sehr deutlich …..
Pingback: Rückblick: 89. Deutscher Archivtag in Suhl | siwiarchiv.de
Die Kausa Klimpel/Metz zeigt, dass in diesem Bereich einfach kaum belastbare Urteile vorliegen. Daher ist das oft „Auslegungssache“.
Stimmt! Allerdings wurde auch in der kommunalarchivischen Fachgruppensitzung auf die Vertauenswürdigkeit als „Markenkern“ (!) der Archive, gemeint war vor allem auf die Rechtmäßigkeit archivischen Handels, rekuriert. Dies bedeutet wohl, solange keine Urteile vorliegen, wird vorsichtig gehandelt werden (müssen). Dies müssen wir als offene Archive allerdings schleunigst unsere Nutzer*innen mitteilen, um nicht wieder in den Ruf zu kommen, alles wegzusperren.
Pingback: Literaturhinweis: B. Fleermann/G.Genger/H. Jakobs/I. Schatzschneide: “Die Toten des Pogroms 1938” | siwiarchiv.de
Das ist bestimmt eine interessante Ausstellung. Vielen Dank für den Tipp. Ich werde die Ausstellung besuchen.
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik September 2019 | siwiarchiv.de
Die Dokumentation erwähnt auf S. 113 auch Siegfried Honi, der am 5.5.1879 in Niedernetphen geboren wurde. Spätestens seit 1905 lebte er in Hausberge an der Porta (heute: Prota Westfalica) und übernahm dort die Metzgerei seines Schwiegervaters. Er starb am 7.4.1939 an den Folgen der schweren Misshandlungen in der Pogromnacht in Hannover.
Pingback: Einweihung Gedenktafel am Siegener Bahnhof | siwiarchiv.de
Pingback: Neues Bauen in Westfalen – Beispiel: Siegen, LYZ | siwiarchiv.de
Pingback: Neues Bauen in Westfalen – Beispiel: Siegen, LYZ | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 22.9. – 4.10.2019 | siwiarchiv.de
Pingback: Tagung: Kriegsfolgenarchivgut | siwiarchiv.de
Karl Born: Ich nehme nicht an, dass es sich hier um den Architekten handelt, würde das aber gerne bestätigt finden: Der Architekt Karl Born (1885 Weidenau – 1951 Frankfurt) entwarf 1919 ein sehr gut ausgestattes, größeres Wohnhaus an der Bismarckstraße 67 in Siegen. 1924 entstand nach seinen Entwürfen eine opulente Villa für einen Prokuristen. Für 1936 wird in „Archthek“, einer wissenschaftlichen Datenbank zur Bau- und Architekturgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts für den deutschsprachigen Raum, ein weiterer, aber ungenannter Bau erwähnt. 1937 folgt dann ein Bauauftrag für Siegen-Weidenau, Austr. 34 – 46, Blech- und Stanzwerk Bertram Müller. 1947 trat in sein Büro der Architekt Aloys Sonntag (1913 – 1979) ein, der 1948/1951 das Architekturbüro als selbstständiger Architekt übernahm, wie im „Blog der Archive im Kreis Siegen-Wittgenstein“ (siwiarchiv.de) nachgewiesen. Das Büro existiert noch heute.
Sehr geehrter Herr Hanke,
leider haben wir, wie oben erwähnt, bisher keine weiteren Informationen zur Person des Karl Born. Das Einwohnerbuch der Stadt Siegen und der Kreise Siegen und Altenkirchen von 1940 weist für den Bereich der Stadt Siegen
zwei mal den Namen Karl Born aus, hinzu kommt der von ihnen angeführte
Architekt in Weidenau in der Bruchstraße 9.
Welcher Karl Born zu den GründerInnen der VVN in Siegen gehörte bleibt vorläufig unbekannt.
Meine Frage wäre in Bezug auf den Architekten Karl Born, ob dieser Gegner oder Verfolgter des Nationalsozialismus war?
Sollten sie weitere Informationen zur Identifizierung bekommen, dann bitten wir um Benachrichtigung, neue Erkenntnisse unserer Seits werden wir hier
auf SiWiArchiv eintsellen.
Mit freundlichen Grüßen
Torsten Thomas, VVN-BdA Siegerland – Wittgenstein
Nachdem ich über im Laufe der Zeit entstandene Personenverzeichnisse zu Parteimitgliedschaften verfüge, schaute ich dort einmal rein, fand aber gerade auch in den Daten zu linken und linksliberalen Persönlichkeiten (Nachlass Popp, DFG-Kartei u. a.) einen Karl Born nicht vor. Aber wie sieht es aus mit Entschädigungsakten?
Bei einem Siegerländer Architekten und Angehörigen der bürgerlichen Mitte ist ja eher nicht von einem NS-Verfolgten auszugehen, vielmehr von einem Unterstützer. Vielleicht ergeben die Hinweise auf August und Marie Born ja Näheres, die das Regionale Lexikon der NS-Akteure und -Begleiter nennt.
M. E. müsste man nun wie folgt vorgehen:
1) Verifizierung des im Internet auffindbaren Geburtsdatum, 5.1.1885 in Weidenau, im Siegener Stadtarchiv
2) Überprüfung der personengeschichtlichen Dokumentationen des Stadtarchivs Siegen, ob dort nicht doch etwas zu Karl Born zu finden ist. Denn Irles Personenlexikon erwähnt den Architekten nicht.
3) Wie oben vorgeschlagen, Überprüfung der Entschädigungsakten im Landesarchiv NRW
4) Überprüfung der Unterlagen des ehem. Document Centers im Berliner Bundesarchiv
Für die beiden letzten Punkte wäre ein korrektes Geburtsdatum sehr hilfreich.
Anhand der im Stadtarchiv Siegen befindlichen Weidenauer Personenstandsregister (Geburten 1885) lässt sich zumindest festhalten, dass am 5. Januar 1885 ein August Wilhelm Karl Born (Sohn der Luise Born, geborene Stark, und des Ludwig Born aus Fickenhütten) zur Welt kam. Er verstarb nach einem Stempelvermerk am 10. Januar 1951 in Frankfurt am Main.
Nachtrag: Die Personalia-Sammlungen des Stadtarchivs Siegen (vorwiegend bestehend aus biografischen Presseberichten) verweisen leider auf keinen Karl Born.
Kleine Ergänzung: Im „Wohnungsbuch der Stadt Siegen, der Kreise Siegen und Altenkirchen“ aus dem Jahr 1925 findet sich Karl Born, Archititekt B.D.A. und vereid. Taxator, ebenfalls unter der Adresse Bruchstr. 9. Das Büro befand sich in der Wiesenstr. 8.
Die Lehrer der einklassigen Volksschule Ruckersfeld in der Zeit des Nationalsozialismus:
“ …. 1.10.1924 bis Dez. 1936 Georg Fischer aus Aue/Wittgenstein
1.1.1937 – 30.11.1966 Heinrich Mester aus Bochum-Langendreer …..“
Aus: Heinrich Mester: 900 Jahre Ruckersfeld, Ruckersfeld 1979, S.148
Pingback: Sonderführungen zur Ausstellung “550 Jahre Asdorfer Weiher” in Freudenberg | siwiarchiv.de
Für Freudenberg-Alchen gibt die Chronik folgende Lehrpersonen an:
“ … Wilhelm Ring 1906-1951
Theo Fischbach 1920-1937
Auguste Klappert ( Handarbeit) 1929 – 1961
Wihelm Wiemer 1937
Ernst Römer 1937-1938
Heinrich Sybre 1938
Paul Kramer 1938-1943
Hannemarie Schütz 1941-1955
Wilhelm Stahl 1945-1946 ….“
aus: Heimat und Verschönerungsverein Alchen e.V. (Hg.): 650 Jahre Alchen. Eine Dorfgeschichte, Freudenberg 1995, S. 163
Pingback: Rubens-Medici-Zyklus beim Kultur-Hackathon “Coding Da Vinci: Westfalen-Ruhrgebiet” | siwiarchiv.de
Auch in Wittgenstein finden sich in den Dorfbüchern Agaben zu Leherinnen und Lehrern“ …..
Fritz Lockert , Hauptlehrer, 1916 – 1940
[? Canstein
Helmut Zindler]
Marianne Strohmann 1920-1938
….
Johannes Heinmöller 1924-1935
Alfred Bettermann 1935-1967
Lotte Sölter 1938-1939
Helmut Rosenkranz 1940
Friedrich Grimme 1941-1945
Ewald Kleine 1944
Waltraud Spies 1945
Friedrich Arndt 1945-1947 ….“
aus: Krämer, Fritz (Hg.): 750 Jahre GirkhausenBalve 1970, S. 62
Ausführlicher stellt der ehemalige Lehrer Otto Krasa die Lehrerinnen und Lehrer in seiner ortsgeschichtlichen Schrift vor:
“ ….. Robert Heide, geb. am 15.9 1876 in Flammersbach , Kr. Siegen , besuchte einige Jahre die Weisenbauschule in Siegen , danach die Präparandenanstalt und das Lehrerseminar in Dillenburg 1894-1897 .Als Lehrer zunächst in Quotshausen, Kr, Biedenkopf und Ibyn, Kr. Mörs , ab 1910 in Gosenbach , 1923 zum Konrektor und 1929 zum Rektor an hiesiger Schule ernannt . Nach seiner Pensionierung wurde er wieder bedingt durch den Lehremangel in den Schuldienst übernommen , wo er die Schulstelle des zum Heerdienst einberufenen Lehrers Berthold Fischer verwaltet . Robert Heide wurde ein Opfer der anfangs April 1945 um Gosenbach tobenden Kämpfe. In einem Zimmer an der Giebelseite der Lehrerdienstwohnung die er nach seiner Pensionierung weiterhin bezog schlug ein Granatspitter durchs Fenster, der ihm ein Bein abriß. Da kein sofortige Hilfe zur Stelle war, verblutete er und hatte somit ein tragisches Ende gefunden im Alter von 68 Jahren.
Martha Meyer, geb. am 3.12.1894 in Wissen , Tochter des ev. Pfarrers Meyer daselbst. Nach bestandener Reifeprüfung am Oberlyzeum in Neuwied und der Lehramtsprüfung an der Semiraklasse daselbst zunächst tätig an der höheren Schule in Gosenbach , versetzt nach Hattingen an der Ruhr .
Paul Hoffmann , geb. an 4.4.1899 in Gosenbach als Sohn des Grubenverwalters Jakob Hoffman besuch des Lehrerseminars in Gummersbach 1916-1918. Nach seiner Entlassung aus dem Militärdienst war er an hiesiger Schule tätig vom 24.4.1919 bis 31.8.1933 , am 1.9.1933 versetzt nach Niederndorf, Kr, Siegen, 1945 zum Hauptlehrer daselbst ernannt .
Adolf Hasseberg, geb. am 8.1.1899 in Lippstadt , Besuch des Lehreseminars in Lüdenscheid 1917-1919 an hiesiger Schule tätig vom 1.10.1919-31.12.1922 am 1.1.1923 versetzt nach Dortmund. Nach erfolgreichem Hochschulstudium wurde er Leiter der Pädagogischen Hochschule nach Dortmund als Professor berufen.
Karl Stüll, geb. am 23.8.1896 in Klafeld, Kr, Siegen. Besuch des Lehrerseminars in Gummersbach. Unterbrechung der Vorbereitungszeit durch den Kriegsdienst vom 8.11-1915-26.1.1919 . Abgangsprüfung von Seminar vom 26.2.-3.3.1920, erste Anstellung im Schuldienst in Menden , Kr, Iserlohn. Vom 1.1.1923-31.5.1932 an hiesiger Schule tätig, am 1.6.1932 versetzt nach Struthütten, Übertragung der dortigen Hauptlehrertelle , später Hauptlehrer in Langenau , Kr, Siegen.
Otto Krasa, geb. am 25.6.1890 in Radziunz , Kr, Miltisch in Schlesien, als Sohn des Lehrers Karl Krasa daselbst , Besuch des Kgl. Lehrerseminars in Krotoschin ( Provinz Posen) 1908.-1911. Im Zuge der Überweisung von ev. Schulamtsbewerben nach dem Westen der Regierung in Arnsberg überwiesen, seit 16.10.1911 an hiesiger Schule tätig, 1914-1918 Kriegsdienst. Für die Monate August und September 1936 von der Regierung in Arnsberg beurlaubt, um in größerem Umfang als bisher das Aufsuchen und Kartieren der von ihm entdeckten vorgeschichtlichen und mittelalterlichen Hüttenplätze im Siegerland vorzunehmen. Am 1.10.1939 zum Hauptlehrer ernannt . Am 1.4.1955 trat er nach Erreichung der Altersgrenze in den Ruhestand. Am 10. Oktober 1957 wurde ihm für die Erforschung der alten Eisenverhüttung im Siegerland das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.
Berthold Fischer, geb. am 26.9.1896 in Fredeburg , Kr. Meschede , Besuch des Lehrehseminars in Hilchenbach 1913-1915, Herresdienst als Freiwilliger bei der Marine bis Nov. 1918 ab 25.1.1919 an hiesiger Schule tätig. Am 25.8.1939 zum Heeresdienst einberufen bei der Stabkomp . der Mar. Art. Ers. Abtlg. in Cuxhaven zuletzt befördert zum Ltn. d. M. Art. am 1.4.1945. Nach seiner Entlassung aus dem Heeressdienst wieder im Schuldienst hierselbst seit dem 27.8.1945, Ernennung zum Hauptlehrer am 1.7.1947, in den Ruhestand versetzt am 31.3.58
August Lütgert, geb. am 6.5.1910 in Krombach Kr. Siegen Reifprüfung an der Oberrealschule Weidenau 1929. Besuch der Pädagogischen Akademie in Dortmund 1931. Unterbrechung des Studiums wegen Krankheit. 1935 Ablegung der ersten Prüfung für das Lehramt an Volksschulen erste Lehrstelle an der einklassigen ev. Volksschule in Verserde, Kr. Altena vom 15. Mai.1935 bis zu, April 1936 hierauf Vertretungsstelle in Weidenau, vom 1. Sept.1936 bis Dez.1955 an hiesiger Schule tätig, versetzt nach Eisern, daselbst zum Konrektor ernannt.
Else Houben, geb. am 5.2.1901 in Bochum des Lehrerinnensemirars daselbst 1918-1921 -30.10.1926 Telegraphendienst in Bochum. Eintritt in den Schuldienst am 31.10.1936 , zunächst 2 Monate an der Neustadtschule in Wattenscheid, vom 1.1.1927-31.3.1930 an der Pestalozischule in Lünen-Brambauer, vom 1.4.1930-30.11.1933 in Schwelm, vom 1.12.1933-31.8.1951 an hiesiger Schule tätig auf eigenen Wunsch versetzt nach Wattenscheid, daselbst zur Konrektorin ernannt.
Wilhelm Kuhn, geb. am 5.5.1892 in Hilchenbach . Besuche der Präparandie und des Lehreseminars daselbst 1906-1912. Erste Lehrerstelle in Lippe bei Burbach Kr. Siegen 1.5.1912-23.10.1916, zweite Lehrerstelle in Oberheuslingen, Kr. Siegen, 21.10.16-3.5.1945, Kriegsdienst 6.4.1915-23.10.1916 und 11.9.1917 -11.11.1918. Seit 1.5.1948 an hiesiger Schule tätig. Versetzung in den Ruhestand am 1.4.1955.
……
Irmgard Siebel, geb. am 26.8.1927 in Siegen als Tochter des Kaufmanns Friedrich Siebel daselbst. Ausbildung Mittlere Reife , Frauenfachschule und Schulhelferlehrgang in Bayreuth , am 1.7.1944 Anstellung als Schulhelferin an der Obenstruhtschule in Siegen, von 1945-1947 an den Volksschulen in Buschhütten und Kreuztal. Besuch der Pädagogischen Akademie in Bonn 1948 -1950, Anstellung als Lehrerin auf der Lippe und Wahlbach Kr. Siegen von 1950-1954, ab Ostern 1954-31.3.1957 an hiesiger Volksschule tätig , versetzt nach Siegen am 1.4.1957. ….“
aus: Krasa, Otto: Chronik der Gemende Gosenbach, Hilchenbach 1964, S. 146 – 149
Oberdielfen. den12.10.019
„die Ruhestätte als Teil der Stadtgeschichte für die Bürgerinnen und Bürger zugänglicher und die Grabstätte zu einem musealen Ort zu machen.“
So verstehe ich es das dies nun was ganz Neues ist und zusätzliches zum Museum der Stadt Siegen, Oberes Schloß angeboten wird
Ein wenig traurig, nein eigentlich Böse der beiden Männer gegenüber, die die Führrungen jahrelang, bis zu ihrem Tode gerne und mit Herzblut übernopmmen haben.Zu bestimmten Zeiten wie ich mich erinerre.
Hermann Wunderlich der ein Eisenwaarengeschäft in der Kölnerstr. hatte schloß den, wenn ein Interressierter ich schreibe nun extra Ein, sich bei ihm vorstellte.Jahrelang nahm er dieses war, wie auch sein Nachfolger Herr Delphenthal vom Rosterberg .Beide Herren hatten detaliertes Wissen zu den Einzelund Gruppenführrungen
Die Sache ist dann eingeschlafen nach dem Tode des Letztgenannten.und war gewiß nicht in Ihrem Sinne. So ist dasscreibeb der Stadt an die Öffentlichkeit mit den Worten wie:
“ künftig einer breiteren Öffentlichkeit präsentiert werden“ ;Nur bei Stadtführungen und jährlich beim Tag des Offenen Denkmals seien Besichtigungen in der Vergangenheit möglich gewesen wenigstens für Mich befremdend
Eckhardt Behrendt ,Oberdielfen
Hochinteressant, vor allem die Bilder von den höheren Töchtern von 1906, die nicht ahnten, was ihnen bevorstand! Ich besuchte die Schule in den Nachkriegsjahren (2. Weltkrieg), als wir sie ein paar Jahre lang noch mit den heimatlosen Schülern des zerstörten Jungengymnasiums im Schichtunterricht teilen mussten. Direkt nach dem Krieg mussten auch die Mädchen zunächst mit der Kleinbahn nach Eiserfeld fahren, was mir erspart blieb.
Allerdings – ein Steinweg-Flügel war auch 1949 schon vorhanden oder hatte vielleicht auch den Krieg überlebt?
Vielen Dank für den Kommentar! Alle Berichte zur Geschichte des Lyzeums sind hier herzlich willkommen. Zum Steinweg-Flügel kann ich leider nicht viel sagen; aber ich werde mich einmal umhören.
Pingback: Richtfest für Schutzbau an der Fundstätte Gerhardsseifen | siwiarchiv.de
Pingback: Wo im oberen Siegtal ist das? Wer ist zu erkennen? | siwiarchiv.de
Pingback: Rückblick vom Siwiarchiv: 89. Deutscher Archivtag in Suhl | Archivalia
Weiteres zum Schülerinnenstreik findet sich hier:
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 5.10. – 17.10.2019 | siwiarchiv.de
Pingback: “Lebensgeschichte aus dem Koffer” | siwiarchiv.de
Sowohl die 4. Auflage aus dem Jahr 1909 als auch die 5. Auflage aus dem 1910 sind nun auf den Seiten in Münster online einsehbar.
Auch die Geschichtswerkstatt Siegen e.V. hat sich des fünfzigjährigen Jubiläums des Schülerinnen-Streiks am Siegener Mädchengymnasium angenommen: In der kommenden Ausgabe des Jahrbuchs „Siegener Beiträge“ (Erscheinungsdatum Ende November) versucht Christoph Bode, emeritierter Professor für Anglistik der LMU-München, „eine Rekonstruktion und Kontextualisierung jenes Streiks, den man durchaus – neben den Protesten gegen den NPD-Landesparteitag am 16. November 1968 – als das herausragende politische Ereignis der „1968er“-Zeit in Siegen betrachten kann, …“. Bode, zur Zeit des Schülerinnen-Streiks Schülersprecher am benachbarten Jungengymnasium, kann dabei auf authentisches Material zurückgreifen, Original-Flugblätter und vor allem seine eigenen Tagebuch-Aufzeichnungen des Oktobers 1969.
Am 12. Dezember 2019 wird der Autor um 18.30 Uhr im Stadtarchiv Siegen eine Lesung aus seinem umfangreichen Artikel halten.
Danke für den Publikations- und Veranstaltungshinweis! Die Geschichtswerkstatt Siegen hatte ja bereits vor vier Jahren auf die Bedeutung des Streiks hingewiesen: “ …. Beim Schülerinnenstreik im Oktober 1969 kamen Forderungen nach personeller Veränderung im Lehrerkollegium, Schaffung eines demokratischen Schulsystems und der Rücktritt der Oberstudiendirektorin auf. Einige Tage hilt der Streik Siegen in Atem, dann ging alles ganz schnell. Die Direktorin gab den Weg frei und nach kurzer Zeit war der Spuk vorbei. Ein einmaliger Vorgang in der deutschen Schullandschaft. ….“ (aus Gerhardus, Tobias: „Die zeitgemäße Ausbildung des weiblichen Geschlechts.“ Zur Geschichte des Siegener Mädchengymnasiums, Siegen 2015, S. 126). Um so begrüßenswerter ist es, dass sie am Thema weiterarbeitet.
2 Literaturhinweise zum Schülerinnenstreik:
1) Betrifft: Erziehung, Ausgabe 12, 1969, S. 9
2) Raimund Hellwig: „Hurra, Revolution“, in „Siegen, Dorf mit Krone. Geschichten und Anekdoten“, 2015 , Seite 24 – 27
Der Eintrag wurde auch kürzlich im Rundfunkforum besprochen – u. a. mit Bildern der Sendemasten, die hier angesprochen wurden.
Pingback: Video: “1619 – Die erste Feuerspritze” in Siegen | siwiarchiv.de
Korrekte Adresse:
https://www.radio-rum.de/blog/
Danke für die Korrektur!
Pingback: Leader-Förderung für die Alte Synagoge in Bad Laasphe | siwiarchiv.de
Sowohl die Siegener Zeitung als auch die Westfälische Rundschau besprechen die Revue, vollständig leider nur in deren Printausgaben.
Pingback: Ausstellung “RAUMWUNDER – neue Wege in Design und Möbelbau. | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 18.10. – 30.10.2019 | siwiarchiv.de
Pingback: Ausstellung: “Hermann Kuhmichel – Leben und Werk” | siwiarchiv.de
ich haufe das buch , oder DVD , zu kunnen kaufen , hier in Belgien oder „online“ .
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik Oktober 2019 | siwiarchiv.de
Unglaublich. Ein Nazikünstler, der wie kaum ein anderer im Siegerland, auf das seine Bekanntheit sich beschränkte, für die enge Symbiose von „Heimat“bewegung und NS-Bewegung steht, wird drei, vier Generationen später wieder von heimat- und bildungsbegeisterten Bürgern gefeiert. Als sei nichts geschehen. Auch nichts an Aufarbeitung, ein Bildungsbeitrag, der nie ankam, inzwischen vergessen ist oder nun verworfen wird.
Mit Festreden, einen Tag vor dem Jahrestag der reichsweiten Ausschreitungen gegen die jüdische Minderheit und der Brandstiftung der Synagogen.
Zwei Tage nach den Festreden zur Eröffnung der Kuhmichel-Ausstellung in Freudenberg…
„Über die reizvolle Verwirklichung bestechender Einfälle hinaus zum Wesentlichen vorgedrungen ist auch Hermann Kuhmichel. … (Er) hat in seinem Porträt ‚Infanterist‘, dem er die Züge eines Westwallkameraden lieh, das Gesicht des deutschen Soldaten als Symbol des Kampf- und Siegeswillens der Nation gültig geprägt. Seine Fähigkeit zur Erspürung und Belichtung des Seelischen kommt ferner in dem scharf umrissenen ‚Kopf eines Offiziers‘ von jenem schalkhaften Zug umspielten anderen des verewigten Betreuers der Siegerländer Künstlerschaft Dr. Kruse zum Ausdruck. … In dem … bewegten figürlichen Motiv ‚Stukas!‘ ist dem Künstler die Symbolisierung der Schreckwirkung beim Einsatz dieser Waffe auf den Gegner gut gelungen.“ (Otto Heifer, Siegener Zeitung, 13.6.1942)
„… lenken sofort das Hauptaugenmerk die Werke des Bildhauers Hermann Kuhmichel auf sich. … Von ihm kann man am ehesten berichten, daß er feines Anpassungsvermögen an die aus dem Volke kommenden Wünsche besitzt, ohne sich auch nur im geringsten selbst dabei aufgeben zu müssen. … Die Geltung der Einzelseele, auf die sich die Kunst in früheren Jahren aufbaute – wobei allzuoft Verwechslungen von Seele und Intellekt vorgekommen sind – dankte sie ihre Haltlosigkeit, die völlige Abhängigkeit vom Unzulänglichen im Menschlichen.[Originalsyntax] Heute ist die tragende Kraft der Volksseele zum Durchbruch gekommen, jenes Unveränderlichen, Stetigen, Klaren und Starken, das dem schwankenden Individuum erst die seelischen Kräfte verleiht. Die Kräfte des Blutes, die in dieser Seele lebendig sind, müssen auch in der Kunst durch den Künstler sprechen. Was kümmert es uns, wenn in irgendeinem Werk ein gepeinigtes Herz aufschreit – wir hören es nicht. Aber wenn der Spiegel unseres geheimen Sehnens und unseres Seins uns vorgehalten wird, dann berührt das Bild, in das wir schauen uns mit mächtigem Leben. Wenn Kunst aus solchem Drange entsteht, dann ist sie an die Landschaft gebunden, dann können wir bei uns auch von Siegerländer Kunst sprechen. Und so sehen wir auch Hermann Kuhmichel als den Siegerländer Künstler. Das Bild des Menschen, das er schafft, ist ernst, stark, fromm, mit einem ganz nach innen gekehrten Blick, es ist dem Siegerländer Menschen zutiefst verwandt. … Daß Kuhmichel nicht an die Überlieferung in der thematischen Gestaltung gebunden ist, bewies er mit den Umschlagdeckeln für die beiden Ehrenbürgerbriefe der Stadt Siegen für Hindenburg und Adolf Hitler.“ (Otto Dinkela, Siegener Zeitung, 21.12.1934)
Na, da lässt sich der eine oder andere Gedanke zur Eröffnung oder für begleitende Gespräche als überzeitliche Wahrheit und Weisheit vielleicht noch nutzen?
Pingback: Wie geht es weiter mit der Archivierung in Netphen? | siwiarchiv.de
Pingback: Zum Stand des Hauses der Geschichte Nordrhein-Westfalen | siwiarchiv.de
Gemeinsam mit Reinhard Gämlich durfte ich 1984 ein zweimonatiges Praktikum im Stadtarchiv Iserlohn absolvieren, bevor wir den Kölner Kurs in Brauweiler besuchten und danach als Archivar in unseren Heimatstädten tätig wurden. Während Reinhard Gämlich bereits im wohlverdienten Ruhestand weilt werde ich diesen Schritt zum 01.03.2020 ebenfalls erledigen.
Herzlichen Glückwunsch lieber Reinhard zu Deiner verdienten Ehrung.
Vielen Dank für diese herzlichen Beitrag!
Pingback: Kultur-News KW 45-2019 News zu Museen, Ausstellungen, Digitalisierung
Pingback: Zum Stand des Hauses der Geschichte Nordrhein-Westfalen | Archivalia
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 31.10. – 12.11.2019 | siwiarchiv.de
Ich bin erschrocken, wie anmaßend und gnadenlos Ulrich Opfermann über den vielseitigen Siegerländer Künstler Hermann Kuhmichel urteilt. Er verurteilt einen Mann, der niemandem geschadet oder etwas zu Leide getan hat. Kuhmichel hat den Ersten Weltkrieg mit gesundheitlichen Schäden überstanden und am Zweiten zunächst im Sanitätsdienst und 1944 an der Front in Frankreich teilgenommen. Sein Atelier wurde im Krieg zerstört. Er war im „Dritten Reich“ als freischaffender Künstler tätig, der eine Familie zu versorgen hatte. Wie hätte sich Ulrich Opfermann in der Nazidiktatur verhalten? Hätte er die Existenz seiner Familie aufs Spiel gesetzt? Hermann Kuhmichel war kein Anhänger der Nazis. Um einen Einblick in seine politische Einstellung zu erhalten, empfehle ich, die Ausführungen dazu im 2016 erschienenen Bildband von Frieder Henrich nachzulesen. Dr. Hans H. Hanke (LWL) schreibt in seiner Rezension: „Man kann Henrich in dieser nun gut belegten Position durchaus folgen – zumal Kuhmichel nicht der einzige Künstler war, dessen mentaler und künstlerischer Spagat zwischen NS-Gegnerschaft und NS-Aufträgen bewiesen ist. […] Da steht keine heldische, angriffslustige Figur, muskulös und statisch aufgerüstet, wie man es von Thorak, Breker, Meller und vielen anderen willfährigen NS-Größen der Kunst kennt.“ Im Übrigen wurden Kuhmichels Kunstwerke über die Region hinaus im ganzen Bundesgebiet geschätzt.
Lieber Herr Wolf,
vielen Dank für das Follow-up zu Ihrer anregenden Session auf dem ArchivCamp! Das erinnert mich daran, meine Ergebnisse zum Instagram-Workshop zu verschriftlichen.
Ergänzen möchte ich noch Links zum Inhalt des Flurfunks (#hastetöne und #archivradio) während des ArchivCamps:
* https://twitter.com/hashtag/hastetöne?src=hashtag_click&f=live
* https://twitter.com/hashtag/archivradio?src=hashtag_click&f=live
Viele Grüße aus Marburg,
Tim O.
Die Aussagen mancher Reaktionäre sind immer wieder erstaunlich:
Kuhichel war kein Anhänger der Nazis.
(Traute Fries)
Wlaimir Putin ist ein lupenreiner Demokrat.
( Gerhard Schröder)
Die Welt ist eine Scheibe.
Pabst Urban VIII
Dies kann man heute wissen.
Auszug aus den regionalen Persönlichkeitslexikon (Internet)
Kuhmichel, Hermann
* 4.3.1898 Eiserfeld, gest. 21.9.1965 Weidenau, bildender Künstler, nach Machtübergabe u. a. zahlreich ns- und kriegspropagandistische Beiträge, darunter Kassetten für Ehrenbürgerbriefe der Stadt Siegen für Hitler und Hindenburg, die Plastiken „Judas“ (1933), „Der Bonze“ (1934), „Die Familie“ (1934), Ausgestaltung des „Kameradschaftshauses“ der Fa. Schmidt & Melmer, Weidenau („Führerbüste“ neben Gründerporträts, kriegsmotivische Reliefs; 1938), „Infanterist“ (1942), „Offizier“ (1942), „Wehrmachtssoldat“, „Stukas!“ (1942), „Feldwebel Wrede“, gemeinsam mit Hans Achenbach durch den Kreispropagandal. Theobald Meiswinkel als einer der heimatlichen „Künstler“ gewertet, die „ihr Schöpfertum betont in den Dienst der Zeit gestellt“ hätten (1942), siehe auch die regionalen Kunstexperten Otto Heifer und Josef Zimmermann
„… lenken sofort das Hauptaugenmerk die Werke des Bildhauers Hermann Kuhmichel auf sich. Er ist in seinem Schaffen ungemein fruchtbar, … . Neben dem Rubensbrunnen der Stadt Siegen und dem demnächst zur Ausstellung gelangenden Kriegerdenkmal der Gemeinde Netphen entstand eine Reihe anderer Werke,. die von der ruhigen Fortentwicklung des in sich gefestigten Künstlers sprechen. Von ihm kann man am ehesten berichten, daß er feines Anpassungsvermögen an die aus dem Volke kommenden Wünsche besitzt, ohne sich auch nur im geringsten selbst dabei aufgeben zu müssen. … Die Geltung der Einzelseele, auf die sich die Kunst in früheren Jahren aufbaute – wobei allzuoft Verwechslungen von Seele und Intellekt vorgekommen sind – dankte sie ihre Haltlosigkeit, die völlige Abhängigkeit vom Unzulänglichen im Menschlichen.[Syntax so!] Heute ist die tragende Kraft der Volksseele zum Durchbruch gekommen, jenes Unveränderlichen, Stetigen, Klaren und Starken, das dem schwankenden Individuum erst die seelischen Kräfte verleiht. Die Kräfte des Blutes, die in dieser Seele lebendig sind, müssen auch in der Kunst durch den Künstler sprechen. Was kümmert es uns, wenn in irgendeinem Werk ein gepeinigtes Herz aufschreit – wir hören es nicht. Aber wenn der Spiegel unseres geheimen Sehnens und unseres Seins uns vorgehalten wird, dann berührt das Bild, in das wir schauen uns mit mächtigem Leben. Wenn Kunst aus solchem Drange entsteht, dann ist sie an die Landschaft gebunden, dann können wir bei uns auch von Siegerländer Kunst sprechen. Und so sehen wir auch Hermann Kuhmichel als den Siegerländer Künstler. Das Bild des Menschen, das er schafft, ist ernst, stark, fromm, mit einem ganz nach innen gekehrten Blick, es ist dem Siegerländer Menschen zutiefst verwandt. … Daß Kuhmichel nicht an die Überlieferung in der thematischen Gestaltung gebunden ist, bewies er mit den Umschlagdeckeln für die beiden Ehrenbürgerbriefe der Stadt Siegen für Hindenburg und Adolf Hitler.“ (Otto Dinkela, Siegener Zeitung, 21.12.1934)
„Über die reizvolle Verwirklichung bestechender Einfälle hinaus zum Wesentlichen vorgedrungen ist auch Hermann Kuhmichel. … (Er) hat in seinem Porträt ‚Infanterist‘, dem er die Züge eines Westwallkameraden lieh, das Gesicht des deutschen Soldaten als Symbol des Kampf- und Siegeswillens der Nation gültig geprägt. Seine Fähigkeit zur Erspürung und Belichtung des Seelischen kommt ferner in dem scharf umrissenen ‚Kopf eines Offiziers‘ von jenem schalkhaften Zug umspielten anderen des verewigten Betreuers der Siegerländer Künstlerschaft Dr. Kruse zum Ausdruck. … In dem … bewegten figürlichen Motiv ‚Stukas!‘ ist dem Künstler die Symbolisierung der Schreckwirkung beim Einsatz dieser Waffe auf den Gegner gut gelungen.“ (Otto Heifer, Siegener Zeitung, 13.6.1942)
„In den Kreis der Modernen gehört auch Hermann Kuhmichel mit seinen Holzschnitzereien von starker Kraft der Aussage (‚Juden an der Klagemauer‘, ‚Flüchtlinge‘ usw.) und seinen beiden Farbstickereien ‚Der Schatzgräber‘ und ‚Die große Sünderin‘, expressiven Kunstwerken eigener Art und Farbgebung.“ (1952)
Dietermann; Irle 1974, 197; Abb.: SHK 1939, nach 124, 1941, 39; SNZ, 18.4.1934, 17.3.1936; SZ, 2.11.1929, 21.12.1934, 8.7., 24.10.1938, 13.6.1942; WP/Rt, 5.11.1952
Pingback: Geschichts-Theater: “Siegens wilde Mädchen – Eine Revue”. | siwiarchiv.de
Inwieweit die Kunstwerke Kuhmichels nationalsozialistisch sind, ist ein interessante Frage. Es sind Auftragsarbeiten für nationalsozialisitische Stellen ausgeführt und gezeigt worden. Aus welchen Gründen Kuhmichel diese Aufträge angenommen hat, darüber lässt sich trefflich diskutieren. Auf der einen Seite kann man eine Nähe Kuhmichels zum Nationalsozialismus vermuten, auf der anderen Seite wird man betonen, dass Kuhmichel ja auch seinen Lebensunterhalt bestreiten musste.
Auffallend bei Kuhmichel sind auch Werke, die militärische Themen zeigen. Hier ist die von Opfermann in die Diskussion gebrachte Schnittmenge zwischen dem in diesem Fall nationalsozialistischen Kunstverständnis und dem Kuhmichelschen Oeuvre recht hoch. Dies berichtigt zwar m. E. noch nicht dazu, Kuhmichel als Nationalsozialisten zu kennzeichnen. Aber ein Unbehagen gerade bei diesen militaristischen Werken bleibt bei mir.
In jeder Diktatur hängen die Künstler ihre Fahne in den Wind der jeweils mächtigen Auftragsgeber.
Zahlreiche Marx- bzw. Leninbüsten im Osten zeugen heute noch davon.
Es gibt jedoch kein Gesetz zur Verpflichtung als Künstler.
Man darf auch schlichtweg Arbeitnehmer sein.
Ich hatte ihn als „Nazikünstler“ bezeichnet. Dass er Kunst für Nazis, das Nazisystem und – bitte nicht vergessen – den Nazikrieg gemacht hat, scheint mir unbestreitbar zu sein. Dass er das für Geld gemacht hat auch. Ob und inwieweit er dabei selbst völkischen Überzeugungen anhing und die Nazis prima fand, ist ein bisschen schwierig zu beantworten, aber auch egalitarianism . Wie er künstlerischen Ausdruck in kantig-monumentalen unzweifelhaft militaristischen Wehrmachtsgestalten suchte, das spricht m. E. schon für mindestens eine große Offenheit und Bereitschaft, mit „künstlerischer“ Propaganda einen überall wahrnehmbaren Beitrag zu leisten. Und für seine Kompetenz, das NS-glaubwürdig hinzukriegen. Wie schon oben zu lesen, er hätte auch was anderes machen können, wenn er nur gewollt hätte. Wenn es auch weniger einträglich gewesen und weniger öffentliches Lob eingebracht hätte. Nein, es hat wenig Wert, diesen Herrn nach dem Modell von 1949 zu entnazifizieren und ihm einen Schein „innerlich kein Nazi“ auszuschreiben.
Was haben diese Feststellungen mit „gnadenlos“ zu tun? Das ist eine in der Sache gänzlich unberechtigte, eine unangemessene, maßlose Verurteilung. So artikuliert sich das Heimatsentiment? Na, danke.
Hat eigentlich, diese Frage noch zum Abschluss, K. jemals eine Scham, eine Reue, eine Distanzierung zu seiner Nazikunst artikuliert und sei es, dass er einfach nur erklärt hätte, es täte ihm leid, er habe ja doch nicht anders gekonnt, man möge ihn bitte verstehen? Ist mir bei meinen Untersuchungen zur ja hoch NS-belasteten regionalen Heimatszene bislang noch nie begegnet, aber vielleicht ist er die Ausnahme? Ich bin gespannt.
Pingback: Relaunch von archive.nrw.de im Frühjahr2020 | siwiarchiv.de
Die in dem von Detlef Koppen zitierten Artikel angegebenen Arbeiten von Kuhmichel nennen die beiden monumentalen Kasernenverschönerungen leider nicht, das sollte dort mal nachgetragen werden:
„Johann der Mittlere von Nassau“, 4,50 m, an der Graf-Johann-Kaserne auf dem Heidenberg (1936) und ein „Wächter aus Stein“, das heißt ein Wehrmachtssoldat unterer Ränge, 3 m, an der Herzog-Ferdinand-Kaserne auf dem Wellersberg (1936).
Natürlich ordnet sich der Kasernenbau vor allem anderen in die Vorbereitung eines Weltkriegs ein. Die Klügeren warnten schon lange: „Hitler bedeutet Krieg“. Leider waren sie – schon gar im Siegerland – eine eher kleine Minderheit. Kuhmichel in das damalige Meinungsspektrum einzuordnen fällt leicht. Zu leicht für eine heutige Darstellung, die vor allem aus dem besteht, was nicht gesagt wird, die nicht die politischen und die moralischen Implikationen seines Tuns anspricht, und die dennoch ja wohl überzeugen will. Das muss daneben gehen, wenn das Licht angemacht wird.
Die Grafen-Skulptur und mit ihr Kuhmichel wurden in der Parteizeitung der NSDAP 1936 so kommentiert:
„Der Soldat soll wissen, warum er Soldat ist, soll die Verbundenheit zur Heimat gewinnen und seine Bindungen an sie erkennen lernen. Dazu hilft die Kunst, die sie in mannigfacher Weise auf den heimatlichen Gedanken Gedanken und seine Verbindung mit dem Dienst des Soldaten abstimmen kann. Hier ist durch Hermann Kuhmichel … ein Standbild geschaffen, das die in Siegen dienenden Soldaten an … den Gründer Siegener Militärakademie erinnern soll, einen Mann, der durch sein Werk den Soldatenstand emporgehoben und ihm seine Ehre gegeben hat. Den Bürger erinnert das Denkmal an einen Schützer des Wohlstandes und Friedens.“ (SNZ, 26.8.1936)
Das ist eine aufschlussreiche Aussage zur Verschränkung der Heimat- mit der Militaristenszene dieser Jahre, die eine breite Schnittmenge reaktionärer Inhalte repsräsentierten, grau, braun und noch ein paar andere Tönungen.
Inzwischen konnte ja der durch Kasernenabriss gefährdete „Wächter“ von einer großen Heimatkoalition noch mal gerettet werden. Ausgerechnet dorthin setzte sie ihn, wo die Toten dieses verbrecherischen Krieges liegen. Dazu passt diese Freudenberger Ausstellung bestens.
Der oben zitierte Artikel geht auch nicht ein auf die deutschnationalen und NS-affinen sog. Kriegerdenkmäler, die Kuhmichel in mehrere Dörfer stellen durfte. Ihr allgemeiner Inhalt war nicht zuletzt die Erinnerung an die „Schmach von Versailles“ und der Appell zur Revision der Ergebnisse dieses Kriegs. Das bekannteste „Kriegerdenkmal“ lag in Netphen. Es gelangte „zu trauriger Berühmtheit“ (Klaus Dietermann) über die Grenzen des Gebirgskessels hinaus, weil es inhaltlich über das Übliche hinausging: „Netphen baut als erste Gemeinde Deutschlands ein gemeinsames Ehrenmal für die gefallenen Helden im feldgrauen und braunen Kleid … und Bildhauer Kuhmichel entledigte sich glänzend seiner gestellten Aufgabe.“ (SNZ, 17.1.1934) Motto des „Ehrenmals“: „Und ihr habt doch gesiegt.“
An dieser Stelle sei in Erinnerung gerufen, dass Klaus Dietermann 1985 eine Dokumentation zum Thema publizierte. Sie und ihr Inhalt (wie alles, was er publizierte: „Aufarbeitung der NS-Vergangenheit“) gerieten inzwischen offenbar in Vergessenheit. Der Mitte-Diskurs verschiebt sich nach rechts. So sieht’s doch aus, wenn man unter den Strich guckt.
Mir scheint, dass für Kuhmichel alle Quellen „auf den Tisch“ müssen. So fand bzw. findet in die Diskussion bisher keinen Einzug: Henrich, Frieder:
Mit Hermann Kuhmichel durch das Siegerland. Eine dokumentarische Zwischenbilanz über Leben und Werk des großen Künstlers, 2016 – Link zur Renzension von Hans Hanke: https://www.whb.nrw/367-download/Heimatpflege/2017/HiW_6_2017_RZ_INet.pdf .
Im Frühjahr 2008 stellte die Westfälische Rundschau ein Frühwerk des Künstlers vor: „Wat wärn de Hänn soe waich“ oder Haferflockensuppe mit Salz. Siegerländer Bildhauer Hermann Kuhmichel gestaltete 1931 das „Arbeitslosen-Häuschen“ in der Hitschelsbach mit einem Relief.“ Ein Hinweis darauf, dass m.W. ein erschöpfendes Werkverzeichnis bislang fehlt. Ein solches wäre wünschenswert, um das künstlerische Schaffen Kuhmichels differenziert bewerten zu können.
In der Datenbank der Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste fand sich ein Werk Hermann Kuhmichels – die Plastik „Meine Eltern“ – , das vom zuständigen Propagandaministerium im Rahmen der „Entartete Kunst“-Aktion 1937 oder 1938 von einem Wittener Museum nach Berlin geschafft wurde. Die Spur des Werkes verliert sich 1945 in Güstrow. Leider liess sich über diesen Vorgang nichts Weiteres ermitteln.
Das hier zitierte Online-Personenlexikon weist keine archivischen Quellen auf; hat man bisher nicht in den Archivien recherchiert (Bundesarchiv ?) Ich bin gespannt.
Die Diskussion war ja zu interessant, als dass der Kuhmichel-Artikel im Regionalen Lexikon der NS-Belastung (http://akteureundtaeterimnsinsiegenundwittgenstein.blogsport.de/a-bis-z/gesamtverzeichnis/) davon hätte unberührt bleiben können. Was nun die „entartet“-Behauptung angeht, erbrachte die Recherche in der Datenbank Proveana des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste, die die Arbeit der Koordinierungsstelle für Kulturverluste Magdeburg fortführt, also der einzige vorliegende ernsthafte Hinweis,
keinen Befund. Zwar tritt dort ein Bild des Malers Heinrich Pforr „Meine Eltern“ (http://www.lostart.de/DE/Verlust/257351) auf, nichts aber sonst, weder Kuhmichel noch ein weiteres Werk mit diesem Titel. Nun mag es natürlich sein, dass Künstler und Arbeit von der Vorgängereinrichtung aufgenommen waren, sie aber nach Überprüfung aus dem Datenbestand herausgenommen wurden. Weiß siwiarchiv mehr?
In der Datenbank „Beschlagnahmeinventar Entartete Kunst“ der FU Berlin finden sich 3 Werke Kuhmichels.
Kurznachtrag zu meinem Kommentar weiter oben: Mit „egalitarianism“ wollte ich mich nicht wichtig machen. Das hat mir ein Thesaurus da reingesetzt. Ich hatte einfach geschrieben: „Ob und inwieweit er … völkischen Überzeugungen anhing und die Nazis prima fand, ist … egal.“
Na ja, „Emil Nolde war Antisemit und glühender Nazi.“ (Die Welt, 4.5.2019) Er fiel in die Kategorie „entartete Kunst“, was ihn sehr schmerzte. Das eine muss das andere demnach nicht ausschließen. Was diese Einordnung – für ein einziges bislang bekanntes – Werk für Kuhmichel bedeutete, wissen wir nicht. Sagen lässt sich, dass dieses Urteil oder das Werk ein Ausrutscher gewesen sein müssen: entweder eines ziemlich einsamen NS-Dogmatikers, denn das wiederholte sich nicht, schon gar nicht dort, wo man ihn so gut kannte, oder von ihm, denn das passierte ihm bis 1945 bei kontinuierlich guter Auftragslage nicht wieder.
Und was ist bewiesen oder widerlegt mit dem „Arbeitslosen-Häuschen“? Oder mit der „Ausschauenden“ von nach dem NS-Ende, die nach den eher eckigen Formen nun mit fließenden aufwartete und gemessen an den drei oder mehr als vier Meter hohen Klötzen an den Kasernen nun Kleinformat hatte. Außer natürlich, dass anderes nicht mehr so in die Zeit gepasst hätte. Wie schon gesagt, ein Scham- oder Reuebekenntnis für sein NS-Engagement über mindestens zwölf Jahre ist bislang noch nicht bekannt. Auch die genannte Schrift und deren Rezension können dazu nichts mitteilen.
Eine kurze Auswertung von Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen, R 001/Personalakten Nr. 10547:
1) Studium:
Ostern 1910 – Ostern 1911 in Münster: Alte Sprachen
Ostern 1911 – Ostern 1912 in Aachen: Mathematik, Naturwissenschaften
2) Erster Weltkrieg:
– 5.3.1915 Unterschenkelschuss am Hartmannsweilerkopf (Linker Fuss bleibt steif)
– 27.1.1915 Gefreiter
– Einheiten:
22.8.1914 – 9.10,1914 Rekr. Dep. Inf. Reg. 25
9.10.1914 – 16.2.1916 6. Komp- Inf. Reg. 25
17.2.1916 – 30.4.1916 6. Komp. I. Ersatz-Bat. Inf. Reg. 25
ab 30.4.1916 dauernd kriegsunbrauchbar
– Feldzüge:
10.10.1914 – 14.11.1914 Champagne
17.11.1914 – 6.12.1914 Flandern
14.12.1914 – 5.3.1915 Vogesen
3) Familie
– verh. 10.8.1920 Elisabeth Holthausen (Eltern: Ludwig H., *30.8.1852 in Hinsbeck, Rektoratslehrer, Katharina geb. Glose)
– 4 Kinder: 3 Töchter, 1 Sohn (1942 gefallen)
4) Lehrertätigkeit
– auf Vorschlag des Kuratoriums des städtischen Lyzeums in Siegen zum Oberlehrer gewählt
– 4.9.1934 Diensteid auf Adolf Hitler
– Mai 1945: Komm. Leitung des Lyzeums (Wohnort: Siegen-Eiserfeld)
– Bei endgültiger Anstellung als Direktor erwähnt Kloth die Gefängnisstrafe
– 18.5.1948 Kultusminister schaltet sich auf parlamentarische Anfrage ein
-13.12.1949 Kabinettsbeschluss zur endgültigen Anstellung als Direktor
5) Politische Betätigung
– Fragebogen zum Gesetz v. 7.4.1933: Zentrum von 1919 bis zum 1.7.1933
– nach dem 1. Weltkrieg: Philologenverein
– NSLB (1.8.1933, 233507), NSV (1.4.1934, 121442), Reichsluftschutzbund (1.6.1933, 620)
– Bericht vom Juni 1933: „unverbesserlicher Zentrumsmann“, aktiv im Kath. Gesellenverein, Vertrieb von 100 Ex. „Christenkreuz und Hakenkreuz“
– 17.5.1939 Treuedienstehrenzeichen in Silber
– Bericht (OStR´in Schefer) v. 8.5.1943: „Eifer und Mühe“ bei der Altstoffsammlung
Online findet sich der Hinweis, dass Kuhmichel 1941 den ersten Rubenspreis der Stadt Siegen erhielt: https://wiki.zeitraum-siegen.de/ideen-traditionen/rubenspreis . Ein weiteres Indiz dafür, dass Biographie und Werk Kuhmichels noch nicht abschließend erforscht worden sind; denn sowohl das regionale Personenlexikon als auch die Wikipedia erwähnen diese Ehrung nicht.
Pingback: Literaturhinweis: Jakob Saß: “GEWALT, GIER UND GNADE | siwiarchiv.de
Ein Diskussionsbeitrag von Dr. Ingrid Leopold:
Das Streitgespräch, veranlasst durch einen Kommentar zur Kuhmichelausstellung in Freudenberg, habe ich verfolgt und wollte mich eigentlich nicht einmischen, da mir diese Art von Polemik zuwider ist. Aber um dem Künstler gerecht zu werden sehe ich die Notwendigkeit, einiges zu korrigieren und klarzustellen.
In der Diskussion werden als Beweislast für die Einstellung Kuhmichels zum Nationalsozialismus ausschließlich Auszüge aus der öffentlichen Presse des Dritten Reiches angeführt, die sich durch entsprechenden Wortlaut und Pathos auszeichnen.
Aus der damaligen Interpretation der Kunstwerke werden Rückschlüsse auf den Menschen gezogen und Anschuldigungen ausgesprochen, ohne ausreichend recherchiert zu haben. Unter wissenschaftlicher Arbeit versteht man eine andere Vorgehensweise.
Es gibt handschriftliche Dokumente aus den Jahren 1941 bis Kriegsende in Form persönlicher Briefe von Hermann Kuhmichel an seinen Freund Alfred Henrich, der als Soldat im Russlandfeldzug eingesetzt war.
Sie geben die Betroffenheit und Verzweiflung des Künstlers über die damalige Situation wieder. Kriegsführung und das Schicksal der Soldaten bezeichnet er als „Ausweglosigkeit“ und „Schlamassel.“
Die Briefe sind im Besitz des Sohnes des Empfängers und bei Bedarf im Original jederzeit zugänglich.
Für den Künstler war sein Leben in der NS – Zeit stets eine Gratwanderung zwischen Anerkennung und Diffamierung, zumal er nicht Mitglied der NSDAP war.
Bereits 1935 drohte ihm ein Ausstellungs – und Schaffensverbot wegen sozial – kritischer und christlich – religiöser Motive in seinen Kunstwerken. Durch Fürsprache des Direktors des Siegerlandmuseums Dr. Hans Kruse konnte die Verfügung abgewendet werden.
Im Rahmen der Aktion „Entartete Kunst“ der Reichskulturkammer in Deutschen Museen wurden 1937 nicht nur eines als „Ausrutscher“, sondern drei Kuhmichel – Arbeiten beschlagnahmt: die Holzschnitte „Untersuchung“ und „ausgesperrt“, sowie die Holzskulptur „meine Eltern.“
Die Begründung lautete: „Hermann Kuhmichel verherrlicht in seinen Werken Kulte des Weltjudentums und vernachlässigt trotz nachdrücklicher Einlassungen örtlicher Parteimitglieder seine Pflicht, all sein Können in die Verewigung des arischen Menschen zu stellen.“
Hermann Kuhmichel war in zwei Weltkriegen als Soldat an der Front eingesetzt. Über 2 Jahre war er im Lazarett und 1945 in amerikanischer Gefangenschaft mit Entlassung in das zerbombte Siegen. Themen seines Kunstschaffens in der Nachkriegszeit waren Entbehrungen und menschliches Leid, Vertreibung und Flucht, Gefangenschaft und Tod.
Er war geprägt von tiefer Religiosität. In seinem künstlerischen Schaffen stand stets der Mensch im Mittelpunkt.
Als er 1965 starb fand man folgenden Kommentar in der Siegener Zeitung:
„Demut, Hingabe und Liebe waren die erregenden und tröstenden, die helfenden und heilenden Kräfte, die in ihm wirksam waren. Ein Wahrheitssucher, dessen bildende Hand mit einer für die Menschen der Gegenwart unfassbaren Geduld den Werkstoff formte.“
Über das NS-Propagandaministerium erreichte die Preußische Akademie der Künste im Juli 1933 eine Eingabe des Wuppertales NSDAP-Reichstagsabgeordneten Hermann Schroer zwecks Förderung des Bildhauers Hermann Kuhmichel in Siegen. Die Antwort der Akademie fiel wie folgt aus:
„Hermann Kuhmichels Werke, die mir in einer Photographie und schlechten Drucken vorliegen, interessieren zunächst durch ihren starken Ausdruck und die naive Einfachheit ihres Aufbaus. Bei näheren Zusehen muss man leider feststellen, dass seine Einfachheit und Monumentalität nicht aus geistiger Überlegeneheit, sondern aus dem Mangel an Formgefühl und Können geboren wurden. Wenn es ihm nicht gelingt diese seine Schwächenzu überwinden, wird er sich kaum aus der Gruppe jüngerer Bildhauer, die auf gleichen Wegen wandeln, herausheben. Um ein zuverlässiges, abschließendes Urteil über seine Möglichkeiten abzugeben, müsste man ihn länger beobachten.“
Quelle: Akademie der Künste, Berlin, Archiv, Sig. PrAdK 0941, Bl. 87 rv, Link
Bei dem oben genannten Karl Born, Mitgied der VVN Kreisgruppe Siegen,
handelt es sich um den 1906 in Siegen geborenen Karl Born.
Er war vor 1933 Mitglied der Zentrumspartei und stand in Opposition zur NS Diktatur. Er wurde mehrmals durch die Gestapo verhört und dabei Misshandelt.
Auch eine 6 monatige Haftstrafe in Einzelhaft musste er 1937/38 über sich ergehen lassen. Durch den Entzug der Eisen und Blechquote wurde seiner Schlosserei die Grundlage entzogen. Nach dem 20.7.1944 wurde er nochmals durch die Nazis kurzzeitig verhaftet.
Damit dürfte geklärt sein, dass es sich bei dem Karl Born in der VVN nicht um den gleichnamigen Architekten handelt.
Torsten Thomas, VVN-BdA Siegerland – Wittgenstein
Danke für die Klarstellung!
Den einen ist Polemik „zuwider“, den anderen Personenkult. Das ist nun mal so und hat immerhin eine recht interessante Kontroverse provoziert.
Polemik ist oft ein Ergebnis von Verbitterung. Ich will hier nicht den Opfermann-Versteher raushängen lassen (das hat U.F.O. nicht nötig), aber es ist für mich gut nachvollziehbar, dass der Blick auf den deutschen Homo sapiens während der vergangenen ca. 75 Jahre oder allgemein den internationalen über die Jahrtausende seiner angeblichen Höherentwicklung hin genug Anlass für Kulturpessimismus gibt, was dann gelegentlich sehr rigoros und polemisch artikuliert wird. Für abgehärtete Zeitgenossenen ist das erträglich, oft erfrischend, jedenfalls allemal respektabler als unreflektierte Mythologisierungen. Es mag sein, dass gelegentlich mit Kanonen auf Spatzen (Kuhmichel, Wurmbach u.a.) geschossen wird, die einfach nur auffallend widerspruchsvolle und somit irritierende Personen waren und zum Streit zwischen Kritikern und Verehrern herausfordern. Problematisch für die Geschichtsschreibung ist es aber, wenn unberührt von allen sachlichen Argumenten mit den armen Spatzen zugleich auch den Geiern Absolution erteilt wird. Zum Beispiel voraussichtlich in den kommenden Wochen, wenn wieder einmal ein gewisser Nazi-Bürgermeister (wörtlich im August 1944: „Ich bin ein getreuer Gefolgsmann des Führers.“) als Siegener Lichtgestalt vergöttert wird, obwohl man es seit 1934 besser wissen könnte.
„Den einen ist Polemik ‚zuwider’, den anderen Personenkult.“ Ja, gewiss, dieser kühlen Feststellung ist nur zuzustimmen. Wenn ich von der Zuschreibung „gnadenlos“ einmal absehe, weil sie in eine andere Kategorie als die der Polemik einzuordnen wäre, finde ich zum meinem Glück weder das eine noch das andere in dieser kleinen Diskussion. Insofern sehe ich auch keinen Anlass, nach einem Widerspruch gegen die Hinweise weiter oben ins Verbittern zu fallen. Bin sehr froh, davon bislang verschont geblieben zu sein.
● Der Widerspruch gegen eine Überbewertung des Bildhauers
Kuhmichel,
● die Frage, wo im Spektrum von Opportunismus und Überzeugtheit
er mit seinen zahlreichen NS-Arbeiten einzuordnen wäre,
● die Erinnerung an die zahlreichen Belege seiner NS-Auftragstätigkeit
spätestens seit 1934,
● die Thematisierung des Schweigens (https://westfalen.museum-digital.de/index.php?t=objekt&oges=2225) sowohl der
Heimatbewegung wie auch von ihm selbst zu den NS-Jahren,
● des Schweigens auch über die große öffentliche Wertschätzung, die
ihm durch NS-Sprecher und NS-offizielle und -affine Medien wie die
SNZ und die SZ erfuhr (und die durch Wortlaut und Pathos ihre
Bedeutung nicht verlieren, ganz im Gegenteil),
● die Nachfrage nach einem Scham- und Reuebekenntnis von K.
● der Widerspruch gegen die Umdeutung von K. zu einem verfolgten
Künstler,
was hat das mit Polemik zu tun? Es sind Überlegungen und Fragen, die schon viele Male bei Staatskünstlern gestellt wurden, weshalb soll das hier „Polemik“ sein? Das sind doch Anmerkungen und Fragen, die unbedingt zu stellen sind, wenn man an einer Aufarbeitung der Nazi-Zeit auch im regionalen Raum interessiert ist? Da kann es doch nicht reichen, bei der einen oder anderen Gelegenheit im Jahresverlauf moralische Bekenntnisse vorzutragen? Es geht doch um Aufklärung?
Und noch ein kurzes PS in diesem Sinn:
An einer Stelle der Diskussion kamen Hinweise auf die von K. als „Schicksal der Soldaten“ beschriebenen Zustände „Ausweglosigkeit“ und „Schlamassel“, die er auf sie zukommen sah. Leider fehlt die Zeitangabe. Vielleicht lässt sie sich noch nachtragen? Wäre interessant. Bekanntlich gab es die Erwartung eines militärischen Fehlschlags nach ersten „Erfolgen“ für die NS-Wehrmacht, die Waffen-SS usw. im, wie es in Übernahme der damaligen Bezeichnung heißt, „Rußlandfeldzug“ schon bald für viele.
Und das im engsten Kreis zum Ausdruck zu bringen, war nichts, was jemand zum Systemgegner gemacht hätte (immer vorausgesetzt die private Überlieferung trügt nicht). Dass ein solcher Pessimismus sich auch aus der Kenntnis der Massenverbrechen speiste und nicht zuletzt Angsterwartungen entsprach – man hatte ein alliiertes Strafgericht zu fürchten -, ist schon vor Jahren quellengesättigt gründlich fachlich erarbeitet worden. Man sprach selten über die Massenverbrechen, kannte sie aber und die Führung nutzte die Angst vor Strafe, um zum Weitermachen zu motivieren. War erfolgreich, auch bei Schriftstellern, Künstlern und sonstigen Vertretern des Bildungsbürgertums als der frühen festen Basis der NSDAP und anderer völkischer Zusammenschlüsse, dem bei aller „Bodenständigkeit“ gewiss auch K. zuzurechnen ist.
Es heißt an einer anderen Stelle, der Leiter des Siegerlandmuseums habe sich bei Nazi-Instanzen für K. und gegen ein Berufsverbot eingesetzt. Mag sein oder auch nicht. Belege für diesen Vorgang gibt es, wenn ich richtig sehe, bislang keine. Dass aber der Museumsleiter auf etwaige Gegner von K. Einfluss hätte ausüben können oder Einfluss ausübte, ist plausibel, denn auch dieser Heimatakteur war wie K. oder noch darüber hinaus dem NS eng verbunden (http://akteureundtaeterimnsinsiegenundwittgenstein.blogsport.de/a-bis-z/gesamtverzeichnis/#kruse3).
„Heimat“ gilt als etwas besonders Schönes und Wertvolles. Aber man sollte sie m. E. nicht überzuckern. Die Heimatszene jedenfalls des 20. Jahrhunderts war auch im Siegerland ein Sumpf. Mindestens dafür steht auch Kuhmichel.
Zur Verleihung des „Rubenspreis“ 1941 ergaben Recherchen des Siegener Stadtarchivs: “ ….Die Stadt Siegen veranstaltete am 12. und 13. Juli 1941 eine Rubens-Gedenkfeier, die allerdings im zeitgenössischen Stil politisch gefärbt war. Es fand eine Ausstellung mit Werken von Rubens und anderen zeitgenössischen Künstlern im Siegerlandmuseum statt. Zudem empfing die Stadt Siegen eine Delegation aus Antwerpen, der auch drei Mitglieder des „flandrischen Kulturrats“ angehörten. Es handelte sich um einen Gegenbesuch, nachdem im Vorjahr eine Siegener Delegation zu einer Rubens-Gedenkveranstaltung nach Antwerpen gereist war.
Des Weiteren wurde vor dem Hintergrund des Rubens-Gedenkens eine mit 2.000 RM dotierte Rubens-Stiftung (an einer Stelle in den Akten auch als Rubenspreis bezeichnet) gestiftet. Die Mittel sollten alle zwei Jahre zum Ankauf von Werken der bildenden Kunst von Künstlern des westfälisch – rniederrheinisch – niederländisch-flämsichen Kulturkreises eingesetzt werden. 1941 wurde Hermann Kuhmichel als erster Künstler mit der Rubens-Stiftung bedacht. Er schuf nämlich eine Rubensbüste, die von der Stadt Siegen erworben wurde. ….“ Quellen: Siegener Zeitung vom 14.07.1941 und der Verwaltungsakten.
Übrigens, Kuhmichel hat sich selbst ebenfalls zum „Rubenspreis“ geäußert. Dazu werfe amn einen Blick in die hier bereits erwähnte Publikation Henrichs.
Das mehrfach erwähnte Buch von Frieder Henrich ist für die hier aufgeworfene Thematik eher unergiebig. Die abgedruckten Auszüge aus Kuhmichels Briefen (1941-44) nehmen nur ca. 3 Seiten ein. Zur konkreten Frage: Das Wort „Schlamassel“ benutzte er am 18.7.1941: „Meine Gedanken sind … bei Ihnen [Alfred Henrich an der Ostfront] und allen Freunden u. Bekannten, die in dem Schlamassel drinstecken.“ Dann am 13.6.1942: „So langsam ist uns hier klar geworden, was wirklich in Russland vor sich geht u. wie ungeheuer die Leistung der Front gewesen ist.“ Am 14.10.1944 aus Gotha von der Flak-Ausbildung: „Diese verspätete Rekrutenzeit geht auch vorüber, ich sehne mich nach frischer Luft u. nach einem einzigen anständigen Kerl, mit dem ein Wort zu reden ist. Das Verhängnis kettet mich nun schon fast ein Jahr an Menschen, mit denen mich nichts verbindet als die schlechte Luft, die ich mit ihnen teilen muß. Na, es wird mal wieder anders kommen.“ Frustration über den Kriegsverlauf und die persönlichen Beschwernisse: Sicher. Verzweiflung über den Krieg an sich oder pazifistische Gedanken würde ich in die sehr wenigen vorliegenden Dokumente dagegen nicht hineininterpretieren. Wie repräsentativ die sind, lässt sich natürlich ohne Kenntnis des „Privatarchivs Henrich“ und vielleicht noch anderer unveröffentlichter Sammlungen nicht sagen.
Zum Rubenspreis: „Inzwischen habe ich von der Stadt Siegen den sogenannten Rubenspreis bekommen. Samstag-Sonntag war hier eine ansehnliche Rubensfeier, die Antwerpener Militär- u. Civilverwaltung war hier u. mannhafte Flamen haben viel geredet. Ich kann mir denken, daß es der Stadtverwaltung große Überwindung gekostet hat, mich danach auszuzeichnen. Die Siegener Künstlerschaft fühlt sich, wie immer, zurückgesetzt und da ist auch nicht einer, der ein frdl. Wort an mich gerichtet hat, im Gegenteil, man hetzt u. verleumdet aufs Neue. Wäre ich doch nur aus diesem Kreis heraus!“ Zur Preisverleihung müsste sich eigentlich im Siegener Stadtarchiv Material finden lassen.
Auch bemerkenswert: „Mein Widersacher, der Oberbürgermeister, hat sich ein Loch in den Bauch geschossen u. wird mir fernerhin kein Leid mehr zufügen.“ (13.6.1942. Alfred Fissmer kehrte allerdings nach dem Suizidversuch und vorübergehender Beurlaubung in sein Amt zurück.) Wenn ausgerechnet Kuhmichel für die von seinem Widersacher so heiß geliebten Kasernen mit der „Kunst am Bau“ beauftragt worden war, wären natürlich die Hintergründe interessant. Vielleicht können die umfangreichen Kasernen-Bauakten im Stadtarchiv Hinweise darauf liefern. (OB Fissmer war von der Wehrmacht als Kommissar für die örtliche Aufrüstung eingesetzt worden, deshalb das viele militärbezogene Material im kommunalen Archivbestand. Das erklärt übrigens auch seine Aktivitäten außerhalb der Stadtgrenzen – v.a. in den Ämtern Weidenau und Freudenberg – zu denen er als Siegener OB nicht legitimiert gewesen wäre.)
Danke, Herr Wolf! Unsere Kommentare haben sich irgendwie überschnitten.
Überschnitten ja, aber sie ergänzen sich doch im Sinne der hier geforderten Aufklärung.
Kleiner Nachtrag zum Rubenspreis: In der österreichischen Zeitschrift „Die Bühne“ Heft 16 (1941) S. 12, findet sich folgende Notiz zu den Rubensfeierlichkeiten in Siegen: „Aus Anlaß der Rubens-Feier der Geburtsstadt Geburtsstadt Siegen findet im Museum des Siegerlandes in Siegen eine Gedächtnisausstellung mit Rubens-Stichen, Handzeichnungen flämischer Künstler aus der Rubens-Zeit, Holzschnitten, Schabblättern und Dokumenten zum „Fall Rubens“ statt. In der ausliegenden Rubens-Literatur finden die Schriften des holländischen Archivars Bakhuizen van
den Brink, die die Erkenntnis, daß Siegen die Geburtsstadt Rubens ist, ans Licht gefördert haben, besondere Beachtung. Die eigene Sammlung von Rubens- Stichen konnte das Siegerländer Heimatmuseum durch wertvolle Neuanschaffungen bereichern. Weiter erwarb das Museum eine Rubens-Büste des Bildhauers Hermann Kuhmichel, von der die Lauchhammer-Werke einen Eisenguß angefertigt haben…..“
Pingback: Neuerscheinung zur Geschichte der Westfälischen Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung | siwiarchiv.de
Nach dem Erscheinen der Broschüre „Kanonen und Kuhmchel“ wandte sich Julius Kuhmichel, der Sohn Hermann Kuhmichels, am 28.10.1985 an die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Siegerland. Der Brief enthält u.a. eine von Julius Kuhmichel erstellte Chronik der Jahre 1930 bis 1956, für diese hatte er Tagebuch(!)aufzeichnungen und Zeitzeugenberichte verwendet. Mit dieser Zusammenstellung wollte er die deutliche Kritik an Kuhmichels Wirken während der NS-Zeit entkräften. Das Schreiben befindet sich mittlerweile im Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein unter der Signatur 3.19. (Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Siegerland) Nr. 76 . Die Chronik kann nun hier eingesehen werden: Chronik
Dank an die CJZ für die Genehmigung!
Dank an das Stadtarchiv für die Zusammenstellung einiger interessanter Angaben zu dieser „Rubens-Gedenkfeier“.
Dort wird der „flandrische Kulturrat“ genannt, der 1941 zur Rubens-Ausstellung, zur Begründung einer Rubens-Stiftung/eines Rubens-Preises und zur Präsentation von Kuhmichels Rubens-Büste eingeladen und in Siegen vertreten war. Dazu ein paar Sätze.
Der, wie er hieß, „flämische Kulturrat“ war ein von den NS-Besatzern Belgiens geschaffenes „Lenkungsorgan“ für die „Verflamung bzw. Germanisierung“ Flanderns und bestand aus besatzungsfreundlichen Personen aus Kultur, Wirtschaft und Politik. Insofern wäre es interessant, einmal die Namen der drei Delegationsmitglieder zu erfahren. An der Spitze des Kulturrats stand der Dichter und Feingeist Cyriel Verschaeve, dessen Nachfolger im Jahr darauf Antoon Jacob wurde. Sie beide waren germanophile militante „flamingants“, also niederländisch-niederdeutsche Völkische. Wegen Kollaboration wurde Jacob, der 1944 Mitglied einer flämischen „Exilregierung“ in Norddeutschland war, nach dem Ende der Besatzung festgenommen und inhaftiert, während Verschaeve zum Tode verurteilt wurde. Er hat freilich nach Österreich fliehen können. Später wurde er zu einem Helden und Idol des Vlaamse Militanten Orde, der 1983 verboten wurde. Dieser Zusammenschluss ist besonders durch eine Serie vor wie nach dem Verbot begangener z. T. mörderischer Attentate auf Migranten und Linke bekannt.
Der Siegen-Besuch aus Flandern folgte einem Siegener Besuch zu einer „Rubens-Gedenkveranstaltung“ im Jahr zuvor in Antwerpen. Das dürfte die Verleihung des Rembrandt-Preises an Hendrik/Henry Luyten 1940 in Antwerpen aus Anlass des 300. Todestages von Peter Paul Rubens gewesen sein, getragen von der deutschen Militärverwaltung, der Hansischen Stiftung und DeVlag. Die Hansische Stiftung war eine Schöpfung des Propagandaministeriums, der Volksdeutschen Mittelstelle, von Hans Friedrich Blunck u. a. NS-Instanzen. 1941 ging der Preis an Raf Verhulst, „Dichter und Volkstumsaktivist“, der bereits im Ersten Weltkrieg als Kollaborateur zum Tode verurteilt worden war. Jede Preisvergabe, ob Rembrandt oder Rubens oder sonst wer, war an eine Genehmigung durch das Propagandaministerium gebunden.
„DeVlag“ war die Deutsch-Flämische Arbeitsgemeinschaft, gegründet von dem im Siegerland wohlbekannten NS-Kulturfunktionär Franz Petri (http://akteureundtaeterimnsinsiegenundwittgenstein.blogsport.de/verzeichnis/gesamtverzeichnis/#petri2), einem „Organisator der flämischen Kollaborationsbewegung“, dem das „germanisches Volkserbe in Wallonien und Nordfrankreich“ wichtig war und der gerne Belgien als „deutsche Westmark“ statt als „französische Ostmark“ gesehen hätte.
Nein, um Kuhmichel ging es jetzt nur am Rande, schon aber auch um das Beziehungsgeflecht, das existierte und in dem er, ob etwa am Rande oder anders positioniert, sich bewegte und das bei allen internen Differenzen, die es wie überall auch hier gab, durch und durch nazistisch war. Dass die internen Meinungsunterschiede nach dem NS-Ende genutzt werden konnten und fleißig genutzt wurden, sich zu einem NS-Gegner oder gar -Verfolgten zu machen, Biografien umzuarbeiten und zu glätten, soll nicht weiter erstaunen. Es war das Übliche und sicher in vielen Fällen erforderlich, um möglichst ungestört weitermachen zu können. Es ist schon bemerkenswert, wie wenig Eingeständnisse, etwas falsch gemacht zu haben, aus dieser ja flächendeckend dichten NS-Bevölkerung anschließend und über Jahrzehnte hinweg zu hören waren und wie hoch der Anteil der nun plötzlich als NS-Gegner Auftretenden war, die niemand vorher je in dieser Rolle gekannt hatte und die, wenn es sie gegeben hätte, tatsächlich das System hätten gefährden müssen. Wovon die Forschung nicht ausgeht, wenn sie von einer „Konsensdiktatur“ spricht.
(zum Nachlesen: Burkhard Dietz, Ulrich Tiedau, Helmut Gabel (Hrsg.), Griff nach dem Westen, Teilband II, Münster 2003)
„Die drei Delegationsmitglieder“ werden in einer kurzen Meldung über die Rubensfeier in der „Deutschen Zeitung in den Niederlanden“ (Nr. 32 v. 6.7.1941) genannt:
Robert van Roosbroeck, Oscar Dambre und Achiel Stubbe (Vornamen von mir nach ein bißchen Googelei ergänzt). Jeder war mit einem Vortrag angekündigt. (Das nur spontan und in Eile. Gründlichere Recherchen überlasse ich dem Rest der Menschheit. Wenigstens bei Roosbroeck dürfte es sich lohnen.)
@ Peter Kunzmann, @ Ulrich F. Opfermann: Vielen Dank für die Hinweise zum „Rubenspreis“ 1941! Das schreit ja förmlich nach einer kleinen Miszelle.
Nun doch noch eine Ergänzung.
Das in New York erschienene Journal „News from Belgium“ druckte in seiner Ausgabe Nr. 19 vom 9.8.1941 (in engl. Übersetzung) einen Artikel aus der Kölnischen Zeitung vom 14.7.41 ab, in dem außer den drei oben genannten „Gelehrten“ noch andere Delegierte des „Rubens festival at Siegen“ aufgeführt wurden:
Leo Delwaide, Bürgermeister von Antwerpen; Jan Grauls, Gouverneur der Provinz Antwerpen; „certain military authorities of Belgium“, unter ihnen „Kriegsverwaltungschef Dr. Delius“. Bei letzterem handelte es sich um den in Siegen geborenen Walter D., Sohn des Siegener OB Anton D., Anfang der 1940er Jahre Stadtkommissar bei der deutschen Militärverwaltung in Antwerpen.
Leon Delwaide war der von den Besatzern eingesetzte OB von Antwerpen, ein Politiker einer katholisch-flämischer Partei, sowohl glaubensfester Katholik als auch zutiefst überzeugter Antisemit. Er wird in der belgischen Zeitgeschichtsschreibung für die Deportation von mehr als 3.000 jüdischen Antwerpenern mitverantwortlich gemacht. Es ist jener Delwaide, der nach den Aufzeichnungen des Sohns Kuhmichel 1936 in dessen Atelier besuchte. Dort dürfte er dann sowohl dessen christliche als auch dessen Nazi-Werke kennengelernt haben.
Es ist an dieser Stelle Anlass, auf die mit zahllosen Biografien belegbare Tatsache zu verweisen, dass Christlichkeit und Nazigläubigkeit sich überhaupt nicht ausschließen mussten. Bekanntlich war der heutige Kreis S/W auch deshalb eine Nazi- Hochburg, weil er eine protestantische Hochburg war. Delwaide aber zeigt an, dass schon bald auch die andere große Konfession angefressen war.
Nach dem NS-Ende wurde im Zuge der Entnazifizierung der Mythos aufgebaut, bürgerliche Christlichkeit habe gg. Nazitum geradezu immunisiert. Auch Kuhmichel bediente sich dieses Mythos. Wie zu sehen, entfaltet er immer noch einen Nutzen.
Literatur:
Werner Grebe: Die Obernau-Talsperre, in: Hermann Böttger: Geschichte des
Netpherlandes, Selbstverlag des Amtes Netphen, 1967, S. 463-465
Günter Klingbeil: Die Obernau-Talsperre,: in Die Wasserwirtschaft, 60. Jg.
6/1970, 6 S.
Bitte hier denName korrigieren:
Günter Klingebiel nicht Klingbeil.
Dipl.-Ing. Günter Klingebiel war von 1981 bis 1994 Geschäftsführer des Wasserverbandes Siegen-Wittgenstein
Danke für den Korrekturhinweis und die Zusatzinformation!
Pingback: Museum Wilnsdorf macht Platz für “digitale Maschinenhalle” | siwiarchiv.de
Im Bestand „Kreis Siegen, Landratsamt“ befinden sich unter der Nummer 2301 Anträge zur Verleihung des Ehrenkreuzes für Frontkämpfer im ersten Weltkriegs. Dort ist auch ein Antrag von Otto Krasa zu finden, der u. a. Aussagen über die Einsatzgebiete Krasas macht (z. B. von Januar 1915 bis April 1915 in den Karpaten) und über die militärischen Auszeichnungen: Eisernes Kreuz II. Klasse. 1935 hat Krasa das Ehrenkreuz erhalten
Im Bestand „Kreis Siegen, Landratsamt“ befinden sich unter der Nummer 2258 Anträge zur Verleihung des Ehrenkreuzes für Kriegsteilnehmer im ersten Weltkriegs. Antrag Kloths konnte dort nicht gefunden werden. Ob er einen Antrag auf Verleihung des Ehrenkreuzes für Frontkämpfer im ersten Weltkriegs gestellt hat, müsste noch überprüft werden (Nr. 2395).
Im Bestand „Kreis Siegen, Landratsamt“ befinden sich unter der Nummer 2258 Anträge zur Verleihung des Ehrenkreuzes für Kriegsteilnehmer im ersten Weltkriegs und unter der Nummer 2301 Anträge zur Verleihung des Ehrenkreuzes für Frontkämpfer im ersten Weltkriegs. Diese Ehrenkreuze wurden 1934 und 1935 verliehen. Anträge Kuhmichels liessen sich nicht ermitteln.
s.a. Schweisfurth, Uwe: Die Ritterkreuzträger des Kreises Siegen-Wittgenstein 1939 – 1945, Hilchenbach 2002, S. 111 – 113
Franz Klemens Gieseking schreibt in seinem Artikel: „Westfälische Kunst der Gegenwart. Ein Nachwort zur Großen Westfälischen Kunstausstellung in Dortmund“ in „Heimat und Reich“ Jg. 1935, H. 11, S. 433-438 folgendes zu Kuhmichel: “ …. Überhaupt waren in dieser Ausstellung die Bildhauer zwar nicht zahlreich, aber leistungsmäßig ausgezeichnet und mit ausgeprägten Eigenarten vertreten. Von Hermann Kuhmichels gehaltvoller und überaus gekonnter Gruppenplastik „Liebespaar“ , einer der besten Arbeiten der ganzen Ausstellung, ……“ (zitiert nach: Walter Gödden (Hg.): Westfälische Literatur im Dritten Reich. Die Zeitschrift „Heimat und Reich“. Eine Dokumentation. Teil 1: 1934 – 1937, Bielefeld 2012, S, 198)
Pingback: Rubensfeiern in Antwerpen 1940 und Siegen 1941 | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 13.11. – 25.11.2019 | siwiarchiv.de
2. Diskussionsbeitrag von Dr. Ingrid Leopold:
„Dem Archivar möchte ich meinen Dank aussprechen für Veröffentlichung des Briefes, den Julius Kuhmichel im Oktober 1985 als Reaktion auf das Erscheinen der Broschüre „Kanonen und Kuhmichel“ an die Gesellschaft für christlich – jüdische Zusammenarbeit verschickte.
Die Chronik, bestehend aus Tagebuchaufzeichnungen und Zeitzeugenberichten aus den Jahren 1930 bis 1956, enthält Daten und Fakten aus dem Leben des Künstlers, die betroffen machen.
Hermann Kuhmichel war in der Nazizeit Repressalien und Bedrohungen ausgesetzt, die seine und die Existenz der Familie gefährdeten.
Kontakte zu „ Volksfeinden“ brachten ihn in große Schwierigkeiten.
Da war der Nachbar, ein „Kommunist“, dem er zur Hilfe kam, – der „britische Imperialist“, der einen Holzschnitt – Zyklus von ihm erworben hatte,
oder der bekannte „sowjetische Schriftsteller Maxim Gorki“, mit dem er seit einem gemeinsamen Aufenthalt in der Lungenheilstätte St. Blasien 1927 einen Briefwechsel pflegte.
Mit seinen Plastiken und Holzschnitten zu alttestamentarischen Themen verherrlichte er „das Weltjudentum.“
Angedrohte Strafmaßnahmen wie „Ausstellungs – und Schaffensverbot“ oder „Einsatz in einem Strafbataillon an der Ostfront“ konnten durch Einwirkung einflussreicher Freunde abgewendet werden. Sie rieten ihm, sich vorsichtig zu verhalten, und bei seinem künstlerischen Schaffen das Kunstverständnis der damaligen Zeit zu berücksichtigen und sich anzupassen.
So kamen die Monumentalplastiken bei der Ausgestaltung öffentlicher Bauten zustande.
Bei den Entnazifizierungsmaßnahmen nach dem Krieg wurde Hermann Kuhmichel im März 1948 als „Entlasteter“ eingestuft.
Im Oktober 1985 wurde er im Siegerland als „Nazi“ an den Pranger gestellt.
In der aktuellen Diskussion wird dem Künstler unter anderem vorgeworfen, er habe sich in der Nachkriegszeit nie für seine Mittäterschaft im Dritten Reich entschuldigt.
Ich frage: „Wofür sollte er sich entschuldigen?“
Aus meiner Sicht war es Aufgabe und Pflicht der Gegenpartei, – der Kritiker, -nach Kenntnisnahme der Chronik aus dem Leben Kuhmichels die Verleumdungen einzustellen und eine Entschuldigung auszusprechen. Bis heute ist nichts dergleichen erfolgt. „
Zwischen 1) Biographieforschung im engeren Sinne (Frau Fries, Frau Dr. Leopold u.a.) und 2) Rezeptionsforschung (hier v.a. U.F.O.) sollte sorgfältig unterschieden werden. Beide Ansätze verfolgen unterschiedliche Fragen, deren Vermengung leicht zu vermeidbaren Frustrationen führt.
1a) War H.K. Nationalsozialist? Nein.
2a) Wurde H.K. von den nationalsozialistischen Machthabern vereinnahmt? Ja.
1b) Warum hat er das zugelassen? Materielle Notlage, Sorge um seine Familie, als sozialer Außenseiter ein leichtes Opfer für Erpressung …
2b) Spricht ihn das von seiner Verantwortung als Künstler frei? Nein, denn für die Wahrnehmung von Kunst im öffentlichen Raum spielt die persönliche Tragik des Künstlers keine Rolle. Ob z.B. ein Kriegerdenkmal freiwillig von einem glühenden Militaristen oder im gleichen Stil unter Zwang von einem heimlichen Pazifisten geschaffen wurde, ist für die Betrachter gleichgültig; sie sehen darin ein „Vorbild“ des propagierten Zeitgeistes und werden davon ggf. in dessen Sinne beeinflusst.
1c) Wie stand H.K. nach 1945 zu seiner vorangegangenen Schaffensphase? Vielleicht wird sich das aus den Lebensdokumenten nie erschließen; vielleicht gab es im engsten privaten Kreis Bekundungen von Scham und Reue; vielleicht war es ihm einfach zu peinlich, öffentlich dazu Stellung zu nehmen; vielleicht war ihm die öffentliche Wahrnehmung seiner Person egal … — manches ist denkbar.
2c) Eignet sich der ambivalente H.K. nach 1945 als Vorbild? Sicher nicht — was aber zu der allgemeineren Frage führt, warum „prominente“ Menschen, die ebenso widerspruchsvoll sind wie jeder „Namenlsose“, überhaupt als Vorbilder in Anspruch genommen werden sollen. H.K. stand, wenn ich mich recht erinnere, vor einigen Jahren auf der Kandidatenliste für die Wahl des „größten Siegerländers aller Zeiten“ (oder der letzten 200 Jahre). Solche an den Heroenkult vergangener Epochen erinnernde Veranstaltungen scheinen mir wenig hilfreich für die Schärfung des historischen Blicks zu sein.
Danke für den Beitrag! Ein kleine Richtigstellung sei aber erlaubt: Hermann Kuhmichel stand nicht auf der Kandidatenliste der „20 Größten“ anlässlich des 200jährigen Jubiläums des Kreis Siegen-Wittgenstein.
Oh. Nun ja, alte Knaben und ihr Gedächtnis sind ein Thema für sich … :-(
Alles gut. Ich habe selber zur Vorsicht einmal nachgesehen. Es gab ja ein umfangreichere Liste, aus der die 20 Vorschläge ermittelt wurden. Übrigens wurde dieser längere Liste weiterbearbeitet, u.a. mit der Rubrik „Zwielicht“. Sie können sicher erraten, wer darin Platz gefunden hat. Ich meine berechtigterweise, wie die laufende Diskussion zeigt.
a) Kleiner Nachtrag zu dem belgischen Politiker Léon Delwaide, einem katholischen Glaubensbruder, dem nach dem Manuskript des Kuhmichel-Sohns der Künstler seinen Auftrag zu einer Rubens-Büste zu verdanken hatte und den er schon 1936 kennenlernte:
„We believe that Leon Delwaide carried the responsibility for the arrest, the deportation, and the death of more than 3.600 Jews from Antwerp. (Sylvain Brachfeld, A gift of life. The deportation and the rescue of the Jews in occupied Belgium (1940-1944), Jerusalem 2007, S. 31
Delwaide: „a blatant antisemite and xenophobe before the war and who became the mayor of Antwerp during the occupation (David Bankier, Israel Gutman (Hrsg.), Nazi Europe and the Final Solution, Jerusalem 2009, S. 486)
b) Ob Rubens-Büste, Ehrenbriefkassette, die verschiedenen Soldaten-/Offiziersdarstellungen oder später die Ausschauende oder „Das Wirtschaftswunder: Was K. mit „entarteter Kunst“ zu tun gehabt haben könnte, ist einfach unbegreiflich. Seine bislang öffentlich bekannten Kunstwerke sind ausnahmslos von einer derart biederen und für einen Künstler derart durchschnittlichen und unauffälligen, geradezu antimodernen Machart, dass auf diese Idee selbst der bösartigste völkische Kritiker unmöglich kommen kann. Wie sich das zusammenreimen könnte, ist absolut rätselhaft.
Ergänzungen zu Delwaide unter Punkt a) des Kommentars von Ulrich F. Opfermann an anderer Stelle: http://www.siwiarchiv.de/ausstellung-hermann-kuhmichel-leben-und-werk/#comment-84877
Eine Bitte des Admins: Kommentare, die sich ausschließlich auf den „Rubenspreis 1941“ beziehen, bitte hier posten: http://www.siwiarchiv.de/rubensfeiern-in-antwerpen-1940-und-siegen-1941/ . Danke!
Pingback: Sohlstätte im Kreisgebiet | siwiarchiv.de
Auf die Wikipedia-Löschungsdiskussion verweist kritisch Archivalia: https://archivalia.hypotheses.org/107443 .
Habe beim aufräumen ein ca. 70 Jahre altes kleines Ölgemälde
ca 50 x 60 cm. gefunden. Es handelt sich um ein Ölgemälde auf Holzfaser-
platte. Meines Erachtens handelt es sich hier um spanische Tänzerinnen.
Ich bin kein Fachmann, trotzdem finde ich das Gemälde als typischen
Helsper. ( ist signiert)
Persönlich habe ich Walter sehr gut gekannt.
Da das Bild meiner Meinung nach schützenswert ist, wüsste ich gerne,
wie ich weiter verfahren soll. Ich bin gerne bereit, das Gemälde
in die richtige Hand ( evtl. Frau Jasper ) abzugeben.
Eine kurze Biographie von Karl Born befindet sich nun auf der Seite
http://widerspruchundwiderstandimnsinsiwi.blogsport.de/
Danke für den Hinweis!
Pingback: Architektur 1960+, Brutalismus im Kreisgebiet: Katholische Kirche Bad Laasphe | siwiarchiv.de
Pingback: Architektur 1960+, Brutalismus im Kreisgebiet: Katholische Kirche Bad Laasphe | siwiarchiv.de
Pingback: Architektur 1960+, Brutalismus im Kreisgebiet: Katholische Kirche Bad Laasphe | siwiarchiv.de
Pingback: „kinder sollen einen raum haben, in dem sie das sein können, was sie wollen“ | siwiarchiv.de
Das erste hab ich mal hierhin rübergesetzt und es ergänzt, um die Lesefreundlichkeit und den Informationsgehalt zu verbessern. Mir ging es um die Frage, in welchem Milieu man sich bewegte, wenn man von flämischen oder deutschen völkischen Heimatenthusiasten umgeben war:
a) Nachtrag zu dem belgischen Politiker [Dr.] Léon Delwaide, einem katholischen Glaubensbruder, dem nach dem Manuskript des Kuhmichel-Sohns der Künstler seinen Auftrag zu einer Rubens-Büste zu verdanken hatte und den er schon 1936 kennenlernte:
“We believe that Leon Delwaide carried the responsibility for the arrest, the deportation, and the death of more than 3.600 Jews from Antwerp. (Sylvain Brachfeld, A gift of life. The deportation and the rescue of the Jews in occupied Belgium (1940-1944), Jerusalem 2007, S. 31
Delwaide: “a blatant antisemite and xenophobe before the war and who became the mayor of Antwerp during the occupation (David Bankier, Israel Gutman (Hrsg.), Nazi Europe and the Final Solution, Jerusalem 2009, S. 486)
b) Dr. Robert van Roosbroeck arbeitete seit 1933 bei der Zeitung und gehörte zu jenen Mitarbeitern der Tageszeitung De Schelde, die dort eine prodeutsche Positionierung durchsetzten. Er trat dem völkischen Vlaamsch Nationaal Verbond bei und nahm Teil an den Aktivitäten von DeVlag (s. o). Nach der NS-Besetzung wurde er Leiter des Amts für Erziehung von DeVlag. Wie schon im Ersten Weltkrieg kollaborierte er mit der Besaatzungsmacht. 1940 tratt er der Allgemeinen SS Flandern bei und wurde Leiter des Nederlandsche Kultuurraad. 1942 wurde er unter Delwaide Beigeordneter für das Unterrichtswesen in Groß-Antwerpen und erhielt eine Hochschullehrerstelle. 1944 flüchtete er nach Deutschland und wurde Mitglied einer dort befindlichen flämischen „Exil-Regierung“.
Nach dem NS-Ende tauchte er in Antwerpen unter. In Abwesenheit wurde er zum Tode verurteilt und verschwand in die Niederlande. Da die westliche Politik bewährte Antikommunisten gut brauchen konnte, konnte er sich ab 1954 frei bewegen, ab 1970 auch in Belgien und unter zahlreichen Pseudonymen weiterhin Flämisch-Völkisches publizieren. (Armand van Nimmen, Rob Van Roosbroeck en tijdgenoten, Gent 2014)
c) Die westfälische Zeitschrift „Heimat und Reich erschien zwischen 1934 und 1943. Schriftleiter war Josef Bergenthal, Parteigenosse und SA-Mitglied, etwas später auch Landesleiter der Reichsschrifttumskammer. Herausgeber war der Siegerländer Altnazi und Landeshauptmann Karl-Friedrich Kolbow (http://akteureundtaeterimnsinsiegenundwittgenstein.blogsport.de/verzeichnis/gesamtverzeichnis/#kolbow). Das abgebildete Inhaltsverzeichnis sagt genug. Es nennt die Prominenz der westfälischen Heimat- und Nazi-Literatur (Westfälische Literatur im „Dritten Reich“, Die Zeitschrift Heimat und Reich. Eine Dokumentation. Herausgegeben und bearbeitet von Walter Gödden (Veröffentlichungen der Literaturkommission für Westfalen, Bd. 51, Bielefeld 2012)
d) Franz C/Klemens Gieseking: kommt noch.
Im Anschluss an
http://www.siwiarchiv.de/rubensfeiern-in-antwerpen-1940-und-siegen-1941/#more-21736
das Fazit gerne hier:
Die Heimatszene, in der Kuhmichel sich bewegte, arbeitete und erfolgreich war, war offen, nicht für „entartete Kunst“, sondern für völkisch-heimatliche, die den völkischen Zusammenhalt stärkte. In Westfalen, dem das Siegerland bekanntlich entgegen seiner Geschichte zugeschlagen wurde, wie in Flandern. Sie war bei Licht betrachtet allerdings ein Sumpf. Die umfangreiche öffentlich bekannte NS-Produktion von Kuhmichel, die nach Aussagen Jahrzehnte später angeblich das „Verhungern“ der Familie verhindern sollte, belegt das.
Pingback: Ausstellung “Vom Bauhaus zum AppHaus – kreative Spielräume gestern und morgen” | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Adventskalender 4/2019 | siwiarchiv.de
Pingback: Broschüre: “Die Siegener Synagoge 1904 -1938” erschienen | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Adventskalender 6/2019 | siwiarchiv.de
Guten Morgen, ich möchte die Beiträge gerne abonnieren.
Viele Grüße von Eva-Nadine Wunderlich
Dafür muss ein entsprechendes „Feed-Lese“-Plug-in in ihrem Browser installiert werden.
Hallo, zum Artikel über Dipl.Ing. Hermann Reuss: es befindet sich ein Gedichtband von ihm bei mir, von 1925. Bitte nehmen Sie Kontakt auf, mit freundlichem Gruß G. A.
Pingback: siwiarchiv-Adventskalender 8/2019 | siwiarchiv.de
Ich finde, es wäre wohl angemessen gewesen, auf die Literatur-/Forschungsbasis dieser Veranstaltung hinzuweisen.
Hallo Herr Opfermann, danke für den Hinweis. Wir haben wirklich umfassend recherchiert, viele weitere Quellen erschlossen und genutzt, aber Ihr Buch „Heimat-Fremde“ ist nach wie vor grundlegend- und im Programm und auf den Plakaten wird ihre Arbeit als Quelle und Inspiration genannt.
In der Ankündigung der Veranstaltung war es uns wichtig, das – wovon ich ausgehe- gemeinsame Anliegen ins Zentrum zu rücken. Wir hätten sonst auch noch weitere Namen nennen müssen, denen wir viel verdanken. Daher bitte ich Sie um Verständnis, dass wir eine Anleihe beim Titel Ihrer Monografie gemacht haben. Die Jugendlichen lesen nicht aus Büchern – sie haben sich aus den Materialien eigene Texte entwickelt, die ausdrücklich nicht dokumentarischen Anspruch erheben. Ich freue mich über einen Austausch!
Danke für die weiteren Informationen zur Veranstaltung! Wer die Auseinandersetzungen des „Jungen Theaters Siegen“ mit zeithistorischen Themen kennt, weiß deren Durchdringung des jeweiligen Themas zu schätzen.
Ich sag’s auch deshalb, weil es seit einiger Zeit immer wieder Anlässe gibt,sich zu fragen, was man da eigentlich die ganzen Jahrzehnte, die es inzwischen sind, gemacht hat.
Hallo Herr Opfermann, habe ihr Buch „Heimat Fremde“ gelesen. Was mich wundert ist, dass eine Aufarbeitung der Zwangsarbeit nach dem Krieg nie richtig stattgefunden hat. Wenn ein Bernhard Weiss, ein verurteilter Kriegsbrecher, Präsident der IHK Siegen für 20 Jahre war, und noch heute ein Platz in Dahlbruch nach ihm benannt ist. Dann kann man das nur durch Wegschauen erklären. Kann man Sie irgendwie kontaktieren?
Lieber Herr Kiendl, Kontaktdaten in der Mail, die ich Ihnen schickte.
Aber um kurz auch in der kleinen Öffentlichkeit, die sich hier vorfindet, auf die inhaltliche Seite Ihrer Frage einzugehen: Die Zahl der verurteilten und insbesondere der unverurteilt gebliebenen Menschheits- und Kriegsverbrecher in Westdeutschland ist Legion gewesen (Lesetip etwa nur einmal Norbert Freis „Vergangenheitspolitik“ von 1999). Die juristischen Weichen waren nach einer kurzen Schockphase so gestellt, dass die Herrschaften unbehelligt an die Schreibtische, um die es hier vor allem geht, wieder zurückkehren oder das Ruhegeld in Empfang nehmen konnten. Das sollte so sein, weil man bewährte Antikommunisten in leitender Funktion unbedingt brauchte. Dem Schweigen über deren Untaten entsprach das Schweigen der Schulen und weiter Teile der Medien über die Verbrechen in den Nazijahren. Wo und wie hätten Menschen sich schlau machen können, ohne in den schlimmen Verdacht zu kommen, „Parteigänger Ulbrichts“ zu sein, der existenzgefährend sein konnte?
Nur zwei konkrete Beispiele:
a) Die kleine mit schlichtesten Mitteln zusammengestellte Wanderausstellung „Ungesühnte Nazijustiz“ (1959-1952), die in den Niederlanden und Großbritannien ein großer Erfolg war und viel Lob erhielt, wurde hier als ein Werk von Anhängern „Pankows“ (= „Ostzone“) verrissen. Die SPD-Studenten, die sie erarbeitet hatten, wurden von ihrer Partei ausgeschlossen.
b) Der Film „Das Mädchen Rosemarie“ enthielt eine wenige Minuten andauernde Szene, in der mit vergangenheitspolitischem Bezug zur neuen Bundeswehr Mario Adorf und ein zweiter Schauspieler „Wir hamm‘ den Kanal noch immer nicht voll“ sangen. Die Szene musste entfernt werden.
c) Es gab einen Prozess zum „Zigeuner-Komplex“, sprich zu den Verbrechen an der Roma-Minderheit. Mehr als 70 Beschuldigte. Niemand wurde verurteilt. Es gab einen Angeklagten, den vormaligen Kripochef der Bundeshauptstadt Bonn. Er wurde wg. „Verhandlungsfähigkeit“ aus dem Verfahren entlassen. Der „fröhliche Rheinländer“, verantwortlich für eine große Zahl von Auschwitz-Einweisungen, hatte sich in diesen Zustand gesoffen. Alkoholabusus. Einer aus der Spitze der Bonner Gesellschaft.
Nein, „der“ Bevölkerung den Vorwurf machen zu wollen, sie sei der unmoralische Teil gewesen, sie sei nach wie vor eine Nazi-Bevölkerung geblieben, das finde ich völlig unangebracht. Die politische Führung organisierte die Unwissenheit ihres Wahlvolks, deren Verdummung durch Unterlassen von Information und durch die Verbreitung von Mythen. Dabei hatte sie eifrige Helfer in allen Führungsgruppen, keinesfalls nur in der Wirtschaft, wie man in Betrachtung des Bernhard Weiss vielleicht meinen könnte.
Hat technisch wohl nicht geklappt meine Adresse ch.Kiendl@kiga-gmbh.de
Habe leider keine Email erhalten
Ulrich Opfermann
HeimatFremde
„Ausländereinsatz“ im Siegerland, 1939 bis 1945:
wie er ablief und was ihm vorausging.
Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung Bd. III
Herausgegeben vom Förderverein „Geschichte der Arbeiterbewegung und der Gewerkschaften für den Kreis Siegen-Wittgenstein“ e.V.
Hell&Dunkel Verlag, Siegen 1991
ISBN 3-928347-00-4
http://zwangsarbeitimsiegerland.blogsport.de/start/
Danke für die bibliographische Angabe!
Ergänzung: Seit November 2015 verweist die siwiarchiv-blogroll auf das regionale Online-Angebot zur Zwangsarbeit.
Mit 5 Silbergroschen (oder doch Schokogroschen?) war diese Spendengala auch nicht ganz billig, oder? 30 preußische Silbergroschen = 1 Taler steht zumindest bei Wikipedia
Danke für den Hinweis! Im Wiki der Computergenealogen finden sich einige Hinweise zum konkreten Werte:
„… Einkommensbeispiele
Um 1850 Wochenlohn eines Baumwoll- und Leinenwebers: 2 Taler, 3 Silbergroschen
Um 1850 Tageslohn einer Strickerin oder Weißnäherin in Berlin: 4 Silbergroschen
….
Beispiele von Lebenshaltungskosten
Um 1850 Wochenkosten eines 5 Personenhaushaltes: 3 ½ Taler
Um 1850 mittlere Miete: 20 Groschen, 20 Pfennig
Um 1850 3 ½ Pfund Fleisch: 12 Groschen, 3 Pfennig
Um 1850 3 Schwarzbrote: 10 Groschen, 6 Pfennig
Um 1850 6 Becher Kartoffeln: 11 Groschen
Um 1850 1 ½ Pfund Butter: 9 Groschen
Um 1850 3/4 Pfund Kaffee: 5 Groschen
Um 1850 Drei Pfund Mehl: 3 Groschen 6 Pfennig
Um 1850 Heizkosten: 5 Groschen
Um 1850 2 Portionen Gemüse: 3 Groschen
Um 1850 Fett: 3 Groschen
Um 1850 Reis: 1 Groschen, 6 Pfennig
Um 1850 Milch: 2 Groschen, 6 Pfennig
Um 1850 Bier: 1 Groschen, 6 Pfennig
Um 1850 Seife: 2 Groschen
Um 1850 Schulgeld: 4 Groschen …“
Vielleicht war das ein besonderer Weihnachtsbaum von dem Gasthof oder der Baum, der in der Stadt aufgestellt war. Nach Weihnachten wurde er in seiner eigentlichen Funktion ja nicht mehr gebraucht, aber das Holz war ja noch von Nutzen!
Ich vermute einfach mal, dass die Angabe „Verlosung des Baumes“ hier irreführend ist. Die traditionsreichen Weihnachtsbaumverlosungen waren Veranstaltungen, bei denen rund um den Baum drapierte oder daran gehängte viele kleine Gaben (Spenden) verlost wurden. Bei so großen Gruppen, wie sie eine Gastwirtschaft fassen konnte, kam da schon einiges an Teilnahmegebühren „zum Besten der Armen“ zusammen. Den Baum selbst wird im vorliegenden Fall wahrscheinlich Gastwirt Wolschendorff beschafft und nach Weihnachten verheizt oder frierenden Nachbarn überlassen haben. Von den eher gut betuchten Gästen, die sich bei der Verlosung die Ehre gaben, war aber sicher keiner auf das bisschen Holz angewiesen.
Das hört sich sinnvoller an, als meine Vermutung.
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 26.11. – 8.12.2019 | siwiarchiv.de
Zur Geschichte der Zwangsarbeit im Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein wird auch auf folgende Online-Angebote, die bereits auf siwiarchiv vorgestellt wurden (Link 1, Link 2), verwiesen:
1) Aktives Gedenkbuch für die Opfer des Nationalsozialismus im Kreis Siegen-Wittgenstein. Dort kann u. a. nach Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter suchen.
2) Archiv des internationalen Suchdienst in Arolsen. Dort kann nach Personen und Orten im Kreisgebiet gesucht werden. Es findet sich auch eine Anzahl Treffer zu Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern.
Vielen Dank für die Hinweise, ich kenne einige, andere noch nicht, um so wichtiger für unsere weitere Arbeit!
Pingback: Führung durch die Ausstellung “Hermann Kuhmichel – Leben und Werk” | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Adventskalender 8/2019 | siwiarchiv.de
Zur Ehrung Reinhard Gämlichs s.a. :https://www.hilchenbach.de/Aktuelles/Verdienstmedaille-f%C3%BCr-Reinhard-G%C3%A4mlich.php?object=tx,2632.7.1&ModID=7&FID=2632.3661.1&NavID=2632.2&La=1&NavID=2632.647.1&startkat=2632.372
Heute habe ich mir die Kuhmichel Ausstellung in Freudenberg angesehen.
Das vielfältige künstlerische Schaffen von Kuhmichel wird durch die verschiedenen Exponate eindrucksvoll dargestellt und hat mich schon beeindruckt. Über den künstlerischen Gehalt lässt sich diskutieren, die Wahrnehmung von Kunst bleibt etwas Individuelles.
Neben den Exponaten der Ausstellung gab es viele Bilder von Kuhmichels
Kunst im öffentlichen Raum z. B. der Skulpturen in der Wenscht.
Es fehlten allerdings die Fotos seiner militärischen Figuren oder der von ihm gestalteten Ehrenbriefkassette von 1933. Die kurze Darstellung der Zeit von 1933 – 1945 auf dem ausliegenden Flyer reicht nicht aus, um die Rolle Kuhmichels in dieser Zeit ausreichend dar zu stellen. Die Zeitungsartikel zur Rubenspreisverleihung von 1941 sind leider ohne Kommentierung bezw. einer Einordnung in den hist. Kontext ausgelegt. Das ist so zu wenig.
Kuhmichel mag dem NS vielleicht abgelehnt haben, arrangiert hat er sich aber mit ihm. Bestimmt hätte er seine Familie mit anderen künstlerischen Tätigkeiten über Wasser halten können aber er ging den Pakt mit dem Teufel ein und hat geliefert wie gewünscht! Genau dieses Mitläufertum hat dem Faschismus Halt gegeben und seine Macht gefestigt, besonders wenn es sich um bekannte (hier regional bekannte) Personen handelte. Dazu bedurfte es keiner innerlichen Akzeptanz des NS oder einer Parteimitgliedschaft.
Leider kommt dies alles in der Ausstellung nicht vor und hier kann ich nur aus dem ersten Beitrag von Dr. Opfermann zitieren „…wird drei, vier Generationen später wieder von heimat- und bildungsbegeisterten Bürgern gefeiert. Als sei nichts geschehen.“ Liebe AusstellungsmacherInnen in Freundenberg ich schätze ihre Arbeit sehr, die Ausstellungen zu Adolf Sänger und Karl Jung-Dörfler haben mir sehr gut gefallen, aber so wie in dieser Ausstellung zu Kuhmichel geht es einfach nicht!
Pingback: siwiarchiv-Adventskalender 15/2019 | siwiarchiv.de
1. Danke für den Bericht über den Ausstellungsbesuch und die konstruktive Kritik.
2. Ich muss allerdings anmerken, dass auch Saenger ein – um Ton der Kuhmichel-Kritiker zu sprechen – Nazi-Künstler war. Auch Saenger hat Aufträge für NS-Ministerien in Berlin ausgeführt – s. a. http://akteureundtaeterimnsinsiegenundwittgenstein.blogsport.de/a-bis-z/gesamtverzeichnis/2/#saenger. Nicht das hier ein falscher Eindruck entsteht.
16. Jh.
Leider nein!
Liebe Kinder aufgepasst!
Da schauen wir mal hier nach:
Seit wann beschert in Wittgenstein das „Christkind“ zu
Weihnachten die Kinder?
Zeitschrift Wittgenstein, Jg. 86 (1998), Bd. 62, Heft 4, S. 154
Interessanter Hinweis. Wenn die dort aufgeführte Information die gesuchte Antwort ist, müsste aber die Frage präzisiert werden: „Spätestens seit wann …“ ist der Weihnachtsbrauch in Wittgenstein quellenmäßig nachweisbar? Das Christkind könnte ja schon vor dem genannten Jahr aktiv gewesen sein (vielleicht sogar im oben vermuteten „16. Jh.“, bald nach der Reformation), ohne dokumentierte Spuren hinterlassen zu haben.
Hier geht es aber nicht um Spekulationen ….., sondern um den Zeitpunkt, wo die Bescherung durch das Christkind in Wittgenstein quellenmäßig in Archiven belegt ist. Schließlich ist siwiarchiv ein Archivblog ;-) .
Die Kritik an der Fragestellung ist berechtigt. Aber die Fragestellung wurde aber der Einfachheit halber übernommen.
Rund um 1880
LG
Leider nein.
Die oben erwähnte Publikation „Hauberge im Siegerland“ erschien in „Heimat und Reich“, Jg. 17, 1935 Heft 2, S. 57 – 60.
Zu Otto Arnold s. a. Karl Heinz Gramss: Mit Gespür das Siegerland durchstreift. Otto Arnold – Ein Fotopionier zwischen den Weltkriegen, in: Siegerland, Band 62 Heft 3-4 / 1985, S. 66ff
Ich würde zum Zeitpunkt 1950 bis 1970 tippen
Es war nicht im 20. Jahrhundert.
Wenn es nicht im 16. Jh. und auch das 19. und 20. Jh. ausgeschlossen ist, kann es sich um das 17. oder 18. Jh. handeln. Ich denke mal noch früher könnte es ausgeschlossen sein.
Explizit ausgeschlossen habe ich das 19. Jahrhundert ja noch nicht, aber aufgrund des Kommentars von Kollegen Kunzmann, ist Ihre diesbezügliche Annahme wohl korrekt. Somit bleiben noch 200 Jahre übrig!
Nach einigem Nachlesen komme ich zu folgendem Schluss. Martin Luther hat im 16. Jh. angefangen das es ein Christkind ist. Also wird das Christkind im Wittgensteiner Land wahrscheinlich im 17. Jahrhundert das erste Mal erwähnt bzw. dokumentiert. Wenn das so auch nicht stimmt weis ich auch nicht weiter.
Juli 1818
Leider nein!
@ Anke Ermert: Ihre Vermutung ist richtig. Leider gibt die hier bereits erwähnte Literatur eine konkrete Jahreszahl, so dass ich befürchtee, dass nun jemand anderes quasi den Elfmeter verwandelt.
Dann sage ich die goldene Mitte des 17. Jh. also das Jahr 1650.
Sie sind hartnäckig! Aber: leider nein, es war früher.
Das Jahr 1630
Sie nähern sich …..
Nun aber …
Damit der Ansporn nicht nachlässt macht die Geschichtswerkstatt Siegen aus dem kleinen Buchpreis einen „großen“ und lobt noch ein Jahrbuch „Siegener Beiträge“ für den „Gewinner“ aus. Die Auswahl kann frei aus den noch lieferbaren Bänden getroffen werden. Unter http://geschichtswerkstatt-siegen.de/ (Rubriken Aktuelles und Publikationen) finden sich alle Bände und über die Email-Adresse kann Kontakt mit der Geschichtswerkstatt aufgenommen werden.
Das Jahr 1620
Das könnte zu früh sein, aber 1633 wäre auch noch im rennen.
@ Peter Kunzmann, Bernd Plaum: Danke für die Zurückhaltung!
@ Anke Ermert: Hartnäckigkeit wird auch von siwiarchiv belohnt! Die Antwort ist korrekt!
Vielen Dank. Wenn mich was interessiert bin ich leider sehr hartnäckig.
Raten ist doof. Belegen ist besser.
Der Beleg ist bereits in den Kommenataren genannt worden. Dort heißt: „Man ist geneigt, das „Christkind“ als Gabenbringer dem weihnachtlichen Brauchtums-kreis der bürgerlichen Kultur des 19. Jahrhunderts zuzuordnen. Weit gefehlt! In der Geld-rechnung der Kellerei Wittgenstein des Jahres 1620, abgelegt durch den Kellner Joist Streithov (WA Akte R 4) lesen wir unter den Ausgaben:
„Den Bäckern: Den 24. t. Xbr. (Dez.) für Wecken, so das Christkindgen ausgeteilt, Johan-nes Hasselbach gegeben 0 – 12 – 0.“ (Das sind 12 Albus oder ein halber Gulden.)
Der Laaspher Bäcker Hasselbach backte also die Wecken, die das Christkind am Heilig-abend an die Laaspher Kinder verteilte. Der gütige Spender war Graf Ludwig d.J., der ein Vierteljahr zuvor aus kurpfälzischem Dienst in Simmern in die heimische Residenz zu-rückgekehrt war.“
Dazu sage ich. Sag das richtige Jahr.
Rezeption Otto Arnolds:
Ausstellungen:
1) Fotoausstellung „Otto Arnold. Fotografie 1927 -1938. Arbeitswelt und Landschaft des Siegerlandes, Siegen, Kreishaus, Koblenzer Str, 25.2. bis 23.3.1989
2) Fotoausstellung „Häute, Leim und Filz“ im LWL-Freilichtmuseum Hagen, Gelbgießerei, 16.7. zum 31.10.2017, Link: https://www.siwiarchiv.de/fotoausstellung-haeute-leim-und-filz/
Weil ich das Gefühl habe, dass diese Rätselrunde von leisen Missklängen begleitet war, hier noch ein paar Anmerkungen eines durch „Zurückhaltung“ aufgefallenen Beobachters.
1. Nicht jede(r) hat das Privileg, z.B. die Zeitschrift „Wittgenstein“ sofort in Reichweite zu haben. Literaturhinweisen kann also nicht immer ohne Aufwand (Bibliotheks-/Archivbesuche) gefolgt werden. Da bleibt es dann letztendlich doch beim Raten (weshalb es ja auch „Rätsel“ heißt). Rätsel, zu deren Lösung man auf Digitalisate zurückgreifen könnte, würden sich vielleicht noch größerer Beliebtheit erfreuen.
2. Die anfängliche Vermutung von Frau/Herrn (?) Sassmannshausen würde ich nicht einfach so als falsch abtun, sondern sehe darin eine ernstzunehmende Hypothese. Warum soll in dem reformations-freudigen Ländchen Wittgenstein nicht schon etliche Jahrzehnte vor 1620, also wirklich im 16. Jahrhundert, die Abkehr vom heiligen Nikolaus und Zuwendung zum „Christkind“ erfolgt sein? Der von Werner Wied 1998 erbrachte Nachweis war wohl eher ein Zufallsfund, den er im Archiv nicht weiter verfolgt hatte. „Erstmaligkeiten“ sind naturgemäß schwer zu verifizieren.
3. In der besinnlichen Adventszeit könnte man auch einmal das Schweigen der Quellen auf sich wirken lassen. Das meiste über die Vergangenheit werden wir niemals wissen, weil schlichtweg keine Informationen an die Nachwelt weitergegeben worden waren.
zu 2) ja, das war meine Vermutung. Ausgehend von Martin Luther und seiner ablehnenden Haltung zur Heiligenverehrung hat er in/seit den 1530er Jahren das „Christkind“ als Alternative zum Hl. Nikolaus gesehen… Interessant auch, dass Weihbischof Johannes Bonemilch -der akad./theologische Lehrer Luthers- in Laasphe geboren wurde.
@ Peter Kunzmann @ Andreas Saßmannshausen:
Es wird nicht bestritten, dass das Christkind nicht schon vorher in Wittgenstein beschert haben kann. Ob nun Vermutung oder wohlbegründete Hypothese – Fakt ist allerdings die Quellenlage, nach der sich erst 1620 ein schriftlicher Niederschlag für dieses Brauchtum findet.
Ferner war der Hinweis publiziert, auffindbar in einer Online-Bibliograhie und er wurde schließlich schon recht früh hier gepostet, so dass ein Blick in das Wittgenstein-Heft allen Teilnehmenden wie auch immer möglich gewesen wäre.
@Peter Kunzmann:
1) Entweder hartnäckig raten und etwas arbeiten – also ein bisschen was muss man für 2 Bücher schon tun.
2) Ja, Geschichte ist leider quellenbasiert. „Virtuelle“ Geschichte führt im besten Fall zu anderen oder gar besseren Fragen – allerdings in den seltesten Fällen wohl zu fundierten Ergebnissen.
In diesem Fall ist die aufgeworfene Frage: Warum gibt es keinen Quellenbeleg für die Bescherung durch das Christkind im Wittgensteiner Land, obwohl dies weit vor dem ersten Nachweis einer Bescherung durch das Christkind reformiert war? Doch dies ist eine andere Frage und muss von anderen beantwortet werden …..
Wird das „Siwi-Adventsrätsel“ der statistische Spitzenreiter dieses Jahres???
Literatur: Theoretisch schon klar, aber im praktischen Leben überlegt man es sich (besonders im Winter) doch, ob man nach Feierabend extra zur Bibliothek fährt, bloß um wegen so eines Rätsels etwas nachzuschlagen.
Online-Bibliographie „Wittgenstein“: Wer sie kennt, ist manchmal im Vorteil. Letzter Bearbeitungsstand: 4. Dezember. Also ein guter Anlass, wieder einmal darauf hinzuweisen.
http://www.wittgensteiner-heimatverein.de/bibliografie.html
Das exakte Jahr hätte man dort auch nicht gefunden, aber die Eingrenzung auf die Zeit des Dreißigjährigen Krieges.
„Geschichte ist leider quellenbasiert“: Wieso „leider“? Und wird sie diesem Anspruch gerecht? Als bekennender Quellenfetischist ärgere ich mich eher permanent darüber, dass „Geschichte“ sehr oft jenseits aller Quellenbasis betrieben wird. Ich erinnere an den „Fall Reibekuchen“ vor 3 (?) Jahren. (Herr Burwitz wartet vermutlich immer noch auf Antwort vom Heimatbund.)
Noch älterer Quellenbeleg: Wer sagt denn, dass es keinen gibt? Der für 1620 wurde fast vier Jahrhunderte später entdeckt. Irgendwo in den weltlichen und kirchlichen Archiven Wittgensteins könnte irgendwann noch eine weitere Entdeckung gelingen. Oder auch nicht. Man weiß es eben nicht. Solche kleinen Funde können allerdings dazu ermutigen, beim Durchforsten alter Akten oder auch Zeitungen über den engen Horizont der eigentlich verfolgten Themen hinauszuschauen.
Und wer war nun der junge Mensch, der 1620 in Laasphe als „Christkind“ kostümiert die Wecken verteilte???
In der Tat: Ich warte noch immer. Aber vielleicht recherchiert der Heimatbund noch. Frohe Feiertage!
Pingback: Ausgabe III-2019 von “Wittgenstein. Blätter des Wittgensteiner Heimatvereins e.V.” erschienen | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 9.12. – 21.12.2019 | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Adventskalender 23/2019 | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Adventskalender 24/2019 | siwiarchiv.de
Hallo lieber Bernhard,
Du im Internet!!!
LG Deine Mutti
Anna Lohrum u.Christa
Bleuel
Auch ich habe ein Gemälde vom Matterhorn, signiert mit „S.R.Vogt“ und auf der Rückseite ist noch ein Schriftzug auf einen Papierstreifen aufgeklebt. Geschrieben mit einer Schreibmaschine steht hier:
„5485 S.R. Vogt: Matterhorn“
Es ist gerahmt, scheinbar noch im Originalrahmen, welcher allerdings beschädigt ist.
Größe ca. 30 cm x ca. 40 cm
Können sie mir näheres zu diesem Bild erzählen z. B. wann es entstand, ob es mehrfach vom Maler gefertigt wurde, ob er vor Ort war …
Ich bedanke mich für Ihre Bemühungen. Cornelia Hansche
Pingback: Landtag beschließt Stiftung “Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen” | siwiarchiv.de
Pingback: Landtag beschließt Stiftung “Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen” | Archivalia
Pingback: 20.12.1679 – Todestag Johann Moritz von Nassau-Siegen | siwiarchiv.de
Nach einem ersten Durchhören, halte ich den Beitrag im Großen und Ganzen für gelungen! Was gut deutlich wird, sind die unterschiedlichen Betätigungsfelder des Johann Moritz, zudem ist der Beitrag um ein ausgewogenes Bild bemüht. Der Sendungstitel „Tod des Feldmarschalls Johann Moritz von Nassau-Siegen“ hat mich zuerst zwar etwas befremdet, da das Militärische sehr in der Vordergrund gerückt wird, aber es im Beitrag hauptsächlich um seine Projekte als „Renaissance Mensch“ in Politik, Architektur und Gartenbau geht. Tatsächlich stand Johann Moritz die meiste Zeit seines Lebens in militärischen Diensten und es gibt kaum ein Bild von ihm, wo er nicht in Harnisch dargestellt ist.
Einige Fehler im Detail (z.B. Krönchenstiftung 1652 statt 1658, brasilianische Taufschale anstatt peruanische Schale) machen das Radiofeature nicht weniger hörenswert! Die Hintergrundgeschichte zur Taufschale kann man übrigens hier nochmal ausführlich nachlesen: https://wiki.zeitraum-siegen.de/ideen-traditionen/taufschale
Vielen Dank für den Kommentar! Johann Moritz ist ja in diesem Jahr wieder in das Blickfeld der historischen Betrachtung geraten. Ich fand die Betrachtung des populären Radioformats für hier erwähnenswert, da der Anlass so kurz vor den Feiertagen sicherlich dem ein oder der anderen entgangen ist.
Pingback: siwiarchiv-Jahresend-Rätsel | siwiarchiv.de
Das Christkind war
Johannes Hasselbach
Wohl off topic?
Pingback: Auflösung des siwiarchiv-Jahresendrätsels: | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik Dezember 2019 | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Jahresstatistik 2019 | siwiarchiv.de
Matthias Grass schrieb auf rp-online anlässlich des Todestages von Johann Moritz: “ ….. Die Niederländer kennen ihn als den „Brasilianer“. Doch gerade als Brasilianer fiel dunkler Schatten auf die in Kleve als Lichtgestalt verehrte barocke Figur des stattlichen Fürsten. Nassau handelte mit Sklaven, seine Büste wurde zeitweise aus dem Mauritshaus in den Haag verbannt. In Kleve steht sie noch. Museumsdirektor Harald Kunde ist eben kein Bilderstürmer und hat versprochen, die Geschichte des 1604 geborenen Fürsten aufzuarbeiten. ….“ Die Aufarbeitung ist wohl allgegenwärtig …..
Werden in dieser Broschüre Arbeiten von Gertrud Vogd-Giebeler erwähnt ?Wie kann man diese Broschüre erhalten ?
Die Fragen wurden via E-Mail beantwortet.
Der Kuhmichel-Artikel im Regionalen Personenlexikon wurde inzwischen ergänzt (http://akteureundtaeterimnsinsiegenundwittgenstein.blogsport.de/verzeichnis/gesamtverzeichnis/#kuhmichel1). Das Regionale Personenlexikon ist kein Verzeichnis großer regionaler Persönlichkeiten, sondern eins zu Personen, die in der und für die NS-Bewegung, bei der und für die Machtübergabe und während der Geschichte des nachfolgenden Herrschaftssystems in der Region eine Rolle spielten. Es nennt viele personengebundene Daten, die im regionalen Nach-NS-Narrativ häufig fehlten und die z. T. immer noch nicht aufgenommen sind. Ich zitiere von dort:
„… ein hoch talentierter Künstler mit einer überaus vielfältigen Schaffenspalette. Von ihm entstanden Eisengussplatten und -skulpturen, Steinskulpturen und -reliefs, solche aus Holz und Metall, Wandputzbilder (Sgraffitos), Glasmalereien, Monotypien, Holzschnitte, Kohlezeichnungen oder sogar Wandteppiche …“ (Werbetext des Veranstalters, des 4Fachwerk-Mittendrin-Museums, für die Ausstellung [November/Dezember 2019]), das heißt: keine zeitlichen Verweise
„Sein erstes Siegerländer Atelier entsteht 1929 in einem stillgelegten Fabrikgebäude in der Siegener Flurenwende, das später den Krieg nicht übersteht. Den Neuanfang nach dem 2. Weltkrieg wagt Kuhmichel 1953 mit dem Umzug in ein eigenes Haus mit Atelier am Weidenauer Schneppenberg. … Die Ausstellung ermöglicht einen fundierten Überblick über die große Bandbreite seines Schaffens von monumental wirkenden Standbildern bis hin [zu] berührenden fadenfein ausgeführten Textilbildern.“ (Freudenberg online, Werbetext des Veranstalters, undat. [November/Dezember 2019])
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 22.12.2019 – 3.1.2020 | siwiarchiv.de
Die Westfälische Rundschau berichtet heute in ihrer Printausgabe über die Diskussion hier – leider ist online nicht alles kostenlos einsehbar: https://www.wp.de/staedte/siegerland/neue-kontroverse-um-siegener-kuenstler-hermann-kuhmichel-id228049461.html .
Pingback: Denkmalschutz-Handbuch DEHIO wird digital | siwiarchiv.de
Pingback: Siegerlandmuseum wirkt an Forschungsprojekt des Fraunhofer Instituts mit | siwiarchiv.de
Die Siegener Zeitung wies am 20.12.2019 auf die Biographie hin. Leider ist der Artikel online nicht vollständig einsehbar: https://www.siegener-zeitung.de/siegen/c-kultur/suedamerikanische-perspektive_a189730 .
Bei einer schnellen Recherche fand sich folgende regionale Literatur zur weiteren Forschung:
– Achenbach, Heinrich von: Aus des Siegerlandes Vergangeneheit, Bd. VI: 1560 – 1623, 1895 – 1898, S. 21f
– Gerber, Harry: Christof Corvin, in: Nassauische Lebensbilder. Bd 3, 1948, S.117-126.
– Graffmann, Heinrich: Christoph Corvin und sein Werk, in: 1050 Jahre Herborn. Herborn 1964. S. 68-75
– Holler, Siegfried: Christoph Corvin gründete die Hohe-Schule-Druckerei in Herborn. Herborn als traditionsreicher Druckort. in: „Hinterländer Anzeiger“ 159 (1998) Nr. 235 vom 30.8.1998, S. 22
– Knodt, Emil: Das Testament des Christophorus Corvinus, des ersten Buchdruckers der hohen Schule zu Herborn in: Bilder aus der Geschichte der Stadt Herborn. Herborn 1914, S. 110-115
– Schilling, Marlies: Die Piscatorbibel, in: Der Westerwald. Bd. 75 (1982), H. 4, S. 139-143
– Störkel, Rüdiger: Literatur in „Dill-Athen“ : Herborn und die Welt der Bücher 1585 – 1900, in: Mitteilungsblatt des Geschichtsvereins Herborn e.V., Bd. 55 (2007), H. 3/4, S. 118-160, Ill.
– Vitt, Hans Rudi: Christoph Corvinus, Siegens erster Buchdrucker. Zu seinem 4000. Geburtstag, in: Unser Heimatland, 1952, S. 38
Folgendes einschlägiges Archivgut fand sich:
– Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, HHStAW Bestand 1136 (Sammlung A (Kleinschriften zur nassauischen Orts- und Personengeschichte)) Nr. 110 [Vom Wirken des Universitätsbuchdruckers Christoph Corvin in Herborn, 1941 (Zeitungsausschnitt)]
– Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, HHStAW Bestand 95 (Hohe Schule Herborn) Nr. 1908, Buchdrucker Christoph Corvin und dessen Familie, 1615-1622
– Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, HStAD Bestand R 6 A (Bürgerliche Wappen) Nr. NACHWEIS ( Wappennachweis Corvin, (Rab), Herborn, s. a. Herborner Familienwappen, S. 1/ 2 (HfV))
– Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, HStAD Bestand O 64 (Materialsammlung Knodt) Nr. 940, Materialsammlung zum Wappen Corvin[us], Herborn, Usingen, Witzenhausen, [ca. 1914-1969]
Nach den frühen Drucken Corvins kann im „Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts (VD 16)“ gesucht werden.
Die Mappen mit der Korrespondenz zwischen Fritz und Adolf Busch und dem Verlag Breitkopf & Härtel gehören zu den Archivalien, die nach der Rückübertragung des (vor 1989 verstaatlichten) Bestandes an den Alt-Eigentümer Mitte der 1990er Jahre nach Wiesbaden, an den heutigen Verlagssitz von Breitkopf & Härtel, überführt wurden. Freundlicher Hinweis aus dem Sächsischen Staatsarchiv Leipzig.
Ich bin schon sehr erstaunt über die Energie, sich über die Neigung eines längst Verstorbenen Künstlers zum Faschismus auszutauschen.
Und würde mir wünschen, dass mit der gleichen Verve gegen heutige Hass schürende Mitbürger vorgegangen würde. Dafür ist aber leider schon wieder ein Maß an Zivilcourage erforderlich. Und nicht so billig zu haben.
Ich glaube im übrigen aus eigener Erfahrung niemandem, der behauptet, Auftragsarbeiten nicht entgegen genommen zu haben! Dafür steht mir zu sehr der opportunistische vorauseilende Gehorsam meiner Kollegen in einem hierarchischen Gefüge vor Augen
Es hat mich ebenfalls gewundert, dass die Kuhmichel-Diskussion hier bei der Ankündigung entstanden ist. Aber der Verve ist doch begrüßenswert. Denn Kuhmuchels Werk ist ja nicht Vergessen, sondern integraler Bestandteil aktueller Siegener Erinnerungskultur – Rubensbrunnen am Oberen Schloss, Ausschauende am Unteren Schloss, Wächter auf der Kreisgedenkstätte in Siegen-Gosenbach. So wird die vermeintlich akademische Diskussion m. E. sehr aktuell.
Ein bisschen Eergie ist tatsächlich erforderlich, um sich über das private Gespräch hinaus gegen den Mainstream artikulieren zu können. Die wenigsten von uns verfügen schließlich über einen nennenswerten öffentlichen Einfluss oder sind gar Eigner von Medien. Ich hatte anfang des Monats einen Leserbrief an die WR (mit der WP und anderen Medien Teil der „Funke-Gruppe“) geschrieben, der zur dort angesprochenen Kuhmichel-Kontroverse Stellung nahm. Leider erschien er nicht. Er ging so:
„Als Klaus Dietermann, der spätere Gründer der heutigen Siegener NS-Gedenkstätte 1985 mit seiner Schrift „Kasernen und Kuhmichel“ an den Künstler erinnerte, ging es ihm darum, eine Lücke im kollektiven Gedächtnis zu schließen. Die Nazis hatten Mitglieder, Unterstützer und Helfer wie überall so auch im Siegerland auch im christlichen Bildungsbürgertum gehabt. Nein, weder Dietermann noch irgend jemand sonst hat je behauptet, dass Kuhmichel selbst ein eingeschriebener Nazi gewesen sei. Ob das so war oder nicht, wie weit die Schnittmenge Kuhmichels mit nazistischen Überzeugungen etwa beim Abarbeiten der Nazi-Aufträge tatsächlich reichte, ist bis heute nicht hinreichend geklärt. Es ging einfach um die Tatsache von Kuhmichels Auftragskunst für das NS-System. Die war damals vielen unbekannt.
Die Freudenberger Ausstellung kehrt leider in ihren biografischen Verweisen explizit zu den Auslassungen der 1950er bis 1980er Jahre zurück. Sie revidiert den erreichten Kenntnisstand, vertritt einen regionalen Geschichtsrevisionismus. Anders als Dietermanns Schrift klärt sie nicht auf, sondern deckt zu. Dem schwierigen Bemühen des Siegerländer NS-Gedenkens arbeitet sie nicht zu, sondern entgegen. Das ist sehr bedauerlich.“
Der gestrige Vortrag von Frau Dr. Ingrid Leopold im 4Fachwerkmuseum Freudenberg straft das Gesagte von Herrn Opfermann Lügen.
Es wäre nach wie vor interessanter zu wissen, was man in der Gegenwart tun kann, um dem neu erwachten rechten Gedankengut die Stirn zu bieten, damit dies nicht zum „Mainstream“ werden kann.
Die Diskussion einer regionalen bzw. lokalen Person der Kunstgeschichte bzw. der Zeitgeschichte ist in unserem regionalarchivischen Weblog nicht ungewöhnlich. und liefert durchaus Ansätze, „um dem neu erwachten rechten Gedankengut die Stirn zu bieten“. Es geht hier wie dort um Differenzierung auf der Grundlage umfassender Fakten(recherche).
Es wird ja niemand davon abgehalten, das zu tun. Hier aber lautet aus Anlass dieser Ausstellung das Thema „Kuhmichel“. Wie von den Auststellungsmachern mit der NS-Vergangenheit Kuhmichels umgegangen wurde, ist oben nachzulesen. Sie selbst sind es die sprechen.
Pingback: Es geht weiter mit der Archivierung in Netphen ….. | siwiarchiv.de
Siehe auch:
Lerchstein, Wilfried: „Lernen und Beten in der evangelischen Kapelle Grissenbach“, in: „Grissenbacher Lesebuch – 700 Jahre Dorfgeschichte(n)“, Herausgeber: Grissenbach Aktiv e.V., Netphen 2011, S. 145 – 147
Lerchstein, Wilfried: „Die neue Kapelle aus 1745 und der spätere Anbau einer Schule“, in: „Katholisches Glaubensleben in Deuz im Laufe der Jahrhunderte“, Herausgeber: Katholischer Kirchenverein „St. Matthias“ Deuz e.V., Netphen 2018, S. 16 – 17
Lerchstein, Wilfried: „Das Schulwesen in Walpersdorf“ und „Zur Geschichte der Walpersdorfer Kapellen“, in: „Lebendiges Walpersdorf – Geschichte und Geschichten aus dem oberen Siegtal“, Herausgeber: Heimatverein Walpersdorf e.V., Netphen 2019, S. 36 – 43 und S. 72 – 75
Vielen Dank für die Ergänzungen! In der Tat wurden vor allem die Ortschroniken noch nicht ausgewertet. Entsprechende Hinweise würden uns daher sehr freuen!
Da fehlen noch die Kapellenschulen in
– Plittershagen
– Mausbach
– Oberheuslingen
– Eisern
– Oberdielfen
– Littfeld
– Lindenberg.
Wenn auch frühere Kapelleschulen einbezogen werden sollten:
– Büschergrund
– Niederndorf
Bei der Recherche, die der Liste zunächst zugrunde lag, ging es sich um Standorte noch möglichst im Originalzustand erhaltener Bauten. Daher: danke für die Hinweise!
Ausgewertet wurden für die Liste die einschlägigen regionalen Bibliographien, so dass der ein oder andere Text fehlen kann. Gibt es zitierfähige Texte über Kapellenschulen im Freudenberger Stadtgebiet? Wenn ja, dann gerne hier ergänzen!
Ich empfehle eine Stern-Mail an die Städte und Gemeinden
als untere Denkmalbehörde. Dort sind den Denkmalakten meist die
ortsgeschichtlichen Grundlagen beigefügt.
Alternative
Abfrage der Klarissa-Datei bei der LWL-Denkmalpflege
Kann man machen. Aber dann würden die mittlerweile untergegangenen wohl nicht in der Literaturliste erscheinen ….
Übrigens zur Kapellenschule Büschergrund kann doch einfach auf Ising, Anne: Von der Kapellenschule zum Schulzentrum. Einige Kapitel Schulgeschichte aus Büschergrund, in: Heimat- und Verschönerungsverein Büschergrunde.V.(Hg.): Büschergrund. Ursprung Oberndorfs und Weiterentwicklung der Ortschaften Anstoß, Bockseifen, Büschen und Eichen, Siegen 2011, S. 306 – 317 verwiesen werden
Im Allgemeinen zu den Schulen im Kirchspiel Rödgen sei erwähnt das es eine Akte gibt, die über das Pfarr- und Schulhaus angelegt ist.Hier nun ist aber nicht eine Kirchspielschule mit einer dort angestellten Lehrperson gemeint, sondern es hat einen Raum im Pfarrhaus gegeben, wo der Seelsorger die Jugend unterrichtete.
Was die Zeit angeht ist eine Aussage die vor Gericht in dem Schulstreit der von den beiden „Dielfen“ in den Jahren1763-1768 geführt wurde:“1609 gab es eine Schule in Niederdielfen, aber da war noch kein Katholik im Ort“Das dort 1659 eine Glocke in der Kapelle hing, die in Köln gegossen wurde, belegt die Inschrift.
In Eisern hat laut dem evangel. Ehebuch in der dortigen Kappellenschule 1653 eine Trauung stattgefunden,so auch in Obersdorf. Ein Jahr später in Oberdielfen, und Rinsdorf, wenig später1656 in Niederdielfen. Eine Prestige im Religionsstreit für alle Glaubensgenossen der mit seiner Braut und der gesamten Familien“zu erscheinen hatte“. Im Gotteshaus selber wurden aber auch Ehen vollzogen und „mit Vermerk“ im evangelischen Pfarrhaus.
aus 2019 noch nicht in Heimatland veröffentlicht Kapelle Obersdorf und über in meinen Kroniken
1994 Oberdielfen umfangreich und 2011 Flammersbach
Vielen Dank für die Hinweise!
1994 Oberdielfen umfangreich in derKronik von 1994 dargestellt
mit der Schulgeschichte des Ortes!
Pingback: Siwiarchiv-Blogparade: #Archivesindnichtneutral ? | siwiarchiv.de
Pingback: #Archivesindnichtneutral – eine siwiarchiv-Blogparade | Archive 2.0
Wunderbar und traurig – schön, dass laut über solcherlei Fragen diskutiert wird, schade, dass solcherlei Fragen überhaupt diskutiert werden müssen. Natürlich sind wir neutral, natürlich gibt es einen internationalen ethischen Kodex für Archivarinnen und Archivare, verabschiedet vom ICA in Peking 1996 (den niemand kennt bzw. gern ignoriert-s.a.: https://www.ica.org/en/ica-code-ethics); natürlich ist in unserer Demokratie Staat und Kirche getrennt (*räusper*); natürlich…nicht immer.
In der Hoffnung, dass solcherlei Blogs die Köpfe und Herzen vieler Archivierender erreichen, wünsche ich viel Erfolg!
Verbreitet den Kodex & und seid so neutral wie es nur geht.
Vielen Dank für die schnelle Reaktion! Ja, der Code of ethics ist eine Richtschnur für die Arbeit. Allerdings lässt er da durchaus Spielraum, z. B. in Bewertungsfragen oder bei der Auswahlarchivierung, der Archivierenden Wahlmöglichkeiten gibt, beri denen man durchaus die Neutralität in Frage stellen könnte.
Ferner wird darin m. E. eher weniger die Rolle von Archiven bei der Öffentlichkeitsarbeit und der Archivpäadagogik diskutiert.
Kapellenschule Mausbach
Stadtarchiv Freudenberg
Bestand Amt Freudenberg
B2108 Schule Mausbach [1901-1909]
Kapellenschule Lindenberg
Stadtarchiv Freudenberg
Bestand Amt Freudenberg
B 2526 Schule Lindenberg [1919-1927]
Kapellenschule Plittershagen
Leidig, Burkhard:
Aus der Plittershagener Schulchronik
in: Freudenberg im Zeitgeschehen 1982, Heft 2, S. 33-35
Danke für die Ergänzungen! Ich sehe da eigentlich schon ein Publikationsprojekt am Horizont …..
Pingback: Vortrag: Wolfram Pyta “Der politische Lebensweg des Paul von Hindenburg” | siwiarchiv.de
Pingback: Vortrag: Wolfram Pyta “Der politische Lebensweg des Paul von Hindenburg” | siwiarchiv.de
Neutralität ist wünschenswert und erforderlich in Archiven, das steht außer Frage. Da aber viele Archivare/Archivarinnen Historiker/Historikerinnen sind (was überhaupt nichts schlechtes ist! Bin ich selbst :-)), bewerten einige vielleicht leider doch nicht so neutral oder haben eine eher subjektive Betrachtungsweise bei Sichtung/Bewertung der Unterlagen.
Dennoch finde ich, dass Neutralität zur täglichen Archivarbeit zählt und freue mich auf weitere Kommentare über dieses wichtige Thema. :-)
Vielen Dank für den Kommentar! Interessant wäre es m. E. genauer auszuloten, was denn subjektive Bewertungskriterien sind ?
Bewertungskriterien sind immer subjektiv. Es gibt m.E. nur zwei Wege, diese zu „objektivieren“, ohne je Objektivität oder Neutralität zu erreichen:
– Transparenz
– Beteiligung mehrer Personen(-gruppen).
Aber wie sollte eine Bewertungsentscheidung absolut neutral getroffen werden? Es wird anhand hoffentlich transparenter Kriterien eine Wertsetzung vorgenommen. Dadurch werden Auswertungsmöglichkeiten zwangsläufig eingeschränkt. Um im umfassenden Sinne neutral zu sein, müsste alles aufbewahrt werden.
Es geht vermutlich vielmehr um die Frage der politischen/wissenschaftlichen „Neutralität“ im Sinne von „sine ira et studio“. Dabei ist Transparenz m.E. ein Thema, das unbedingt in den Neutralitätskontext gehört. Generell beschäftigen wir uns zu selten mit dem, was Berufsethos konkret bedeutet. In Sonntagsreden hingegen kommt es dauernd vor…
Vielen Dank für den Kommentar! Dass Transparenz und Neutralität einander bedingen, ist richtig. Die Frage ist jedoch, ob bei aller Transparenz eine Bewertungsentscheidung neutral ist? Bei der Bewertung von Massenakten gibt es ja unterschiedliche Vorgehensweise (Überlerungs des Verwaltungshandelns, Statistische Auswahl oder Buchstabenauswahl). Ist es neutral, wenn ich mich bei der Buchstabenauswahl z. B. für die Buchstaben entscheide, die einen erhöhten Anteil von Nachnamen nichtdeutschen Ursprungs enthalten – selbst, wenn ich das Dokumentationsziel formuliere, Dokumentation von „Lebensgeschichten“ von Personen mit Migrationshintergrund ?
M.E. geht es im Beispielsfall nicht um Neutralität, sondern um „falsch“ und „richtig“. Da hilft Transparenz im Sinne von „Begründungsobjektivität“. Wenn ich ein Überlieferungsziel postuliere und einen Weg wähle, der dazu nicht passt, habe ich schlichtweg etwas falsch gemacht. Das lässt sich durch Transparenz objektiv überprüfen. Die Bewertungsentscheidung bleibt dennoch subjektiv.
Die Sache mit der scheinbaren Neutralität war ja auch bei der Bewertung nach Evidenz (Menne-Haritz) ein Thema. Es ist auch eine subjektive Wertsetzung, wenn man sagt, das Verwaltungshandeln müsse dokumentiert werden. Was auch immer das dann konkret bedeutet…
Wenn ich es recht sehe, dann ist bereits die Postulierung des Überleiferungsziel nicht neutral bzw. sublektiv, die Bewertungsentscheidungen sind es auch.
So sehe ich das auch! Das ist aber kein Freibrief! Deshalb: Transparenz…
Kapellenschule Oberheuslingen
Stadtarchi Freudenberg
Bestand Amt Freudenberg
A 2113
evangelisches Schulgebäude in Oberheuslingen [1851-1908)
Stadtarchiv Freudenberg
Bestand Amt Freudenberg
B 2114
Schulbau in Oberheuslingen [1902-1922)
Stadtarchiv Freudenberg
Bestand Amt Freudenberg
C 364
Instandsetzung der Schule in Oberheuslingen [1928-1945]
Bestellsignatur: (Amt Freudenberg – Bestand C), C 364
Stadtarchiv Freudenberg
Bestand Amt Freudenberg
D 523
Schule in Oberheuslingen [1958-1968)
Enthält: Zeichnungen
Wer auch immer die Recherche in Auftrag gegeben hat – es wird doch!
Pingback: Siwiarchiv-Blogparade: Sind Archive neutral? | Archivalia
Pingback: Film “Siegerland zwischen Gegenwart und Zukunft” | siwiarchiv.de
Erst wenn wir erkennen, dass wir eben nicht neutral sind, dass wir alle internalisierte -Ismen in uns tragen, wenn wir unsere Arbeit und unser tägliches Handeln regelmäßig hinterfragen und uns unserer Vorurteile bewusst sind, können wir unserer Aufgabe und unserer Verantwortung als mit der Auswahl, Sicherung und Vorlage historischer Dokumente angemessen nachkommen.
Danke für dieses wichtige Thema, das hier in Deutschland ganz dringend mehr Öffentlichkeit braucht. Ich werde versuchen, mich an der Blogparade zu beteiligen, da mich das Thema auch privat seit einiger Zeit umtreibt. Sehr gut passt aber auch der Beitrag aus dem Stadtarchiv Darmstadt zur Geburtstagsblogparade 2018 zu diesem Thema, den ich hier gerne noch einmal verlinke: https://dablog.hypotheses.org/338
Eine einfache Suche nach „Kapellenschule“ bei archive.nrw.de ergab 3 Treffer für Siegen-Eisern, Siegen-Trupbach und Siegen Weidenau (Foto von 1883 ?):
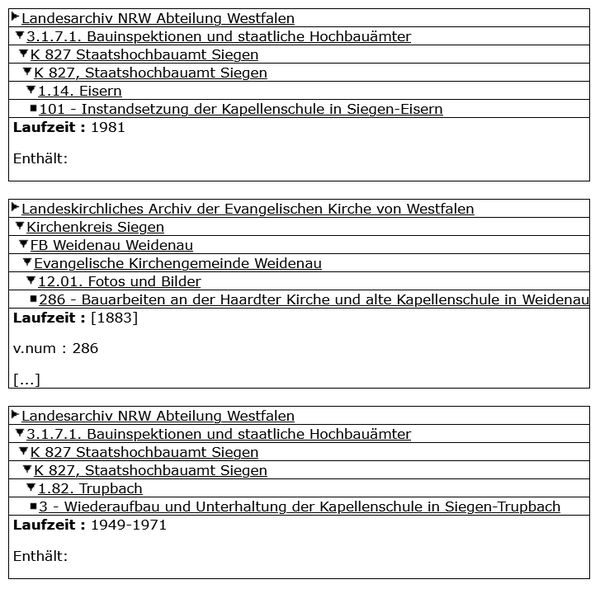
2 Ergänzungen zur Kapellenschule in Sassenhausen:
Johannes Burkardt: Die Kapelle in Sassenhausen: Freundlicher Wegweiser ins Herz des Wittgensteiner Landes. In: Bernd Geier (Hrsg.) Sassenhausen, Bad Laasphe 2001, S. 16 ff.
Bernd Geier: Sassenhausen (Kirchengemeinde Weidenhausen), in: Johannes Burkardt/Andreas Kroh/Ulf Lückel: Die Kirchen des Kirchenkreises Wittgenstein in Wort und Bild, Bad Berleburg 2001, S. 145 – 148
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 4.1. – 16.1.2020 | siwiarchiv.de
Weitere Literaturfunde:
– Siegerländer Heimatkalender 1999, [Bilder von Kapellenschulen im Kalendarium]
– „Schule und Schulkapelle“, in: Gerhard Horn/Gerhard Moisel/Wolfgang Schmidt: Seelbach. Bilder aus der Geschichte des Siegener Stadtteils, Siegen 1994, S. 203 – 224
– Heimatverein Salchendorf (Hg.): 700 Jahre Salchendorf im Freien Grund 1316 – 2016, Salchendorf 206, S. 98 – 101.
– Otto Krasa: Chronik der Gemeinde Gosenbach, Hilchenbach 1964, S. 139 – 152
– Heimatverein Helberhausen-Oberndorf (Hg.): 700 Jahre. Eine spannende Reise durch Helberhäuser Geschichte, Siegen 2018, S. 326ff
– Erich KS. 115 – lein: Ortschronik von Buschhütten, Langenau und Bottenbach, Bad Berleburg 2002, S. 115 – 121
Pingback: “Notararchiv” der Gerichte im Oberlandesgerichtsbezirk Hamm in Siegen eingerichtet | siwiarchiv.de
Ich war schon dreimal am Futapass um das Grab meines Vaters zu besuchen.Mein Vater wurde am 5.10.1944 durch einen
Granateneinschlag im Settatal getötet. Leider bin so weit weg . Das letzte mal waren mein Bruder und ich 1916 am Friedhof
Der Friedhof ist sehr einfach aber übersichtlich gestaltet. Auch neue Grabtafeln wurden ergänzt.Grossen Dank an das Schwarze Kreuz für die Erhaltung und Pflege.
Johann Halmdienst aus Mürzzuschlag in Österreich
Pingback: Heute vor 400 Jahren: Christoph Corvin stirbt in Herborn | siwiarchiv.de
Pingback: Universität Siegen besucht das Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein | siwiarchiv.de
Pingback: Vortrag: Wolfram Pyta “Der politische Lebensweg des Paul von Hindenburg” | siwiarchiv.de
Grundtenor des gestrigen Vortrages:
Pingback: Kultur-News KW 04-2020 - Kultur - Geschichte(n) - Digital
Ein gelungener Vortrag mit einem eloquenten Dozenten, der im Anschluss jede Frage umfassend und verständlich beantwortet. Ein wirklich spannender und informativer Abend über den „Entscheider“ Hindenburg.
Nicht nur die Öffentlichkeit hat keine Ahnung, wozu Archive da sind und was sie für eine Bedeutung für die Gesellschaft haben und was Archivar tun und leisten, sondern leider auch oft die vorgesetzten Dienststellen. Es gelingt den fühtrenden Archivaren ganz offensichtlich nicht, ihre Aufgaben und ihre Arbeit den Entscheidungsträgern in Politik, Verwaltung und Gesellschaft schlüssig zu vermitteln. Museen und Bibliotheken haben es da einfacher.
Auf der einen Seite muss ich Prof. Hempel zustimmen, ich muss aber auch widersprechen. Sicherlich haben es Museen und Bibliotheken leichter, was aber, und da kommen wir zum Widerspruch, nicht an den Kolleginnen und Kollegen liegt, deren Engagement in vielen Bereichen groß ist, was aber nicht honoriert wird.
Mit einem Ausstellungsstück im Museum kann z.B. ein Dezernent besser in der Presse dastehen, als mit einem schnöden Aktenband. Das ist leider Fakt und beruht auch auf eigenen Erfahrungen.
Die Archive sind leider in vielen Kommunen der „Rattenschwanz“ der Kulturbetriebe und werden immer noch als bloße Aktenbewahranstalt gesehen. Da helfen keine Führungen, „Aufklärungs-„Veranstaltungen und Vorträge. Ganz skurril wird es, wenn in Archiven Fachleute (Historiker) sitzen, diese Fachkräfte gerade bei historischen Projekten aber nicht abgerufen werden. Das ist bloße Ignoranz.
Natürlich sieht es nicht überall so düster aus, gerade in kleineren Kommunen haben Archive eine gute Chance, da sie dort enger mit dem Kulturbereich verbunden sind. Aber in größeren Städten haben es Archive, sofern es keine staatlichen Einrichtungen sind, sehr schwer, sich gegen die Konkurrenz der anderen Kultureinrichtungen durchzusetzen.
Das Bild, das jetzt in Tübingen herrscht, ist schon erschreckend. Die Stadt, Universitätsstadt mit reicher historischer Tradition, scheint sich dieser Tradition nicht bewusst zu sein oder ignoriert sie. Vlt. fiel auch schon der Satz: Für unsere Geschichte haben wir ja das Museum. Wie man dieses Missverhältnis aufbrechen kann, kann ich nicht beantworten. Dass wir in unseren Archiven auch Kulturgut aufbewahren, dass vlt. nicht so toll aussieht wie ein Rembrandt, aber doch für unser historisches Gedächtnis wichtig ist, das muss man, auch gerade vor den am Montag begangenen Gedenkveranstaltungen, immer wieder betonen.
Tatsächlich sehe ich hier noch einen anderen Aspekt. Archive sind eben nicht nur Kultureinrichtungen und Sammlungsort der Erinnerung einer Stadt. Sie sind auch Dienstleistungseinrichtungen für andere städtische Ämter und Dienststellen. Es geht hier nicht nur darum, wertvolle kulturelle Güter zu sichern, sondern auch, den Verwaltungsbetrieb am Laufen zu halten. Recherchen von Verwaltungsmitarbeitenden in Archiven beziehen sich häufig auf ganz aktuelle Belange. Es wird nach dem Grundriss eines Gebäudes gesucht, das nun umgebaut werden soll, für ein Bauvorhaben wird nach Informationen über Altlasten geforscht oder es stellt sich die Frage, wann eine bestimmte Entscheidung durch den Magistrat verabschiedet wurde, da ein vergleichbares Thema gerade wieder in der Diskussion präsent ist. Privatpersonen fragen nicht nur nach ihren Vorfahren, um Familiengeschichte zu betreiben, sondern auch um eine Staatsbürgerschaft nachzuweisen oder Rentenansprüche geltend machen zu können. Dahinter steckt wenig Recherche in Kulturgut, sondern ganz alltägliche Verwaltungsarbeit. Das wird hier sehr gerne außen vor gelassen und ein Archiv zu „soetwas wie einem Museum“ das „halt was mit Büchern macht“. Das kennt man, das hat man schon, das kann man ja abschaffen. Dabei ist es so viel mehr.
Dem kann ich auch zustimmen! Archive als Serviceeinrichtung ist ein ganz wichtiges Thema und muss in der Verwaltung auch bekannt gemacht werden, um den Stellenwert zu erhöhen. Dies gilt auch für die Öffentlichkeit. Die ketzerische Frage sei aber gestattet: Machen wir uns als Archive dann nicht auch wieder zum bloßen Aktenaufbewahrungsort irgendwo im Keller? Degradieren wir uns da nicht selber?
Sind wir denn nur „Aktenaufbewahrungsort“, wenn wir sachgerechte Lagerung, qualifizierte Recherche und Bereitstellung ermöglichen? Dann wären Bibliotheken auch nur „Bücheraufbewahrungsorte“. Und können wir nicht beides sein? Gedächtnis- und Kultureinrichtung und Dienstleister*innen für unsere Träger? Wir müssen uns ja zum Glück nicht entscheiden, sollten aber immer wieder überprüfen, welches Bild wir nach außen vermitteln und ob das wirklich unseren ganzen Aufgabenbereich abdeckt (auch wenn einige Bereiche vielleicht nicht ganz so „cool“ sind) ;)
Der Spagat ist schwierig, da stimme ich zu. Gerade bei den Bibliotheken ist es ja so, dass dort mittels gezielter Öffentlichkeitsarbeit dem Trend entgegengewirkt wird. Die Bibliothek als Aufenthaltsort nicht nur zum Ausleihen von Büchern bzw. als „Bücheraufbewahrungsort“.
Ich finde beide Bereiche wichtig und dränge auch immer darauf, dass wir uns unsere Fachkompetenz bewusst sind und auch gegenüber der Verwaltung darauf hinweisen. Leider ist das teilweise schwierig, da die Akzeptanz solange da ist, wie man keine Arbeit verursacht. Hier Stichwort: Schriftgutverwaltung/Behördenberatung. Recherchen werden oftmals als selbstverständlich angesehen und der Aufwand nicht bedacht. Hier ist gezielte Aufklärung notwendig, wir führen ja schließlich keine Wikipedia-Suche durch.
Und was die Frage nach der Serviceleistung „sachgerechte Lagerung“ betrifft: Das hängt davon ab, wie das Archiv ausgestattet sind. Bei uns laufen z.B. Wasserleitungen durchs Magazin und es müssen ständig Luftentfeuchter laufen….
Es gelingt uns nicht, unsere Aufgaben der Öffentlichkeit nachhaltig zu vermitteln. Den Palmer-Vorschlag werden viele als modern und sinnvoll bewerten. Teure Innenstadt meiden, dazu digitale Bereitstellung. Dagegen medial eine Gegenposition gewinnend zu vermitteln ist ziemlich schwierig.
Leider ja, es sei denn, den Kommunen fallen die Kosten irgendwann auf die Füße. Zu diskutieren wäre auch, ob man sowas einen Museum zumuten würde…
Pingback: Regionales im Luxemburger Nationalarchiv | siwiarchiv.de
Echte Überraschung!
Ebenso interessant : Eingabe „Siegen“.
Pingback: Siwiarchiv zur Causa Tübingen: „Archive werden auf Sicht gefahren“ | Archivalia
Pingback: Wikipedia-Artikel zu Ludwig Bald (1902 – 1945) | siwiarchiv.de
@ allen Mitdiskutierenden: Vielen Dank bis hierhin für die intensive Diskussion!
ich möchte gerne auf einen weiteren Aspekt archivischer Öffentlichkeitsarbeit hinweisen, den Thekla Kluttig via Twitter anmahnte:
.
Diesen Hinweis möchte ich um die Mitarbeit der Archive bei den e-Goverment-Bestrebungen der Träger (s. Landesarchiv NRW) und bei open-data-Projekten (s. Transparenzportal beim Staatsarchiv Hamburg) erweitern.
Der Hinweis auf das Thema Digitalisierung ist richtig und wichtig! Wir hatten das gerade heute morgen bei der Dienstbesprechung auf dem Programm. leider meinen viele Kommunen, dass man mittels Share Point-Produkten Digitalisierung spielend hinbekommt. Leider vergisst man dabei seine Pflicht der korrekten Aktenführung. Bei einer Fortbildung gestern kam dazu von einer leitenden Verwaltungsangestellten der Satz: Wer brauch denn noch Akten? Gerade hier liegt das das große Problem. Eine korrekte Aktenführung existiert in den meisten Fällen im analogen Bereich nicht, wie soll es dann im digitalen Bereich klappen? Wir haben mehrere „Aufklärungsaktionen“ gestartet, geben Fortbildungen zum Thema Schriftgutverwaltung (dies leider eher mit durchschnittlichem Erfolg was die Teilnehmerzahlen angeht), aber das Verständnis ist einfach nicht da. Und wenn die Verwaltungsspitze unsere Hinweise in der Allgemeinen Dienstanweisung zum Bereich korrekte Aktenführung mit dem Hinweis „dies ist allgemein bekannt“ markiert und streicht, was soll man da noch machen?
@ Stadtarchiv Freudenberg, Ulrich F. Opfermann: Ich war selbst überrascht über die Funde in Luxemburg. Ein Blick über die Grenzen lohnt sich.
Gestern erschien in der Printausgabe der Westfälischen Rundschau ein Bericht über den Vortrag, der leider nur bedingt online einsehbar ist: https://www.wp.de/staedte/siegerland/historiker-in-siegen-hindenburg-verhalf-hitler-zur-macht-id228280249.html .
Unmittelbar nach der Veranstaltungsankündigung erschien bereits ein Leserbrief ebenfalls in der Print-Ausgabe der Westfälischen Rundschau, der die unterschiedlichen Umbenennungspraltiken von Hindenburgstraßen in der Region thematisierte – s. dazu https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/nstopo/strnam/Begriff_2.html.
s. a. Gemeinde Neunkirchen, Pressemitteilunf v. 24.1.2020, „Mit einem Klick in der Vergangenheit“, Link: https://www.neunkirchen-siegerland.de/Quicknavigation/Startseite/Mit-einem-Klick-in-der-Vergangenheit.php?object=tx,2.1&ModID=7&FID=2027.3281.1&NavID=2027.10
HABE DEN BALD ZU HAUSE
Richtig die Abgabe da Wilnsdorf „am Schlafen “ ist
Aktueller Sachstand in Tübingen – optimal ist anders, aber besser:
Zum Sachstand berichtet Archivalia: https://archivalia.hypotheses.org/124292
Schön, dass die Lücke am Anfang nun, nach längerer Wartezeit, von den Münsteranern wenigstens verkleinert wurde. Die Bayerische Staatsbibliothek konnte bislang nur Digitalisate ab 1821 anbieten, da sie die früheren Jahrgänge nicht im Bestand hat. Bleibt zu hoffen, dass auch die restlichen 17 Monate ab August 1816 bald noch ergänzt werden.
„Mit dem Schluß dieses Monats wird das Amtsblatt für die Provinz Westfalen aufhören, und von den verschiedenen Landes-Regierungen, in Münster, Minden und Arnsberg, vom ersten künftigen Monats anfangend, ein besonderes Amtsblatt für jeden Regierungs-Bezirk herausgegeben werden.“ (Amts-Blatt für die Provinz Westfalen, Nr. 56 vom 31. Juli 1816)
Danke für die Ergänzung! Ich war so frei und habe den Link hinzugefügt.
Hier findet sich der Hinweis auf das Amtsblatt der Bezirksregierung
in Koblenz, zu der der damalige Kreis Siegen gehörte.
http://opacplus.bsb-muenchen.de/title/4105339/ft/bsb10014780?page=5
1969 wollte ich Hern Münker mit dem Auto von Barmenol mitnehmen
Herbergsvate Jupp Schöttler konnte ihm abringen, das ich den betagten Herrn zum Zug nach Finnentrop fuhr. Mein Weg führte ja über Hilchenbach,Nein!
Pingback: R. Gämlich: Kapellenschulen in Hilchenbach | siwiarchiv.de
Sven Panthöfer teilte via Email folgens Rechercheergebnis miit:
„Als Quelle dienen die Mitgliederlisten des VDI.
Den Einträgen im Mitgliederverzeichnis des VDI nach muss Schatzki 1891/92 nach Geisweid gekommen sein. Eine Tätigkeit in Schmallenberg wird nicht angegeben.
1885: Ingenieur in Düsseldorf (bis 1891 keinem BV zugeordnet)
1886: Ingenieur der Noell’schen Waggonfabrik Würzburg
1887: ebenso
1888: Ingenieur der Maschinenfabrik Bern, Bern
1889: Ingenieur bei Starke & Hoffmann, Hirschberg, Schlesien
1890: ebenso
1891: Ingenieur bei Belter & Schneevogel, Berlin (Mitglied im Berliner BV)
1892: Ing., Bureauchef der Siegener Verzinkerei, Geisweid (Berliner BV)
1893-1910 Siegener Verzinkerei und Mitglied im Siegener BV
„
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 30.1. – 11.2.2020 | siwiarchiv.de
Pingback: Fritz Bause (?-1943). Beginn einer Recherche. | siwiarchiv.de
Gesucht wird offenbar das konkrete Geburtsdatum für weitere Recherchen? Finden sich für diesen Kriegssterbefall in den Sterberegistern der Stadt Siegen keine Einträge? War Bause vielleicht verheiratet, sodass ein Heiratseintrag existiert?
Bei den hier vorgestellten Informationen handelt es sich primär um Onlinefunde. Die Suche in den Archivalien beginnt jetzt und die Ergebnisse werden als Kommentar hier ergänzt werden.
Die Fragen hat nun auch das Stadtarchiv Siegen beantwortet – s.u.
Im Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen liegen die Urkunden und Register des Notars von 1937-1942 vor. Ich weise ich vorsorglich darauf hin, dass für die Nutzung dieser Notariatsunterlagen eine Sondergenehmigung erforderlich ist.
Daneben konnte auch unter der Signatur R 001/Personalakten Nr. 0/I, 4881 (Altsignatur) eine Personalakte ermittelt werden, die den genannten Notar betreffen könnte. Ob dem so ist, muss im Rahmen einer Aktenrecherche ermittelt werden.
Im Bundesarchiv in Berlin befindet sich eine weitere Akte (R 3002/106475), die Andreas Vomfell betreffen könnte: https://invenio.bundesarchiv.de/invenio/direktlink/5a3839d8-01af-4ab1-b439-68e012fb6d25/ .
Ein gutes Vorhaben Herr Landrat und Vorsitzender des Heimatbundes Siegerland-Wittgenstein !
Es wird wohl hoffentlich dann auch einmal ein solch festgefahrener Fall , wie er beispielsweise beim sog. „Hüttenmeisterhaus“ in Kreuztal – Kredenbach vorliegt, zur Sprache kommen.
Hier ist weder die Kommune ( Untere Denkmalbehörde) noch der private Eigentümer bereit, den unaufhaltsamen Verfall des historisch wertvollen und ortsbildprägenden, denkmalgeschützten Fachwerkgebäudes aufzuhalten. Selbst das derzeit bestehende Denkmalschutzgesetz (DSchG.-NRW § 30 ) läßt durchaus die Enteignung eines uneinsichtigen Privatbesitzers zu, aber solange eine Kommune nicht auch von einem ihr übergeordneten Gesetzgeber (evtl. Obere Denkmalbehörde-NRW ) zur Übernahme, Instandsetzung und weiteren Instandhaltung *) eines sonst dem unweigerlichen Verfall preisgegebenen Denkmals gezwungen wird, braucht man sich nebenbei über das Verschwinden des regionalen Heimatbewußtseins im Siegerland nicht zu wundern. Auch der Erhalt historischer Gebäude trägt u.a. auch zur Förderung der doch hoffentlich auch heute noch wünschenswerten regionalen Identität und Wohlbefinden bei, vor allem dann, wenn dazu der Kommunalverwaltung eine möglichst gemeinschaftsfördernde, soziale Nutzungsmöglichkeit für das letztlich vom Steuerzahler renovierte Denkmalgebäude einfallen sollte.
Für solche Aufgaben scheinen aber die Dorfgemeinschaften (sofern überhaupt noch vorhanden ) oder zögerlich agierende „Heimatvereine„ letztlich überfordert zu sein. Aber sie könnten m.E. zumindest den Landesgesetzgeber zu einer entsprechenden Novellierung bzw. offenbar notwendigen Konkretisierung des DSchG-NRW veranlassen.
* ) > evtl. Enschädigsforderungen des Privatbesitzers werden natürlich hierbei den Instandsetzungs- und Erhaltungskosten dem derzeitigen Marktwert gegengerechnet !
Pingback: „Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen“ in Düsseldorf: Stiftung nimmt Arbeit auf | siwiarchiv.de
Ausgezeichnet
Pingback: Kultur-News KW 08-2020 - Kultur - Geschichte(n) - Digital
Im alphabet. Namensverzeichnis des Standesamtes Siegen zu den Sterbefälle zwischen 1940 bis 1945 konnte kein entsprechender Eintrag zu Fritz Bause aufgefunden werden. Parallel wurden die hier befindlichen Adressbücher aus 1935, 1940 sowie 1952 auf etwaige Einträge überprüft. Die Recherche im Adressbuch aus 1935 und 1940 ergab einen Vermerk zu einem Fritz Bause, Kölner Straße 64 sowie Schnabelstraße 4. Im Adressbuch aus 1952 konnte kein Fritz Bause mehr nachgewiesen werden.
Anhand der o.g. Angaben zum Wohnort wurde abschließend noch die Siegener Straßenkartei durchgesehen. Dort konnte in der Schnabelstraße 4 ein Eintrag zu Fritz Bause, geboren am 11.11.1904 aufgefunden werden.
Pingback: Blogparade #ArchiveSindNichtNeutral: Transparenz und Vertrauen – Stadtarchiv Darmstadt
Kurz vor knapp noch geschafft – der Beitrag aus dem Stadtarchiv Darmstadt ist online: https://dablog.hypotheses.org/11010
Vielen Dank! Der grundsätzliche Beitrag zur Bedeutung einer weitgehenden Transparenz der Archive zeigt, dass Archivar*innen nur so die Verlässlichkeit herstellen können, da sie eben nicht neutral sind.
Als altmodischer Archivbenutzer erlaube ich mir einen Einspruch. Ich erwarte nicht, dass das von mir in Anspruch genommene Archivpersonal seine Verlässlichkeit erst krampfhaft „herstellen“ muss, wenn ich zur Tür reinkomme, oder seine Neutralität auf mein Verlangen irgendwie nachweisen kann. Ich möchte Verläßlichkeit und Neutralität bei Menschen, die im Öffentlichen Dienst tätig sind, einfach stillschweigend voraussetzen können. Diese Menschen haben einmal durch Ablegen eines Gelöbnisses bzw. Eides zum Ausdruck gebracht, dass sie sich den ethischen Anforderungen des Dienstes für die Öffentlichkeit gewachsen fühlen und darüber keine Grundsatzdiskussionen führen müssen. Neutralität: Wenn man morgens den Archivkittel anzieht, legt man gleichzeitig für die nächsten acht Stunden die privaten Vorlieben, Abneigungen, Vorurteile usw. ab. Wer das wegen erfolgreicher Erziehung zur Egozentrik als schwer zu meisternde Herausforderung empfindet, würde in der sogenannten „freien“ Ellenbogen-Wirtschaft vielleicht eher seine Lebenserfüllung finden.
Das Dilemma der archivischen Bewertung ist objektiver Natur und lässt sich nicht lösen, da nun einmal Benutzer (wollen alles aufgehoben haben) und Archivträger (wollen Platz und Personal sparen) niemals unter einen Hut zu bekommen sind. „Transparenz“ auf Seiten der Archive ist gut und schön, hilft aber auch nicht viel weiter, weil Benutzer die Ergebnisse von Bewertungen in der Regel erst dann wahrnehmen, wenn die verantwortlich gewesenen Archivare gar nicht mehr für Stellungnahmen zur Verfügung stehen. Irgendwann werden Benutzer vielleicht naiv fragen, warum Archivarinnen und Archivare freiwillig unter Bergen überflüssiger Massenakten ersticken und immer noch am Tabu der Nachbewertung und -kassation festhalten. Die Antwort wird dann womöglich lauten: „Weil unsere Vorgänger sich etwas dabei gedacht haben.“ Haben sie das?
Das Unbehagen über die mangelnde bzw. nicht existente Beteiligung der Nutzer am Prozess der Überlieferungsbildung kann ich gut verstehen. Die Schweiz beschreitet derzeit ja andere Wege. Mal schauen, inwiefern dort das Angebot des Mitwirkens an Bewertungsentscheidungen angenommen und umgesetzt wird.
Was die Frage der Nachkassation anbelangt, bitte ich zu berücksichtigen, dass die Entscheidungen nicht objektiv sein können und immer zeitgebunden sind. Dies bedeutet, dass jede Nachkassation (= erneute Bewertungsentscheidung) genauso gut bzw. schlecht ist wie die vorherige. Denkt man den Nachkassationsgedanken zu Ende, dann würde man in arhythmischen Abständen immer wieder mit neuen Ideen und Perspektiven an die Bestände gehen (können) bis irgendwann (nach 100 Jahren?) vom Bestand nichts mehr übrig ist, denn jeder Bewertungsvorgang reduziert ja das Vorhandene und jede „Zeit“ hat ihre eigenen Forschungsströmungen, Wertvorstellungen etc.
…und Ihre Nachfrage, ob sich „unsere Vorgänger“ etwas dabei gedacht haben, wird durch die notwendige Transparenz der Bewertungsentscheidungen beantwortet. Sie ist halt das A und O…
Vielen Dank für den Kommentar! Ich bin wie Sie gespannt auf die Schweizer Ergebnisse. Bei der NAchbewertung bin ich bei Ihnen.
Danke für die sachliche Antwort! Das mit der Nachkassation meinte ich auch nicht so, dass nun jede neue Archivarsgeneration die übernommenen Bestände neu bewerten soll. Bei den ausufernden Massenakten frage ich mich allerdings, ob man die anhand formaler Kriterien getroffene Auswahl von Samples überhaupt als „Bewertung“ bezeichnen kann. Diese würde m.E. darin bestehen, über den zukünftigen Wert solcher ausschließlich für statistische Zwecke nutzbarer Akten zu spekulieren. Man könnte also fragen: Sind aus diesen Akten überhaupt noch Informationen zu gewinnen, die nicht schon längst (bevor das Archiv ins Spiel kam) z.B. von den statistischen Ämtern erfasst worden sind und zur Nutzung dauerhaft vorgehalten werden? Ist die „quantitative Sozialforschung“, deren Vertreter sich momentan vielleicht noch für den Nabel der Welt halten, so zukunftsträchtig, dass ihr zuliebe Archive die Grenzen ihrer Kapazitäten überschreiten? Sorry, das führt zu weit vom Thema ab. Die Gefahr bei der Beteiligung Außenstehender besteht jedenfalls darin, dass sich dann am Ende doch nur wieder die am lautesten Schreienden durchsetzen. Archivbenutzer haben es oft schwer, Archivarinnen und Archivare aber nicht minder!
M.E. führt das nicht vom Thema ab, sondern sogar mitten hinein. Was gibt uns unser Berufsethos bezüglich der Überlieferungsbildung vor? Was sind die Kriterien für die Bewertung? Inwiefern sind wir als Archivare der „Gesellschaft“ rechenschaftspflichtig? Diese Diskussionen sind längst überfällig und müssen jenseits der Sonntagsredenbekenntnisse auch mit unseren „Kunden“ geführt werden.
Eine diesbezügliche Selbstverständigung wird vom VdA-Arbeitskreis Bewertung demnächst in Angriff genommen. Vielleicht sorgt das für die erhoffte Diskussionsgrundlage!? Spätestens dann ist es an uns, diese Dinge auch ernsthaft (!) zu diskutieren…
Ergänzend möchte ich anmerken, dass auch nach Samples ausgewählte Massenakten mehr zu bieten haben, als die Verwendbarkeit für rein statistische Auswertungen. Es finden sich hier auch exemplarische Beispiele verschiedener Lebenswirklichkeiten und darüber hinaus ein Einblick in die Arbeitsweise der abgebenden Ämter, z.B. auch bei Personalnotstand und Wechsel der zuständigen Mitarbeiter*innen. Das ist durchaus auch für andere Forschungsgebiete von Bedeutung.
Lieber Kollege Kunzmann, ich habe ein wenig den Eindruck, dass Sie in Ihren engagierten Kommentar Gleichbehandlung mit Neutralität verwechseln. Archivierende sind nicht neutral, selbst bei aller Transparenz nicht. Wie Sie richtig schreiben stehen die Archivierenden im öffentlich-rechtlichen Raum für die freiheitlich-demokratische Grundordnung (FDGO). Dies ist eine Position, die den Zugang zu Archivgut verwehrt! Gemeint sind die Ränder der Gesellschaft, die sich in kritischer Distanz zur FDGO befinden. Allerdings gehört genau jenes Archivgut unbedingt zur archivischen Pflichtaufgabe, der Dokumentation der Lebenswirklichkeiten im jeweiligen Sprengel.
Ich stimme Ihnen zu, auch bei der Frage der Ränder sind wir mitten in der Thematik „Berufsethos“. Vielleicht liege ich falsch, aber mir scheint dieses grundlegende Thema unterbelichtet zu sein. Es wäre verheerend, wenn der Eindruck entstünde, unsere Tätigkeit sei beliebig…
Lieber Herr Wolf, obwohl ich nicht die Absicht habe, bei dieser Diskussion mehr als ein Zaungast zu sein, muss ich jetzt noch zwei Erwiderungen loswerden. 1. Die Institution „Öffentlicher Dienst“ ist mehr als 200 Jahre alt. Das Ideal des zugrundeliegenden Berufsethos leitet sich aus allgemeinen Menschenrechten ab; es ist nicht erst von der FDGO kreiert worden. Wenn sich junge (?) Leute unter den relativ gemütlichen Rahmenbedingungen der FDGO jetzt als Erfinder eines solchen Ethos inszenieren wollen, spricht das nicht für ihren historischen Sinn. Damit brüskieren sie nebenbei auch all jene, die schon unter ungleich schwierigeren Bedingungen versucht hatten, dieses Ideal in ihrem Berufsalltag nicht ganz untergehen zu lassen. (Ich bin sicher, es gab sie.) 2. Wenn im Archivarslatein „Neutralität“ etwas anderes als Gleichbehandlung (von Archivbenutzern und Registraturbildnern) bedeutet, klären Sie mich (und die übrigen irritierten Leser) doch bitte auf. Danke.
Hallo Herr Kunzmann,
es gibt, auch in Deutschland, Menschen, die schlechte Erfahrungen mit öffentlichen Institutionen und ihren Vertreter*innen gemacht haben. Auch diese Menschen dürfen öffentliches Archivgut nutzen und die Aufbewahrung dieser Unterlagen durch öffentliche Einrichtungen/Ämter kann hierfür, aufgrund der gemachten Erfahrungen, eine Hürde darstellen. Das ist fatal, denn gerade Archivgut öffentlicher Träger kann dabei teilweise auch zur Rechtswahrung beitragen. Ich erinnere hier nur mal an die Opfer der Verfolgung nach §175 StGB, die inzwischen einen Anspruch auf Entschädigung haben, diesen aber nachweisen müssen. Auch hier kommen Archive ins Spiel, die aber von den Betroffenen als Teil des Systems betrachtet werden können, dessen Opfer sie geworden sind. Wenn wir unserer Verantwortung als Archivar*innen gerecht werden wollen, müssen wir diesem Misstrauen u.a. durch die angesprochene Transparenz entgegenwirken. Gleiches gilt z.B. auch für Opfer von Missbrauch in staatlichen Einrichtungen oder Personen, die rassistischer Diskriminierung durch öffentliche Bedienstete ausgesetzt waren. Verständnis und Entgegenkommen erleichtern diesen Menschen den Zugang zu Archivalien und begründen damit auch die Bedeutung von Archiven in einer Gesellschaft, zu der auch die genannten Menschen gehören.
Pingback: Blogs kurz vorgestellt: "Archivalia" • Verein für Computergenealogie e.V. (CompGen)
Wie soll man da schreiben, das gefällt mir ?
Man möchte weinen.
Aber es ist gut, die Erinnerung für die Zukunft aufzubewahren.
Pingback: Tag der Archive im Stadtarchiv Siegen | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik Februar 2020 | siwiarchiv.de
Das LYZ, die „Heimat“ des Kreisarchivs Siegen-Wittgenstein, steht unter vorläufigem Denkmalschutz, wie die Siegener Zeitung am 29.2.2020 berichtete: https://www.siegener-zeitung.de/siegen/c-lokales/neue-tuer-im-lz-aus-plastik_a194977
s. a. http://geschichtswerkstatt-siegen.de/2020/02/27/literatur-4/
Ausstellungseindrücke:


Kurzinformation zum Autor:
Johann Georg Martin Fürchtegott Mollat
geb. 21.3.1863, Kassel
1880ff Jurastudium Leipzig, Göttingen, Strassburg, Marburg
1884 Promotion in Göttingen
1890er Privatgelehrter (Korrespondenz: Cassel?)
1896 Assistent Handelskammer Braunschweig
1897-1906 Syndicus der Handelskammer in Frankfurt/Oder
1906-1920 Gerichtsrat & Syndicus der Handelskammer Siegen,
Syndicus der Berg- und Hüttenmännischen Vereins zu Siegen
1910 – 1920 DVP-Stadtverordneter in Siegen
1920 Umzug nach Berlin Syndicus der Berliner Zweigstelle der Siegener Handelskammer
verstorben 07.08.1947
Publikationen Mollat
Lesebuch zur Dt. Staatswissenschaft von Kant bis Bluntschli, 1891
Quellenbuch der deutschen Politik in neunzehnten Jahrhundert, Leipzig 1892
Mitteilungen aus Leibniz ungedruckten Schriften, 1893
Krause, Karl Christian Friedrich Der Erdrechtsbund an sich selbst in seinem Verhältnisse zum Ganzen und zu allen Einzeltheilen des Menschheitslebens. Aus dem hs. Nachlasse des Verfassers herausgegeben Leipzig 1893
Reden und Redner des ersten deutschen Parlaments, Osterwieck 1895
Volkswirtschaftliches Quellenbuch, Osterwieck/H. 1913
Siegerländer Heimatbuch, Siegen 1914
Gesetz über die Handelskammern, Siegen 1914
Handbuch der Handelskammer zu Siegen, Siegen 1914
Krieg und Wirtschaftsleben, Siegen 1915
Einführung in das Gesetz über vorbereitende Maßnahmen zur Besteuerung der Kriegsgewinne vom 24. Dez. 1915, Siegen 1916
Einführung in das Kriegssteuergesetz vom 21. Juni 1916, Siegen 1917
Der Glaube an unsere Zukunft, Siegen 1917
Einführung in das Kriegsabgabegesetz vom 26. Juli 1918, Siegen 1918
Unsere nationalen Erzieher von Luther bis Bismarck- Osterwieck (Harz) 1923
Deutsche Meister. Lebenserinnerungen führender deutscher Männer aus der Zeit von Goethe bis Bismarck, 1927/1928
Hegel, Die Verfassung des Deutschen Reiches. Eine politische Flugschrift. Aus dem handschriftlichen Nachlasse des Verfassers in der Preußischen Staatsbibliothek neu hg. von Georg Mollat. Stuttgart 1935.
Von Goethes Mutter zu Cosima Wagner Stuttgart 1936
Literatur:
Irle, Lothar: Siegerländer Persönlichkeiten- und Geschlechter-Lexikon, Siegen 1974, S. 225
Bernert, Helmut: Johann Georg Martin Fürchtegott Mollat, in: Rheinisch-Westfälische Wirtschaftsbiographien Bd. 15, Rheinische und westfälische Handelskammersekretäre und -syndici vom 18.bis zum Anfang des 20.Jahrhunderts, Münster 1994,S.197–206
Quellen:
Bundesarchiv Berlin: R 9361-V/29272 (Sammlung Berlin Document Center (BDC): Personenbezogene Unterlagen der Reichskulturkammer (RKK))
Universitätsarchiv Göttingen, Jur. Prom. 9357 (Mollat, Johann Georg Martin Fürchtegott – Exegese von c. 3 X de consuet. 1,4 – Ref.: Mejer ), 8.1.1884
Niedersächsisches Landesarchiv Wolfenbüttel, 3 Z Nr. 20/276, 1 Artikel, Mollat Dr; wissenschaftlicher Hilfsarbeiter in Braunschweig , Braunschweigische Landeszeitung 23.07.1896 Nr.341
Niedersächsisches Landesarchiv Wolfenbüttel, 3 Z Nr. 20/277, 1 Artikel, Mollat, G.; ehemaliger Sekretär der Handelskammer in Braunschweig, Braunschweigische Anzeigen 25.10.1897 Nr.295
Netz:
Aktive Gedenkbuch für die Opfer des Nationalsozialismus im Kreis Siegen-Wittgenstein, Link: http://aktives-gedenkbuch.de/index.php/About/glossar#M (Aufruf: 6.3.2020)
Ergänzung:
Deutsches Herz, verzage nicht!
(Ansprache bei der Vaterländischen Kundgebung am 20. Oktober 1918 zu Siegen)
Siegen : Buchholz, 1918
(Umfang zum Glück nur 4 Seiten)
Digitalisat:
https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht/?PPN=PPN730358089
Dank für die Ergänzung!
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 25.2. – 8.3.2020 | siwiarchiv.de
Link zur Presseschau zum diesjährigen Tag der Archive
Das Fürstliche Archiv Wittgenstein in der Rentkammer Bad Laasphe ist ebenfalls geschlossen; zunächst bis zum 30. April 2020.
Das Stadtarchiv Freudenberg ist derzeitig nur
ab dem 17. März 2020 nur noch
schriftlich, telefonisch und per Mail zu erreichen.
Mórer Platz 1,
02734 / 43-148,
d.koeppen@freudenberg-stadt.de
Das Universitätsarchiv Siegen schließt ebenfalls ab morgen, 20.03.2020, bis mindestens 20.04.2020 (Option 03.05.2020) und ist dann nur noch per E-Mail erreichbar: archiv@ub.uni-siegen.de.
Ich möchte zwei weitere Titel empfehlen, die sich mit Epidemien in Siegen auseinandersetzen:
Andreas Bingener, Armenunterstützung und Gesundheitspflege im frühneuzeitlichen Siegen, in: Siegerland 87, Heft 1 (2010), S. 3-22.
Kirsten Renate Seelbach, In dieser harten und sterbenden Zeit. Maßnahmen gegen die Pest 1620-1750. Marburg 2007 (Zugl. Marburg, Univ., Diss., 2006).
Danke für die Ergänzung!
Kurze Anleitung, wie der Landmann und diejenige, so keinen Arzt erlangen können, bey herumgehender Ruhr und in denen Jahreszeiten, da solche gewöhnlich sich einzufinden pfleget, sich zu verhalten haben, für die Fürstl. Oranien Nassauische Lande entworfen. 1779 (32 S.).
Nöthige Belehrung bey der an vielen Orten grassierenden Ruhr,
in: Dillenburgische Intelligenz-Nachrichten 1781, Sp. 614-616.
Ein Blick in das verflossene Jahr 1781 bei Gelegenheit der hin und wieder verbreiteten Ruhr,
in: D.I.N. 1782, Sp. 81-90.
Beyträge zur Geschichte der Pest, die 1607 u. 1625 im Nassauischen geherrscht hat,
in: D.I.N. 1799, Sp. 593-597.
……. und manches mehr in den alten Intelligenz-Nachrichten.
Interessant wäre eine Dokumentation des Umgangs mit der Spanischen Grippe im Siegerland 1918/19. Läge die Siegener Zeitung digitalisiert vor, könnte man eine solche Presseschau jetzt sehr schön im „Home Office“ zusammenstellen. Was lehrt uns dies?
1) Danke für die Ergänzungen!
2) Ja, ich habe mich selbst etwas gewundert, dass zur Spanischen Grippe nichts vorlag.
3) Für Wittgenstein könnte ja nun geforscht werden s. http://www.siwiarchiv.de/zeit-punkt-nrw-zeitungen-aus-dem-altkreis-wittgenstein-online/
4) Digitalisierung im Kulturnereich wird ein intensivewres Thema – wäre eine schöne Lehre …..
Zu Punkt 3) Im Wittgensteiner Kreisblatt findet sich folgendes (Quelle: Auszug aus dem Wittgensteiner Kreisblatt 1914 – 1919 (PDF)
1918/55: Die“spanische Krankheit“ (Grippe) in Wittgenstein
1918/84,85,87: Verstärktes Auftreten von Grippe, Ratschläge
guten tag!
es ist mal lob und dank fällig für das stets interessante und manchmal augenzwinkernde rss-feed des kreisarchivs! das macht spass so. immer wieder bekomme ich anregungen zu ausflügen oder zur eigenen online-recherche.
viele grüsse!
Danke für das Lob! Wir werden uns weiter bemühen.
Deutschlandweite Presseveröffentlichungen zum Jubiläum 125 Jahre Motoromnibus:
1) https://www.welt.de/regionales/nrw/article206606331/Siegen-Omnibus-feiert-125-jaehriges-Jubilaeum.html
2) https://www.badische-zeitung.de/pioniergeist-aus-der-provinz–184066146.html
3) https://www.deutschlandfunk.de/vor-125-jahren-erste-motorisierte-omnibuslinie-der-welt.871.de.html?dram:article_id=472707
Danke an W. L. für die Hinweise!
Und auch in der Frankfurter Rundschau vom 18.03.2020. Kein Link, Old school liest auf Papier.
Danke für die Ergänzung! Wir nehmen auch gerne Hinweise auf Print-Medien.
Pingback: LWL bietet freien Zugang zu rund 100 Westfalen-Filmen | siwiarchiv.de
Pingback: #archivesindnichtneutral – Fazit einer Blogparade | siwiarchiv.de
die dargestellte kapellenschule ist uebrigens die trupbacher –allerdings ist das bild seitenverkehrt–erbaut 1739 -umbau 1870
Die Angaben sind korrekt. Das Bild war wegen der vorgenommenen Bearbeitungen bewusst nicht beschriftet worden und sollte lediglich als „Symbolbild“ dienen.
Pingback: #archivesindnichtneutral – Fazit einer Blogparade | Archivalia
die erwähnte ausstellung war ein wichtiger schritt zur bewussthaltung des künstlers. der vortrag bei der führung durch die ausstellung ging durchaus ein auf die vorwürfe, Kuhmichel sei ein „nazikünstler“ gewesen. auch mit der liste oben sowie der broschüre „kunst im öffentlichen raum“ in siegen gibt es nun einen weiteren baustein, der vielleicht und hoffentlich irgendwann zu einem ausführlichen katalog führt.
https://www.siegen.de/kultur-tourismus/kultur-und-kunst/kunst-im-oeffentlichen-raum/
Wehrmacht: Na ja, das ist das, was als „ruhige Kugel“ zu bezeichnen wäre. Eine Art informelle UK-Stellung, in der er in aller Ruhe an seinen Propagandawerken arbeiten konnte. Das hatte er sich verdient.
Interessante Diss. Da wüsste man gern mehr. Auch bei wem. 1935? Da hätte die Neuordnung der Unis doch schon stattgefunden?
Die Promotionsakte ist im Archiv der Universität Marburg vorhanden. Signatur ist in der to-do-Liste am Ende dieses Eintragsd zu finden. Erstaunlicherweise findet sich in den Bilbiothekskatalogen die gedruckte Dissertation Dapprichs mit folgendem Titel: „Die „Autarkie“ des Aristoteles und der „totale Staat“, so dass hier tatsächlich Klärungsbedarf besteht.
Pingback: Link- und Literaturtipp zur Gründungsgeschichte der Archivschule Marburg | siwiarchiv.de
Pingback: Online: S. Hering, E. Hüwel: Helge Pross. Wegbereiterin der Frauenforschung [2019] | siwiarchiv.de
Pingback: Zum Beginn der „Spanischen Grippe“ im Altkreis Wittgestein (1) | siwiarchiv.de
Hat die Grafschaft Wittgenstein „politisch“ zu Hessen-Nassau-Oranien gehört? Vielen Dank
Kann man so nicht sagen. Zur Wittgensteiner Territotialgeschichte ist zuerst die Arbeit (1927) Günter Wredes heranzuziehen.
s. a.
Heinz Bensberg: Die Pest im Krombacher Kirchspiel, Link: http://heinz-bensberg.de/html/pest_in_krombach.html
Heinz Bensberg: Die Pest wütete im oberen Ferndorftal, Link: http://heinz-bensberg.de/html/die_pest_wutete.html
auch hier schon :“…einen Grund zur Beunruhigung nicht gegeben, die Erkrankung hat einen durchaus harm-
losen Charakter!
„Merkel und Spahn waren damals doch noch nicht…..!??“
@ Herr Garmeister,
Ist es wieder Seitenhieb, gegen das System, in denen Sie sich so benachteiligt fühlen ? Welches keine Rücksicht auf solche Menschen wie Sie nimmt ? In anderen grenzwertigen Kommentaren, von Ihnen im Netz, haben Sie doch schon Ihren Unmut über die Regierung und über das Handeln der Oberen bekundet.
Es sind immer die gleichen gescheiterten Existenzen, die über alles schimpfen und immer benachteiligt werden.
Der Staat ist an Ihren Versagen, nicht schuld. Das haben Sie selbst zu verantworten.
Weitere Ergänzungen:
– Schenck, Karl Albert [war übrigens der Siegener Kreisphysikus],
Versuche mit dem Hahnemann’schen Präservatif [Belladonna] gegen das Scharlachfieber [in Hilchenbach 1810]
in: Journal der practischen Heilkunde [hrsg. v. C. W. Hufeland],
34 (1812), 5. Stück, S. 119-126.
– Ders.,
Neue Bestätigung der Kraft der Belladonna, durch Schützung einer ganzen Stadt [Siegen] gegen Verbreitung des Scharlachfiebers,
in: Ebenda, 56 (1823), 4. Stück, S. 3-17.
Aber jetzt bitte keine Experimente mit Belladonna (Tollkirsche) gegen Corona unternehmen!
Danke für die Ergänzung! Ich habe den Eindruck, dass die regionalen Kreisphysici bzw. -ärzte zeitnah einer intensiveren Betrachtung unterzogen werden (sollten). Bernd Plaum arbeitet in seinem Beitrag zur „spanischen Grippe“ im Siegerland die Rolle des damaligen Kreisarztes Heinrich Hensgen heraus – s. https://geschichtswerkstatt-siegen.de/texte/ . Hensgen war, wenn meine ersten oberflächlichen Recherchen nicht trügen, ein „Desinfektions-Fachmann“. Personalakte im Geheimen Staatsarchiv Stiftung Preußischer Kulturbesitz und Promotionsunterlagen im Archiv der Universität Greifswald liegen vor.
Pingback: Zur „Spanischen Grippe“ im Altkreis Wittgenstein (3) | siwiarchiv.de
Pingback: Sanierungsarbeiten an der Martini-Kirche Siegen haben begonnen | siwiarchiv.de
1) s. a. Alma Kreuter: Deutschsprachige Neurologen und Psychiater. Ein biographisch-bibliographisches Lexikon von den Vorläufern bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts , München 1996, S. 490. Dort auch weitere noch nicht im Wikipedia-Eintrag ausgewiesene Veröffentlichungen Guders
2) Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, I. HA Rep. 76[I. HA Rep. 76 Kultusministerium, Ältere Medizinalregistratur, Personalakten und Personalunterlagen der älteren Medizinalregistratur, Buchstabe G (1850-1922)], VIII A Nr. 4401 Guder, Paul Martin Philipp; geb. in Modritz, 1880 – 1921
Ja, die Angaben zu den Personen kann ich bestätigen. Ich bin Zeitzeuge.
Pingback: Zur „Spanischen Grippe“ im Altkreis Wittgenstein (5) | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 22.3. – 4.4.2020 | siwiarchiv.de
s.a. Lothar Irle, in: Siegerländer Woche, 1. Jahrgang Nr. 8, 1965:
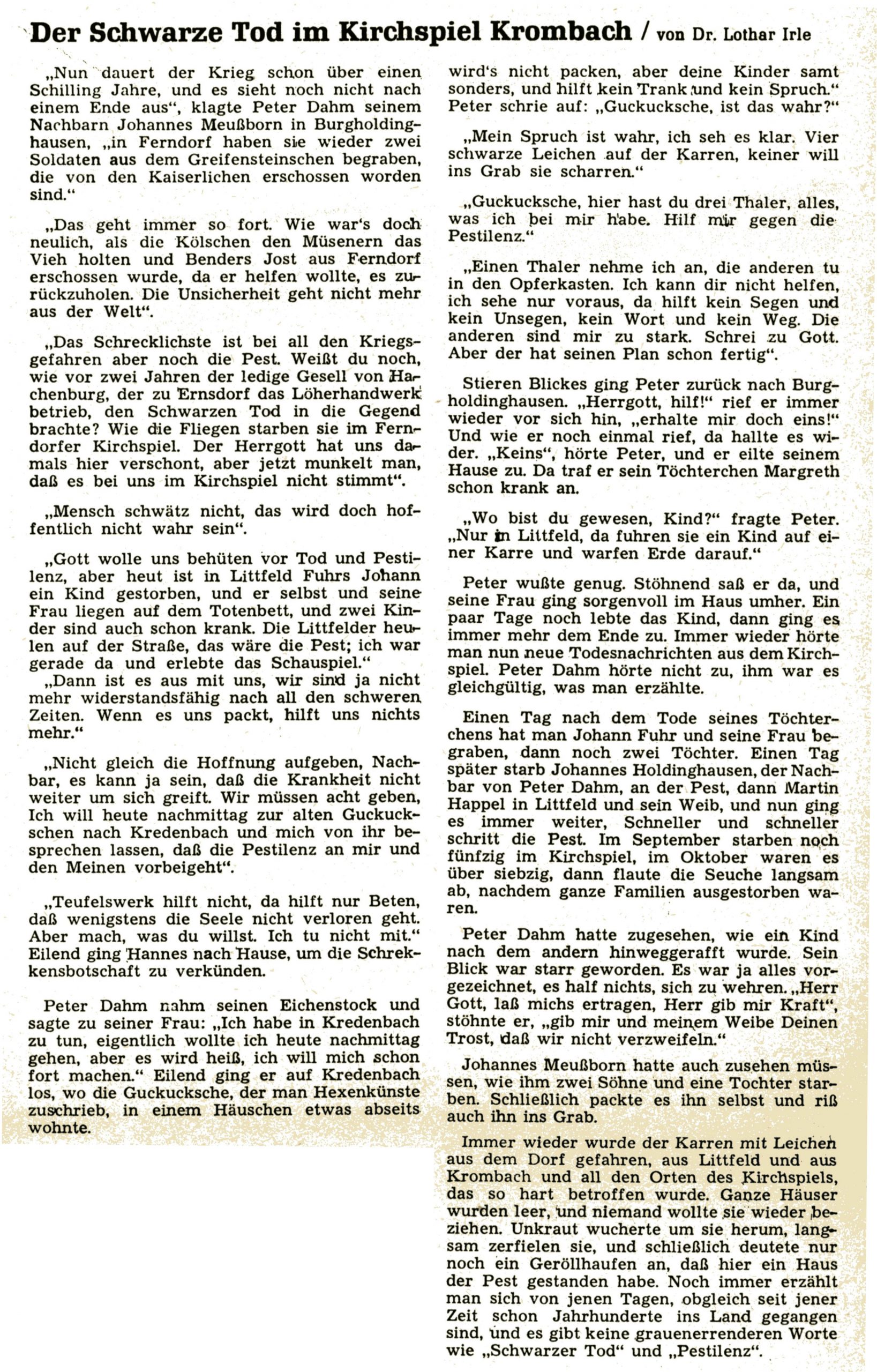
Pingback: Literaturhinweis: Traute Fries: „Jüdische Familien aus Klafeld-Geisweid“ | siwiarchiv.de
Heute erschien in der Wittgensteiner Print-Ausgabe der Westfalenpost eine Zusammenfassung der fünf hier vorgestellten Artikel. Online leider hinter der Bezahl-Schranke: https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/spanische-grippe-wittgensteiner-erfahrung-mit-der-pandemie-id228867757.html
Das ist ein Display von einer Heizungsregelung.
Danke für den Versuch! Allerdings handelts es sich nicht um ein Heizungsdisplay.
Eine Waage vielleicht?
Leider nein. Vielleicht gibt es im Laufe des Tages einen weiteren visuellen Tipp.
Ein Solarpanel für eine beleuchtete Hausnummer vielleicht?
Leider nein!
Der Artikel Wittgensteiner Kreisblatt wurde gestern in Wikipedia eingestellt, der für die Wittgensteiner Zeitung vorgestern.
Danke für den Hinweis!
Ich tippe auf einen Badekarren wie sie früher z. B. in den Nordseebädern benutzt wurden.
Leider nein! Aber wir kommen der Antwort schon näher. Ich frage mich, wo im Kreisgebiet ein solcher Karren gestanden haben könnte ….. ;-)
eine ehemalige Umkleidekabine in einem Schwimmbad
Leider auch nicht!
Heckfenster des erstern Omnibus (Siegen-Netphen-Deuz)
Eventuell auch die Frontscheibe des Modells.
Gemeint ist sicherlich das große Ganze: der erste Benz Omnibus
Die Reflektion im Fenster beschäftigt mich – etwas aus dem Technikmuseum in Freudenberg? Der zweite Hinweis könnte evtl. (besonders, wenn man sich das blau eingefärbte Foto ansieht) auch eine Abdeckung von einem Brunnen sein – ich hatte es erst für ein Wagenrad gehalten, aber eine Brunnenabdeckung würde auch Sinn machen. Lieben Gruß aus Burbach, Sven
Eine Radarfalle? Blitzer?
Ich Tippe auf ein Sichtfenster zum prüfen eines Mühlenrades.
Ich korrigiere mich. Es ist ein Planwagen mit Sichtfenster hinten. wie sie früher üblich waren.
@ alle: Vielen Dank für die zahlreichen Lösungsversuche! Ich bitte um Nachsicht, dass ich mir als Admin über die Feiertage ein wenig Blogferne gegönnt habe.

@ Tobias, Lena, Daniel: Gratulation zur richtigen Antwort!
Hier die Auflösung für alle:
Aus Bundesarchiv Berlin: R 9361-V/29272 (Sammlung Berlin Document Center (BDC): Personenbezogene Unterlagen der Reichskulturkammer (RKK)) geht nach Recherchen von Helmut Géwalt hervor,
1) dass Mollat in Siegen der Loge „Zu den drei eisernen Bergen“ angehörte. Er dürfte bis zur Auflösung der Logen im Herbst 1933 weiter Mitglied dieser Loge oder einer anderen Tochterloge der Mutterloge „Zu den drei Weltkugeln“ gewesen sein.
2) dass Mollat Sommer 1896 eine Landwehrübung gemacht und als Vizefeldwebel der Landwehr entlasssen worden ist
3) dass Mollat von 1871 bis 1880 das Kasseler Lyceum Fridericeanum besucht hat,
4) dass Mollat bei der Handelskammer in Frankfurt/oder 12 kaufmännische Fortbildungsschule gründete,
6) dass Mollat in Siegen Lehrer des Volksbildungsvereins, Mitglied des Kuratoriums des Realgymnasiums, des Lyzeums, der gewerblichen
Fortbildungsschule und der Stadtschuldeputation war,
7) dass Mollat bei der Wahl zur NAtionalversammlung im Januar 1919 als Kandidat der DVP antrat,
8) dass er August 1920 als geschäftsführendes Vorstandsmitglied des „Vereins deutscher Eichenloh-Sohlledergerber“ nach Berlin übersiedelte,
9) dass er in dieser Funktion bis 1923 – Auflösung des Vereins – arbeitete,
10) dass er bis 1930 als Leiter der Berliner Geschäftstelle der Handelskammer und des Berg- und Hüttenmännischen Vereins zu Siegen tätig war,
11) dass ihm am 8. Januar 1934 anlässlich des Goldenen Doktor-Jubiläums der Titel Dr.jur. durch die Rechts= und Staatswissenschaftliche
Fakultät zu Göttingen verliehen wurde.
Ferner weist Gewalt auf einen Brief Mollats im Nachlass Friedrich Meineckes hin (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, VI HA NL Meinecke, F. Nr. 29).
Bernert gibt in seinem Beitrag folgende hier noch nicht genannte Quellen an:
1) Kürschners Deutscher Gelehrtenkalender 1931, S. 1986-1987
2) Siegener Zeitung, 20./21.3. 1943
3) Verzeichnis der deutschen Handelskammerbeamten 1930, S. 213
4) Jahrbuch der deutschen Industrie- und Handelskammern 1925, Nr. 199
5) Jahrbuch der deutschen Industrie- und Handelskammern 1928, Nr. 80, S. 681
6) Jahrbuch der deutschen Industrie- und Handelskammern 1930, S. 32
7) Georg Wenzel. Deutscher Wirtschaftsführer. Lebensgänge deutscher Wirtschaftspersönlichkeiten; ein Nachschlagebuch über 13000 Wirtschaftspersönlichkeiten unserer Zeit, Hamburg 1929, Sp. 1526
Zudem erwähnt er noch folgende Publikationen Mollats:
– Die juristischen Prüfungen und der Vorbereitungsdienst zum Richteramte. Sammlung der in den deutschen Bundesstaaten geltenden Vorschriften. In fünf Abteilungen, Berlin 1886
– Rechtsphilosophisches aus Leibnizens ungedruckten Schriften, Leipzig 1895
-Geschichte der deutschen Staatswissenschaften von Kant bis Bluntschli, i. Abt. Lesebuch zur Geschichte der Staatswissenschaften, Kassel 1890
– Lesebuch zur Geschichte der Staatswissenschaften des Auslandes, Osterwieck 1891
– Lesebuch zur Geschichte der deutschen Staatswissenschaften von Engelbert von Volkersdorf bis Johannes Stephan Pütter, Tübingen 1891
– Volkswirtschaftliches Lesebuch für Kaufleute, Frankfurt/oder 1905
Bernert gibt noch folgende biographische Details:
1) Eltern: Johann Wilhelm Mollat, Metzgermeister und Stadtrat, Johanna Louise Wilhelmine AlbertineHenriette Credé [lt. Gewalt ist der Vater noch zu überprüfen]
2) Heirat 2.7.1898 in Kassel Julie Eleonore Auguste Berlit (*25.9.1876 in Kassel, +10.2.1959 in Frankfurt/Main)
3) 3 Kinder: 9.5.1899 Wilhelm (Assistent an der Handelskammer in Siegen, Ministerialrat in Bonn), 8.2.1901 Hellmuth (Kaufmann), 30.12.1902 Lore
4) Ostern 1869 höhere Bürgerschule, dananch Privatschule
5) Sterbeort: Ranis/Thür.
Eine NDR-online-story zum 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Bergen-Belsen widmet sich Adolf Haas: https://story.ndr.de/bergenbelsen/
s. a.:
– B.B.: Georg Mollat, in Hessenland (50) 1939, S. 47, Link:
https://orka.bibliothek.uni-kassel.de/viewer/image/1289911336242_0050/55/
– StadtA Kassel Bestand S 1 (Personenbezogene Sammlung (hauptsächlich Zeitungsausschnitte)) Nr. 1855
ein Namenschild?
Ich vermute einen Osterrätsel-Irrläufer. Daher: das Rätsel ist bereits gelöst.
Heinz Stötzel verweist in seinem Beitrag „Lernen und beten an einem Ort. Kapellenschulen der Brauersdorf, Nauholz und Obernau“ (Siegener Zeitung, Heimatland v. 11. April 2020) auf folgende, archivischen Quellen:
1) Archiv der Stadt Netphen, Schulakte Brauersdorf-Nauholz 1841-1910, Register-Nr. 415
2) Archiv der ev. Kirchengemeinde Netphen, Schulakte Obernau
Wenn einem schon ein „Blick in die Bestände“ versprochen wird, dann ist es deprimierend, dass man als interessierter Betrachter mit Bildern in einer solch schlechten Bildqualität abgespeist wird. Es ist sehr wünschenswert, wenn hier umgehend sowohl rückwirkend als auch für die Zukunft deutlich nachgebessert wird.
Liebe Frau Schulz!
Mein Vater war Schüler des Fürst-Johann Gymnasiums, wo er 1952 sein Abitur gemacht hat und wahrscheinlich bei Ihrem Großvater Kunstunterricht hatte. Beim Aufräumen in meinem Elternhaus habe ich 2 Bilder Ihres Großvaters gefunden.
Wenn Sie möchten, können Sie mit mir Kontakt aufnehmen.
Hallo Frau Vollmer,
das ist ja sehr nett, danke, gerne können Sie mir die Bilder mal per Whats up schicken…
0170-8350263
dann schaue ich mir Sie mal an.
Wo wohnen Sie und lebt Ihr Vater noch ??
Ich lebe in München.
Mit freundlichen Grüßen
Heike Schulz
Dann noch nachträglich alles Gute zum Geburtstag!
Zu weiteren Projekten der lokalen bzw. regionalen Dokumentation der Corona-Pandemie s. a. https://archive20.hypotheses.org/9172
Guten Abend, ich schreibe sie an bezüglich der Dinge die in der Corona Zeit gemacht werden. Ich lade sie herzlich ein unsere Seite bei Facebook #SiegerlandStones zu besuchen.
Gerne Können sie auch in Kontakt mit uns treten 02734/439428.
Hierbei handelt es sich um Wandersteine die gemalt ausgelegt und gefunden werden. Dieses ist mit Facebook verknüpft so das die gemalten und gefundenen Steine gepostet werden. Analoges mit Digitalem verbinden. Bei Intresse gerne melden wie wir etwas für sie tun können, oder selber mal in der Gruppe eine Konservation starten.
Mit freundlichen Grüßen
Katja Bruland mit Sabrina Ohrendorf und Rebecca Schepp
Wenn es mal im Kreisarchiv nicht mehr so läuft, empfehle ich „The Royal Archives“. Da könnten Sie, lieber Jubilar, der Queen dann immer persönlich gratulieren (und sie Ihnen).
Das durchaus moderne Selbstbild des Archivs lässt sich dieser Stellenausschreibung entnehmen:
https://theroyalhousehold.tal.net/vx/mobile-0/appcentre-1/brand-0/candidate/so/pm/1/pl/4/opp/1144-Archives-Manager
Nein, dahin wird wahrlich niemand „strafversetzt“! Leider ist die Bewerbungsfrist vor vier Jahren abgelaufen, aber vielleicht gibt es mal wieder eine Gelegenheit.
Nun, schöner Gedanke! Allein mein Englisch wird mir wohl einen Strich durch die Rechnung machen.
Zum Beitrag auf Radio Siegen s. a. :
Pingback: Linktipp: Wikipedia-Artikel zum „Wittgensteiner Kreisblatt“ | siwiarchiv.de
Pingback: „Von der Zinkwanne in die Badeanstalt | siwiarchiv.de
ich gerne mal wissen, an welchem Hilfspaket man als kleiner Sport- oder Kulturverein teilhaben kann. Ich kenn bisher leider noch keines
M.E. sind da analog die entsprechenden Dachverbände mit vergleichbaren Initiativen gefordert.
Leider ist der Tagungsband mit 59 Euro deutlich teurer, als zunächst in der Buchvorstellung angegeben.
Danke für den wichtigen Hinweis!
Pingback: Foto-Dokumentation zu Auswirkungen der Corona-Pandemie in Netphen-Deuz | siwiarchiv.de
Pingback: Sanierung der Fürstengruft kann im Sommer starten | siwiarchiv.de
Hoffentlich erinnert man sich und schmükt sich nicht an den Wächter der Gruft und Seinem Nachfölger die immer wieder zu festen Zeiten fachkundige Führrungen machten! Wer waren diese Männer?Traurig den Wächter der Gruft und seinen Nachfolger nicht den Namen nach zu kennen!(Erinnerungsschild haben Beide , nein ist man Ihnen schuldig)
Also künftig wird an festen Zeiten us w, ist doch nichts Neues, nein, verschlafen hat Siegen,das Geschichtsbewußte,ja, eingeschlafen ist Alles was in den Hän -den des des des HV lag Keine Ruhmestat das Erwachen lassen unter der Führrung der oben angeführten Personen.
Friedrich Wilhelm Cunos Schrift (1881) zu Olevian ist online einsehbar.
Auf den gemeinsamen Antrag der CDU und FDP wurde hier bereits hingewiesen. Ebenfalls online ist ein Entschließungsantrag der SPD hierzu: https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-9120.pdf
Pingback: Video (nl.): Peter Paul Rubens: „Alte Frau und Junge mit Kerze“ (1616/17) | siwiarchiv.de
Pingback: Videotipp: Vorstellung des Archivportals-D | siwiarchiv.de
Der Landtag hat gerade den Antrag der CDU/FDP-Antrag beschlossen.
Es handelt sich hierbei um das Digitalisat des Exemplars aus der Königlichen Bibliothek Den Haag. Zwei weitere Digitalisate sind via Google Books im Volltext (PDF) zugänglich, nämlich von den Exemplaren der Bayerischen Staatsbibliothek und der British Library. Ich frage mich, warum große Bibliotheken ihre Scan-Vorhaben nicht abstimmen, um die mehrfache zeitaufwendige Bearbeitung gleicher Titel zu vermeiden. Das käme am Ende der Vielfalt zugute.
Pingback: Gedächtnisbuch deutscher Fürsten und Fürstinnen reformierten Bekenntnisses online | Archivalia
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 18.4. – 30.4.2020 | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik April 2020 | siwiarchiv.de
Pingback: „Wittgenstein“ 1 (2020) erschienen | siwiarchiv.de
Pingback: Foto-Dokumentation zu Auswirkungen der Corona-Pandemie in Siegen | siwiarchiv.de
Pingback: Oberes Schloss Siegen: Gas gegen Holzschädlinge
Pingback: Understatement - stadt.land.text NRW 2020
Eine ausführliche Biographie Kienzlers sollte auch folgendes berücksichtigen:
Bundesarchiv Berlin, R 2/117666 (Reichsfinanzministerium), Personalakte Herbert Kienzler, 4.6.1907in Eichen/Nidder, Regierungsbausrat Preuß. Staatsbauamt Teschen
Pingback: Zur „Spanischen Grippe“ im Altkreis Wittgenstein (6) | siwiarchiv.de
Pingback: Zur „Spanischen Grippe“ im Altkreis Wittgenstein (6) | siwiarchiv.de
Der Link
Gebäude Kienzlers gesucht – und gefunden funktioniert nicht.
Ein Gebäude wäre der Friedenshort in Freudenberg, heute
Friedenshortstraße 46.
Zum Schuleintrag vom 23. November 1918 in der Schulchronik Benfe:
Richtig ist, dass die Chronik 1898 im staatlichen Auftrag von Lehrer Hugo Gössing (aus Wambel bei Dortmund) begonnen wurde. Gössing war vom 1. April 1898 bis 31. März 1901 Lehrer der Dorfschule Benfe. Die erwähnte handschriftliche Eintragung dürfte von Lehrer Heinrich Blau (geb. 23.01.1893) aus Herne stammen, der mindestens seit Nov. 1917 als Ersatz für den gefallenen Vorgänger Karl Dürr aus Erndtebrück (+ 11.12.1917 Frankreich) in Benfe tätig war und offenbar bis 30. März 1919 blieb. Quelle: Dieter Bald: Die Geschichte der Dorfschule Benfe, in: Dorfbuch Benfe, Heimatverein Benfe e.V. (Hg), Erndtebrück 2015, S. 185-212.
PS: Dem Artikel ist eine Liste sämtlicher Dorfschullehrer in Benfe beigefügt.
Vielen Dank für die Präzisierung! Die Schulchronik selbst enthält biographischen Angaben aller Lehrer*innen der Benfer Volksschule. In der preußischen Volksschullehrerkartei findet sich eine Karte zu Hugo Gössing.
Pingback: Ausstellung: Analogien – Bernd & Hilla Becher, Peter Weller, August Sander | siwiarchiv.de
Lothar Irle bemerkt im „Siegerländer Persönlichkeiten- und Geschlechter-Lexikon“, Siegen 1974, S. 173, zu Kienzler: “ ….. 1972 im Ruhestand,. Mehrere Jahre als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Leiter von Kreisbauämtern im Regierungsbezirk Arnsberg tätig, gehörte dem Planungsausschuß des Deutschen Verbandes für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung an, eines der beide Mitglieder des Deutschen Landkreistages im Kuratorium des Oberprüfungsamtes für die höhere technischen Verwaltungsbeamten zu Frankfurt am Main. Siehe: SZ, 3.6.1971, 23.7.1971, 3.6.1972, 1.7.1972″
Weitere Literatur zu Scheiner:
Wolfram Erber: Edition deutzkultur, Alt-Deutz in Bildern der Maler Jakob und Wilhelm Scheiner, Ansichten von Köln-Deutz aus der Jahrhundertwende, Köln 2018
Wolfram Erber: Zeugen des Kölner Stadtwandels, Die Maler Jakob und Wilhelm Scheiner, in: Draußenseiter, Das Kölner Straßenmagazin, Nr. 187, Köln, April 2018
Ich freue mich, dass der Brief meiner Großmutter veröffentlicht wird. Sicher sind viele solcher Brief geschrieben und verschickt worden. Wir haben noch einen 2. vom 8. Mai von anderer Verwandschaft. Aber dieser gibt mir auch heute noch einen Blick auf das Aufatmen und Bangen an diesem besonderen Tag.
„Frieden ist geworden“, hat sie geschrieben, nun ja, der Krieg war beendet.
Frieden können wir Menschen noch immer nicht so gut.
Auch Ihnen danke dafür, dass der Brief hier veröffentlicht werden durfte!
Pingback: Foto-Dokumentation zu Auswirkungen der Corona-Pandemie in Siegen II | siwiarchiv.de
Siegfried Vogt war von der 5. Klasse an, damals Sechsta, mein Kunstlehrer am Mädchengymnasium. Er hat während der Unterrichte seine persönliche Sichtweise auf die Welt zur Verfügung gestellt, zb den Unterschied von „Lieschen Müller zu Frau Dr. kaufen ein paar Scheiben Wurst beim Metzger“. Wie unterscheiden sie sich im Benehmen, was können wir beobachten? Oder er hat uns das „Sehen“ beigebracht, das man zum Zeichnen braucht: „wenn da das Bein und hier der Fuß und so die Perspektive, dann ist die Linie so… Sonst brechen wir ihr den Fuß.“
Er konnte Pferde von innen nach außen auf die Tafel zeichnen, frei Hand begonnen bei den Knochen und Gelenken, Muskeln aufgelelegt, Haut drüber …fertig.
Er war immer ganz bei der Kunst. Wenn Schülerinnen schwänzten hat er es nicht beachtet und mit denen gearbeitet, die da waren.
Es gibt viele kleine Situationen, an die ich mich erinnere. Und ja, er war auch Schüler von Otto Dix, zumindest beim Aktzeichnen, denn er berichtete von einer Begebenheit, als ein Aktmodell durch das lange Stehen ohnmächtig wurde. Die Studenten sprangen auf, um zu helfen, während Otto Dix rief: „lasst sie liegen, lasst sie liegen… Jetzt hat sie die richtige Farbe!“ wenn ich Dix-Bilder ansehe, möchte ich die Geschichte sofort glauben!
Ich fand diesen Kunstmaler, der keine Hochachtung zeigte vor Reglements in den 70ern ganz wunderbar. Ihn habe ich geachtet, da er irgendwie echt war und menschlich! Vor Krieg und Kriegsdienst hat er stets gewarnt. Er erzählte von seinen grausamen Erlebnissen… Einmal brachte er Zeichnungen und Skizzen aus der Gefangenschaft in Russland mit. Sie waren nicht schön, aber sehr berührend!
Er zeichnete immer, auch bei Konferenzen, notfalls auf dem Butterbrotpapier. Und er hatte die Idee, dass er sich mit dem, was er malt oder zeichnet innerlich verbinden muss, „…dann werde ich ganz die Jungfrau Maria“, sagte er, legte den Kopf zur Seite und lächelte sanft. Das sah echt und ulkig aus, wenn der alte Mann das tat.
Ich bin Kunst-Therapeutin geworden. Und das liegt auch an dem Unterricht von Siegfried Vogt.
Vielen Dank für Ihre persönlichen Erinnerungen an Siegfried Vogt!
ich war zutiefst bewegt, als ich die Zeilen las.
Schöner kann man unseren verstobenen Vater nicht würdigen.
Die Zeit in den Siegener Gymnasien zählte bestimmt zu seinen schönsten Zeiten, von denen er ja wirklich nicht viele erleben durfte, was ja für die ganze Generation galt.
Ich erinnere mich, wie oft er von „seinen Schülern“ und „seinen Schulen“ schwärmte.
Ich wünsche Ihnen für Ihre Tätigkeit alles Gute und genau solch liebe Schüler, wie Sie es einmal waren!
Wolfram Vogt
Dankeschön für die Rückmeldung. Ich freue, dass es jemand liest… und dass Sie, als sein Sohn meinen Kommentar mögen, erst recht. Alles Gute
Pingback: Foto-Dokumentation zu Auswirkungen der Corona-Pandemie im Wittgensteiner Land | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 1.5. – 13.5.2020 | siwiarchiv.de
Pingback: Online: „In die Illegalität gedrängt. Zur Flucht gezwungen. Ermordet. | siwiarchiv.de
Pingback: Eimerchen her! | Unser Siegen
Pingback: Foto-Dokumentation zu Auswirkungen der Corona-Pandemie in Freudenberg | siwiarchiv.de
Folgender Satz bleibt unklar:
„Am 1. Juni 1817 kam der Kreis Siegen zum Regierungsbezirk Arnsberg der Provinz Westfalen, nachdem das Gebiet vorher kurz der Provinz Jülich-Kleve-Berg angegliedert worden war.“
Gehörte also der Kreis Siegen vor dem 1. Juni 1817 kurze Zeit zur Provinz Jülich-Kleve-Berg? Diese Aussage macht stutzig, wenn man dazu die Bekanntmachung Nr. 342 der Königlich-Preußischen Regierung zu Arnsberg liest und dort steht, dass „der Kreis Siegen von dem Regierungs-Departement Coblenz getrennt, mit dem Regierungs-Bezirke Arnsberg vereinigt“ werde. Die Eingliederung des Kreises Siegen wird mit dem 1. Juni 1817 angegeben.
Quelle: Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Arnsberg, Nr. 36 v. 18. Juni 1817, S. 341.
Pingback: Foto-Dokumentation zu Auswirkungen der Corona-Pandemie im Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein | siwiarchiv.de
Danke für den Hinweis! Der Eintrag stellt eine Zusammenfassung des Forschungsstandes dar, der sich für die frühe Verwaltungsgeschichte des Kreises Siegen wohl auf Hans Kruse bezieht. Ich überprüfe es.
Pingback: Georg Mollat (1863 – 1947) | siwiarchiv.de
Pingback: Stellungnahme des VdA zur geplanten Umstrukturierung des Stadtarchivs München | siwiarchiv.de
Zur archivrechtlichen Bewertung s. Thomas Henne, „Gleich- oder nachrangig? Die Auswertung von Archivgut als Aufgabe von Archiven – die gesetzlichen Vorgaben“, Archivwelt, 18/05/2020, https://archivwelt.hypotheses.org/2338.
Pingback: Archivare aus dem Kreisgebiet IV: Ernst Canstein | siwiarchiv.de
Hans Kruse, Das Siegerland unter preußischer Herrschaft, S. 44:
„Wegen seiner [Siegens] früheren Zugehörigkeit zum Großherzogtum Berg hätte es nahe gelegen, es der Düsseldorfer Regierung, also dem 1816 gebildeten Oberpräsidialbezirk Jülich, Kleve und Berg zuzuweisen. Da seine Übergabe an Preußen aber einige Wochen später erfolgte, als die der Düsseldorf zugeteilten Gebiete und es territorial und geographisch mit den von Nassau abgetretenen Gebieten am Rhein und auf dem Westerwalde eng zusammenhing, war es natürlich, daß der neugebildete Kreis Siegen dem ehemals nassauischen, nun preußischen Regierungsbezirk Ehrenbreitstein angegliedert wurde, der zum Oberpräsidialbezirk des Großherzogtums Niederrhein mit dem Sitz des Oberpräsidiums in Koblenz gehörte.“
Das ist eindeutig, und ich sehe keinen Grund, Kruses Aussage anzuzweifeln. Statt „Jülich-Cleve-Berg“ müsste es in dem Zeitungsartikel also „Niederrhein“ heißen. (Die Provinzen NR und JCB wurden dann 1822 zur Rheinprovinz vereinigt.)
Vielen Dank für die Klarstellung!
Der Hinweis zur kurzen Zugehörigkeit zur Provinz Jülich-Kleve-Berg fusst laut Wikipedia auf: August Horn: Das Siegthal – von der Mündung des Flusses bis zur Quelle. Verlag von T. Habicht, Bonn 1854, s. Link zur Online-Ausgabe auf siwiarchiv. Im Kaptiel zur Geschichte des Siegerlandes finde ich jedoch auf die Schnelle keinen Beleg für die im Wikipedia-Eintrag gemachte Äußerung.
August Horn: Fehlanzeige. Auch die Volltextsuche im Digitalisat ergibt keinen Treffer für die Provinz Jülich-Cleve-Berg.
Danke fürs Durchsehen!
1) Weiterer Eintrag im Blog der Archivschule Marburg zum Thema: s. a. https://archivwelt.hypotheses.org/2373
2) Archivalia meldete sich ebenfalls zu Wort: https://archivalia.hypotheses.org/123493
Pingback: Paläographische Links in sozialen Netzwerken | Archivalia
Wikipedia bzw. der Autor des Beitrags zur Kreisgeschichte hat kein Monopol auf diesen Lapsus: Als angeblicher Teil der Provinz Jülich-Cleve-Berg und dort dem Regierungsbezirk Düsseldorf zugeordnet erschien Siegen schon 200 Jahre früher in einem Werk des Erlanger Gelehrten (v.a. Anglisten) Johann Christian Fick (1763-1821): Geographisch-statistische Beschreibung aller Staaten und Nationen der Erde. Ein Handbuch für Jeden, nach den besten Hülfsquellen und den neuesten politischen Veränderungen bearbeitet, Erster Theil, Nürnberg bey Friedrich Campe 1817, S. 315 f.
Wie zuverlässig die Angaben in solchen einst beliebten ambitionierten Fleißarbeiten sind, bedarf sicher keiner Erörterung.
In einem Nachfolgewerk korrigierte Herr Fick zwar diesen Fehler, verspätete sich damit aber leider so sehr, dass wieder Unsinn herauskam: Das Lehrbuch der Geographie oder Beschreibung der Erde und ihrer Bewohner, 2. Auflage, Nürnberg 1825, S. 100 ordnete Siegen nun der Provinz Niederrhein zu, was ja schon beim Erscheinen der (mir nicht vorliegenden) 1. Auflage 1820 überholt war, abgesehen davon, dass es 1825 auch die Provinz Niederrhein gar nicht mehr gab.
Ficks Buch von 1817 hatte, seiner Angabe in der auf März 1817 datierten Vorrede zufolge, schon 2-3 Jahre früher erscheinen sollen, was jedoch wegen der aktuellen territorialen Umbrüche aufgeschoben wurde und dem Autor noch Gelegenheit zu mancherlei Änderungen des Manuskripts gab. Es ist also anzunehmen, dass 1815/16 tatsächlich Gerüchte im Umlauf waren, Siegen solle Jülich-Cleve-Berg zugeordnet werden, was er voreilig für bare Münze nahm. Für ihn in Franken war das Siegerland vermutlich zu abgelegen, als dass er über die dortigen Entwicklungen auf dem laufenden gewesen wäre.
Vielen Dank, lieber Herr Kunzmann, für diesen Hinweis auf die Bemerkungen von Fick. Das war damals scheinbar ein kaum noch zu durchschauendes hin und her schieben von Territorien und Zuständigkeiten.
(Fortsetzung vom 23.5.)
Zurückverfolgen lässt sich die „Jülich-Cleve-Berg-Theorie“ natürlich bis zu Friedrich Wilhelms III. noch aus Wien ergangener „Verordnung wegen verbesserter Einrichtung der Provinzial-Behörden“ vom 30. April 1815 (Gesetz-Sammlung für die Königlich Preußischen Staaten 1815, S.85-98). In der dort gegebenen Übersicht wurden „die von Nassau und Oranien erworbenen Länder“ (die allerdings noch gar nicht in Besitz genommen worden waren) der „Regierung im Herzogthum Berg zu Düsseldorf“ innerhalb der „Provinz Kleve Berg“ zugewiesen. In Anlehnung an die französische Verwaltungsstruktur (Großherzogtum Berg – Département Sieg – Arrondissement Siegen) wäre diese Zuordnung immerhin nachvollziehbar gewesen. Jedoch ist die Verordnung vom 30.4.1815 nie umgesetzt sondern bald fallengelassen worden. Die Einsetzung der neuen Provinzial- und Bezirksregierungen folgte dann wohl weitgehend einer Allerhöchsten Kabinettsordre vom 9. November des gleichen Jahres (in der Gesetz-Sammlung nicht veröffentlicht; vielleicht in einer der späteren Quelleneditionen zu finden). Aber schon im „Patent wegen Besitzergreifung der oranischen Erbländer“ vom 21. Juni 1815 (Gesetz-Sammlung 1815, S. 126-127) hieß es: „Wir vereinigen dieselben mit Unserm Großherzogthum am Nieder-Rheine“, also der zweiten im Entstehen begriffenen Rheinprovinz neben [Jülich-]Cleve-Berg.
Die beiden Provinzen mit ihren schließlich je drei Regierungsbezirken (ursprünglich waren nur je zwei vorgesehen) konstituierten sich am 22. April 1816, ein volles Jahr nach der königlichen Ankündigung. Vom ersten Tag an waren „die oranischen Länder, welche Preußen behält“ der „Regierung zu Coblenz“ im „Ober-Präsidial-Bezirk des Großherzogthums Niederrhein“ unterstellt. (Bekanntmachung in den neuen Amts-Blättern der betroffenen königlichen Regierungen, u.a. Koblenz, Nr. 1 vom 22.4.1815, S. 3 ff.). Eine vorherige wirksame Zuordnung des Siegerlandes (soweit es damals preußisch war) zur anderen Provinz lässt sich also ausschließen.
In der Interimszeit zwischen Juni 1815 („Besitzergreifung“) und Ende April 1816 kann Siegen nur der provisorischen Oberverwaltung des „General-Gouvernements des Nieder- und Mittelrheins“ unterstanden haben, da die Provinzialbehörden ja noch nicht handlungsfähig waren.
Im vorletzten Absatz muss es heißen:
(Bekanntmachung in den neuen Amts-Blättern der betroffenen königlichen Regierungen, u.a. Koblenz, Nr. 1 vom 22.4.1816, S. 3 ff.).
nicht 1815
Ja, so schnell das mit den Tippfehlern. Danke!
… und schon wieder einer …
Pingback: Foto-Dokumentation zu Auswirkungen der Corona-Pandemie im Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein | siwiarchiv.de
Einen chronologischen Überblick bietet: Tim Odendahl, „Debatte um Kernaufgaben von Archivierenden streift auch Offene Archive“ im Blog Archive 2.0, 24.5.2020, Link: https://archive20.hypotheses.org/9201
Gewohnt kurz und knackig: Klaus Graf: „Stadtarchiv München sollte von Facharchivierenden geleitet werden“, Link: https://archivalia.hypotheses.org/123549
Pingback: Debatte um Kernaufgaben von Archivierenden streift auch Offene Archive | Archive 2.0
Pingback: Adelsarchivar Ernst Canstein von den Nazis umgebracht | Archivalia
Pingback: Archivare aus dem Kreisgebiet IV: Ernst Canstein | siwiarchiv.de
Verstehe ich da etwas falsch ??? Diese Ausstellung fand doch schon 2018 statt. . Wird sie dieses Jahr vielleicht wiederholt ??? Das sollte m.E. hier etwas eindeutiger dargestellt werden, dass es sich bei diesem Beitrag nur um eine Erinnerung handeln soll.
Danke für den Hinweis! Sie haben recht. Ich meinte zwar eine entsprechende Pressenotiz gelesen zu haben, aber eine aktuelle Wiederholung wird nirgendwo angezeigt.
Nachtrag zur Literatur:
Mecking, Sabine: Erstklassige Verwaltungskarrieren bei zweitklassigen Voraussetzungen. Die städtische Funktionselite der westfälischen Gauhauptstadt Münster, in: Schmiechen-Ackermann, Detlef/Kaltenborn, Steffi: Stadtgeschichte in der NS-Zeit. Fallstudien aus Sachsen-Anhalt und vergleichende Perspektiven, Münster 2005, S. 66 – 78. Fissmer wird auf S. 71 erwähnt. Zitat zur Situation westfälischer Großstädte waährend des Nationalsozialismus: “ ….. Statistisch betrachtet wechselte in jeder größeren Stadt einmal der Amtsinhaber. ….“
Wie kann man diese Broschüre erhalten?
Die Frage wurde via E-Mail beantwortet.
Aus kirchenarchivischer Sicht würde ich noch ergänzen:
Roger P. Minert: Alte Kirchenbücher richtig lesen. Hand- und Übungsbuch für Familiengeschichtsforscher. Wuppertal 2004.
Aus linksrheinischer Sicht außerdem: Wolfgang Hans Stein: Französisches Verwaltungsschriftgut in Deutschland. Die Departementalverwaltungen in der Zeit der Französischen revolution und des Empire. Marburg 1996.(Anhang mit zahlreichen Faksimiles und Transkriptionen)
Das in der Liste genannte Werk von Heribert Sturm ist 1961 in überarbeiteter und erweiterter Form als selbständige Publikation erschienen. Heribert Sturm: Unsere Schrift. Einführung in die Entwicklung ihrer Stilformen. Neustadt an der Aisch 1961.
Vielen Dank für die Ergänzungen!
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Kurrentschrift hat zu Dohna 2001 und Seidl (PDF im Internet Archive). Wieder mal ignoriert: Archivalia:
https://archivalia.hypotheses.org/8833
GUTZWILLER, Hellmut. Die Entwicklung der Schrift vom 12. bis ins 19. Jahrhundert (Veröffentlichungen des Solothurner Staatsarchivs 8) o. Ort 1981.
https://books.google.de/books?id=eAQ5DAAAQBA
Ist der Link vielleicht nicht mehr aktuell? Ich bekomme immer den berühmten Fehler 404 „That’s an error.“
@Klaus Graf: Vielen Dank für die zahlreichen Hinweise!
Möglicherweise hat der Kollege bei dem Link, der ins Nirwana führte, die letzten Stellen vergessen, und das tschechiche Buch „Klíč k novověké paleografii“ (Schlüssel zur modernen Paläographie) ist gemeint:
https://books.google.de/books?id=eAQ5DAAAQBAj&PG
Einen Titel kann ich noch beisteuern:
Franz Neugebauer, Fibel zum Erlernen des Schreibens und des Lesens deutscher Handschriften des 19. Und 20. Jahrhunderts, 1. Auflage Dresden 2015, Eigenverlag der Sütterlinstube Dresden.
Bezug vermutlich über:
Franz Neugebauer
Rottwerndorfer Str. 2
01257 Dresden
franz@suetterlinstube-dresden.de
Ich selbst hab´s in Stade im Museumsshop gekauft.
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik Mai 2020 | siwiarchiv.de
Die FDP-Fraktion im Siegener Stadtrat unterstützt zurzeit ein Nachdenken über Fissmer – https://www.facebook.com/groups/372599270383625/ – , um ein möglichst komplettes Bild Fissmers zu erhalten , wird hier an dieser Stelle auch auf die Rolle Fissmer beim Schutz des Rheinischen Kulturgüter hingewiesen. NAch dem Erscheinen des Hollywood-Films“ Monuments men“ wurde dieser Aspekt der Stadtgeschichte ja näher beleuchtet, aber meiner Erinnerung nach trat dabei Fissmer nicht explizit in Erscheinung. „immerhin“ wird des Aspekt des Fissmer´schen Wirkens an exponierter Stelle – im Park am Oberen Schloss in Siegen – gedacht:
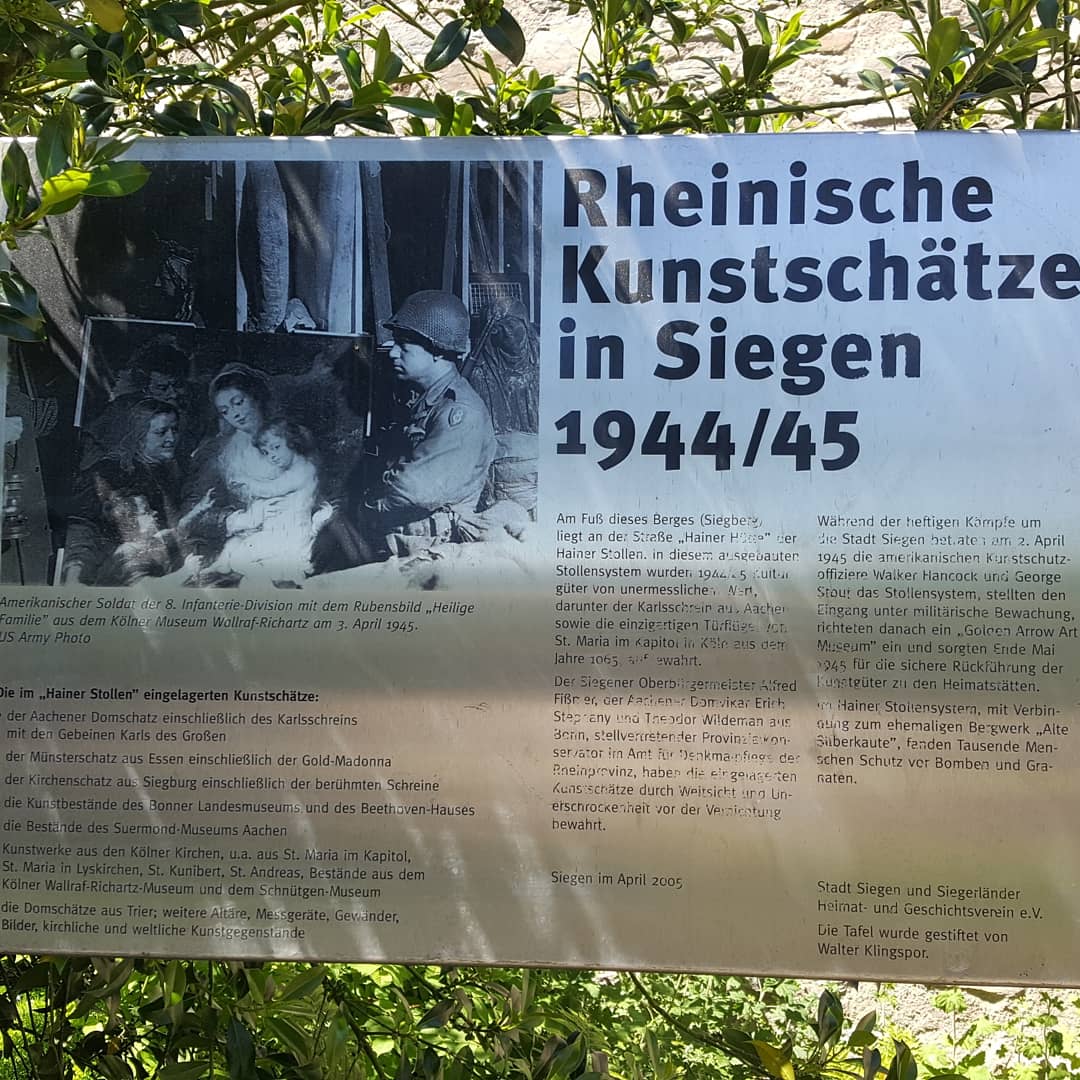
Zur Rolle Fissmers bei der Unterbringung der Kulturgüter gab zuletzt Auskunft: Josef Lambertz: Siegen und die Odyssee des Aachener Domschatzes im Zweiten Weltkrieg, in: Siegener Beiträge 16 (2011), S. 129-144. Die dort gemachten Aussagen stützen sich u. a. auf: Erich Stephany: Die Schicksaledes Aachener Domschatzes während des Kriegs 1939 – 1945, in: Wilhelm Neuß (Hg.): Krieg und Kunst im Erzbistum Köln und Bistum Aachen, Mönchengladbach 1948 [Stephany war als Aachener Domvikar mit der Verbringung des Domschatzes nach Siegen betraut]. Lambertz erwähnt ein zufälliges Treffen Fissmers mit dem rheinischen Landeskonservator Wolff-Metternich auf einer Zugfahrt, der Siegen als Bergungsort in die rheinischen Überlegungen gebracht habe. Daher scheint eine Auswertung der einschlägigen Bestände des LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum in Pulheim-Brauweiler in Hinblick auf die Rolle Fissmers angezeigt.
In diesem Zusammenhang warten einige Fragen noch auf gründlichere Erörterung durch die Biographen:
1. Der Hainer Stollen war als Schutzraum für Menschen, nicht für Gegenstände ausgebaut und dafür ausgewiesen worden. War die Zweckentfremdung zur Unterbringung der Kunstwerke, um die sich Fissmer aus eigenem Antrieb so eifrig bemüht hatte, legal? (Oder wäre sie es heute?)
2. Für die Kunstwerke wurde eine beträchtliche Fläche des Stollens in Beschlag genommen. (Die genaue Quadratmeter-Zahl habe ich vergessen, ist aber in der Literatur zu finden.) Diese Fläche hätte eine Anzahl von Menschen im dreistelligen Bereich aufnehmen können. Wie viele Schutzsuchende sind bei den Luftangriffen im Stadtzentrum ums Leben gekommen, weil sie am Hainer Stollen wegen dessen vorzeitiger Überfüllung abgewiesen wurden und so schnell keine anderen Räumlichkeiten mehr ansteuern konnten?
3. Hatte Fissmers Übereifer (um nicht zu sagen Sammelleidenschaft) womöglich verhindert, dass für die Unterbringung der Kunstwerke bessere Alternativen gesucht worden wären? Es ist ja überliefert, dass etliche Gegenstände durch die Aufbewahrung in dem dafür klimatisch völlig ungeeigneten Stollen beschädigt oder vernichtet wurden (z.B. Gemälde durch Schimmelbefall).
Überhaupt bieten Leben und Wirken Fissmers Anlass zu vielen Fragen. Manche werden sich wegen verschollener Quellen (z.B. der persönlichen Handakten von 1944/45) nicht mehr beantworten lassen, andere nach intensivem Aktenstudium aber sicher doch. Für Interessierte gäbe es viel zu tun … (Das sollten aber die Siegener Eingeborenen und nicht Zugezogene erledigen.)
Zwei weitere biographische „Baustellen“ + weitere Literatur:
1) Fissmer als „Autor“:
In der regionalen Bilbgraphie von H. R. Vitt ist nur ein Text Fissmers aufgeführt: „Die Entwicklung des städtischen Gemeinwesens in den letzten hundert Jahren“, in Siegener Zeitung v. 10. Januar 1923.
Ferner ist ein Geleitwort Fissmers in der von Hans Kruse herausgegebenen Festschrift „Siegen und das Siegerland 1224/1924“ (Siegen 1924) belegt.
2) Fissmers Rede anlässlich der 725-Jahr-Feier der Stadt Siegen am 1./2. Oktober 1949. Neben Fissmer haben wohl der amtierende Oberbürgermeister Ernst Bach, Regierungspräsident Fritz Fries und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Karl Arnold gesprochen – s. http://www.inside-siegen.de/onlinenews2.php?id=7307&s= . Ein Grußwort in der Festschrift der 725-Jahr-Feier ist ebenfalls vorhanden.
3) Gerhard Hufnagel: Interesse und Verantwortung. Die metallindustriellen Arbeitgeberverbände des Siegerlandes vom Kaiserreich bis zur Deutschen Diktatur, Siegen 200, S. 349, 391
“ …. Noch eine kleine Debatte: Die Linken forderten wortreich, das Germania-Denkmal aus der Fissmer-Anlage zu entfernen. und am Oberen Schlossbei den Kanonen unterzubringen. Dafür gab es keine weitere Untersützung, alle übrigen Fraktionenlehnten das Ansinnen rundweg ab.“ (Quelle: Siegener Zeitung, „Grüne Fissmer-Oase hat Zukunft“, 4.6.2020 [Print])
Zum aktuellen Sachstand:
1) Tobias Riegel, „Skandalurteil: Helmut Kohls Geheimnisse bleiben „Privatsache“, Nachdenkseiten.de, 27.05.2020, Link: https://www.nachdenkseiten.de/?p=61309
2) Sabine Schiffer, „Kohl-Akten bleiben weiterhin versteckt“, medien-meinungen.de, 28.5.2020, Link: https://medien-meinungen.de/2020/05/kohl-akten-bleiben-weiterhin-versteckt/
3) Gaby Weber, „Entwendete Akten von Helmut Kohl bleiben Privateigentum“, Telepolis, 30.5.2020, Link: https://www.heise.de/tp/features/Entwendete-Akten-von-Helmut-Kohl-bleiben-Privateigentum-4768730.html
4) 3sat Kulturzeit, 3.6.2020, „Streit um Kohl-Akten“, Link: https://www.3sat.de/kultur/kulturzeit/ex-kanzler-kohls-akten-100.html
Die „Germania“ von Prof. Friedrich Reusch (1843-1906) steht für die „Deutschen Einigungskriege“, die Preußen zu verantworten hatte. Indirekt erinnert das Denkmal an den berühmten Roman „Die Waffen nieder!“ von Bertha von Suttner (1843-1914). Das furchtbare Geschehen dieser Kriege ist Inhalt des Romans. Das daraus entstandene Theaterstück wurde 1908 in Siegen uraufgeführt. Die Kosten trug Fabrikant Karl Ley (1858-1941), der bereits 1894, 15 Monate nach der Gründung der Deutschen Friedensgesellschaft durch Bertha von Suttner und Alfred Hermann Fried (1864-1921) in Berlin, die Ortsgruppe der DFG in Siegen gründete.
Das Denkmal und der Name des Platzes symbolisieren „die preußische Zeit“ Siegens.
Danke für die Information! Dann sollte dies bei der behutsamen Überarbeitung des Platzes aber auch so kommuniziert werden, da die Germania als Symbolfigur in der Zeit des Kaisserreich im allgemeinen einen Bedeutungswandel – s. https://de.wikipedia.org/wiki/Germania_(Personifikation)#Kaiserreich_und_20._Jahrhundert . Übrigens, das Siegener Denkmal fehlt in dieser Liste: https://de.wikipedia.org/wiki/Germaniadenkmal .
Eine Zusammenfassung des bisherigen Verlaufs der Verfahren findet sich auf der Homepage der Klägerin: http://www.gabyweber.com/index.php/de/prozesse/110-kohl-akten
Wenn man in die Zeitung schaut, muss man sich fragen, ob es wirklich noch sinnvoll ist, sich zu Fissmer um Aufklärung zu bemühen. Dort findet sich neuerdings die mit nichts belegte und belegbare Behauptung, Fissmer sei nach einem Ausschluss aus der Nazi-Partei nach einem Schwarzmarktprozess um das Hotel Kaisergarten dieser Partei wieder beigetreten. Wie kann man irgendwo beitreten, wenn keiner einen will? Nein, 1937 – das hat also mit dieser Schwarzserviergeschichte nichts zu tun – wurde nach jeweils vorausgegangenem Aufnahmeantrag und nach der Zustimmung durch die Parteioberen Fissmer ein zweites Mal aufgenommen. Den ersten Antrag hatte er vor dem Mai 1933 gestellt. Das gefiel dem Gau Westfalen-Süd, wenn auch nicht der Ortsgruppe Siegen-Altstadt. Die mochte ihn mehrheitlich nicht und meldete sich, nachträglich. Warum die Ortsgruppe etwas einzuwenden hatte, ist unbekannt. Politische Differenzen müssen es nicht gewesen sein. Fissmer fiel – wie viele Beitrittsaspiranten – daraufhin unter die von 33 bis 37 geltende allgemeine Beitrittsperre. Was ihn nicht hinderte, der Förderorganisation der SS beizutreten und großzügig über die systematische Misshandlung der Nazi-Gegner im Keller des Braunen Hauses hinwegzusehen, auf die Pfarrer Ochse ihn ansprach.
Nein, es ist wohl einfach so, dass die Fissmer-Mythen gezielt gepflegt und verbreitet wurden und immer noch werden und dass man sich gern öffentlich als ihr Freund zu erkennen gibt, weil sie tatsächlich immer noch ein geeignetes Mittel der Selbstdarstellung sind, sich nämlich als konservative Mitte und Heimatfreund ins Spiel zu bringen. Das schließt dann mit ein, dass man einen schwarzbraunen Politiker, der provokativ noch im Entnazifizierungsverfahren mit dem Hitler-Gruß auftrat, zu einer „national-konservativen“ Ortsgröße veredelt und alles infrage stellt, was diese Darstellung aufklärend infrage stellt.
Das ist leider eine Sorte von Beschäftigung mit der Zeitgeschichte, die nicht ernst genommen werden kann. Oberflächlich geklitterte Geschichte, keine Überraschung.
Wieder so steile Thesen ohne Grundlage und Belege. Der Schriftwechsel über die Wiederaufnahme liegt vor und wird demnächst veröffentlicht. Zitat aus dem Schreiben der Parteikanzlei vom 1.6.1943: Die Mitgliedschaft des Oberbürgermeisters Fissmer ist nach Mitteilung der Gauleitung Westfalen-Süd wiederhergestellt.“ Wie kann man historisch gegen etwas argumentieren, wenn man die Quellen nicht kennt?
Das ist leider eine Sorte von Beschäftigung mit der Zeitgeschichte, die nicht ernst genommen werden kann. Oberflächlich geklitterte Geschichte, keine Überraschung.
Bislang liegt gar nichts vor. Das unterscheidet diese Anmerkung und etwa auch die Beleglage bei dem Hugo-Herrmann-Zitat, das alternativ zu Klaus Dietermanns begründete Zitierung von Hugo Herrmann gesetzt war und sich von diesem bei aller Ähnlichkeit im Inhalt beträchtlich Unterschied, von dem, was hier unter Verweis auf die Literatur und Primärquellen (wie beim Regionalen Personenlexikon) anzutreffen ist. Bislang fehlen die Belege. Na, ich bin mal gespannt.
Im übrigen: Selbst wenn es sich bei dem oben Gesagten um Thesen handeln würde, so wären sie doch nicht „steil“, sondern passten vollständig ins Bild.
Auf kurzem Weg hier aber noch einmal die Belege für Fissmers zwei Anträge auf und Mitgliedschaften in der Nazipartei: Kartei der NSDAP-Mitgliedschaften im Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde.
Beleg für den „Deutschen Gruß“/Hitler-Gruß an den Entn. – Ausschuss: in der Ent. – Akte im Landesarchiv NRW, Abt. Rheinland in Duisburg. Bestand und Signatur jeweils im Regionalen Personenlexikon. Man kann sich Kopien auch schicken lassen.
Nein, es geht nicht um Thesen, sondern um gesicherte Sachverhalte.
Na dann schon jetzt mal die Zitierung: Das zitierte Dokument ist unter der Signatur Bundesarchiv Berlin, R 1501/142146 verzeichnet und enthält das Schreiben der Parteikanzlei an das Reichsinnenministerium.
Es ist insofern schwierig, die Zitierung auf die nun angegebene Quelle zu beziehen, als man leider nicht genau weiß, wo das Zitat beginnt, weil das Anführungszeichen fehlt. Ich setze jetzt mal eins, so wie es sein könnte und komme damit dann zu einer Mitteilung der Parteikanzlei vom 1.6.1943 an das Reichsinnenministerium, mit der eine gleichlautende(?) vorausgegangene Mitteilung der Gauleitung wiedergeben wird:
[„]Die Mitgliedschaft des Oberbürgermeisters Fissmer ist nach Mitteilung der Gauleitung Westfalen-Süd wiederhergestellt.“
Anzunehmen wäre, dass die Mitgleitschaft nach der Schwarzwarengeschichte um das Hotel und Restaurant Kaisergarten durch entweder einen Ausschluss oder eine Suspendierung beendet worden war. Nun wurde sie wiederhergestellt.
Was hatte das aber mit einer Einschätzung von F. als schwarzbraunem Protagonisten einer völkischen, rassistischen und kriegstreiberischen Politik zu tun? Was hat das mit seiner Gegnerschaft gegen den widerständigen Pfarrer Ochse und F.s Drohung mit dem „Heimtücke-Gesetz“ zu tun? Was mit seiner Rolle bei der Synagogenbrandstiftung oder dem Erwerb des Synagogengrundstücks durch die Stadt „als eine wertvolle Ergänzung unseres Besitzes“ (Fissmer)?
Einen „Fund“ wie diesen in diese Kontexte irgendwie auch nur grob einordnen zu können, scheint mir unmöglich.
F. hatte sich früh schon entschieden, der Nazipartei beizutreten und blieb ihr Mitglied bis 1945, bevor er dann im Anschluss in die CDU wechselte so wie andere in die FDP (Ernst Achenbach) oder in die SPD (etliche spätere Wittgensteiner Landräte z. B.).
So sieht das nun mal aus mit der westdeutschen Nach-NS-Geschichte, im ganzen Land und auch nun eben im Siegerland. Das festzustellen, hat nichts „Steiles“, sondern ist eine Binse.
Unbeantwortet blieb noch die Nachfrage nach der Quelle für die Hugo-Herrmann-Zitierung. Ich finde sie deshalb wichtig, weil sie in ihrem Inhalt im Widerspruch zu der Zitierung von Klaus Dietermann steht, der notierte, was Herrmann ihm sagte. Der Widerspruch bezieht sich auf den Tag der Inhaftierung. Wenn sie am 9. November 1938 am hellen Tag stattfand (wie Herrmann drei Mal sagte), muss F. sie wenn vielleicht auch nicht angeordnet, so doch mindestens unterstützt haben. Der frühe Zeitpunkt wäre insofern nicht ungewöhnlich, als es im benachbarten Hessen (und andernorts) mit den Ausschreitungen und Festnahmen schon am 8. November losging. Davon mag er wohl erfahren haben.
An anderer Stelle wurden die Vergabe des Bundesverdienstkreuzes an F. und die im Landesarchiv in Duisburg dazu vorfindlichen Unterlagen angesprochen. Ich bin ja hier nicht weit von dieser Fundstelle entfernt, muss aber sagen, mir reicht vollständig die Vergabe, muss nicht wissen, was dazu verzapft wurde. Es ist eine Ehrung von mutmaßlich vielen tausend, die in Westdeutschland an alte Nazis gingen, beantragt von irgendwelchen ortsprominenten Heimatfreunden mit ähnlichen Biografien und begründet mit irgendwelchen Ortsmythen, die bis heute hochgehalten werden. Heute von jüngeren Politikvertretern, die sich davon immer noch Applaus versprechen und denen es Wurst ist, ob diese Mythen belegbar sind oder nicht. Es geht um die Wirkung auf den Wähler. Dem können die Duisburger Unterlagen nichts hinzufügen. Zeitverschwendung.
Es genügt m. E., was auf dem Tisch liegt. Der Fall F. ist exemplarisch, zeitgeschichlich und rezeptionsgeschichtlich/“erinnerungskulturell“ und F. unter dem Strich und aufs Ganze bezogen ein kleines Licht. Einer der mit seinen reaktionären Auffassungen jeweils bestens in die Zeit passte. Als die Nazis das Siegerland zu einer ihrer Hochburgen machten durch deren aktive Tolerierung und „vaterländische“ Begleitung, dann durch aktive Unterstützung als ihr Vertreter und prominenter Sprecher und schließlich durch seine Ortsprominenz und durch sein Ich-bereue-nichts im anschließenden Kalten Krieg, der nach Typen wie ihm rief. Das waren dann Krieger, wie man sie brauchen könnte, nun natürlich in anderen Parteien.
2011 gab es nach dem Magazin Der Spiegel knapp eine Viertelmillion BVK-Träger, unter ihnen auch nicht wenige nichtdeutsche Empfänger wie etwa der letzte absolute Kaiser der Welt Haile Selassi oder der kubanische Diktator Fulgencio Battista. Maßgabe war „die persönliche Bindung der Tüchtigsten an den Staat“ und da konnte F. ja allerhand vorweisen, wenn auch nicht gerade in seinem Bezug zum Weimarer Verfassungsstaat, den er gemeinsam mit seinen „vaterländischen“ Kameraden tatkräftig kippen half.
Dem Großen BVK, das er nach obligatorischer Überprüfung übrigens durch auch den westdeutschen Verfassungsschutz erhielt, gingen daher das Kriegsverdienstkreuz 2. und dann 1. Klasse voraus, jeweils „mit Schwertern“. Das war auch schon wegen persönlicher Bindung der Tüchtigkeit an den Staat vergeben worden.
Ins Verhältnis ist die Vergabe des BVK zu den Zeitverhältnissen zu setzen. Da waren ja die Ex-Nazis in Politik, Gesellschaft und Beruf häufig noch aktiv anzutreffen. Auch als „Netzwerker“, wie es heut gern heißt. Von den nicht ganz 50.000 BVK-Empfängern des Jahres 1961 – täglich kamen 14 dazu – dürfte ein hoher Anteil aus der NSDAP gekommen sein.
Ein weitaus höherer Anteil als im Schnitt der westdeutschen Gesellschaft, hier geht es ja um Führungsqualitäten und -kontinuitäten.
Bis heute ist das alles, wie die Diskussion anzeigt, unzureichend bearbeitet und unzureichend angekommen. Die „Gnade der späten Geburt“ lässt unbefangen nach bewährten Mitteln symbolischer/demagogischer Politik greifen, und mit dazu gehört die freundliche Öffnung gegenüber der verstorbenen schwarzbraunen Altherrenschaft.
Der gegenwärtige Forschungsstand zu Fissmer lässt in der Tat nicht mehr bahnbrechend Neues erwarten. Aber für diejenigen, die Fissmers lebensrettenden Bunkerbau für öffentlich ehrenwert halten, ist „leider“ eine möglichst lückenlose Auswertung aller einschlägiger Quellen erforderlich, um sich nicht den Vorwurf der mangelnden Gründlichkeit gefallen zu lassen.
Einen Hinweis hat die aktuelle Diskussion noch einmal in Erinnerung gerufen, der so m.W. in den online verfügbaren biografischen Texten nicht vorhanden ist: Fissmer war Mitglied der Nordischen Gesellschaft, ein Mitgliedsmarke findet sich in den Fissmer-Erinnerungen.
Ja, sicher, gegen Gründlichkeit einer Recherche gibt es kein stichhaltiges Argument.
Was Fissmer angeht, ist er m. E. hinreichend ausrecherchiert, wiewohl mit der Zugehörigkeit zur völkischen Nordischen Gesellschaft noch wieder ein weiterer Tupfer das Bild ergänzt.
Was den Weg vom KVK zum BVK angeht, da finde ich, zeigt sich noch wieder ein bemerkenswerter Hinweis auf die die „Stunde Null“ überspringende Kontinuität vom NS- zum westdeutschen Nachfolgestaat. Geht man nur mal das Regionale Personenlexikon durch, das ja ein paar tausend Kurzbiografien versammelt, stellt man fest, dass Fissmer keine seltene Ausnahme war. Ich bin nur bis zum Buchstaben L gegangen. Es waren viele vormalige Nazis bis hin zu Alten Parteigenossen, die später BVK-würdig waren. Ich nenne hier nur exemplarisch Ernst Achenbach, Ernst Bald, Erich Böhne, Friedrich Flick, Konrad Kaletsch, Otto Krasa, Wilhelm Langenbach. Es fiel mir bei diesem Durchgang auf, dass diese BVK-Träger häufig Wirtschaftsbosse oder eng mit der Wirtschaft liiert waren und dass sie häufiger, als es diese kleine Partei erwarten ließ, in der FDP waren.
Hier öffnet sich für die regionale Geschichtsforschung noch wieder ein weites Feld, real- wie rezeptionsgeschichtlich. Lässt sich m. E. nur ohne parteimäßige Befangenheiten und nur in Freiheit von der Ressourcenfrage(!) bearbeiten. Dafür scheinen mir zur Zeit die Voraussetzungen nicht gegeben. Irgendwelche Debatten mit je anderthalb Sätzen in den als „soziale Medien“ betitelten Mitteilungsformen mögen ein Optimum an Aufmerksamkeit herbeiführen, sind in der Sache aber wenig geeignet. Sehr gut finde ich das Angebot der Kreisarchive, an geschichtliche Fragen heranzugehen. Auch zu Fissmer findet man hier nahezu alles, was man braucht, um zu einer Meinung kommen zu können. Hier wäre der Ort für eine ernsthafte Diskussion.
„Nahezu alles“: Mag sein, und das ist sicher eine ganze Menge. Was übrig bleibt und nur im überregionalen Rahmen (Berlin, Koblenz) recherchiert werden könnte, ist m. E. von nicht geringerer Brisanz. Vor allem zwei Fragen drängen sich auf:
1. Ging die Initiative zur Militarisierung Siegens 1934 (mit all ihren späteren Konsequenzen) von Fissmer aus oder war er „nur“ Erfüllungsgehilfe der Reichswehr? Dokumente zu seinen anfänglichen Geheimverhandlungen im Kriegsministerium sind meines Wissens bisher nicht bekannt (womöglich auch gar nicht mehr erhalten).
2. Sofern das Gerücht zutrifft, dass sich im Kulturbauamt im Hermelsbacher Weg eine V2-Leitstelle befunden hat: Welche Rolle spielte Fissmer dabei, dass dieselbe in Siegen und noch dazu in einem Städtischen Verwaltungsgebäude eingerichtet wurde? (Solche der SS unterstehenden Leitstelllen dienten der anfängllichen Funk-Fernsteuerung der V-Waffen nach ihrem Abschuss, u.a. auch der, die am 16.12.1944 im Zentrum Antwerpens einschlug.)
Danke für die Anregungen! War das Kulturbauamt nicht Kreissache? Also war dieses städtische Gebäude dann „nur“ vermietet?
Wenn auch noch nicht durch einen Kirchenbucheintrag oder Eintrag im Standesamt abgesichert, kann ich das mutmaßliche Sterbejahr von Pez beitragen: 1958. Pez war bekanntlich Dorfschullehrer in Herbertshausen. Er hat dort – vermutlich Ende der 1920er Jahre – neben der Schule eine Birke gepflanzt, die heute unter Denkmalschutz steht. Vor Jahrzehnten hat der dortige Schützenverein ein Holzschild an der Birke anbringen lassen: „Johannes Pez 1891 – 1958.“ Pez war nach Kriegsende wegen seiner NS-Belastung aus dem Schuldienst entlassen worden.
Danke für die Hinweise!
Ein Archiv ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
Danke für den Beitrag!
„Kreisarchive“ = Archive im Kreis
Ein Archiv ist eine Bibliothek die das ganze Zeitgeschehen in Städten und Ländern archiviert/aufhebt, für die nachkommende Generation.
Danke für den Beitrag!
Herr Kunzmann liegt m. E. richtig. Ich habe dazu eine Notiz meines Vaters Wilhelm Fries, vermutlich von 1985, die er anlässlich der Erinnerung an die Garnisonswerdung der Stadt Siegen 1935 aufgeschrieben hat: „Bau der Kasernen in Siegen.
Die Baugenehmigung der ersten Kaserne in Siegen (1933) am Wellersberg geht auf das Jahr 1931/32 zurück. Mein Bruder Karl Fries (Anstreichermeister), der an den Kasernen gearbeitet hat, konnte dies auf den Zeichnungen feststellen. Wirtschaftlich war der Bau der Kasernen bei der damaligen großen Arbeitslosigkeit positiv. Wie später festgestellt werden konnte, hat sich der damalige Oberbürgermeister von Siegen, Alfred Fißmer, für den Standort Siegen sehr bemüht.
Bei dieser Gelegenheit denke ich an die Unterhaltung, die Wilhelm Steinbrück und ich Anfang der 30er Jahre mit dem damaligen (ehemaligen!) Ministerpräsidenten von Sachsen, Dr. Erich Zeigner, anlässlich von Vorträgen für die Friedensgesellschaft im Hotel Monopol in Siegen bis nachts 3 Uhr hatten. Zeigner gab uns damals einen Überblick über die geheime Organisation der deutschen Wehrmacht. Fritz Fries zog die Angabe von Dr. Zeigner sehr in Zweifel. Dr. Zeigner sprach damals in einer öffentlichen Versammlung für die DFG bei Langenbach in Siegen, Wilhelmstraße.“
Das Thema der Versammlung am 19. Mai 1931 lautete: „Kommen Hitler und Hugenberg an die Macht?“ Der Pressebericht der Sieg-Rheinischen Volkszeitung dazu ist in meinem Buch über die Deutsche Friedensgesellschaft im Bezirk Sieg-Lahn-Dill wiedergegeben.
Danke für den Hinweis! Deckt sich so zumindestens nicht mit der einschlägigen Literatur (H. Bäumer), wenn ich mich recht erinnere.
Ob H. Bäumers Elaborat zur Kasernengeschichte „einschlägig“ ist, sei dahingestellt. Auf die historischen Hintergründe der Garnisonwerdung Siegens geht er kaum ein, schwelgt dafür ausgiebig in Erinnerungen an die Militärmusik, in deren Genuss die Siegener ab 1935 endlich kamen. Schwamm drüber.
Fissmer (wie auch seine Amtskollegen in anderen Garnisonstädten) hatte in den 1940er Jahren auf Bitten der Wehrmacht eine Geschichte der Garnison geschrieben (Manuskript im Stadtarchiv Siegen vorhanden). Demnach war die Belebung der lokalen und regionalen Wirtschaft ein angenehmer Nebeneffekt (den man m. E. nicht überbewerten sollte, da die Wehrmacht als Bauherr sicherlich ihre eigenen Kriterien für die Auftragsvergaben hatte); das Hauptmotiv war definitiv, so Fissmer, frühzeitig die Kriegsfähigkeit Deutschlands wieder herzustellen, ohne formal gegen die Auflagen des Versailler Vertrages zu verstoßen. Dafür bot sich die Stadt Siegen an: Verkehrsknotenpunkt, militärisch brauchbare Industrieeinrichtungen und vor allem: Nicht weit vom Rhein aber gerade noch außerhalb des entmilitarisierten 50-km-Korridors gelegen.
Neben der von Fissmer verfassten „Geschichte“ lassen auch seine vor dem Krieg und während desselben wiederholt aber vergeblich an die Wehrmachtsführung gerichteten Anträge auf Verlegung weiterer militärischer Einrichtungen keinen Zweifel an seinen Intentionen. Frei nach dem sogenannten US-Präsidenten: „Make Siegen and The Reich great again!“
Herrn Wolfs Frage zum Kulturbauamt ist wohl berechtigt. Über eine Einrichtung des Kreises hätte theoretisch der Landrat seine schützende Hand halten müssen. Wie es sich in diesem Fall verhielt, müssten weitere Recherchen ergeben. Erwähnenswert ist vielleicht, dass Alfred Fissmer seine Aufrüstungsaktivitäten außerhalb der kreisfreien Stadt Siegen nicht als Oberbürgermeister derselben verfolgte (das wäre Amtsmissbrauch gewesen), sondern dafür vom Wehrmachtsfiskus 1935 als Kommissar eingesetzt worden war. (Ernennungsurkunde im Stadtarchiv Siegen.) Mit weitreichenden Vollmachten ausgestattet, hatte er freie Hand, z.B. um ca. 400 ha Haubergsgelände in den Ämtern Weidenau und Freudenberg für den Truppenübungsplatz zu roden und die Trupbacher Haubergsgenossen zu enteignen, weil sie ihm ihr Land nicht verkaufen wollten. Konflikte mit den jeweils amtierenden Landräten, die sich gelegentlich vor vollendete Tatsachen gestellt sahen, waren vorprogrammiert.
Ein Archiv ist Zeitzeuge für Dinge, die nicht in Vergessenheit geraten sollten!
Danke schön!
Danke für die vielen Informationen!
Ein Archiv (lat. archivum ‚Aktenschrank‘; aus altgr. ἀρχεῖον archeíon ‚Amtsgebäude‘) ist eine Institution oder Organisationseinheit, in der Archivgut zeitlich unbegrenzt im Rahmen der Zuständigkeit des Archivs oder des jeweiligen Sammlungsschwerpunktes aufbewahrt, benutzbar gemacht und erhalten wird (Archivierung).
Danke schön!
2013 hat der umstrittene Siegener Professor Jürgen Bellers Editionen „zurück zu den Akten“ vorgelegt: http://www.siwiarchiv.de/editionen-zuruck-zu-den-akten/ . Wie wohl die Auswahl(kriterien) und die unübersichtliche Zitierweise höchst prblematisch sind, widmet sich eine dieser Editionen der Arbeit Fissmers in den 20er Jahren.
Ein Archiv ist ein Ort, den die geschichtslos in den Tag hineinlebenden 99 Prozent der Menschheit nie betreten und an dem das restliche eine Prozent zu ergründen versucht, welche der beiden Parteien denn nun das Ziel der menschlichen Evolution war.
Das nenne ich mal Vergangenheitsbewältigung! Der Lehrer, ganz offensichtlich ein Anhänger des Nationalsozialismus wird nach 1945 durch amtliche Stellen
aus dem Schuldienst entlassen und die rührigen Dorfbewohner bringen später eine Erinnerungsplakette an einem von ihm gepflanzten Baum an.
Oh dü mei Wittjestä…
Ich nehme allerdings an, dass der Baum unter Naturschutz und nicht unter Denkmalsschutz steht.
Zur „Ehrenrettung“ der Wittgensteiner sei gesagt, dass man sich m.W. dort einer intensiveren biographischen Betrachtung Pez´ widmen wird.
Ein Archiv ist das Netz, das die flüchtige Geschichte der Menschen einfängt und gleichzeitig ein Kleinod, das oft unterschätzt wird!
Ein Archiv ist das sensible kulturelle sowie das rechtlich-administrative Gedächtnis einer Gesellschaft.
Ein Archiv ist das höchste Gut unserer Gesellschaft!
Ein Archiv ist das gesammelte Wissen von Generationen.
Auf Twqitter finden sich bis jetzt folgende weitere Beiträge:
Ein Archiv ist eine Schatztruhe.
@Peter Kunzmann, @Karin Walter, @Christine Wilhelms, @Martina Kämmerer, @Knoll, @Klaus Graf, @Edie-Marie W., @Karsten Kühnel, @Thomas Johann Bauer, @Agnieszka Kleemann
Vielen Dank für das Mitmachen!
Ein Archiv ist die Instanz zwischen Mythos und Logos
Danke schön!
Ein Archiv ist eine Oase der Erkenntnis.
Vielen Dank fürs Mitmachen!
Ein Archiv ist eine Inspirationsquelle für die Beschäftigung mit Geschichte.
Danke schön!
Derzeit ist in der lokalen Diskussion die Feststellung zu hören, die Fissmer unterstellte kommunale Polizei sei in die Festnahmeaktion der jüdischen Männer im Kontext der Synagogenbrandstiftung im November 1938 nicht involviert gewesen, und zwar deshalb, weil die Polizei „nicht gewollt“ habe. Mit anderen Worten: weil Fissmer das nicht gewollt habe. Daraus leite sich eine positive Facette im „Gesamtbild“ von Fissmer ab.
Basis dieser Schlussfolgerung ist eine Zitierung von Hugo Hermann, einem der Festgenommenen. Leider ist nicht angegeben, woher sie genommen ist (und auch nicht angegeben, wo sie endet, denn im Fließtext fehlt das Abführungszeichen). Sie ähnelt der Zitierung Hugo Herrmanns durch Klaus Dietermann in dessen Broschüre „Die Siegener Synagoge“ (S. 4). Zu den Unterschieden gehört, dass bei Dietermann Hugo Herrmann die Festnahme dreimal in dem kurzen Text auf den 9. November legte, morgens, was heißen würde, dass es sich um eine Verhaftungsaktion viele Stunden vor der zentralen Anweisung in der Nacht vom 9. auf den 10. November und weit vor den reichsweit sich ereignenden Festnahmen gehandelt hätte. Das wiederum hieße, dass es eine lokale Initiative gewesen wäre und die könnte nicht am Oberbürgermeister vorbei gelaufen sein. Dafür wäre dann Fissmers Wort entscheidend gewesen.
Möglich ist natürlich auch, dass Hugo Herrmann trotz des dreimaligen Verweises auf den 9. November einem Irrtum unterlag. Er war als „Zeitzeuge“ gefragt, und auch Zeitzeugen können irren. Das weiß jeder etwas Ältere ohne nähere Erklärungen. Das besondere Maß an Glaubwürdigkeit, das dieser Quelle im allgemeinen Verständnis zugesprochen wird, ist grundsätzlich nicht gerechtfertigt, auch wenn man die Perspektive nicht auf den „Zeitzeugen als den Feind des Historikers“ zuspitzen muss. Distanz zur Quelle ist also auch hier angebracht.
Wäre der 10. November der Tag gewesen, an dem sich sowohl die Brandstiftung als auch die Festnahmen nach den zentralen Vorgaben ereignet hätten, wäre Folgendes zu berücksichtigen: Es wäre zwischen der Sicherheitspolizei, also Kripo und Gestapo, einerseits und der „grünen“ uniformierten Polizei, die Fissmer unterstand, andererseits zu unterscheiden. Die beiden hatte jeweils unterschiedliche Kompetenzbereiche. Die Verhaftungsaktion war Gestaposache und lag außerhalb der Entscheidungskompetenz von Fissmer. Die Kripo, die an der Brandstelle im Auftrag der Staatsanwaltschaft präsent war, ebenfalls. Aus dem Verhalten von Gestapo und Kripo lässt sich also zu Fissmer nichts ablesen. Kommunale Polizeikräfte schickte er los, um Plünderungen zu verhindern – es sollte von dem, was anschließend vom Reich requiriert werden sollte, nichts wegkommen –, was nicht ganz gelang. Es kam auch zu Plünderungen. Innerhalb der Brandstiftergruppe war mindestens mit dem SS-Mann Schmidt auch die Stadtverwaltung vertreten. Von Reaktionen darauf durch Fissmer ist nichts bekannt.
Die oben zitierte Schlussfolgerung zugunsten des OB geht demnach umfänglich in die Irre.
Danke für die notwendigen Präzisierungen!
Weiterer Beitrag via Twitter:
Ein Archiv ist … ein guter Anfang!
Vielen Dank!
Zur Rolle Fissmers bei der Etablierung des Landgerichts Siegen s. Walter Irmer/Gerhard Schnautz: Siegens Kampf für sein Landgericht, in: Landgericht Siegen (Hg.): Recht im südlichen Westfalen. Festschrift zum 50jährigen Bestehen des Landgerichts Siegen, Siegen 1983, S. 13 – 19
Ein Stadtarchiv ist eine Wissenseinrichtung, die es ermöglicht, die Geschichte(n) einer Stadt und ihrer Bewohner/ -innen zu schreiben.
Danke für die Teilnahme!
Hugo Herrmann in seiner Rede am 9. November 1962 in der Geisweider Friesenhalle: „In Siegen geschah weiter nichts. Während man in fast allen Städten und Dörfern sich nicht damit begnügte, die Synagogen zu zerstören, plünderte man dort die Geschäfte und demolierte die Wohnungen der Juden.
Das haben die Siegener Juden dem damaligen Oberbürgermeister Fißmer zu verdanken. Derselbe soll erklärt haben, daß er an der Vernichtung der Synagoge und der Verhaftung der Juden nichts ändern könne. Aber für die Ruhe und Ordnung in der Stadt Siegen habe er zu sorgen. So kam es, daß in unserem Privathaus am Giersberg die ganze Nacht ein Kriminalbeamter gewacht hat. Wohl einmalig in Deutschland. Anderntags fand man in unmittelbarer Nähe Haufen von Flaschen und Steinen.“
Wilhelm Fries hat bezeugt, dass im Geschäft der Familie Frank in Weidenau weder geplündert noch irgendetwas zerstört wurde. SA-Männer haben den Eingang bewacht.
Empfehlenswert: Wolfgang Benz – Gewalt im November 1938 – Die „Reichskristallnacht“. Initial zum Holocaust, Bonn 2018, Sonderausgabe für die Bundeszentrale für politische Bildung
Darin wird beschrieben, dass neben Plünderung und Zerstörung Menschen brutal gequält und getötet wurden.
Danke für den Hinweis!
Ein Archiv ist die Zukunftsfähigkeit der Vergangenheit
Danke schön!
Ein weitere Beitrag via Twitter:
Vielen Dank fürs Mitmachen!
Ein Archiv ist ein rechtlich strukturierter Raum.
Danke schön!
Ein Archiv ist unersetzlich.
Vielen Dank!
Hinzuzufügen wäre freilich, dass der wegen Teilnahme an der Synagogenbrandstiftung angeklagte und dann verurteilte Obersturm[bann?]führer der SS Walther Schleifenbaum im Verfahren 1947 erklärte, er habe in Siegen bei den „Ausschreitungen gegen die Juden im November 1938 … auch das zertrümmerte Schaufenster eines jüdischen Geschäftes gesehen.“ Das war eine Aussage, die nicht ent-, sondern belasten konnte.
Mir erzählte als Besucherin der Siegener NS-Gedenkstätte am 7. November 2010 eine ältere Dame (* 1931), ihren Namen lasse ich mal weg, die Kölner Straße in Siegen sei zumindest in einem Teilbereich am Pogromtag mit Scherben übersäht gewesen, wie sie gesehen habe. Gegenstände seien aus Läden auf die Straße geflogen.
Hugo Hermann bezog sich mit dem was er zu Fissmer vortrug und wofür die Siegener Bevölkerung diesem Dank schulde, wie er meinte, auf ein Hörensagen, auf eine umlaufende Entlastungsgeschichte. In der Fissmerschen Entnazifizierungsakte ist tatsächlich dazu Aussage zu finden: 1948 erklärte Fissmer, er habe im November 1938 „Doppelpatrouille mit Karabiner“ durch die Polizei angeordnet, um Plünderungen zu verhindern. Das war eine Aussage, die nicht be-, sondern entlastete. Wäre es so gewesen, was mit der Behauptung von Fissmer natürlich nicht bewiesen ist, würde er nur den Vorgaben von oben entsprochen haben, denn, wie schon gesagt, die Reichsführung hatte im Sinn, statt durch spontan ablaufende Plünderungen sich des Eigentums der jüdischen Minderheit systematisch in einem zentral organisierten geschlossenen Ausplünderungsverfahren anzueignen.
Dass die Siegener Bevölkerung vielleicht sogar stärker als die Bevölkerung anderer Städte der Versuchung zu plündern ausgesetzt war, dafür sprechen die Siegener Vorerfahrungen von 1921, die ja noch in guter Erinnerung gewesen sein werden. 1921 war es vor allem, aber nicht nur auf dem Siegberg im Zuge von Straßenunruhen zu umfangreichen Plünderungen zahlreicher Läden in jüdischer Inhaberschaft gekommen. Fissmer, der schon damals OB, wird das bewusst gewesen sein. Für die Annahme, dass es ihm um das Wohl der jüdischen Bevölkerung gegangen sein könnte, falls er wie von Herrmann behauptet Plünderungen zu unterbinden versucht haben sollte, dafür gibt es keine seriösen Belege.
Und noch einmal zu Hugo Herrmann und zu dessen Erklärung „So kam es, daß in unserem Privathaus am Giersberg die ganze Nacht ein Kriminalbeamter gewacht hat. Wohl einmalig in Deutschland.“ Ob einmalig, muss naturgemäß offen bleiben, die Kripo war auf Anruf gekommen, nachdem ein dicker Stein durch das Fenster des Kinderzimmers geflogen kam, das Steinwerfen hörte daraufhin auf, die Kripo ging wieder, das Steinwerfen wurde fortgesetzt, erneut Kripo (Klaus Dietermann, Die Siegenener Synagoge, S. 24). Wer die zentralstaatliche nichtkommunale Polizei geschickt hatte, ist unbekannt. Gesichert lässt sich sagen, dass nach dem NS-Ende dieser Vorgang ebenso wie die Legende von der Nicht-Plünderung dem Fissmer-Mythos hinzugefügt wurde.
Nein, die Zeitgeschichte hat sich in Siegen so ereignet wie an vielen anderen Orte, der NS-Bürgermeister verhielt sich so wie andere Bürgermeister an anderen Orte auch. Die Stadt war nicht die Ausnahme von der Regel. Was ist daran so schwer zu akzeptieren?
Und schließlich: nichts, von dem, was hier zu lesen ist mit Ausnahme der Angabe der älteren Dame ist neu. Was sich sagen lässt, ist, dass mühsam erarbeitetes gesichertes Wissen dabei ist, zugunsten der Mythen der 1950er bis 1970er Jahre revidiert zu werden. Das ist nach einer ähnlichen Diskussion im vergangenen Jahr erneut das Problem.
vier weitere Twitter-Reaktionen:
Ein Archiv ist der Ort, an dem ich die nächsten Jahre Arbeiten möchte, um digitale und analoge Unterlagen für die kommenden Generationen zu überliefern.
Danke für diese persönliche Satzerweiterung!
Einverstanden! Allerdings fehlt eine wissenschaftliche Biographie, die z. B. die im Stadtarchiv Siegen befindlichen Diensttagebücher Fissmers auswertet. Ein Ego-Zeugnis zwar, dass sicher präzise bearbeitet werden muss. Aber der Fund der Mitgliedschaft in der Nordischen Gesellschaft, rechtfertigt m.E. die Mühe, diese Auswertung dem bisherigen Kenntnisstand hinzuzufügen. Ob sich dadurch die Politik zu einer eindeutigen Entscheidung hinsichtlich der Fisser-Anlage hinreißen lässt oder gar die uneingeschränkten Fissmer-Befürworter eine kritischere Haltung einnehmen, ist für mich zweitrangig
Zu viele Aufschlüsse sollte man aber gerade von den persönlichen Handakten nicht erwarten. Darin hatte Fissmer eben allmögliches abgeheftet, womit er sich den lieben langen Tag lang beschäftigte. Naturgemäß finden sich da viele (im Rückblick) Banalitäten. Man gewinnt den Eindruck eines Oberbürgermeisters, der seine Augen im Dienst und nach Feierabend überall hatte, dem der gute äußere Eindruck „seiner“ Stadt wichtig war und der sich deshalb über so weltbewegende Mißstände echauffieren konnte wie z.B. Grasbüschel, die auf dem Rathausplatz zwischen den Pflastersteinen wuchsen. Und, wie oben erwähnt, fehlen in dieser Serie die Akten aus den letzten Kriegsjahren. (Warum?)
Von größerem Interesse könnte (den Titeln nach zu vermuten) im Stadtarchiv z.B. eine ganze Reihe von Akten zu Behandlung, Unterbringung und im kommunalen Bereich erfolgtem Arbeitseinsatz von Kriegsgefangenen und zivilen Zwangsarbeitern sein, deren Dienstherr der OB war. Wenn er so ein großer Menschenfreund war, wie die Legende behauptet, müsste sich das ja dann auch in solchen Dokumenten widerspiegeln. (Ich habe da meine Zweifel, aber als Gast in Siegen, der ich erst seit 22 Jahren bin, halte ich mich zurück.)
Wenn die Güte eines Arguments, wie vor wenigen Tagen zu erleben, in Wortmeldungen der Paralleldiskussion wortwörtlich danach abgewogen wurde, ob ein Sprecher innerhalb oder außerhalb des Gebirgskessels zu situieren ist, stößt man auf Qualitätskriterien mit Tradition. Die bringen, ließe sich sagen, in der Sache nichts, aber das stimmt nur halb, sie bringen filzigen Regionaltraditionen, die da eine Weile ein Problem hatten, verlorene Anerkennung. Die sind eben doch immer noch ein gutes Klebemittel.
Sagt jemand, der nicht ganz vier Jahrzehnte Aufenthalt nachweisen kann, was ja so viel nicht ist, und nach seiner Rückkehr an den Ausgangsort („außerhalb“) die Annahme bestätigt fand, dass es dort auch nicht anders zuging und zugeht. Es könnte etwas mit dem ganzen Land zu tun haben, dem „Innerhalb“ aller Gesprächsteilnehmer.
Zwei weitere Beiträge via Twitter:
Ich frage mich gerade, ob die Diskussion zwei Ebenen hat ,die gerne miteinander verwoben werden? Eine (erinnerungs)politische Ebene, die hier wie überall in der Bundesrepublik traditionsbehaftet verläuft, und eine geschichtswissenschaftliche, wobei gerade die bis jetzt noch nicht bzw. wenig bekannten Kleinigkeiten nicht uninteressant ist. Der von Fissmer mit Argusaugen überwachtet Strassenzustand in Siegen, dessen Vorschlag zum Weihnachtsmarkt oder dessen Hartnäckigkeit bei der Ansiedlung des Landgerichts sind Mosaiksteine, die zusammengefügt eine präzisere Biographie ergeben werden, die nicht unbedingt Einfluss auf die erinnerungspolitische Diskussion haben wird.
Zum Weihnachtsmarkt s. Nationalzeitung. Amtliches Kreisblatt für die Kreise Siegen-Land und -Stadt, 13.12.1937:

Das trifft m. E. gut den sarkastischen Ton an Stellen der letzten zwei Beiträge (wenn ich nicht nur mich, sondern auch Peter Kunzmann richtig verstanden habe). Es ist natürlich richtig, noch wieder auf das Thema zu verweisen. Wenn wir dann dabei sind, noch wieder zu sammeln, nämlich Bearbeitungsdefizite, dann komme ich noch wieder auf das Regionale Personenlexikon zurück. Dort finden sich die folgenden Stichworte im Fissmer-Artikel zu Fissmers Rolle in der Weimarer Republik:
„ohne enge Parteibindung stets an der Seite des völkisch-nationalistischen Lagers (Selbstbezeichnung: „vaterländisches Lager“) von DNVP, NSDAP, Kriegervereinen, Antisemitischem Schutz- und Trutzbund (Selbstbezeichnung: „Siegerländer Hakenkreuzer“), Bismarckjugend usw., daher wiederholt Konflikte mit Oberbehörden wegen städtischer Toleranz für antirepublikanische Aktivitäten (so 1924 wegen Unterstützung der zunächst als verfassungsfeindlich verbotenen Großveranstaltung „Deutscher Tag“ mit führenden Beiträgen aus der verbotenen NSDAP), nie an der Seite von DDP, SPD, KPD oder des Zentrums in deren Kampf gegen die vereinte Rechte, daher deren gemeinsamer Protest gegen parteiliche und verfassungsfeindliche Politik und Praktiken des OB (1927), schon vor 1933 verbotswidrige Beschäftigung von stadtbekannten Vertretern der äußersten Völkischen im städtischen öffentlichen Dienst (z. B. Wilhelm Langenbach, Deutschvölkische Freiheitsbewegung, Albert Link, NSDAP, Theo Steinbrück, NSDAP) und Entlassung Linker (Willi Kollmann 1932 nach dessen Wechsel von der SPD zur KPD), F. zur Machtübernahme (1933): „Heute weht in [dem Regierungsbezirk] Arnsberg ein anderer Wind.“
Darunter dann Hinweise auf die Quellen. Der Weg ist also vorbereitet, dem gründlicher nachzugehen.
Ein Archiv ist … spannend!
Danke! Ja, jedes Archiv ist spannend.
Zwei weitere Beiträge via Twitter:
Ein Archiv ist immer eine Reise wert!
Danke fürs Mitmachen!
Via Twitter:
Drei weitere Beiträge via Twitter:
Via instagram kamen folgende Beitrage:
Pingback: Linktipp: Kommunalarchive unterstützen – aber wie? – Stadtarchiv Darmstadt
Ein Archiv ist das pralle Leben der Vergangenheit für die Zukunft.
Heute via Twitter:
Ein Archiv ist das Gedächtnis einer Gesellschaft, ein Erinnerungsort, ein Speicher des Vergangenen, ein Schutz vor Vergesslichkeit und gegen das Vergessenmachen.
Danke schön!
In der Print-Ausgabe der Siegener Zeitung vom 13.6.2020 finden sich zwei Leserbriefe („Eine PR-Aktion“ und „Scheinheiligkeit“), die sich mit dem FDP- Vorhaben der Umbenennung der Fissmer-Anlage ausinandersetzen.
Für mich ist es wichtig, dieser interessanten Diskussion noch zwei oder drei Dinge hinzuzufügen:
Das auf facebook veröffentlichte Zitat von Hugo Hermann ist dem Buch „Jüdisches Leben in Stadt und Land Siegen“ entnommen (ich unterstelle, dass sich die Frage darauf bezog, das war jetzt nicht so klar formuliert). Klaus Dietermann beruft sich bei der Wiedergabe auf die Tonbandprotokolle. Ich vertraue ihm in dieser Beziehung mehr als anderen, die hier vielleicht anderes lieber sehen würden. Es ist ein Zitat, das mit Einordnung in den Kontext von Nutzen sein kann. Es dient nicht zur Exkulpierung, sondern ist ein Ansatz zu weiteren Recherchen. Welche Zitierung der Kommentator meint, verrät er uns interessanterweise nicht.
Die Fundstelle aus dem Bundesarchiv wurde gewünscht, ich hab` sie geliefert, und nun ist es doch wieder nicht richtig, geschweige denn wichtig. Tatsache ist, dass die Fundstelle die Behauptung gegenstandslos macht (Bei der Gelegenheit: In des Kommentators Beiträgen gibt es viele Behauptungen, die nicht belegt sind.) Das Zitat gehört auch zur Biografie Fissmers dazu, weil es unter anderem zum Verhältnis Fissmers zum Gauleiter aussagekräftig ist.
Zweitens finden sich hier in dieser Gesamtdiskussion so viele Details, dass man vermuten darf, ein Gesamtbild könnte die Stadtforschung in Siegen – und nicht nur die Fissmer-Forschung – einen großen Schritt voranbringen. Ein solches Gesamtbild muss natürlich ergebnisoffen erforscht werden. Man darf aber nicht vom gewünschten Ergebnis her rückwärts ermitteln, um sich dann selber augenzwinkernd zu bestätigen.
Dankbar bin ich für die Hinweise von Peter Kunzmann auf die Aktivitäten Fissmers bei der Akquise zusätzlicher Militäreinrichtungen. Fissmer dürfte sich mit seiner Wirtschaftsförderungsstrategie in die Reihe anderer Garnisonsstadt-Oberbürgermeister würdig eingefügt haben (dazu sei auf die Geschichte der Bielefelder und Herforder Garnison verwiesen) Richtig ist auch, dass die Qualität der Handakten Fissmers ohne Kontext nicht wirklich gut nutzbar sind. Recht hat Herr Kunzmann natürlch auch mit seinen Verweisen auf das Bundesarchiv. Ergänzt werden müsste hier ein Hinweis auf die Qualität der Entnazifizierungsakte von Fissmer im Speziellen und die von Entnazifizierungsakten im Allgemeinen. Erhellend finde ich die ergänzenden Hinweise von Traute Fries zu Hugo Hermann und erlaube mir dazu den Hinweis, dass auch die Rolle Fissmers bei der Vermarktung der Villa Hermann auf dem Giersberg an General Hollidt (zum Einheitswert von, ich glaube 34000 RM) irgendwie aus der Betrachtung herausgefallen ist. Spannend fände ich es auch, einige der hier aufgeworfenen Fragen – etwa zur Entlassung und dem Schicksal des Sparkassenangestellten Friedrich Vetter in den Kontext zu stellen – dass nämlich die Situation der Siegener Sparkasse aufgrund eines bereits zehn Jahren schwelenden Skandals um ein allzu spekulatives Großinvestment nicht ganz einfach war und dass Fissmer damals vom NS-Gauleiter Wagner wegen seiner Rolle in der Sparkassen-Affäre als Oberbürgermeister als „nicht haltbar“ bezeichnet wurde und zum freiwilligen Rücktritt aufgefordert wurde. Kontext und Duktus spannend sein, wenn Fissmer zur Beschleunigung der Siegener Hochbunkerbauten zusätzliche Zwangsarbeiter forderte.
Damit sehe ich der Diskussion im Siegener Rat um die Umbenennung der Fissmer-Anlage sehr gespannt entgegen, wobei ich nicht mit historisch tiefgreifenden Erörterungen rechne. Ebenso gespannt bin ich darauf, ob es – ähnlich wie hier an manchen Stellen – den Versuch geben wird, die notwendige Diskussion auf Fissmer-Freunde und Fissmer-Gegner, auf gute Meinung oder schlechte Meinung zu reduzieren, wie das heute in den Seichtgebieten unserer Diskursgesellschaft Mode geworden ist. Genau das soll es nicht sein. Den Vorwurf der Geschichtsfälschung an Dieter Pfau und sein Team im Zusammenhang mit der Ausstellung im Krönchen-Center 2005 empfinde ich in diesem Kontext als zumindest grenzwertig.
Für mich persönlich nehme ich in Anspruch, dass ich eigentlich nur an dem interessiert bin, was wirklich war, und auch, dass die Stadt mit einem solchen Anstoß den Neueinstieg in eine neue Erinnerungskultur schaffen kann, nachdem bisher in der Tat Erinnerungen, Anekdoten und Mythen eine ziemlich große Rolle spielten. Ich muss auch niemanden verteidigen, vielleicht auch deshalb, weil ich die Fissmer-Frage eher historisch als politisch betrachte.
Tatsache ist: Es handelt sich um einen Bürgerantrag aus dem Jahr 2018, der im Rat diskutiert wird, und nicht um einen Anstoß der FDP-Fraktion. Die Zeitungsberichterstattung war insofern grob fehlerhaft.
Der unausgewiesenen Zitierung von Hugo Herrmann bei facebook stellte ich das Herrmann-Zitat bei Dietermann, Die Siegener Synagoge (1996, 2. Aufl.), S. 4, deshalb gegenüber, weil dieses sich von der facebook-Zitierung an einer ganzen Reihe von Stellen unterschied. Nun sind die Dinge ja geklärt. Ein Vergleich mit der jetzt vorgenommenen Fundstelle für facebook (Dietermann, Jüdisches Leben in Stadt und Land Siegen, 1998, S. 97) ergibt, dass tatsächlich beide Zitierungen Herrmanns durch Klaus Dietermann erstens an etlichen Stellen auseinandergehen und die erste auch sehr viel umfangreicher ist, und dass sie zweitens die Gemeinsamkeit aufweisen, dass der Zitierende beide Male erklärt, er zitiere Herrmann wortwörtlich. Daraus sollte hinreichend deutlich werden können, dass meine Nachfrage unvermeidlich war, solange die Quelle für die facebook-Zitierung fehlte.
Ein Punkt ist aber nicht zu übersehen, eine nun vorgenommene Veränderung durch den Einsteller. Er schreibt auf facebook:
„Der 10. November 1938 um 9:00 Uhr war das Geschäftshaus noch voller Leute, und ich wohnte damals mit meiner Familie oben im Geschäftshaus im obersten Stock, dem siebten. …“
Original:
„Um 9 Uhr war das Geschäftshaus noch voll Leute, und ich wohnte damals mit meiner Familie oben im Geschäftshaus im obersten Stock, im 7. …“
Die dietermannsche fette Überschrift („Der 10. November 1938“) für das Brandstiftungskapitel machte er zu einem Teil seines auch wegen anderer sichtbar werdender Veränderungen fragwürdigen „Zitats“. Ich enthalte mich jedes Versuchs einer Erklärung für diese Umarbeiten, komme aber an der Feststellung nicht vorbei, dass diese eine Einfügung eines Tattags von ganz besonderer Bedeutung ist, denn sie widerspricht Herrmann. Dieser platzierte in dreifacher Betonung die Verhaftungsaktion auf den 9. November und damit viele Stunden vor das Heydrich-Fernschreiben vom 10. November, 1.20 h, in allen Bezirken „insbesondere wohlhabende Juden“ festzunehmen und dazu Kontakt wegen Unterbringung mit den KZ-Leitungen aufzunehmen. Dietermann, dem der Pogrom-Kalender aus der Literatur bekannt gewesen sein wird, hatte keine Zweifel, dass es in Siegen so war, wie von Herrmann mitgeteilt: „Alle jüdischen Männer wurden an diesem Tag [9.11.] verhaftet und ins Rathaus gebracht.“ (Siegener Synagoge, S. 23)
Der Verweis auf den 10. November stellt das infrage, und das ist deshalb hervorzuheben, weil Siegen mit dem 9. November als Verhaftungstag eine Ausnahme darstellt, die nicht ohne mindestens einen wesentlichen Verantwortungsanteil des OB F. als lokalem Polizeichef für diese Verhaftungen erklärbar ist. Plausibel würde sie durch die lokalen Aktivitäten, wie sie sich im benachbarten Hessen, zahlreich in Nordhessen, aber auch andernorts, bereits am 7. und am 8. November ereignet hatten (ich habe in „Mit Scheibenklirren und Johlen“ ausführlich darauf hingewiesen).
Damit sind wir dann beim Kern des Themas. Wenn F. der Diskussion ausgesetzt ist, wenn er als Namengeber infrage gestellt ist, dann geht es dabei um seinen Anteil am Aufstieg, an der Etablierung und an der Sicherung/Erhaltung der Naziherrschaft, um seine Verantwortlichkeiten und um seine Integration in die Naziverhältnisse. Seine Mitgliedschaft in der NSDAP, die durch nichts bestreitbar ist, ist nur ein Ausdruck dafür. Seine Weigerung, sich jemals dazu selbstkritisch zu äußern, ein weiterer. Seine Praxis als NSDAP-OB in Fragen, die den verbrecherischen Charakter der NS-Politik berühren, das ist zu klären, nicht sein Sachbeitrag zur Ausstattung der kommunalen Schulen, zur Regelung der Müllabfuhr oder zum Straßenbau. Diese Form von Aufrechnung geht so daneben wie etwa der Autobahnbau, der wie erinnerlich gern von der Zeitzeugengeneration jahrzehntelang kompensatorisch für „die guten Seiten“ der Nazizeit angeführt wurde. Das ist inzwischen abgeklungen, sollte diese Form der Argumentation nun fürs Siegerland wieder aufgegriffen werden?
Gerade nicht. Ich wiederhole mich gerne. Es geht nicht darum, Fissmer zu exkulpieren, sondern ein historisch stimmiges Gesamtbild zu präsentieren, das die Stadtforschung insgesamt weiterbringen wird. Und wenn Fissmer am Ende fundiert als belastet, als Mittäter betrachtet werden kann (ich glaube auch, dass viele Indizien dafür sprechen), dann ist das so. Seine Nachkriegshaltung zu seiner Rolle in der NS-Zeit ist relevant. Seine Rolle als Leiter der Polizei in der Weimarer Republik gegenüber Nazis und Völkischen ist ebenso relevant. Genau das ist ja das Ziel historischer Forschung, dass man ein stimmiges Gesamtbild hat. Und genau da ist der alte Fissmer eben nicht auserforscht, Herr Peter Kunzmann hat auf die möglichen Quellenfunde in überregionalen Archiven bereits hingewiesen, Traute Fries auf die Nachkriegsbeiträge von Hugo Hermann zu Fissmer, die natürlich immer nur Ausgangspunkt für weitere Fragestellungen sein können. Und dass in der Siegener Erinnerungskultur manches von Mythen und Hörensagen überlagert wird – geschenkt. Das ist das tägliche Brot des Historikers, Licht hineinzubringen.
Weitere Beiträge via Twitter:
Pingback: Lesetipp: Ahnenpässe im Archiv für Alltagskultur | siwiarchiv.de
Gestern noch via Twitter:
Weitere Einträge via instagram:
Außer Konkurrenz:
#EinArchivist 1000x besser als Homeoffice.
Eine biographische Auswertung von R 3001 Reichsjustizministerium 51012 (Bundesarchiv Berlin). Die Akte enthält zudem ein Lichtbild aus dem Jahr 1936:
Geburtsdatum, -ort: 11. November 1904 in Bocholt/Westfalen
Vater: Oberstudiendirektor; 1 Bruder, 1 Schwester
Religion: kath.
1921/1922 – 1924 Ferien“jobs“ während der Schul- und Semesterferien: Notstandsarbeiten beim Gartenbauamt Gladbeck, ungelernter Arbeiter beim städtischen Fuhrpark Gladbeck, Bauhilfsarbeiter auf der Zeche „Gergmannsglück“ bei der Firma B. Gladen, Buer, Bauhilfsarbeiter bei der „Bauindustrie-Genossenschaft“ Gladbeck
Sport: Leichtahtletik, Schlag-, Fußball-, Faustball.
Während der Semester 1923, 1923/24, 1924 Teilnahme an „inoffiziellen“ wehrsportlichen Übungen der studentischen Korporationen in Würzburg. Weitere Teilnahme an wehrsporetlichen Übungen während des Referendariats in Paderborn.
Während der Ruhrbesetzung eintägige Verhaftung und Versagung des Reiseausweises
Referendariatsexamen beim Oberlandesgericht Hamm: 14. – 16. Dezember 1926 nicht bestanden, 27. November/1. Dezember 1928 „ausreichend“, Anschließend Staatsanwaltschaft Essen, Amtsgericht Gladback, Landgericht Münster, Amtsgericht Münster, OLG Hamm, Rechtanwälte und Notare Funke und Bäcker, Paderborn
Assessorexamen: 2. Juli 1932 nicht bestanden, 17. Juli1933 „ausreichend“
20. September 1933 Rechtsanwalt in Siegen
1. April 1933 Eintritt in die SA, dem NSRB und der NSDAP (2 165 439)
24. April 1933 – 15.Mai 1933 Freiwilliger Arbeitsdienst im Lager Hornheide-Sudmühle bei Münster
Aug. 1935 Übernahmne der Praxis Dr. Hamann
28. Juli 1936 Heirat
27. Aug. 1936 Antrag auf Ernennung zum Notar: -abgelehnt
28. Mai 1937 2. Antrag auf Ernennung zum Notar: „Seit der Errichtung des Landgerichts und der Garnison in Siegen sowie dem Wiederaufblühen des Siegener Wirtschaftsleben sei in den Notariaten ein derartiger Aufschwung zu verzeichnen, dass für weitere Notarstellen Platz vorhanden sei, ….. Wiederholt habe er [Bause] Partei- und Volksgenossen an andere Notare verweisen müssen, so habe er eine erhebliche Anzahl von Notariatssachen, die ihm Arbeitsdienstmänner bezw. deren Väter übertragen wollten, ablehnen müssen. Die Zahl der ihm aus den Reihen der SA-Kameraden angetragenen Notariatsgeschäfte sei so gross, dass seine Nichternennung zum Notar für ihm finanziell besonders fühlbar sei. ….“
8. Juni 1937 Ernennung zum Notar
1938 (?) Geburt eines Kindes
Ab Kriegsbeginn 1939 Kriegsdienst:
– September 1940 Feldwebel und Offiziersanwärter beim III Infanterie-Regiment 181 in Frankreich
– zuletzt Oberleutnant und Schwadronführer
– Eisernes Kreuz II
15. September 1940 Antrag Bauses auf Zuweisung eines Notariats in den „zurückgegliederten, westlichen Reichsgebiet“ [Elsass/Lothringen] bzw. Rückkehr in den Staatsdienst nach Kriegsende
1. März.1943 „an den Folgen einer im Osten erlittenen Verwundung gestroben“
Pingback: HESAUS – Datenbank des Hessisches Landesarchiv zur Auswanderung online | Archivalia
Zitat, datiert vom 28. Mai 1937, aus einer Personalakte des Siegener Rechtanwaltes und Notars Fritz Bause: “ …. Seit der Errichtung des Landgerichts und der Garnison in Siegen sowie dem Wiederaufblühen des Siegener Wirtschaftsleben sei in den Notariaten ein derartiger Aufschwung zu verzeichnen, dass für weitere Notarstellen Platz vorhanden sei, ….“
Link: http://www.siwiarchiv.de/fritz-bause-1943-beginn-einer-recherche/#comment-96012 .
Eine Frage an die Wirtschaftshistoriker: Waren Garnison und Landgericht nur teilweise verantwortlich für das Wiedererstarken der Siegener Wirtschaft?
Pingback: 73 x #EinArchivIst | Archivalia
Aufgrund der von Bause selbst gemachten Angaben (s.o.) wurde das Universitätsarchiv Würzburg angeschrieben. In der Studentenkartei lies sich Fritz Bause nachweisen: Bause studierte im Sommersemster 1923, Wintersemester 1923/24 und im Sommersemester 1924 Jura in Würzburg. Sein Abiturzeugnis des Gymnasiums in Bottrop stammte vom 12. März 1923. Ebenfalls auf der Karteikarte ist ein Bild Bauses, wohl aus dem Jahr 1923. Als Vater wurde der in Gladbeck wohnende und wirkende Studiendirektor Josef Bause notiert. Aus dem verlinkten Personalbogen des Vaters geht hervor, Bause insgesamt 3 Geschwister hatte, Der Vtaer war seit 1902 verheiratet und ist am 13. Juni 1929 verstorben.
Verwaltungsvorlage v. 15.6.2020 zur „Umbenennung der Fissmer-Anlage“ für die Sitzung des Rates der Stadt Siegen:
„Beschlussvorschlag:
Der Rat der Universitätsstadt Siegen stellt fest, dass die Grünanlage neben der Nikolaikirche weiterhin den Namen „Alfred FissmerAnlage“ trägt. Darüber hinaus beschließt der Rat, eine Informationstafel zur Person Alfred Fissmer analog bisheriger Hinweise (Acrylausführung) anzubringen. Darüber hinaus werden auf der Webseite https://unser-siegen.com weitergehende Informationen zur Verfügung gestellt.
Sachverhalt / Begründung:
Ausgelöst durch eine Bürgeranregung hat sich der Haupt-und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 30.05.2018 mit der Umbenennung der Alfred-Fissmer-Anlage befasst. In der Vorlage dazu (Nr. 1894/2018) wurde seitens der Verwaltung schon damals beschrieben, dass die Einordnung des ehemaligen Siegener Oberbürgermeisters difizil ist und unterschiedliche Blickwinkel betrachtet werden müssen. Damals wurde ausgeführt, dass über eine Ausstellung und die damit vorbereitenden Informationszusammenstellung möglicherweise weitere Erkenntnisse gewonnen werden können. Zunächst ist festzuhalten, dass aus unterschiedlichen Gründen die Ausstellung nicht umgesetzt worden ist.
Gleichwohl sind seitens der Verwaltung weitere Recherchen angestellt worden. Unter anderem wurden die Akten zum Schwarzschlächter-Prozess gesichtet wie auch Einblick in die angesprochene Entnazifizierungsakte genommen. Als Ergebnis vorweg kann festgestellt werden, dass auch hieraus und aus weiteren Quellen keine finale Beurteilung Fissmers in die eine wie die andere Richtung vorgenommen werden kann.
Das Stadtarchiv Siegen liefert in der Anlage eine biografische Skizze über die Person Alfred Fissmer. Wie schon in der Vorlage 1894/2018 ausgeführt, dürfte auch hier bei der Lektüre deutlich werden, dass das Thema Fissmer äußerst facettenreich ist. Insofern bietet auch das Biogramm im Detail keine Gewähr für Vollständigkeit, sondern es ist als ein Überblick zu verstehen. Nichtsdestotrotz dürften alle wesentlichen –insbesondere kritischen – Aspekte in der Vita des ehemaligen Oberbürgermeisters thematisiert sein.
Auf wertende Bemerkungen wurde verzichtet bzw. an diskutablen Stellen wurde versucht, auch gegenläufige Meinungen einfließen zu lassen. Das Biogramm stellt daher einen möglichst wertneutralen Abriss der Vita Fissmers dar. Insgesamt wird aber auch daran deutlich, dass eine Entscheidung „Für“ und „Wider“ abzuwägen ist.
Insofern wird noch einmal auf den Beitrag von Matthias Frese verwiesen, der ausführt, dass Straßennamen und Plätze eine Form von Geschichtspolitik darstellen. Sie würden den Erinnerungswunsch an die den Namen verleihenden Personen zu einem bestimmten Zeitpunkt abbilden. Von daher würden Straßenumbenennungen in die Erinnerungskultur eingreifen. Damit bestehe die Gefahr, dass einzelne Personen, Ort, Ereignisse aus dem Geschichtsbild einer Stadt getilgt und so kulturgeschichtliche und gesellschaftliche Zusammenhänge zerstört würden. Abhilfe könne hier eine transparente Aufklärungsarbeit leisten.
Im Rahmen dieser Aufklärungsarbeit und im Kontext der Ausführungen des Herrn Frese schlägt die Verwaltung vor, dass der Name beibehalten, in der Anlage mit einem Hinweisschild die Person Alfred Fissmer auf Basis des Biogramms beschrieben und weitere Informationen auf der Internetseite https://unser-siegen.de [sic!] veröffentlicht werden. Denkbar ist darüber hinaus, im Rahmen einer Veranstaltung die Person Alfred Fissmer zu betrachten.
Nachrichtlich sei noch darauf hingewiesen, dass die Umgestaltung der Alfred Fissmer Anlage gegenwärtig nicht mehr weiter verfolgt wird, so dass auch hierdurch die Anbringung der In-formationstafel möglich ist.“
Quelle: Ratsinformationssystem der Stadt Siegen
Ein Kommentar zu diesem Schlag ins Gesicht aller ernsthaften Historiker kann sich auf ein einziges Wort beschränken: „Peinlich.“ (Nämlich für die Stadt Siegen.) Und das soll nun auch mein letztes in dieser ganzen Angelegenheit sein.
Ich persönlich bin auch etwas irritiert bei dem, was die Stadt da „herausgefunden“ hat. Eine Basis für eine Entscheidung ist das jedenfalls nicht.
Vorgelegt wurde, was in Auftrag gegeben wurde, ein Gesamtüberblick über die Vita, aber das ist nicht das, worum es geht.
Thema war, ist und bleiben F. s Integration in die Rechtsaktivitäten gegen die Weimarer Republik innerhalb des von Deutschnationalen und Nazis einträchtig formierten „Vaterländischen Lagers“ und, nachdem das Ziel erreicht war, dessen Integration in das Naziregime und nach 1945 der Umgang damit.
Dass er der Sohn eines bürgerlichen Industriellen war, dass er Jurist war usw., das ist in einer vertiefenden Beschäftigung mit seiner Entwicklung von Schwarz nach Braun sicher interessant, aber für die Platzbenennung nicht von Bedeutung.
Die städtische Schlussfolgerung „unbelastet“ geht über das Entscheidende hinweg, deckt es zu, klebt am Mythos der 1950er Jahre.
Und bedient sich bei der Weißwaschung ausgerechnet eines so windigen Sozialdemokraten wie dieses Fritz Fries, eines Vorläufers der späteren „Betonfraktion“, dem die eigene Partei den Stuhl vor die Tür setzte, weil er unerträglich geworden war.
Nein, diese seit Jahren laufende Diskussion wird mit dem Täfelchen, einem Armutszeugnis, nicht beendet werden können. Sie wird weitergehen. Gut so, denn die schwarzbraunen Beiträge zum Aufstieg der Nazis und zu den sich anschließenden Verbrechen des Regimes, das sie durchgedrückt hatten und von dem ja auch F. sich nie wieder distanzierte, bleiben so in der Diskussion. Das ist wichtiger als drei feierliche Sätze an einem Gedenktag.
„sich nie distanzierte“
In der heutigen Print-Ausgabe der Siegener Zeitung findet sich ein Leserbrief zur Umbenennung der Fissmer-Anlage mit der Überschrift „Angemessene Würdigung“.
Leider hinter der Bezahlschranke: der heutige Online-Artikel „Stadt Siegen ist gegen eine Umbennung der Fissmer-Anlage“ von Hendrik Schulz, Link: https://www.wp.de/staedte/siegerland/stadt-siegen-ist-gegen-eine-umbenennung-der-fissmer-anlage-id229357152.html
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 9.6. – 21.6.2020 | siwiarchiv.de
So kündigte die Siegener Zeitung heute 2 Artikel – eine Darstellung der aktuellen politischen Sachlage, 1 Exzerpt aus dem Biogramm des Stadtarchivs – zu Fißmer an:
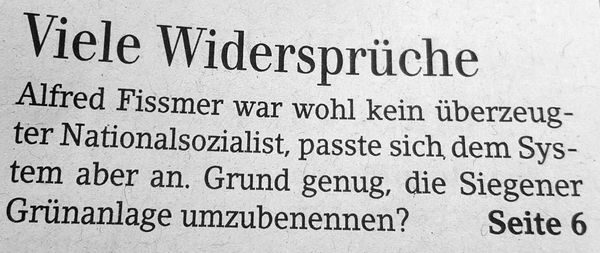
Leider findet sich nur dies hinter der Bezahlschranke: https://www.siegener-zeitung.de/siegen/c-lokales/wer-war-alfred-fissmer_a202978.
Pingback: Linktipp: Kirchenbücher katholischer Gemeinde aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein | siwiarchiv.de
Pingback: Zur Benennung einer Straße nach Alfred Fissmer in Siegen, 1947 | siwiarchiv.de
Pingback: Zur „Spanischen Grippe“ im Altkreis Wittgenstein (7) | siwiarchiv.de
Pingback: Zur „Spanischen Grippe“ im Altkreis Wittgenstein (7) | siwiarchiv.de
Zur gestern stattgerfundenen Ratssitzung, in der auch über Umbenennung diskutiert wurde, erschienen heute zwei Presseartikel:
1) Hinter der Bezahlschranke: Hendrik Schulz Siegener Fissmer-Anlage behält Namen – Aufarbeitung angeregt, Westfälische Rundschau, Link: https://www.wp.de/staedte/siegerland/siegener-fissmer-anlage-behaelt-namen-aufarbeitung-angeregt-id229384466.html
2) Hinter der Bezahlschranke: Mi(chael) R(oth) ?: Debatte um Fissmer ist erst der Anfang. Arbeitskreis soll über politisch strittige Namen von Plätzen und Straßen in Siegen diskutieren, Siegener Zeitung, Link: https://www.siegener-zeitung.de/siegen/c-lokales/strittige-namen-von-plaetzen-neu-diskutieren_a203149
Die Eintragung zu Netphen muss lauten: St. Martin (nicht: St. Marien). Am Martinstag 1895, also vor 125 Jahren, wurde die katholische Pfarrkirche St. Martin in Netphen vom Gemeindepfarrer Caspar Alexander Vollmer benediziert.
Danke ! Geändert.
Bürgermeister Steffen Mues am 26.6.2019 u. a. zur Alfred Fissmer Anlage – ab 1min 39
Pingback: Sterberegister (1974 – 1938) aus dem Landkreis Siegen online | siwiarchiv.de
Pingback: Sterberegister (1874 – 1938) aus dem Landkreis Siegen online | siwiarchiv.de
Wenn ich dem obigen Link folge, bin ich bald dort, wo der DFGViewer mir nur noch eine weiße Seite anzeigt. Mehrmalige Versuche Sterberegisterzweitschriften unter Burbach und Weidenau aufzurufen, führten zu diesem Ergebnis. Auch der Weg über LAV NRW, Abt. Ostwestfalen-Lippe, lässt mich ratlos zurück.
Hat beim Erstellen des Eintrages noch funktioniert…. Möglicherweise handelt es sich um ein Kapazitätsproblem. Ein Aufrufen über den Umweg der Findmittel ist leider nicht möglich, da dort die Findmittel nicht mit den Digitalisaten der Register verknüpft sind.
Das Problem ist behoben. Vielen Dank für den Hinweis!
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik Juni 2020 | siwiarchiv.de
Und die Grünen so:
Es war ein gemeinsam besprochener Antrag von Grünen und FDP, dem der verbliebene Teil der Jamaika dann doch nicht mehr zustimmen konnte. Die vermeintliche Urheberschaft der Grünen ist also, sagen wir mal, eher vom Wunsche getrieben.Nicht so schlimm. Was aber bemerkenswerter ist: Auch in diesem Antrag ist – ebenso wenig wie in der Verwaltungsvorlage – überhaupt keine Rede mehr vom inzwischen zwei Jahre alten Bürgerantrag, der formal und tatsächlich noch nicht beschieden ist.
Die Urheberrechtsfrage mögen die Fraktionen unter sich klären. Tatsächlich interessant ist, dass, wenn der Antrag von 2018 noch nicht erledigt, dann muss doch da irgendetwas passieren. Man hat jetzt den Eindruck, dass die Angelegeneheit mit der Ratsentscheidung seinen Gang geht. Erlaubt die Geschäftsordnung des Rates ein solches Vorgehen? Wenn nein, dann müsste formal der alte Antrag als hinfällig beschlossen werden.
Jetzt auch als PDF: https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Downloads/Meldungen/2020-06-26_archivglossar.pdf?__blob=publicationFile
Disclaimer: Die vorliegende Version richtet sich an männliche Personen. Durchgehend sind männliche, teilweise auch weibliche Personen genannt. Die Veröffentlichung der Version, die sich auch durchgehend an Frauen richtet und an inter und nichtbinäre Personen und diese im Text erwähnt steht bisher noch aus.
(„Weiblich“ und „männlich“ schließt hier trans Frauen und trans Männer mit ein. Eine Unterscheidung zwischen cis und trans nimmt das PDF nicht vor.)
In der heutigen Print-Ausgabe findet sich ein Leserbrief, der eine Umbennung der Fissmer-Anlage als „[a]llenfalls peinlich“ bewertet. Der Brief enthält keine neuen Informationen, verweist aber auf die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes – ein Grund mehr, die m. W. noch nicht ausgewertete Ordensakte einzusehen.
In der heutigen Print-Ausgabe findet sich ein Leserbrief, der das „[e]rhellende Biogramm (!)“, das der Verwaltungsvorlage – s.o. beigegeben war, lobt und die persönliche Wahrnehmung der Ratssitzung schildert.
In Wikipedia wurde auch ein Beitrag über Jakob und Wilhelm Scheiner veröffentlicht.
Siehe Link: https://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_und_Wilhelm_Scheiner
Danke für die Ergänzung!
Das Blog des Archivs der Evangelischen Kirche im Rheinland hat einen weiteren Literaturhinweis: https://blog.archiv.ekir.de/2020/07/03/schreibschriften-eine-illustrierte-kulturgeschichte/ (via Archivalia)
In der vergangenen Woche (Montag o. Dienstag) erschien in der Westfälischen Rundschau der Leserbrief „Fissmer – eine neue Legende“, der u. a. unbelegte Rechtfertigungsversuche pro Fissmer kritisiert.
Das Geleitwort zur der von Paul Fickeler erstellten Publikation „Waldrich Siegen 1840-1955. Zur Geschichte der Stadt Siegen und des deutschen Werkzeugmaschinenbaues. Festschrift Dr.-Ing. E. H. Oskar Waldrich zum 75. Geburtstag“ (Siegen 1955) stammt von Alfred Fissmer, der als Oberbürgermeister i. R. und Ehrenbürger der Stadt Siegen unterzeichnet – und nicht als Mitglied des Aufsichtsrats, so dass man annehmen darf, dass Fissmer zu diesem Zeitpunkt noch nicht dem Aufsichtsrat angehörte.
Vielleicht ist ja der Titel des Alt-Oberbürgermeisters unter dem Geleitwort weihevoller gewesen als der des Aufsichtsrats, der ja gewissermaßen sein Heu im eigenen Stall frisst, wenn auch aus der ersten Klasse. Ich kann es gerade nicht belegen, aber irgendwo habe ich den Hinweis gelesen, dass er damals bereits Aufsichtsrat war.
Ich bin über die Nicht-Erwähnung des Aufsichsratstitel am Ende des Geleitwortes gestolpert. Alle bisherigen biografischen Darstellungen erwähnen leider nicht, wann Fissmer in den Aufsichtsrat eintrat. Daher ist jede Präzisierung willkommen.
Zur nicht unberechtigten und gewohnt meinungsstark vorgetragenen Kritik s. https://archivalia.hypotheses.org/124663
Ehemaliger Schießplatz auf dem Fischbacherberg, heute Erfahrungsfeld Schön und Gut.
Sieht mir eher nach dem Schießgelände auf dem Wellersberg aus.
In dem bereits mehrfach erwähnten Biogramm der Stadtverwaltung heißt es:
„….Darüber hinaus erfuhr das Museum im Oberen Schloss eine Neukonzeption und Modernisierung. …“ (S. 1) Differnzierter (?) schildert dies Martin Griepentrog in „Kunsthistorische Museen in Westfalen (1900 – 1950): Geschichtsbilder. , Kulturströmungen, Bildungskonzepte, Paderborn 1998, S. 107, 119, der dort die Neukonzeption des Museums als eine – weitere ?- Auseinandersetzung zwischen Fissmer und Hans Kruse darstellt.
Pingback: Psychomania (Transformierte Abformungen) – skulpturale Einfassung der Germania-Figur | siwiarchiv.de
Hinter dem Zaun befand sich das Munitionsdepot Wellersberg.
Fischbacherberg: Schießplatz der ehem belgischen Garnison, davor Wehrmacht
Ein Literaturfund zum Kaisergartenskandal:
aus: Klaus Hoppmann-König: Mehr Gerechtigkeit wagen. Autobiographische Collage, Berlin 2006, S. 82
M. E. handelt es sich hier um die Umzäunung des ehemaligen belgischen Munitionsdepots oberhalb der Kinderklinik
Genauso ist es!
Neuer Termin:

s. a. https://www.lwl-archaeologie.de/blog/kirche_bad-berleburg
es könnte sich um das ehemalige Munitionsdepot (Hawk Raketen)
in Burbach am Siegerlandflughafen handeln
Instagram-Post der Stadt Siegen, 11.7.2020:
Auflösung des Sommerrätsels 2020/1:
Es handelt sich um das Munitionsdepot der Belgier am Wellersberg. Das Gelände um das Depot (ca. 14 ha) wurde 1971 zum militärischen „Schutzbereich“ erklärt. Spätestens in diese Zeit fällt die heute noch vorhandene Umzäunung . Die Freigabe des Munitionsdepots erfolgte 1992. Seit 1998 wird das Areal vom „Gebrauchshundsportverein“ genutzt. Die Hunde werden wohl der Grund dafür sein, dass der vom Zahn der Zeit gezeichnete Zaun nicht schon längst entfernt worden ist.
Korrekt haben somit Manfred Heiler und giebeler geantwortet – herzlichen Glückwunsch dazu!
Morgen folgt der 2. Teil des Sommerrätsels und damit für alle eine weitere Chance richtige Antworten zu sammeln.
„Zu Fuß vom Lyz ins Stadtbad“ – Erinnerungen an das Schulschwimmer des Gymnasium am Löhrtor in den 1950er Jahren.
Pingback: siwiarchiv-Sommerrätsel 2020/2 | siwiarchiv.de
Wellersberg (Panzerstraße)
Auf dem Bild ist die Wetterfahne der Obenstruthschule zu sehen.
Der Standort des Fotografen ist das Dach der Kinderklinik am Wellersberg.
Siegen Wielandstraße 17 mit Hahn?
Der Fotograf stand dafür im unteren Berich der Verbindungstreppe /-weges zwischen Wieland- und Herderstraße.
Der Fotograf zieht den Hut vor Ihrer Ortskenntnis! Die Antwort ist nun wirklich nicht mehr zu übertrumpfen.
Danke :-)
Auch von meiner Seite aus herzlichen Glückwunsch! Sie ziehen damit mit den beiden Gewinnern des ersten Rätsels gleich.
Pingback: Kirchenbücher: Onlinestellung des Dekanats Siegen abgeschlossen | siwiarchiv.de
In der heutigen Print-Ausgabe der Siegener Zeitung erschien ein Leserbrief unter der Überschrift „Namen beibehalten“ – nomen ist omen.
Zum Thema Aufarbeitung ungute Bezeichnungen öffentlicher Orte entnehme ich gerade einer anderen Tageszeitung eine Nachricht von jenseits des Gebirgskessels:
In Trier hat gerade der Stadtrat mit 29 zu 17 Stimmen bei vier Enthaltungen die Umbenennung der dortigen Hindenburgstraße beschlossen. Ein neuer Name ist erst noch in der Diskussion. Vordringlich war jedenfalls, dass der alte entfernt werden konnte.
Hindenburg war ja wohl ebenfalls einer dieser deutschnationalen/nationalkonservativen Ehrenmänner, die dafür sorgten, dass der Führer durch Kasernen-, Bunker- und Straßenbau die durch den Ahnenpass ausgewiesenen „Volksgenossen“ wieder in Lohn und Brot bringen könnte. Die erfreut selbstverständlich erfreut waren. Bis hin zu manchen ihrer Enkel.
Über die Hindenburgstraße wurde im Kreisgebiet ja bereits diskutiert. In Hilchenbach ging man einen anderen Weg: http://www.siwiarchiv.de/namensumbenennung-der-hindenburgstrasse-in-hilchenbach/
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 5.7. – 17.7.2020 | siwiarchiv.de
Funde zum Kaisergartenskandal und Fissmer:
1) Samstag, den 13. Dezember 1941, trägt Karl Friedrich Kolbow folgendes in sein Tagebuch ein: “ …. In dem Kaisergartenskandal in Siegen (Uebertretungen der KRiegswirtschaftsverordnungen) seien sowohl Kreisleiter Burk wie auch Oberbürgermeister Fißmer persönlich so sehr verwickelt, daß seines Erachtens [Anm.: gemeint ist Paul Giesler] ihr Weg am Gefängnis nicht vorbeiführen würde, was für Fißmer´s lange Beamtenlaufbahn entsetzlich sei. Besonders Herrn Heringlake [Anm.: In der Abschrift findet sich „Herrn Heminglake“] würde es an den KRagen gehen. …..“
in: Dröge, Martin: Die Tagebücher Karl Friedrich Kolbows 1899 – 1945. Landeshauptmann der Provinz Westfalen, Paderborn 2009, S. 499
2) Am 13. Juni 1942 schreibt Hermann Kuhmichel an Alfred Henrich:
„…. Mein Widersacher, der Oberbürgermeister, hat sich ein Loch in den Bauch geschossen u. wird mir fernerhin kein Leid mehr zufügen. Ich hätte ihm trotz allem einen besseren Abgang gewünscht. …..“
in: Henrich, Frieder: Mit Hermann Kuhmichel durch das Siegerland. Eine dokumentarische Zwischenbilanz über Leben und Werk des großen Künstlers, Siegen 2016, S. 93
3) Auf der Homepage von Karl Heupel ein Pressebericht sowie eine Dokumentenpräsentation der Ausstellung „Justiz im Nationalsozialismus“ im Siegener Landgericht aus dem Jahr 2009. Die Präsentation enthält auch Angaben zum Verfahren gegen Fissmer.
Gerade die Dramatik des Selbstmordversuchs verdeutlicht quasi im Brennglas, dass unterschiedliche Sichtweisen auf ein und diesselbe Handlung möglich sind. War das Motiv das verletzte Ehrgefühl eines preußischen Beamten und Offiziers, schiere Existenzangst oder ein Schuldeingeständnis?
Neben tieferen Erkenntnissen zur Persönlichkeit Fissmersscheint eine Beschäftigung mit dem Kaisergartenskandal auch einen Blick auf das Zusammenwirken der NS-Funktioneliten mit den maßgeblichen Kreisen der Siegener Stadtgesellschaft zu erlauben.
Umso bedauerlicher ist es, dass die zentralen Unterlagen der Staatsanwaltschaft am Dortmunder Sondergericht nicht erhalten sind. So können nur die Auswertung der Presse und Zufallsfunde (s. o.) weiteres Licht in den Skandal bringen.
Die Vermutungen halte ich für durchaus richtig. Am Beispiel Kaisergarten-Skandal lässt sich vieles festmachen, wenn auch nicht alles. Allerdings erlaube ich mir die Feststellung, dass gerade zu diesem Komplex einiges an Aktenmaterial erhalten geblieben ist, so der Bericht des Dr. Jenner zum Prozess an das Reichsinnenministerium. Darüber werde ich in absehbarer Zeit veröffentlichen, um zur differenzierten Betrachtung beizutragen.
.
Da Hans Bruno Jenner ja hier bereits erwähnt wurde, erscheint es sinnvoll auf knappe biographische Hinweise zu verweisen: „Jenner, Hans J.“, in: Hessische Biografie <https://www.lagis-hessen.de/pnd/1025242211> (Stand: 27.2.2020).
Jenner war ferner Ehrensenator der Universität Marburg für „sein Eintreten in seinem Verwaltungskreis für die Universität und die Jubiläumsstiftung“. – s. https://www.uni-marburg.de/de/universitaet/profil/geschichte/ehrensenator-innen
Wird es sich bei der angekündigten Veröffentlichung um eine Auswertung der dreibändigen Personalakte Jenners (Bundesarchiv Berlin, R 1501/207672-7674) handeln?
Hans Jenner war sowohl bei Fissmer als auch einige Jahre später bei Fries, Fritz aktiv. Die Akte liegt in der Tat im Bundesarchiv, Teile davon auch in Duisburg. Es geht hier aber eher um Fissmer.
… und hierbei auch um die Revierstreitigkeiten zwischen den Siegener Nazihäuptelnbei denen eine Zuordnung Fissmers nur in groben Zügen möglich ist. So hat sich m. E, aus der anfänglichen Zweckpartnerschaft zwischen Fissmer und Paul Giesler schnell ein Streit entwickelt, wie er auch in den bei Dröge zitierten Passagen deutlich wird. Leider hält sich Kolbow in seinen Schilderungen ja etwas zurück. Als Insider dürfte er gut informiert gewesen sein.
Wobei Jenner sich ausweislich der Bestände wohl differenziert (!) aber mehrfach zugunsten von Fries äußert, dem damals von SPD-Funktionären aus der Region eine Mitgliedschaft in der NSDAP vorgeworfen wurde.
Ergänzung der Literaturliste zu Alfred Fissmer:
– Dudde, Matthias: Die besoldeten Mitglieder des Magistrats der Stadt Bochum 1856 bis 1918, in: Bochumer Zeitpunkte. Beiträge zur Stadtgeschichte, Heimatkunde und Denkmalpflege 27 (2011), S. 28ff, Link: https://www.kortumgesellschaft.de/tl_files/kortumgesellschaft/content/download-ocr/zeitpunkte/Zeitpunkte-27-2011OCR.pdf
– Deutsches Soldatenjahrbuch 35 (1985, S.52: „…. Hollidt meinte: „Der damalige Oberbürgermeister von Siegen, Fiß- mer, den ich hochgeachtet habe und mit dem mich Freundschaft verband, wollte wohl gern einen General in Siegen haben.“ …..“
Auf Jenner wies Peter Kunzmann bereits vor einiger Zeit hin. Jenner berichtet einiges zu Fries einem windigen Sozialdemokraten der regionalen Spitzenklasse, wie man anschließend weiß, und lieben Freund von Fissmer, siehe die Hinweise in „Widerspruch und Widerstand“ der VVN.
In der heutigen Print-Ausgabe erschien ein weiterer Leserbrief „Erhellendes Biogramm“, der sich für die Beibehaltung des Namens aussprach.
Was das „differenziert“ da jetzt soll, frage ich mich. Es ist einfach so, dass Jenner wiedergibt, was ihm so vorliegt. Dazu gehören mehrere Berichte, in denen Augenzeugen sagen, an Fries‘ Revers das Parteiabzeichen bemerkt zu haben. Das kann er sich einfach nur so angesteckt haben, um Eindruck zu machen, es kann ein echter Beleg sein, die Augenzeugen können sich geirrt haben (mehrere), wie auch immer. Jedenfalls wundert sich niemand über diese Möglichkeit. Jenner hält sich bei der Interpretation zurück. Weder differenziert noch undifferenziert. Das wäre jetzt ein Attribut zur Jenner-Darstellung, das in der Sache nichts, nur etwas für die heutige Performance der letzteren etwas bringen kann.
Ach ja, zur weiteren Bereicherung des Sachverhalts läßt sich hinzufügen, dass diese Beobachtung auch aus seiner Partei, der SPD, kam. Ob da nun jemand irrte, log oder wahr sprach, steht dahin. Sagen lässt sich, dass F. sich dort sehr unbeliebt, wenn nicht gar verhasst machte, wenn dergleichen öffentlich über ihn vorgetragen wurde. Einem nachweislichen Ex-Nazi, der den Entnazifizierungsausschuss mit dem Deutschen Gruß ansprach, dürften das Zeichen am Revers und der daraus resultierende Konflikt ganz gut gefallen haben. F., der gelernte Dreher, war ja ein Unterstützer von F., dem studierten OB und besseren Herrn, der so leutselig und humorig sein konnte, wie die Alten berichten. Und in der Sache mit dem Parteiabzeichen, da lag ja Humor.
Das sollte schon aus Differenzierungsgründen mal gesagt sein.
Weder sind die Fälle Fissmer und Fries aufgearbeitet noch scheint es von Seiten einiger Diskussionsteilnehmer ein Interesse daran zu geben, dass diese Themen differenziert aufgearbeitet werden, weil ja die Differenzierung ein Beitrag sei, den Mythos mit der Realität zu verbinden und alles zu exkulpieren. Es geht nicht um die heutige Performance, es geht auch nicht darum, aus dem alten Fissmer einen antifaschistischen Widerstandskämpfer und aus dem alten Fries einen Kryptonazi zu machen. Das ist einer historischen Betrachtung vorbehalten. Und wenn man sich die Zeugenaussagen genau ansieht, die in der Fries-Akte enthalten sind, dann kann man durchaus Parteikabale in der Beschuldigung vermuten, auch wenn Friesens Rolle im Dritten Reich hinterfragenswürdig ist. Hätte, hätte, Fahrradkette.
Pingback: siwiarchiv-Sommerrätsel 2020/3 | siwiarchiv.de
Die Türe befindet sich am alten Brauereigebäude in Weidenau (heute Uni Fachbereich Kunst), und zwar 2 Fenster weiter links vom dortigen Haupteingang.
Die vereinfachenden Sichtweisen finden derzeit Platz auf der Leserbriefseite der Siegener Zeitung auch heute erschienen im Print drei Leserbriefe: „Siegener gerettet“, „Fissmer gebührt Ehre“ und „Verwendung der Gelder“. Alle votieren eindeutig für die Beibehaltung des Platznamens.
Ein Beleg für die das profunde Verfolgen der Diskussion gefällig? Aus „Siegener gerettet“: “ ….Dass der Rat beschlossen hat, den Platz in der Obberstadt nicht umzubenennen, ist sachlich richtig. Dennoch werden bestimmte Gruppierungen die Angelegeneheit nicht auf sich beruhen lassen – bis der Platz Karl-Marx-Platz oder vielleicht Rosa-Luxemburg-Platz heißt. Aber bald ist Kommunalwahl.“ Anm.: Der Schreiber stammt aus Kreuztal ……
Altes Brauhaus in Weidenau
Da ich etwas spät zur Auflösung komme, sind beide Antworten korrekt, wie dieses Bilde von Manfred Knoche vom 23.5.2014 belegt:

Damit führt Manfred Knoche mit 2 richtigen Lösungen an. Es folgen Manfred Heiler, giebeler und Reinhard Kämpfer mit je 1 richtigen Lösung. Also noch ist alles drin!
Ein Beleg für die u. a. im Biogramm des Stadtarchivs bemerkte Sparsamkeit Fissmers aus der Stuttgarter Sonntags-Zeitung vom 1. März 1931:
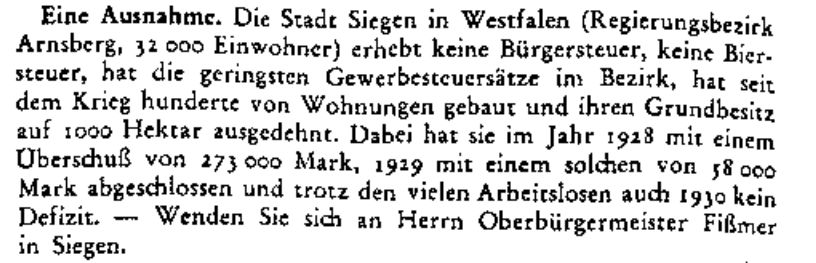
Diese Meldung darf nicht unkommentiert bleiben, bevor dem »sparsamen« Fissmer ein weiterer Mythenkranz geflochten wird. Was hier präsentiert wird, ist eine Zeitungsmeldung, nicht mehr und nicht weniger, die sehr stark einen Sachverhalt kürzt und so damals durch den deutschen Blätterwald rauschte. Doch um die darin enthaltenen Zahlen richtig würdigen zu kennen, ist es notwendig zu wissen, wie sich der städtische Haushalt zusammensetzte, durch welche Einnahmen und Ausgaben sowie außergewöhnlichen Verkäufen aus städtischem Vermögen sich die Überschüsse erzielen ließen (z.B. Hundesteuer hoch, Sozialleistungen kürzen). Diese Entwicklung über mehrere Jahre zu verfolgen, am besten noch im Vergleich mit anderen Städten, führt erst zu einer diskussionswürdigen Grundlage zu diesem Aspekt von Fissmers Berufsbiografie. Seinem Biografen bleibt diese aufwendige Forschung vorbehalten. Zum Aufrechnen gegen die NS-Vergangenheit Fissmers dienen die Ergebnisse jedoch nicht.
Ich entschuldige mich für die unkommentierte Präsentation des Zeitungsakrtikel. Aber: es zeigt wie die erinnerungspolitische Debatte geführt wird, ohne dass eine wissenschaftlichen Anforderungen genügende Biographie vorhanden ist. Die Fragen bzw. Hinweise zur Einordnung der Leistungen Fissmers lassen m. E. auch auf die NS-Zeit ausdehnen. Wir suchen also Kleinstädte mit ca. 30.000 Einwohnern, um Vergleiche ziehen zu können.
Ein weitere Fund zur „Fissmerschen Finanzpolitik“:
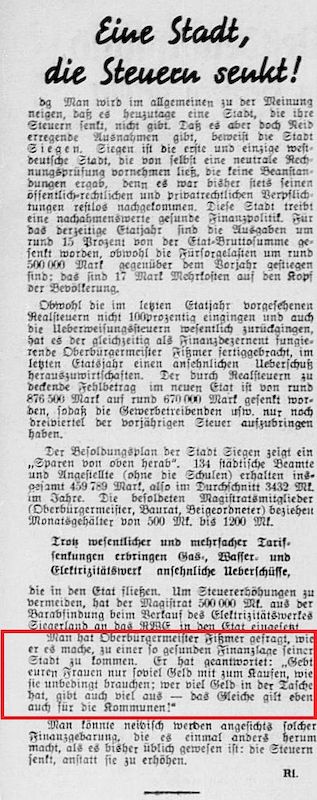
Quelle: Duisburger General-Anzeiger, 7. September 1932
Noch einmal zurück in das Jahr1931 in der in Aachen erscheinenden Zeitung „Echo der Gegenwart“ erschien am 21. Januar 1931 folgender Artikel zu Fissmer Sparpolitik:
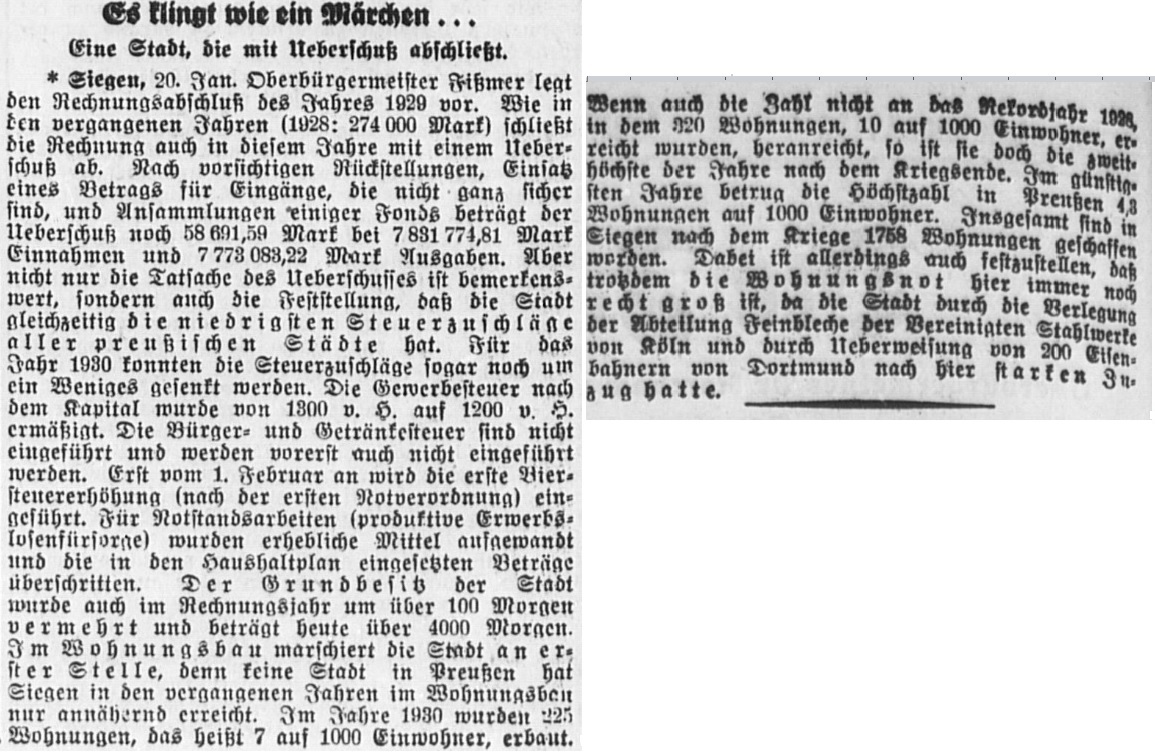
Es ist nicht zu erkennen, was da „differenziert“ wird und wie sowas dabei herauskommen könnte, wenn alles Mögliche an vor allem disparater Information auf einen bunten Haufen geworfen wird. Wie jeder andere Bürgermeister, Gemeindedirektor, Regierungspräsident usw. hat ja auch Fissmer nicht den ganzen Tag Beschwerden gegen den Pfarrer geschrieben, bei seinen Spezis über Schwierigkeiten bei seiner Parteiaufnahme geklagt, Juden ins Polizeigefängnis eingewiesen oder Aufträge zum Kasernen- und Bunkerbau ausgeschrieben, sprich ständig seine Partei- und Staatstreue unter Beweis zu stellen versucht.
Dass er sich auch um den Müll, die Ordnung in den Schulen, Bäckereien und auf dem Friedhof gekümmert hat, das aufzulisten ist aber verzichtbar und kein Ausdruck von „Differenzierung“. Es ist banal. Es nimmt dem ersten nichts, nicht das Geringste. Thema ist die NS-Belastung und die ist klar auf den Punkt zu bringen und nicht mit der Phrase vom „differenzieren“ wegzureden. Das ist unmöglich.
Denn die Belastung ist leicht nachzuweisen: Wenn etwas watschelt, quakt und flattert wie eine Ente und zudem die Bandarole von der Entenzählstelle am Bein trägt, dann ist es eine. Und kein Steinadler, wie die eine oder andere Amsel vielleicht meint.
Die Beschäftgung mit Fissmer hat ja nun mal leider mehrere Ebenen:
1) erinnerungspolitisch ging (geht ?) es um die Benennung eines Platzes,
2) der Forschungsstand zu Fissmer dürfte herzu hinreichned sein,
3) dennoch ist festzustellen, dass eine umfassende biographische Darstellung fehlt.
Heute erschien in der Print-Ausgabe der Siegener Zeitung ein Leserbrief unter der Überschrift „Bittere Kritik“, der sich mit der Umbenennungsdiskussion im Siegener Stadtrat beschäftigt.
Heute erschien in der Print-Ausgabe der Siegener Zeitung ein Leserbrief unter der Überschrift „Nicht hinnehmbar“, der sich mit der Umbenennungsdiskussion im Siegener Stadtrat beschäftigt.
Ein Quellenfund fur Heinrich Goedecke:
National Archives Kew, FO 1060 [ Control Office for Germany and Austria and Foreign Office: Control Commission for Germany (British Element), Legal Division, and UK High Commission, Legal Division: Correspondence, Case Files, and Court Registers ]/1649 , Heinrich Goedecke, 1945
s. a. Video von KulturSiegen, 21.7.2020:
Hier stimmt evtl. etwas nicht ganz; Fickeler kann wohl kaum sein Abitur schon mit 13 Jahren 1906 im Realgymnasium Siegen abgelegt haben, oder ??? Könnten sie das bitte einmal überprüfen ? Vermutlich war es 1910 / 11 ?
Herr Dick hat natürlich recht. 1906 war das Jahr, in dem Familie Fickeler (wieder) nach Siegen kam und Paul das Realgymnasium bezog. Sein Abitur legte er dort zu Ostern 1913 ab. Berufsziel: „Bergfach“.
„Behutsamkeit bei Fehlerkritik“ verdienen nicht nur Tote, sondern auch lebendige Menschen im zarten Jugendalter. Um einen solchen handelt es sich wahrscheinlich bei der Verfasserin/dem Verfasser dieses Praktikumsberichtes. Das alte Sprichwort „Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen“ sollte nicht in Vergessenheit geraten. Durch den ein wenig mißlungenen Versuch, die genannten Quellen zu referieren, geht die Welt nicht unter. Wer sich für die Biografie Paul Ficklers interessiert, findet leichten Zugang zu den originalen Texten (Kern-Terheyden übrigens in „Siegerland“ 1993). Sehr ergiebig sind diese allerdings auch nicht. Vielleicht kann sich mal ein Siegener (w/m) dazu durchringen, den Nachlass des Geografen Carl Troll in Bonn, der auch etliches Material zu Fickeler enthält, zu sichten.
Danke für die verständnisvolle und schnelle Korrektur! Das Wochenende war ein wenig low media ;-). Ein weiteres Dankeschön für den Hinweis auf den Nachlass Troll!
Neben einer Recherche im Universitätsarchiv in München finden sich Hinweise auch im Berliner Bundesarchiv:
– Bundesarchiv, BArch NS 15 (Der Beauftragte des Führers für die Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung der NSDAP) Nr. 200, Wissenschaftler, Privatgelehrte und Schriftsteller sowie deren Arbeiten. – Korrespondenz, Beurteilungen, Eingaben, Presseausschnitte , Bd. 10, (1931), 1935 -1943
enthält u.a.: Fickeler, Paul, Dr., Privatgelehrter (Bl. 226)
– Bundesarchiv, BArch NS 15/138, Auskunftsersuchen an einzelne Gauleitungen Bd. 5, (1933) 1935 – 1941, enthält u.a.: Fickeler, Paul, Dr., Privatgelehrter (Bl. 86)
– Bundesarchiv, BArch NS 15/28, Auskunftserteilung an das Deutsche Volksbildungswerk. – Einzelfälle (Tageskopien), Bd. 2, Jan. – Juni 1939, enthält u.a.: Fickeler, Paul, Dr., Privatgelehrter (Bl. 232)
– Bundesarchiv, BArch NS 15/158a, Auskunftserteilung und Auskunftsersuchen an das Amt Wissenschaft, Bd. 1, 1935-1940, enthält u.a.: Fickeler, Paul, Dr., Privatgelehrter (Bl. 76)
– Bundesarchiv, BArch NS 15/260, Auskunftserteilung und Auskunftsersuchen an das Außenpolitische Amt der NSDAP vornehmlich über als Vortragsredner vorgesehene Personen, 1935-1943 enthält u.a.: Fickeler, Paul, Dr., Privatgelehrter (Bl. 144)
– Bundesarchiv R 9361-II/233115 (Sammlung Berlin Document Center (BDC): Personenbezogene Unterlagen der NSDAP / Parteikorrespondenz), Fickeler, Paul, Dr. Dr. , *7.4.1893
Im Leibniz-Institut für Länderkunde in Leipzig befinden sich im Nachlass Otto Timmermann (Signatur: K 976) Unterlagen zur Anatolienreise von Paul Fickeler und Werner Leimbach 1934.
In der Universitätsbibliothek Heidelberg befinden sich unter der Signatur Heid. Hs. 4040 I einige Briefe von Fickeler, aber auch an Fickeler.
In der Münchner Stadtbibliothek / Monacensia befinden sich im Nachlass Hans Brandenburg (Signatur: HB B 75) weitere Briefe Fickeler.
Weitere Einzelbriefe lassen sich via Kalliope finden
Ich versuche zu lösen:
1.) Sprache : Esperanto
2.) Verfasser der Notiz: Richard Casimir Karl August Robert Konstantin Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (* 29. Oktober 1934 in Gießen; † 13. März 2017 in Bad Berleburg
3.) Verfasser der Glückwunsche: Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat (* 11. Juni 1934 in Talence im Département Gironde, Südfrankreich; † 13. Februar 2018 auf Schloss Fredensborg
Frage 1 ist richtig beantwortet! Die Fragen 2 und 3 leider nicht. Ein Freiexemplar steht Ihnen aber natürlich zu, wenn Sie wollen. Melden Sie sich gerne bei mir! (marcus.stumpf@lwl.org)
Mein Antwortvorschlag:
1. Esperanto
2. Richard Hermann Gustav zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (geb. 27.05.1882 auf Schloss Berleburg, gest. 25.04.1925 in Hanau)
3. Dessen Schwager Udo Prinz zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg (geb. 08.09.1896 in Langenzell, gest. 28.12.1980 in Bad Mergentheim)
Frage 1 war ja schon vorher richtig beantwortet. Die Antwort auf Frage 2 ist korrekt! Auch Ihnen steht damit ein Freiexemplar zu!
Zur Frage 3: Die Lesung „Udo“ ist leider nicht richtig … Es darf also weiter gerätselt werden!
Ich korrigiere: Sie bekommen auf Wunsch natürlich zwei Freiexemplare, denn zwei waren für Antwort 2 ausgelobt!
Mein Antwortvorschlag:
1. Esperanto
2. Richard Hermann Gustav zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, 27.5.1882-25.04.1925
3. Benedikt (Beno) Reinhard Xavier von Herman-Wain, 02 November 1862-05 März 1932
Die Lesung Beno stimmt leider auch nicht … Fürst Richard hatte eine gleichmäßige, aber trotzdem nicht leicht zu lesende Schrift …
Frage 3: Udo Amelung Karl Friedrich Wilhelm Oleg Paul zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg
Bei Frage 1: In der Laudatio ist der 26.5. als Geburtstag genannt.
Dass das Geburtstagsdatum im Text fälschlich 26.5. lautet, war mir gar nicht aufgefallen. Danke für den Hinweis! Aber Fürst Richard hatte natürlich am 27.5. Geburtstag, wie er ja selbst unten notiert hat. Prinz Udo zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg ist zwar nicht der Verfasser gewesen, aber (Achtung: Tipp) die Richtung zur Familie Löwenstein-Wertheim-Freudenberg ist gar nicht so falsch …
Pingback: siwiarchiv-Sommerrätsel 2020/4 | siwiarchiv.de
Na, dann tippe ich mal auf den Chef des Hauses, Ernst zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg.
Warm, aber noch nicht heiß! Die Spur führt zu einem Kind des Bruders von Fürst Ernst zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg, eines Geschwisters des oben bereits verdächtigten Prinzen Udo. Und noch etwas: Die richtige Lösung passt auch paläografisch!
Ilka zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg, Prinzessin zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg 1887-1971
Auch nah dran, aber noch nicht die Lösung … Noch ein paläografischer Hinweis: Der gesuchte Name steht wirklich da und es handelt sich auch nicht um eine Abkürzung. Man kann das Rätsel aber auch über weitere genealogische Recherchen bei der Familie Löwenstein-Wertheim-Freudenberg lösen.
Er hat ja noch mehrere Schwestern… Ich versuche wirklich eine davon herauszulesen… Am ehesten vielleicht noch Elisabeth 1890-1953.
Dor Vorschlag ‚Elisabeth‘ kommt der Lösung schon sehr nahe, kann aber nicht stimmen. Fürst Richard notierte ja: „Tischrede in Esperanto an meinem Geburtstag 27.5.19 meines Vetters, des Prinzen […]“. Der Prinz, Urheber des Textes, kann schwerlich Elisabeth geheißen haben, sondern hieß …?
Auflösung erfolgt ansonsten heute um 13:00 Uhr ;-)
Dann wird die richtige Lösung wohl der inzwischen wiederverheiratete Mann der schon 1883 verstorbenen Elisabeth sein: der Generalleutnant Otto Emil Karl Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (geb. am 23. November 1842 in Darmstadt; gest. am 9. Mai 1911). Damit macht auch die Ansprache des Jubilars als Veteran und Schwager Sinn (Schwager recht weitläufig definiert?); und eine humorvolle Tischrede in Esperanto passt zu seiner literarischen Tätigkeit.
„Otto“ ist in der Tat die einzig richtige Lesung. Fürst Richard schrieb das große und das kleine „o“ sehr schmal (darauf muss man erstmal kommen …).
Es bleibt aber ein Problem: Zu dem jetzt vorgeschlagenen Prinzen Otto hätte eine launige Tischrede in Esperanto zwar wirklich gepasst, aber er war ja nun leider schon 1911 verstorben, kann also 1919 keine Tischrede mehr gehalten haben …
Noch ein Vorschlag:
Otto-Konstantin Pr zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (1878 – 1955)
In der Tat, der war es!
Otto Konstantin Prinz zu Sayn-Wittgenstein (1878-1955). War verheiratet mit der oben bereits erwähnten Elisabeth Prinzessin zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg (1890-1953). Prinz Otto war Fürst Richards Vetter zweiten Grades und zugleich sein Schwager, denn Fürst Richard war mit Madeleine (1885-1976), die ältere Schwester Elisabeths., verheiratet. Prinz Otto Konstantin war also auch Schwager von Prinz Udo und Prinzessin Ilka zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg (beide oben erwähnt). Dies allerdings nur bis 1923, weil in diesem Jahr die Ehe zwischen Prinz Otto und Prinzessin Elisabeth geschieden wurde. Prinz Otto war obendrein Neffe des ebenfalls oben vorgeschlagenen, 1911 verstorbenen, älteren Prinzen Otto.
Alles ziemlich verwickelt …
Aber Kompliment an alle Knobler und Knoblerinnen für das bewiesene Durchhaltevermögen!
Die Gewinner können sich gerne bei mir melden!
a) Zwischen den Haltestellen Hillnhütten und Stift-Keppel-Allenbach
b) Es handelt sich um die „Friedrichsruh“, die Grabstelle des Stiftsförsters Friedrich Vorländer. Dort steht: „Hier ruhet der Stifts-Oberförster Friedrich Vorlaender, geb. Allenbach am 3. April 1792, gest. Allenbach am 26. Februar 1869.“
Beide Antworten sind korrekt – herzlichen Glückwunsch!
Somit führt weiterhin Manfred Knoche mit 2 richtigen Lösungen an. Es folgen nun Sven Panthöfer, Manfred Heiler, giebeler und Reinhard Kämpfer mit je 1 richtigen Lösung. Es bleibt spannend!
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 18.7. – 30.7.2020 | siwiarchiv.de
Dr. Monika Schaupp, Wertheim, stellte freundlicherweise Literaturhinweise, die sie bei VHS-Paläographiekursen oder Workshops zur Familienforschung austeilt, zur Veröffentlichung hier zur Verfügung:
Paläographie / Schriftkunde
Paul Arnold Grun: Leseschlüssel zu unserer alten Schrift (Grundriß der Genealogie 5). Limburg 1984 (Reprint).
Harald Haarmann: Geschichte der Schrift. Von den Hieroglyphen bis heute (Beck’sche Reihe 4075). München 32009.
Elisabeth Noichl, Christa Schmeißer (Bearb.): Deutsche Schriftkunde der Neuzeit. Ein Übungsbuch mit Beispielen aus bayerischen Archiven. München 2007
Heribert Sturm: Unsere Schrift. Eine Einführung in die Schriftkunde. Neustadt/A. 1993 (Reprint).
Harald Süß: Deutsche Schreibschrift. Lesen und Schreiben lernen. München 2000.
Fritz Verdenhalven: Die deutsche Schrift. Ein Übungsbuch. Neustadt/A., 2. verb. Aufl. 1991.
Sütterlin (mit Buchstabenlisten zum 17.-19. Jh.): http://www.suetterlinschrift.de/Lese/Inhalt.htm; Sütterlin-Lern-Programm (SLP 2000) der Universität Saarbrücken: http://www.genealogy.net/slp/ (auch: http://www.aurnh.de/suetterlin.htm).
Abkürzungsverzeichnisse, Wörterbücher
Frank Ausbüttel: Abkürzungen aus Personalschriften des XVI. bis XVIII. Jahrhunderts (Marburger Personalschriften-Forschungen 18). Sigmaringen 1993
Christa Baufeld: Kleines frühneuhochdeutsches Wörterbuch. Lexik aus Dichtung und Fachliteratur des Frühneuhochdeutschen. Tübingen 1996
Frühneuhochdeutsches Wörterbuch (Mitte 14. bis Mitte 17. Jahrhundert), – https://fwb-online.de/
Adriano Cappelli: Lexicon Abbreviaturarum. Mailand 1993 (Reprint http://inkunabeln.ub.uni-koeln.de/vdibProduction/handapparat/nachs_w/cappelli/cappelli.html
Karl E. Demandt: Laterculus Notarum. Lateinisch-deutsche Interpretationshilfe für spät-mittelalterliche und frühneuzeitliche Archivalien. Mit 4 Tafeln spezieller Zahlenschreibungen des 14.-16. Jahrhunderts (Veröffentlichungen der Archivschule Marburg 7). Marburg 71998.
Otto Dornblüth: Wörterbuch der klinischen Kunstausdrücke für Studierende und Ärzte, Leipzig 1894, unveränderter fotomechanischer Nachdruck 1999. Vorwort vom November 1893.]
Otto Dornblüth: Klinisches Wörterbuch. Die Kunstausdrücke der Medizin. 13./14. vollkommen umgearb. Aufl. 1927.
– http://www.textlog.de/klinisches.html
Jacob und Wilhelm Grimm: Deutsches Wörterbuch. Erstausgabe 1854-1971. ND 1984.
– http://germazope.uni-trier.de/Projects/DWB
Paul Arnold Grun: Schlüssel zu alten und neuen Abkürzungen. Wörterbuch lateinischer und deutscher Abkürzungen des späten Mittelalters und der Neuzeit mit historischer und systematischer Einführung für Archivbenutzer, Studierende, Heimat- und Familienforscher u.a., Nachbildungen der Originale (Grundriß der Genealogie 6). Limburg/Lahn 1966 (Reprint).
Jörg Heinrich, Martin Klöpfer: Abkürzungen und Schriftbesonderheiten in der Frühen Neuzeit aus altwürttembergischen Quellen. Stuttgart 2003]
Reinhard Heydenreuter, Wolfgang Pledl, Konrad Ackermann: Vom Abbrändler zum Zentgraf. Wörterbuch zur Landesgeschichte und Heimatforschung in Bayern. München, 22009.
Rudolf Kunz: Wörterbuch für südhessische Heimat- und Familienforscher (Darmstädter Archivschriften). Darmstadt 1995.
Johann Georg Krünitz, Oekonomische Encyklopädie oder allgemeines System der Staats- Stadt- Haus- und Landwirthschaft, 242 Bände, 1773 bis 1858. [Eine der umfangreichsten Enzyklopädien des deutschen Sprachraums und der wichtigsten deutschsprachigen wis-senschaftsgeschichtlichen Quellen für die Zeit des Wandels zur Industriegesellschaft]
– http://kruenitz1.uni-trier.de
Hermann Metzke: Lexikon der historischen Krankheitsbezeichnungen. Neustadt/A. [1994].
Reinhard Riepl: Wörterbuch zur Familien- und Heimatforschung in Bayern und Österreich. Waldkraiburg, 2. verb. und erg. Aufl. 2004
Peter-Johannes Schuler: Historisches Abkürzungslexikon (Historische Grundwissen-schaften in Einzeldarstellungen 4), Stuttgart 2009.
Fritz Verdenhalven: Familienkundliches Wörterbuch. Neustadt/A. 31992
Johann Heinrich Zedler: Grosses vollständiges Universal-Lexikon aller Wissenschaften und Künste. Halle, Leipzig 1732-1754. ND Graz 1961-1964, – http://www.zedler-lexikon.de
Erhard Agricola: Aus dem Nachlaß bearb. und für den Druck vorbereitet von Wilhelm Braun, Wörterbuch des christlich geprägten Wortschatzes. Stuttgart 2003.
Friedrich Hauck, Gerhard Schwinge: Theologisches Fach- und Fremdwörterbuch: mit einem Verzeichnis von Abkürzungen aus Theologie und Kirche und einer Zusammen¬stellung lexikalischer Nachschlagewerke. Göttingen 2005
Archiv- und Aktenkunde
Friedrich Beck, Eckart Henning: Die archivalischen Quellen. Eine Einführung in ihre Benutzung. Weimar, 5. aktual. Aufl. 2012
Martin Burkhardt: Arbeiten im Archiv. Praktischer Leitfaden für Historiker u. andere Nutzer. Paderborn 2006
Hans Wilhelm Eckhardt, Gabriele Stüber, Thomas Trumpp: „Thun kund und zu wissen jedermänniglich“. Paläographie – Archivalische Textsorten – Aktenkunde (Landschafts-verband Rheinland – Archivberatungsstelle, Archivhefte 32). Köln 1999.
Forschen im Archiv – ein Kurzlehrgang. – https://internet.archivschule.uni-marburg.de/projekte/forschen/Index.html
Eckhart G. Franz: Einführung in die Archivkunde. Darmstadt, 7., aktual. Aufl. 2007.
Gebhard Mehring: Schrift und Schrifttum. Zur Einführung in archivalische Arbeiten auf dem Gebiet der Orts- und Landesgeschichte. Stuttgart 1931.
Bei Wikisource, Blättern durch gescannte Seiten und durch Textversion: http://de.wikisource.org/wiki/Schrift_und_Schrifttum:04
Mark Mersiowsky: Die Anfänge territorialer Rechnungslegung im deutschen Nordwesten. Spätmittelalterliche Rechnungen, Verwaltungspraxis, Hof und Territorium (Residenzen-forschung 9). Stuttgart 2000.
Südwestdeutsche Archivalienkunde: http://www.leo-bw.de/themenmodul/sudwestdeutsche-archivalienkunde. Erläuterungen dazu siehe ZWLG 78 (2019), S. 411-414.
Gabriele Stüber, Thomas Trumpp: Französisch im Archiv. Ein Leitfaden für Archivare und Historiker (Landschaftsverband Rheinland – Archivberatungsstelle, Archivhefte 23). Köln 1992.
Thomas Vogtherr: Urkundenlehre. Basiswissen (Hahnsche Historische Hilfswissenschaften 3). Hannover 2008.
Familienforschung (inkl. Auswanderung)
Ahnenforschung – Auf den Spuren der Vorfahren (inkl. CD-ROM). Ein Ratgeber für Anfän-ger und Fortgeschrittene, hg. vom Verein für Computergenealogie e.V., Reichelsheim (Wetterau) 2007.
Rolf Bidlingmaier: Verzeichnis der Kirchenbuchverkartungen und Ortsfamilienbücher in Baden-Württemberg. Stuttgart 2006
Computergenealogie. Magazin für Familienforschung, hg. vom Verein für Computergenealogie e.V. (erscheint vierteljährlich) [
Familienforschung. Ahnenforschung leichtgemacht. Computergenealogie für Jedermann. Offizielles Magazin des Vereins für Computergenealogie, 2019.
Stefan Lindtner: Von Königheim im Großherzogtum Baden in die Vereinigten Staaten von Amerika. Auswanderer aus Königheim im 19. Jahrhundert. Königheim 2011.
Claus Müller: Helmstadter Auswanderer nach Ungarn und Österreich, in: Blätter für frän-kische Familienkunde 32 (2009), S. 257-264.
Wolfgang Ribbe, Eckart Henning: Taschenbuch für Familiengeschichtsforschung, Neu-stadt/A. 1995
Friedrich R. Wollmershäuser: Emigrants and absentees from the Kingdom of Württemberg and surrounding regions / Auswanderer und Abwesende aus dem Königreich Württemberg und seinen Nach¬barregionen. Vol. 1: 1785-1815, Vol. 2: 1816-1835. Ubstadt-Weiher 2017
Friedrich R. Wollmershäuser: Emigrants from the Grandduchy of Baden before 1872; Vol. 2: The Odenwald and Bauland regions with the districts of Adelsheim, Boxberg, Buchen Eberbach, Gerlachsheim, Krautheim, Mosbach, Tauberbischofsheim, Walldürn and Wert-heim / Odenwald und Bauland mit den Amtsbezirken Adelsheim, Boxberg, Buchen, Eber-bach, Gerlachsheim, Krautheim, Mosbach, Tauberbischofsheim, Walldürn und Wertheim. Ubstadt-Weiher 2017. [
Sascha Ziegler (Hg.): Ahnenforschung. Schritt für Schritt zur eigenen Familienge¬schichte. Hannover 32012
weitere Hilfsmittel
Hubert Emmerig: Glossar zu Münztechnik und Münzverwaltung in Spätmittelalter und frü¬her Neuzeit. Zum frühneuhochdeutschen Wortschatz in ausgewählten Quellen (14. bis 17. Jahrhundert). Braunschweig 2006
Hermann Grotefend: Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit. Hannover 1991, – http://bilder.manuscripta-mediaevalia.de/gaeste//grotefend/grotefend.htm
Gabriele Hendges: Maße und Gewichte im Hochstift Würzburg vom 16. bis zum 19. Jh. München 1989.
Wolfgang von Hippel: Maß und Gewicht im Gebiet des Großherzogtums Baden am Ende des 18. Jahrhunderts (Südwestdeutsche Schriften 19). Mannheim 1996.
Niklot Klüßendorf: Münzkunde. Basiswissen (Hahnsche Historische Hilfswissenschaften 5). Hannover 2009
Dieter Lauer: Die Schatzungslisten der Jahre 1542, 1594, 1603, 1609, 1655 für den Ort Billingshausen im Main-Spessart-Kreis. Auswertungen, Erläuterungen und Aufzeichnun¬gen zum Bild eines fränkischen Dor¬fes und seiner Bewohner. Nürnberg 1987
Dieter Lauer: Tabellen mit Münz-Symbolen zu den Schatzungslisten der Jahre 1542, 1594, 1603, 1655 und den Cent-Protokollen von 1587 bis 1617 für den Ort Billingshau¬sen im Main- Spessart- Kreis. Nürnberg 1988
Henner R. Meding: Die Herstellung von Münzen. Von der Handarbeit im Mittelalter zu den modernen Fertigungsverfahren (Gesellschaft für Internationale Geldgeschichte). Frankfurt 2006. [
Tabellen zur Verwandlung der alten Maase und Gewichte des Großherzogthums Baden in die neuen allgemeinen Badischen. Karlsruhe 1812
Wolfgang Trapp: Kleines Handbuch der Münzkunde und des Geldwesens in Deutsch¬land. Stuttgart 1999. [Reclam gelbe Reihe]
Fritz Verdenhalven: Alte Meß- und Währungssysteme aus dem deutschen Sprachgebiet. Was Familien- und Lokalgeschichtsforscher suchen. Neustadt/Aisch 21993
Fritz Verdenhalven [Bearb.]: Kleiner historischer Städtenamen-Schlüssel für Deutschland und die ehemaligen deutschen Gebiete. Neustadt/A. 1970.
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik Juli 2020 | siwiarchiv.de
Pingback: „Neuer Alltag“ mit Corona in einem südwestfälischen Kreisarchiv | siwiarchiv.de
Pingback: „Neuer Alltag“ mit Corona in einem südwestfälischen Kreisarchiv | siwiarchiv.de
Pingback: Blogparade #KulturAlltagCorona: Neuer Alltag mit Corona in Kultur und Museum | Zeilenabstand.net - Kultur & Digitales
Pingback: „Neuer Alltag“ mit Corona in einem südwestfälischen Kreisarchiv | Archivalia
Besteht denn keine Möglichkeit, das Dokument zu bearbeiten und dabei die „Sprache der Täter:innen“ zu entfernen? Es ist 2020 absolut unangebracht, Menschen „Z*geuner“ zu nennen, egal in welchem Kontext. Wenn sie als Opfer nationalsozialistischer Gewaltherrschaft genannt sind, ist die Bezeichnung erst recht zu vermeiden.
Falls eine Bearbeitung nicht möglich ist, wäre zumindest eine Einordnung der verwendeten Begriffe bei der Bereitstellung hier angebracht.
Die Kritik an der fehlenden Einordnung ist brechtigt und ist der kurzfristigen, um nicht zu sagen, spontanen Veröffentlichung des Dokumentes geschuldet. Eine Bearbeitung des Dokumentes war nicht möglich.
Die publizierte Aufstellung geht allerdings – und dies war die Motivation – mit der Quellenauswertung teilweise über den bisherigen Stand des Aktiven Gedenkbuchrs für die Opfer des Nationalsozialismus im Kreis Siegen-Wittgenstein hinaus.
Zur regionalen Literatur:
– Opfermann, Ulrich F.: „Daß sie den Zigeuner-Habit ablegen“. Die Geschichte der „Zigeuner-Kolonien“ zwischen Wittgenstein und Westerwald, Frankfurt a. M. u. a. 1996, 2., ergänzte Aufl., Frankfurt a. M. u. a. 1997.
– Opfermann, Ulrich F.: Der „Mäckes“ – Zu Geschichte und Bedeutungswandel eines Schmähworts, in: Nassauische Annalen, Bd. 109, 1998, S. 363-386.
– Opfermann, Ulrich F.: Zigeunerverfolgung, Enteignung, Umverteilung. Das Beispiel der Wittgensteiner Kreisstadt Berleburg, in: Kenkmann, Alfons; Bernd-A. Rusinek (Hrsg.), Verfolgung und Verwaltung. Die wirtschaftliche Ausplünderung der Juden und die westfälischen Finanzbehörden, Münster 1999, S. 67-86.
– Opfermann, Ulrich F.: The registration of Gypsies in National Socialism. Responsibility in a German region, in: Romani Studies (continuing Journal of the Gypsy Lore Society), 5th Series, Vol. 11, No. 1 (2001), S. 25-52.
– Opfermann, Ulrich F.: Berleburg im Nationalsozialismus, in: Riedesel, Rikarde/Johannes Burkardt/Ulf Lückel (Hrsg.), Bad Berleburg – Die Stadtgeschichte, Bad Berleburg 2009, S. 215-246.
– Opfermann, Ulrich F.: „Schlussstein hinter Jahre der Sittenverwilderung und Rechtsverwirrung“. Der Berleburger Zigeuner-Prozess, in: Antiziganismuskritik, 2 (2010), H. 2, S. 16-34, siehe: http://www.antiziganismus.de/resources/2010_2_Antiziganismuskritik.pdf ; geringfügig abweichender Nachdruck in: Wittgenstein. Blätter des Wittgensteiner Heimatvereins e. V., 99 (2011), Bd. 75, H. 1, S. 27-37 (Teil 1); 99 (2011), Bd. 75, H. 3, S. 113-123 (Teil 2).
– Opfermann, Ulrich F.: Siegerland und Wittgenstein. „Etwa 85 v. H. besitzen eigene Häuschen“, in: Karola Fings; Ulrich Friedrich Opfermann (Hrsg.), Zigeunerverfolgung im Rheinland und in Westfalen. 1933-1945. Geschichte, Aufarbeitung und Erinnerung, Paderborn 2012, S. 233-255.
– Opfermann, Ulrich F.: Soest. „Mit deutscher Gründlichkeit und Gewissenhaftigkeit“, in: Karola Fings; Ulrich Friedrich Opfermann (Hrsg.), Zigeunerverfolgung im Rheinland und in Westfalen. 1933-1945. Geschichte, Aufarbeitung und Erinnerung, Paderborn 2012, S. 257-264.
– Opfermann, Ulrich F.: Genozid und Justiz. Schlussstrich als „staatspolitische Zielsetzung“, in: Karola Fings; Ulrich Friedrich Opfermann (Hrsg.), Zigeunerverfolgung im Rheinland und in Westfalen. 1933-1945. Geschichte, Aufarbeitung und Erinnerung, Paderborn 2012, S. 315-326.
– Opfermann, Ulrich F.: „Zigeuner“ auf der Heimatbühne. Eine Sauerländer Erfolgsautorin und ihr Hauptwerk, ders. mit Karola Fings (Hrsg.), Zigeunerverfolgung im Rheinland und in Westfalen. 1933-1945. Geschichte, Aufarbeitung und Erinnerung, S. 301-314; mit kleinen Änderungen auch in: Christine Koch-Mundartarchiv in Zusammenarbeit mit dem Kreisheimatbund Olpe (Hrsg.), Josefa Berens-Totenohl (1891-1969). Nationalsozialistische Erfolgsautorin aus dem Sauerland. Forschungsbeiträge von Peter Bürger, Reinhard Kiefer, Monika Löcken, Ortrun Niethammer, Ulrich Friedrich Opfermann und Friedrich Schroeder (daunlots. internetbeiträge des christine-koch-mundartarchivs am museum eslohe, nr. 70), Eslohe 2014, S. 69-84, siehe: http://www.sauerlandmundart.de/pdfs/daunlots%2070.pdf
– Opfermann, Ulrich F.: Sinti und Jenische. Ein Beitrag zur regionalen Minderheitengeschichte, in: Siegener Beiträge. Jahrbuch für regionale Geschichte, 20 (2015), S. 164-177.
– Opfermann, Ulrich F.: Restbestände des Romanes und des Jenischen in Wittgenstein und im Siegerland, in: Klaus Siewert, Geheimsprachen in Westfalen, …, in: Klaus Siewert (Hrsg.), Geheimsprachen in Westfalen, Bd. 3, Hamburg/Münster 2017, S. 221-254.
Weitere regionale Literatur zu „Jenische und Sinti“ findet sich unter der gleichnamoge Rubrik in der Bibliographie Wittgenstein (S. 43-48, Stand: 1.8.2020)
Ehem. Truppenübungsplatz Trupbach. Andreaskreuz soll vor querenden Panzern warnen.
Richtig! Gratulation!
Querende Panzer – ist dies eine Vermutung oder ist dies auf Militärgeländen so? Wir waren uns unschlüssig über den Sinn des Schildes.
Weiterhin führt Manfred Knoche mit 2 richtigen Lösungen an. Es folgen nun Herbert Bäumer, Sven Panthöfer, Manfred Heiler, giebeler und Reinhard Kämpfer mit je 1 richtigen Lösung. Für Spannung bei der letzten Runde in der kommenden Woche ist also gesorgt.
Zum Hintergrund der Zusatzfrage: In unmittelbarer Nähe des Kreuzes befinden sich noch einige zerbröckelnde Beton-Konstruktionen, die man mit etwas Phantasie für Bahnschwellen und einen Prellbock halten könnte – wenn auch alles winzig dimensioniert ist. Der Gedanke drängt sich auf, dass hier irgendein schienengebundenes Transportmittel in Betrieb war. Wenn dem so wäre, könnte das Kreuz auch der Warnung vor diesem eher unscheinbaren Vehikel gedient haben. Panzer fuhren ja auf dem großen Gelände überall herum, so dass eigentlich an jeder Wegkreuzung ein Andreaskreuz hätte stehen müssen. Dann wären aber sicherlich mehr als nur dieses eine erhalten geblieben. Sachdienliche Hinweise sind hier jederzeit willkommen.
Pingback: Rückblick auf die Blogparade #KulturAlltagCorona | Zeilenabstand.net - Kultur & Digitales
Pingback: Alfred Fissmer im Kreistagsprotokoll vom 15. September 1919 | siwiarchiv.de
Pingback: Aus dem Bildarchiv des Kreisarchivs: Ludwigsburg in Bad Berleburg | siwiarchiv.de
Der Baum steht auf der Trupbacher Heide. Besonders auffällig sind die in den Stamm eingelassenen Trittstufen. Und wenn mich nicht die Erinnerung trügt, dann steht der Baum auf der Gemarkungsgrenze.
Die dritte Frage ist noch nicht beantwortet…..
Rechts neben dem Baum steht eine Fichte.
@Raimund Hellwig: Es handelt sich in der Tat um die historische Grenzeichen zwischen Siegen und Freudenberg. QAuch die Steigeisen bzw. Stufen wurden richtig erkannt. Damit wurde die Frage zu 66 % gelöst.

@giebeler: Die Fichte ist richtig – damit haben Sie das Rätsel zu 33 % gelöst.
Somit ergibt sich folgender Endstand:
1) Manfred Knoche mit 2 richtigen Lösungen
2) giebeler mit 1,33 richtigen Lösungen
3) Herbert Bäumer, Sven Panthöfer, Manfred Heiler, und Reinhard Kämpfer mit je 1 richtigen Lösung
4) Raimund Hellwig mit 0,66 richtigen Lösungen.
Herzlichen Glückwunsch an Manfred Knoche!
Vielen Dank an Peter Kunzmann für das diesjährige Sommerrätsel!
Pingback: Durbridge-Serie macht VHS Sorge | siwiarchiv.de
Unterzeichnet vom Pressesprecher Hans Berggold, geschrieben von der Schreibkraft Martina Kring.
Ein Hoch dem Verfasser, dem Korrektor und dem Kreisarchivar.
Diese wahrliche Geschichte treibt mich an, den deutschen Fußballbund und der FIFA in einem persönlichen Gespräch nahezulegen, die WM 2022 in Katar nicht auf den November / Dezember – das ist intensive Lernzeit in der VHS – sondern auf den Juli / August zu platzieren… da haben wir Sommerpause.
Lieber Gruß
insbesonder an den Kreisarchivar
Anmerkungen zum letzten Rätsel:
Die markante Eiche hätte Maler wie Caspar David Friedrich inspiriert und wirkt zu recht als Blickfang, was aber nichts daran ändert, dass sie eigentlich verkrüppelt ist. Ihr Habitus wie auch die geringe Höhe (besonders deutlich im Vergleich mit der knapp 20 Meter hohen Fichte) lassen auf massiven Verbiss in frühen Jahren schließen – wahrscheinlich durch Rinder, da sie sicher am Rand eines beweideten Haubergs stand, wo sie wohl nie auf den Stock gesetzt worden war aber vielleicht der Samengewinnung diente. Möglicherweise waren ihre Wachstumsdefizite seinerzeit (ich schätze vor weniger als 200 Jahren) auch der Grund dafür, an dieser Stelle zwischen Siegener und Freudenberger Gebiet noch zusätzlich einen gewissermaßen „amtlichen“ Grenzbaum mit besserer Zukunftsperspektive, nämlich die solitäre Fichte, zu pflanzen. Die metallischen Steighilfen am Stamm der Eiche führten während der militärischen Nutzung des Geländes zu einer Beobachtungsplattform in ihrer Krone. Heute lassen dort oben erziehungsberechtigte Banausen gern ihren Nachwuchs herumklettern. Spätestens nach dem ersten Unfall wird der sehenswerte Baum, der sich ohnehin in einem nicht sehr gesunden Zustand zu befinden scheint (viel Totholz im Kronenbereich) vermutlich der Säge zum Opfer fallen. Das wäre schade.
Ein anderer Grenzbaum ganz in der Nähe ist die berühmtere „Hohle Eiche“. Wer sie kennt, wird sich freuen, dass sie trotz des Brandanschlages von Karfreitag 2017 immer noch sehr vital ist.
Einem Aufsatz von Uta Birkhölzer und Alfred Becker in „Siegerland“ 83 (2006), S. 111-123 ist zu entnehmen, dass vom Forstamt Siegen 2005 eine „Inventur der heutigen Grenzbäume im Siegerland“ initiiert worden war, um die in den Gemeinden „noch vorhandenen Grenzbäume zu erfassen, zu beschreiben und Besonderheiten wie z.B. Gefährdungsart und -grad festzuhalten“. Publiziert wurde anscheinend (im genannten Aufsatz) lediglich ein „erstes Ergebnis“, und zwar für den Forstbetriebsbezirk Holzklau. Es wäre schön, wenn die umwelthistorisch sicher interessanten Erhebungen der Siegerländer Öffentlichkeit irgendwann komplett zugänglich gemacht werden könnten (was natürlich die optimistische Erwartung voraussetzt, dass dieses Projekt überhaupt über erste Ansätze hinaus gediehen war).
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 31.7. – 12.8.2020 | siwiarchiv.de
Hallo ich finde das alles hoch interessant aber noch interessanter finde ich wir heißen auch Dirlmeier aus Memmingen .
Ich meine ja nur so fiele Dirlmeiers gibts ja auch nicht ♂️ viel Erfolg in der Zukunft und Gesundheit !.
Grüße Klaus Dirlmeier
Pingback: Salzmann und Groos – 2 Beispiele für die Kooperation von Archivweblogs – Archive 2.0
Pingback: Warum Archive bloggen sollten? Ein Beispiel: – Archive 2.0
Pingback: Blogparade – siwiarchiv wird 5 Jahre alt! – Archive 2.0
Aufgrund dieses Ergebnisses bleibt der/dem an Archiven Interessierten wohl nichts anderes übrig als dieser Anregung zu folgen:
Die Süddeutsche Zeitung berichtete gestern zum Stadtarchiv München: „Archivare fürchten um Unabhängigkeit“, Link: https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-stadtarchiv-institut-fuer-stadtgeschichte-gruene-1.5000161
Der zitierte markige Satz aus dem CDU-Wahlprogramm
„Archivarbeit ist auch kommunale Daseinsvorsorge“
verwendet zwar eine juristisch eher unpräzise, aber rhetorisch gut verwendbare Begrifflichkeit. Gegen die Forderung nach mehr „Daseinsvorsorge“ lässt sich schlecht argumentieren, erst recht nicht in Pandemiezeiten.
Vielen Dank für Ihren Kommentar und die Analyse des vorletzten Satzes des Zitates! Ich persönlich finde allerdings die konkreteren Aussagen interessanter – in Richtung citizen science bzw. crowd sourcing und in Richtung digitaler Langzeitarchiviverung.
Ein Auswertung von Corinna Nauck „Mit Bürgersinn und Bürgergeist. Kommunale Selbstverwaltung und Stadtentwicklung in der kreisfreien Stadt Siegen“ (St. Katharinen 1999):
• 21.02.1933: Nachdem die kommunalen Vertretungskörperschaften nach der Machtergreifung Hitlers am 08.02.1933 für aufgelöst erklärt wurden, beruft Fissmer die Stadtverordnetenversammlung nochmal ein und dankte den Kommunalpolitikern für ihre geleistete Arbeit
• Oktober 1933: Fissmer versucht erneut – unter Berufung auf die hohe Wohndichte im Stadtkreis -, mittels einer Eingabe an den Regierungspräsidenten in Arnsberg Eingemeindungspolitik einzuleiten – ein Teil des zur Gemeinde Achenbach gehörenden Heidenberges, wurde in den Stadtkreis eingegliedert; Heidenberg wurde erst 1935 im Zuge der Garnisonwerdung bebaut (Nauck, S. 91)
• 28.02.1934: zum letzten Mal traten die gewählten Vertreter der Stadt in einer Sitzung zusammen – Oberbürgermeister Fissmer betonte besonders, dass er gemäß dem Gemeindeverfassungsgesetz für die Verwaltung der Stadt „allein verantwortlich sei“ (Nauck, S. 70)
• er setzte seine Vorstellungen mithilfe der Verwaltung ohne vorherige Beratung im Stadtparlament durch (Nauck, S. 68)
• das Stadtoberhaupt musste sich nicht bemühen, die Gemeinderäte von Plänen und Vorhaben zu überzeugen- Kenntnis genügte (Nauck, S. 68)
• die meisten Wirkungsfelder der kommunalen Selbstverwaltung wurden nun zur Beratung an Ausschüsse übergeben, die Ergebnisse der Beratung dem Bürgermeister zur Entscheidung vorgelegt und entsprechende Vorlagen Gemeinderat meist nicht unterbreitet (Nauck, S. 69)
• 1937: Fissmer regt die Errichtung einer Theater- und Konzerthalle an (spätere „Siegerlandhalle“) (Nauck, S. 383)- spätere Aufnahme des Projekts- Fertigstellung: November 1960 (Nauck, S. 398)
• September 1939: Fissmer ordnet in seiner Eigenschaft als örtlicher Luftschutzleiter den Bau von öffentlichen Luftschutzräumen in der Nähe des Bahnhofs und im Bereich der Eintracht an (Nauck, S. 128)
• ab 1939: besondere Bemühungen um die „geistige Gesundheit“ der Bevölkerung und insbesondere der Soldaten: Fissmer beauftragt Gartenamt mit Verschönerung der Grünanlagen der Stadt (Nauck, S. 132-133)
• Januar 1940: Fissmer teilt mit, dass „… in allen Stadtteilen ausreichende öffentliche Luftschutzräume ausgebaut“ worden seien (Nauck, S. 128)
• 1940: aufgrund eines Führererlasses gibt Fissmer die Errichtung von Stollen zum Schutz der Bevölkerung in Auftrag- in der Nachkriegszeit will er Stollen mit stadtplanerischen Aktivitäten verbinden- Verkehrserleichterung etc. (Nauck, S. 130)
• 1941: Oberbürgermeister Fissmer regt Pläne zur Errichtung eines Aufmarschgeländes auf dem Gelände der „Eintracht“ vor (Nauck, S. 135)
• 1942: Fissmer setzt ein Ortsstatut von 1919 wieder in Kraft, da der Wohnungsfehlbestand in Siegen auf 1300 Wohnungen beziffert wurde (S. 126)
• ab 1942: Fissmer fordert Aufwertung des Gartenbestandes in Nutzungsbestand mit städtischer Förderung – zur Versorgung der Bevölkerung (Nauck, S. 134)
Im Katalog zur großen Siegener Ausstellung zur Nachkriegszeit in Siegen 2005 im ehemaligen Kaufhof findet sich auch ein eigener Abschnitt zu Alfred Fissmer. Vieles dort ist in der Zwischenzeit bekannt. Eines jedoch habe ich unlängst „wieder“entdeckt. Der Selbstmordversuch Fissmers im Mai 1942 wurde und wird bisher eher weniger thematisiert. In der Ausstellung fand sich ein Polizeibericht (Quelle: Stadtarchiv Siegen S 412), der den Hergang des Selbstmordversuches schildert. Der dort geschilderte Hergang ist bemerkenswert. Fissmer hatte demzufolge seinen leitenden Schutzpolizisten aus dessen Dienstzimmer geschickt und sich mit dessen Waffe versucht zu erschießen. Es stellen sich auch hier mehrere Fragen…….
Im Archiv des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe befindet sich im Nachlass der Franz Petri unter der Signatur 914/84 ein Aktenband, der Vorgänge aus dem unmittelbaren Tätigkeitsbereich der Militärverwaltung Belgien/Nordfrankreich vom 19. Juni 1941 – 17. Juli 1941, 9. August 1941 enthält. Für die Rubensfeierlichkeiten besonders interessant dürften folgende Schreiben sein:
– Vermerk von KVR Reese über eine Verfügung des MVCh zur Teilnahme an der Rubens-Feier der Stadt Siegen und derartigen Ausstellungen; o.O., 14.07.1941, (kult), S. 021
– KVR Reese an das Museum des Siegerlandes, Siegen: Absage einer Einladung zur Teilnahme an der Rubensfeier; o.O., 20.06.1941, (kult), S. 146
Ein Fund im Bundesarchiv Berlin:
R 3001{Reichsjustizministerium]/20342 Anpassung von Rechtsverhältnissen an veränderte wirtschaftliche Verhältnisse (1933) 1935-1939 (1943), enthält u.a.: Herabsetzung von Rentenbezügen bei Leibrenten.- Schriftwechsel mit dem Oberbürgermeister von Siegen, 1935
Pingback: 90 Euro für ein Buch zum Archivrecht | Archivalia
Wenn sich diese Intension bei der Novellierung des DSchG. NRW durchsetzt, dann wird in Zukunft so manches denkmalgeschützte Gebäude vernichtet werden.
Beispiel: Hüttenmeisterhaus in Kreuztal Kredenbach-Lohe.
Die Kommune Kreuztal / Untere Denkmalbehörde lehnt es bis heute strikt ab, in diesem speziellen Fall ein zulässiges Enteignungsverfahren nach §30 DSch NRW einzuleiten, weil man dann die rel. hohen Renovierungs- und späteren Erhaltungskosten nicht tragen möchte. Eine erstrebenswerte soziale, allgemeinwohlfördernde Nutzung des renovierten Gebäudes wurde leider bisher von den dort politisch Verantwortlichen nicht gefunden.
Der priv. Eigentümer kann aber das bereits über 300 Jahre alte , ortsteilbestimmende Fachwerkgebäude keinem wirtschaftlichen Nutzen zuführen, weil sich das einfach bei den hohen Renovierungskosten, trotz evtl. zu erwartenden Landes-Zuschüsse , einfach nicht rechnet . Und wenn der Eigentümer es nicht freiwillig der Kommune übereignen möchte, (gesetzlich wäre die Kommune dann zur Übernahme aber gezwungen !) ist der weitere Verfall des denkmalgeschützten Fachwerkhauses unausweichlich vorgegeben.
Wenn hier aber in der Novelle des DSchG NRW für derartige speziellen Fälle, keine entsprechenden gesetzlichen Vorgaben gemacht werden, die der Unteren Denkmalbehörde eine zwingend gebotenen Übernahme in kommunaler Hand vorgibt, bleibt das DSchG NRW auch weiterhin nur ein „papierner Tiger“ .
(die zu erwartenden Renovierungskosten aus Steuermitteln müssen den evtl. geforderten priv. Entschädigungsforderungen gegengerechnet werden. Der Kommune werden max. 10 Jahre für die Renovierung des Denkmals zugebilligt)
Den nachfolgenden Generationen bleibt ja immerhin im Falle z.B. des Kredenbacher Hüttenmeisterhauses, nach Abriß oder völligen Verfall des Denkmals, die helle Freude an einer Hallenblechwand oder einem erweiterten Parkplatz. (s.a. Fotos)


Ob die dann dafür auch Verständnis aufbringen werden ?
Das wäre ja aber auch nicht der erste Fall , wo man sich dann leider viel zu spät über die Vernichtung Siegerländer Kulturgutes aufregt.
Pingback: „Eigennutz statt Denkmalschutz“ in NRW | Archivalia
Offensichtlich wird das Portal doch noch fertig. https://archivamt.hypotheses.org/14521
Pingback: Diskussion im Stadtrat Siegen zur Umbenennung der Alfred-Fissmer-Anlage | siwiarchiv.de
http://www.archiv.rwth-aachen.de/2020/08/24/das-verfahren-des-hochschularchivs-der-rwth-aachen-wahrend-der-corona-krise/
Pingback: Kommunalwahl 2020: Archivpolitischer Check der Wahlprogramme für Netphen und Neunkirchen | siwiarchiv.de
Weiterer „Fund“ im Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Bestand
503 Innenministerium Nr. Nr. 4339 a, Wahrnehmung der Kommunalaufsicht bei Bau und Unterhaltung von Straßen und Wasserbauten, enthält: Gründung eines Lahnverbandes zur Errichtung einer Lahntalsperre bei Laasphe, 1955 – 1960.
Ferner müsste wohl die folgende Literatur ausgewertet werden:
„Neuerscheinung: Die Kabinettsprotokolle der Hessischen Landesregierung -Kabinett Stock (1947-1950)Die Kabinettsprotokolle gehören zu den wichtigsten und interessan-testen Quellen für die hessische Landespolitik in der Frühphase der jungen deutschen Demokratie. Nachdem 2008 der erste Teil der Kabi-nettsprotokolle der Regierung Stock für die Jahre 1947 und 1948 er-schienen ist, liegt nunmehr mit dem zweiten Teilband eine vollstän-dige, kommentierte Ausgabe der gesamten Regierungszeit des Kabi-netts Stock 1947 bis 1950 vor.Zu den teilweise schon aus Band 1 bekannten landespolitischen The-men der Schul-, Hochschul-, Kultur-, Justiz-, Sozial-und Wirtschaftspo-litik, der Reform der Kommunalverfassung und des Wahlrechts sowie des Abschlusses der Entnazifizierung kamen mit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes neue, von der Bundespolitik bestimmte Schwerpunkte hinzu. Hier zeigt sich, wie selbstbewusst, konstruktiv und kritisch die hessische Landesregierung auf der Grundlage der neuen verfassungsmäßigen Ordnung gegen-über der Regierung Adenauer eigene Positionen vertrat.Der zweite Teilband besitzt eine eigene ausführliche Einleitung, die den zeitgeschichtlichen Kontext beschreibt und in die Themenfelder einführt. Aussagekräftige Dokumente ergänzen die Protokolle, ein Sach-und Personenindex erschließt den Band.Sonderpreis der Historischen Kommission für Nassau für Band 1 (1947-1948) und Band 2 (1949-1950) zusammen: € 59,-.Bestelladresse: Historische Kommission für Nassau Mosbacher Straße 55 65187 Wiesbaden Tel.:0611/881-0 Fax: 0611/881-145, E-Mail: wiesbaden@hla.hessen.de, http://www.hiko-nassau.de “ (Quelle: Newsletter HessenArchiv aktuell08/2020)
Das Werk ist zurzeit im Entstehen begriffen – hier der Stand von gestern Nachmittag:

Man kan den Werdegang ja selbst vor Ort verfolgen oder im Netz auf der Hompegage des Festivals s. obigen Link zum Projekt.
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik August 2020 | siwiarchiv.de
Stand heute Morgen:

Pingback: Was bedeutet Demokratie für Archive? | siwiarchiv.de
Ist die Aussage „Ein umfassendes Archiv wäre ein teuerer Luxus“ denn grundsätzlich falsch? Wenn ja, bitte ich um Erläuterung. Ich frage, weil der Obdachlose, der dieser Tage, als ich frühmorgens in der Volksbankfiliale Geld abgehoben habe, dort in der Ecke lag, das sicher genauso sehen würde. Und mit ihm vermutlich alle anderen im Elend lebenden Erdenbürger. Nichts gegen Luxus, aber es sollte doch jeder/jedem klar sein, dass man ihn nur haben kann, wenn man anderen etwas wegnimmt. 86.000 Euro pro Jahr für einen studierten Archivar? Pflegeheime, Krankenhäuser, die Freiwillige Feuerwehr usw. hätten zweifellos auch Verwendung für das Geld, und das würde zu recht niemand für Luxus halten.
Versuchen Sie es lieber mit einem Kommentar, der nicht versucht, obdachlose Menschen gegen die qualifizierte Arbeit in einer Institution auszuspielen, die Pflichtaufgabe und elementarer Bestandteil einer demokratischen Gesellschaft ist. Die beiden Themen haben nämlich nichts miteinander zu tun, auch wenn man sich um beide sorgen muss.
Offenbar haben Sie den Artikel nicht vollständig zur Kenntnis genommen: das Nicht-Auffinden einer Bauakte, die in einem ordnungsgemäß geführten Archiv noch hätte aufgefunden werden können, hat alleine einen Schaden in sechsstelliger Höhe verursacht. Davon alleine hätte man das Archiv vermutlich schon ein paar Jahre finanzieren können, zukünftige, ähnlich teure Fälle könnten zudem vermieden werden.
Ein vernünftig geführtes Archiv ist eben kein unnötiger Luxus, sondern nicht umsonst eine rechtssichernde Pflichtaufgabe, die Kommunen zu erfüllen und zu finanzieren haben – davon profitieren dann irgendwann auch Feuerwehr und Pflegekräfte. Und inwiefern der Obdachlose jetzt darunter leidet, dass eine Kommune eine Pflichtaufgabe auch ausreichend finanziert, müssten Sie mir noch mal erklären, wenn es nicht nur reiner Whataboutism sein sollte.
Ein/e ausgebildete/r Archivar/in ist u.a. ein Spezialist für Verwaltungsschriftgut, der viele gesetzliche Regeln im Kopf haben muss, wenn es um die Aufbewahrung und Archivierung von amtlichem Schriftgut geht. Er/Sie muss in der Lage sein, zu entscheiden, welche Akten so aussagekräftig sind, dass man sie in die 5-10% der Akten aufnimmt, die dauerhaft, also für immer, aufbewahrt werden – mehr dürfen es auf keinen Fall sein, schließlich wollen Sie nicht jedes Jahr ein neues, fachgerechtes und teures Magazin bauen, damit die Räume nicht von neuem überquellen (das Magazin müssen Sie selbstverständlich aus fachlicher Sicht mitplanen, ansonsten hat in Ihrer Verwaltung ja niemand Ahnung von den notwendigen räumlichen und klimatischen Voraussetzungen). Trotzdem muss diese Entscheidung getroffen werden, für die man u.a. wissen muss, welche Unterlagen von wem geführt werden – ist der eine Ordner mit wichtigen Niederschriften jetzt das „Original“ oder sind es nur Kopien? War die Abteilung, aus der diese Akten kommen, federführend für den Vorgang oder nicht? Sind die Unterlagen bei der eigentlich federführenden Stelle noch vorhanden oder hat sie dort jemand vorzeitig entsorgt? Werden die Ordner mit Unterlagen zu Baumaßnahmen an der Kreisstraße jetzt noch gebraucht oder blockiere ich mir damit nur wertvollen Platz im Magazin? Wenn ich jetzt entscheide, dass die Akten nicht dauerhaft ins Archiv sollen, dürfen die dann jetzt schon entsorgt werden, damit der drängelnde Hauptabteilungsleiter mehr Platz in seinem Aktenkeller hat, oder gibt es gesetzliche Regelungen, nach denen die Akten noch 20 Jahre aufbewahrt werden müssen? Gleichzeitig müssen Sie diesen Hauptabteilungsleiter daran hindern, Akten einfach so zu schreddern und damit unersetzbare Unterlagen mit historischem Wert zu vernichten. Der/die Archivar/in muss wissen, warum Akten zwischen 1850 und 1950 vom Zerfall bedroht sind und was man dagegen tun kann, warum Papierfischchen, Metall und Plastik ein Problem sind, was die Vermerke auf preußischen Akten bedeuten, er/sie muss diese Akten (und noch viel ältere Schriftstücke aus zig Jahrhunderten) lesen und beurteilen können, er/sie muss in der Lage sein, diese Unterlagenin einer Spezialsoftware aussagekräftig zu inventarisieren („Verzeichnen“ und zu einem „Findbuch“ zusammenstellen), damit Sie, wenn Sie irgendwann mal etwas im Archiv suchen, auch etwas finden. Er/sie muss entscheiden, welche Unterlagen so wichtig sind, dass es sich lohnt, sie zu digitalisieren (denn alles kann man nicht digitalisieren), anschließend muss er/sie zumindest über soviel technischen Sachverstand verfügen, dass er/sie die Digitalisate auch ins Internet bekommt, bequem verknüpft mit den beschreibenden Informationen aus dem Findbuch und so aufbereitet, dass Sie die 200 Seiten eines Personenstandsregisters von 1820 (in dem Sie gerade ihre Vorfahren suchen) zuhause im Internetbrowser schön durchblättern können und nicht jedes Digitalisat einzeln ohne Zusammenhang anschauen müssen. Dabei muss er/sie natürlich u.a. das Urheberrechtsgesetz und die Datenschutzgesetze im Kopf haben, denn niemand möchte, dass seine Geburtsurkunde vor Ablauf der gesetzlichen Schutzfristen im Internet verfügbar ist. Wenn er/sie damit fertig ist, muss er/sie dem Bürgermeister Details zu einem Jubiläum heraussuchen (die nur zu finden sind, wenn frühere Generationen im Archiv vernünftig verzeichnet haben), u.U. den Geschichtsverein bespaßen (der sich auch vor allem dann freut, wenn er die historischen Bestände des Archivs auch nutzen kann und die nicht irgendwo im Heizungskeller in 40 Jahre alten Kartons gestapelt sind), seinen/ihren Job als Stadtchronist/in erfüllen (das gesellschaftliche Leben der Stadt soll ja auch dokumentiert werden), vielleicht noch schnell den Nachlass eines bedeutenden Bürgers sichern, den die Erben gerade verscheuern wollen und verschiedene Arten von Recherchen beantworten. Zu guter Letzt muss er/sie inzwischen auch ein tieferes Verständnis u.a. von elektronischer Aktenführung, Dokumentenmanagementsystem, eGovernment, Dateiformaten und deren Archivierbarkeit, der Haltbarkeit von Datenträgern (haben Sie schon mal versucht, mit Ihren 15 Jahre alten, selbstgebrannten CD-ROMs oder Ihren 20 Jahre alten Disketten zu arbeiten?), Datenaustauschschnittstellen zwischen verschiedenen aktenführenden Systemen und der elektronischen Langzeitarchivierung im Allgemeinen. Möglicherweise muss er/sie sogar maßgeblich an der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems mitarbeiten (weil sonst niemand mehr Ahnung von vernünftiger Aktenführung hat), AGs zur Verbesserung der Schriftgutverwaltung in der Verwaltung leiten (damit beim nächsten Mal die Bauakte nicht verschwindet), und so weiter, und so weiter. Von der historischen Bildungsarbeit mit Schulen, Vorträgen, Ausstellungen etc. fange ich gar nicht erst an. Wie Sie jetzt vielleicht sehen, benötigen Sie hier eine/n Spezialistin/en, der/die gut ausgebildet ist und der weiß, was er/sie tut und der genug Zeit für seine zahllosen Aufgaben hat. Ein modernes, fachgerechtes Archiv kann unmöglich mit einer Verwaltungskraft, die mit ein paar Stunden die Woche ins Archiv abgeordnet wird, geführt werden. Egal, wie sehr sich diese Kraft bemüht, sie wird die umfangreichen Anforderungen nicht erfüllen können und aufgrund von fachlicher Überforderung und Zeitmangel im Zweifel alles nur noch schlimmer machen. Spezialisten haben ihre Berechtigung und dürfen dafür auch entsprechend bezahlt werden (die 86.000 € sind übrigens nicht das Bruttogehalt, sondern die Arbeitgebergesamtkosten; das Bruttogehalt beträgt etwa die Hälfte). Sie gehen ja schließlich, wenn Sie Zahnprobleme haben, auch nicht zu Ihrem Nachbarn mit der Bohrmaschine, weil der billiger ist als der Zahnarzt.
… Und neben den vielen anspruchsvollen Tätigkeiten muss die Archivarin dann in ihrer Dienstzeit auch noch Deppen wie mich belehren. Wahrlich, ein hartes Schicksal.
Der Netphener Bürgermeister (den ich nicht kenne und dem ich nichts schulde) hat, wenn ich das richtig verstehe, sinngemäß gesagt:
1. Die Erledigung der archivischen Kernaufgaben ist in seiner Kommune gewährleistet. 2. Darüber hinausgehenden „teuren Luxus“ (nämlich eine wissenschaftliche [!] Leitung des kleinen Archivs) kann oder will man sich nicht leisten. Was daran verwerflich sein soll, sehe ich nicht. Sollten die in Netphen für das kommunale Archiv Zuständigen mangelnde Kompetenz an den Tag legen, müßte eben eine Lösung gefunden werden (was aber kein Thema des derzeitigen Kommunalwahlkampfes sein sollte). Sie durch einen Hochschulabsolventen zu ersetzen, wäre nicht die einzige und auch nicht zwangsläufig die beste Option. Allen nicht-akademischen Archivmitarbeitern (ob bezahlt oder ehrenamtlich) pauschal fehlende Professionalität zu unterstellen, ist dünkelhaft und beleidigend. Diese Personen leisten oft hervorragende und anerkannte Arbeit. Ob Hochschulabgänger (in dieser Sparte wohl meist Historiker, möglichst noch promoviert) diese in jedem Fall so viel besser machen würden, wage ich zu bezweifeln.
Übrigens: Da Sie mit dieser obskuren Bauakte argumentieren, verfügen Sie hoffentlich über Hintergrundinformationen , die mir und den meisten anderen Lesern fehlen. Ohne Kenntnis der näheren Umstände sollte man es nämlich lieber unterlassen, öffentlich zu suggerieren, das Verschwinden dieser Akte sei im Archiv von einem unfähigen bzw. schlampigen Mitarbeiter verschuldet worden.
Zum Thema „Luxus“ könnte man lange philosophieren, wenn es einen Sinn hätte. Jeder mitdenkende und nicht übermäßig selbstbezogene Mensch weiß aber auch so, was gemeint war. Wenn Sie noch ein anderes Beispiel haben wollen: Ich als historisch Interessierter finde Archive toll; noch toller hätte ich es aber gefunden, wenn meine schwer demente Mutter ihre letzten drei Lebensjahre nicht in einer Pflegeeinrichtung hätte verbringen müssen, die ihr wegen ungenügender Personalausstattung nur menschenunwürdiges Dahinvegetieren bieten konnte. Ich bin mir sicher, dass sich viele Archivbenutzer zugunsten einer sozial gerechteren Verteilung der beschränkten Ressourcen damit arrangieren könnten, dass sich Archive und andere kulturelle Einrichtungen beim Geldverschenken bescheiden hinten anstellen, solange sie ihre „Kernaufgaben“ jederzeit voll erfüllen können. Dass es aber auch genug verwöhnte Zeitgenossen gibt, die das niemals für sich akzeptieren würden, steht außer Zweifel.
Bitte lesen Sie auch den Kommentar von Frau Wolf und verkneifen Sie sich, die nächste Einrichtung der sozialen Daseinsfürsorge an Land zu ziehen, um zwei vollkommen unterschiedliche Bereiche gegeneinander auszuspielen.
Keine Pflegeeinrichtung wird personell besser ausgestattet, nur weil ein Archiv eine wissenschaftliche Kraft weniger beschäftigt. Wie Herr Schröter-Karin aufgezeigt hat, helfen Archive sogar dabei, Ressourcen einzusparen (die dann wiederum Geld sparen). Ihr Unmut ist hier fehl am Platz.
„Zwei vollkommen unterschiedliche Bereiche“, die, wie Sie oben schrieben, „nichts miteinander zu tun haben“ – klar, so kann man das sehen. Muss man aber nicht. Vielleicht fallen Ihre Scheuklappen mit fortschreitender Lebenserfahrung von selbst ab, und Sie erkennen irgendwann, dass es nur diese eine Gesellschaft mit eng verflochtenen Verantwortlichkeiten gibt. Und nein, mein Unmut über verwöhnte (wenn auch „politisch korrekte“) Wohlstandsbürger, die ihre jeweiligen Standesinteressen für den Nabel der Welt halten, ist keineswegs fehl am Platz.
Sehr geehrter Herr Kunzmann,
es ging mir nicht darum, Sie zu belehren, sondern deutlich zu machen, dass der Archivarsberuf heutzutage deutlich mehr ist als nur Akten zu stapeln. Das das offenbar falsch rübergekommen ist, tut mir sehr leid.
Es geht hier außerdem nicht darum, Verwaltungsbeschäftigten Schlamperei zu unterstellen. Vor Schlamperei würde auch eine Fachausbildung nicht schützen. Es geht darum, dass Verwaltungsbeschäftigte mit zu wenig Ressourcen eine Aufgabe erfüllen sollen, denen sie schlicht und ergreifend nicht gewachsen sind, u.a., weil sie nicht dafür ausgebildet sind. Wenn ich als ausgebildeter Archivar ins Ordnungsamt abgestellt würde und dort meinen Job dann mit der Hälfte der benötigten Stundenanzahl erledigen sollte, würde garantiert auch nichts Gutes dabei herauskommmen.
Das der Bürgermeister behauptet, es wäre alles in Butter, wundert mich nicht, aus meiner eigenen Erfahrung (ich bin als Archivar für sechs Kommunen zuständig) kann ich Ihnen aber versichern, dass das bei der Ausstattung des Archivs gar nicht stimmen kann.
Zudem handelt es sich bei einem/r ausgebildeten Archivar/in, der nach Tarifstufe 9b eingestellt wird, nicht um jemanden, der im Keller rumsitzt und sich in wissenschaftlichen Wolkenkuckucksheimen rumtreibt. Es handelt sich um Beschäftigte mit einem FH-Bachelor bzw. einer dreijährigen verwaltungsinternen Ausbildung zum Diplom-Archivar. Ich missachte im übrigen auch niemanden, der keine akademische Ausbildung hat, das archivische Berufsfeld erstreckt sich schließlich auch auf Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Archiv, die ebenfalls eine Ausbildung absolviert haben. FaMIs leisten hervorragende und unersetzbare Grundlagenarbeit, auch wenn sie halt nicht dafür ausgebildet werden, handschriftliche Texte aus dem 17. Jh. zu lesen. Ich bin im sogar der Meinung, dass man lieber einen Diplom-Archivar einstellen sollte, als einen promovierten Historiker ohne Archivausbildung. Ein guter Historiker ist schließlich noch lange kein guter Archivar. In Netphen ist aber eben gar keine ausgebildete Archivfachkraft am Werk, und das ist m.E. ein großes Problem, da die Aufgaben und Anforderungen im Archivarsberuf in den letzten 20 Jahren größer und nicht kleiner geworden sind.
Im Übrigen tut es mir leid, was Ihrer Mutter widerfahren ist, ich hoffe, das meinen Eltern so etwas erspart bleibt. Da das Personal in Pflegeeinrichtungen allerdings i.d.R. nicht durch Steuergelder finanziert wird, sehe ich nicht, was das mit einer Personalstelle der Stadt Netphen zu tun hat. Wenn Sie mir die Ergänzung gestatten, würde ich allerdings behaupten behaupten, dass Ihnen ein besser bezahlter Facharchivar hier mehr geholfen hätte, da durch dessen höheres Gehalt höhere Beiträge zur Pflegeversicherung geleistet werden könnten. Die Pflegeversicherung wiederum zahlt indirekt das Gehalt der Pflegerinnen und Pfleger in der Altenpflege.
Da habe ich wohl zu langsam getippt :D.
Ach Herr Kunzmann, über unsere Arbeit erzählen wir gern, haben wir es doch oft mit Vorurteilen zu tun. Dafür können die meisten nicht mal was, da liegt eben noch viel Arbeit vor uns. Das ist kein hartes Schicksal, sondern Teil unserer Aufgaben. Ohne in die konkreten Verhältnisse vor Ort genauer eingeweiht zu sein, glauben Sie uns, haben wir eine zu unserem Leidwesen vermutlich ziemlich treffende Vorstellung davon, wie die Kernaufgaben, die der Bürgermeister hier erfüllt sieht, tatsächlich abgedeckt sind. Wie hier schon kommentiert wurde, geht das nicht gegen diejenigen, die tapfer versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Warum wir uns das vorstellen können? Weil wir das Ergebnis unterausgestatteter Archive mehr als einmal gesehen haben. Wir sind Kummer gewöhnt. Wenn Sie sich für die Arbeit der Archive tatsächlich interessieren, was schön wäre, wüssten Sie, dass wir alles andere als Geld verschenken. Und bei allem Verständnis für Ihre persönlichen Erfahrungen: Aufrechnen hat noch nie jemandem mehr gebracht. Das weiß jeder mitdenkende Mensch. Oh, und damit keine Missverständnisse aufkommen: „Ob Hochschulabgänger (in dieser Sparte wohl meist Historiker, möglichst noch promoviert) diese in jedem Fall so viel besser machen würden, wage ich zu bezweifeln.“ Mal abgesehen davon, dass wir tatsächlich wissen, was wir tun, geht es hier nicht um promovierte Historiker. Die angesprochenen Aufgaben und die Eingruppierung in E9 zielen auf ein Diplom oder BA in Archivwissenschaft ab. Wenn Sie sich wirklich für Archive interessieren, finden Sie z. B. hier: https://www.archivschule.de/ mehr Informationen.
Den Kommentaren von Frau Friedrich und Herrn Schröter-Karin ist kaum noch was hinzuzufügen. Sie sehen, Herr Kunzmann, es ist nicht das erste Mal, dass wir mit dem Vorwurf konfrontiert werden, Archive seien ein verzichtbarer Luxus. Einzelne Pflichtaufgaben einer Gemeinde – Kindergärten und Schwimmbäder werden da auch immer gern herangezogen, die Feuerwehr tatsächlich seltener – gegeneinander ausspielen zu wollen ist wenig hilfreich. Genauso wenig wie ein Bürgermeister, der meint, die archivischen Pflichtaufgaben könne man auch Ehrenamtlichen überlassen. Über die angemessene Verteilung der verfügbaren Mittel wird in jeder Kommune jedes Jahr in den Haushaltsanträgen verhandelt. Und ja, Archive sind, ohne pathetisch zu sein, unverzichtbar für eine Demokratie. Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns ist da ein Stichwort. Das gilt auch für die „kleinen“.
Zwei Fragen:
1) Verstehe ich Sie richtig, dass die Stadt Netphen, die archivischen Personalkosten besser in Pflegeheime und Krankenhäuser investieren sollte – wie wohl sie keine solche Einrichtung unterhält?
2) Ist Ihnen entgangen, dass die Stadt Netphen sich sehr wohl um ein fachgerechte Archivierung bei gleichzeitiger Kostenreduzierung bemüht – s. http://www.siwiarchiv.de/es-geht-weiter-mit-der-archivierung-in-netphen/ ?
Pingback: Heute vor 50 Jahren: Beginn der „Schacholympiade 1970 – | siwiarchiv.de
Pingback: Sachstand: Evaluierung des Archivgesetzes NRW (2018 – 2020) | siwiarchiv.de
Pingback: Sachstand: Evaluierung des Archivgesetzes NRW (2018 – 2020) | siwiarchiv.de
In diesem Zusammenhang möchte ich an die Deutsche Schachmeisterschaft vom 10. bis 31.08.1947 in Weidenau erinnern. Einer der Initiatoren war der Oberstudienrat Hermann Meyer vom FJM-Gymnasium. Er war von 1946 bis 1948 Vorsitzender des Schachbezirks Siegerland und in den 50er Jahren Jugendleiter des Schachverbands Südwestfalen. Später richtete er am FJM-Gymnasium eine Arbeitsgemeinschaft „Schach“ ein, die alle daran teilnehmenden Schüler zu gefürchteten Spielgegnern machte. (Siegener Zeitung, 13. März 1986) Die Post gab Sonderstempel heraus.
Sehr geehrter Herr Kunzmann,
als Abschluss, da ich mich dann aus der Diskussion zurückziehen werde: ich muss keine Besitzwahrung betreiben, ich habe inzwischen einen gut bezahlten Job.
Diesen Job habe ich im übrigen, weil ich erst ein Universitätsstudium absolviert und mich dann auf eigene Kosten (mittlerer 4-stelliger Betrag) in einem berufsbegleitenden Studium zum Archivar weitergebildet habe. Währenddessen habe ich zehn Jahre auf befristeten Stellen gesessen. Ja, es hat sich gelohnt, dafür habe ich aber auch hart genug gearbeitet.
Ich habe keine Ahnung, wie Sie einen Wohlstandsbürger definieren, offenbar gehören wir ja dazu, da Sie mit einiger Verachtung von Fachpersonal sprechen. Bitte denken Sie aber weiterhin daran: Sie möchten von ausgebildeten Polizisten geschützt werden, nicht von irgendwelchen Hilfssherrifs; Sie möchten, dass ein ausgebildeter Handwerker Ihr Haus baut und repariert und nicht der Kumpel vom Schwager vom Nachbarn, damit es nicht beim ersten Sturm auseinanderfällt; Sie möchten, dass ein ausgebildeter Zahnarzt Ihre Zähne bearbeitet und nicht irgendein Metzger mit einem Bohrer in der Hand, nur weil der billiger ist. Wenn Sie Geld und/oder Zeit in etwas investieren, erwarten auch Sie, dass da hinterher etwas bei rausspringt. Und wenn Ihre Kommune einen Beschluss zu Ihren Gunsten trifft, erwarten auch Sie, dass dieser Beschluss Bestand hat und nicht zehn Jahre später jemand behauptet, den Beschluss habe es nie gegeben und es nicht mehr nachweisbar ist, weil die Akten weg sind.
Auch, wenn Sie das gerade nicht sehen wollen, leisten Archive eine wichtige Arbeit (wenn man sie lässt), die keine Spielerei für irgendwelche Spinner ist, sondern eine gesetzlich festgelegte Pflichtaufgabe einer Kommune. Von dieser Arbeit, die aufgrund ihrer Anforderungen zwangsläufig von Fachpersonal erledigt werden muss, profitieren auch Sie.
Das Sie offenbar der Meinung sind, dass dieses Fachpersonal nicht entsprechend seiner Ausbildung bezahlt werden muss, finde ich überaus traurig.
Mit freundlichen Grüßen
Tobias Schröter-Karin
@alle
1) siwiarchiv steht eigentlich für einen wertschätzenden Umgang. Unbegründete persönliche Angriffe werden hier zukünftig nicht mehr zugelassen.
2) Die Diskussion kann m. E. entlang folgender Fragen weitergeführt werden: Sind Archive gleich wichtig wie soziale Leistungen? Wenn ja, warum?
Ein weiterer Hinweis zur Schacholypmpaide:
Sehr geehrter Herr Schröter-Karin,
Sie haben sehr viele Eulen nach Athen getragen und offene Türen eingerannt. Da meine Biographie hier nicht von Belang ist, lasse ich es dabei bewenden.
Wo ich angeblich „Verachtung für Fachpersonal“ geäußert haben soll, können Sie ja fairerweise noch nachtragen; ich sehe es nicht. Behauptet habe ich lediglich, dass ein kommunales Archiv wie das in Netphen („Stadt“ erst seit den Gebietsreformen der 1960er Jahre, eigentlich ein Konglomerat kleiner bis kleinster Landgemeinden) nicht unbedingt einen wissenschaftlichen Archivar benötigt, wenn in andern vergleichbaren oder größeren oder älteren Kommunen das Archiv von abgeordneten Sachbearbeitern oder umgeschulten Gymnasiallehrern oder FH-Absolventen über viele Jahre sehr professionell geleitet wird. Da könnte ich Hilchenbach, Freudenberg, bis vor ein paar Monaten Siegen und sicher noch etliche andere nennen. Anscheinend wurde in Netphen (genau weiss ich es nicht) von der SPD-Ratsfraktion die Maximalforderung erhoben, die dann vom parteilosen Bürgermeister als „Luxus“ in Frage gestellt wurde. Ich hoffe wie vermutlich auch Sie, dass am Ende ein sinnvoller Kompromiss zustande kommt, also: Ein bißchen kleinere, aber dennoch solide Brötchen backen.
Das derzeitige Wahlkampfgetön mit der Anspielung auf eine „nicht auffindbare Akte“ zu motivieren, halte ich für unseriös, wenn hier nicht eindeutige Indizien gegen den ehrenamtlichen Archivbetreuer vorgebracht werden können. Wenn es die von mir vermutete Person ist, handelt es sich nicht um irgendeinen heimatforschenden Kaninchenzüchter, sondern um einen pensionierten höheren Verwaltungsbeamten eben dieser Stadt Netphen, der wegen seiner früheren Dienstaufgaben sicherlich eine wichtige Bauakte erkannt und nicht weggeworfen hätte. Soviel abschließend dazu.
Ja, ich halte Sie und mich und alle anderen Einwohner dieses Landes, die mehr als ihre elementaren Lebensbedürfnisse befriedigen können, für Wohlstandsbürger. Und bevor Sie fragen: Ich habe dem Obdachlosen neulich keinen der eben aus dem Automaten gezogenen Scheine zugesteckt. Darum geht es auch überhaupt nicht. Mir gehen nur Hybris, Scheinheiligkeit und Selbstgerechtigkeit auf die Nerven. Davon sehe ich in den Verlautbarungen mancher Archivare (w/m) eine ganze Menge. Archivare können ebensowenig wie die Vertreter aller anderen Berufe diese kranke Menschheit mit einem Geheimrezept beglücken. Sie sind Rädchen im großen Getriebe, nicht unvergleichbar wichtiger als die übrigen Rädchen. Ein bißchen mehr Demut angesichts der existentiellen Probleme dieser Welt wäre angemessen.
1) Ich würde mich sehr über die Beantwortung meiner Fragen freuen.
2) Leider sind die Protokolle des Rechnungsprüfungsausschuss noch nicht öffentlich, so dass kein Beleg für die gemachten Aussagen zur „Aktenaffäre“ eingereicht werden kann.
Lieber Herr Wolf, inzwischen ist es ein wenig unübersichtlich geworden, aber Ihre Fragen waren ja wohl an mich gerichtet.
1.) Nein, Sie haben das nicht richtig verstanden. Ich habe nicht gefordert, dass die Stadt Netphen archivische Personalkosten in andere Bereiche investieren solle. Ich habe (mit zwei lediglich der Illustration dienenden Beispielen) daran erinnert, dass die den Archiven für ihre Arbeit zur Verfügung gestellten und nicht von ihnen selbst produzierten materiellen Werte auch anders verteilt werden könnten, wenn die Gesellschaft andere Prioritäten setzen würde. Archivare können keinen gesellschaftlichen Paradigmenwechsel anstoßen, aber ihnen sollte bei ihrem relativ hohen Bildungsstand bewußt sein, auf wessen Kosten sie (und viele andere, ich auch) letztendlich leben.
2.) Das ist mir nicht entgangen, und gerade das war der Aufhänger für meine eingangs gestellte Frage: Wenn der SPD-Stadtrat den Eindruck zu erwecken versucht, der Bürgermeister wolle das Netphener Archivwesen plattmachen, ist mir das suspekt. Wenn es zutrifft, dass das Bestehende vorerst sicher ist und sogar noch ausgebaut werden soll, wären unrealisierbare zusätzliche Forderungen durch den Stadtrat eher kontraproduktiv. „Alles oder nichts“ kann kein Grundsatz vernünftiger Realpolitik sein.
Sofern ich das richtig verstanden habe, unterscheidet die Stadt Netphen in ihren Erwägungen zwischen einem ausbaufähigen Archiv, das seinen Kernaufgaben voll gerecht wird, und einem (Zitat:) „umfassenden“ Archiv, in dem wohl zusätzlich noch wissenschaftliche Forschung betrieben wird. Letzteres wäre wegen der Personalausstattung deutlich teurer und unter den gegebenen Umständen – ich bleibe dabei – ein „Luxus“. So etwas ähnliches gab es in den 1950 Jahren in Siegen mit der vom Stadtarchivar geleiteten „Forschungsstelle Siegerland“, und sogar dort hatte ein so ambitioniertes Projekt nur kurzen Bestand. Die ganze ausufernde Diskussion beruht auf der Unterstellung, ich habe den Sinn eines gut ausgebauten Kommunalarchivs (erste Variante) geleugnet. Vielleicht erst mal sorgfältig lesen, was wirklich dasteht, bevor der „Shitstorm“ losgelassen wird?
Vielen Dank für die Antwort! Gestatten Sie mir noch Nachfragen?
– Wo genau findet sich der Beleg, dass an Stelle des wissenschaftlichen, höheren Archivdienstes gedacht ist? M.E. ist unter Berücksichtigung des Hinweises von Schröter-Karim eine Stelle des gehobenen Archivdienstes angedacht. Dies entspräche auch der Linie der landschaftlichen Archivpflege.
– Sie unterstellen einer Äußerung, die sich auf einen Bericht im Rechnungsprüfungsausschuss bezieht, aus dem Januar 2019 „Wahlkampfgetöse“. Welcher Wahlkampf war denn das?
Bitte mit Quellen belegen, da sind wir berufsbedingt penibel, wenn Sie „Hybris, Scheinheiligkeit und Selbstgerechtigkeit“ mancher (?) ArchivarInnen ins Feld führen. Wie schon gesagt: Archive sind wichtiger Bestandteil einer Demokratie und das sage ich nicht, weil ich mich oder unsere Arbeit wichtig tun möchte. Es geht um Nachweisbarkeit, Nachvollziehbarkeit, die Möglichkeit, Rechenschaft einzufordern. Es geht um Verantwortung. Und das über das Heute hinaus. Keine Gemeinschaft ist zu klein oder zu unbedeutend, um eine Geschichte zu haben. Von Maximalforderung habe ich übrigens im Bericht nichts entdecken können (was der Bürgermeister unter einem umfassenden Archiv versteht, entzieht sich meinem Verständnis). Im Gegenteil, die vorgeschlagene interkommunale Zusammenarbeit ist ein vernünftiger Weg gerade für solche Kommunen.
P. S.: Niemand wirft dem ehrenamtlichen Betreuer vor, die oder eine andere wichtige Akte vernichtet zu haben. Wenn ich da aus meiner Erfahrung sprechen darf: Die Aktenführung und -ordnung in den Verwaltungen werden oft mehr oder weniger stiefkindlich behandelt. Akten, die länger nicht mehr gebraucht werden oder geschlossen in der sogenannten Altregistratur liegen, haben es da besonders schwer. Sie verschwinden häufig, ohne dass es jemandes Absicht oder Versagen wäre. Die Strukturen müssen stimmen. Eine ehrenamtliche Betreuung kann beim besten Willen keine fachlich qualifizierte Aufgabenerfüllung ersetzen, gerade was Beratung und Übernahme angeht und gerade, wenn nicht nur im Archiv, sondern auch in der Registratur gespart wird.
Stand, 8.9.2020:

Also ich finde, man sollte diese Lebensbereiche nicht gegeneinander ausspielen. Ich als Bürger finde, es gibt Berufsgruppen, an denen sollte nicht gespart werden. Dazu gehören Feuerwehr, Polizei und Gesundheitswesen. Und natürlich kann man auch hier und da auf der anderen Seite bei Archiven und Museen sparen, warum auch nicht? Es muss ja wirklich kein kostspieliges Luxusarchiv sein. Bedenklich wird es nur da, wo Kernaufgaben nicht mehr erfüllt werden können, weil zwar die Aufgaben immer mehr geworden sind (Personenstandsunterlagen, digitale Archivierung), aber die Ausstattung nicht parallel mitgewachsen ist. Ein Archiv sollte man halt auch nicht kaputtsparen.
Ob Archivarbeit tatsächlich Luxus ist? Nun solange es sich nur historische Ergebnisse archivischer Arbeit betrachtet werden, mag man dieser Einschätzung folgen – denn wer braucht schon Geschichte, wenn es darum geht, sich um einen Obdachlosen zu kümmern.
Allerdings leist(et)en Archive auch immer Arbeit, die mehr oder weniger vielen Bürger*innen nutz(t)en. Archive als rechtwahrende Institutionen wurden hier zwar aufgeführt – allerdings bislang noch ohne Beispiele.
Die Sicherung und Nutzung der Stasiunterlagen erlaubt in den neuen Bundesländern nicht nur die historische Dokumentation einer staatlichen Unrechtsbehörde, sondern auch vielen einzelnen Bürger*innen konkrete Hilfe bei der „Bewältigung“ der eigenen Lebensgeschichte.
Ebenfalls in den neuen Bundesländern ist die Rolle der Archive bei der Klärung der Eigentumsverhältnisse m. E. nie angemessen gewürdigt worden.
Gleiches gilt für die Rolle der Archive bei der Entschädigung der Zwangsarbeiter*innen. Soll ich noch die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in Kinderheimen erwähnen?
Beinahe Tagesgeschäft von Kommunalarchiven ist die Mitarbeit an der Erstellung von Altlastenkataster, die Ermittlung von Arbeitszeiten bei Rentenfragen, die Vorlage von Adoptionsakten, die Mitarbeit bei der Erbenermittlung bis hin zur Ermittlung von Schulabgangszeugnissen, weil diese irgendwann einmal verlorengingen. Die Liste mag gerne ergänzt werden.
Alle genannten Arbeiten könnhen von Ehrenamtlern angefangen ausgeübt werden; dies gilt aber auch für die genannten sozialen, gesundheitlichen oder pflegerischen Bereiche.
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 26.8.2020 – 7.9.2020 | siwiarchiv.de
Dann erkläre ich es eben noch einmal. Es gibt eine ganz spezielle Frage von lokalem oder bestenfalls regionalem Interesse innerhalb des Kreises Siegen-Wittgenstein. Diese bewegt die Gemüter in der Gebietskörperschaft Netphen und wurde vom Moderator hier thematisiert: Benötigt Netphen ein funktionsfähiges Kommunalarchiv, wie es viele andere Kommunen dieser Größe und dieses Charakters, auch im Siegerland, haben? (Natürlich „ja“.) Oder benötigt Netphen, was anscheinend dem SPD-Stadtrat vorschwebt, ein Archiv mit darüber noch deutlich hinausgehenden Aufgaben, ein wissenschaftliches Archiv, womöglich mit Forschungsorientierung? Der Bürgermeister meint „nein“ und hält ein solches umfassenderes Archiv in Netphen für eine Nummer zu groß („Luxus“); ich habe gewagt, der gleichen Meinung zu sein.
Über diese Netphener Kontroverse hätte man daraufhin auf Siwiarchiv Gedanken austauschen können. Das ist nicht geschehen. Auch gut. Statt dessen brach von weit her, teils aus Hessen und Schwaben kommend, eine gewaltige Sturmflut allgemeiner archivpolitischer Traktate herein, die an der speziellen Frage „Gutes bezahlbares Archiv oder luxuriöses zu teures Archiv in Netphen?“ total verbeigehen und mich mit Zurechtweisungen über die elementaren Grundlagen des Archivwesens volltexten. Danke, brauche ich nicht, Thema verfehlt. Und Ende.
Es wäre insgesamt hilfreich, wenn man alle Einträge zur Archivierung in Netphen liest – s. http://www.siwiarchiv.de/zehn-fragen-zur-archivierung-in-netphen-und/ . Denn die heraufbeschworene Luxusvariante kann ich hier nicht entdecken.
Sorry, ich hatte übersehen, dass Sie dieser Tage auf einen schon bald zwei Jahre alten Beitrag verlinkt hatten, den ich daraufhin fälschlich für eine aktuelle Stellungnahme aus Netphen hielt. Seitdem dürfte viel Wasser die Sieg heruntergeflossen sein. (Für Ortsfremde: Die Sieg-Quelle befindet sich im Netphener Archivsprengel.) Das offensichtliche Mißverständnis hätte sich auch sofort mit 1-2 Sätzen korrigieren lassen. Nun ja. C’est la vie.
Pingback: Debatte: Sind Archive Luxus? | Archivalia
Ob die regierungsinterne Abstimmung über den Entwurf des Archivgesetzes mit dem geplanten Kulturgesetzbuch Nordrhein-Westfalen in Zusammenhang steht. Ein Blick in die entsprechende Vorlage für die heutige Sitzung des Kulturausschusses des Landtages NRW ergibt Folgendes: “ …. 4. Transparente Rahmenbedingungen für Kunst und Kultur schaf-fen und sichern ….. o Die kulturellen Aspekte des Archivwesens und des Denkmalschutzes sollen angemessen berücksichtigt werden. …..“ (S. 2-3)
Laut Ausschussprotokoll erläuterte der parlamentarische Staatssekretär Klaus Kaiser zum Tagesordnungspunkt „Eckpunkte Kulturgesetzbuch Nordrhein-Westfalen“ folgendes zu Archiven: “ ….. Unter dem Titel „Kulturelle Einrichtungen und Handlungsfelder“ widme sich der vierte Teil den zentralen Elementen der kulturellen Infrastruktur, also den Archiven als den kulturellen Speicherorten, aber auch den Museen, Theatern und Orchestern. …. Der Landesregierung liege viel daran, bei den Vorarbeiten gut voranzukommen, um anschließend ausreichend Zeit für eine parlamentarische Begleitung und Beratung zu haben. Ziel sei eine Inkraftsetzung des Gesetzes zum 1. Januar 2022. Bei Nachfragen seitens der Fraktionen oder einzelner Abgeordneter leiste sein Haus gerne Hilfestellung. Über Fortschritte werde er im Ausschuss berichten. …..“ (S.11) Der SPD-Abgeordnete Andreas Bialas stellte u. a. folgende Frage: “ …. ob letztendlich auch bestehende Gesetze zusammengefasst oder einbezogen werden sollten, etwa im Hinblick auf das Kulturfördergesetz, das Archivgesetz, das Pflichtexemplargesetz, das Denkmalschutzgesetz, das Musikschulgesetz oder das Bibliotheksgesetz. Er erinnere in diesem Zusam-menhang auch an § 96 Bundesvertriebenengesetz, an bestimmte Bereiche der Hochschulgesetze, an Kunst am Bau und an den Denkmalschutz. Sicherlich könnten in dieser Hinsicht Schnittstellenprobleme mit anderen Ministerien und mit anderen Ausschüssen erwartet werden. ….Natürlich könne der Kulturbereich die Digitalisierung in Gesetze einfließen lassen, allerdings gebe es in einem anderen Ministerium, vor allem in dem von Herrn Professor Dr. Pinkwart, bereits zahlreiche Digitalisierungsstrategien. Schon mehrfach habe seine Fraktion die Frage gestellt, inwieweit das Kulturministerium sich in Sachen „Digitalisierung“ mit anderen Ressorts abstimme – etwa mit Blick auf schnelle Netze in Bibliotheken, Musikschulen, VHS-Archiven [sic!], Museen und auch Zoos. Neben dem MWIDE lägen die Zuständigkeiten in diesen Bereichen teilweise auch in der Verantwortung der Kommunen. …..“ (S. 12).
Zwei Fragen dazu:
1) Bedeuten die Aussagen des Staatssekretärs, dass das Archivgesetz erst 2022 novelliert wird?
2) Hat der Staatsekretär auf die Frage geantwortet, ob das Archivgesetz in das Kulturgesetzbuch miteinbezogen wird?
Auch hier die Anmerkung, dass ich die Bezeichnung „Kriegstote“ für hier ermordete und anders gewaltsam zu Tode gekommene ZwangsarbeiterInnen unpassend und verschleiernd finde.
http://zwangsarbeitimsiegerland.blogsport.de/start/hilchenbach/namen-hilchenbach/#allenbach
Pingback: Kommunalwahl 2020: Archivpolitischer Check der Wahlprogramme für Netphen und Neunkirchen | siwiarchiv.de
Pingback: Literaturhinweis: Christian Brachthäuser: Buchdruckkunst in der Grafschaft Nassau. | siwiarchiv.de
„Luxusarchive“ mag es im Lande Utopia geben. Ich halte das aber eher für einen aussichtsreichen Kandidaten für das Unwort des Jahres!
Ich denke, dass auch nicht an „Luxusarchive“ gedacht wurde. Vielmehr ging es bei der Diskussion um die Erledigung der Kernaufgaben eines kleinen Stadtarchivs. Einerseits wurde der Eindruck suggeriert, dass dies nur durch eine wissenschaftliche Kraft erfolgen können, demgegenüber stand die Position, dass das Führen eines kleinen Stadtarchivs durchaus auch mit „Bordmitteln“ (z. B. fortgebildete Verwaltungskräfte) machbar ist – vor dem Hintergrund, dass die Aufgabe „Archiv“ bereits ein Luxus ist. Gerade dieser letzte Punkt sollte m. E. tatsächlich intensiv diskutiert werden. Denn der Stellenwert von Archiven in den Gefügen ihrer Träger ist ja i. d. R. nicht eben hoch, wenn finanzielle Verteilkämpfe oder gar wachsende finanzielle Probleme des Trägers hinzukommen, ist dann ein Archiv eine quantité négligeable?
Stand, 15.9.2020:

Rezeption von Geschichte, erst recht der Zeitgeschichte, ist eben ein Feld der unterschiedlichen Interessen und des Konflikts. Einblick in die Akten und die Erzeugung von Verschlusssachen sind Mittel der geschichtspolitischen Auseinandersetzung. Immer wieder neu.
Eine Binsenwahrheit.
Eine Binsenweisheit – in jedem Fall für die Fachöffentlichkeit. Allerdings entbindet dies nicht von der Dokumentation aktueller Konflikte.
Zudem ist die deutliche Positionierung des Bundesarchivpräsidenten ebenso festhaltenswert.
Pingback: “history repeating”- Geschichtliche Bedeutung und Fortschreibung- eine Endlosschleife? | siwiarchiv.de
Pingback: BND-Akten ewig geheim? | Archivalia
Pingback: Wittgenstein Heft 2 / 2020 erschienen | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 8.9. – 20.9.20 | siwiarchiv.de
Stand 22.9.2020:
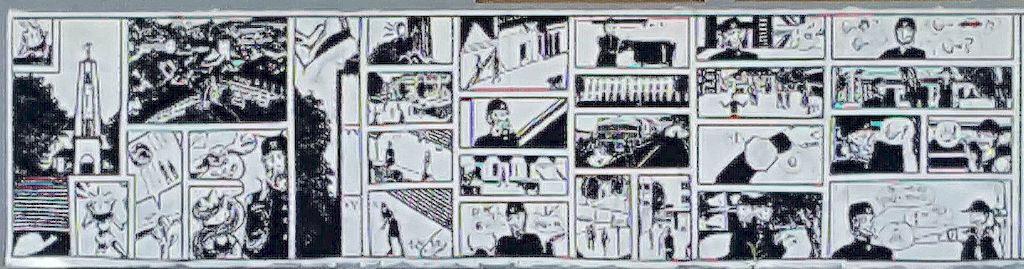
Pingback: Siegen: Broschüre zur „Gartenstadt Wenscht“ jetzt online | siwiarchiv.de
Leider: Einmal mehr klappt „ab sofort online einsehbar“ nicht.
Danke für den Hinweis! Sollte jetzt funktionieren.
Pingback: Arbeitskreis Offene Archive – Videomeeting am 23. September 2020 | siwiarchiv.de
Zur Barrierefreiheit in Hinblivk auf die Verwendung „leichter Sprache“ wurde m. W. erstmals 2012 auf Archivalia diskutiert.
Auch der wichtige und ebenfalls intensiv diskutierte Blogbeitrag zur gendergerechten Erschließung soll hier nicht unterschlagen werden.
Darüberhinausgehend dürfte es interessant sein zu ermitteln, ob sich Archiv(ierend)e in einer demokratischen Gesellschaft positionieren sollen, bspw. gegen Rassismus oder eben #Archivistsforfuture ……
Stand 29.9..2020:
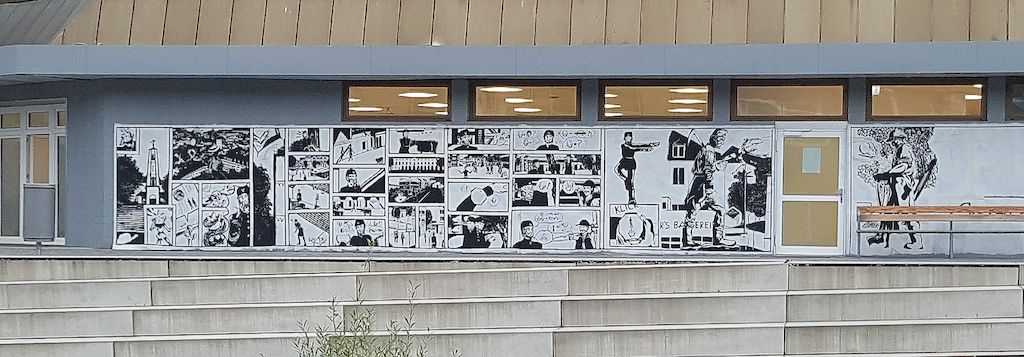
Der Hinweis eines Nutzer verweist auch auf eine Tätgkeit Fickelers als Vortragsredner im Befehlsbereich des „Kom[man]d[ierenden]. Adm[irals] Fr[ankreich] im Herbst 1940. Unterlagen des Freiburger Militärarchivs (bundesarchiv) müssten daher daraufhin überprüft werden.
Am 21. August 2020 postete das LWL-Archivamt den Henweis auf Fortbildungsveranstaltungen zum Relaunch des NRW-Archivportals, der Ende September 2020 erfolgen soll.
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 21.9. – 3.10.2020 | siwiarchiv.de
Stand 6.10.2020:

s. a. https://www.wp.de/staedte/siegerland/siegen-wieso-henner-und-frieder-zu-comic-aliens-werden-id230594322.html
s. a.
Pingback: Vortrag Dr. Matthias Plaga Verse: „Siegerländer Frömmigkeitstradition zwischen Pietismus und Neupietismus“ | siwiarchiv.de
Steuerlich gilt ja auch Schach im Gemeinnützigkeitsrecht als Sport. Man spricht auch vom Schachsport. Eigentlich müssten daher auch die Aufsätze etc. hierzu mit in die Liste aufgenommen werden (z.B. zur XIX. Schacholympiade in Siegen 1970).
Zur Schacholympiade einschlägig sind:
Keene, R.D. / Levy, D.N.L.: Siegen Chess Olympiad, Chess Ltd., Sutton Coldfield 1970.
Präsidium der XIX. Schach-Olympiade: XIX. Schach-Olympiade, Siegen 1970.
Mario Tal: Bruderküsse und Freudentränen: Eine Kulturgeschichte der Schach-Olympiaden, Köln 2008
Tischbierek, Raj: Sternstunden des Schachs. 30x Olympia. London 1927 – Manila 1992, Sportverlag Berlin 1993.
Pingback: Relaunch des nordrhein-westfälischen Archivportals archive.nrw.de | siwiarchiv.de
Pingback: Siwiarchiv kritisiert Archive NRW | Archivalia
s. a. https://biancawalther.de/ein-reisetagebuch-taucht-auf/
Handelt es sich dabei um ein gedrucktes Buch, das man käuflich erwerben kann?
Ja, das Buch müsste im Buchhandel vorhanden sein.
Erlaube mir darauf hinzuweisen, daß in der Überschrift zu Opfermanns Aufsatz zwei Fehler sind: 1. Weihe starb 1980 und nicht 1960 2. Er war Landrat bis 1945 und nicht nur bis 1944. Beides ergibt sich aus dem Aufsatz selbst, das Sterbedatum auch aus anderen Quellen.
1) Vielen Dank für den Hinweis! Die Überschrift wurde entsprechend geändert.
2) Bis wann Weihe nun genau Landrat war, wird sich wohl nur durch einen Blick in die Personalkaten in Münster ermitteln lassen.
Pingback: Bibliographie zur Geschichte der Hexenverfolgungen in Westfalen und Lippe | siwiarchiv.de
2 Ergänzungen:
“ …. Der VdA-Vorsitzende Ralf Jacob ruft alle in der Verantwortung stehenden KollegInnen in antragsberechtigten Archiven dazu auf, die gebotene Chance für ihre Einrichtungen zu nutzen. ….“ s. VdA v. 12.10.2020, Link: https://www.vda.archiv.net/aktuelles/meldung/682.html.
„…. Wichtig ist dabei, dass die Mindestantragssumme 10.000 Euro beträgt, aber „eine Unterschreitung in begründeten Ausnahmefällen insbesondere für kleinere Einrichtungen zulässig“ ist (Förderbedingungen 6.2). „Die Einbringung von Eigenmitteln in der Höhe von 10 Prozent der Gesamtprojektsumme ist erforderlich, kann [aber] auch durch eingeworbene Drittmittel erfolgen.“ (ebd., 6.4)“, s. archivamtblog, 13.10.2020, Link: https://archivamt.hypotheses.org/14553
Dem Vorspruch zu dieser Art von Veranstaltung wird jeder vernünftige Mensch gern zustimmen, aber er wird sich fragen, was das, was dann folgt, damit zu tun hat. Was hat die Bekämpfung von Populismus, Antisemitismus und Rassismus mit einer Darstellung militärischer Operationen, des militärtechnischen Instrumentariums aus militärtaktischer und -strategischer Perspektive und der Beschreibung von Frontbewegungen zu tun? Das ist der Stoff, an dem üblicherweise Militärliebhaber sich hochziehen, wie sie weit abseits von Friedens- und Antirassismusinitiativen und – bewegungen ihr seltsames Steckenpferd pflegen.
Der Vorspruch, er liest sich leider wie eine vorsorglich abgegebene Entlastungserklärung gegen den zu erwartenden Vorwurf der vergangenheitspolitischen Blindheit, des Militarismus und des falschen Heroismus.
Viel Vergnügen bei dieser Art des „geschichtlichen Lernens“ an den Standorten der Geschütze, der Route der Panzer und in Betrachtung der Orte der MG-Nester der „12. Volksgrenadierdivision“, sprich der letzten zusammengekratzten Reste des NS-Militärs.
Pingback: Video: Otto Piene – Lichtballett | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 4.10. – 18.10.2020 | siwiarchiv.de
Pingback: Friedrich Vorländer (1792 – 1869) – 1. Haubergsoberförster im Kreis Siegen. | siwiarchiv.de
Pingback: Friedrich Vorländer (1792 – 1869) – 1. Haubergsoberförster im Kreis Siegen. | siwiarchiv.de
Pingback: Video: Vortrag “ Zur Geschichte des Unteren Schlosses“ in Siegen | siwiarchiv.de
Zur Problematik „digitalisierter Archivbestände im NRW-Archivportal“ s. https://archivamt.hypotheses.org/14566
Pingback: ARD Retro startete heute in der ARD Mediathek | Archivalia
Pingback: Nachbetrachtungen zu den „Zeitzeugen auf Zelluloid“ | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 19.10. – 31.10.2020 | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik Oktober 2020 | siwiarchiv.de
Pingback: Archivportal-D: Archivgut, Archive und die Weimarer Republik (neu) entdecken | siwiarchiv.de
Pingback: Video: Brasilien und Nassau – | siwiarchiv.de
Als ausgesprochener Rechtsausleger seiner Partei sehr umstritten.
Daher auch der der Link auf den Wikipedia-Eintrag zu Reinhardt.
Pingback: Wilhelm Hyazinth von Nassau-Siegen – Zeugenverhör aus dem Hessischen Hauptstaatsarchiv Wiesbaden | siwiarchiv.de
Pingback: Neue Informationen zur Gedenkstunde am „Platz der Synagoge“ | siwiarchiv.de
Danke, TW. Und heute vor 12 Jahren die Umbenennung des Kreuztaler Gymnasiums.
Was für eine Synchronizität!
Danke!
Pingback: „Netpher Kalender“ 2021: „Netphen . . . bedeutende Unternehmen, so wie die früher waren.“ | siwiarchiv.de
Ja, danke!
@ Joe Mertens
@ Torsten Thomas
Gern geschehen! Hoffentlich können wir im kommenden Jahr den 80. Todestag angemessen miteinander begehen.
Dafür komme ich auch nach Siegen!
Ein Hinweis auf die Ausstellung und die Publikation als Kulturtagestipp der siwikultur:
Pingback: Nach dem Relaunch ist vor dem Relaunch – eine Kritik zum überarbeiteten Archivportal „Archive in NRW“ | archivamtblog
Pingback: Fotoeindrücke zur Gedenkstunde am „Platz der Synagoge“ | siwiarchiv.de
Die Broschüre kann zurzeit wegen des Relaunchs des NRW-Archivportals nur unter diesem Link aufgerufen werden: https://docplayer.org/19074726-Die-urkatasteraufnahme-in-westfalen.html
Nach Hilchenbach-Lützel
Leider nein…..
In ihren Stall nach Volnsberg.
Weil heute heute ist – ich kann da meine Herkunft nicht verleugnenen – , hätte ich den ersten Teil der Antwort ohne Ortsangabe als Lösung gelten lassen. Aber so, muss ich leider auf die korrekte Ortsangabe bestehen.
zu ihrem stall in wilgersdorf
Leider nein …..
Video der Gedenkveranstaltung:
Nach Helberhausen
Es ist auch nicht Helberhausen.
Gosenbach
Nein, es ist auch nicht Gosenbach.
Die gehen in den Stall nach Oberdielfen.
Oberdielfen ist es auch nicht.
Langenholdinghausen
Herzlichen Glückwunsch! Diese Antwort ist richtig.
Der Bildindex für Kunst und Architektur enthält eine Ansicht der Stadt Siegen, die Dilichs, Hessische Chronica, Kassel 1605, entnommen ist: https://www.bildindex.de/document/obj20659694?medium=mi02914d14 Ein Vergleich ist m.E. lohnenswert.
Pingback: Online: Stammbaum der Familie Delius westfälischen Zweiges 1604 – 1906 | siwiarchiv.de
Pingback: Wikipedia-Artikel zu Friedrich Christian Vogel (1800 -1882) | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 1.11. – 15.111.2020 | siwiarchiv.de
Zur Biographie des Schulgründers s.:
Bundesarchiv
R 9361-V/14469 Sammlung Berlin Document Center (BDC): Personenbezogene Unterlagen der Reichskulturkammer (RKK), Bode, Adolf, Dr.Geburtsdatum: 13.10.1915
R 73/10353 Deutsche Forschungsgemeinschaft (Aktenzeichen Bo 1/04/1), Bode, Adolf, Dr., Geburtsdatum: 13.10.1915
Enthält : Forschungsstipendium für die Zeit vom 1.12.1942 bis zum 31.3.1943 für Untersuchungen über den amerikanischen Humanismus und das deutsche Geistesleben (Das Stipendium wurde von den Professoren Wolfgang Schmidt, Englisches Seminar der Universität Bonn und Friedrich Schönemann, geb. 30.5.1886, Amerika-Abteilung des Englischen Universitätsseminars Berlin, befürwortet.), Berlin, z.Zt. Luftgaukomando III/IV Stabskompanie, Berlin-Dahlem, Philosophie.- Stipendium, 09.12.1942; Verlängerung des Forschungsstipendiums für die Zeit vom 1.4.1943 bis zum 30.11.1943 für Untersuchungen über den amerikanischen Humanismus und das deutsche Geistesleben , Bonn, 1. Sprachmittler-Abteilung d. Lw., Philosophie.- Stipendium, 30.04.1943 ….
Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein, 2. 08.1.1 (Referat Kommunikation und Steuerung), A 182, Bundesverdienstkreuze, 29.12.1982 – 04.11.1983
Ein Blick in die Ordensakte des Kreisarchivs ist leider wenig ergiebig – sowohl in Hinblick auf die Schulgeschichte (lediglich Kopien einen Ausarbeitung Alfred Lücks zum 25jährigen Bestehen der Schule) noch in Hinblick auf die Biographie des Schulgründers.
Auf Anregung des Siegerländer Heimat- und Geschichtsverein erhielt Dr. Adolf Bode 1984 das Bundesverdienstkreuz am Bande. Aufgrund der Orientierung der Schule an den Bedürfnissen der regionalen Eisen- und Hüttenindustrie wurde auch seine kulturgeschichtliche Beschäftigung, insbseondere die Studienfahrten in ehemalige nassauische Gebiete, geehrt. Auch seine berufsständischen Aktivitäten – als Gründungsmitglied Aufbau des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen e. V. im Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer seit 1955 sowie als Leiter des Referates „Berufsausbildung“ im Landesverband von 1970 bis 1976 – finden in der Ordensbegründung Erwähnung.
s. a. „Siedhoff-Buscher, Alma“ aus der Datenbank der Forschungsstelle für Biografien ehemaliger Bauhaus-Angehöriger (BeBA). URL: https://bauhaus.community/gnd/120060663 (Abrufdatum: 17.11.2020)
Ich denke gern an die Englischkurse bei Dr. Bode und seiner Frau zurück. Besonders ist mir meine erste, selbst verdiente Gruppenreise 1963 mit ihnen nach London in Erinnerung geblieben. Es war eine gut organisierte, mit vielen Besichtigungen verbundene Studienfahrt. Der Besuch bei den Ford-Werken in London Dagenham mit damals 55.000 Mitarbeitern bleibt unvergesslich. Alle Teile der Fahrzeuge (Traktoren und Pkw) wurden dort hergestellt. Das war die Zeit vor der „Just-in-time-Produktion“. Herr Dr. Bode führte uns im Britischen Museum zum Wielandkästchen und Mr. Bonner von der Bibliothek zeigte die 1150 verfasste Vita Merlini mit der Erwähnung von Siegen. Der Siegerländer Heimatverein hat 1961 aus den „Siegerland“-Blättern einen Sonderdruck herausgegeben: „Das erste Arbeitsbild zur Vorgeschichte des Siegerlandes – Anmerkungen zu einem Kunstwerk Hermann Kuhmichels von Dr. phil. Adolf Bode“. Die Broschüre ziert ein Foto des großformatigen Stickbilds mit sechs Szenen aus der Wielandsage, das im Haus der Siegerländer Wirtschaft hängt. Erstaunlich gut hat sich die Leuchtkraft der Farben erhalten. Ich bin gespannt auf den Sonderband der „Siegener Beiträge“.
Vielen Dank für die Schilderung nach über die Gruppenreise der Sprachenschule nach Großbritannien!
Via einer privaten Facebook-Gruppe kam der Hinweis, dass in der Zeit zwischen 1978 und 1983 ca. 15 weibliche Schülerinnen und ca. 4 männliche Schüler, die Schule beuschten. Neben den Fremdsprachen wurde auch Deutsch, Stenographie und Maschineschreiben vermittelt.
Die Zahl der SchülerInnen lag, auch in dem genannten kleinen Zeitraum, tatsächlich um ein Vielfaches höher. Wahrscheinlich ist hier lediglich 1 Klasse gemeint. Der Band enthält genauere Angaben.
Danke für die Präzisierung!
Ich habe in der Zeit von 1975-1978 meine Ausbildung an der Sprachenschule Siegerland (Tagesschule) gemacht. Noch heute erinnere ich mich an diese Zeit gern zurück und bin unendlich Dr. Bode und seiner Frau dankbar. Die Ausbildung verlangte viel Einsatz -aber es hat sich gelohnt. Dr. Bode und seine Frau haben uns nicht nur die Sprache gelehrt sondern vieles mehr, was ich in meinem Berufsleben anwenden konnte. Auch später hatte ich noch Kontakt zu den Beiden. Sie haben und werden immer einen besonderen Platz in meinem Leben haben.
Danke für den Kommentar!
Pingback: „Das Siegerland ist eine Welt für sich“ | siwiarchiv.de
Zu den abschließenden Pflanzarbeiten s. Stadt Siegen, Aktuelles, 20.11.20
Pingback: Literaturhinweis: Matthias Plaga-Verse: „Neupietismus im Nationalsozialismus | siwiarchiv.de
„Nationalgesinnt“ statt „nationalistisch“, da geht’s doch schon los mit der Beschönigung…
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 16.11. – 28.11.2020 | siwiarchiv.de
1) Ist das aufgrund der Verlagswerbung nicht etwas vorschnell?
2) Diskussionswürdig finde ich an der Werbung allerdings auch den Satz: “ …. Dennoch findet die Bedeutung der Gemeinschaftsbewegung in historischen Arbeiten zum Siegerland während des Nationalsozialismus bisher kaum Erwähnung. ….“ An weg mag dieser Sachverhalt liegen an der regionalen Zeitgeschichtsforschung oder an der Gemeinschaftsbewegung u. a. als Archivträger?
3) Ich denke, die Arbeit hat eine ausführliche Rezension verdient.
4) Schließlich hätte ich zu diesem Zweck eine hybride Publikation der Arbeit auf dem digitalen Punblikationsserver OPUS der Universität Siegen begrüßt.
Richtig muss es Güterschuppen heißen und nicht Güterlokschuppen. Der Lokschuppen befand sich nördlich vom Bahnhof, wo heute das Einkaufszentrum befindet.
Polizeigebäude an der Weidenauer Straße in Siegen
Korrekt!
Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Richtig – aber bedauerlicherweise zu spät.
Hallo Her Wolf, ist ein Blick aus dem alten Kreishaus auf den abgerissenen Seitenflügel, vielleicht den alten Sitzungssaal oberhalb des Seiteneingangs. Habe 1977 hier meine Lehre angefangen. Im Sitzungsdienst haben wir immer viel Spaß gehabt.
Leider nein!
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik November 2020 | siwiarchiv.de
Pingback: Freudenberg: Jens Benner bringt Gedächtnis der Stadt ins digitale Zeitalter | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Adventskalender 2/2020 | siwiarchiv.de
Die belgischen Streitkräfte?
Ich wäre sicher überrascht gewesen, wenn mir die belgischen Streitkräfte ein Fotoalbum geschenkt hätten. Es hätte zwar sehr schön zu einem hier vorgestellten Projekt gepasst – aber leider waren es nicht die „Belgier“.
Bewohner des Hauptdurchgangslagers für Vertriebene auf dem Wellersberg
Ebenfalls hätte ich mich über ein Album der Bewohnerinnen und Bewohner des Hauptdurchgangslager am Wellersberg gefreut – aber die Bilder stammen auch nicht von dort.
Der Stadtförster?
Wenn es der Stadtförster gewesen wären, dann hätte ich dieses Album sicher dem Stadtarchiv angeboten. Nein, es war nicht der Stadtförster.
Von der „Puddingschule“, deren Gelände auf den Fotos zu sehen sein könnte?
Kleingartenverein am Fischbacherberg
Wenn ich richtig gegoogelt habe, dann ist der heute auf dem Fischbacherberg existierende Kleingartenverein zu jung. Auch ein eventuell früherer Verein war nicht der Urheber der Bilder. Schließlich gilt auch hier: ein solches Fotoalbum hätte ich selbstverständlich dem Siegener Stadtarchiv überlassen.
Die Fotos stehen im Zusammenhang mit dem heutigen Berufskolleg AHS Siegen – vielleicht ein Schulgarten?
@Manfred Knoche
@Sven Panthöfer
Die korrekte Schulbezeichnung lautete „Mädchen-Berufs, Berufsfach- und Fachschulen Siegerland“ – soviel Zeit muss sein. Es handelte sich tatsächlich um den Schulgarten.
@alle
Aber was wurde dort angebaut? 2 Pflanzen sind mir bekannt, bei einer bin ich mir nur ziemlich sicher.
Auf Bild eins sind Tomaten, und Rahbarbar (nicht sicher aber eine andere Gartennutzpflanze mit so großen Blättern kenne ich nicht) zu sehen.
Bild zwei sieht nach Mais aus und das andere könnten aufgehängte Weizenähren sein zum trocknen?
Bei Bild eins habe ich auch die Tomaten erkannt und gedacht, dass diese auch rechts stünden – jedoch die Blätter der rechten Pflanze sind tatsächlich recht groß.
Das zweite Bild zeigt tatsächlich im Vordergrund Mais, Weizen ist es aber nicht.
Es ist scheint aber eine Pflanze die mit Getreide verwandt oder auch ist. Weizen ist es nicht, dann gibt es noch Gerste, Hafer, Roggen. Wenn das auch nicht zutrifft weis ich es nicht was es sein sollte.
Kein Getreide.
Übrigens könnte es sich zwischen Tomate und Rharbarber um Artischocke handeln? (Habe da zuerst an Distel gedacht …. :-) )
Da im Netz schon vermutet wurde, dass das erste Bild links eine Tabakpflanze zeigt, will ich ergänzen, dass das Fotoalbum nur noch Tollkische und Ricinusgewächse explizit benennt.
Das muss aber ein sehr nass-kalter Maibeginn gewesen sein. Die Bäume sind ja noch komplett ohne Grün und die Bekleidung ist auch noch eher winterlich.
Ja, das stimmt schon, würde ich als Rheinländer auch so sehen. Allerdings kann es durchaus ein wenig kälter sein – im Mai in Wittgensteiner Land. Auch das Grün der Bäume kann durchaus später sprießen.
Pingback: Zur Verehrung der Hl. Barbara im Siegerland | siwiarchiv.de
Auf Bild 2 könnte Flachs zum trocknen aufgehangen sein.
Flachs ist korrekt; immerhin war das Siegerland ja auch einmal eine Textilregion: http://www.siwiarchiv.de/siwiarchiv-adventskalender-7-2020/ . Jetzt fehlt nur noch eine Pflaze: Tollkirsche, Tabak und Ricinus stehen zur Auswahl.
Das müsste das Kreisaltersheim in Weidenau, so um 1952 etwa erbaut.
Blick vom Hardter Berg auf das Gebäude, worin heute das Studierendenwerk ist.
Gratulation! Sie haben gewonnen!
Berufsschule am Fischbacherberg.
Burkhard Schneider hat Recht, und der FotoGraf des 3. Bildes stand auf oder über der Straße „An der Höh“, von wo aus man die drei Häuser vorne rechts heute noch (fast) unverändert vorfindet!
Die Häuser selbst sind in der Ludwigstraße 25-35
Der jetzige Emmy-Noether- Campus
Ich vermute, dass sich hier der Heimatverein Holzhausen in seiner Einschätzung des Standortes des Gasthof Frank irrt. Man vergleiche die auf der Postkarte (im Hintergrund rechts) abgebildete Kirchturmspitze und den Kirchturm der ev. Kirche in Holzhausen-Burbach: http://geo.hlipp.de/photo/39218
M. E. hat der Ort Holzhausen-Bad Laasphe niemals eine Kirche besessen! Deshalb muß der Gasthof Frank in Burbach-Holzhausen gestanden haben.
Pingback: siwiarchiv-Adventskalender 7/2020 | siwiarchiv.de
In Bild 1: links Tabak, dann eine Artischocke, rechts Tomaten
In Bild 2: im Vordergrund Mais und aufgehängter Flachs
Bei Bild 1 kann ich mit Tabak noch nicht so ganz leben. Im Album sind noch folgende „Nutzpflanzen“ abgebildet:
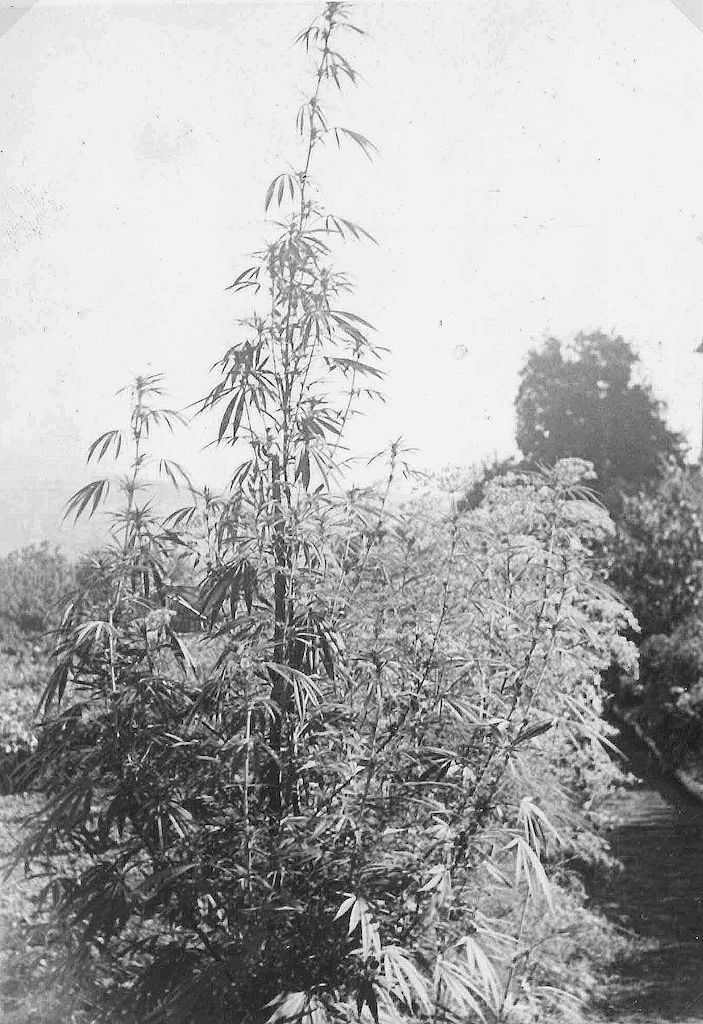
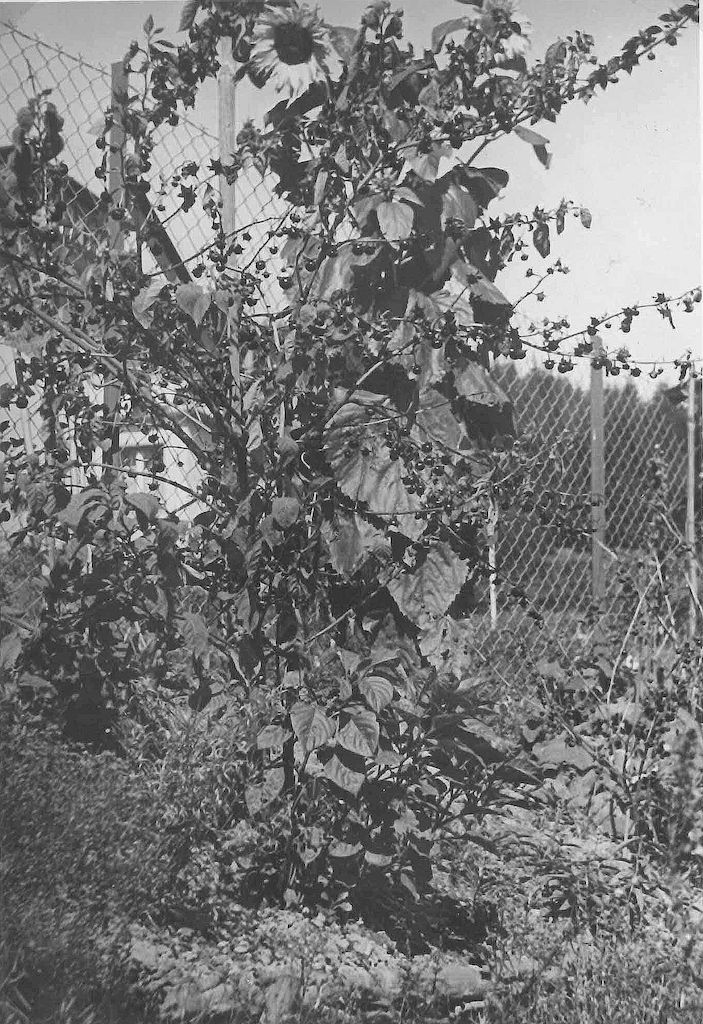

Hanf
Tollkirsche
Ricinus
Hilchenbach-Lützel, links das Schulgebäude
um 1950
Leider nicht das richtige Jahrzehnt
Korrekt!
Manfred Knoche belegt mit 2 Bilder, dass die Antwort von Burkhard Schneider wohl stimmt:
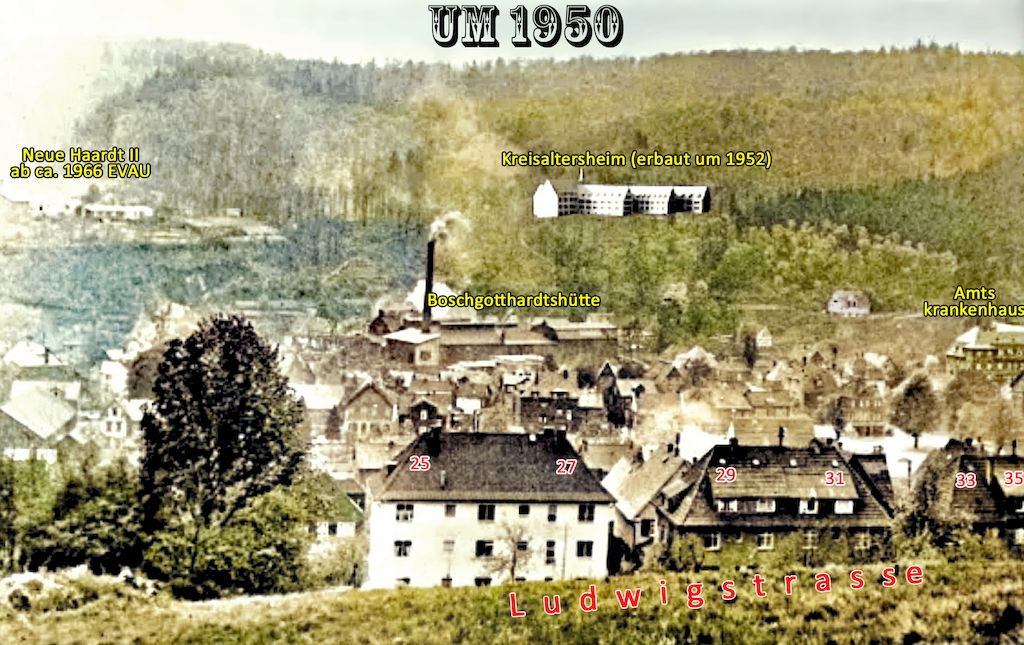
 .
.
Hmmm! Die Lösung stimmt leider nicht mit den Erschließungsangaben der vom Hochbaumt an das Kreisarchiv abgegebenen Glasnegative, die dankenswerterweise von den Kolleginnen im Stadtarchiv Kreuztal digitalisisert wurden, überein. 2 der Bilder zeigen deutlich das Kreisaltenheim.
Beim obersten Bild bin ich mir allerdings nicht sicher, ob die Angaben, die hier vorliegen nicht doch stimmen, so dass das Rätsel in eine 2. Runde geht.
Hallo!
Ich denke auch, dass es sich um das ehem. Kreisaltenheim im Tiergarten Weidenau handelt.
Wenn man das Fabrikgebäude auf Bild 1 mit den anderen beiden Fotos sowie den Belegfotos von Herrn Knoche vergleicht, finde ich sieht man das recht deutlich. Der überspitzte Giebel der rechten Fabrikhalle und auch der schmale längliche Aufsatz auf dem linken Fabrikdach sprechen dafür. Ebenso der Blickwinkel auf das Altersheim.
Demnach müsste das Foto auf der gegenüberliegenden Seite der Ferndorf geschossen worden sein(Herrenfeldstraße).
Allerdings würde mich interessieren welche Angabe das Hochbauamt denn dazu gemacht hat und freue mich auf die endgültige Auflösung.
LG
Ich komme mit dem Horizont des ersten Bildes nicht so ganz klar. Mir scheint, dass das Gebäude dort auf einem „Bergrücken“ gebaut werden sollte.
…was Herr Burkhard Schneider sagt :)
Glückwunsch an der Stelle!
LG
1930er
das erste bild wurde zur optischen hervorhebung des
gebäudes bearbeitet, der tiergarten im hintergrund wurde nahezu entfernt, um so die umrisse des planvorhabens zu verdeutlichen.
Einverstanden! Meine Irritation rührte daher, dass die Aufschrift auf dem Umschlag, mit dem die Glasnegative dem Kreisarchiv übergeben wurden lediglich die Lungenheilstätte Eiserfeld-Hengsbach erwähnen. Zudem zeigen einige der Negative auch Modelle für die Lungenheilstätte.
Zur Geschichte der Heilstätte s. diverse Einträge auf siwiarchiv: http://www.siwiarchiv.de/?s=Heilst%C3%A4tte+Hengsbach&submit=Suchen
Hilchenbach Lützel, Kronprinzenstraße 15 „Neue“ Schule von 1902, heute Dorfgemeinschaftshaus.
Die alten Stromleitungen deuten auf die 1940er Jahre
Noch nicht das richtige Jahrzehnt ……
Hier ein paar Daten zum Kreisaltersheim:
Am 2.10.1951 war die Grundsteinlegung durch Landrat Büttner.
Am 30.03.1952 konnte Richtfest gefeiert werden.
Später baute man links hinter dem Gebäude ein Schwesternheim, am 31.08.1952 konnte dort Richtfest gefeiert werden.
Mehr zum Kreisaltenheim: http://www.siwiarchiv.de/sigrid-rapp-ridder-von-baracken-zu-einem-festen-alters-und-pflegeheim-2/
Habe jetzt mal im Internet nach den Blättern gesucht, und bin zu dem Schluss gekommen das auf Bild 1 links weder Tabak, Tollkirsche, Rizinus noch Artischocke abgebildet ist. Tabak hat spitz zulaufende Blätter und die sind relativ glatt, die Tollkirsche hat kleinere Blätter und beim Rizinus sind die Blätter eher sternförmig, Artischocke hat sehr stark gekräuselte Blätter, zumal ich nicht glaube das diese damals schon angebaut wurden.
Meiner Meinung nach ist auf Bild 1: Tomaten, links Rhabarber und in der Mitte eventuell noch der Hanf, aber nicht genau sagbar weil es nicht so gut erkennbar ist.
Bild 2: Mais und aufgehängter Hanf
Vielen Dank für die Hartnäckigkeit! Also Rharbarber habe ich ein wenig bodennäher in Erinnerung, aber ich bin da nicht so sattelfest. Beim zweiten Bild handelt es sich um zum Trocknen aufgehängten Flachs. Dies ist wenigstens sicher, denn so lautet die Bildunterschrift im Fotoalbum.
Rhabarber wird mit wachsendem Alter hoch und es wird ein schwerer Busch draus. Wenn man Glück hat und es kommt auf die Sorte an. Das ich Hanf geschrieben habe war ein versehen, ich meinte aber Flachs.
Hilchenbach, Wilhelmsburg (Stadtmuseum/-archiv). Zur Datierung könnte
a) die Verlegung des Haupteingangs vom Hauptgebäude in den Seitenflügel
b) die Entfernung der Mauer in der Bildmitte
herangezogen werden.
Genau! Dies wären Ansätze um eine Datierung vorzunehmen. Eventuell handelt es sich ja auch bei der Person um eine mehr oder weniger bekannte Persönlichkeit, so dass man anhand deren Lebensdaten eine ungefähren Zeitraum bestimmen kann.
Na gut! Ich habe eine Postkarte von 1957 gefunden, da waren die Bäume vor der Schule noch deutlich kleiner, demnach sollte das Foto Mitte der 60er gemacht worden sein …
Dem Bild angemessen würde ich sagen, dass dieser Lösungsvorschlag deutlich kälter ist.
Pingback: „Siegerländer Intelligenz-Blatt“ ist online einsehbar | Archivalia
Kriegswinter 1945
Korrekt!
Pingback: Projekt „Zeit.Raum Region – Das neue Siegerlandmuseum“ der Stadt Siegen mit zweitem Stern ausgezeichnet | siwiarchiv.de
Pingback: LWL-Medienzentrum: Online als Episoden – Dokumentarfilm „Als die Amerikaner kamen“ | siwiarchiv.de
Hilchenbach/Vormwald – Blick von der Wilhelmsburg auf die Sterzenbacher Str., 1920er Jahre
Allenbach, Bau der Breitenbach-Talsperre, 1953-1957
Korrekt!
Die Ortsangabe ist schon einmal richtig …..
Doch kein Rharbarber? Via E-Mail erhielt ich folgenden Hinweis: “ ….. Die Blattform deutet auf eine Brassica-Art hin. Ich vermute Brassica oleracea var. ramosa (Baumkohl, Strauchkohl, Ewiger Kohl, Tausendköpfiger Kohl) – eine alte und früher populäre Gemüsesorte, die mit der Zeit so üppig werden kann wie das abgebildete Gewächs. Auch die Mischkultur in Nachbarschaft mit Tomaten wird aus gärtnerischer Sicht empfohlen. …..“
Ob folgender, via E-Mail eigegangene Tipp zur Datierung hilft: “ …. Für die Ausstellungs-Datierung bietet natürlich das „S“ in Form der Sig-Rune (drittes Bild) einen Anhaltspunkt. ….“
Pingback: Video zum Gedenken an Bruno Kappi | siwiarchiv.de
Pingback: Literaturhinweis: „Die Tagebücher der Luise Niederstein geb. Dresler für ihren Sohn Werner“ | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 29.11.2020 – 15.12.2020 | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Adventskalender 18/2020 | siwiarchiv.de
Im Universitätsarchiv Göttingen befinden sich unter der Signatur Kur. 8412 Personalakten Banfields aus seiner Lektorentätigkeit (16.10.1828-25.05.1833).
Im Landeshauptarchiv Koblenz befindet sich im Bestand Bezirksregierung Koblenz folgen Sachakte under Nr.17665 „Anlage einer Kobalt-Aufbereitungsanstalt auf der Madersbacherhütte durch Thomas Banfield in Siegen (1846-1851).
Im Bayrischen Hauptstaatsarchiv München befindet sich im Bestand „Gesandtschaft London“ unter der Nr. 515 folgender Aktenband „Banfield, Thomas, vormals Bibliothekar des Königs Max II. von Bayern, Unterstützung seiner Hinterbliebenen.“ (1856).
Hallo, es handelt sich hier vermutlich um Katasterunterlagen des Kreises auf Mikrofiche. Diese sind nach Flurstücken geordnet.
Dies ist die richtige Antwort! Beweisfoto:
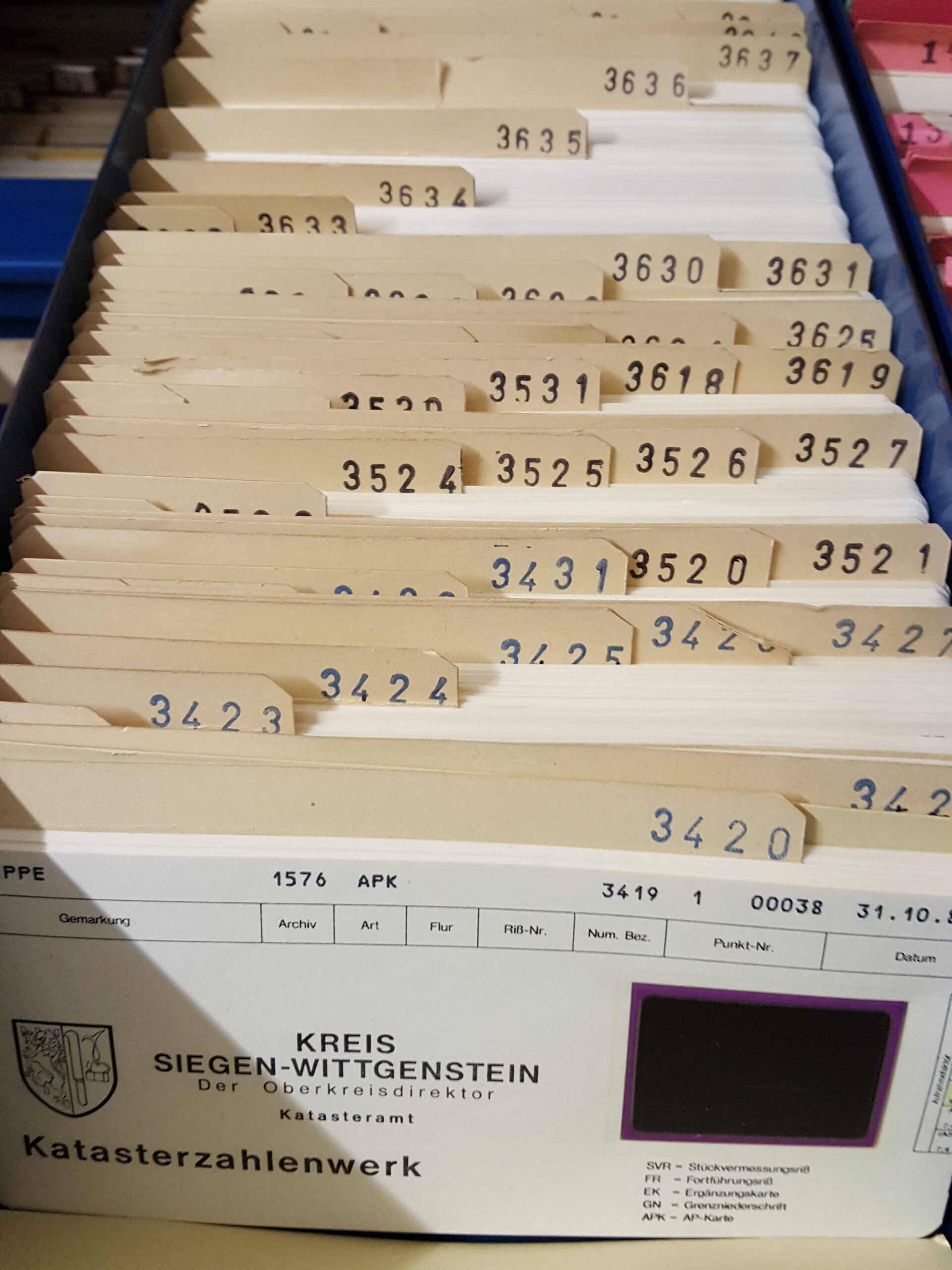
Ich würde auf ein Lautarchiv z.B. vom Radio tippen:
Wie komme ich an einen Aufsatz von Otto Bäumer in FiZ 1972, Nr. 3 S. 7 -13?
Pingback: 2 oral-histoy-Videos zur Flucht von Ostreußen bis nach Siegen | siwiarchiv.de
Pingback: Archivnachrichten aus Hessen 2020/2 online – Archivalia
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 16.12. – 28.12.2020 | siwiarchiv.de
Pingback: GEPRIS Historisch – Infoportal der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zu Forschung und Forschungsförderung von 1920 bis 1945 | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik Dezember 2020 | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Jahresstatistik 2020 | siwiarchiv.de
Pingback: „Siegerland“ Band 97, Heft 2 (2020) erschienen | siwiarchiv.de
Das Heft ist aktuell erhältlich bei: Bücher buy Eva in Hilchenbach, Mankel Muth in Kreuztal und Weidenau, Alpha in Siegen, Weinaug in Netphen und Braun in Neunkirchen. Unter Beachtung der Corona-Schutzmaßnahmen kann es auch bei Wilfried Lerchstein in Netphen-Grissenbach im Heideweg 6 an der Haustür abgeholt werden nach vorheriger Terminvereinbarung unter 02737/209527 oder lercwi@web.de .
Hallo,wo kann man noch die DVD Der Eisenwald
bekommen .
Mfg
R.Sting
s. https://www.57lesershop.de/sortiment/musik-film/
Für die kritische Durchsicht der biographischen Angaben Meydenbauers gebührt Albrecht Grimm Dank!
Mit den Bemühungen um die Gestaltungssatzung in der Wenschtsiedlung und dem Programm „Stadtumbau West“ ab 2008 rückte das Wohnumfeld der Gartenstadt in den Fokus. Im Bezirksausschuss Siegen-Geisweid wurde 2014 von der SPD-Fraktion nach dem Spielplatz: „Teich mit drei Tieren“ unterhalb des Hauses Wenschtstraße 63 gefragt, wem die Anlage gehört, wer die Figuren schuf, ob sie denkmalwürdig seien. Der Stadtverwaltung war die städtische Anlage aufgrund ihrer versteckten Lage erst seit geraumer Zeit bekannt. Der LWL zeichnete Ende Mai 2015 den Spielplatz als Denkmal des Monats aus und nannte als Künstlerin Ruth Fay (1923-2008). Zu dieser Annahme hatte möglicherweise das Beton-Nilpferd von Ruth Fay geführt, das noch von ehemals zweien beim Kindergarten am Fischbacherberg übrig geblieben ist. Im vergangenen Jahr meldete sich die Landschaftsarchitektin Jutta Curtius, Nettetal, und stellte richtig, dass die Figuren Ente – Seehund – Schwein von dem Künstler Clemens Pasch (*1910 in Sevelen am Niederrhein, †1985 in Düsseldorf) geschaffen wurden. Er hatte mit den Figuren 1960 einen Wettbewerb einer Bonner Baugesellschaft gewonnen. Das Bonner Ensemble existiert nicht mehr, das in Dortmund ist erhalten geblieben.
Die Renovierung des Dr.-Dudziak-Parks wurde Ende vergangenen Jahres abgeschlossen.
Zur Unterschutzstellung des Spielplatzes s. a. http://www.siwiarchiv.de/der-ehemalige-kinderspielplatz-in-der-siedlung-vorderes-wenscht-in-siegen/ – dort auch ein Link zu Ruth Fay. Zu Clemns Pasch s. https://de.wikipedia.org/wiki/Clemens_Pasch
Pingback: Video (engl.): Reingung des Gemäldes „Eine Herbstlandlandschaft mit Blick auf Het Steen am frühen Morgen“ von Peter Paul Rubens | siwiarchiv.de
Pingback: Archivgut to go? – Archivalia
Pingback: Nachkassation – warum diskutieren nur Archivierende über dieses Thema? | siwiarchiv.de
s. a. Karl-Heinz Keldungs: NS-Prozesse 1945 – 2015. Eine Bilanz aus juristischer Sicht, Düsseldorf, 2020, S. 397
Conze, Eckart/Frei, Norbert/Hayes, Peter/Zimmermann, Moshe: Das Amt und die Vergangenheit. Deutsche Dipomaten im Dritten Reich und in der Bundesrepublik, München 2010, S. 19, 234, 316, 356f, 360, 412, 474f, 576, 578, 612f. 654, 663, 671, 681, 683ff., 690
s. a. Karl-Heinz Keldungs: NS-Prozesse 1945 – 2015. Eine Bilanz aus juristischer Sicht, Düsseldorf, 2020, S. 112
Pingback: Online: Fr. Otto Groos: „Als der Grossvater die Grossmutter nahm. | siwiarchiv.de
Spuren des Borkenkäfers
Leider nein.
Wenn ich es mir nun noch einmal in Ruhe auf einem großen Bildschirm ansehe, dann ist mir meine Antwort fast peinlich.
Tröste es Sie, dass Sie nicht alleine waren? Auf FB wurde diese Vermutung ebenfalls geäußert.
Ein Höhenprofil unseres Landkreises?
Es handelt sich um ein großes Gemälde, das reliefartig Berge und Täler des Kreises Siegen-Wittgenstein darstellt.
Höhenschichtmodell des Kreisgebietes
Gratulation! Die Antwort ist korrekt: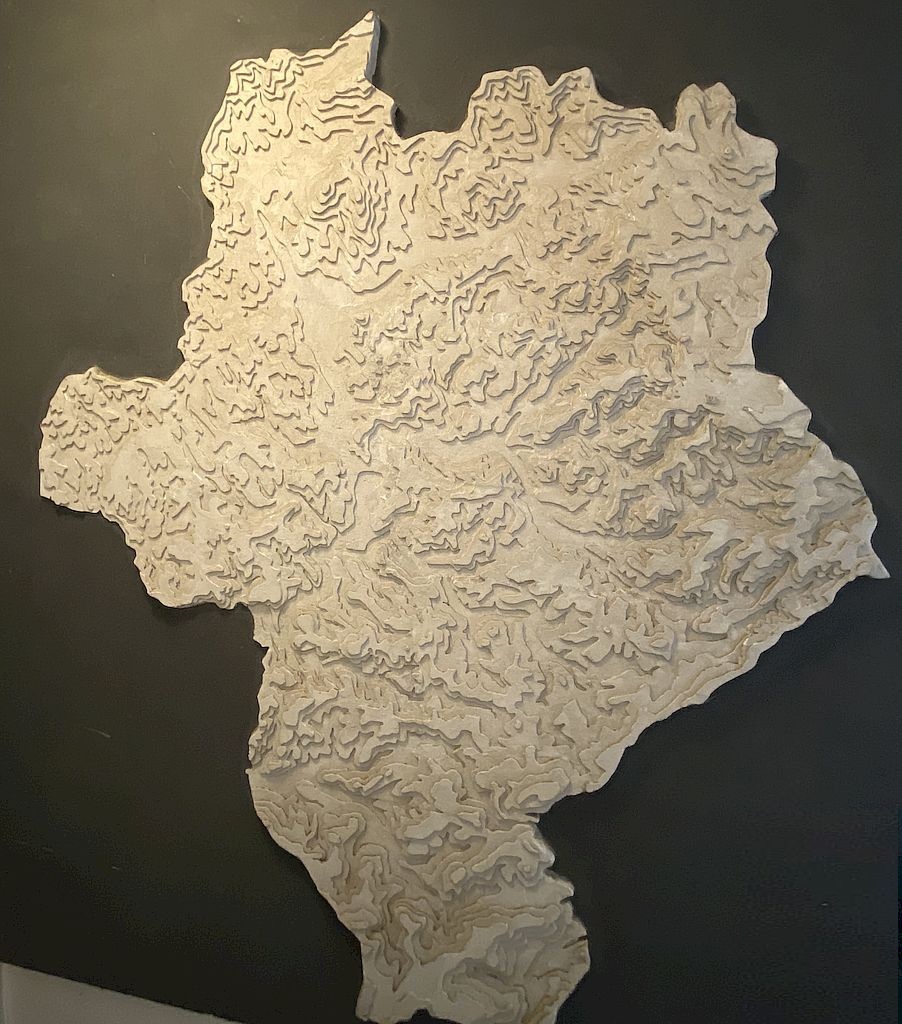
Das Relief wurde im Zusammenhang mit dem Nachlass Flosdorf übernommen. Unklar ist noch, in welchem Zusammenhang es entstanden ist (z.B. Siegerlandschau?)
Pingback: Absage des Siegener Forums am 21.01.2021 | siwiarchiv.de
Pingback: Archive im Kulturgesetzbuch NRW – Archivalia
Nur Altkreis Siegen!
Danke für den Hinweis! Würde dann für eine Erstellung vor 1975 sprechen oder das irgendwo noch ein Relief des Altkreises Wittgenstein existiert …..
Pingback: „Ich sage Ihnen alles, was ich weiß.“ Wilhelm Voss im Verhör 1946/1947. | Abgehört
War heute etwas zu spät auf dieses Rätsel gestossen.
Ich habe dieses Relief im Hause vom Herrn Flosdorf gezeigt bekommen, ich durfte 2 x dort mit ihm ein Interview führen. In seinem Wohnzimmer, in dem ein Flügel und eine riesengrosse Bücherwand stand, unterhielten wir uns über seine Tätigkeit und über das Leben in Siegen zu der Zeit.
Ebenso vom Balkon seines Bungalows durfte ich ins Tal hinunter Aufnahmen machen, eine Position für Fotografen, die von sowas träumen. Ohnehin ist die Steinstraße sehr gut für Fotoaufnahmen geeignet.
Vielen Dank für diesen kleinen Bericht! Leider wissen wir noch nicht viel über den Baurat, so dass jede Information für uns hilfreich ist.
Habe ein Bild (Landschaft – tanzende Mädchen im Wald) ) gemalt von
Willi Schütz, in der Gefangenschaft 1952. Das Bild hat noch den einfachen Rahmen aus der Gefangenschaft.
Mein Vater (Hubert Henke), ein Freund und Mitgefangener im Lager Workuta brachte es 1955 bei seiner Heimkehr mit.
Mein Vater war zum Tode verurteilt und zu 25 Jahren begnadigt worden.
Das letzte mal wo sich die beiden trafen, nach meiner Erinnerung, war eine Ausstellung im Sauerland-Museum in Arnsberg.
Siehe oben
Es ist sonst nicht meine Art, mich nicht für die Erinnerungen hier zu bedanken. Daher entschuldigen Sie bittemein Versäumnis, Herr Henke.
Pingback: #Archiverinnerungskultur – eine nicht nur archivische Blogparade | siwiarchiv.de
Pingback: #Archiverinnerungskultur – eine nicht nur archivische Blogparade – Archivalia
1.7.1919 endgültig im Volksschuldienst angestellt, Brungerhausen (?)
Gebürtig was Warzenbach, hat die Tochter des Hegemeister Schenk geheiratet. In dessen Haus hat der eine zeitlang in Bungershausen gewohnt.
War bei den Warzenbächern, ich sage es mal so; Ach nicht gerade beliebt.
Pingback: Blogparade zum Thema der #Archiverinnerungskultur | digithek blog
Pingback: Virtuelle Heimatsammlungen NRW gingen online | siwiarchiv.de
Pingback: Virtuelle Heimatsammlungen (Vertriebene) NRW online – Archivalia
Ein Zufallsfund:

Alfred Fissmer, Standbild aus dem Film „Siegen wird Garnisonstadr. Einzug der Soldaten am 16.10.1935“ des Fotostudios H. Schmeck (KrA SIWI 4.1.5./104)
Darf ich Sie höflich darauf hinweisen, dass ich einen Nachruf auf Herrn
Professor Dr. Dr. h.c. mult. verfasst habe:
1. ,,Ein lauterer Geisteswissenschaftler mit weitem Horizont. Zum Tode von Artur Woll, eines geistig-politisch unabhängigen und unbestechlichen Gelehrten.“ Fakultät III der Universität Siegen;
2. Eine aufrechte Autorität mit weitem Horizont. Zum Tode von Artur Woll,
einem Meister wirtschafts- und sozialwissenschaftlichwr Analytik. In:
Querschnitt. Die Zeitung der Universität Siegen, Nr. 1/2020.
Freundlich grüßt Sie, sehr geehrte Damen und Herren, Bodo Gemper.
s. a. Gerhard Kötter, „Alfred Fissmer – Bürgermeister der Stadt Siegen von 1919 bis 1945 ….. Mitläufer … Mitwisser … Verwalter“, Link: https://gerhard-koetter.de/?p=18846 (Aufruf: 19.1.2021)
s. dazu auch Klaus Graf „Schließung der wissenschaftlichen Bibliotheken in Bayern vermutlich unverhältnismäßig“, Archivalia, 19.1.2021, Link: https://archivalia.hypotheses.org/129061 (Aufruf 20.1.2021)
In die Trägerschaft dieser coronabedingt leider notleidenden Veranstaltung sollten m. E. mindestens die Vereinigung der Verfolgten des NS-Regimes (VVN-BdA) und das Aktive Museum Südwestfalen (AMS) mit einbezogen sein, um die Reichweite und damit die öffentliche Aufmerksamkeit zu erhöhen. Es geht doch immer auch darum, durch Zusammenarbeit eine Wirksamkeit zu verbessern.
Pingback: Wittgenstein Heft III (2020) erschienen | siwiarchiv.de
Pingback: Literaturhinweis: Klaus Gietinger: „Blaue Jungs mit roten Fahnen. Die Volksmarinedivision 1918/19“ | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 11.1.2021 – 23.1.2021 | siwiarchiv.de
Pingback: Neue evangelische Kirchenbücher bei Archion: Wilnsdorf und Wingeshausen | siwiarchiv.de
Pingback: „Siegener Beiträge. Jahrbuch für regionale Heschichte“ Band 25 (2020) erschienen | siwiarchiv.de
Pingback: „Siegener Beiträge. Jahrbuch für regionale Geschichte“ Band 25 (2020) erschienen | siwiarchiv.de
Pingback: "Remembering is the guarantor of democracy"
2011 erstellte das Kreisarchiv eine Materialsammlung zu Otto Marloh, die als PDF für die weitere biographische Forschung hier zur Verfügung gestellt wird
Pingback: "Remembering is a guarantor of democracy" - DeasileX
Pingback: Young People Remember | Memorials as digital places of learning – reviewer4you
Pingback: Young People Remember | Memorials as digital places of learning | The New York Press News Agency
Meine Mutter hat ein Ölgemälde von Vogt. Würden gerne wissen ib es was wert ist.
Interessant aus der Sicht eines NRW-Kreisarchivs ist das Gefälligkeitsgutachten zum Eigentum am Archivgut der preußischen Landratsämter. Denn es besteht ein grundsätzliches Interesse der inzwischen fast vollständig fachlich besetzten Kreisarchive an den Landratsamtsbeständen; dafür liegen allerdings keine rechtlichen Gründe vor, sondern die Kreisarchive verstehen sich hier vornehmlich als Sprachrohr ihrer Nutzenden. Wenn man 150km und mehr zum zuständigen Landesarchivs fahren muss, fördert dies nicht eine von allen gewünschte citizen science. Insofern hätte ich mir einen Beitrag zur Digitalisierungstrategie des Landesarchivs NRW für die preußischen Landratsamtsbestände gewünscht und für sinnvoller gehalten.
Allerdings einen juristischen Streitpunkt umgeht der Text aber beinahe charmant: “ …. Daneben hatte auch der Kreisausschuss Aufgaben der allgemeinen Landesverwaltung wahrzunehmen (§ 75 KreisO). Deswegen bestand und besteht staatliches Eigentum möglicherweise auch an den Akten der Kreisausschussregistratur. Darüber gibt es zurzeit aber keinen Streit, und dieser Punkt ist für die hier interessierende Fragestellung ohne Belang. ….“ (S. 310) Eben dies ist aus Kreisarchivsicht sehr wohl strittig und hätte daher ausführlich behandelt werden sollen!
Das Stadtarchiv Siegen, wo man die Broschüre sonst immer abholen konnte, ist ja z.Z. geschlossen. Falls das KrönchenCenter-Gebäude selbst zugänglich sein sollte, könnte man ja nach vorheriger Terminabsprache einen Abholtermin an der Eingangstür zum Stadtarchiv vereinbaren, ähnlich wie dies derzeit viele geschlossene Ladengeschäfte auch organisiert haben.
Dieser Vorschlag ist gegenwärtig nicht zielführend!
In der heutigen (!) Print-Ausgabe der Siegener Zeitung erschienen unterder Rubrik „Heimatland“ zwei Artikel Herbert Bäumers zu Alfred Fissmer. Während sich der Artikel „Der visionäre Bürgermeister“ der Urheberschaft Fissmers an der Idee eines Siegbergtunnels widmet, stellt der Artikel „Betonbauten gegen Bomben“ die Geschichte des Bunkerbaus in Siegen, Weidenau, Klafeld und Kaan-Marienborn dar. Ein weiterer Artkel zu r Bautechnik undAusstattung der Bunker ist angekündigt.
Alfred Fissmer [unter der Hankenkreuzfahne ?], Standbild aus dem Film „Gebirgsfest am 4. Juni 1939 in Siegen“ (KrA SIWI 4.1.5./300)
Pingback: Wikipedia-Artikel zu Frieda Claudy (1880 – 1946) | siwiarchiv.de
Vielleicht auch in diesem Forum: Schön, dass Ihnen der Artikel aufgefallen ist. Er ist Ergebnis einer mehr als halbjährigen Recherche in den Archiven. Außerordentlich hilfreich war die Online-Verfügbarkeit der meisten Jahrgänge des Kreisblatts bis Mitte 1933. Dazu standen mir etliche Beilagen der Wittgensteiner Zeitung bis 1944 zur Verfügung. Wenn auch die Pandemie die Einsichtnahme des Wittgensteiner Kreisblatts von 1939 bis 1945 bisher verhindert hat, so konnten doch inzwischen 152 Gedichte von Claudy gefunden werden. Daher wird im Frühjahr ein Gedichtband mit Anmerkungen zum Leben der Dichterin herausgegeben werden.
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik Januar 2021 | siwiarchiv.de
Pingback: Young People Remember | Memorials as digital places of learning
Pingback: Video: Einführung in die Familienforschung – Archivalia
Unser Beitrag zur Blogparade:
http://www.archiv.rwth-aachen.de/2021/02/03/das-gestern-das-heute-das-morgen%ef%bb%bf/?fbclid=IwAR1DYgQLwWLGw45rpmEqCDQj9EhS2jqa26u-r8O1KtDloaEZRHPkkZ6axVw
Ein bemerkenswerter Schritt nach vorne, der leider sehr lange auf sich hat warten lassen, nun aber wirklich mehr als ein kleiner Start ist. Besonders als nicht im Siegerland wohnender Historiker freue ich mich nun über den erleichterten Zugriff auf Archivalien und Drucksachen. Einen großen Dank an alle Beteiligten im Stadtarchiv Siegen! Ich bin schon sehr gespannt, wie es in den kommenden Jahren mit dem Ausbau des digitalen Angebotes weitergehen wird.
Pingback: Familienforschung in digitalisierten Kirchenbüchern | siwiarchiv.de
Pingback: Stadtarchiv Siegen stellt viele Digitalisate online – Archivalia
Hier findet sich eine Literaturliste zur Sport- und auch zur Turngeschichte im Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein: http://www.siwiarchiv.de/geschichtswettbewerb-des-bundespraesidenten-bewegte-zeiten-sport-macht-gesellschaft/
Adolf Wurmbach (1891-1968) hat intensiv an die Juden in Krombach und Littfeld erinnert. In seinem Elternhaus hatten sie zeitweise einen Betraum. In dem folgenden Gedicht „Schatten“ erinnert er an seinen Freund Raphael Meyer. Das Gedicht „Israelischer Waldfriedhof in Burgholdinghausen“ hatte verschiedene Versionen, die folgende ist meines Erachten die eindringlichste.
Schatten
Durch unser Dorf
Gehen die Schatten
Aus drei Judenhäusern.
Sie gehen mit gebundenen Händen
Und einem leuchtenden Stern
Auf der Brust.
Eine Rauchwolke
Schleppt ihnen nach,
Und Asche in der Luft.
Manchmal begegnen sie mir
In meinen Träumen
Einer von ihnen
War mein Freund,
Er hieß Raphael.
Durch unser Dorf
Gehen die Schatten
Aus drei Judenhäusern
Schatten –
Schatten –
Schuld.
Israelischer Waldfriedhof in Burgholdinghausen
Gräbermale
In Waldesdunkel.
Hebräerspruch:
Levi und Sara Meier.
Sie warten. –
Warten:
Wo bleiben unsere Kinder,
Die Enkel?
Wo?
Der Wind weiß es,
Der von Osten kommt,
Von Sobibor
Und Treblinka.
Und Gott
Weiß es.
Zu Adolf Wurmbach finden sich einige Einträge auf siwiarchiv: http://www.siwiarchiv.de/page/2/?s=Adolf+Wurmbach&submit=Suchen
Pingback: Namensregister zu Standesamtsurkunden und mehr aus Siegen online • Verein für Computergenealogie e.V. (CompGen)
In der kommenden Sitzung des Kulturausschusses der Stadt Siegen am 23.2.2021 soll folgender Tagesordnungspunkt verhandelt werden: „Informationstafel zur Beschilderung der Alfred-Fissmer-Anlage“- Der von der Verwaltung vorgeschlagene Beschlussvorschlag empfiehlt die Annahme dieses Hinweistextes.
Pingback: Mittelalterliche Pergamenturkunden zurück im Stadtarchiv Siegen | siwiarchiv.de
s. nun Westfalenpost, Ausgabe Wittgenstein, 15.2.2021 (Print)
Warum greift die Volt-Fraktion das Thema jetzt auf, obwohl bekannt ist, dass sich ein neuer Arbeitskreis mit den Straßennamen nach belasteten Persönlichkeiten befassen wird. Es geht nicht nur um Irle! Ganz besonders geht es auch um Adolf Stoecker. Da hat sich trotz wiederholter Versuche leider nichts getan. Bei Walter Krämer hat es von 1947 bis 2015 gedauert bis ein Platz nach ihm benannt wurde.
2008/2009 hat sich ein AK schon einmal intensiv mit der „Aufarbeitung der historischen Hintergründe von Straßennamen in Siegen“ befasst. Leider ohne sichtbares Ergebnis.
Neben den drei im Antrag genannten Straßennamen, die Frauen gewidmet wurden, habe ich weitere zwölf entdeckt. Der Barbaraweg ist nach der Schutzheiligen der Bergleute benannt. Sie ist aber auch gleichzeitig die Schutzgöttin der Artillerie. Der Weg erhielt den Namen im Zuge des Kasernenbaus 1936/37! Muss er jetzt umbenannt werden?
In der Tat geht es nicht nur um Irle, es ghet um den „Bergfrieder“, um Stoecker, Ernst Bach, Otto Krasa, natürlich auch Hindenburg und andere Straßennamen. Movens für den Antrag zu Irle waren zwei Dinge: 1. der „Arbeitskreis Straßennamen“ ist sicher der richtige Weg, um sich intensiv mit belasteten namenspaten zu beschäftigen, bei denen Verstrickungen noch nicht hinreichend erforscht sind und es (siehe Fissmer) Für und Wider gibt. Im Fall „Irle“ ist aber alles so klar, dass man den noch nicht einberufenen Arbeitskreis nicht unnötig mit einem zusätzlichen Fall belasten muss.Für diese Ehrung spricht nun tatsächlich rein gar nichts. 2. Der Antrag greift einen Bürgerantrag aus dem letzten Sommer aus (der bis heute (!) noch nicht im Haupt- und Finanzausschus diskutiert wurde), der die mangelnde Sichtbarkeit von Frauen im Siegener Stadtbild thematisiert. Dies bezogen auf Denkmäler, Straßennamen und Weiteres. mit Therese Giehse als Namenspatin wird also auch dieser wichtige Aspekt aufgegriffen.
Für Volt als antragstellende Fraktion kann ich sagen: in unseren Augen spricht nichts gegen eine schnelle Umbenennung gerade der Lothar-Irle-Straße. Demokratische Meriten hat Irle sich nicht erworben, bis zu seinem Tod sind schriftliche Äußerungen seinerseits nachweisbar, die ihn als unbelehrbaren Faschisten und Nationalsozialisten zeigen – ich bin jedenfalls sehr auf die potentiellen Argumente gegen eine Umbenennung gespannt.
Christiane Luke veröffentlichte in ihrer Artikelserie „Siegener Theatergeschichte“ am 2. und 3. April 2004 zwei Berichte in der Westfälischen Rundschau zum Engagement Therese Giehse in Siegen. Giehse kam als Ensemblemitglied des Westfälischen Landestheaters nach Siegen. Sie wirkte von Herbst 1920 bis Frühjahr 1921 an Aufführungen von 21 Theaterstücken mit.
Die Recherchen Lukes fussen u. a. dem Buch Monika Sperrs „Ich habe nichts zum Sagen (Berlin 1977) über Therese Giehse sowie auf Recherchen des Siegeners Stadtarchivs für das Deutsche Theatermuseum München.
„Das Werk Ludwig Balds hat eine herausragende Bedeutung, da es erstmals eine zusammenhängende territorialpolitische Entwicklung des Siegerlandes darstellte.“
Diesem Satz in dem Wikipedia Eintrag zu Ludwig bald kann ich zustimmen, den übrigen Text des Eintrags halt ich aber für unvollständig, sehr fraglich und zum Teil für Geschichtsklitterung!
Der Zweite Weltkrieg brach nicht so einfach aus, sondern war von langer Hand geplant und er begann auch nicht mit einem Feldzug gegen Polen sondern mit einem Überfall, der schon alle Grausamkeiten des folgenden Vernichtungskrieges zeigte.
Mit der Biographie von Ludwig Bald wird im Artikel sehr naiv umgegangen.
Ludwig Bald trat am 1.5.1933 der NSDAP bei. Er erhielt die Mitgliedsnummer 2265220. Er hat sich noch sehr beeilt Mitglied zu werden, bevor die Partei eine Aufnahmesperre erließ. Den Antrag dürfte er schon vorher gestellt haben.
Drei Monate später, am 1.7.1933 trat er dem NSLB bei. In der NSV war er ab dem 1.10.1933 Mitglied. Am 1.9.1934 trat er den beiden NS „Blut und Boden“
Organisationen VDA ( Verein für Deutschtum im Ausland) und BDO ( Bund Deutscher Osten) bei. Diese Mitgliedschaften dürften wohl deutlich zeigen wo Ludwig Bald politisch zu verorten war.
Diese Angaben sind sehr einfach durch eine Anfrage an das Bundesarchiv zu bekommen.
Quelle: NSDAP-Zentralkartei | BArch R 9361-VIII KARTEI / 610020
Es wäre schön, wenn der Wikipedia Artikel entsprechend ergänzt würde.
Danke für die Recherche und den Kommentar!
Pingback: Online: Franz Kössler: „Personenlexikon von Lehrern des 19. Jahrhunderts. | bibliotheca.gym
„…. Bereits 1932 hatte Fissmer angeregt, die Fürst-Bülow-Strasse umzubenennen. Anlass dieses Vorstosses waren die 1930 posthum erschienen Erinnerungen des ehemaligen Reichskanzlers Bernhard von Bülow, die sich kritisch mit der Staatsführung Kaiser Wilhelm II. auseinander setzten und im nationalen Lager für Entrüstung sorgten. …..“
Ab dem 31. März 1933 hieß die Straße dann Leo-Schlageter-Str. Fissmer nutzte die neue Machtkonstellation, um die Umbennung durchzusetzen und um die Verwaltung in einem guten Licht gegenüber den Nationalsozialisten erscheinen zu lassen. (Quelle: Christian Bald/Christian Franke/Marc Neumann: Feiern, Denkmäler und Strassennamen -Symbolische Politik im Siegerland in der Zeit des Nationalsozialismus, in: Armin Flender/Sebastian.Schmidt: Der Nationalsozialismus im Siegerland. Ein Quellenband zur Regionalgrschichte, Siegen 2000, S.40)
Auszug aus dem Regionalen Personenlexikon (Quellenhinweise Punkt für Punkt dort):
„ohne engere Parteibindung stets an der Seite des völkisch-nationalistischen Lagers (Selbstbezeichnung: „vaterländisches Lager“) von DNVP, NSDAP, Kriegervereinen, Antisemitischem Schutz- und Trutzbund (Selbstbezeichnung: „Siegerländer Hakenkreuzer“), Bismarckjugend usw., daher wiederholt Konflikte mit Oberbehörden wegen städtischer Toleranz für antirepublikanische Aktivitäten (so 1924 wegen Unterstützung der zunächst als verfassungsfeindlich verbotenen Großveranstaltung „Deutscher Tag“ mit führenden Beiträgen aus der verbotenen NSDAP), nie an der Seite von DDP, SPD, KPD oder des Zentrums in deren Kampf gegen die vereinte Rechte, daher deren gemeinsamer Protest gegen parteiliche und verfassungsfeindliche Politik und Praktiken des OB (1927), schon vor 1933 verbotswidrige Beschäftigung von stadtbekannten Vertretern der äußersten Völkischen im städtischen öffentlichen Dienst (z. B. Wilhelm Langenbach, Deutschvölkische Freiheitsbewegung, Albert Link, NSDAP, Theo Steinbrück, NSDAP) und zugleich Entlassung Linker (Willi Kollmann 1932 nach dessen Wechsel von der SPD zur KPD)“
Fissmer verstand sich immer als als völkischer Kämpfer innerhalb der als „Vaterländische Verbände firmierenden Zusammenschlüsse rechtsaußen, zu denen seit ihrer Gründung die NS-Organisationen als integrierter Teil gehörten. Im nachhinein zu versuchen, weltanschauliche Abgrenzungen vorzunehmen, ist müßig. In ihrem Weltbild, zu dem als feste Komponente ihr Antisemitismus und ihre „weiße“ Überheblichkeit gehörten, unterschieden sie sich nicht. So belegt es auch dieses neue Detail. Fissmer biederte sich nicht „den Nazis“ an und war dann dort ein Fremder. Er wurde mit seiner Entscheidung, der Nazipartei beizutreten, deren eingeschriebenes Mitglied und verwies auf diese Entscheidung und diese Eigenschaft jedesmal , wenn er sich mit seinem Parteiabzeichen und/oder mit dem Deutschen Gruß der Öffentlichkeit präsentierte. Er drängte ja darauf, mit dazu gehören zu dürfen. Das machte nicht jeder.
Ich bedanke mich ebenfalls für die Recherche und den Kommentar! Wenngleich ich Ihnen mit Ihrer Wertung nicht in allen Punkten zustimme:
Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass mir sämtliche Ergebnisse des Bundesarchiv, die man Ihnen bezüglich Ludwig Bald mitteilte, mir bisher vorenthalten wurden. Meine Anfrage habe ich bereits am 6. März 2020 beim Bundesarchiv in Berlin und Militärarchiv in Freiburg gestellt. Aus Berlin erhielt ich – nach zehn Monaten- aus der Personenkartei der Deutschen Dienstelle (WASt) am 20. Januar 2021 lediglich drei Verwendungsauskünfte: 1939: 3. Kompanie Infanterie-Regiment 346 (B563/79525), 1942: Stamm-Lager /Kriegsgefangenenlager I A, Stablack (B563/49656) und 1943: Stab Landesschützen-Bataillon 211 (B563/10018). Keinerlei Hinweise auf eine NS-Belastung. Damit waren die Recherchen des BA abgeschlossen. Ebenso wie bei Ihnen, jedoch mit anderem Ergebnis, das Ihnen ebenfalls neu sein dürfte. Nachdem ich heute Ihren Kommentar gelesen habe, habe ich die NS-Belastung von Ludwig Bald in dem kritisierten Artikel nachgetragen. So viel zum Vorwurf der Klitterung.
Pingback: Archive und vormoderne Erinnerungskultur – Archivalia
Archive und vormoderne Erinnerungskultur
https://archivalia.hypotheses.org/129795
Pingback: Siegen: Jahresberichte des Stadtarchivs und der Denkmalpflege sowie Neues zur Siegener Stadtgeschichte | siwiarchiv.de
Wichtiger Hinweis: Bei dem im Potokoll erwähnten Hellwig handelt es sich um Heinrich Hellwig (SPD), um mögliche Missverständnisse sofort aufzuklären.
s. wohl auch: http://widerspruchundwiderstandimnsinsiwi.blogsport.de/verzeichnis/biografische-skizzen/#hellwig
Artikel der Siegener Zeitung zum Thema: https://www.siegener-zeitung.de/siegen/c-lokales/volt-will-lothar-irle-strasse-umbenennen_a225894
Zur Diskussion dieses Artikel auf der Facebook-Seite der Siegener Zeitung:
Auch hier ein Fehler im Regionalen Personenlexikon: Hellwig war SPD-Mitglied.
Auch schon vor 1945? Wenn ich den verlinkten Text richtig verstehe bezieht er sich hauptsächlich auf diese Zeit.
Soeben (23.2.2021) hat der Siegener Kulturausschuss mit den Stimmen von CDU und SPD den Text einer Acryltafel über Alfred Fissmer beschlossen. Einen Kurztext für die Tafel und einen für eine im Netz abrufbare Langfassung. Höchst bedauerlich, dass damit auch eine Reihe von Ungenauigkeiten und Fehlern mit beschlossen wurden, über die man vermutlich noch diskutieren wird. Über die Fehler gesprochen hat dagegen heute niemand. Ein zaghafter Versuch, im Arbeitskreis Straßennamen nochmals über die Texte zu sprechen, scheiterte am unerschütterlichen Glauben von CDU und SPD. Grüne, Volt und Linke stimmten gegen den Entwurf.
Fun Fact: Der Bürgerantrag aus dem Jahr 2018 ist nach wie vor nicht beschieden. Nachdem der Hauptausschuss die Thematik mit Hinweis auf Forschungen und eine Ausstellung eines Seminars der Uni hintangestellt hat, entschied der Rat in 2020:
Beschluss:
1. Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt, eine Informationstafel zu Alfred Fissmer analog bisheriger Hinweise (Acrylausführung) anzubringen.
2. Form und Inhalt der Informationstafel werden dem Fachausschuss vorher zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.
3. Darüber hinaus werden auf der Website https://unser-siegen.com weitergehende Informationen zur Verfügung gestellt. 4. Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt die Wiedereinsetzung eines Arbeitskreises, der sich mit den kritischen Namensgebungen von Straßen, Orten und Plätzen in unserer Stadt befasst und Leitlinien für eine Erinnerungskultur entwickelt und ggfs. Empfehlungen zu neuen Namensgebungen oder Informationstafeln zur kritischen Würdigung der Personen vorschlägt. Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 3 Enthaltungen
Zum Bürgerantrag kein Wort, auch wenn bis heute immer wieder suggeriert wird, die Fißmeranlage werde weiter durch Ratsentscheid Fißmeranlage heißen.
Fun Fact 2: Der Rat entschied in den sechziger Jahren, die Anlage Fißmer-Anlage zu benennen, obwohl der Oberbürgermeister Fissmer mit Doppel-s hieß.
Und hier der beschlossene Text in Kurz- und Langfassung zur geflissentlichen Betrachtung, verbunden mit dem Hinweis, dass man angesichts der Forschungslage Einzelheiten je nach Position begründet sehr unterschiedlich betrachten kann:
Alfred Fissmer (1878-1966) war von 1919 bis 1945 Bürgermeister und Oberbürgermeister der Stadt Siegen. In seiner Amtszeit machte er sich durch die nachhaltige Förderung Siegens verdient, darunter weitsichtige Maßnahmen zu Stadtplanung, Infrastruktur und Bauwesen sowie eine vorbildliche Finanzpolitik. Auf Initiative Fissmers wurde Siegen durch die Ansiedlung mehrerer Kasernen zum Militärstandort. Auch betrieb er ein umfangreiches Luftschutzprogramm zum Schutz der Zivilbevölkerung. In der NS-Zeit war Fissmer Mitglied verschiedener NS-Organisationen und trat 1937 in die NSDAP ein, ohne als bekennender Nationalsozialist aufzutreten. Gleichwohl setzte er sich für Verfolgte des NS-Regimes ein. Er arrangierte sich mit den Machthabern, wohl um sein Amt zu erhalten, und war somit als Oberbürgermeister für die Vorgänge in Siegen mitverantwortlich. Nach dem Zweiten Weltkrieg trat Fissmer in die neu gegründete CDU ein und blieb im öffentlichen Leben präsent. 1953 wurde er zum Ehrenbürger der Stadt Siegen ernannt und erhielt das Bundesverdienstkreuz verliehen.
Danke für diese Aktuelle Infos aus der Sitzung. Die Siegener Zeitung berichtet heute bereits – leider hinter der Bezahlschranke: https://www.siegener-zeitung.de/siegen/c-lokales/lothar-irle-ein-fall-fuer-die-experten_a226065?fbclid=IwAR0pe-dMCcL5Iy5-r17CFs7DOskWZRKddA76tpbkNNYmO_–A42WOC3mFoQ. Auf der Facebook-Seite der Siegener Zeitung wird dieser Artikel diskutiert: https://www.facebook.com/siegenerzeitung/posts/4188148704530847 .
Steffen Schwab kommentiert heute in der Westfälischen Rundschau: „Siegen in Sachen Fissmer und Irle: Unmöglich“, Link: https://www.wp.de/staedte/siegerland/siegen-in-sachen-fissmer-und-irle-unmoeglich-id231647763.html
Steffen Schwab kommentiert heute in der Westfälischen Rundschau: „Siegen in Sachen Fissmer und Irle: Unmöglich“, Link: https://www.wp.de/staedte/siegerland/siegen-in-sachen-fissmer-und-irle-unmoeglich-id231647763.html
In der heutigen Print-Ausgabe der Siegener Zeitung erschien der Artikel „Kurzinfo als Klitterung kritisiert“ zur Disussion im städtischen Kulturausschuss zur Fissmer-Anlage.
Der 4.Herr von links, ist mein Vater, Siegfried Förster, Bürgermeister von Siegen im Jahre 1974 bis 1978. Oberbürgermeister war Friedemann Kessler und Stellv. war Herr Ostholthoff.
Vielen Dank für die Bestätigung und Ergänzung der Angaben, Frau Reuter!
Sehr geehrter Herr Wolf,
ich mache höflichst darauf aufmerksam, dass der Obersteiger Röhrig sicherlich künstlerisch hochbegabt, aber kein Kunstmaler war, sondern ein Kunstmeister. Ich bitte, den Eintrag entsprechend zu ändern. Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Andreas Bingener
Schriftleiter
Danke für die Korrektur! Da war wohl der Wunsch der Vater des Gedankens …..
Kunstmeister statt Kunstmalermeister, dann ist es richtig. Kunst von Wasserkunst, einem Begriff aus dem Bergbau!
Das „-maler-“ ist doch gestrichen.
Das Herausgreifen und Deuten einzelner Aspekte finde ich wirklich gelungen. Auch das Hervorheben fehlender Belege, die die Einordnung von Fißmer somit schwer machen.
Herr Hellwig hat sicherlich Recht, wenn er sagt, dass zu wenig diskutiert wurde, bevor man die Tafeltexte verfasst hat. Danke für den Gastbeitrag.
Geradezu typisch für den Umgang mit einem lokalen Protagonisten des NS Regimes, da fehlt eigentlich nur noch die Behauptung, Fissmer habe im März 1945 Hitlers Nero-Befehl in Siegen verhindert. Sein damaliges Amtshandeln und die an Gesetze und Verordnungen gebundene Aufgabenerfüllung wird herangezogen, um ihn als Person zu erhöhen und sein Handeln zu rechtfertigen. Eine typische Vorgehensweise in der frühen Nachkriegsgesellschaft, die in ihren Reihen immer „Helden“ suchte, um Identifikationsfiguren für die Vorstellung zu finden: es war damals doch nicht alles so schlimm. Offensichtlich ist man in Siegen auf diesem Stand stehen geblieben.
Ein Dankeschön an die treffende Bewertung durch den Kenner der Materie, den seit vielen Jahren zum Thema NS forschenden und publizierenden Hagener Zeitgeschichtler Ralf Blank, Mitglied der Historischen Kommission für Westfalen.
Es genügt nun einmal nicht, in linearer Fortführung die Mythen der 1950er Jahre immer wieder neu aufzuwärmen, um zu einem angemessenen Urteil über diesen Fissmer kommen zu können.
Um das noch wieder am Beispiel zu erläutern:
Raimund Hellwig bezieht sich in seinem Beitrag weiter oben auf den von CDU-SPD-AfD konsentierten Satz aus dem bekannten Fissmer-Narrativ: „Auch betrieb er [Fissmer] ein umfangreiches Luftschutzprogramm zum Schutz der Zivilbevölkerung.“
Es ist ein Kernsatz bei der Heraushebung als große Siegener Persönlichkeit, eine wesentliche Komponente der nun inzwischen über drei Generationen anhaltenden Verehrung. Die resultiert einzig aus der Überhöhung einiger Persönlichkeitsmerkmale dieses OB und kümmert sich um sonst nichts. Sie weiß ja alles schon von den primären, sekundären und inzwischen tertiären „Zeitzeugen“.
Nicht einmal wurde dabei auf die einzige umfangreichere Schrift verwiesen, die dazu angeführt werden könnte, die Arbeit von Joachim Stahl, Bunker und Stollen für den Luftschutz im Raum Siegen, Kreuztal 1980. Auch sie sieht den OB nicht anders, aber sie wagt schon einmal einen Blick über die Ränder des Gebirgskessels: Zwar – in der Zustimmung ganz der Sichtweise der Weimarer Rechten nach dem WK I wie auch ihrer Nachfolger nach dem WK II folgend – sieht sie den Krieg als berechtigten Revisionsversuch von Versailles, damit aber das Bunkerbauprogramm als eine Konsequenz aus der Gewissheit eines künftigen Kriegs. Das war nun keineswegs ein genialer Einfall von Fissmer, sondern eine Überzeugung überall im Reich. Die politische Linke warnte „Hitler bedeutet Krieg“, und die politische Rechte hoffte „denen zeigen wir es noch.“ Die zutreffende Schlussfolgerung von Raimund Hellwig: „Tatsache ist, dass das Deutsche Reich bereits vor der Machtübergabe das Thema Luftschutz pflegte.“
Das heißt:
Am 10. Oktober 1940 erging ein „Führerbefehl“ zu einem reichsweiten Bunkerbauprogramm, das örtlich von den Oberbürgermeistern umzusetzen war, was dann ab 1941 geschah. Dem waren an vielen Orten bereits lokale und wohl meist private oder kommunale kleinere Initiativen vorausgegangen, Schutzräume zu schaffen, was im Siegerland durch die allenthalben vorhandenen und inzwischen nicht mehr genutzten Stollen leicht möglich war. Dergleichen war weder dort noch in anderen Regionen ein großes Verdienst der Bürgermeister, sondern eine Reaktion auf die von oben betriebene Kriegsvorbereitung und eine Reaktion von unten auf diese Bestrebungen, während das eigentliche Programm, das Großprogramm, der Kriegsführung, der Sicherung der Ruhe an der Heimatfront und dem künftigen Durchhalten galten. Ebenfalls definitiv keine Initiative der Bürgermeister. Wären hier Bauherren zu nennen, wären es Adolf Hitler, Hermann Göring und die Kriegsführungsexperten um sie herum.
Das Großprogramm, in das die Bürgermeister einzusteigen hatten, stand vor zwei Schwierigkeiten: Es fehlten Arbeitskräfte, und es fehlten freie Grundstücke. Im Siegerland kamen die Arbeitskräfte für 12-Stunden-Schichten wie andernorts auch in hohen Anteilen aus den lokalen Ausländerlagern, und Grundstücke wurden ab 1941 vermehrt durch die Verfolgung und Vernichtung der jüdischen Minderheit frei, so auch in Siegen, wenn man mal an das Synagogengrundstück denkt.
Lokal wurde das Thema natürlich propagandistisch als Volksschutzprogramm dargeboten. Es ermöglichte vor Ort den NS-Bürgermeistern eine positive Selbstdarstellung: „Dem Oberbürgermeister als Sprecher der Bevölkerung“ übermittelten im November 1943 die NSDAP-Ortsgruppenleiter ihre Dankbarkeit für „seinen“ Bunkerbau. Mit der Bevölkerung, von der so nach 1945 die Rede war, war zuvor allerdings immer das „Volk“ in der völkischen Version gemeint gewesen. Anders als in anderen Staaten, in denen ebenfalls Bunker gebaut wurden, wurden im NS-Reich die Zugangsberechtigungen nach rassistischen Kriterien vergeben, also auf „Biodeutsche“ begrenzt. Sie bildeten die „Zivilbevölkerung“, die der OB erfolgreich geschützt habe, wie es über den Rassismus hinweggehend dann in späteren Jahren hieß.
Der Ort, an dem die oben zitierten Ortsgruppenleiter dem Oberbürgermeister ihren Dank aussprachen, der im Reich nach lokaler Einschätzung in unseren Jahren eine Spitzenposition beim Bunkerbau gehabt habe, weshalb es nur vergleichsweise wenige Luftkriegsopfer aus der „Zivilbevölkerung“ gegeben habe, war Mannheim (Jörg Schadt/Michael Caroli, Mannheim im Zweiten Weltkrieg, Mannheim 1993, S. 33f.), und der OB ein Carl/Karl Renninger (Fred L. Sepaintner, Badische Biographien, Stuttgart 2011, S. 326). Siegen und Mannheim werden nicht die einzigen Orte in Westdeutschland gewesen sein, deren Oberbürgermeister in dieser Weise und überall gleich unzutreffend gerühmt wurden.
Es liegt hier kein Anlass, Fissmer in irgendeiner Weise eine Medaille anzuheften und damit die Volksschutzpropaganda der Nazis weiter hochzuhalten.
Zeigt diese Analyse doch das Versagen von Verwaltung und Politik. Diese Tafel ist untragbar.
@alle: Vielen Dank für die bisherigen Diskussionsbeiträge!
2 Anmerkungen:
1) Ein Kardinalproblem der Tafeltexte ist das Fehlen eines Quellen- und Literaturverzeichnisses. Nur damit kann eine stetige Auseinandersetzung mit Fissmer gewährleistet werden – wenn man dies durch die Beibehaltung des Namens so will.
2) Auch hier ein ceterum censeo: Mir wäre etwas mehr Geduld bei der Erforschung von Fissmers Biographie sehr lieb gewesen. Eine Recherche im Archivportal NRW lässt u. a. folgenden Fund zu: Im Stadtarchiv Siegen befindet sich folgender Aktenband Säuberung der Museen von „entarteter Kunst“ (Signatur Best. D / Stadtverwaltung Siegen, 1919-1945, Nr. Nr. 1253,
Laufzeit: 1937 – 1939) er enthält u. a. ein „Schreiben von OB Fissmer an Kruse betr. „entartete Kunst“ (!)“. In Anbetracht der auch noch nicht endgültig erforschten Rolle Fissmers bei der Evakuierung rheinischer Kunstschätze in den Hainer Stollen – hierauf wurde hier an anderer Stelle bereits verwiesen – zeigt dieser Hinweis, dass es sehr lohnenswert gewesen wäre, sich intensiver mit F. auseinander zu setzen, bevor man eine Tafel „durchpeitscht“..Übrigens: ein Quellenverzeichnis hätte diesen Punkt des Kommentars eventuell überflüssig gemacht.
Pingback: #Archiverinnerungskultur – eine nicht nur archivische Blogparade | siwiarchiv.de
Ein kurzer Nachtrag vielleicht noch zu den Feststellungen Raimund Hellwigs zu dem Übergang des Wohneigentums der jüdischen Familie Eduard Herrmann in „arische“ deutsche Hände nach der Vertreibung der Herrmanns:
Die Villa ging an den Standortkommandanten, den Berufsoffizier Karl Adolf Hollidt.
Zu Hollidt wäre zu sagen, dass er als vormaliger antidemokratischer Freikorpsoffizier, der in die Weimarer Reichswehr wechseln konnte, um anschließend in die NS-Wehrmacht einzutreten, für ein rechtes, ein völkisches Milieu steht, das im Siegerland den Ton angab und dessen Seilschaften Gesellschaft und Politik beherrschten. So nimmt es auch nicht Wunder, dass Hollidt 1948 im OKW-Prozess in Nürnberg wegen Kriegs- und Menschheitsverbrechen (konkret: wegen verbotwidriger Verwendung von Kriegsgefangenen und Verschleppung und Versklavung von Angehörigen der sowjetischen Zivilbevölkerung) verurteilt wurde.
Im Siegerland machte das nach Hollidts baldiger Amnestierung (im Zuge der Vorbereitung der westdeutschen Remilitarisierung) nicht viel. Bald war er Vorsitzender des Verbands der Heimkehrer, ein Presbyter seiner Glaubensgemeinschaft und hochgeachteter Gesellschaftsvertreter. Wie Fissmer. Das alte Milieu hatte sich vom Schock erholt, vitalisierte und rekonstruierte sich. Wiederaufbau. In diesen Kontext ordnet sich auch die bis heute lebendig gebliebene Mythenbildung zum vormaligen OB ein.
Pingback: Heute vor 12 Jahren: Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln – Archivalia
Leserbrief in der Siegener Zeitung hierzu:
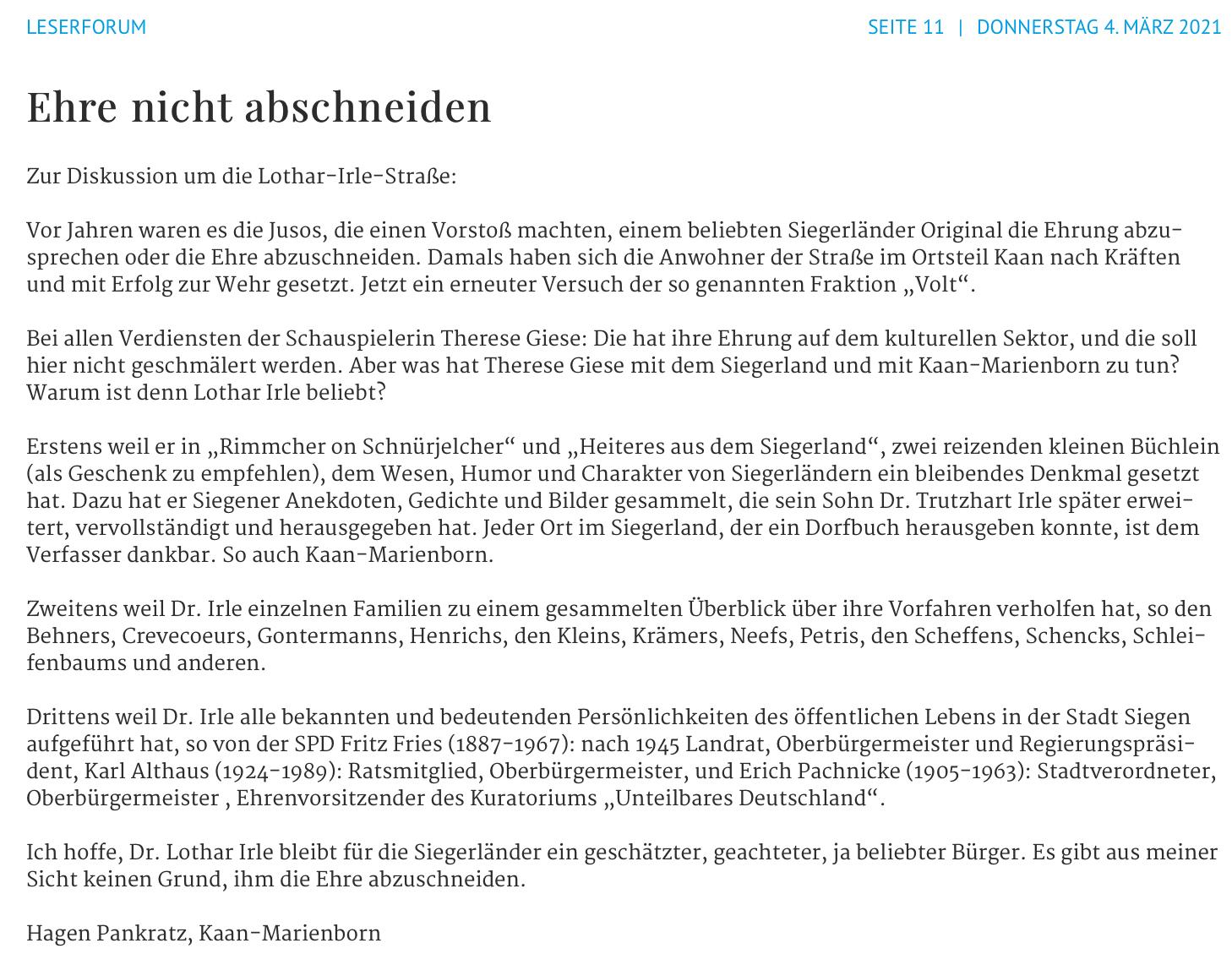
Heute findet sich in der Siegener Zeitung (Print) der Leserbrief „Straßennamen prüfen“, der die Verharmlosung Irles durch obigen Leserbrief benennt, darauf hinweist, dass der Leserbriefschreiber bei der Kommunalwahl 2020 für die AfD kandidierte und ein gewissenhaftes Untersuchen der Straßenamen forderte, an deren Ende eine Umbenennung oder eine erklärende Erweiterung des Straßennamenschildes stehen sollte.
b ist richtig
Denkmal-Gruftenweg :
Für sächliche Forschungsarbeiten (WK1-Marinekorps Flandern/Seewehr-Batterie Augusta) möche ich vernehmen of die Nahme Hugo Kuylen (Lt.d.R Matrosenregiment-1) vermeldet is aud das Denkmal. Vielen Dank im Voraus, Paul (bcknokke@telenet.be)
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 22.2. – 6.3.2021 | siwiarchiv.de
In der Siegener Zeitung findet sich in der Print-Ausgabe vom 5. März 2021 der Leserbiref „Ignorieren hilft nicht“ ein Leserbrief von Marie-Luise Schwartz, Pine Ridge Reservation, South Dakota. Schwartz lebte von 2000 bis 2008 während ihres Lehramtsstudiums in der Lothar-Irle-Str. Sie schreibt u. a.: „…. Viel wichtiger ist dieTatsache, dass diese Art Umbenennungen und „cancel culture“ die Vergangenheit weder ändern noch auslöschen können, Sie sind meiner Meinung nach kein konstruktiver Umgang mit Geschichte. …. Es kostet Ehrlichkeit, Mut, Demut und Vergebung, sich seinen eigenen Fehlern als auch den Fehltritten ganzer Nationen zu stellen.“
Ich habe da viele Fragen:
1) Ist der Briefschreiberin der Werdegang Irles und dessen Gedankenwelt vor, während und nach (!) dem 2. Weltkrieg bekannt? Ich werde den Eindruck nicht los, dass auch hier die regionalhistorischen Arbeiten seit 1997 nicht bekannt sind ….
2) Ist es im Falle Irles vor dem Hintergrund der oben erwähnten Publikationen nicht vielmehr: „cancel unculture“?
3) Sorgen die beinahe endlosen Umbenennungsdebatten nicht für die gewünschte kritische und konstruktive Auseinandersetzung anstelle der tumben und plumpen Beibehaltungsvertreter?
s. a. https://www.thomaskellner.com/de/werkverzeichnis/werkgruppen/die-mundloecher-auf-der-eisernhaardt.html
Sehr löblich ist es dem Archiv der Jugendkulturen unter die Arme zu greifen! Auch finde ich die angebotenen Produkte frech und witzig, da werde ich bestimmt was bestellen.
Archive sollten sich nicht in die Lage versetzen parteilich oder gar parteiisch sein zu wollen. Der Werbeaufdruck „Archive sind nicht neutral“ drückt jedoch genau dies aus, was ich für äußerst problematisch halte. Denn hier wird der neutrale und objektive Blick auf die Geschichte in Zweifel gezogen. Politische Slogans schaden der Glaubwürdigkeit wissenschaftlicher Arbeit massiv. Wir sollten uns von agitativen Sprüchen und populistischen Haltungen scharf abgrenzen – so sehr die Idee der gesamten Aktion eine gute Öffentlichkeitsarbeit darstellt. Diesen Spruch jedenfalls hafte ich mir nicht an die Brust!
Und was wurde nun von siwiarchiv beigesteuert? Ich tippe auf „Archive. Geschichte suchen und finden“ im Layout des „Archivar“, denn da hat möglicherweise ein Wolf schwarz gesehen…
Da ein Vorschlag gewünscht ist: „Archive. Denn was heute niedergeschrieben ist kann morgen nicht angezweifelt werden“
Thomas Reich, Münster
Vielen Dank für den Kommentar und den Vorschlag!
„Archive sind nicht neutral“ ist in der Tat provokativ und wurde bereits im vergangenen Jahr intensiv, aber sicher noch nicht abschließend hier diskutiert: http://www.siwiarchiv.de/siwiarchiv-blogparade-archivesindnichtneutral/ .
Nein, der gewählte Slogan stammt nicht von hier.
Es ist schön, dass die Spendenaktion so viel Aufmerksamkeit bekommt. Dennoch muss ich darauf hinweisen, dass die hier als „populistisch“ betitelte Beurteilung von Archiven keine „agitative“ Sondermeinung ist. Archive können nicht neutral und nicht apolitisch sein. In ihre Sammlungstätigkeit, Personalwerbung und Vermittlungsarbeit fließen zwangsläufig auch die Vorstellungen, Sozialisierungen und Haltungen der archivierenden Personen mit ein. Gleiches gilt übrigens für wissenschaftliche Forschung, ganz gleich ob Geistes- oder Naturwissenschaften, selbst auch. Es gibt im englischsprachigen Raum bereits ausführlich Arbeiten zu diesem Thema. Das deutsche Archivwesen hat das in der Breite leider noch nicht aufgegriffen. Das Archiv der Jugendkulturen dagegen schließt sich der international diskutierten selbstkritischen Beurteilung von Archiven an: https://twitter.com/Jugendkulturen/status/1367168646687191040?s=20. Es lohnt sich, Informationen zu diesem Thema zu sammeln und sich mit der eigenen „Vorbelastung“ gegenüber potentiellen Nutzungsgruppen zu beschäftigen. Eine Plattform für Diskussionen und evtl auch Lernmöglichkeiten zu diesem Thema bietet übrigens eine anstehende Veranstaltung des Arbeitskreises „Offene Archive“ im VdA im April: https://archive20.hypotheses.org/10011.
Pingback: NRW: Denkmalschutzgesetz auf dem Weg | siwiarchiv.de
c ist richtig
Am 9.3. gab es in der Siegener Zeitung (Print) einen Leserbrief „Respektlos und arrogant“, der einerseits die deutliche Kritik an dem Tafeltext zu Fissmer zurückwies und andererseits auf die Vorgehensweise „Aufklären statt Umbenennen“ abhob. Sowohl dieser Leserbbrief als auch der oben erwähnte „Flüchtigkeitsfehler“ mit dem falschen Bürgermeistervornamen haben mir keine Ruhe gelassen, so dass ich das Biogramm Fissmers, dass die Verwaltung zur Sitzung des Rates am 24.6.2020 und die Langfassung zum Kulturausschuss am 23.2.2021 einmal verglichen habe. War ich doch davon ausgegangen, dass diese beiden Texte identisch sind. Bei der Synopse (PDF) wurden die Textpassagen der Langfassung, denen des Biogramm zugeordnet. Beide finden sich zum Nachkontrollieren im Ratsinformationsystem der Stadt Siegen – sehen Sie also selbst: PDF: Fissmer Synopse Biogramm vom 24.6.2020 (links), Langfassung vom 17.2.2021 (rechts).
Ob die Kritik an der Langfassung im Ausschuss nun besserwesserisch war, und, ob Sie mit dem Stadtarchivleiter den Richtigen traf, mögen Sie entscheiden. Denn interessant sind m. E. folgende Fragen:
Warum musste das Biogramm des Stadtarchivs eigentlich umgeschrieben werden?
Wer ist für die Redaktionierung der Langfassung verantwortlich?
Wie wertschätzend für die Arbeits des Stadtarchivs ist es, wenn ein ausführlicheres Biogramm nicht weiter gekürzt werden muss?
Ich wage einmal einen Blick in die Zukunft:
Im Rahmen des Gesetzgebungverfahrens zum Kulturgesetzbuch, das ja auf dem bereits vorhandenen Kulturfördergesetz NRW aufsetzen soll, wird es noch keine Zusammenführung mit dem Archivgesetz geben. Die Neufassung des Archivgesetzes wird offenbar erst zu einem späteren Zeitpunkt seitens der Exekutive wieder aufgegriffen werden……
Auf dem obigen Poster ist Johann Trollmann abgebildet. Im Artikel der Westfälischen Rundschau vom 27.07.2019 mit der Überschrift: Leid, Ausgrenzung und Verfolgung – Die Doku „Sinti und Roma. Eine deutsche Geschichte“ beleuchtet Vorurteile und Ressentiments, mit denen die beiden Volksgruppen seit jeher zu kämpfen haben, lautet die Bildunterschrift:
„Ein Star, der keiner sein durfte: Der Boxer Johann Trollmann im Jahr 1928.“
Die heutige Heimatland-Seite (Print) der Siegener Zeitung widmet sich Edith Langner.
Der dem Eintrag zugrunde liegende Handbuchtext ist hier abrufbar: https://www.landtag.nrw.de/home/der-landtag/abgeordnete-und–fraktionen/die-abgeordneten/ehemalige-abgeordnete/abgeordnetendetail.html?k=00596
Ebenfalls ist ein Porträt Langners in „Landtag intern“, 3. Jahrgang, Ausgabe 29 vom 01.12.1972, S. 2: Link.
Ich war auch schon da mit meinem Vater,da war ich ungefähr 27 J. Er suchte damals auch seinen Vater ,aber durch einen Italienischen Freund der auf die siche gegangen ist, fand mein Vater heraus das sein Vater auf dem Friedhof Medicina/Bolongna (Erstbestattungsort) jetzt Fuda Pass liegt ,Block 5,Grab 73
Edith Langner war von 1969 bis 1979 als sachkundige Bürgerin in folgenden Ausschüssen des Kreises Siegen-(Wittgenstein) tätig: Ausgleichsausschuss (1969-79, Mitglied, Vertriebene), Kreis-VHS-Beirat (1975-79, stellv. Mitglied), Kreisvertriebenenbeirat (1969-74, stv. Mitglied)
Nachstehend ein paar Literatur- und Medienhinweise zur Biographie von Edith Langner
Literatur:
Homolla, Erna: Die Kümmerin vom Fischbacherberg. Erinnerungen an die Landtagsabgeordnete Edith Langner, in: Durchblick 2 (2019), S. 44 – 45
Pfau, Dieter/Seidel, Hans Ulrich: Nachkriegszeit in Siegen1945 bis 1949. Flüchtlinge und Vertriebene zwischen Integration und Ablehnung, Siegen 2004, S. 190, 191
Schiemer, Hansgeorg: 40 Jahre CDU für Siegerland und Wittgenstein (Schriftenreihe des CDU-Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein e.V. Nr.6), Siegen 1986, S. 102 -103, 116
Siegerländer Heimatkalender 1968, Siegerländer Chronik [ für den 10.07.1966: In den Landtag gewählt: Hans Reinhardt (SPD), Hans-Georg Vitt (SPD) und Edith Langner (CDU). Anm: Nachtrag am 17.5.22]
Siegerländer Heimatkalender 1971, Siegerländer Chronik [für den 14. Juni 1970: Im Siegerland in den Landtag gewählt: Hans Reinhardt (SPD), Hans Georg Vitt (SPD) und Edith Langner (CDU). Anm: Nachtrag am 17.5.22]
Siegerländer Heimatkalender 1988, S. 35
Medien:
„Frau Stadtverordnete Langner wird 50 Jahre alt,“ in: Siegener Zeitung vom 23.1.1963
„Siegerländer CDU nominiert eine Frau“, in: Siegener Zeitung vom 31.1.1966
„Aus dem Hause: Raum 14: Oase im Landtag.“ in: Landtag intern, 1. Jahrgang, Ausgabe 4 vom 29.10.1970, S. 6, Link
„Vom Pfarrhaus in den Landtag“, in: Der Nordwestspiegel vom 18.11.1970
„Es begann mit dem Willen, den Nächsten zu helfen“, in: SiegenerZeitung vom 26.11.1970
„Ehrenbrief für Frau Langner“, in: Siegener Zeitung vom 28.1.1971
„Landesgrenze kein Nachteil für Schüler mehr.“ in: Landtag intern, 2. Jahrgang, Ausgabe 4 vom 11.02.1971, S. 9, Link
„Zur Person: Edith Langner.“ in: Landtag intern, 2. Jahrgang, Ausgabe 5 vom 18.02.1971, S. 11, Link
„Aus dem Hause: Dr. Lenz, Wilhelm: Nordrhein-Westfalens Landtagspräsidium erlebt Demokratie in Stockholm.“ in: Landtag intern, 2. Jahrgang, Ausgabe 15 vom 27.05.1971, S. 10, Link
„Plenarbericht: Abgeordnete fragen – Minister antworten. Fragestunde im Plenum“, in: Landtag intern, 2. Jahrgang, Ausgabe 17 vom 18.06.1971, S. 4-5, Link
„Spielkreise ersetzen fehlende Kindergartenplätze.“ in: Landtag intern, 2. Jahrgang, Ausgabe 21 vom 09.09.1971, S. 10, Link
„Parlamentarischer Untersuchungsausschuß hat sich konstituiert.“ in: Landtag intern, 2. Jahrgang, Ausgabe 27 vom 21.10.1971, S. 3, Link
„Ersatzlösungen für fehlende Kindergartenplätze.“ in: Landtag intern, 2. Jahrgang, Ausgabe 28 vom 28.10.1971, S. 12, Link
„Ausschussbericht. Petitionsausschuß: Kummerkasten des Bürgers.“ in: Landtag intern, 2. Jahrgang, Ausgabe 29 vom 11.11.1971, S. 8, Link
„Sorge um Pflichtstundenzahl der Pädagogen.“ in: Landtag intern, 2. Jahrgang, Ausgabe 30 vom 18.11.1971, S. 10, Link
„Ländergrenzen im Gebiet der Kreise Siegen und Wittgenstein.“ in: Landtag intern, 2. Jahrgang, Ausgabe 31 vom 25.11.1971, S. 8, Link
„Neuordnung der Ausbildungsvorschriften für medizinische Berufe.“ in: Landtag intern, 2. Jahrgang, Ausgabe 32 vom 02.12.1971, S. 11, Link
„Silberner Frauenhilfe-Kreuz für Edith Langner“, in: Siegener Zeitung vom 15.12.1971,
„Pflichtstunden für Lehrer.“ in: Landtag intern, 3. Jahrgang, Ausgabe 9 vom 16.03.1972, S. 13, Link
„Gästebuch.“ in: Landtag intern, 3. Jahrgang, Ausgabe 13 vom 04.05.1972, S. 14, Link
„Kindergärtnerinnen.“ in: Landtag intern, 3. Jahrgang, Ausgabe 15 vom 18.05.1972, S. 12, Link
„Kindergärtnerinnen.“ in: Landtag intern, 3. Jahrgang, Ausgabe 18 vom 15.06.1972, S. 13, Link
„Gästebuch.“ in: Landtag intern, 3. Jahrgang, Ausgabe 24 vom 27.10.1972, S. 15, Link
„Porträt der Woche: Edith Langner (CDU).“ in: Landtag intern, 3. Jahrgang, Ausgabe 29 vom 01.12.1972, S. 2 [Link s. o.]
„Zur Person: Geburtstage.“, in: Landtag intern, 4. Jahrgang, Ausgabe 2 vom 19.01.1973, S. 15, Link
„Verdienste im sozialen und politischen Bereich“, in: Siegener Zeitung vom 20.1.1973
„Verkehrsprobleme.“ in: Landtag intern, 4. Jahrgang, Ausgabe 7 vom 23.02.1973, S. 11, Link
„Großes Verdienstkreuz für Edith Langner“, in: Siegener Zeitung vom 20.9.1973
„Abgeordnete mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.“ in: Landtag intern, 4. Jahrgang, Ausgabe 21 vom 21.09.1973, S. 7, Link
„Überflußgesellschaft.“ in: Landtag intern, 4. Jahrgang, Ausgabe 28 vom 23.11.1973, S. 9, Link
„Junge Aussiedler in Förderschulinternaten.“ in: Landtag intern, 5. Jahrgang, Ausgabe 8 vom 15.03.1974, S. 13, Link
„Landtag: 143 Wahlmänner für die Bundesversammlung.“ in: Landtag intern, 5. Jahrgang, Ausgabe 10 vom 29.03.1974, S. 7, Link
„Katholischen Frauengemeinschaft aus Hüttental-Weidenau zu Besuch im Landtag.“ in: Landtag intern, 5. Jahrgang, Ausgabe 11 vom 06.04.1974, S. 16, Link
„Zu Besuch im Landtag.“ in: Landtag intern, 5. Jahrgang, Ausgabe 17 vom 14.06.1974, S. 16, Link
„Offiziere zu Besuch im Landtag.“ in: Landtag intern, 5. Jahrgang, Ausgabe 20 vom 13.07.1974, S. 16, Link
„Landespressekonferenz“. in: Landtag intern, 5. Jahrgang, Ausgabe 30 vom 29.11.1974, S. 16, Link
„Prüfungsordnung.“ in: Landtag intern, 6. Jahrgang, Ausgabe 6 vom 01.03.1975, S. 14, Link
„Das Parlament war ihr Schicksal. Ein Drittel der Parlamentarier kommt nicht wieder“, in: Landtag intern, 6. Jahrgang, Ausgabe 10 vom 23.04.1975, S. 5-6, Link
„E. Langner nahm Abschied von politischen Ämtern, in: Siegener Zeitung vom 17.1.1977
„Frau Pastor stand jahrzehntelang ihren Mann“, in: Siegener Zeitung vom 22.1.1983
„Edith Langner von schwerem Leiden erlöst“, in: Siegener Zeitung vom 9.12.1986
„Zur Person: Edith Langner (verstorben)“. in: Landtag intern, 17. Jahrgang, Ausgabe 20 vom 16.12.1986, S. 24, Link
„Edith-Langner-Anlage übergeben: Areal soll „Ruhe und Frieden“ beingen, in: Siegener Zeitung vom 8.10.1993
[Anm.: Die Verlinkungen auf die Fundstellen im „Landtag intern“ und die Verlinkunk auf den „Durchblick“ erfolgten am 18.5.2022]
Gestern auf dem Westfälischen Archivtag betont der Archivrechtler und Leiter des Rheinischen Archiv- und Fortbildungszentrums:
“ …. Schon bei der vorgelagerten Überlieferungsbildung sei fraglich, ob rechtliche Bestimmungen, wie z.B. Vernichtungsbestimmungen der Übernahme von personenbezogenen Daten in den Archiven trotz der weitreichenden Anbietungspflicht entgegenstehe.
Aber auch bei unproblematischen Daten stelle sich die Frage, mit welcher Methodik wir diesen umfangreichen Quellentypus, der in Zukunft massenhaft auf die Archive zukäme, erschließen werden können.
Durch eine praktikable und zielführende Erschließungsmethodik erreiche man vielseitige Auswertungsmöglichkeiten.
Mit diesen und weiteren Fragen läutet Herr Schröder die erste Sektion des Westfälischen Archivtages 2021 ein und übergibt das Wort dem ersten Referenten Herrn Dr. Steinert aus dem LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum in Pulheim.
Sein Vortrag beschäftigt sich mit der Frage: „Übernahme von personenbezogenen Unterlagen in der Verwaltung in Zeiten der Datenschutz-Grundverordnung – Weitermachen wie bisher?“
Zu Beginn stellte der Redner fest, dass die nordrhein-westfälische Archivwelt immer noch auf ein novelliertes Archivgesetz warte, dass der Datenschutzgrundverordnung von 2016 Rechnung trägt. Im Moment stehe die DSGVO dem Archivgesetz NRW entgegen.
Der Redner benannte noch einmal die Unterscheidung, die die DSGVO bei Bestimmungen in Bezug auf personenbezogene Daten im Archiv macht.
Grundlegend untersage die DSGVO die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Art. 9 Absatz 1.
Jedoch räume die Verordnung ein, bei einem ausdrücklich im öffentlichen Interesse liegendem Archivzweck durch die Artikel 5 und 6 DSGVO auf die Erfordernisse zu verzichten (sog. Derogation).
Zu betonen sei, dass die DSGVO nur für lebende Personen gelte.
Neben dieser unmittelbaren Privilegierung der Archive gibt es auch eine Privilegierung der Archive durch Artikel 89 Absatz 3 DSGVO, die eine zentrale Bestimmung für die Archive sei.
Einzige Voraussetzung für diese Ausnahme sei die Anpassung der Archivgesetzte, die wiederum in NRW fehle.
Durch eine geringe Änderung des Archivgesetzes wäre diese Ausnahme möglich.
In den meisten Bundesländern ist eine solche dringende Novellierung des Archivgesetzes, die Voraussetzung der Derogation ist, bereits geschehen. In fünf Bundesländer unter denen auch NRW ist, stehe dies hingegen noch aus.
2018 habe es einen Gesetzesvorschlag für die Novellierung gegeben, der aber 2019 nach einer ergebnislosen Anhörung der Verbände im Sand verlaufen sei.
Herr Steinert nennt dies eine „schleppende Bearbeitung des Gesetzgebers“ und hofft deshalb, auf eine problemlose Übernahme der personenbezogenen Daten, die durch die kommende Novelle ermöglicht werden solle.
Diese Möglichkeit eröffnet der Redner durch die exemplarische Nennung der Bestimmungen die dies im Moment im Archivgesetz NRW verhinderten.
Neben einer minimalen Abänderung des §4 Absatz 2 Archivgesetz, der durch eine zwei Sätzestarke Nummer 3 des Gesetzeslautes derogierbar wäre, seien ebenfalls die Artikel 15,16,18 und 19-21 DSGVO derogierbar.
Eine solche Abänderung erspare sehr viel Arbeit und würde zudem eine klare rechtliche Grundlage bieten
Herr Steinert stellte fest, dass die Derogation unter datenschutzrechtlichen Aspekten „vollkommen unbedenklich [sei], da das Archivgesetz durch Schutzfristen die Einhaltung des Datenschutzes garantiert“.
Eine Wiederaufnahme der Frage, ob man weiter machen soll wie bisher, käme zu dem Schluss, dass wir es eigentlich nicht dürften, es aber trotzdem im Hinblick auf die noch ausstehende Novellierung tun müssten.
Herr Schroeder hielt abschließend fest, dass die jetzige Lage eine unbefriedigende sei und leitete in diesem Zuge zu der Auswertung der anfangs gestellten Umfragen ein.
Die Frage, ob Dienststellen die Anbietung personenbezogener Daten verweigerten, konnten 27% der Teilnehmer bejahen, was zu angesichts dieser hohen Anzahl zu Verwunderung führte.
Herr Steinert griff diese Zahl auf schilderte, dass er dieses Problem zwar kenne, jedoch nicht in einem solchen Umfang, woraus sich ein noch größerer Handlungsbedarf des Gesetzgebers ergebe.
Das Problem sei also durch aus real und auch dringend. Eine Novellierung des Archivgesetzes sei somit dringend erforderlich und schon längst ausstehend, wie Herr Steinert abschließend zusammenfasste. ….“
Quelle: https://archivamt.hypotheses.org/14812
Eine gegenüber dem Vortrag aktualisierte Powerpoint-Präsentation verweist u.a. darauf, dass neben NRW nur noch Hamburg das Archivgesetz noch nicht an die EU-DSGVO angepasst hat. Die Präsentation ist inzwischen online: PP-Präsentation Steinert (PDF)
Pingback: Buchprojekt „Siegener Stadtgeschichte“ gestartet | siwiarchiv.de
Pingback: „Den guten Stand der Denkmalpflege in NRW nicht verspielen“ | siwiarchiv.de
Hochinnovativ im 21. Jahrhundert: ein Buchprojekt.
Innovativ findet sich nicht in der Presseerklärung, insofern wäre das konventionelle Vorgehen hier nicht zu kritisieren – was wäre denn ein modernes Vorgehen? Ein Stadt-Wiki vielleicht. Dies existiert allerdings schon: https://wiki.zeitraum-siegen.de/ . Ein citizen science bzw. oral history Projekt für die neueste Geschichte? Auch dies ist bereits vorhanden: https://unser-siegen.com/. Also was wäre Hochinnovativ?
Vergessen wurde hier zudem das studentische Portal Regioport Siegerland: https://www.regioport-siegerland.de/de/ . Bei dem Projekt zur Siegener Stadtgeschichte hätte man diese drei Angebote durchaus mit einbeziehen können. Als Vorbild und zur Weiterentwicklung hätte ja die Kooperation von siwiarchiv mit dem kreishistorischen Zeitspuren-Projekt gedient.
Dass siwiarchiv als weitere Plattform genutzt werden kann, bedarf keiner Erwähnung.
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 7.3. – 20.3.2021 | siwiarchiv.de
Video: Stephanie Kortyla (Sächsisches Staatsarchiv): “ Zur Archivierung von Daten aus Twitter mittels der twittereigenen Exportfunktion („Twitterarchiv“), ein Überblick über die Schnittstellenentwicklung 2018 bis 2021″, Vorstellung auf der Tagung des Arbeitskreises „Archivierung von Unterlagen aus digitalen Systemen“ (AUdS) am 22. und 23.03.2021
Weitere Literatur:
– Pfau, Dieter: „Die Bevölkerung […] mit auf dem Wege der vollkommenen Verarmung“. Der freiwillige Arbeitsdienst im Siegerland (Dez. 1931 – Jan. 1933), in: Siegener Beiträge 3 (1998), S. 129 – 141
– Pfau, Dieter: Kriegerdenkmale, Volkstrauer und nationalsozialistische Sinnstiftung – Über die Transformation kultureller Traditionen im Siegerland 1929 – 1932, in: Siegener Beiträge 4 (1999), S. 101 – 116
– Schiemer, Hansgeorg: Volksbegewhren und Volksentscheide – Politische Willensbildung im Siegerland inder „Weimarer Zeit“, in: Siegener Beiträge 3 (1998), S. 119 – 128
– Schiemer, Hansgeorg: Vor 70 Jahren: Volksbegehren und Volksentscheid gegen den Young-Plan 1929, in: Siegener Beiträge 4 (1999), S. 85-100.
Weitere Literatur:
Irle, Trutzhart : Auferstanden aus Ruinen – Zerstörung und Wiedergeburt der Stadt Siegen, Gummersbach 2005, S. 27 (Danke an W. L. für den Hinweis!)
Pingback: Sterbenebenregister des Regierungsbezirks Arnsberg (1874 – 1938) online – Archivalia
Das Siegerland hat eine interessante Geschichte und viele Kunstschätze aufzuweisen. Es ist wichtig und notwendig, sie zu erhalten, und die Bürger und Bürgerinnen der Stadt auf diesen kulturellen Reichtum aufmerksam zu machen.
Weitere Literatur:
– Tschacher, Werner: „All this trouble for thoise damned old bones!“ Aachener Mythen um Karl den Großen zwischen Dekonstruktion, Transformation und Persistenz, in: Kéry, Lotte (Hg.): Eloquentia copiosus. Festschrift für Max Kerner zum 65. Geburtstag, Aachen 2006, S. 81 – 100, bes. S. 90-91
– Becker, Alfons: Über Denkmalpflege und Naturschutz in der Rheinprovinz in: Ruland, Josef (Hrsg.): Festschrift für Franz Graf Wolff Metternich. Neuss 1973, S. 50 – 70, bes. S. 62
– Renkhoff, Otto: Nassauische Biographie. Kurzbiograpjien aus 13 Jahrhunderten, Wiesbaden 1992, S. 193
– Klappert, Hans: Verbot für Brüsseler Tomaten und Apfelsinen. Protokoll der Erinnerungen von Oberbürgermeister Fissmer, in: „Siegerland“, Band 68, H. 3–4 (1991), S. 87 – 92
– Dietermann, Klaus: Kriegsbeginn – 1939 in Stadt und Kreis Siegen, Siegen 1988, S. 22–27
– Philippi, Detmar Alemannenalbum 1969 Zum 125. Stiftungsfest der Burschenschaft Alemannia zu Bonn, 1969, S. 50.
Weitere Literatur:
– Radermacher, Willy: Kyffhäuser- und Schützenkameradschaft Siegen e. V. 1870 – 1995. Dokumentation zum 125jährigen Bestehen, o. O. 1995, S. 103 (Bild)
1. Hebezeug für eine Schmelzpfanne
2. Vetter
3. Schmeck
1. Gießkran
2. Deutsche Edelstahl Werke
3. Loos
Zwei „Bilder“ zur Familiengeschichte Fissmers:

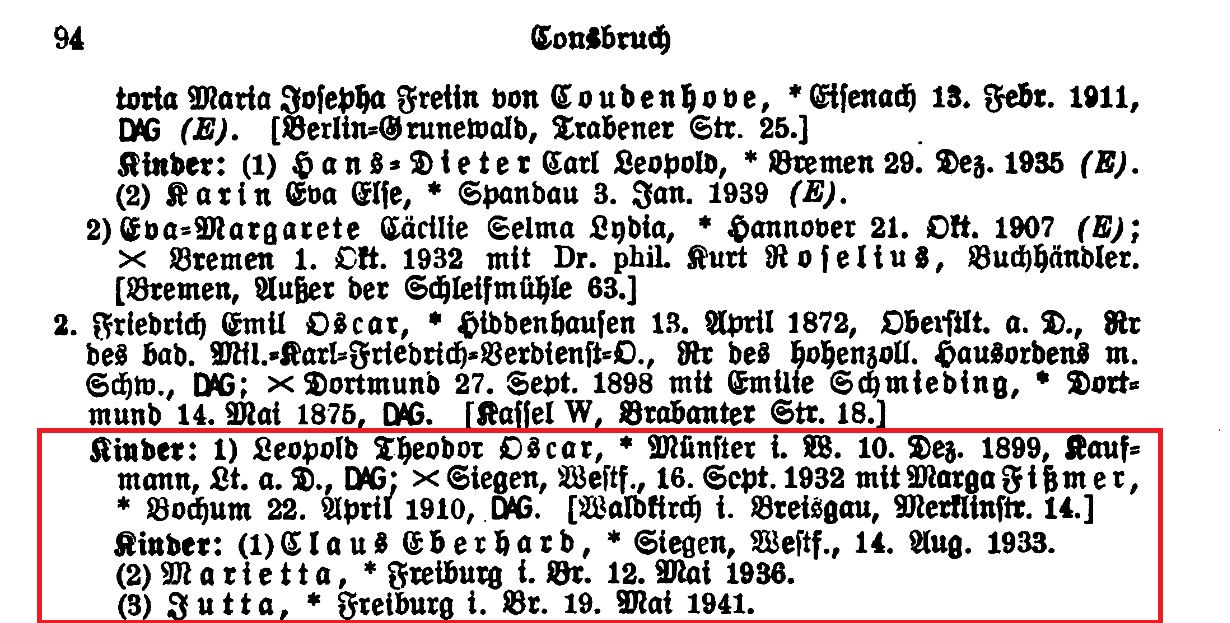
a) Verlobung:
Quelle: Allgemeiner Anzeiger zum Militärischen Wochenblatt Nr. 87 vom 16. Juli 1908
b) Tochter und Enkel:
Quelle: Gothaisches genealogisches Taschenbuch der adeligen Häuser
zugleich Adelsmatrikel der deutschen Adelgenossenschaft. Teil B, Gotha
1942
Weitere Literatur:
– Dietermann, Klaus: Kasernen und Kuhmichel, Siegen 1985
Lastaufnahmemittel für Gießpfanne
Stahlwerke Geisweid
Dr. Paul Fickeler
Hebezeug für eine Gießpfanne
Charlottenhütte
Holdinghausen
Halterung für Roheisenkippe
Niederschelderhütte
Charlottenhütte
Pingback: siwiarchiv-Osterferien-Rätsel 2021/2 | siwiarchiv.de
Der Bildtitel lautet: „Gießpfannen-Gehänge für 100t Tragkraft“. Schnellster Löser ist somit Sven Panthöfer – Gratulation! Die Herstellerfirma und der Fotograf wurden jedoch nicht richtig gelöst. Heute besteht ja eine neue Chance.
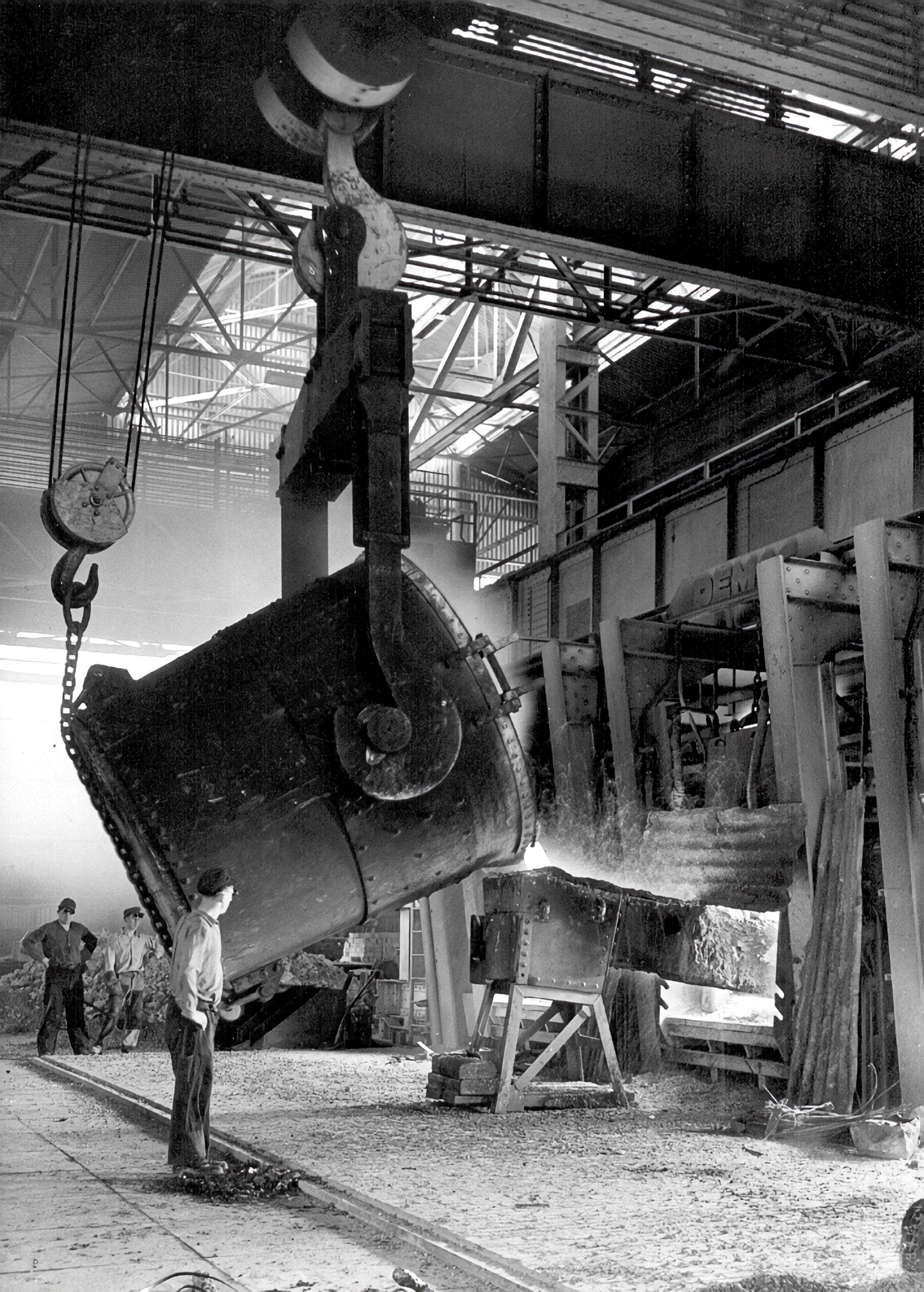
Manfred Knoche stellte dankenswerterweise folgendes Bild zu verfügung das eine Roheisen-Kippe mit dem Gehänge in Aktion zeigt:
1. Druckfilter
2. Büdenbender, Netphen
3. Foto Ernst Besser
Keine der Antworten kann ich gelten lassen – leider.
Lieber Herr Wolf, meinen Sie nicht, dass die Fragen nach Hersteller und Fotograf etwas über das Ziel hinausschießen? Da bleibt nur raten und das ist auf die Dauer etwas langweilig. Geben Sie doch wenigstens Hinweise.
Grüße S.P.
Ehrlich gesagt hatte ich erwartet, dass Firma und Fotograf recht schnell erraten werden …..
Mit Hinweisen bezüglich der Firma halte ich mich noch bis morgen zurück. Übirgens ist dieses Raten ja auch ein Ausdruck der starken mittelständischen Wirtschaft im Kreisgebiet.
Soviele Industriefotografen können wir nun auch nicht mehr haben, daher darf gerne weitergeraten werden.
Letzter Versuch ;-)
Hersteller: Siemag
Fotograf: Peter Weller
Immer noch nicht! Was die Firma anbelangt, schauen Sie bitte auch in den nächsten Tagen ´rein. Ich denke da klärt sich etwas. Ich bin bei den Fotografen über die Findigkeit aller Mitratenden erstaunt. Wenn ich jedoch eine Sammlung Weller-Bilder erhalten hätte, dann wäre es allerdings durch die Medien gegangen. Weller ist immerhin eine Inspiration für Bernd und Hilla Becher gewesen.
Ja, aber hier geht es ja nur um einen einzigen Weller ;-)
Da ich ja schon um Tipps gebeten: Alle Bilder – auch die noch kommenden – stammen aus einer Hand.
Pingback: siwiarchiv-Osterferien-Rätsel 2021/3 | siwiarchiv.de
Ein Tipp: Der abgebildete Gegenstand wird zur Herstellung eines Produkts verwendet, das Archiven wohlbekannt ist.
Beim ersten Anblick habe ich allerdings an die Waffenkammer von Agent K aus dem Film „Men in Black“ gedacht …..
1. Luftdruck Kompressor Kessel
2. Lohenner
Auch hier muss ich leider streng sein. Es ist kein Kompressor-Kessel und die gesuchte Firma ist ca. 75 Jahre älter als die Firma Lohenner. Schließlich bin ich ja auch nach einem Tipp zum Fotografen gefragt worden. Der Name findet sich hier im Blog im Zusammenhang mit visuellem Dokumentationsgut. Viel Glück heute!
Pingback: #SIEistSIEGEN im Siegener Haupt- und Finanzausschuss | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Osterferien-Rätsel 2021/4 | siwiarchiv.de
Das sieht aus wie ein starker Industrie Magnet für schwere Eisenstücke. Bertram
Fuhrmann
Es ist kein Magnet. Aber vielleicht hilft ein Blick auf das erste Rätsel, um auf eine Idee zu kommen, wo dieses Teil zum Einsatz kommt. Firma und Fotograf sind leider falsch.
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik März 2021 | siwiarchiv.de
Zweiter Versuch:
1. Pfannenwagen für Flüssig-Roheisen
2. Karl Buch
3. Uwe Niggemeier (danke für den Tipp!)
Bei der Lösung der ersten Frage haben Sie sich etwas weiter entfernt. Firma und Fotograf sind es leider immer noch nicht.
1. Dampf(druck)kessel
2. Justus-Stahlschmidtsche-Werke
3. keine Ahnung. Der Tipp half mir leider nicht
Da ich bei der Lösung der ersten Frage streng war, bin ich es hier auch – also nein, kein Dampf(druck)kessel. Die Firma ist leider falsch, aber ich habe den Eindruck, dass nun in der richtigen „Kategorie“ gesucht wird. Und schließlich zum Fotografen, es ist ja noch ein bisschen Zeit und zum Finden benötigt man auch etwas Zeit. Ich habe nicht grundlos visuelles Dokumentationsgut geschriben ….
Pingback: siwiarchiv-Osterferien-Rätsel 2021/5 | siwiarchiv.de
Teil eines Walzgerüstes
Das Teil wurde im Vorfeld verwendet – daher leider nein.
Pingback: siwiarchiv-Osterferien-Rätsel 2021/6 | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv wünscht Frohe Ostern! | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Osterferien-Rätsel 2021/7 | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Osterien-Rätsel 2021/8 | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Osterferien-Rätsel 2021/9 | siwiarchiv.de
Ein Hinweis zum Produkt findet sich heute auf dem Twitter-Kanal von siwiarchiv: https://twitter.com/siwiarchiv
Behälter für das Zinkbad einer Verzinkerei
Hersteller und Fotograf unbekannt
Gratulation zur korrekten Beantwortung der Frage nach dem abgebildeten Produkt!
1502 als Schmiede in Siegen gegründet, dominierte die Region über Jahrhunderte hinweg, stieg als Siegener Aktiengesellschaft (SAG) auf und heißt mittlerweile The Coatinc Company.
Die Bilder könnten von der Familie Dreßler sein, als Gründer heute ist es Herr Niederstein.
Ja. Gemeint war die Fa. Coatinc, aber quasi nur als Kunde der gesuchten Firma. Daher stammen die Bilder auch nicht aus dem Besitz der Familie Dresler/Niederstein.
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 21.3. – 5.4.2021 | siwiarchiv.de
Fotograf: Carl Siebel
Firma: Gontermann und Peipers
Weder Fotograf noch Firma wurden richtig erraten. Danke für die Teilnahme! Es finden sich immer einmal wieder weitere Hinweise bei den nachfolgenden Rätseln. Da diese beiden Fragen und auch weitere Produkte der Firma noch nicht erraten wurden, lohnt sich das Mitmachen weiterhin!
Kenne die Kinos alle noch.Außerdem das‘central‘ auf der Sandstraße.sowie den‘Charlottenbunker‘,
Vielen Dank für den Kommentar! Weitere Erinnerungen an die Siegener Kinogeschichte sind herzlich willkommen!
Eisenträger für Brückenbau.
Thyssen/Krupp
Fotograf nicht bekannt
Leider nein! Daher habe ich mich entschlossen heute einmal 3 Tipps zu geben – s. Kommentar.
3 Tipps:
Das gezeigte Werkstück wurde in der Landwirtschaft eingesetzt.
Die gesuchte Firma feierte 1936 ihr 100jähriges Bestehen.
Der Fotograf taucht im im Blog im zusammenhang mit dem Medium Film auf.
1. zentrales Teil eines Tiefpflugs / Moorpflugs
2. Gebrüder Schuss, Siegen
3. Fotograf unbekannt
Es handelt sich in der Tat um das Rahmenteil eines sogenennaten Kuhlpflugs, der u. a. in Mooren etc. eingesetzt wurde. Auchdie Firma wurde nun endlich richtig erraten – daher doppelte Gratulation!
Herstellende Firma: Siegener AG
Leider nein. Wenn ich mich recht erinnere war die Siegener AG bereits vorgeschlagen worden.
Es könnte ein Industrie Lüftungsventilator sein.
Gratulation! Die Antwort ist korrekt! Jetzt noch bis heute 24 Uhr weitere richtige Lösungen einsenden und es wird noch einmal spannend. Zum Fotografen noch ein Hinweis: Er findet sich hier im Zusammenhang mit einem Film über Weidenau. Bei den noch ungelösten Bildern hilft vielleicht die vergleichende Google-Bildersuche.
Zu Kanstein s.folgende Literatur:
Werther, Steffen: SS-Vision und Grenzland-Realität. Vom Umgang dänischer und „volksdeutscher” Nationalsozialisten in Sønderjylland mit der „großgermanischen“ Ideologie der SS, Stocklholm Studies in History 95, Stockholm 2012, s. 38, 66, 251, 254, 297
Pingback: R.I.P. Friedhelm Menk (19. März 1938 – 25. März 2021) | siwiarchiv.de
In der Kurzfassung des Fissmer-Anlage-Begleittexts heißt es im Anschluss an die seit Fissmers Verschwinden aus dem Amt vorgetragenen These, „auch betrieb er ein umfangreiches Luftschutzprogramm zum Schutz der Zivilbevölkerung.“ Damit erhält der Protagonist eine Lebensretter-Rolle, die dann mit seiner NS-Belastung verrechnet werden kann und die angesichts von Todesziffern, wie sie ohne Bunker anzusetzen wären, zu einem außerordentlich günstigen Saldo für den Belasteten führt.
Es ist aber zu sagen, dass diese These ein reiner Mythos ist, denn:
– Wenn bereits seit der Jahresmitte 1937 in Siegen mit dem Einbau von Luftschutzkellern in Neubauten begonnen wurde, war das keine lokale Initiative, die etwa von Fissmer ausgegangen wäre, sondern eine Folge ministerieller Verordnungen zum Luftschutz. Das Ministerium war das Reichsluftfahrtministerium unter dem Oberbefehlshaber der Luftwaffe Hermann Göring.
– Zwar druckte eine Siegener Druckerei die reichsweit verbindliche „Ortsanweisung für den Luftschutz der Zivilbevölkerung“, verlegte und verteilte sie aber nicht. Fissmer hatte damit nichts zu tun.
– Am 10.10.1940 trat mit Führerbefehl das „Führer-Sofortprogramm“ zum Bau von Luftschutzbunkern in Kraft. Für dessen Umsetzung war der Reichsminister für Bewaffnung und Munition Fritz Todt zuständig. Fissmer hatte mit der Entstehung dieses Befehls nichts zu tun.
– In der Besonderen Anlage 10 des Mobilmachungsplans der Luftwaffe war die Stadt Siegen als einer von 104 Luftschutzorten I. Ordnung aufgeführt. Es gibt keinerlei Quellenbelege dafür, dass das auf Aktivitäten von Fissmer zurückzuführen ist. Es ergaben sich daraus Handlungsanweisungen für die Polizei, die Feuerwehr, die Technische Nothilfe, das DRK usw. Fissmer als regionaler Luftschutzleiter war hier in jeder Hinsicht allein ein Ausführender. Was dazu quellenmäßig vorliegt, ist ein nicht zuzuordnendes Konzept zu einem Brief des Landrats Weihe an das Luftgaukommando VI in Münster vom 26.5.1943. Es spricht, wie es dann vollzogen wurde, die Ausgliederung „wegen Schwierigkeiten der Betreuung“ von Eiserfeld, Niederschelden, Buschhütten, Kreuztal, Dreistiefenbach, Dillnhütten, Dahlbruch, Hilchenbach, Eichen, Freudenberg, Salchendorf, Neunkirchen und Netphen aus dem Bereich des Luftschutzortes I. Ordnung, also eine Herunterstufung an. Bei dieser Ausgliederung sieht Joachim Stahl Fissmer am Werk, dem die genannten Orte zuviel gewesen seien. Handfeste Belege kann er aber auch dazu nicht vorweisen. Sicher lässt sich sagen, dass sich auch dazu – erstrangiger Schutz für Siegen, nachrangiger für die anderen -, was Fissmer angeht, überhaupt nichts Gesichertes sagen lässt.
Bei keinem dieser Vorgänge hatte der OB von Siegen mehr zu tun, als dass er sich an die Vorgaben zu halten hatte und schauen musste, dass andere sich daran hielten. Es gibt nicht den geringsten Ansatzpunkt, ihn zu einem Lebensretter zu machen. Diese Eigenschaft müsste, wenn das die Schlussfolgerung aus dem Bunkerbau sein soll, der NS-Spitze mit Hitler, Göring und Todt zugemessen werden. Die nun allerdings Bunker bauten, um Krieg gegen die Menschheit führen zu können. Fissmer in Siegen fiel im weiteren Verlauf zu, dass der Zwangsarbeitseinsatz effektiv war und dass in die fertigen Bunker nur reinkam, wer einen Ahnennachweis für seine „rassische“ Reinheit vorzulegen imstande war. Diese Praktiken retteten keine Leben.
Quellen: Joachim Stahl, Bunker und Stollen für den Luftschutz im Raum Siegen, Kreuztal 1980; Holger Happel, Bunker in Berlin. Zeugnisse des Zweiten Weltkriegs, Berlin 2015; Siegener Zeitung, 8.6.1937
Leider musste ich die Bilder alle ein wenig bearbeiten:
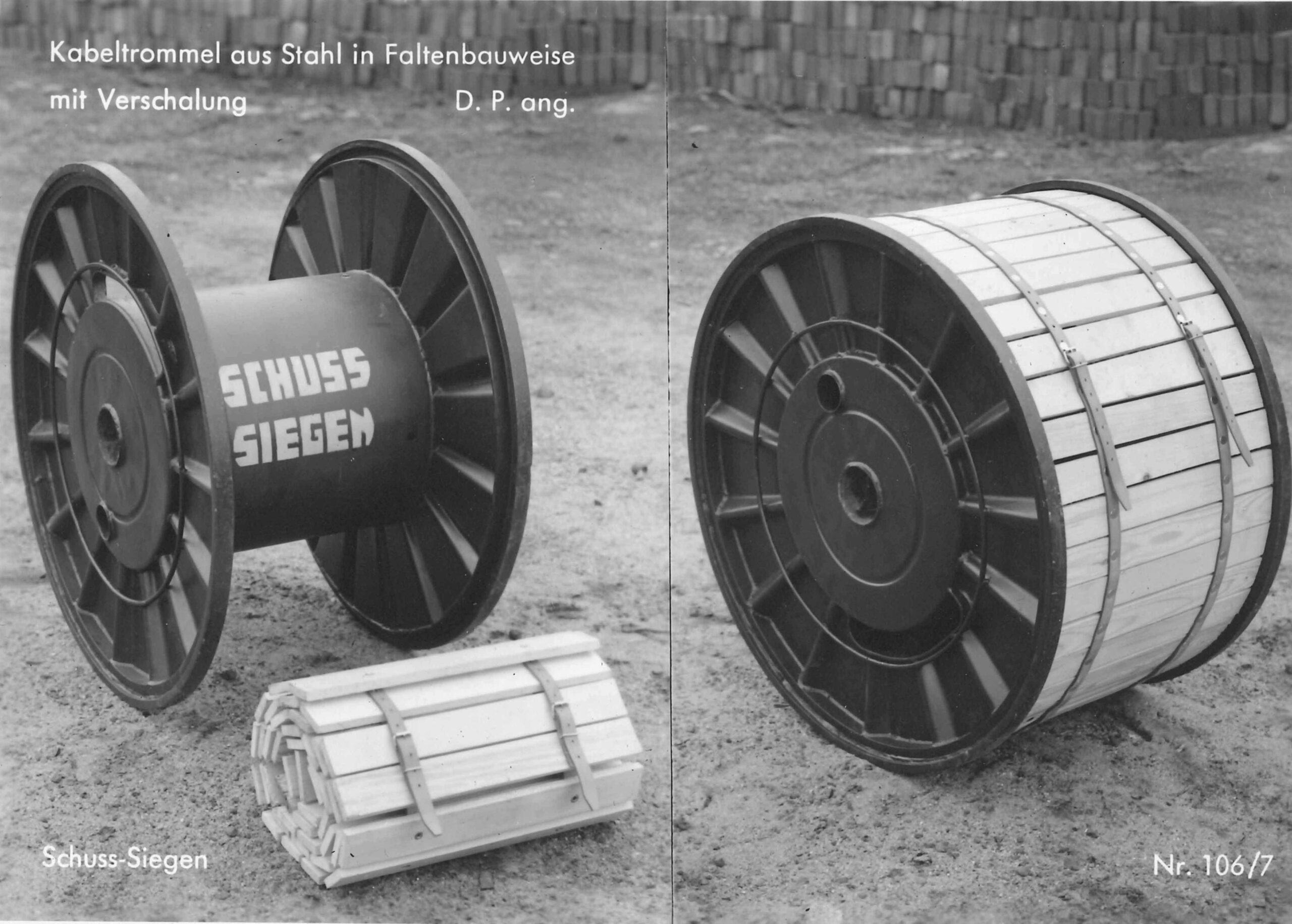
In Lothar Irles „Siegerländer Persönlichkeiten und Geschlechter-Lexikon (Siegen 1974, S. 220) finden sich die Hinweise, dass Menk seit 1972 als Stadtarchivar fungierte und seit 1968 als Synodalarchivpfleger – leider ohne Quellenhinweis.
Manfred Knoche hat via folgender Email siwiarchiv zwei Bilder überlassen, einerseits die heutige Lage der Firma sowie ein Rätsel für den Archivaren:


„[N]ach dem ambitionierten Osterrätsel 2021 Marathon ist es trotz Lösung immer noch schwer zu den Gebrüdern Schuss Informationen zu finden.
Deshalb gefallen Ihnen vielleicht die beiden angehängten Bilder?
Wenn Sie jetzt noch das abgebildete Produkt und den Fotografen dieses Bildes erraten gibt es wie immer einen kleinen Preis :-)“
Meine Antwort lautete: „Dampfkessel, Vakuumbehälter, Rührwerksbehälter, ….. könnte es alles sein. Ich gebe ja zu, dass es schwierig war. Aber ich hatte gedacht, dass irgendjemand einen Bezug zur Firma Schuss gehabt hätte. Nun, gut, dem war wohl nicht so. Den Fotografen vermute ich einmal im privaten Umfeld.“ – Vielleicht kann mir ja jemand helfen?
Vielen Dank, lieber Herr Wolf, für die Gratulation. Das Rätsel hat die Rätselgemeinde schon sehr gefordert. War sehr herausfordernd und leider konnten die wenigsten Rätsel gelöst werden. So wie Herr Knoche nun Sie etwas in die Pflicht nimmt, würde ich Sie bitten noch etwas zum Fotokonvolut mitzuteilen. Wie kam es ins Kreisarchiv, aus welcher Zeit stammen die Aufnahmen und wer ist Foto Wolpert – im Siegerländer Umfeld habe ich diesen Namen bisher nicht gehört. Vielen herzlichen Dank für Ihre Arbeit und viele Grüße aus OWL. S.P.
2 annähnernd identische Ringalben mit den Produktfotografien der Firma Gebrüder Schuss kamen auf dem Weg der Schenkung in das Kreisarchiv. M. E. dienten sie zur Kundenakquise auf Messen oder durch Vertreter.
Eine Datierung ist leider nicht möglich – 1950er Jahre oder früher?
Fotografenmeister Hans Wolpert hatte seinerzeit Anfang der 1950er Jahre sein Studio in Weidenau in der Austr.(Gebäude Fa. Schleifenbaum + Steinmetz) .
Er war bekannt durch seine Industrie-Fotografien. Im April 1955 hat er auch einen 16 mm SW-Stummfilm (ca. 40 min,) über die Stadtwerdungsfeiern in Weidenau, inkl. Umzug der Weidenauer Industrie am 23.4., aufgenommen (s.a. Kreisarchiv). .
Bei diesem Industriefotoatelier begann 1951 auch der heute bekannte Prof. Detlev Orlopp (*1937) seine Lehre als Fotograf.
1. Verantwortlich für die Bombardierung Siegens waren nicht die Kasernen, sondern die Eisenbahnanlagen. Die Kaserne spielten in den alliierten ZielPlanungen keine Rolle. Das lässt sich alles anhand von alliierten Quellen einfach überprüfen.
2. Fissner war ganz gewiss nicht die treibende Kraft bei den Luftschutzmaßnahmen in Siegen, sondern das Luftschutz – Bauprogramm, dass im Oktober 1940 verabschiedet wurde. Dort und in den nachfolgenden Bauprogrammen war fast geschrieben, welchen Umfang der Luftschutz in Siegen besitzen durfte. Dafür gab es dann auch staatliche Zuwendungen und Zuweisungen. Ich meine aber, dass Fissner den Abriss der Synagoge forciert hatte, um dort einen Luftschutzbunker zu errichten. Wenn das ein Verdienst war – ?
Genau wegen dieser Ungenauigkeiten und fehlerhaften Formulierungen ist der Alternativentwurf entstanden. Im Übrigen gilt aber nach wie vor das, was Thomas Wolf an anderer Stelle geschrieben hat: Man hätte sich grundsätzlich mehr Zeit für diese Dinge nehmen müssen.
Die Fraktion Die Linke hat sich intensiv mit den in den letzten Wochen (z. T. noch einmal) veröffentlichten Beiträgen von kundigen Experten und Historikern zur Causa „Fissmer“ – auch ausdrücklich der Begründung der FDP-Fraktion zu deren Antrag – beschäftigt. Und als Konsequenz die eigene Beschlusslage einer Revision unterzogen. Sie nimmt ihre Unterstützung des gemeinsamen Textentwurfs der sechs Fraktionen zurück und enthält sich auch bei einer Abstimmung des FDP-Antrags.
Angesichts der deutlich gewordenen Diskrepanzen und Defizite in der Erforschung der Persönlichkeit und des Handelns Fissmers und der Schwierigkeit ihrer Bewertung erscheint es der LINKEN als angemessen, sinnvoll und notwendig, dass sich zunächst der Arbeitskreis „Aufarbeitung der historischen Hintergründe von Straßennamen in Siegen“ damit in der gebotenen Ruhe beschäftigt bevor ein endgültiger Tafeltext beschlossen werden kann.
Des weiteren wird auch die Beschäftigung mit dem Langtext in Erinnerung gerufen, insbesondere das immer noch fehlende Literatur- und Quellenverzeichnis, zu dem ein Entwurf auf SiWi-Archiv bereits veröffentlicht wurde.
Siegener Zeitung, 15.4.2021 berichtet zur gestrigen Ratssitzung leider nur im Print: „Tafeltext zu Fissmer endlich gebilligt. Breite Mehrheit im Rat für Kompromissformel. Trotzdem tauchen neue Zweifel auf.“ . „Geteasert“ wird mit folgendem Zitat: „Der Hl. Nikolaus war auch kein Demokrat, trotzdem ändert niemand die Bezeichnung Nikolaikirche gleich nebenan.“ (Martin Heilmann, Ratsglied der Grünen)
Zeitungen:
– Das Volk, „Bürgermeister Alfred Fissmer tritt sein Amt in Siegen an“, 19. August 1919
Siegener Nationalzeitung/Siegener Zeitung, „Siegen ist gestern Garnisonstadt geworden – Feierlicher Einmarsch des Infanterieregiments 57, 16. Oktober 1935
Siegener Nationalzeitung, „Richtfest für die Kasernengebäude auf dem Fischbacherberg in Siegen“, 11. September 1936
Pingback: Quellen- und Literatursammlung zur Lebensgeschichte Alfred Fissmers | siwiarchiv.de
Pingback: Erich Moning (1902 – 1967) – Bürgermeister (1929 – 1945) und Oberkreisdirektor im Siegerland (1946 – 1963) | siwiarchiv.de
Pingback: Erich Moning (1902 – 1967) – Bürgermeister (1929 – 1945) und Oberkreisdirektor im Siegerland (1946 – 1963) | siwiarchiv.de
Facebook-Post der Grünen Siegen, 15.4.2021:
Facebook-Post der Grünen Siegen, 16.4.2021:
Es wäre auch möglich, den Namen zurück zu nehmen
und auf einer Tafel zu erklären, warum der Name zurück genommen wurde.
Wäre möglich…immer noch!
Dieser, aus meiner Sicht immer noch mögliche Schritt, ist ein Kompromiss mit den Menschen, die immer noch nicht verstehen wollen oder können, das ein „Fördermitglied der SS“ für eine Ehrung im öffentlichen Raum einer Stadt
vollkommen ungeeignet ist!
Pingback: Video: „Stützen & Schützen“ | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 6.4. – 18.4.2021 | siwiarchiv.de
Literatur:
Sozial- und Versicherungsamt der Stadt Siegen (Hg.) „Vom Armenamt zum Sozialamt“ 100 Jahre Sozialamt der Stadt Siegen. Ein geschichtlicher Rückblick 1993, Siegen 1993
Hallo
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren!
Aus einem Nachlaß bekam ich ein Ölgemälde von Hermann Mannskopf.
56 x 77 cm plus 8 cm Rahmenbreite
Es stellt eine Landschaft dar, die wahrscheinlich im Siegener Umland zu finden ist. Gerne würde ich es an Interessierte weiter geben, nur habe ich keine Ahnung vom Wert des Bildes, noch woher ich seriöse Preisinformationen bekommen kann.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen
und danke Ihnen im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Ulrike Staude
s. a. Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte: https://www.dguf.de/ngo/stellungnahmen/49-regelungen-und-gesetzgebungsverfahren/633-2021-dguf-wirkt-an-novellierung-des-dschg-nrw-mit
s. a. Rainer Schreg: „Auffallend laut! Der Protest der Denkmalpfleger in NRW gegen den Gesetzesentwurf der Landesregierung „, im Blog „Archaeologik“, Link: https://archaeologik.blogspot.com/2021/04/auffallend-laut-der-protest-der.html (Aufuf: 22.4.2021)
Pingback: Fotoalben gesucht | siwiarchiv.de
„1. Es werden in kürzester Frist in ganz Deutschland Aktionen gegen Juden, insbesondere gegen deren Synagogen stattfinden. Sie sind nicht zu stören. Jedoch ist im Benehmen mit der Ordnungspolizei sicherzustellen, daß Plünderungen und sonstige besondere Ausschreitungen unterbunden werden können.
2. … (zu Archivmaterial in Synagogen)
3. Es ist vorzubereiten die Festnahme von etwa 20-30.000 Juden im Reiche. Es sind auszuwählen vor allem vermögende Juden. Nähere Anordnungen ergehen noch im Laufe dieser Nacht.“
…
(Geheimes Fernschreiben des Gestapa-Chefs Heinrich Müller an alle Gestapoleitstellen, 9.11.1938, 23.55 h)
„Geheim! Dringend!
… Für die Behandlung dieser Vorgänge ergehen die folgenden Anordnungen:
1. …
a) Es dürfen nur solche Maßnahmen getroffen werden, die keine Gefährdung deutschen Lebens oder Eigentums mit sich bringen (z. B. Synagogenbrände nur, wenn keine Brandgefahr für die Umgebung vorhanden ist).
b) Geschäfte und Wohnungen von Juden dürfen nur zerstört, nicht geplündert werden. Die Polizei ist angewiesen, die Durchführung dieser Anordnung zu überwachen und Plünderer festzunehmen.“
5. Sobald der Ablauf der Ereignisse dieser Nacht die Verwendung der eingesetzten Beamten hierfür zuläßt, sind in allen Bezirken so viele Juden – insbesondere wohlhabende – festzunehmen, als in den vorhandenen Hafträumen untergebracht werden können.“
(Blitz-Fernschreiben des Chefs der Sicherheitspolizei Reinhard Heydrich aus München an alle Stapoleitstellen und SD-Ober- und Unterabschnitte, 10.11.1938, 1.20 h)
„Funkspruch ssd Berlin Nr. 4 … [Chef der Ordnungspolizei, Kurt Daluege, 10.11.1938, 5.30 h]
…
2. Die Ordnungspolizei begleitet solche Demonstrationen und Aktionen nur mit schwachen Kräften in Zivil, um evtl. Plünderungen zu verhindern.
3. …
4. Zerstörte offene Läden, Wohnungen, Synagogen und Geschäfte von Juden sind zu versiegeln, zu bewachen, vor Plünderungen zu schützen.“
(zit. nach: Wolf-Arno Kropat, Kristallnacht in Hessen. Der Judenpogrom im November 1938 [Schriften der Kommission für die Geschichte der Juden in Hessen, Bd. 10], Wiesbaden 1988, S. 74-77, 189)
„Vielenorts entglitten die Aktionen der Straße der Kontrolle des Regimes. Göring geriet über die angerichteten Sachschäden außer sich. Mehrfach befahl Berlin im Laufe des Tages die Verhinderung von Plünderungen und die Verfolgung der Täter.“ (Anselm Faust, Die „Kristallnacht“ im Rheinland. Dokumente zum Judenpogrom im November 1938, [Veröffentlichungen der staatlichen Archive des Landes Nordrhein-Westfalen, Bd. 24], Düsseldorf 1987, S. 55)
Zu den angesprochenen Orten mit Plünderungen gehörte Laasphe. Plünderer wurden dort angezeigt und es kam zu Strafverfahren, wenngleich mit milden Strafen: Ulrich F. Opfermann, „Mit Scheibenklirren und Johlen“. Juden und Volksgemeinschaft im Siegerland und in Wittgenstein im 19. Und 20. Jahrhundert, Siegen 2009, S. 106)
Mindestens die unmittelbare Vorstufe der Plünderung ist auch für Siegen bezeugt: Das SS-Mitglied Walter Schleifenbaum, einer der später im Brandstifter-Prozess Verurteilten, erklärte in seinem Entnazifizierungsverfahren, in dem er ansonsten zum Thema ein generelles Nichtwissen behauptete, er haben beim den „Ausschreitungen gegen die Juden im November 1938 … auch das zertrümmerte Schaufenster eines jüdischen Geschäftes gesehen.“ (ebenda, S. 111; archivalische Quelle: LAV NRW, Abt. Rheinland, NW 1.112, Nr. 1.768)
So wurde es am 7.11.2010 im Gespräch in der Siegener NS-Gedenkstätte von der Zeitzeugin Hedwig Grimm (* 1931) bestätigt: Die Kölner Straße sei zumindest in einem Teilbereich am Pogromtag mit Scherben übersäht gewesen. Gegenstände seien aus Läden auf die Straße geflogen.
Fazit:
1. Wenn es zutrifft, wie der Zeitzeuge Hugo Herrmann behauptet und wie es inzwischen viele Male in die vorherrschende lokale Überlieferung eingegangen ist, dass nämlich die Verhaftung jüdischer Männer und deren Inhaftierung im Polizeigefängnis Siegen am 9. November 1938 geschah, dann kann es nur eine lokale Initiative ohne Rückendeckung von oben des Polizeichefs der Stadt, des OB Fissmer, gewesen sein. Das sollte es sein, was in den städtischen Texten werden kann.
2. Der Behauptung des Zeitzeugen Hugo Herrmann, der OB Fissmer habe die Initiative ergriffen, um Plünderungen zu verhindern, fehlt zunächst einmal jede Basis. Ganz unzutreffend ist die Behauptung, es sei Militär eingesetzt worden. Das war nirgendwo so. Weder bezieht sich der Sprecher Hugo Herrmann auf eine schriftliche noch auf eine mündliche Quelle, etwa ein Gespräch mit dem OB (das auch sehr unwahrscheinlich wäre). Das wurde Er trägt eine ungedeckte Überlegung vor. Die leider inzwischen viele Male in erweiterten Varianten als „bewiesen“ in die Überlieferung eingegangen ist.
Falls Fissmer in dieser Angelegenheit irgendetwas unternahm, ging es auf eine Anordnung von ganz oben zurück. Er hatte sich an die Vorgaben zu halten und zu schauen, dass andere sich daran hielten.
3. Der Fall liegt also exakt so, wie schon beim Bunkerbau. Das eine wie das andere und auch die Aussagen zu den Zerstörungen im Stadtzentrum sind als Pflichtbaustein in die vorherrschende Überlieferung eingegangen. Die dem entgegenstehenden und seit langem bekannten in der Literatur anzutreffenden Sachverhalte wären zwar auf kurzem Weg zugänglich, wurden und werden jedoch hartnäckig ignoriert. Es lässt der Eindruck sich nicht abwehren, dass sie für die stadtoffizielle Überlieferung nicht zugelassen sind, die es vorzieht, ihn als „deutschnational gesinnten Beamten“ darzustellen, der „eher den Parteien der politischen Mitte und des rechten Flügels zugetan war“ und „auch seit 1933 weiterhin als tatkräftiger Entscheider und Lenker der Siegener Kommunalpolitik“ aufgetreten (HP der Stadt Siegen) und also verehrungs-/erinnerungswürdig sei. Damit wird eine vergangenheitspolitisch unglaubwürdige durchlaufende „demokratische“ Kontinuität des OB von Weimar bis heute festgeschrieben, die ihn als herausragenden Namenspatron für den zentralen Platz der Stadt akzeptabel sein lässt.
Danke für die Klarstellungen, die sich u. a. auf die im Kreisarchiv vorhandenen 30min Video-Interview aus dem Jahr 1981 (Signatur: KrA 4.1.5./39) mit Hugo Herrmann gemachten Aussagen Herrmanns zur Pogromnacht 1938 beziehen! Eine entsprechend gekürzte Version des Videos ist hier einsehbar: https://youtu.be/BSWLjMkxAy8
Pingback: „Juhubiläum“ – LWL-Freilichtmuseum Detmold feiert 50 Jahre Eröffnung | siwiarchiv.de
s. a. https://www.kirchenkreis-siegen.de/?katid=1&newsid=1543 sowie Siegener Zeitung/Heimatland v. 24. April 2021 (Print)
Pingback: Literaturhinweis: Katharina Diez: „Editha“ – eine Neuaflage | siwiarchiv.de
Die Geschichte hinter der Siegener Neuen Zeitung und ihres Hauptschriftleiters Gärtner ist allerdings noch spannender, vor allem, da der stellvertretende Landrat als Investor fungierte… .
Klingt interessant! Kommt da noch mehr? Wir würden uns hier freuen.
Pingback: ine-Broschüre: „Kunst im öffentlichen Raum und Kunst am Bau in Siegen“, Teil 3 –Street Art | siwiarchiv.de
Pingback: Online-Broschüre: „Kunst im öffentlichen Raum und Kunst am Bau in Siegen“, Teil 3 –Street Art | siwiarchiv.de
Pingback: Online-Broschüre: „Kunst im öffentlichen Raum und Kunst am Bau in Siegen“, Teil 3 –Street Art | siwiarchiv.de
Die Broschüre ist wirklich brandaktuell. Selbst „InverSieg“, welches erst vor wenigen Tagen entstanden ist, ist hier mit aufgeführt.
Tolle Arbeit und vielen Dank dafür!
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik April 2021 | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 19.4. – 1.5.2021 | siwiarchiv.de
Pingback: Siegen: Kunst im Treppenhaus geht in die 2te Runde | siwiarchiv.de
Pingback: Einrichtung eines LWL-Industriemuseums im Siegerland? | siwiarchiv.de
Zur Aufarbeitung und Dokumentation der bedeutsamen regionalen Industriegeschichte ist die Einrichtung eines Industriemuseums im Siegerland an einem historisch authentischen Ort unbedingt erstrebenswert. Es ist erfreulich, dass auf den Antrag der FDP Fraktion eine positive Reaktion des Kreisausschusses erfolgte mit Gründung einer Arbeitsgruppe „Industriemuseum“.
Den Aktiven und Beteiligten an der Maßnahme wünsche ich ein interessantes Betätigungsfeld, ein gutes Miteinander, Durchsetzungsvermögen und Erfolg.
Danke für den Kommentar! Gibt es Ideen für den angesprochenen historisch authentischen Ort?
Hallo,
wir hoffen, dass der neue Arbeitskreis des Kulturausschusses hier Vorarbeit leistet. Natürlich wäre die Ausgrabungsstelle Gerhardsseifen (Niederschelden) ein guter Standort. Aber auch das Technik Museum in Freudenberg oder die mittelalterliche Bergbausiedlung Altenberg (Hilchenbach) vorstellbar.
Hallo Frau Dr. Leopold,
vielen Dank für diesen positiven Beitrag. Arbeiten wir nun daran, dass der LWL uns in dem Vorhaben unterstützt!
Lieben Gruß
Guido Müller
Fraktionsvorsitzender FDP Siegen-Wittgenstein
Pingback: Linktipp: Denkmalgerechte Sanierung des Dr.-Dudziak-Parks in Siegen | siwiarchiv.de
Pingback: Linktipp: Denkmalgerechte Sanierung des Dr.-Dudziak-Parks in Siegen | siwiarchiv.de
s. a. Siegener Zeitung von heute(Kulturteil, Print)
In der Siegener Zeitung erschien heute der Leserbrief „Vorarbeiten sind da“, der auf die eisengeschichtliche Ausstellung in Haus Pithan in Netphen verweist und zudem die Bedeutung des Stahlbaus im Siegerland betont, wie sie an einer Eisenbahnbrücke in Dreis-Tiefenbach zu erkennen sei. Die Brücke wurde im Siegerland hergestellt und 1905 inDienst genommen. Schließlich verweist der Leserbrief darauf, dass Industriegeschichte im Siegerland mit Mitteln des sanften Tourismus erfahrbar gemacht werden solle.
Eine sehr interessante Ausstellung. Ist es geplant einen Bildband dazu zu erstellen?
M. W. sind noch Exemplare der 1986 erschienenen beiden Bildbände noch im Buchhandel zu erwerben. Ob eine Neuaflage erfolgt oder gar eine aktuelle Auseinadersetzung mit dem Werk Arnolds, kann ich derzeit nicht absehen.
Ein neuer Versuch, diesmal von der FDP. Sie möchte im Siegerland einen weiteren Standort der LWL-Industriemuseen sehen, von denen sich, nach FDP-Aussage, acht im Ruhrgebiet „knubbeln“. Nur nebenbei: Meine geografischen Kenntnisse führen zu einem anderen Ergebnis!
Bemerkenswert und diskussionswürdig ist aber der Gedanke, „ein LWL-Industriemuseum zur frühindustriellen Geschichte“ in das Siegerland zu holen. Nach meinem Verständnis wäre das eine Einrichtung, die den Zeitraum – grob gesprochen – vor 1850 abdecken würde. Damit würde eine weitgehende Doppelung mit dem LWL-Museum Henrichshütte in Hattingen ausgeschlossen, die für die Zeit nach 1850, das Industriezeitalter, steht.
Einen geeigneten Standort für den FDP-Vorschlag zu finden, dürfte schwer werden. Ich halte ihn gar für unmöglich. Alle alten Hüttenstandorte sind plattgemacht, was wiederum Ausdruck fehlenden Geschichtsbewusstseins ist. Ein Ausweg bietet sich aber an, verlangt aber größere Anstrengungen aller Beteiligten, weil die Vernetzung der regional bereits vorhandenen Einrichtungen wie Historischer Hauberg Fellinghausen, Bergbaumuseum Sassenroth, Wendener Hütte usw. über Landesgrenzen von NRW hinaus erforderlich wäre. Unter einem gemeinsamen Motto, z.B. „nachhaltiges Wirtschaften“, könnten diese Standorte ihre inhaltlichen Schwerpunkte ausbilden und miteinander verbinden. Davon würden zudem alle Einrichtungen profitieren.
Danke für den Kommentar! Die skizzierte Lösung wäre allerdings ein Novum, denn bisher befinden sich die LWL-Industriemuseen an einem (!) historisch authentischen Ort. Die Vernetzung musealer Angebote nicht nur zur frühindustriellen Wirtschaftgeschichte Siegerland-Wittgensteins spielt übrigens auch ein Rolle in der Neuausrichtung des Siegerlandmuseums – s. http://www.siwiarchiv.de/projekt-zeit-raum-region-das-neue-siegerlandmuseum-der-stadt-siegen-mit-zweitem-stern-ausgezeichnet/, an der das Kreisarchiv wegen der angegliederten „Dokumentationsstelle Wirtschaftsgeschchte“ seit fast 3 Jahren mitwirkt.
Lieber Herr Plaum,
wir würden sogar viel früher ansetzen, die Region zwischen Wissen und Siegen ist schon in der Keltenzeit eng mit der Eisenerzverarbeitung verbunden. Hier würde ich ansetzen.
Lieben Gruß
Guido Müller
Lieber Herr Müller,
ich habe von vor 1850 geschrieben, das deckt doch alle interessanten Zeiträume davor ab, es bleibt nur die geschickte Integration aller potentiellen Standorte unter ein gemeinsames Thema.
Noch eine Nachfrage: Sind „maßgebliche Region“, größte bekannte Verhüttungsöfen und „eine der ältesten Industrieregionen“ oder das Fehlen eines LWL-Standortes im südlichen Südwestfalen hinreichende Gründe für ein Museum?
Der oben verlinkte Text auf der Homepage des Siegen-Wittgensteiner Kreisverbandes der FDP findet sich nun auch auf der Facebook-Seite der FDP-FW-Fraktion im Landschaftsverband Westfalen-Lippe:
Pingback: Online: Heinrich Gamann: „Das Missions-Museum in Siegen“ | siwiarchiv.de
Etwas despektierlich gegenüber den anderen Berufen.
Zwar habe ich als Bibliothekar keine so breite Palette an Sachen zu erschließen, obwohl die immernoch von Büchern aller Art über Karten bis zu Switch-Spielen oder Nähmaschinen reicht, aber im Grunde ist meine Aufgabe die Gleiche.
Ich erschließe ein Medium und versuche es so in Zusammenhang zu setzen, dass es nicht nur leicht gefunden werden kann, sondern auch, dass die Kunden leicht weitere Medien zu dem Thema oder von dem Autor uvm. finden können.
Ich sehe da keinen so gravierenden Unterschied, dass man sich so äußern müsste.
Offensichtlich hat sich das ein Archivar*in ausgedacht und umgesetzt, ohne links und rechts zu sehen oder gar mal einen Bibliothekar oder Museologen zu Rate zu ziehen.
Ich finde es schade, dass wir uns in der gemeinsamen Branche so wenig interdisziplinär austauschen.
MfG
Stefan Beer, Bibliothekar
Danke für den Kommentar! Wenn schon eine Abgrenzung notwendig ist, dann sollte diese auch speziell archivische Erschließung verdeutlichen ……
Leicht vereinfacht?
Als Bibliothekarin, die sich jahrelang mit Sacherschließung und inhaltlicher Erschließung grauer Literatur sowie Fachartikeln usw. auseinandergesetzt hat, würde ich Herrn Beer zustimmen und von einer sehr starken Vereinfachung in oben zu sehender Darstellung sprechen. Die Idee mit dem Video finde ich gut, die Umsetzung aber nicht so glücklich.
MfG, Almuth Fröhlich
Danke für den Kommentar! Habe ich ähnlich empfunden.
Pingback: Online-Ausstellung: „Monuments men in Marburg. Das Staatsarchiv Marburg als Central Collecting Point“ | siwiarchiv.de
In der Westfäischen Rundschau erschien heute der Artikel „Grossprojekt: Vorstoss für LWL-Museum zur Industriegeschichte im Siegerland“ – leider nur Print. Der Artikel gibt im wesentlich den Antrag der FDP wieder. Er verweist allerdings auch auf die Diskussion im Kreisausschuss, wenn es um die Frage der Unterbringung eines solchen Museums geht.
Hallo,
Ich habe ein Gemälde von S.Vogt unterschrieben von Ihm.
Es zeigt „Mädchen mit Fruchtschale“ Original ist das Bild von Tizian
Guten Tag Frau Voss-Shabanzadeh,
mein Vater hat einige „Klassiker“ auf Anfrage von Interessenten
kopiert, in der Zeit in Dresden, auch während des Studiums.
Das gehörte in der Kunst-Aka Dresden zur Ausbildung.
In der „Freudenberger Zeit“ allerdings nicht so oft.
Es freut mich, daß Sie noch eine Kopie des Tizian Gemäldes Ihr Eigen nennen.
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 2.5. – 14-5-2021 | siwiarchiv.de
Pingback: Landesregierung NRW beschließt Kulturgesetzbuch – Archivalia
Pingback: Monuments Men in Marburg – Archivalia
s. a. Paul Beckus: Rezension zu: Begass, Chelion: Armer Adel in Preußen 1770–1830 Berlin 2020. ISBN 978-3-428-15652-8, In: H-Soz-Kult, 18.05.2021, <http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-50438>.
Pingback: Errichtung der Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung beschlossen | siwiarchiv.de
Pingback: Bilder und Videos zur KulturPur-Geschichte | siwiarchiv.de
Beratungsverlauf im Kreisausschuss,
„Beratungsverlauf:
Landrat Müller führt gemäß der Vorlage und der dazu ergangenen Ergänzung aus.
KT-Mitgl. Müller ergänzt, dass er das Thema bereits mit dem Kreisarchivar diskutiert habe. Dieser sehe das Problem eines möglichen Wegfalls von Förderungen in kleinen Museumsprojekten, wenn ein LWL-Museum entstünde. Aus anderen Bereichen sei ihm aber bekannt, so KT-Mitgl. Müller, dass Museen auch bei Ergänzung durch ein LWL-Museum weiterhin unterstützt würden. Er sei sich bewusst, dass im Falle eines LWL-Museums der LWL das Sagen habe. Mit Gerhardseifen, mit Freudenberg und dem Altenberg,zwischen Kreuztal und Hilchenbach,gäbe es Potenzial für das Thema. Er spreche sich für einen heutigen Startschuss aus, um das Thema weiter im Fachausschuss diskutieren zu können. Eine dann zu gründende Arbeitsgruppe könne vielleicht im kommenden Jahr bereits erste Ergebnisse liefern.
KT-Mitgl. Sittler stimmt den Aussagen von KT-Mitgl. Müller zu. Er ergänzt, dass es auch Gründe gebe, warum in anderen Regionen mehr gemacht werde. Die Hauptfragen, was soll wie und wo dokumentiert und gezeigt werden, sollten im Arbeitskreis besprochen werden. Dies müsse zusammen mit dem LWL abgestimmt werden. Die bisherigen Versuche seien gescheitert, daher spreche er sich für eine Befassung im Kulturausschuss sowie einer Arbeitsgruppe aus.
Auch KT-Mitgl. Droege signalisiert seine Zustimmung. Der Wirtschaftsraum „Siegerland“ im Drei-Länder-Eck sei die Wiege der Industrie in NRW, nicht das Ruhrgebiet. Zudem gebe es im LWL einen Diskurs darüber, ob zentrale Museumseinrichtungen oder das Konzept dezentraler Stätten verfolgt werden solle. Der Kreis habe viele interessante dezentral Punkte, unter Anderem z. B. auch die Laténeöfen, weshalb es für die Region und für den LWL ein wichtiges Konzept darstelle, welches diskutiert werden müsse. Das dezentrale Erbe stehe oft alleine ohne Verbindung da. Diese Stätten sollten verknüpft werden undkönnten überregional besser vermarktet werden sowiebesser zur Geltung kommen.
KT-Mitgl. Helmkampf erklärt, dass dem Gremium in Münster auch bereits ein Antrag vorgelegt worden sei. Es müsse nun aufgepasst werden, dass es keine „Kollision“ gebe. Er spricht sich ebenfalls für den Antrag der FDP-Fraktion aus. Zwar werde solch ein Thema nicht in Kürze abgewickelt, dennoch sei es von Wichtigkeit für die Region.
KT-Mitgl. Müller ergänzt dazu, dass die Anträge im Vorfeld abgestimmt worden seien.“
Quelle: Kreis Siegern-Wittgenstein, Kreistagsinformationsystem, Kreisausschuss, Öffentliche Niederschrift der Sitzung vom 30.4.2021, S. 7
Eine deutliche Stellungnahme zum Denkmalschutzgesetz NRW: ICOMOS-DE-Stellungnahme-NRW-DSchG (PDF)
Hallo, habe im Nachlass meiner Oma ein Gemälde von S.R. Vogt gefunden.
Auf der Rückseite steht „Matterhorn „. Bin hier auf diese Seite gestoßen. Wäre interessant näheres zu erfahren. Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Schöne Grüße aus der Rhön
D. Fuchs
Es handelt sich wohl nicht um den hier vorgestellten Siegfried Vogt, de in der Regel nicht mit S.R. Vogt signiert hat. Ein Blick in kunsthistorische Lexoka – angefangen mit dem Thieme/Becker – sollte Klarheit verschaffen, welcher Künstler in Frage kommt.
Guten Tag. Ich recherchieren die Auswanderung einer 7 koepfigen Familie im Jahr 1881, von Brandoberndorf nach Amerika. Leider konnte ich auf eine Frage bisher keine Antwort finden : wie reiste die Familie nach Hamburg? Wie lange dauerte diese Reise und gibt es Anhaltspunkte zu den Kosten?
Ich wuerde mich sehr freuen., wenn sie mir weiter helfen könnten.
Herzlichen Dank im voraus und mit freundlichen Grüßen
Karin Guterding
Guten Tag Frau Guterding,
die Literatur zur Auswanderung, speziell zur Auswanderung aus Hessen, ist mittlerweile schon sehr umfangreich. Dort finden Sie etliche Aufsätze und Bücher, die Ihnen weiterhelfen und Einblicke vermitteln, wie die erste Phase der Auswanderung zwischen Heimatort und Hamburg verlief. Ob dort auch Angaben zu Brandoberndorf gemacht werden, müssen Sie dann noch ermitteln. Folgen Sie zunächst diesem Link: https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/gsearch/sn/hebis?q=Auswanderung&submit=LAGIS-Suche.
Pingback: Online: Denkmalpflege in Westfalen-Lippe Heft 2021/1 | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 15.5. – 27.5.2021 | siwiarchiv.de
Deutliche Kritik via Archivalia: https://archivalia.hypotheses.org/132139
Ich versuche es nochmal ;-)
Gegenstand: Es handelt sich um eine Förderschnecke.
Hersteller: Karl Adolf Welsch Apparatebau GmbH
Jahr des Fotos: 1961 (Neugündung des Unternehmens in Eiserfeld)
Jetzt bin ich mal gespannt.
Ein Drittel der Antworten ist richtig. Die Förderschnecke stimmt. Laut Beschriftung handelt es sich um eine Getreideförderschnecke.
Die Firma hatte ihren Stammsitz nicht im heutigen Siegener Stadtgebiet. Auch die Aufnahme ist früher entstanden ……
Ergänzung:
„Flender & Co“, 1910 in „Eiserfeld bei Siegen“ gegründet, spätere Marke „Siegperle“
Umzug in ein größeres Fertigungsgebäude 1918, aus dieser Zeit könnte das Foto auch stammen.
Ich hatte auch die Firma Heinzerling (Fördertechnik) im Blick, die haben früher auch so etwas gebaut.
Die Frage ist schon sehr nahe an der „Millionenfrage“ dran…….
Die gesuchte Firma lag eindeutig einer Nachbarkommune der heutigen Stadt Siegen und ist jünger als die in der Antwort angegebenen Jahreszahlen.
Generell gilt ohne Fleiß kein Preis …..
Nach dem Relaunch ist vor dem Relaunch – s. Kritik auf Archivalia: https://archivalia.hypotheses.org/132172
Pingback: Novellierung des Denkmalschutzgesetzes und die Bedeutung der Änderungen für die Stadt Siegen | siwiarchiv.de
Pingback: Novellierung des Denkmalschutzgesetzes und die Bedeutung der Änderungen für die Stadt Siegen | siwiarchiv.de
Pingback: Novellierung des Denkmalschutzgesetzes und die Bedeutung der Änderungen für die Stadt Siegen | siwiarchiv.de
Pingback: Novellierung des Denkmalschutzgesetzes und die Bedeutung der Änderungen für die Stadt Siegen | siwiarchiv.de
Pingback: Video: „Den Vorfahren auf der Spur: Ahnenforschung und Hausnamen“ | siwiarchiv.de
Pingback: Wittgensteiner Familiendatei Jochen Karl Mehldaus zum Download | siwiarchiv.de
Pingback: Möglichkeiten eines weiteren Standorts der LWL-Industriemuseen mit Blick auf die kulturhistorische Bedeutung der Eisenverhüttung in der Region des Siegerlandes | siwiarchiv.de
Sorry, ich denke eine Partei möchte sich hier in Erinnerung rufen und ohne konkrete Pläne und Finanzierungszusagen Aufmerksamkeit „erzeugen“. Fordern und kritisieren (wie in den vergangenen Wochen) geht ja immer, hauptsache Öffentlichkeit. Pläne für ein Museum lagen z.B. beim Reinhold-Forster-Stollen bereits vor. Die Umsetzung konnte bis heute aus verschiedenen Gründen nicht realisiert werden. Leider. Glück Auf P.S. „FDP: Die Verwaltung wird beauftragt, Möglichkeiten eines weiteren Standorts der LWL-Industriemuseen mit Blick auf die kulturhistorische Bedeutung der Eisenverhüttung in der Region des Siegerlandes zu prüfen. Die Verwaltung wird im Kreis Siegen-Wittgenstein nach möglichen Kooperationspartnern suchen, mit denen sich eine erweiterte Darstellung der Industriegeschichte Westfalens umsetzten ließe.“ … Wahlkampf!
Danke für den Kommentar! Wann waren die Pläne um den Reinhold-Forster-Erbstollen akut? Mir bekannt sind Ideen aus dem Jahr 1984 zur Nutzung des Alten Brauhauses in Siegen und Diskussion um das Jahr 2000.
Die Betrebungen der FDP-Kreistagsfraktion sind ja recht anerkennenswert, jedoch stellt sich hier die Frage, warum die „Polit-Aktivisten“ sich bisher denn niemals um dieses schon jahrzehntealte Thema gekümmert haben. Ist denn niemandem bisher aufgefallen, dass es keinen authentisch historischen Ort innerhalb des Siegerlandes mehr gibt, wo noch irgendein Original Zeugnis der alten Montan-Industriekultur erhalten geblieben ist. Einen geeigneten verkehrsgünstigen historischen Ort für den erforderlichen Neubau, oder Ausbau eines Siegerländer-Industriemuseums kann man vielleicht ja u.U. noch finden (s.a. div. Vorschläge i.d. Literatur), aber man wird vom LWL oder der NRW-Landesregierung sicher keinerlei finanzielle Unterstützung erwarten können, wenn sich nicht zuvor die Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Siegen einig wird, um gemeinsam einen bestgeeigneten Ort für ein derartiges Industriemuseum als Außenstelle des Siegerlandmuseums im Siegerland (und nicht ausschließlich in der Stadt Siegen) zu finden.
Die Latenezeitlichen Ausgrabungen in Niederschelden- Gerhardseifen liegen dafür wohl verkehrsmäßig etwas zu ungünstig.
Die Bestrebungen der Stadt Siegen den Burgstraßenbunker für eine Erweiterung des Siegerlandmuseums (Abt. Siegerländer Montan-Industriekultur) für über 16 Mio Euro mit Landes-Steuermitteln erst einmal publikumsbegehbar zu machen, ohne auch nur einen einzigen historischen örtlichen Bezug zum Thema und auch nebenbei ohne die erforderlich günstige Verkehrsanbindung bieten zu können, sollte doch zumindest Herrn Landrat Müller und eigentlich auch der FDP-Kreitagsfraktion bekannt sein.
s.a. auch unter :
http://www.siwiarchiv.de/siegen-foerderverein-sammelte-2-millionen-euro-fuer-museumserweiterung/
Es wäre eigentlich recht schade, wenn sich diese begrüßenswerte Aktivität mehr oder weniger nur als eine Wahl-Werbung der Kreistags-FDP herausstellen sollte.
Danke für den Kommentar! Die Skepsis mag angebracht sein, nicht bezüglich der regionalen Bedingungen, sondern auch bezüglich der Einbettung eines solchen Projektes in die LWL-Museumsstrategie.
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 28.5. – 9.6.2021 | siwiarchiv.de
Pingback: MGKSiegen veröffentlicht neues digitales Angebot zu Fotografien von Bernd und Hilla Becher | siwiarchiv.de
Ein Wochenendtipp: Die Firma befand sich im nördlichen Siegerland …. ;-)
Pingback: Fotoausstellung: „Otto Arnold“ im LYZ. Impressionen. | siwiarchiv.de
Vielleicht die Firma Otto Klein, Ferndorf?
Der folgende Tipp „kostet“ jetzt aber eine recht präzise Beantwortung der dritten Rätselfrage: Kreuztal ist es nicht!
Weitere Funde:
– Bundesarchiv Berlin, R 1501[Reichsministerium des Innern] Nr. 8204, enthält: Aufhebung der Abordnung des Oberlandrats von Rumohr zum Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete, 1942
– Bundesarchiv Ludwigsburg, B 162 [Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen] Nr. 26009, Anzeige der VVN gg. den Präsidenten des Bundesverwaltungsamtes, K. von Rumohr, wg. mutmaßlicher Beteiligung an der Deportation der jüdischen Bevölkerung als Oberlandrat in Mährisch-Ostrau im Jahre 1939, 1964 – 1966
– Bundesarchiv Koblenz, N 1086 [Nachlass Hermann Louis Brill] Nr. 45, Korrespondenz Buchstaben A – F, 1955, enthält u. a..: Bundesausgleichsstelle beim Bundesministerium des Innern, Schriftwechsel mit Ministerialrat von Rumohr
– Bundesarchiv Berlin, R 9361-II [Sammlung Document Center] Nr. 862970
– Bundesarchiv Berlin, VBS 1027 (R 6)/ZD I 3597 [Personalakte 1941 – 1942]
– Kreisarchiv Märkischer Kreis, F 2670, Landrat Karl von Rumohr, sw-Foto
Links:
– Wikipedia-Eintrag
– Eintrag im regionalen Personenlexikon zum Nationalsozialismus in den Altkreisen Siegen und Wittgenstein
– https://ns-reichsministerien.de/2020/10/05/karl-von-rumohr/
– Eintrag im Internet-Portal „Westfälische Geschichte“
Literatur:
– Bundesverwaltungsamt (Hg.): 50 Jahre BVA, Köln 2010, S. 18-19, Link
– Herrmann A. L. Degener, Walter Habel: Wer ist wer? Band 13. Schmidt-Römhild, 1958, S. 1075.
– Palm, Stefanie/Stange, Irina: Vergangenheiten und Prägungen des Personals des Bundesinnenministeriums, in: Bösch, Frank/Wirsching, Andreas (Hrsg.): Hüter der Ordnung. Die Innenministerien in Bonn und Ost-Berlin nach dem Nationalsozialismus (= Veröffentlichungen zur Geschichte der deutschen Innenministerien nach 1945, Bd. 1), Göttingen 2018, S. 122-181
– Stockhorst, Erich : Fünftausend Köpfe: Wer war was im Dritten Reich? Blick + Bild Verlag, 1967, S. 354.
Literatur:
– Dröge, Martin: Die Tagebücher Karl Friedrich Kolbows (1899 – 1945). Nationalsozialist der ersten Stunde und Landeshauptmann der Provinz Westfalen, Paderborn 2009, S. 513
Archivalien:
– Institut für Zeitgeschichte–Archiv MA 246 [Besetzte Gebiete Ost]/ 1, 1937-1945, enthält u.a.: Ernennung Oberlandrat Rumohr zum Abwehrbeauftragten für das Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete (mit Rundschreiben vom 06. Januar 1942), 205-206, 339
– Kreisarchiv des Märkischen Kreises, LA Is A / Landratsamt Iserlohn Bestand A, Nr. 263, Besetzung der Landratsstelle, 1912 – 1938, enth. u.a.: Antrittsschreiben des stellvertretenden Landrats von Rumohr,1935
Literatur:
– Krebs, Albert: Fritz-Dietlof Graf von der Schulenburg. Zwischen Staatsräson und Hochverrat, Hamburg 1964, S. 70, 159, 308, 312, 313, 319, Link: https://www.zeitgeschichte-hamburg.de/contao/files/fzh/Digitalisate/Albert%20Krebs%20Fritz-Dietlof%20Graf%20von%20der%20Schulenburg.pdf
– Fleischhauer, Markus: Der NS-Gau Thüringen 1939-1945. Eine Struktur- und Funktionsgeschichte, Köln 2010, S. 228
– Frank Bösch/Andreas Wirsching (Hg.): Abschlussbericht zur Vorstudie zum Thema »Die Nachkriegsgeschichte des Bundesministeriums des Innern (BMI) und des Ministeriums des Innern der DDR (MdI) hinsichtlich möglicher personeller und sachlicher Kontinuitäten zur Zeit des Nationalsozialismus«, München/Potsdam 2015, in: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2015/abschlussbericht-vorstudie-aufarbeitung-bmi-nachkriegsgeschichte.html., S. 96 – 98
Pingback: Volksaufstand des 17. Juni 1953 in der DDR – Archivalia
Pingback: Vom Ende des Siegerländer Erzbergbaus | siwiarchiv.de
Pingback: Die Veröffentlichung der Wittgensteiner Familiendatei • Verein für Computergenealogie e.V. (CompGen)
Das Zitat stammt aus: Robert M. Edsel, Monuments Men. Auf der Jagd nach Hitlers Raubkunst (Wien: Residenz Verlag, 2013).
Zu leicht? Schlaflos wegen Vollmond? Oder Google? Korrekt ist die Antwort jedenfalls- Gratulation!
Herzlichen Dank, ich freue mich auf den Preis!
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 10.6. – 25.6.2021 | siwiarchiv.de
1) „Denkmalschutz bremst Wohnungsbau
Besonders in den großen NRW-Städten herrscht massive Wohnungsnot. Es braucht tausende neue Wohnungen, doch manchmal steht da der Denkmalschutz im Weg. Die Hürden für den Abriss alter Gebäude sind oft hoch. Da will NRW Bauministerin Scharrenbach nun ran. Künftig sollen sich nicht mehr die Landschaftsverbände um den Denkmalschutz kümmern, sondern nur noch die Kommunen. In den Bauämtern kommt das gut an, bei den Freunden von historischen Gebäuden dagegen gar nicht.“ – ein Beitrag in der Sendung westpol (WDR) v. 20.6.2021, Link: https://www.ardmediathek.de/video/westpol/westpol/wdr-fernsehen/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTRkNzFlMDU5LWRmMTgtNDlhNi1iMTE5LTNjZTgzNWQ5NTYxNQ/
2) Auch die Restaurator:innen unterstützen die Petition: https://www.restauratoren.de/petition-gegen-das-denkmal-nicht-schutzgesetz-in-nrw/
3) „Novelle des Denkmalschutzgesetzes entsetzt Denkmalschützer*inne“, WDR Lokalzeit aus Köln. 22.06.2021, Link: https://www1.wdr.de/fernsehen/lokalzeit/koeln/videos/video-novelle-des-denkmalschutzgesetzes-entsetzt-denkmalschuetzerinnen-100.html
4) Der Westfälische Heimatbund untersützt die Petition, s. Pressemitteilung des LWL v. 22.6.2021, Link: https://www.lwl.org/pressemitteilungen/nr_mitteilung.php?urlID=52730
5) s. a. Blog „Archaeologik“, 23.6.2021: https://archaeologik.blogspot.com/2021/06/gegen-das-neue-denkmal-nicht.html
Bei der Abbildung des Artikels von Gamann ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Anstatt die Seite 178 als weitere Kopie mit einzubinden, folgt eigentümlicherweise die Seite 176, auf der aber das Museum im Oberen Schloss thematisiert wird. Das lässt sich sicherlich leicht beheben und aktualisieren.
Danke für den Hinweis! Es wird so bald wie möglich geändert werden.
Erledigt!
Pingback: Aus Wittgensteiner Familiendatei entstand Online-OFB „Wittgensteiner Land“ | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik Juni 2021 | siwiarchiv.de
Pingback: Aus Wittgensteiner Familiendatei entstand Online-OFB „Wittgensteiner Land“ – Archivalia
Ich habe ja hier bereits auf den Fissmers Beteiligung am Kulturgutschutz hingewiesen. Vielleicht lohnt auch hier noch eine weitere Forschung, denn neben den rheinischen und westfälischen Kulturgüter war im Hainer Stollen auch Kulturgut aus Metz untergebracht. Eine Provenienzforschung ist m.E. angezeigt. Denn dann könnte es wieder ein sowohl als auch geben: Fissmer der mittelbare Kulturgutschützer und der mittelbar Beteiligte am NS-Kunstraub. (Einstiegsliteratur (!): Robert M. Edsel/Bret Witter: Monuments men. Die Jagd nach Hitlers Raubkunst, St. Pölten 2013)
Pingback: Ausstellung zum Fotografen Otto Arnold | siwiarchiv.de
Herr Lohrum mein Name ist Sigi Gomez und ich werde am 21.7
60 Jahren inGEISWEID. Meine Frage: Sind Sie der Meinung dass ich auch habe mein Beitrag geleistet zur der Erhaltung der Stahlwerk Südwestfalen?
Könnten Sie bitte verdeutlichen, imwieweit Ihre Frage sicj auf die vorgestellte Publikation bezieht? M. W. war Kinderarbeit 1960 bereits untersagt.
Pingback: „Siegerland“ Bd. 98, Heft 1 (2021) erschienen | siwiarchiv.de
Zu Helmut Baldsiefen s. https://www.lwl-archaeologie.de/de/blog/helmut-baldsiefen-aus-netphen-ist-80-jahre/ mit Link zu einer PDF-Version des Beitrages!
Bitte bei meinem Aufsatz im Inhaltsverzeichnis das Wort Kraftpot noch in Kraftpost abändern! Vielen Dank!
Danke für den Hinweis! Ist Erledigt.
Hallo ich würde gerne die Modelle aus Papier von Burbach kaufen bitte um Nachricht und kosten mit freudlichenn Grußen M. Schroeren
Fragen Sie bitte direkt bei der Gemeinde Burbach via E-Mail nach.
Auszug aus der Niederschrift der LWL-Kulturausschusssitzung vom 9.6.2021:
“ ….. Herr Arens (FDP) erläutert, dass es ein Defizit gebe, was den Inhalt in Bezug auf die Industriegeschichte im Siegerland angehe. Zudem sei der LWL dort bisher nur schwach vertreten.
Herr Stilkenbäumer (CDU) begrüßt den Antrag der FDP. Das Siegerland falle hinter der Förderung anderer Regionen zurück. Da in der Region aber auch noch andere Aspekte beleuchtet werden müssten, solle der Beschlussvorschlag angepasst werden.
Frau Dr. Rüschoff-Parzinger (LWL) weist darauf hin, dass ein kulturpolitisches Konzept erarbeitet worden sei, in dem auch festgestellt wurde, dass Südwestfalen weniger repräsentiert sei. Sie halte es also für sinnvoll den gesamten Bereich zu beleuchten. Die Errichtung eines weiteren Standorts des LWL-Industriemuseums, die die FDP-FW-Fraktion in ihrem Antrag gewünscht habe, könne als Beispiel mit in den Antrag aufgenommen werden.
Frau Hegerfeld-Reckert (SPD) macht den Vorschlag, dass die Anträge zukünftig digital über die Beamer angezeigt werden. Frau Rüschoff-Parzinger hält dies für sinnvoll.
Nach eingehender Diskussion einigt sich der Kulturausschuss auf einen Kompromiss zwischen dem Vorschlag von Herrn Stilkenbäumer und dem Antrag der FDP-FW-Fraktion und empfiehlt dem Landschaftsausschuss einstimmig folgenden Beschluss:
„Die Verwaltung wird auf Grundlage des kulturpolitischen Konzeptes beauftragt, dem Kulturausschuss einen Bericht über die kulturelle Infrastruktur in Südwestfalen zu geben und zu prüfen, ob Möglichkeiten zur Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen dem LWL und den schon vorhandenen kulturbedeutsamen Infrastrukturen in Südwestfalen bestehen. Unter anderem soll die Möglichkeit eines weiteren Standortes der LWL-Industriemuseen mit Blick auf die kulturhistorische Bedeutung der Eisenverhüttung in der Region des Siegerlandes geprüft werden.“
Quelle: LWL, Sitzungsdienst
Pingback: Karl Albert von Rumohr. Zweiter Versuch über eine Beamtenkarriere: | siwiarchiv.de
Zur politischen Situation in Brilon um 1930 s.: „Ganz besonders schwierig gestaltete sich für die Nationalsozialisten der Aufbau der Partei im Kreis Brilon. Die Gauchronik berichtet, dass es in diesem Kreis bis ins Jahr 1930 nicht möglich gewesen sei, irgendeine nationalsozialistische Organisation aufzuziehen. Die Bevölkerung sei zu 100 Prozent in den katholischen Einrichtungen und in der kirchlichen Gewerkschaft organisiert gewesen. Von Arnsberg aus angesetzte Versammlung seien völlig ergebnislos verlaufen. Erst durch die Weltwirtschaftskrise und die damit verbundenen sozialen Auswirkungen auf die Bevölkerung gewann die NSDAP im Kreis Brilon allmählich an Boden.
Zentrum der politischen Agitation entwickelte sich nicht die Kreisstadt Brilon, sondern die Stadt Olsberg“. in: Schulte-Hobein, Jürgen: Zwischen Demokratie und Diktatur – der Aufstieg des Nationalsozialismus in der Kreisverwaltungen des Hochsauerlandes. In: Der Landrat: Werden. Wachsen.
Wirken. Vom Wandel der Zeit – Kreisverwaltung im Hochsauerland von 1817 bis 2007, Arnsberg 2007, S. 178f. Danke an das Archiv des Hochsauerlandkreises für das Zitat!
Es gibt noch auszuwertende Berichte über die Produktion und Verteilung von Flugblätter durch Mitglieder der katholischen Kirchengemeinde St. Marien auch über die erwähnten „Christenkreuz und Hakenkreuz“- Exemplare hinaus, auch über konspirative Treffen von katholischen Lehrern in der Gaststätte auf der Eremitage. Zusammen mit der besonderen Rolle von Pfarrer Ochse dürfte der Führungskreis der Gemeinde unter besonderer Beobachtung gestanden haben, um dann bei der erwähnten Aktion Gewitter arrestiert zu werden. Es wäre sehr spannend, die Rolle der Kirchengemeinde und der ehemaligen Zentrumsmitglieder – auch im Hinblick auf die später entstehende CDU – nochmals genauer unter die Lupe zu nehmen. Ich vermute, auch ohne das Etikett Widerstand übermäßig zu strapazieren, könnte es hier interessante Ergebnisse geben.
Vielen Dank für den Hinweis!
Betroffene der Verhaftungen nach 20. Juli 1944:
Josef Balogh, Link: http://widerspruch-und-widerstand-im-ns-in-siegen-und-wittgenstein.de/verzeichnis/biografische-skizzen#balogh und http://akteure-und-taeter-im-ns-in-siegen-und-wittgenstein.de/verzeichnis/gesamtverzeichnis#balogh
Heinrich Bamberg, Link: http://widerspruch-und-widerstand-im-ns-in-siegen-und-wittgenstein.de/verzeichnis/biografische-skizzen#bamberg1
Karl Born, Link: http://widerspruch-und-widerstand-im-ns-in-siegen-und-wittgenstein.de/verzeichnis/biografische-skizzen#born
Peter Brinkschulte, Link: http://widerspruch-und-widerstand-im-ns-in-siegen-und-wittgenstein.de/verzeichnis/biografische-skizzen#brinkschulte1
Adam Henrich, Link: http://widerspruch-und-widerstand-im-ns-in-siegen-und-wittgenstein.de/verzeichnis/biografische-skizzen#henrich1
Ludwig Popp, Link: http://widerspruch-und-widerstand-im-ns-in-siegen-und-wittgenstein.de/verzeichnis/biografische-skizzen#popp
Ernst Schramm, Link: http://widerspruch-und-widerstand-im-ns-in-siegen-und-wittgenstein.de/verzeichnis/biografische-skizzen#schramm
Erich Schutz, Link: http://widerspruch-und-widerstand-im-ns-in-siegen-und-wittgenstein.de/verzeichnis/biografische-skizzen#schutz1
Josef Stock, Link: http://widerspruch-und-widerstand-im-ns-in-siegen-und-wittgenstein.de/verzeichnis/biografische-skizzen#stock
Karl Wilhelm, Link: http://widerspruch-und-widerstand-im-ns-in-siegen-und-wittgenstein.de/verzeichnis/biografische-skizzen#wilhelm
Laut E-Mail des Stadtarchivs Ostrava v. 21.7.2021 erscheint Rumohr nicht in der dort vorhandenen deutschen bzw. tschechischen Zeitungen. Lediglich im Findbuchwort des Bestandes „Oberlandrat Mährisch-Ostrau“ wird Rumohr erwähnt; demzufolge trat er Mai 1939 seine Stelle der an. Der erwähnte Bestand befindet sich im Provinzialarchiv in Opava – es wurde bereits angeschrieben.
Pingback: Hinweis: Beitrag zum Siegener Krönchen | siwiarchiv.de
Ein rotes Metallrad mit schwarzer Gummiummantelung/-bereifung und orangenem Gestänge. Vielleicht ein Teil eines Messrades o. ä.
Eine alte Dartscheibe?
Ein farblich grau umrandetes Kirchenfenster von Innen.
Vielen Dank für den Eintrag. Ich hatte das Thema „Ehrung von Gerhard Stötzel in seinem Geburtsort Grissenbach“ ja in einem Leserbrief angesprochen, der am 26. Juli 2021 in der Siegener Zeitung veröffentlicht worden ist. Der Dorfplatz neben der katholischen St. Elisabeth-Kapelle hat ja bisher noch keinen Namen. Da bietet sich ein Gerhard-Stötzel-Platz ja geradezu an. Ich bin sehr gespannt, wie sich die sonst ja leider heillos zerstrittenen Netphener Kommunalpolitiker*Innen in dieser Angelegenheit positionieren werden.
Pingback: siwiarchiv-Sommerferien-Foto-Rätsel 2021/2 | siwiarchiv.de
Danke für die Information! Gibt es da bereits einen Antrag an den Stadtrat?
Der Titel des Eintrages übernimmt eine Schlagzeile der Siegener Zeitung vom vom 26. Januar 2002, Link: https://www.siegener-zeitung.de/netphen/c-lokales/erster-arbeiter-im-reichstag_a36595 .
Ich finde es hervorragend, dass diesem verdienten Siegerländer endlich die ihm gebührende Ehre (hoffentlich) zuteil wird.
Es wäre zu überlegen, ob und wie weitere Würdigungen im Siegerland erfolgen können.
Rad einer Seifenkiste (o.ä.)
Die Kölnische Zeitung ist von 1803 bis 1945 online im Volltext recherchierbar – https://zeitpunkt.nrw/ulbbn/periodical/titleinfo/9715711. Eine erste Recherche zu Fissmer ergab einige Treffer – u.a. auch diesen vom 21.8.1944:
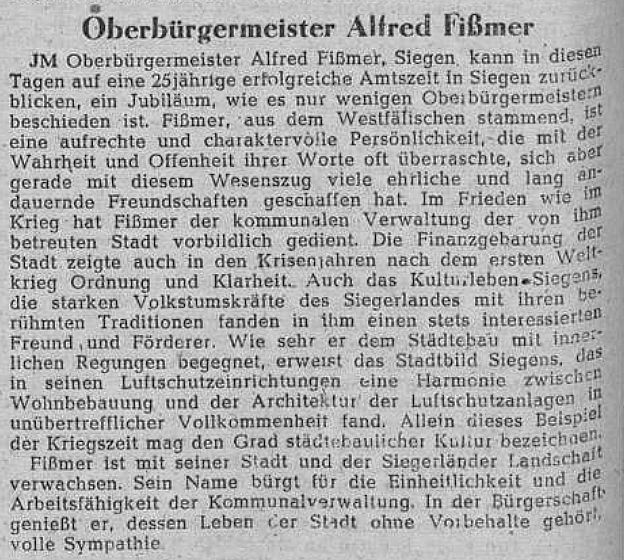
s. a. diesen Hinweis des Siegener Stadtarchivs aus dem Jahr 2013: „Bereits 1936 wandte sich die Stadt Siegen auf Anregung eines in Hamburg lebenden Heinrich Irle an die Hapag in Hamburg und den Norddeutschen Lloyd in Bremen mit der Bitte eines ihrer Schiffe auf den Namen „Siegerland“ zu taufen. Zitat aus der Antwort des Norddeutschen Lloyd an den Herrn Oberbürgermeister: „Daß auch die Stadt Siegen und das Siegerland den Wunsch besitzt, den Namen ihres Landes durch ein deutsches Schiff vertreten zu sehen, ist begreiflich, zumal dieser Name, wie Sie selbst sagen, noch wenig bekannt ist. Aber gerade aus diesem Grund dürfte der Name ‚Siegerland‘ bei der Einstellung der Welt zu unserem deutschen Vaterlande im Auslande ganz anders ausgelegt und ihm eine Bedeutung gegeben werden, die keinesfalls erwünscht sein kann. Sie werden daher auch verstehen, wenn wir aus diesem Grunde Ihrer Bitte … nicht entsprechen können.“ (Quelle: Stadtarchiv Siegen, Best. Stadt Siegen D 313)“, Link: http://www.siwiarchiv.de/taufe-schiff-siegerland-1/
s. a. „Die neue Woche. Zeitgeschehen in Wort und Bild. Sonntagsbeilage zum neuen Tag“, Köln, Sonntag 9. August 1936:
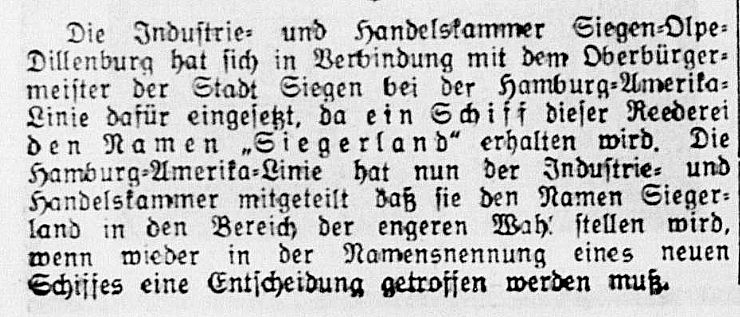
Pingback: Ausstellung: „Paul Neiner fotografiert den Bau der Siegtalbrücke (1964-69)“ | siwiarchiv.de
Zum Umzug des Tübinger Stadtarchivs s. https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/tuebingen/archiv-tuebingen-zieht-nach-kirchentellinsfurt-100.html . Via Archivalia.
Pingback: siwiarchiv Monatsstatistik Juli 2021 | siwiarchiv.de
Die Petition hat die ersten 10.000 Zeichnungen.
Zur Causa Stadtarchiv München gibt es eine neu Entwicklung s. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-stadtarchiv-streit-chef-1.5370533 . Zitat: „…. Der langjährige Chef des Archivs, Michael Stephan, hätte zwar lieber auch die Geschichts- und Erinnerungsarbeit auf Dauer in seiner früheren Behörde gesehen, doch mit dem jetzt erzielten Ergebnis sieht er das Schlimmste abgewendet. Lieber „ein schlechter Kompromiss“ als gar keiner, sagte er. ….“ [Anm.: Hervorhebung durch archivar]
Das ist natürlich ein alter Trainingsdiskus, anlässlich der Olympischen Spiele …..
Bitte keine Rückfragen des Archivars, wem der denn gehört haben könnte, und wer das Foto gemacht hat.
Pingback: Kreisarchiv Altena: Etwa zehn Prozent der Katasteramtsakten, darunter historische Unterlagen des Urkatasters ab 1830 sind unwiederbringlich verloren – Archivalia
Schön wenn etwas wiederhergestellt wird
Danke für Ihre Nachricht. Ich habe Ihren Text der Familie und unseren Freunden weitergeleitet und immer ein positives feedback erhalten.
Ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfüllung in Ihrer Tätigkeit.
Wolfram Vogt
Mit einer Email v. 4.8. verweist das Landesarchiv Opava auf folgende Literatur:
– Naudé, Horst: Erlebnisse und Erkenntnisse. Als politischer Beamter im Protektorat Böhmen und Mähren 1939-1945, München 1975, S. 28, 109, 138
– Kokošková, Zdeňka/Pažout, Jaroslav/Sedláková Monika: Úřady oberlandrátů v systému okupační správy Protektorátu Čechy a Morava a jejich představitelé, Dolní Břežany 2020, S. 133 – 135 [Biogramm Rumohrs mit Bild und Quellenangaben]
– Link zum Bestand „Oberlandrat Mährisch Ostrau“ im Landesarchiv Opava: https://digi.archives.cz/da/permalink?xid=66b2f14a85958f4b0ff6e8ae1ca6c2be
… Wie Herr Vogt dazu kam, in die NSDAP einzutreten? Das wage ich nicht zu beurteilen, ob er einen Weg daran vorbei hätte wählen können. Das waren nur wenige, die sich da schon entgegen stellten.
In den 70er Jahren war er mein Lehrer. Er war einer der wenigen, die über die NS-Zeit und den Krieg sprachen. Er warnte vor den Anfängen, der Aufrüstung und dem Kriegsdienst, und zwar klar und deutlich und sehr persönlich.
Er erzählte davon, wie der Krieg die Menschen und die Menschlichkeit ruiniert.
Vielleicht eine späte Erkenntnis, zu spät für die eigene Biographie… aber gut für die nächste Generation.
Nochmals bedanke ich mich für Ihre Erinnerungen an Siegfried Vogt! Erlauben Sie mir eine Nachfrage: können Sie sich erinnern, ob Vogt sich auch Ihnen gegenüber über seine Zugehörigkeit zur NSDAP geäußert hat?
Ausnahmsweise (siehe oben) kein Kommentarspam, sondern schonungslose Kritik. Die Liste ist schon deshalb unbrauchbar, weil eine für eine Fernleihbestellung essentielle Angabe fehlt, nämlich das zur Nummer gehörige Jahr.
Die in gewohnt liebenswürdiger Art und Weise vorgetragene Kritik nehmen wir gerne auf: Jahrgänge….. Was fehlt noch?
„Der Henner-und-Frieder-Comic am Siegufer zieht um. Das Kunstwerk des Jugendkulturvereins „Jugend mal anders“ erhält an der Universität Siegen ein neues Zuhause. ….“ s. Universität Siegen, Pressemitteilung, 6.8.2021, Link: https://www.uni-siegen.de/start/news/oeffentlichkeit/951084.html
Mit seiner Email v. 4.8. verweist das Landesarchiv Opava auf Unterlagen im Tschechischen Nationalarchiv in Prag zu Karl von Rumohr:
– NA, NSDAP sign. 123-530/4 kart 4
– NA, URP sign. 114-2/43 kart. 7 and
– NA URP-ST sign. 109-4/347 kart. 30.
Die Hefte 1 bis 4 erschienen 1977.
Die Hefte 5 und 6 erschienen 1978.
Die Hefte 7 bis 9 erschienen 1979.
Die Hefte 10 und 11 erschienen 1980.
Die Hefte 12 bis 14 erschienen 1981.
Die Hefte 15 und 16 erschienen 1982.
Die Hefte 17 und 18 erschienen 1983.
Die Hefte 19 und 20 erschienen 1984.
Die Hefte 21 und 22 erschienen 1985.
Die Hefte 23 und 24 erschienen 1986.
Die Hefte 25 und 26 erschienen 1987.
Die Hefte 27 und 28 erschienen 1988.
Die Hefte 29 und 30 erschienen 1989.
Vielen Dank für die Ergänzungen! Sie werden noch eingearbeitet werden.
Auch das „Orts-Gesetz über die Benutzung der Wasserleitung des aus den Gemeinden Krombach, Eichen und Stendenbach bestehenden Zweckverbandes vom den 1. September 1910 ist in der Zwischenzeit von der ULB Münster online gestellt worden: https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6:1-423864
Dies ist auch für die Gemeinde Eichen (1912) online: https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:6:1-423274
Pingback: Ausstellungseröffnung „Demos, Discos, Denkanstöße“ in Netphen | siwiarchiv.de
Regionale Veröffentlichungen zu Carmen Klein (Auswahl):
Siegener Zeitung 16.11.1965, 6.8.1970, 8.8.1970
Westfälische Rundschau 6.8.1960
Irle, Lothar: Siegerländer Persönlichkeiten- und Geschlechter-Lexikon, Siegen 1974, S. 178
Siegerländer Heimatkalender 1979, S. 42
Dresler-Brumme, Charlotte: „Ihre Bilder kennt wohl fast jeder Siegerländer“, in: Siegerland 83 (2006), S 124 – 142
s. a.
Heisener, Kornelia: Carmen Klein, in: Auf den Spuren der Siegenerinnen / Hg. vom Frauenrat der Univ.-Gesamthochschule Siegen. – Siegen, 1996. – S. 75-76
Siegener Zeitung, Jahrgang 99, Nr. 210, 08.09.1921, „Siegerländer Heimatkunst. September-Ausstellung des Siegerländer Heimatvereins. Fritz Kraus – Deuz, ElisabethSchneider – Weidenau, Carmen Klein – Siegen, Zarita Heupel – Siegen“
Siegener Zeitung Jahrgang 105 Nr. 65, 18.03.1927, „Kunstausstellung im Hause der Gesellschaft Erholung Siegen, Obergraben 3.“ [u.a., Hans Achenbach, Hanna Achenbach-Jungemann, Carmen Klein, Loty Caubet-Mehler]
Siegener Zeitung, Jahrgang 97, Nr. 303, 29.12.1919 [Radierungen zweier Künstlerinnen. Carmen Klein, unter anderen die St. Michaelskirche in Siegen ….]
Wenigstens ein Verweis auf die schon 2007 in die englischsprachige Wikipedia eingestellten Beiträge (https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Nolde und https://en.wikipedia.org/wiki/Nolde_Forest_Environmental_Education_Center) wären angemessen gewesen – wenn man denn 2021 unbedingt noch sein eigenes Süppchen kochen muss (was nach meinem Verständnis der Intention dieses internationalen Lexikon-Projektes widerspricht).
Ergänzend und mit minimalem Rechercheaufwand in Google Books zu finden:
– Ausführlicher Nachruf in:
Reading Times, 23.11.1916, p. 5
https://www.newspapers.com/clip/2964785/jacob-nolde-born-berleburg
– Zeitgenössische Beschreibung der Textilfabrik mit Abbildung des Werksgebäudes in:
Reading: its Representative Business Men, and its Points of Interest, New York 1893, p. 99 (+ Werbeanzeige p. 132)
https://www.google.de/books/edition/Reading_Its_Representative_Business_Men/Z9AwAQAAMAAJ
Danke für die Ergänzungen!
Noch ein Hinweis zur Jacob-Nolde-Straße:
Sie befindet sich leider nicht mehr dort, wo sie einmal war. Die Ratsvertreter der Stadt Berleburg hatten 1916 aus Dankbarkeit die damalige und heutige Poststraße in „Jacob-Nolde-Str.“ umbenannt. (Wittgensteiner Kreisblatt vom 26.08.1916). Im Mai 1937 hielt sich Hans Nolde, Sohn des Stifters zu einem Besuch in Berleburg auf. Damals gab es noch die Straße, die seinem Vater gewidmet worden war (National-Zeitung vom 14. Mai 1937). Diese Ehrung Jacob Noldes in Berleburg währte zunächst nur 22 Jahre und sieben Monate. In der Stadtverordnetensitzung vom 9. Januar 1939 sah sich das Ratsmitglied Dr. Nölke veranlasst, einem der damals führenden NS-Politiker ein lokales Geburtstaggeschenk zu bereiten. Er stellte einen Antrag auf Umbenennung der Jacob-Nolde-Straße, der in gleicher Sitzung stattgegeben wurde. Am 12. Januar 1939, dem Geburtstag Görings, erhielt die Straße den Namen Hermann-Göring-Straße (NZ vom 12. Januar 1939); nach Kriegsende 1945 wurde das Straßenschild dieses Kriegsverbrechers auch in Berleburg wieder entfernt. Den Namen Jacob Nolde verlagerte man allerdings in eine Seitenstraße…offenbar nach Kriegsende.
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 4.8. – 16.8.2021 | siwiarchiv.de
Zum Sohn Dr. Albrecht Czimatis:
Czimatis, Albrecht (Adolf Heinrich Peter) *18. April 1897 Kattowitz (Oberschlesien), †22. Dezember 1984 Freiburg; ab 1915 Kriegsteilnehmer, später Reichswehr: Leutnant, Oberleutnant, Hauptmann; Dipl.-Ing.; Diss.: „Rohstoffprobleme der deutschen Aluminium-Industrie im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Entwicklung“ (Dresden-Lockwitz 1930: Welzel, 126 S.);
Ref./Korref.: Gehrig / E. Müller; Dr.-Diplom der TH Dresden
vom 10. Jan. 1930, Dr.-Ing.; militärische Laufbahn: zwischen 1931
und 1934 Batteriechef, 1935 zum Major befördert, im Januar 1939
zum Reichsministerium für Wirtschaft kommandiert, Leiter der
Reichsstelle für Wirtschaftsausbau; im 2. WK: Oberstleutnant,
Oberst, zuletzt Divisionskommandeur, mehrfach ausgezeichnet,
Februar 1943 sowjetische Gefangenschaft; nach dem 2. WK hohe
Position in der Industrie der BRD; Schrift: Czimatis, Albrecht:
Energiewirtschaft als Grundlage der Kriegswirtschaft. Schriften
125 zur kriegswirtschaftlichen Forschung und Schulung, 1936 Ham-
burg (Hanseatische Verlagsgesellschaft)
Quellen: J 1930; SLUB – Dissertation; Alumnidatei; http://www.50-infanterie-
division.de/Personen/Czimatis-Albrecht.htm; Nr. 15267, hinten innen lose inliegende Blätter
Quelle: https://www.ua.tu-dresden.de/_Dokumente/voss2015pf.pdf (S. 124)
Danke für die Ergänzungen!
Pingback: Kulturfilme von Paul Kellermann und Herbert Apelt online | siwiarchiv.de
Das Land NRW hat in 75 Jahren viel geleistet und eine Einheit verschiedener Landesteile zustande gebracht, ohne die traditionellen Unterschiede zu vermischen. Rheinische Lebensfreude und westfälische Eindeutigkeit haben zu einer hervorragenden Einheit gefunden. Es gibt heute wirklich etwas zu feiern!
Herzliche Glückwünsche NRW
Folgende Unterlagen im Berliner Bundesarchiv gilt es noch auszuerten:
R 9361-III/122546 (Sammlung Berlin Document Center (BDC): Personenbezogene Unterlagen der SS und SA)
FDP-Wunsch (22.8.21): „… der Wunsch für das von der FDP geforderte neue LWL-Industriemuseum den Standort Wilnsdorf zu prüfen …“
Quelle:
Pingback: #BTW21: 6 aus 48 – „Archiv“ in den Wahlprogrammen der Parteien | siwiarchiv.de
In der Roosevelt Library in New York werden u. a. die John Franklin Cartes fils in Germany Nazi Party members – https://www.bsb-muenchen.de/mikro/lit200.pdf- aufbewahrt. Sie enthalten auch unter folgender Signatur Reel 8 (Listof Key Nazi´s Cont) Frame 0937 A2 Seiten über Fiszmer, (?) Siegen.
Leider sind in dieser Akte präzise zwei Informationen über Fissmer aufgelistet. 1. Oberbürgermeister, 2. unter „political history, affiliations“ den Hinweis „not“. Die Materialsammlung aus der Roosevelt-Collection ist auch insgesamt etwas dünn, insbesondere bei den weniger toptauglichen Top-Nazis. Erwähnt ist übrigens bei erster Durchsicht auch der Leipziger Oberbürgermeister Goerdeler. Auch zu Paul Giesler findet sich in dessen Akte fast nur öffentlich zugängliches Material, mit Ausnahme des Hinweises auf seine Maßnahmen gegen die protestierenden Münchener Studenten.
Pingback: Video: „Schönes Südsauerland“ | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 17.8. – 29.8.2021 | siwiarchiv.de
Der 26. Bericht der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen – https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Aktuelles/Inhalt/26_-Bericht/26_-Bericht-LDI-NRW.pdf – erwähnt die ausstehende Anpassung des Archivgesetz an die EU-DSGVO unverständlicherweise nicht. Via Archivalia
Auch der 27. Bericht der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen erwähnt die ausstehende Anpassung des Archivgesetz an die EU-DSGVO unverständlicherweise nicht: https://www.ldi.nrw.de/system/files/media/document/file/27_datenschutzbericht_2022_ldi_nrw.pdf
Bei der unlängst erfolgten Experten-Anhörung zum Kulturgesetzbuch wurde deutliche Kritik am Entwurf geübt:
„…. Was sind Ihre Erwartungen an ein Kulturgesetzbuch?
Vor allem sollte es ein maßstabsgerechtes Bild zeichnen. Wenn es um die Kultur in NRW geht, kommt man an den Landschaftsverbänden und Kommunen nicht vorbei, schon aufgrund der föderalen Rechtsgrundlage. ….
Die Draufsicht auf eine starke, weil kompetente Kulturlandschaft mit den vielen Verbänden, Organisationen, Vereinen aber auch Ehrenamtlichen, hätte dem Gesamtbild gutgetan und letztlich dem Gesetz ein deutliches Profil in Würdigung bestehender Leistungen verliehen. “ (Quelle: LVR-Kulturdezernentin Milena Karabaic in der Pressemitteilung des LVR v. 27.8.2021, Link: https://www.lvr.de/de/nav_main/derlvr/presse_1/pressemeldungen/press_report_290117.jsp)
„…. Städtetag, Gemeindebund und die beiden Landschaftsverbände Westfalen und Rheinland sind zudem sehr unzufrieden: Das Gesetz ergehe sich in Beschreibungen, regele aber fast nichts und erfülle auch nicht den systematischen Anspruch an ein Gesetzbuch – zum Beispiel, weil der Denkmalschutz, das Archivgesetz und das Kunsthochschulgesetz nicht drin stehen. ….“ (Quelle: Peter Grabowski, „Darum geht es beim neuen Kultur-Gesetzbuch“, wdr.de, 26.8.2021, Link: https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/kultur-gesetzbuch-anhoerung-landtag-100.html)
Anmerkung: Dass das Archivgesetz fehlt, liegt wohl daran, dass dies erst noch evaluiert bzw. neugefasst werden muss – s. https://www.siwiarchiv.de/sachstand-evaluierung-des-archivgesetzes-nrw/ .Das geplante Denkmalschutzgestz befindet sich in einer kontroversen Diskussion – s. zuletzt: https://www.siwiarchiv.de/petition-gegen-das-neue-denkmal-nicht-schutzgesetz-in-nrw/ .
LWL-Pressemitteilung, 15.9.2021: „Kritik am neuen Kulturgesetzbuch“, Link: https://www.lwl.org/pressemitteilungen/nr_mitteilung.php?urlID=53284
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik August 2021 | siwiarchiv.de
Pingback: Einnahmen aus Lustbarkeitssteuer der Stadt Siegen dürften gering gewesen sein – Archivalia
Pingback: Wikipedia-Eintrag zu Wilfried Lückert (1920 – 2015) | siwiarchiv.de
Eine Reaktion via Twitter:
Die Verantwortlichen wollen natürlich löschen. Die Gründe liegen auf der Hand. Wenn man das Disaster schon nicht ungeschehen machen kann, dann muss man doch wenigstens die Belege beseitigen …
Die politische Vorgehensweise ist ja fast schon Tradition. Begrüßenswert ist m. E. das gemeinsame Vorgehen von Archivar*innen und Historiker*innen
Pingback: 2 oral-histoy-Videos zur Flucht von Ostpreußen bis nach Siegen | siwiarchiv.de
Pingback: Evaluierung des Archivgesetzes NRW steht aus – Archivalia
Pingback: Wäschenbach will runden Archivtisch für Altenkirchen – Archivalia
Pingback: „Vertrieben nach Siegen “ – 3 Zeitzeuginnen-Videos zum heutigen „Tag der Heimat“ | siwiarchiv.de
Alternativ hätte die Überschrift lauten können: „Recycling statt Verbrennung“. Der meistbietende Interessent wollte nicht aktenkundige Daten kaufen, sondern 11 Zentner Altpapier zur Wiederverwertung – ökologisch allemal besser, als dieses in den Öfen des Gerichtsgebäudes zu verheizen. Und viel anders läuft das heute auch nicht, außer dass kassierte Akten zunächst von zertifizierten Vernichtungsfirmen abgeholt werden, die das geschredderte Papier dann verkaufen.
„1856 + Altpapierrecycling“ ist eine bemerkenswerte Kombination: Nur ein Jahr später kam in den USA das angeblich erste industriell gefertigte Toilettenpapier auf den Markt. Sicherlich war die Zeit reif für diese segensreiche Erfindung. Wurde vielleicht auch schon im Siegerland damit experimentiert? Ein interessantes regionalgeschichtliches Forschungsthema!
Pingback: Linktipp: Territorialgeschichte der Grafschaft Wittgenstein | siwiarchiv.de
Eine weitere Reaktion via Facebook:
Traurige Bilanz, danke für diese Zusammenstellung. Auffällig sind jedenfalls die Grünen. Wissen die denn nicht, welche Art von diktatorisch generiertem Schriftgut die Stasi-Unterlagenbehörde millionenfach verwahrt? Was Dokumentation, Analyse, Interpretation und öffentliche Diskussion von Rechtsextremismus und dessen Netzwerken angeht, böte sich aus Sicht der Grünen vermutlich auch eine Kooperation mit der Amadeu-Antonio-Stiftung an, die das seit vielen Jahren – mit Steuergeldern befördert – systematisch und durchaus erfolgreich macht. Eine NGO, die quasi hoheitliche und investigative Aufgaben übernommen hat. Deren Chefin könnte den Grünen allerdings auch erklären, durch wen und durch welche Unrechsthandlungen die Stasi-Akten, die jetzt in jenem von den Grünen als Vergleich bemühten Archiv lagern, im Wesentlichen zustande kamen. Sie war selbst knapp zehn Jahre IM
Pingback: Online: Philippis Beiträge zur Siegerländer Wirtschaftsgeschichte (1909) | siwiarchiv.de
Pingback: Brüder-Busch-Figuren gehen auf Reisen | siwiarchiv.de
sehr geehrte Damen und Herren !
ich interesseire mich für die Stelle als Bundesfreiwilligendienst im Stadtarchiv. Ab 1.10.2021 ist die Stelle noch zu besetzen .
mit freundlichem Gruß
Petra El Mastouri
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 30.8. – 21.9.2021 | siwiarchiv.de
Ein Zufallsfund zum kulturellen Leben in Siegen während Fissmers Amtszeit: “ … Bereits 1927 signalisierte das damalige Kultusministerium Beihilfe zur Errichtung eines Denkmals, doch die Bemühungen der Stadt Siegen den Rubensbrunnen fertigzustellen wurden erst 1930 auf Drängen Berlins in Angriff genommen.
Daraufhin wurde ein Wettbewerb um die künstlerische Gestaltung des Brunnes ausgerufen. Die beiden favorisierten Kontrahenten waren der Düsseldorfer Bildhauer Johannes Knubel und der Eiserfelder Künstler Hermann Kuhmichel. Beide legten der Stadt verschiedene Entwürfe vor. Knubel wollte einen Obelisken errichten lassen, der Lukas mit einem Ochsen als Heiligen der Malergilde und darunter ein Relief von Rubens darstellen sollte. Diese Idee wurde jedoch aus diversen Gründen abgelehnt. …“ (Quelle: Rohde, Simon: Der Rubensbrunnen im Schlosspark des Oberen Schlosses, Link: https://www.regioport-siegerland.de/de/siegen/der-rubensbrunnen-im-schlosspark-des-oberen-schlosses.html)
Es gäbe genug zu tun:
– Harmonisierung des Archivrechts mit dem Urheberrecht, mit den Datenschutzregelungen, mit Informationszugangsregelungen,
– dauerhafte Sicherung der Bestandserhaltung analoger und digitaler Archivalien,
– rechtzeitige Einbindung der Archive in den eGoverment-Prozess
– wohin gehören die dienstlichen Anteile von Politikernachlässen? …
Pingback: Neuer Bestand zur Siegerländer Wirtschaftsgeschichte im Kreisarchiv | siwiarchiv.de
Pingback: Festkonzert: 200 Jahre Friedrich Kiel | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik September 2021 | siwiarchiv.de
Pingback: Wo liegt die „Deutschland-Brücke“? | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 22.9. – 4.10.2021 | siwiarchiv.de
Pingback: Vortrag: „Der Siegerländer Gemeinschaftsverband in Nationalsozialismus“ | siwiarchiv.de
Pingback: Karl-Jürgen Reusch: Zwei Texte zu Johannes Althusius – eine Einladung | siwiarchiv.de
Die Wittgensteiner Bibliographie gibt aktuell (Stand 25.8.2021) folgende Literatur zu Althusius:
– Althusius, Johannes Politik, 3. Auflage Herborn 1614, Übersetzt von Heinrich Janssen, Herausgegeben, überarbeitet und eingeleitet von Dieter Wyduckel, Berlin 2003, 449 Seiten
– Burkardt, Johannes Wer war Johannes Althusius?, FS JAG, S. 207-212
– Dunkelmann, Jürgen Die Althusius-Grabtafel in Goddelsheim Geschichtsblätter für Waldeck, Bd. 96, 2008, S. 73-81 [Betr. Bruder von Johannes Althusius]
– Friedrich, C. Johannes Althusius – seine Lehre von der Politik, FS JAG, S. 32-36
– Gierke, Julius von Berleburg in der Grafschaft Wittgenstein, die Heimat des Johannes Althusius In: Festschrift für Gottfried Hugelmann zum 80. Geburtstag am 26. September 1959, Aalen 1959, Seiten 151-157
– Hollenstein, Helmut Die „Politica“ des Johannes Althusius: Eine Vision und ihre Voraussetzungen, FS JAG, S. 21-31
– Hollenstein, Helmut Johannes Althusius – Ein Historienspiel, Bad Berleburg 2008
– Hollenstein, Helmut Althusius und Comenius im Vergleich Zusammenfassung eines Vortrages beim Symposium „Jurisprudenz, politische Theorie und politische Theologie“, anlässlich 400 Jahre „Politica“ des Joh. Althusius, Herborn 11.-14.6.2003, Mitt. Blätter des Geschichtsvereins Herborn e.V. Jg. 51, Nr. 3/4, Oktober 2003, S. 147-148
– Hollenstein, Helmut Schule und Erziehung bei Althusius, Calvin und Comenius in ihrer Bedeutung für die Gemeinschaftsbildung, Beiträge zur Politischen Wissenschaft Bd. 131, 2004, S. 7-22
– Höting, Ingeborg Johannes Althusius, In: Die Professoren der Steinfurter Hohen Schule, Steinfurt 1991, Steinfurter Schriften 21, S. 20-26
– Homrighausen, Ernst/Homrighausen, Klaus Johannes Althusius DBDie S. 673-675
– Menk, Gerhard Die Hohe Schule Herborn im 16. und 17. Jahrhundert, In: 400 Jahre Arnoldinum 1588-1988 (Schriftenreihe des Kreisheimatbundes Steinfurt 6), Greven 1988, S. 22-30 [u.a. über Graf Ludwig den Älteren vSzW und Johannes Althusius)
– Menk, Gerhard Paul Crocius – ein calvinistischer Pfarrer im konfessionellen Zeitalter, In: Breul-Kunkel, W. u. Vogel, L. Rezeption und Reform. Festschrift für Hans Schneider zu seinem 60. Geburtstag (Quellen und Studien zur hessischen Kirchengeschichte 5), S. 71-96 [Betr. auch. Johannes Althusius]
– Menk, Gerhard Johannes Althusius und die Grafschaft Wittgenstein, Beiträge zur Westfälischen Kirchengeschichte Bd. 35, 2009, S. 9-39
– Neweling, Erich, Johannes Althusius, WHB II/S. 275-286
– Schlarmann, Hans Johannes Althusius, Diedenshausensis, DBWD, S. 345
– Strohm, Christoph Recht und Jurisprudenz im reformierten Protestantismus 1550-1650, In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 123, kanonistische Abteilung 92 (2006), Seiten 453-493
– Störkel, Rüdiger, Herborner Autoren aus der Blütezeit der Hohen Schule
• Johann Althusius, S. 132, In: Literatur im „Dill Athen“, Herborn und die Welt der Bücher 1585-1990, Mitteilungsblatt des Geschichtsverein Herborn e.V., Jahrgang LV, Oktober 2007, Nr. 3/4, S. 118-160
– Troßbach, Werner Johannes Althusius, Staatsphilosoph und Politiker, In: Von Soest – aus Westfalen, Paderborn 1986, Seiten 217-234
– Warnecke, H. J. Althusius und Burgsteinfurt, In: Politische Theorie des Johannes Althusius (Hgg.) Dahm, Krawietz, Wyduckel, Berlin 1988, S. 147-160
– Wyduckel, Dieter Althusius, Johannes, In: Die Deutsche Literatur – Biographisches und bibliographisches Lexikon Reihe II, Bd. 2, S. 345-356
– Wyduckel, Dieter Johannes Althusius (1563-1638) Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (HRG) 2. Aufl. Bd.
1, Spalte 196 – 199
Pingback: Radiotipp: Zeitzeichen (WDR) – 8. Oktober 1821 – Der Geburtstag des Komponisten Friedrich Kiel | siwiarchiv.de
Die Wittgensteiner Bibliographie gibt aktuell (Stand 25.8.2021) folgende Literatur zu Kiel:
– NN: Friedrich Kiels Stellung in der Musikgeschichte und Charakterisierung seiner künstlerischen Eigenart an Hand seiner vier Hauptwerke, DschW. 1927/H. 4/S. 129-132
– NN: Gedächtnisrede des Hofpredigers Emil Frommel [Betr. Fr. Kiel], DschW. 1927/H. 4/S. 132-134
– NN: Zum Gedenken an Friedrich Kiel, in: Wittgenstein, Jg. 84 (1996), Bd. 60, Heft 3, S. 87
– N. N.: Friedrich-Kiel-Gesellschaft gegründet, Wittgenstein, Jg. 67 (1979), Bd. 43, Heft 3, S. 123-124
– Bauer, Eberhard: Friedrich Kiel, 1821-1885, Wittgenstein, Jg. 59 (1971), Bd. 35, Heft 2/3, S. 42
– Büchner, Susanne Kiel, Friedrich In: Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG) 2. neu bearbeitete Ausgabe, (Hg.) Ludwig Fischer , Personenteil 10, Ke-Ler, Kassel/Weimar, Spalte 74-79
– Hartnack, Karl Friedrich Kiel, DschW. 1927/H. 4/S. 128-129
– Marburger, Otto Friedrich Kiel 1821 – 1885. Worte des Gedenkens zum 125. Todestag an seinen Geburtsort Puderbach, Wittgenstein, Jg. 98 (2010), Bd. 74, Heft 4, S. 154-157
– Pfeil, Peter: Briefe des Komponisten Friedrich Kiel, Wittgenstein, Jg. 59 (1971), Bd. 35, Heft 2/3, S. 43-59
– Pfeil, Peter: Friedrich Kiels Erinnerungen an Berleburg, Wittgenstein, Jg. 53 (1965), Bd. 29, Heft 1, S. 50-52
– Pfeil, Peter: Die Handschriften des Komponisten Friedrich Kiel in der Stadt- und Landesbibliothek Dortmund, Wittgenstein, Jg. 51 (1963), Bd. 27, Heft 1,2, S. 7-12
– Pfeil, Peter: Friedrich Kiel, WHB II/S. 286-289
– Pfeil, Peter: Friedrich-Kiel-Gesellschaft e.V., Wittgenstein, Jg. 67 (1979), Bd. 43, Heft 3, S. 123; Wittgenstein, Jg. 68 (1980), Bd. 44, Heft 3, S. 105-106 Wittgenstein, Jg. 70 (1982), Bd. 46, Heft 1, S. 31-32 [Die Friedrich-Kiel-Gesellschaft gibt jährlich „Mitteilungen“ heraus]
– Pfeil, Peter: Friedrich Kiel 1821 -1885, DBP, S. 390-398
– Pfeil, Peter (Hg.): Friedrich Kiel-Studien Bd. 1, Köln 1993, 257 Seiten; Bd. 2, Köln 1997, 112 Seiten; Bd. 3, Köln 1999, 216 Seiten
– Pfeil, Peter/Friedrich-Kiel-Forschungen, Bd. 1 Schenk, Dietmar (Hgg.) Sinzig 2008, 190 Seiten
– Schneider, Willi: Irrtümer in Friedrich Kiels Selbstbiografie, Wittgenstein, Jg. 63 (1975), Bd. 39, Heft 3, S. 162-164
– Schuppener, Ulrich: Ein Komponist aus dem Wittgensteiner Land. Zum 100. Todestag von Friedrich Kiel, Wittgenstein, Jg. 73 (1985), Bd. 49, Heft 4, S. 135-141
– Schuppener, Ulrich: Ein Komponist aus dem Wittgensteiner Land. Zum 100. Todestag von Friedrich Kiel (1821-1885), In: Zeitschrift Siegerland, Bd. 62, 1985, S. 71-76
– Schuppener, Ulrich: Komponist, Virtuose und Musikpädagoge. Friedrich Kiel vor 175 Jahren in Puderbach geboren., In: Zeitschrift Siegerland, Bd. 73, 1996, S. 67-69
– Wallendorf, Claudia: Hörbare Spielfreude. Das Klavierwerk Vol. 1 bis 3 [3 CD] Rez., in: Wittgenstein, Jg. 92 (2004), Bd. 68, Heft 1, S. 41-42
– Zimmermann, Helga: Friedrich Kiels Wirken als Kompositionslehrer, Wittgenstein, Jg. 84 (1996), Bd. 60, Heft 3, S. 88-96
Pingback: Farbfernsehen im Kreisaltenheim | siwiarchiv.de
Danke für diese hilfreiche Meldung.
„Die Bechers 2.0. – unterwegs mit Thomas Kellner“. WDR 5 Scala – aktuelle Kultur. 13.10.2021. 10:29 Min.: „Mit ihren Fotos von Fachwerkhäusern im Siegener Land starteten Bernd und Hilla Becher eine internationale Karriere. Über 50 Jahre später begab sich Thomas Kellner auf die Spuren der Bechers. Jörg Mayer begleitete den Architekturfotografen bei einem Rundgang durch Siegen.“: Radio-Beitrag
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 5.10. – 17.10.2021 | siwiarchiv.de
Pingback: Sachstand: Evaluierung des Archivgesetzes NRW (2018 – 2020/21) | siwiarchiv.de
eine Heftzwecke
Kunststoffgranulat
eine Baumfrucht
Vielen Dank für die interessanten Lösungsvorschläge! Leider sind alle noch ein wenig weit von der Lösung entfernt. Aber vielleicht hilft ein Blick auf den Twitter-Account von siwiarchiv weiter:
Ein Farbgebinde (Farbdose) von oben betrachtet, der Farbdosendeckel als; die Dose steht in einem Karton.
Danke fürs Mitmachen! Aber auch dies ist nicht richtig.
Es sieht aus wie ein Ständer / Fuß, zb. von einem Drehstuhl
Danke fürs Mitmachen! Aber auch dies ist noch weit entfernt von der Lösung.
Knopf von einem Schieberegal
Leider immer noch nicht richtig! Aber die Antworten werden nun etwas archivischer. Im Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein befinden sich jedenfalls mehrere hundert Stück davon……
Im Portal findet sich das Aachener „Echo der Gegenwart“, das durch eine Volltexterkennung jetzt im Volltext durchsuchbar ist, hier:
https://zeitpunkt.nrw/ulbbn/periodical/titleinfo/4371932
Der Suchschlitz befindet sich rechts oberhalb des Vorschaubildes.
Ein Tipp: Das gesuchte Objekt wurde samt Inhalt einige Male auf siwiarchiv vorgestellt.
Das Drehrad/Steuerrad eines Archivregals
Leider nein. Jetzt bin ich übrigens ein wenig erleichtert, nachdem das diesjährige Sommerferienrätsel so rasch gelöst wurde. ;-)
Filmrolle/Filmkasette
Immer noch nicht ……
CD-Hülle
Es handelt sich auch nicht um eine CD-Hülle.
Zum oben gezeigten Bild s. a. folgenden Eintrag im Blog der Europeana: https://www.europeana.eu/en/blog/pedro-sunda-diego-bemba-and-dom-miguel-de-castro
Pingback: 5.000 historische Ansichten aus dem Sauerland online | siwiarchiv.de
Filmdose
Leider nein!
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 18.10. – 31.10.2021 | siwiarchiv.de
Pingback: Landtag NRW: Projekt „Verfolgungsbiografien“ | siwiarchiv.de
Liebe Menschheit in Siegen und in Deutschland! Sie bitte zu, dass Du genau ins Wirtschaftssystem passt! Ansonsten werde bitte erst gar nicht geboren! Wir brauchen in Zukunft nur noch Menschen, die hier ins Wirtschaftssystem passen! Das ist die neue Zukunft in Deutschland! Wo sind wir nur hingekommen?
Dieser Kommentar ist deutlich off topic. Ähnliche allgemeine Äußerungen werden zukünftig gelöscht werden.
Pingback: Auflösung des siwiarchiv-Herbst-Fotorätsels 2021 | siwiarchiv.de
Mit meiner Antwort „CD-Hülle“ vom 26. Oktober 2021 (https://www.siwiarchiv.de/siwiarchiv-herbst-fotoraetsel-2021/#comment-112210) lag ist sehr nahe. Sinngemäß ist aber beides fast dasselbe. Eigentlich sollte ich doch als Gewinner anerkannt werden.
Sie haben ja recht, dass dies sehr ähnlich ist. Aber gesucht war eben eine DVD-Hülle, die nun einmal rechteckig ist, während CD-Hüllen in der Regel fast quadratisch sind.
Pingback: Online-Vortrag: „75 Jahre Justiz NRW – Erinnerungen an den Auschwitz-Prozess am Landgericht Siegen 1986 bis 1991“ | siwiarchiv.de
Kritik an ARD retro: https://blog.digithek.ch/kritik-an-ard-retro/ via Archivalia
Runder Archivtisch im Kreis Altenkirchen am 16.11.2021 – s.

(Screenshot vom FB-Account Wäschenbachs, 7.11.21; Danke an B.B.)
s. Selgert, Felix: Rezension zu “Aufbruch in die Demokratie. Die Revolution 1918/19 im Rheinland und Westfalen”, in: Histrhen. Rheinische Geschichte wissenschaftlich bloggen, 09.11.2021, http://histrhen.landesgeschichte.eu/2021/11/rezension-aufbruch-in-die-demokratie-selgert
CD-Hülle ist falsch, aber DVD-Hülle ist richtig.
Seltsam.
In meinen Augen ist das quasi das Gleiche und man könnte die Antwort von Michael Johne gelten lassen.
Manchmal muss man eben auch im Archiv genau sein. Denn es besteht durchaus ein Unterschied zwischen den Hüllen einer CD und einer DVD:
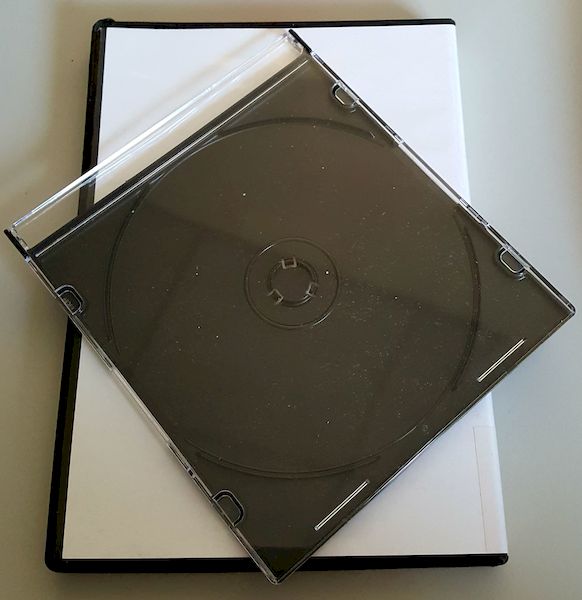
Foto von der gestrigen Probe:
Das verspricht (endlich mal wieder) eine spannende, wenn nicht gar nervenaufreibende Diskussion zu werden! Frage an den geschätzten Administrator und Quizz-Master: Wäre die DVD-Hülle anhand des Bildes eindeutig identifizierbar gewesen, oder hätte eben auch ein Foto des analogen CD-Hüllen-Details zu diesem Ergebnis geführt? Das läßt sich ja im Experiment unter identischen Aufnahmebedingungen leicht herausfinden. Einfach mal ausprobieren und den Vergleich hier präsentieren.
Übrigens fehlt bisher die endgültige Auflösung des Adventsrätsels 3/2020. Bitte abschließend noch die linke Pflanze in Bild 1 benennen.
1) Vergleichsbild:

2) Manches bleibt auf ewig ein Rätsel ……
Das ist ganz offensichtlich kein Vergleichsbild in dem Sinne, wie ich es meinte („identische Aufnahmebedingungen“, also gleiche Kameraposition und -einstellungen mit dem jeweils vergleichbaren Ausschnitt einer DVD- und einer CD-Hülle). Na gut, anders gefragt: Anhand welcher Indizien hätte denn beim Rätselbild die Lösung „CD“ zugunsten „DVD“ ausgeschlossen werden sollen? Die von Ihnen gestellte Frage „Worum handelt es sich?“ (= „Was hat Herr Wolf fotografiert?“) war ja genaugenommen nicht zielführend, weil allenfalls von Hellsehern zu beantworten. Um es mal frei nach Magritte zu sagen: „C’est ne pas une pochette de DVD/CD“, vielmehr nur ein Bild davon. Und Bilder lassen sich nun einmal so arrangieren, dass man sie „Vor-Bildern“ nicht mehr eindeutig zuordnen kann.
Rätsel kommt von Raten. Wenn ich CD-Hülle ausschliesse, dann darf gerne weiter geraten werden.
Screenshot zu Veranstaltung:
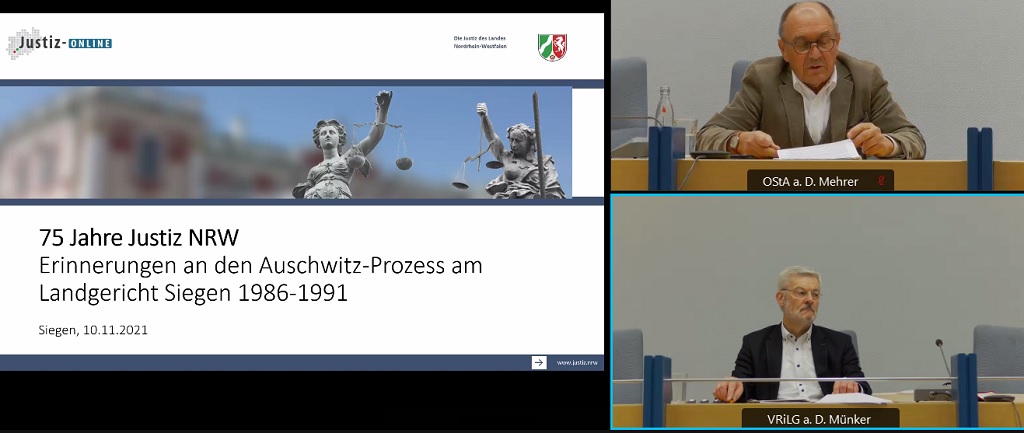
Ist der Vortrag irgendwo auch jetzt noch anzusehen?
Wird m. W. geprüft.
Lieber Herr Wolf, Ihr Engagement auf Siwiarchiv und die generelle Idee der Rätsel in allen Ehren, aber: Dieses Rätsel ist unglücklich gestellt und aufgelöst worden. Michael Johne hätte meiner Meinung nach die Zuerkennung der Lösung verdient. Für die Zukunft schlage ich vor, dass wieder historische Aufnahmen verwendet werden. Das Kreisarchiv verfügt doch sicher über zahlreiche unbekannte Fotos, deren Motive es zu erraten gilt. Damit würden die vielen Denkanstrengungen der Teilnehmenden auch einem sinnvolleren Ziel zugeführt als Makroaufnahmen von Kunststoff-Massenartikeln zu erraten.
Mag sein, dass dies nicht optimal war. Vielleicht hätte ich das Rätsel großzügiger bspw. wie folgt auflösen können:
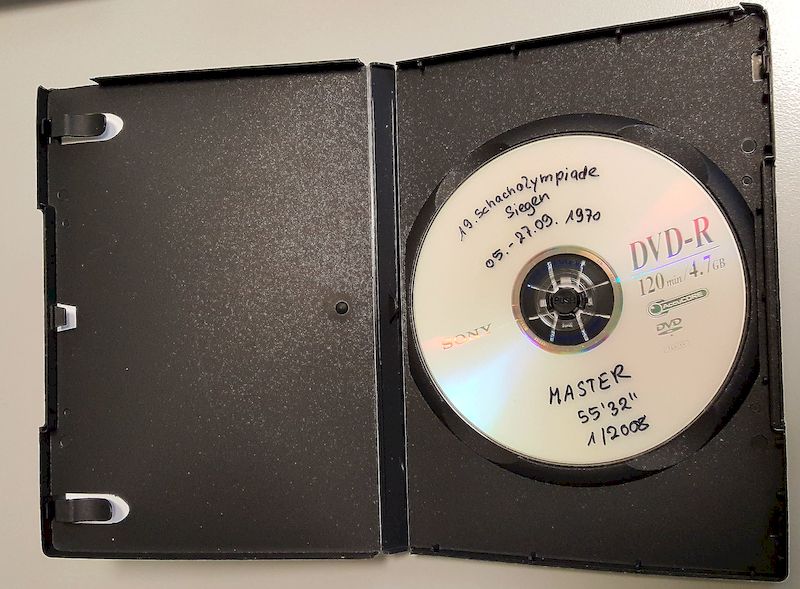 “
“
„Ja! es handelt sich um eine CD!
Hier der Bildbeweis:
M. E. gehört die präzise Beschreibung von Archivgut zu den Aufgaben der Archivierenden.
Das kommende Rätsel wird allerdings kein Archivgut zu Inhalt haben. Vielleicht später noch einmal …..
Wer in Rätseln nur Glücksspiele sieht, soll die nächsten Lottozahlen zu erraten versuchen. In einem intellektuell herausfordernden Blog wie Siwiarchiv erwartet man dagegen eher „Rätsel“ im engeren (gewissermaßen kriminalistischen) Sinne, nämlich etwas, das sich durch die Aktivität des Ratenden (Betrachten des Bildes und Interpretieren der darin gefundenen Informationen) lösen läßt. Im vorliegenden Fall erlaubten die Bildinformationen nur eine weitgehende Annäherung an das gemeinte Objekt. Das wohl bestmögliche Ergebnis hätte gelautet: „Hülle eines scheibenförmigen digitalen Speichermediums“. Mit dem weiteren Schritt in Richtung Konkretisierung (CD oder DVD oder was sonst noch alles ins Laufwerk passen würde) hätte man die Grenzen des „kriminalistischen“ Rätsels verlassen und wäre in die Domäne des Würfelns und Münzenwerfens geraten. Der Vergleich mit „präziser Beschreibung von Archivgut“ hinkt gewaltig (mit Verlaub, lieber Herr Wolf): Selbstverständlich werden an dem zu beschreibenden Archivgut vorher keine Manipulationen oder Verfremdungen vorgenommen, um die armen Archivierenden vor Rätsel zu stellen. Nebenbei bemerkt, illustriert unser kleiner Disput sehr schön das allgemeine Dilemma menschlicher Erkenntnistätigkeit. Meistens sind wir auf Bilder angewiesen, weil die Realien entweder schon verschwunden oder uns in der Gegenwart nicht zugänglich sind. Und was wir aus den vielen Bildern machen, ist letztlich wieder nur ein Bild (z.B. „Geschichtsbild“), niemals eine Wiederbelebung von etwas Objektivem. – Nun aber genug der Altersweisheit!
Aktueller Stand der Petition:
22.673 Unterstützende, davon 12.344 in Nordrhein-Westfalen, d. h. 43% des erforderlichen Quorums von 29.000 Unterschriften sind erreicht. Aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein haben bisher 135 Personen unterzeichnet …..
Diese Erinnerungen an die Schulzeit am Mädchengymnasium in Siegen sind für mich sehr interessant, denn ich habe bis zum Abitur eine Mädchenschule in Fulda besucht, die von Nonnen, – den „Englischen Fräuleins“, – geleitet wurde,- u nter ähnlichen, aber noch wesentlich strengeren Bedingungen als in Siegen. Auch dort gab es (nach der „Mittleren Reife“) die Aufteilung in einen naturwissenschaftlichen und einen Hausfrauenzweig mit sogenanntem „Pudding – Abi“, das allerdings den Zugang zu allen Studiengängen ermöglichte.
Vielen Dank für die persönliche Ergänzung! In der Tat steht eine pädagogikgeschichtliche Aufarbeitung der LYZ-Geschichte noch aus. Sie wäre aufgrund der vorhandenen Unterlagen mindestens für die Zeit als staatliche Schule nicht nur möglich, sondern wohl auch ergiebig.
Ein Mann, der gar keine Ahnung, über die Zeit der Belgier in Siegen hat. Bekommt Informationen, die auch noch Fehlerhaft sind, aber ein Vortrag über die Belgier in Siegen halten. Mfg Olivier Lagneau
2 Fragen seien gestattet:
1) Ist es nicht normal, dass Historiker:innen über eine Vergangenheit schreiben, die sie selber nicht mehr erlebt haben? Erleichtert dies nicht die alte geschichtswissenschaftliche Forderung, dass Geschichte „sine ira et studio“ betrieben werden sollte?
2) Welche falsche Informationen sind denn gemeint?
Zur Person des Vortragenden ist auf die Pressemitteilung zu verweisen. Er hat sich mit dem Thema beschäftigt!
Zur Kritik Lagneaus s. https://geschichtswerkstatt-siegen.de/2021/11/09/siegener-forum-47/#comment-84
In der heutigen Print-Ausgabe der Siegener Zeitung findet sich folgender Artikel „Stadtbad am Löhrtor – Kenner warnt vor voreiligem Abriss. Das Bauhaus und sein kleiner Bruder“ von Jan Schäfer.
Inhaltsverzeichnis Heft 63 (2021):
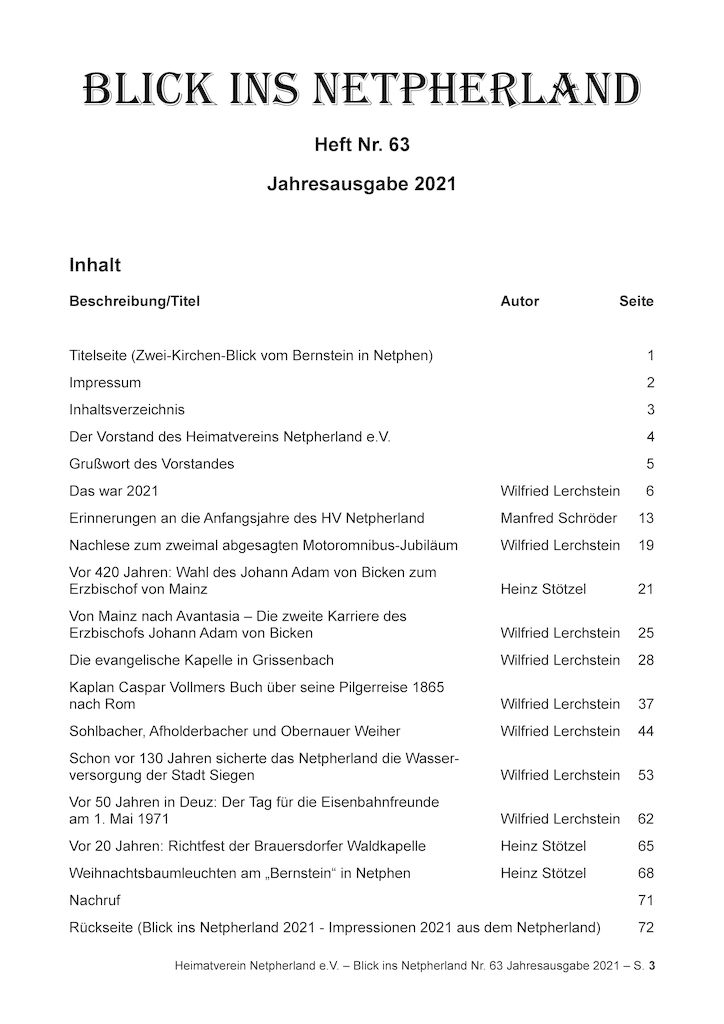
Zu „Archive“ im Koalitionsvertrag s. https://archivalia.hypotheses.org/136752
s.a. https://www.augias.net/2021/11/26/9397/
Im Universitätsarchiv der TU Darmstadt befindet sich die Diplomprüfungsakte von Walter Bonin (UA Darmstadt 115 Nr. 33-23). Die Akte enthält unter anderem sein Zeugnis über die Diplom-Hauptprüfung und einen Abriss des Lebens- und Bildungsganges.
Zu Tersteegen s. a. Eberlein, Hermann-Peter, Gerhard Tersteegen, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: http://rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/gerhard-tersteegen/DE-2086/lido/57c93b838c0789.44496860 (abgerufen am 26.11.2021)
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 14.11. – 27.11.2021 | siwiarchiv.de
Zwei Funde im Iserlohner Kreisblatt:
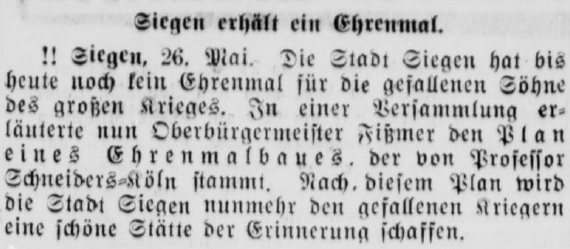
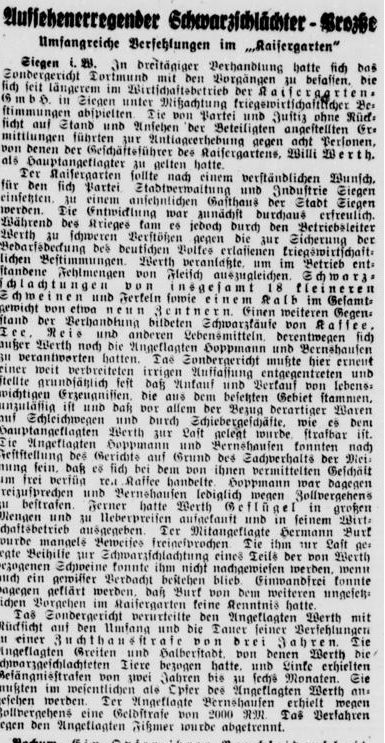
1) 27.5.1936 – Zur Errichtung eines Ehrenmals für die Gefallenen des ersten Weltkriegs. Der Artikel wirft die Frage auf,warum es dem seit 1919 amtierenden Bürgermeister der Stadt Siegen nicht gelungen ist, bis zu diesem Zeitpunkt, eine solche Erinnerungsstätte zu schaffen:
2) 27.5.1942 – zur Kaisergarten-Affäre:
In Opfermanns Personenlexikon finden sich 3 Hinweise auf Atikel zu Fissmer in der Siegerländer Nationalzeitung. 2 sind in der Zwischenzeit online einsehbar:
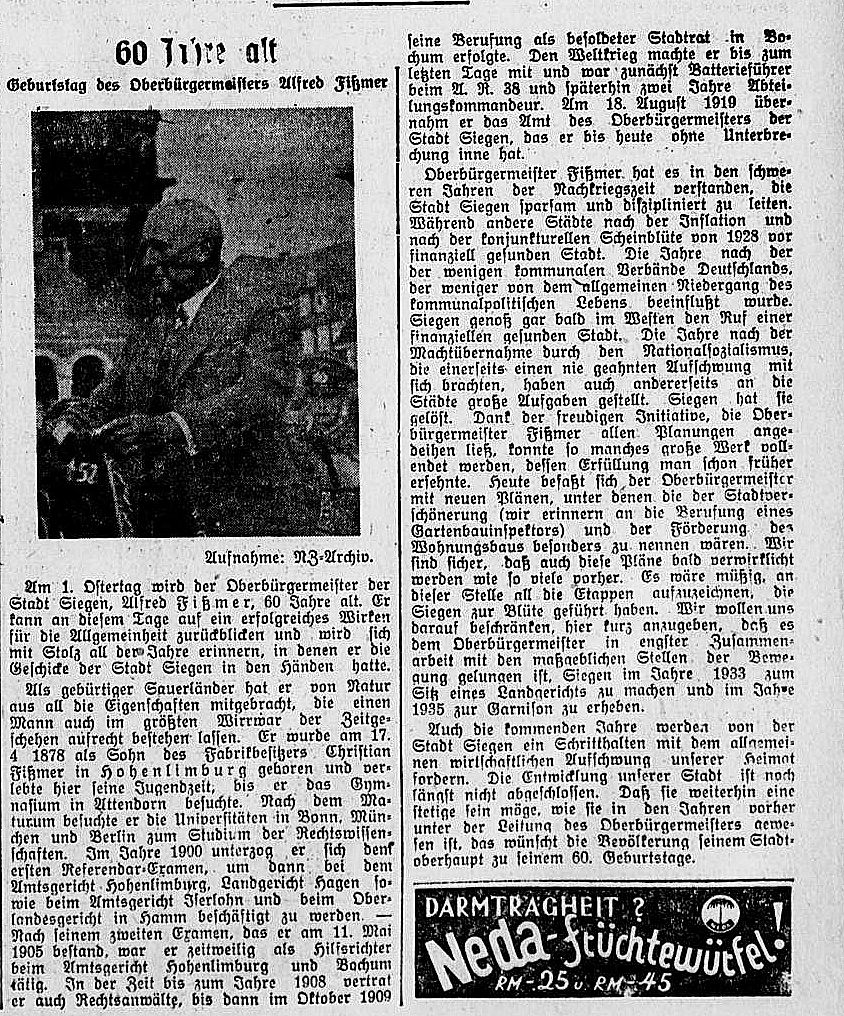
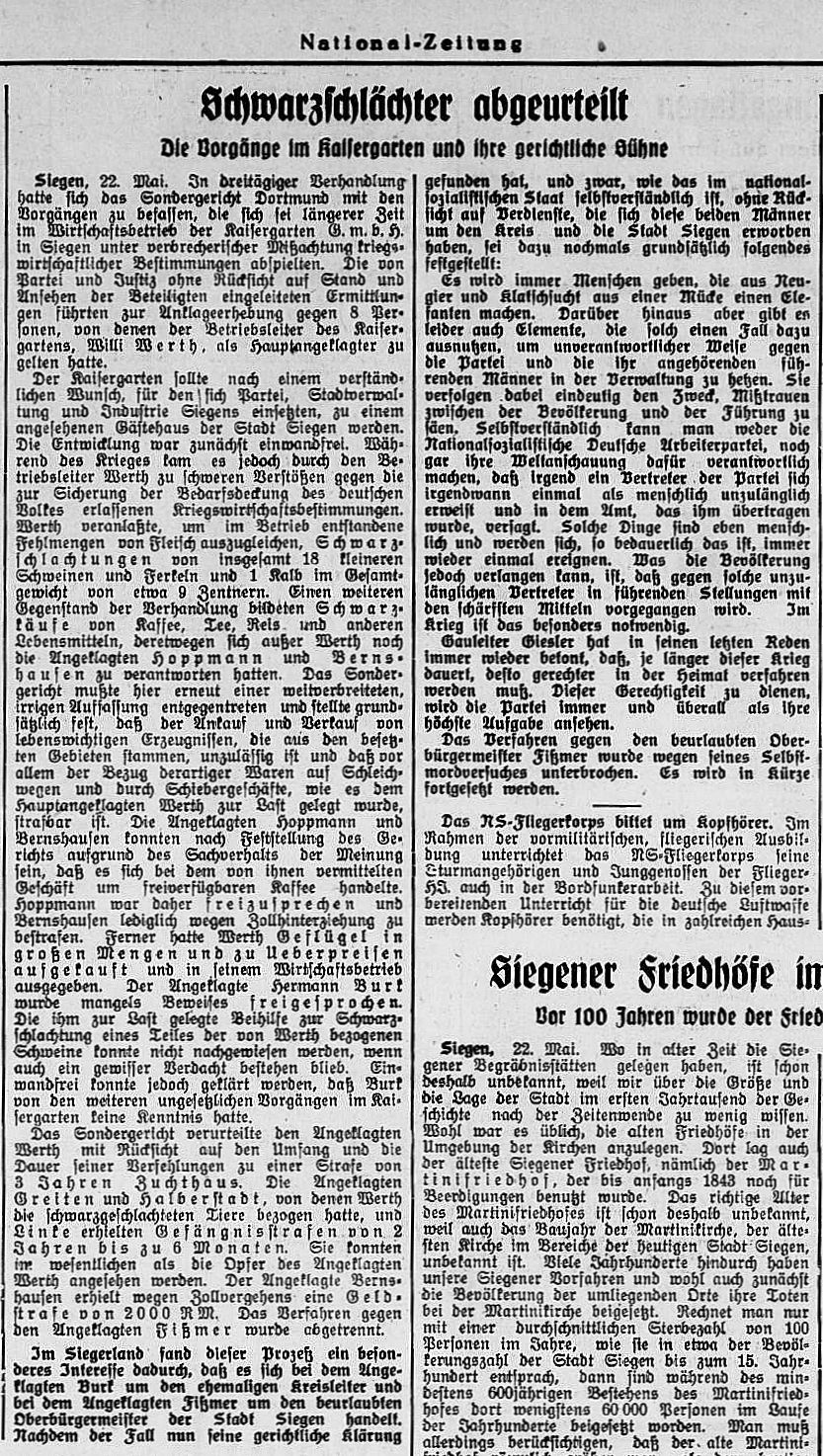
16. April 1938:
22. Mai 1942:
Ist mir wichtig, das zu betonen: Das Regionale Personenlexikon, das nicht nur ein biografischen Lexikon zur NS-Belastung darstellt, sondern eine Menge mehr an Information enthält, ist nicht „mein“ Lexikon, sondern eins der VVN-BdA Siegerland-Wittgenstein. Sie ist es, die sich damit historiografisch verdient gemacht hat.
Vielen Dank für die Klarstellung! Ich habe heute morgen in der Eile die Anführungszeichen vergessen.
Guten Morgen,
da es sich um die gelbe Villa im Dreslers Park in Kreuztal handelt, vermiute ich mal, dass die Initalien auf den Hausherrn Wilhem Dresler weisen und tippe auf W.D….da ich erst seit 2,5 Jahren im Siegerland lebe, bin ich gespannt, ob ich das heutige Rätsel als Düsseldorfer Mädje lösen kann.
Ich wünsche einen beschwingten 1. Advent.
Viele Grüße, Petra
Die Antwort ist zu 50% richtig! Also, ein halbes Buch gehört schon mal Ihnen. ;-)
Ich möchte meine zu 50 % richtige Lösung auf 100 % vervollständigen.
Die beiden Intitialen lauten W.D. und H.D. und weisen auf die Erbauer und Wilhelm und Henriette Dresler hin, die die gelbe Villa bewohnten.
Liebe Grüße und danke für das tolle Rätsel rund um die Geschichte der Fabrikantenfamilie Dresler,
Petra
Jaein! Wir wären bei 75%. Ein Buchstabe ist noch falsch.
Dann bliebe bei H.D. nur noch der Verweis auf den einzigen Sohn des Ehepaares Wilhelm und Henriette Dresler…Heinrich Dresler.
Ansosnten bleibt mir noch die Option des HH als Abkürzung der Initialen für Henriette (Ehefaru) und Heinrich (Sohn)..wenn es jetzt nich stimmt, begnüge ich mit 75 % :-)!
Ich finde es übrigens großartig, dass das Kulturgut dank des Denkmalschutzes und der Archivierung aller Informationen rund um die Zeitgeschichte noch heute in der Stadt so lebendig ist und erhalten wurde..Lichterleuchten, Trauungen, Tourismus.
In den Kommentaren findet sich schonder gesuchte Buchstabe ….. Sie sind ja vollkommen auf den richtigen Weg.
W.D.und H.S = Wilhelm Dresler und Heinrich Sohn
oder
W.D. und S.H. = Wilhelm Dresler und Sohn Heinrich
…in freudiger Erwartung:-)))
Sie denken zu patriachalisch ;-)
Ich tippe auf FWD, die gelbe Villa wurde für Wilhelm Dresler erbaut, dessen vollständiger Name Friedrich Wilhelm Dresler war.
Zwar handelt es sich tatsächlich um Friedrich Wilhelm Dresler, aber als Initialen sind dort nur W.D. zu erkennen, so dass es bei der 50%igen Lösung zunächst einmal bleibt.
Mir erschließen sich die Initialen D S und das könnte
Dreslers Söhne bzw Dresler und Sohn
bedeuten
Dies ist leider nicht richtig. Allerdings kann Ihre Antwort durchaus den Weg zur vollständigen Lösung weisen.
Ich denke, die Lösung liegt im Mädchennamen der Henriette Dresler. Der ist mir leider nicht bekannt. Also Wilhelm Dresler(WD) und Henriette …(HS)
Korrekte Vermutung!
Nach ein wenig Recherche würde ich auf Henriette Schleifenbaum (HS) tippen
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik November 2021 | siwiarchiv.de
Wilhelm Dresler (WD) und Henriette Dresler geb. Söler (HS)
Söler ist es nicht.
@Petra Haunstein
@Anonym
Gratulation für die Lösung des Rätsels!
Wunderbar, ich freue mich sehr!!
Verdientermaßen!
Herzlichen Glückwunsch auch aus dem Stadtarchiv Kreuztal! :-)
Wir haben festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, die Geburtsnamen der Ehefrauen zu ermitteln, weil der in den Veröffentlichungen häufig unterschlagen wird.
Danke für dieses schöne Bild und Rätsel! Stimmt, einfaches googlen war da nicht zielführend. Man musste schon schon den vollen Namen Dreslers und den Vornamen seiner Frau eingeben. Dann wurde man auf eine genealogische Seite gelenkt, die man aber ebenfalls präzise durchsuchen musste. Ich habe den Eindruck, dass fast alle Dresler Friedrich Wilhelm als Vornamen trugen ;-)
Vielen Dank, ich freue mich natürlich auch. Aber ohne die Vorarbeit von Frau Hanstein wäre ich wahrscheinlich nie zur Lösung der letzten „25%“ gekommen.
Bei mir entstand tatsächlich auch der Eindruck, dass die Familie Dresler bei den Männervornamen so ihre Favoriten hatte :)
Gemeinsam sind wir stark! Einer für Alle, alle für Einen:-)
s. a. Lars Peter Dickel, „Bad Berleburg: Straßenschild für Holocaustopfer abgelehnt“, in: Westfalernpost (online) v. 1.12.2021, Link: https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/bad-berleburg-strassenschild-fuer-holocaustopfer-abgelehnt-id233988635.html
– Link zur Vorlage für Sitzung des Ausschusses Planen, Bauen, Wohnen und Umwelt am 30.11.2021: https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz610/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZQKC43O6Y-VG57sTuQz5GoJR1f7Elkul4lXb1ZnijD5F/Reg._Nr._16_Antrag_der_SPD-Fraktion_vom_17.09.2021_-_Benennung_einer_Anwohnerstrasse_im_zweiten_Bauab.pdf
– Link zur Verwaltungsstellungnahme: https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz610/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZZhvw8W2FkBSoczkQpmGIzHfs92Kt9Qi5Kp4xjWZ8HNV/Stellungnahme_zu_Reg.-Nr._16.pdf
In der kommenden Bad Berleburger Stadtverordnetensitzung am 6.12. steht der Antrag noch auf der Tagesordnung (TOP 4.1.) [Link: https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz610/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZR2a5_SEYgGFA1kf5Bav8etigdOQWcuqnxxutJVE_hjx/Bekanntmachung_Stadtverordnetenversammlung_06.12.2021.pdf%5D.
Lediglich im Print zu lesen war der Kommentar:
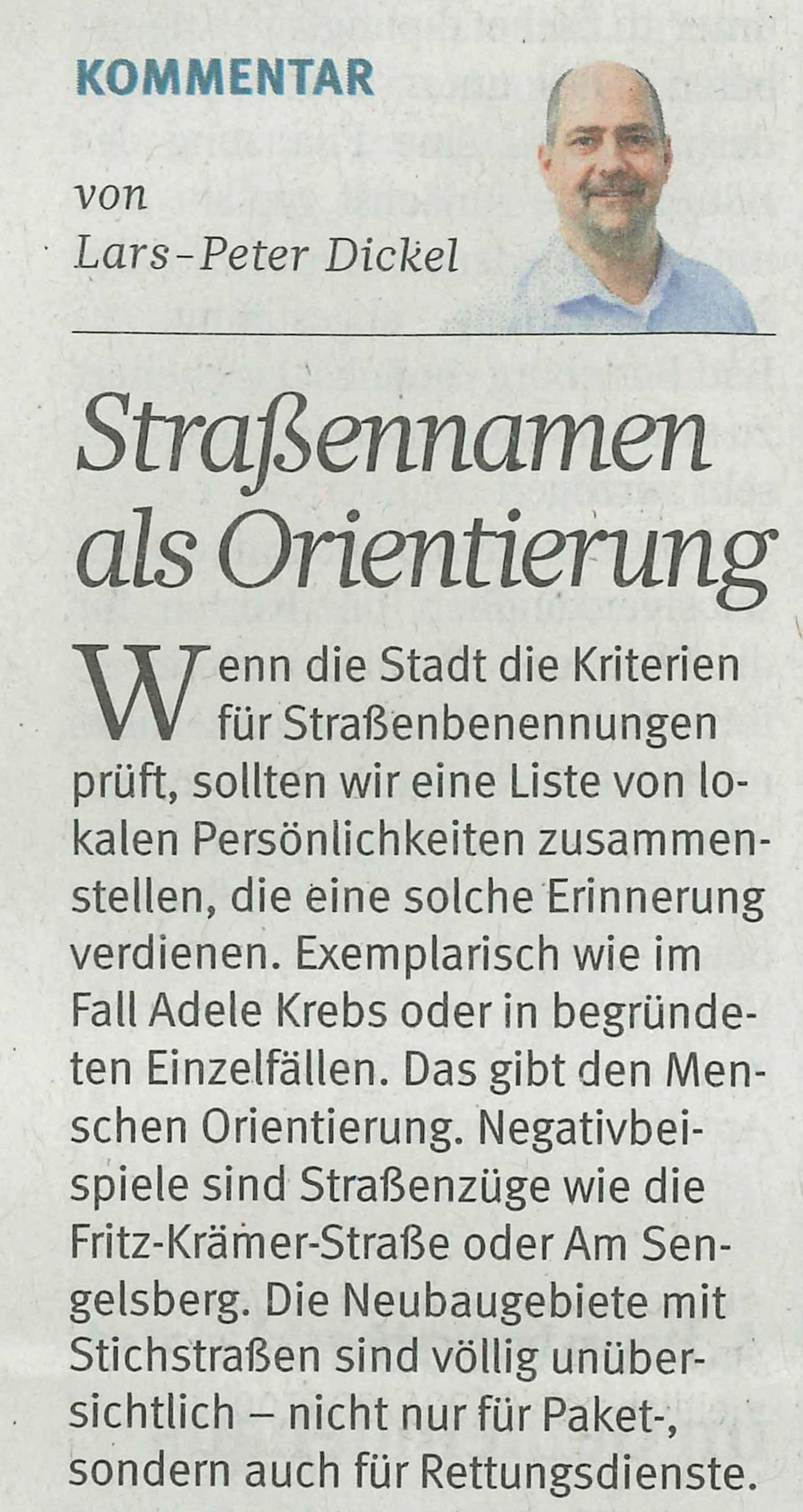
Zur Resonanz s. a. die Facebook-Seite der Westfalenpost:
Ich besuchte in der Zeit von 1974 – 1976 die Tagesschule der Sprachenschule Siegerland. Diese Zeit ist mir in sehr guter Erinnerung geblieben, besonders der Unterricht bei Herrn Dr. Bode – das war schon ganz speziell!
Inzwischen bin ich im Ruhestand, bin aber nach wie vor der Sprache/Sprachen und der Literatur treu geblieben.
Vielleicht erinnert sich noch jemand an mich, so dass wir in Kontakt treten könnten?
Freundliche Grüße aus Würzburg
Renate John
Vielen Dank für Ihren Kommentar! Gerne dürfen Sie mehr über den speziellen Unterricht von Dr. Bode berichten.
Stadtarchiv Hilchenbach
Die Dissertation von Ley ist 1906 leider unvollständig abgedruckt worden. Es fehlten die im Inhaltsverzeichnis genannten Kapitel XI-XIII. 1909 erschienen dann Leys Dissertation und die von Hans Kruse zur Holzköhlerei und Loherei in einem Sammelband unter dem Titel „Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte des Siegerlandes“, herausgegeben von dem bekannten Münsteraner Staatsarchivdirektor und Historiker Friedrich Philippi. P. formulierte in der Einleitung die Hoffnung, die begonnene Schriftenreihe mit einer Arbeit zur Haubergswirtschaft und zum Wiesenbau fortsetzen zu können. Doch es blieb bei diesem einen erschienenen Band, der ebenfalls in Münster digitalisiert wurde: https://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/urn/urn:nbn:de:hbz:6:1-421337
Sie auch Siwiarchiv: https://www.siwiarchiv.de/online-philippis-beitraege-zur-siegerlaender-wirtschaftsgeschichte-1909/
Kreiskirchenamt in Siegen
Heute erschien in der Print-Ausgabe der Wittgensteiner Westfalenpost der Leserbrief „Stolz auf Adele Krebs sein“
Heute erschien in der Print-Ausgabe der Siegener Zeitung der Leserbrief „Opfer neben Tätern“
Heute in der Siegener Zeitung, Ausgabe Wittgenstein, leider nur im Print: https://www.siegener-zeitung.de/bad-berleburg/c-lokales/kehrtwende-bei-sensiblem-thema_a257711.
Ebenfalls berichtet die Wittgensteiner Westfalenpost heute: https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/bad-berleburg-will-an-nazi-opfer-wie-adele-krebs-erinnern-id234030579.html .
Zur gestrigen Ratssitzung ghab es auch Stellungnahmen folgender Parteien:
SPD: https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz610/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZfHB8-Hk8ohOz-pYHukcM-jgb8-b7OXCUOvUlgs4tycl/2021_12_06-_Stellungnahme_der_Verwaltung_zum_Antrag_der_SPD.pdf
UWG: https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz610/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZeDLPcvEvxSEN0JltyMvTrQCMWx6mwPgSKajP9cAfPfL/Eingabe_der_UWG-Fraktion_vom_06.12.2021-_Strassenbenennung.pdf
Linke: https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz610/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZW1hmt5qDXtnokK03jxgeWI1pvtngpkiiPYw3j-1NKHy/Eingabe_des_StV_Fischer_zum_Antrag_Nr._16.pdf
Pingback: Zur Kriegefangenenschaft Dr. Lothar Irles (1905-1974) – | siwiarchiv.de
Das Archiv des Sozialamts gehört dort nicht hin, da es im Dezernat III angesiedelt ist und nicht wie die anderen beiden im Dez. IV.
Prinzipiell ist Lagerung unterschiedlicher Provenienzen in Räumen eines Archivs nicht unüblich. Daher ist die Antwort leider nicht korrekt.
@Sven Panthöfer Die Antwort ist korrekt!
Wegen der erhöhten Brandgefahr in Archivmagazinen müssten sich deren Türen wahrscheinlich in Fluchtrichtung, also nach außen öffnen lassen. Soweit die Theorie …
In Archivräumen sollte dies so sein, aber ….
… aber es ist vielleicht gar kein offizieller „Archivraum“, sondern eine von den Ämtern in Konkurrenz zum zuständigen Kreisarchiv angelegte Sammlung? Die Beschriftung deutet jedenfalls darauf hin.
Aber so schwer war es doch gar nicht. Der Raum ist ein Registraturraum!
Pingback: Archäologie in Westfalen-Lippe 2020 erschienen | siwiarchiv.de
Pingback: Die ältesten deutschen Familienunternehmen – Archivalia
Als Ergänzung nun ide gestern im Laufe des Tages online gestellte, vollständige Pressemitteilung zur Veranstaltung:
„Siegener Bündnis für Demokratie gestaltet Ge(h)Denken in Zeiten der Pandemie
Am 16.12.2021 gedenken die Siegener Bürgerinnen und Bürger zum 77. Mal der Bombardierung ihrer Stadt im Jahr 1944. Über 50.000 Bomben wurden abgeworfen, Siegen versank in Schutt und Asche. Hunderte Menschen starben im Bombenhagel.
Die Veranstaltungen des Gedenktages, die seit 2008 vom Siegener Bündnis für Demokratie mitgestaltet und koordiniert werden, sind auch in diesem Jahr unter dem Vorzeichen der Pandemie und den damit verbundenen Schutz- und Hygienemaßnahmen geplant. Das Siegener Bündnis besteht aus einer Vielzahl von Kirchen, Gewerkschaften, Parteien, Jugendverbänden und weiteren gesellschaftlichen Gruppen und wendet sich dagegen, dass rechtsextreme Gruppierungen versuchen, den Gedenktag für ihre Ideologien zu mißbrauchen.
In diesem Jahr bestehen verschiedene Möglichkeiten am Ge(h)denken teilzunehmen:
Wie in allen Jahren erinnert das stadtweite Läuten der Kirchenglocken um kurz vor 15.00 Uhr an den verheerenden Luftangriff am 16. Dezember 1944. Anschließend findet das „Stille Gedenken“ der Stadt Siegen mit der offiziellen Kranzniederlegung durch den Bürgermeister an der „Gedenkstätte für die Opfer des Krieges und der Gewalt“ im Dicken Turm des Unteren Schlosses. Hier gilt die 3G-Regel.
Im Verlauf des Nachmittages von 15:30 – 17:30 Uhr sind interessierte Bürgerinnen und Bürger in das Aktive Museum Südweastfalen eingeladen. Dabei werden erste Konzeptideen der neuen
Dauerausstellung sowie besondere Quellen zur juristischen Aufarbeitung der Verbrechen im Holocaust unter dem Motto „Aufbruch im Museum“ gezeigt. Der Zutritt ist für maximal 10 Personen zeitgleich und der Einhaltung der 3G-Regel möglich.
Ebenfalls von 15:30 – 17:00 Uhr sind das Aktionsbündnis Friedensbewegung Südwestfalen und „Siegen gegen Rechts“ mit einem Informations- und Diskussionsstand auf der Siegbrücke. „Nie wieder Fachismus – Nie wieder Krieg!“ präsent.
Um 18:00 Uhr findet der traditionelle Ökumenische Gottesdienst zum Gedenken an die Zerstörung Siegens in der Nikolaikirche statt. Es gilt die 3G-Regel und der Eingang ist wegen der Kontrolle vom Parkplatz Pfarrstraße aus.
Zwei weitere Veranstaltungen flankieren das Gedenken:
Bereits am 14.12.2021 präsentiert um 19:30 Uhr das Junge Theater Siegen Max Frisch „Biedermann und die Brandstifter“ reloaded – Warnung vor der Zerstörung der Demokratie“ im Kleinen Theater des Medien- und Kulturhauses Lyz. „In Max Frischs Stück „Biedermann und die Brandstifter“ erleben wir einen reichen Hausherren und seine Frau, welche – trotz zunehmend offensichtlicher Gefahr durch in ihr Haus eingetretene Brandstifter*innen – krampfhaft versuchen, eine bürgerliche Fassade aufrecht zu erhalten. Gewürzt wird dies durch einen Chor, der auch nur warnend berichtet, aber nicht eingreift. Ähnlichkeiten und Parallelen zu aktuellen Entwicklungen rund um die aktuellen Gefahren für unsere Demokratie sind nicht zufällig. Der Einlass giltn nur mit 2G und nur nach Voranmeldung jungestheatersiegen@gmail.com.
Den Abschluss soll am 18.12.2021 ein „Konzert gegen Rechts“ im Musikclub Vortex. Beim Konzert spielen NTBC – Trap & For Heads Down – Punkrock aus Siegen. Es steht noch nicht fest, ob das Konzert mit oder ohne Publikum durchgeführt wird. Weitere Infos folgen.
Ingo Degenhardt (DGB) und Andree Schmidt (Stadt Siegen) rufen stellvertretend für das Siegener Bündnis für Demokratie alle Bürgerinnen und Bürger unter Einhaltung der Schutzregelungen zur Teilnahme an den Veranstaltungen dieses wichtigen Gedenktages auf!“
Quelle: https://suedwestfalen.dgb.de/presse/++co++e1e7c0a0-5c12-11ec-9bcd-001a4a160123
Inhaltsverzeichnis:
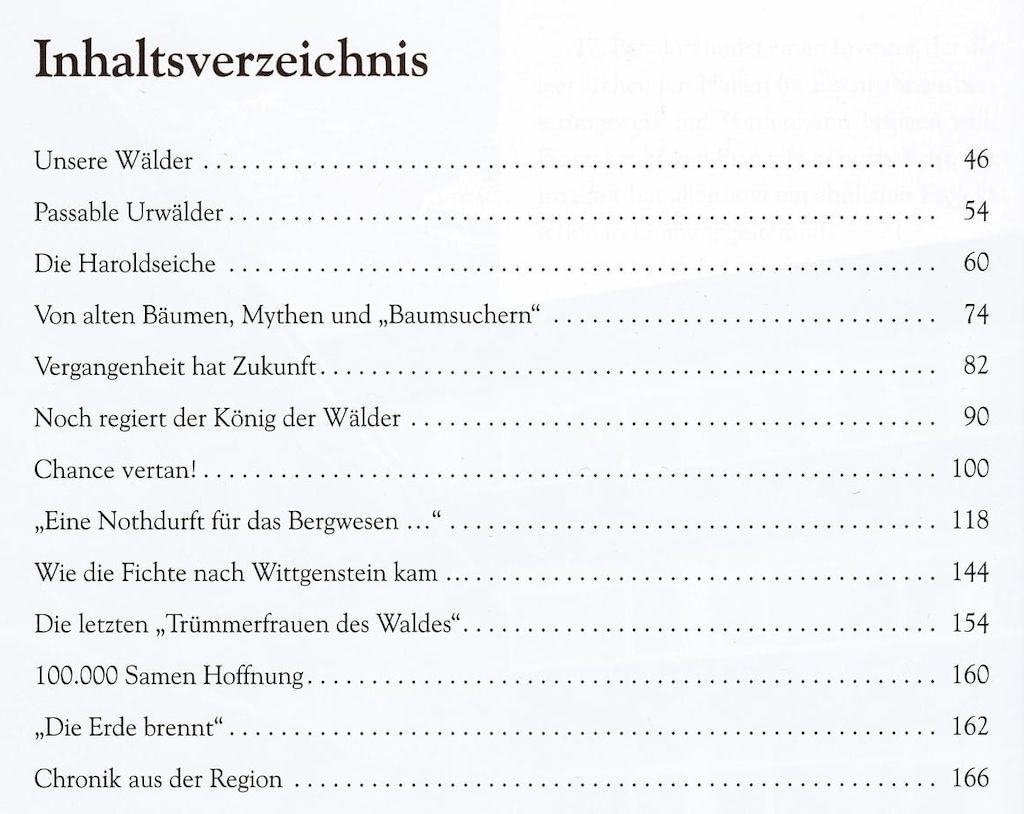
Pingback: Erschienen: „Vergangene Fürstenpracht – Die Geschichte des Herrengartens in Siegen“ | siwiarchiv.de
Stadtarchiv Siegen
Das ist korrekt: Gratulation!
Pingback: Online: „Über die Gangverhältnisse des Siegerlandes und seiner Umgebung“ (1910, 1912) | siwiarchiv.de
Literatur:
Anspach, Maria: Dr. Josef Mengeles „Probetierchen“ – ein Blockführer des „Zigeunerlagers“ Auschwitz-Birkenau vor Gericht, in: Tribüne , H 26 (1987),102, S. 132 – 139
Arnold Roßberg: Die Aufarbeitung des NS-Völkermordes an den Sinti und Roma – Ermittlungsverfahren gegen die Täter und Anmerkungen zu dem Prozess beim Landgericht Siegen über das sog. „Zigeunerlager“ Auschwitz-Birkenau, in: Schonung für die Mörder? Die justizielle Behandlung der NS-Völkermordverbrechen und ihre Bedeutung für die Gesellschaft und die Rechtskultur in Deutschland. Das Beispiel der Sinti und Roma, Heidelberg 2015, S. 94–113
Folgende Zeitungsartikel fehlen noch in der obigen Aufstellung:
– Westfälische Rundschau, [August ?] 1987 [MA: Maria Anspach]: Viele Terminverschiebungen im NS-Prozeß durch kranke Zeugen. Josef J: Häftlingskleidung nur unter Dampf – nie gewaschen“
– Westfälische Rundschau, 27.8.1987: „Es geht um lebenslänglich“
– Westfälische Rundschau, 2.9.1987: Nebenkläger im Siegener NS-Prozess fordern: Auslandsreisen für alle Gerichtspersonen“
– Frankfurter Rundschau, 10.9.1987: Ingrid Müller-Münch (Köln): Beklemmender Streit um historische und juristische Wahrheit. Das Siegener Landgericht verhandelt gegen einen ehemaligen Blockführer im Zigeunerlager Auschwitz-Birkenau
– Westfälische Rundschau, 2.11.1987: Erneut Augenzeugenschilderung: „Ich sah, wie König mit dem Ochsenziemer Onkel Oskar erschlug“
– Westfälische Rundschau, 11.11.1987 Folgen von Auschwitz für Zeugin. Gestern untersucht: Unfähig auszusagen
– Westfälische Rundschau, 15.12.1987 [MA: Maria Anspach]: An Liquidierung des Zigeunerlagers beteiligt?
– Westfälische Rundschau, 16.12.1987 [MA: Maria Anspach]: Gerichtssaal brechend voll für stummen Zeugen: Der Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Broad – Muß er trotzdem aussagen?
– Westfälische Rundschau, [1988?] [MA: Maria Anspach]: Nach Prozeßpause USA-Flug. Widersprüchliches in Vernehmungen der Schwestern Königs
– Westfälische Rundschau, 13.01.1988 [MA: Maria Anspach]: Ehemaliger SS-Richter als Zeuge vor Gericht: „Bis 1944 nichts von Vernichtung gewußt“
– Westfälische Rundschau, 14.01.1988 [MA: Maria Anspach]: Erinnerung für Zeugen of „unendlich schwer. König im Fall Schenk belastewt und entlastet
– Westfälische Rundschau, 20.01.1988 [MA: Maria Anspach]: Aussagen aus dem Nürnberger Prozeß verlesen – Ex-Richter wollte SS reiwaschen: Häftlinge alle wohlgenährt und braungebrannt“
– Westfälische Rundschau, 02.02.1988 [MA: Maria Anspach]: Nachtragsanklage gegen König? Vier neue Zeugen mit dem Vorwurf „Tödliche Prügel
– Westfälische Rundschau, 10.02.1988: In Brake: Zeugenaussage belastete König schwer
– Westfälische Rundschau, 01.03.1988: Haftverschonung für NAziv-Verbrecher
– Westfälische Rundschau, 02.03.1988 [MA: Maria Anspach]: 40 Jahre sind viel zu kurz – um zu vergessen: Erinnerung an den Tod der Mutter ließ Zeugin fast zusammenbrechen
– Westfälische Rundschau, 05.03.1988: Zeitzeugen aus Polen im Prozeß: Der Direktor vom Auschwitzmuseum informiert Gericht
– Westfälische Rundschau, 25.04.1988: Schicksalsberichte inmitten froher Festlichkeit. Ehrenwart in Führerhauptquartier – Dann abgeholt und sterilisiert
– Westfälische Rundschau, 25.04.1988: NS-Prozeß: Schwurgerichtskammer wieder auf Reisen – Angeklagter König erneut schwer belastet. Nach Tritten blieb Schwangere auf der Lagerstraße liegen
– Westfälische Rundschau, 25.04.1988: Maria Anspach: Sintitreffen in Mülheim vor dem Hintergrund von Siegenens NS-Prozeß. Nach den Aussagen vor Gericht Aufarbeitung von Erfahrungen
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 28.11. – 10.12.2021 | siwiarchiv.de
Ergebnisse einer Archivrecherche zur Fernsehberichterstattung zum Prozess:
– WDR, Hier und Heute, 5.5.1987, „NS-Prozess in Siegen“, Dauer 3min 15sek
– WDF, Aktuelle Stunde, Fenster Dortmund, 25.8.1987, „Ehemaliger SS-Führer in Siegen vor Gericht“, Dauer: 23sek
– SWR, 17.11.1988, „SS-Prozess in Siegen“, Dauer: 7min
– WDR, Hier und Heute, 29.6.1989, NS-Prozess“, Dauer: 3min 59sek
– WDF, Aktuelle Stunde, Fenster Dortmund, 3.10.1989, „Schwere Vorwüfre von Romani Rose“, Dauer: 21sek
– WDF, Aktuelle Stunde, 4.10.1989, „Der vergessene Prozeß“, Dauer: 3min 33 sek
– WDF, Aktuelle Stunde, 17.4.1990, „NS-Prozess in Siegen“, Dauer: 4min40 sek
– WDF, Aktuelle Stunde, Fenster Dortmund, 28.11.1990, „Ernst August König soll zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt werden“
– WDF, Aktuelle Stunde, Fenster Dortmund, 2.1.1991, „Verteidigung im Siegener NS-Prozess übt Kritik“
– WDF, Aktuelle Stunde, Fenster Dortmund, 14.1.1991, „Angeklagter Ernst August König beteuert seine Unschuld“
– WDR, Hier und Heute, „Urteil im Siegener NS-Prozess“, Dauer: 3min33sek
– WDF, Aktuelle Stunde, 24.1.1991, Interview zu NS-Prozess“, Dauer: 3min
– NDR, Tagesschau, 24.1.1991, „Urteil für Ernst August König“, Dauer: 1min 12 sek
– WDF, Aktuelle Stunde, Fenster Ruhrgebiet, 18.9.1991, „Selbstmord des NS-Verbrechers Ernst August König“
Rundfunkberichterstattung:
– WDR, Echo West, 28.6.1989, SS-Prozess in Siegen, Dauer: 2min 25sek [Autor: Raimund Hellwig]
– SWR: „zwei kurze Hörfunkbeiträge vom 24.01.1991 zur Urteilsverkündung“
Dank an alle Kolleg:innen in den Medienarchiven!
Aus dem TAZ-Archiv:
TAZ, 6.5.1987, „Großer Andrang zu Siegener NS-Prozess“, Link: https://taz.de/Archiv-Suche/!1866704
TAZ, 4.10.1989, B[ettina] Markmeyer, „Zeugen getäuscht“, Link: https://taz.de/Archiv-Suche/!1796153
TAZ, 29.11.1990, „Ehemaliger KZ-Blockwart soll für Beihilfe zum Mord verurteilt werden“, Link: https://taz.de/Archiv-Suche/!1742497
TAZ, 25.1.1991, Bettina Markmeyer, „Kein Massenmord – aus Mangel an Beweisen“, Link: https://taz.de/Kein-Massenmord–aus-Mangel-an-Beweisen/!1735532/
TAZ, 13.3.1991, „NS-Prozess: Ex-KZ-Wärter muss doch ins Gefängnis“, Link: https://taz.de/Archiv-Suche/!1728171
Eingangstür zum Krönchen Center- Aufzug links.
Ist sowiet korrekt – nur zu Sicherheit: es war kein Rätsel ;-) .
wo ungefähr ist die Gaststätte Hammerhütte
Die Nationalzeitung – https://zeitpunkt.nrw/ulbms/periodical/zoom/8806465 – berichtet in ihrer Ausgabe vom 23.2.1940 ausführlicher über das Unglück. Die dort igen Ortsangaben geben Hinweise , wo genau sich der Unglücksherd befand (Kirchweg 42). Wenn sich die Nummerierung nicht geändert hat, dann befand Explosionsort auf dem Gelände des heutigen Landgerichtsgebäudes.
Stadtarchiv Siegen Eingangsbereich verschließbare Schränke für die Besucher des Archivs
Ist sowiet korrekt – nur zu Sicherheit: es war kein Rätsel ;-) .
Zum Hintergrund s.:
und https://www.siwiarchiv.de/vom-ende-des-siegerlaender-erzbergbaus/
Zwei interessante Facebook-Posts in der Gruppe „Bergbau Siegerland:
1)
2)
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 11.12. – 23.12.2021 | siwiarchiv.de
Die Doku erwähnt Julius Gonsenhäuser, wohnhaft in Berleburg.
Julius G. war verheiratet mit Irma Gonsenhäuser geb. Arensberg und wohnte in Warstein, Hauptstraße 33. Heirat am 6.4.1897 in Warstein.
Gonsenhäuser, Julius (Kaufmann) * 1895 in Berleburg Kreis Wittgenstein
verhaftet nach der Reichspogromnacht – ermordet am 20.12.1938 in Buchenwald.
Seine Urne wurde auf dem jüdischen Friedhof in Warstein beigesetzt.
Gonsenhäuser geb. Arensberg, Irma * 1898 in Warstein
im September 1939 nach Köln verzogen. Deportation ab Düsseldorf am 10. November 1941, nach Minsk, Ghetto
Sie soll 1941/42 im Ghetto von Minsk in Weißrussland umgekommen sein.
Vielen Dank für die ergänzenden Informationen! Sie werden auch in das Aktive Gedenkbuch für die Opfer des Nationalsozialismus im Kreis Siegen-Wittgenstein eingearbeitet werden. Allerdings erscheint mir das Datum der Eheschließung wenig plausibel.
Vielen Dank für die Informationen!
Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein
Die Antwort ist korrekt! Herzlichen Glückwunsch!
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik Dezember 2021 | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Jahresstatistik 2021 | siwiarchiv.de
Rechts von Landrat Schmidt schaut der Kopf von Hans-Georg Vitt hervor, damals BM Hüttental und Verkehrsexperte, MdL im Landtag NRW
Vielen Dank für den Hinweis! Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob dies wirklich Vitt ist.
Bitte schreiben Sie Forster richtig.
Karlheinz Forster
Danke für den Hinweis! Der Beitrag ist entsprechend korrigiert.
Das vom Kreisarchiv hier beigesteuerte Beispielfoto (Protestaktion von Angehörigen der Hüttentaler Bauschule und evtl. der anderen Siegener Fachschulen im Juni 1968, als sie sich offiziell noch nicht einmal „Studenten“ nennen durften) könnte den Eindruck erwecken, es würden auch Bilder aus der Zeit vor 1972 gesucht. Ich wage zu bezweifeln, dass die Pressestelle die Vorgeschichte illustrieren möchte, zumal die Zahl von lediglich für eine Ausgabe des Uni-Journals ausgewählten Fotos letztendlich sehr begrenzt bleiben wird. Eifriger Aktionismus und anschließende herbe Enttäuschung bei vielen unberücksichtigt bleibenden Einsendern sind vorhersehbar. Wie durchdacht dieser Aufruf der Pressestelle ist, habe ich nicht zu beurteilen.
Aus meiner aktiven Zeit erinnere ich mich daran, dass im Archiv der Uni Siegen eine bereits recht umfangreiche Fotosammlung zu vielen Aspekten der Uni-Geschichte zusammengetragen worden ist, aus der die Herausgeber des geplanten „Querschnitt“-Heftes schon jetzt erfolgreich schöpfen könnten. Dieses Bildarchiv stetig auszubauen, ist ein permanentes Anliegen jenseits der hin und wieder zelebrierten Jubelfeiern. Studierende, Alumni und alle anderen jetzigen und früheren Angehörigen der Universität (und ihrer Vorgängereinrichtungen), die durch Übergabe von kleinen oder großen Fotosammlungen etwas zur Dokumentation der Hochschulgeschichte beitragen wollen, sind meiner unmaßgeblichen Einschätzung nach im Archiv stets willkommen.
Pingback: Alma Siedhoff-Buscher, Struktur- und Kompositionsstudie, um 1920 | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 24.12.2021 – 5.1.2022 | siwiarchiv.de
Pingback: Wilfried Lerchstein: Sport, Kirche und Heimatgeschichte | siwiarchiv.de
In der Zwischenzeit befindet sich auch der Beitrag „Sitzstreik der Kumpels im Eisenerzbergbau im Siegerland“ des WDR, hier und heute, vom 21.12.1961 online: https://www.ardmediathek.de/video/wdr-retro-hier-und-heute/sitzstreik-der-kumpels-im-eisenerzbergbau-im-siegerland/wdr/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLWE4OTVhMDc5LTUyZDUtNDkyMC04MzQzLTU0ZjY1YTlmNzYxMA/
Pingback: Zur Lage der Hochschularchive in NRW – Archivalia
Hallo,kann man die DvD der Eisenwald noch irgendwo käuflich erwerben
Mfg
R.Sting
Eventuell im Buchhandel? Ansonsten hat die Firma mundus.tv eine USB-Stick-Zusammenstellung von Siegerland-Filmen im Angebot. Schließlich ist der Film auch noch auf Facebook sichtbar: https://fb.watch/atqDEAs_32/
Pingback: Scheitert die Erweiterung des Siegerlandmuseums? | siwiarchiv.de
Gerade eben:
Bereits gestern:
Position der AfD-Stadtratsfraktion: Bunker Burgstraße/Erweiterung Siegerlandmuseum: Entscheidung zwischen Kopf und Herz, Link: https://afd-fraktion-siegen.de/aktuelles/2022/01/bunker-burgstrasse-erweiterung-siegerlandmuseum-entscheidung-zwischen-kopf-und-herz/
Erster Pressebericht:
Pingback: Ein Ego-Dokument von Friedrich Ackermeier, Bürgermeister Hilchenbachs von 1932 – 1941 | siwiarchiv.de
Hallo mein Name ist Andreas Bartkowiak,
ich kann Frau Woods leider nicht helfen, war vom 27.05.1978 bis 21.02.1980
auf der MS Siegerland unsere Fahrt ging von Rotterdam nach Portugal nach Schweden und zurück nach Rotterdam.
Eine tolle Zeit :) Hat noch jemand Bilder von der MS Siegerland ?????
Pingback: #ArchivAnspruchWirklichkeit – Blogparade zum 10. Geburtstag von siwiarchiv | siwiarchiv.de
Link zur PDF-Version des Buches: http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10048
In der Westfalenpost (Print) erschien heute folgender Artikel „Idee: Odebornbrücke Adele Krebs widmen. Gebürtiger Berleburger verfolgt von Bonn aus die Diskussion zum Gedenken an Jüdin, über die er gerade forscht“ zum Thema. Link zum Artikel: https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/idee-fuer-berleburg-adele-krebs-die-odebornbruecke-widmen-id234348323.html (Ergänzung erfolgte am 20.1.22)
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 6.1. – 18.1.2022 | siwiarchiv.de
Literatur:
– Andreas Eichmüller: Die Strafverfolgung von NS-Verbrechen durch west-deutsche Justizbehörden seit 1945. Eine Zahlenbilanz, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, Jg. 56 (2008) Heft 4, S 621 – 640
– Bundesministerium für Inneres, Bau und Heimat: Perspektivwechsel.
Nachholende Gerechtigkeit. Partizipation. Bericht der Unabhängigen Kommission Antiziganismus, Berlin 2021, Link: https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/PDF/UKA/Bericht_UKA_Perspektivwechsel_Nachholende_Gerechtigkeit_Partizipation.pdf
– Opfermann, Ulrich F.: Zum Umgang der deutschen Justiz mit an der Roma-Minderheit begangenen NS-Verbrechen nach 1945. Das Sammelverfahren
zum „Zigeunerkomplex“ (1958–1970). Expertise für die Unabhängige Kommission Antiziganismus: Unveröffentlichte Fassung, 2020.
– Opfermann, Ulrich F.: „Genozid und Justiz. Schlussstrich als ‚staatspolitische Zielsetzung‘“, In: Zigeunerverfolgung im Rheinland und in Westfalen 1933–1945. Geschichte, Aufarbeitung und Erinnerung, herausgegeben von Karola Fings und Ulrich F. Opfermann, 233–255. Paderborn 2012
Auch ich Brigitte Schuss möchte einen kleinen Beitrag senden:von 1974bis1976 war ich in der Tagesschule für Englisch und ich musste meine Diplomarbeit inEnglisch über Charles Dickens verfassen….auch war unsere Studienreise nach London ein Erlebnis…zumal Dr.Bode unsere Gruppe mit einen hocherhobenem Stock mit Wimpel!!!!In Schach hielt…man wusste immer wo er sich befand….einfach sensationell….lieben Gruss Brigitte Schuss…..
Vielen Dank für die Schilderung Ihrer Eindrücke!
Pingback: Videos: Einführung in die Sphragistik (Siegelkunde) – Archivalia
Die unter Punkt 4 aufgeführte URL ist fehlerhaft , Internet Fehler 404
Danke! Korrigiert:
In der in Siegen von 1986 bis 1993 erschienenen Zeitschrift „der TIPP“ sind folgende Artikel nachweisbar:
– [thostra]: „Bis jetzt wurde hier nur gelogen“. 40 Jahre nach Auschwitz: NS-Prozeß in Siegen, der Tipp 7/8 (1987), S. 6 – 7
– [Raimund Hellwig]: Täter in Auschwitz – Ein Verfahren schreitet voran. Mord im KZ: Der Prozeß gegen Ernst Augsut König (Teil I), der Tipp,4 (1988), S. 10 – 12
– [U.O]: Nur Kavaliersdelikte? NS-Verbrechen und die heutige Justiz, der Tipp,4 (1988), S. 12
Anmerkung: Der zweite Teil des Berichtes von Raimund Hellwig wurde für das Heft 5/88 angekündigt. Die genauen Angaben müssen noch nachgetragen werden.
Pingback: Stolpersteine NRW – Archivalia
Weitere Quelle zur Fritz Müller:
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, I. HA Rep. 84a [Justizministerium], Nr. 54083 Strafverfahren gegen den Nationalsozialisten Friedrich Wilhelm Müller in Obersdorf, Kreis Siegen, wegen Vergehen gegen das Republikschutzgesetz in einer Rede in einer Versammlung der NSDAP in Langenbach bei Neuwied
Pingback: Neue evangelische Kirchenbücher aus dem Kirchenkreis Wittgenstein bei Archion online | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 19.1. – 31.1.2022 | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik Januar 2022 | siwiarchiv.de
Pingback: Karlheinz Forster (1931 – 2022) | siwiarchiv.de
Eltern haben 1988 in einem großen Schulkampf die erste Gesamtschule in Siegen erkämpft.
Oberkreisdirektor Karl- Heinz Forster hat sie dabei unterstützt. Durch Ersatzvornahme über das OVG- Münster hat er es geschafft, das Anmeldeverfahren in einem Siegener Schulgebäude zu ermöglichen. Zuvor hatte die Stadt Siegen (Beigeordneter Koch) den Beauftragten des Regierungsbezirks Arnsberg, Jörg Raguse (späterer Schulleiter), der das Anmeldeverfahren durchführen wollte, des Gebäudes zu verweisen. Bürgermeister war Hans Reinhardt SPD, der im Nachgang die SPD verließ und die UWG gründete
Nachdem die erforderlichen 112 Anmeldungen zusammen waren, konnte die Schule durch Ratsbeschluss mit den Stimmen von Grünen, SPD und FDP im Sommer 1988 ihren Betrieb aufnehmen. Eine 2. Gesamtschule folgte ein Jahr später. Heute gibt es drei Integrierte Gesamtschulen in Siegen. Ein Erfolgsmodell.
Danke an Karl-Heinz Forster.!
History marketing im LYZ – Ein Flyer zum Bücher-Brunch am 6.3. verwendet dieses Bild:
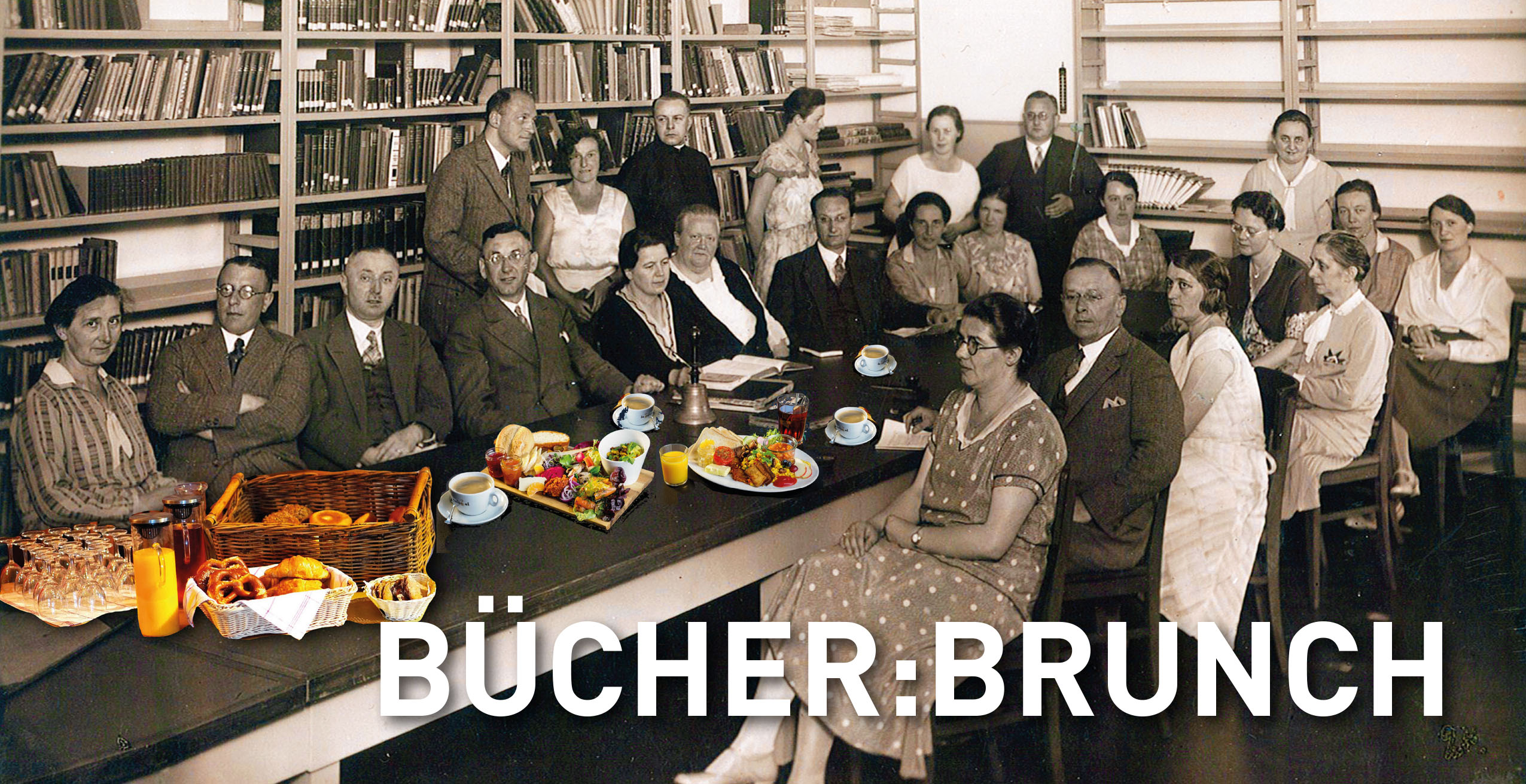
Moin Moin :-)
ich weis nicht ob Sie mir helfen können. Ich bin gebürtig vom WW, heute 62 Jahre Hier und da erzählt man von früher. So auch gestern. Thema die Siegtalbrücke.
Ich meine mich zu erinnern, dass es damals beim Bau 1964 – 1970 irgendwann einen Arbeitsunfall gegeben hat und ein bauarbeiter in den frischen Beton eines Brückenpfeilers gefallen ist und nicht gerettet werden konnt. Ist das Wahrheit oder eine zusammengesponnene Kindererinnerung?
Freue mich auf Ihre Rückantwort.
Mit freundlichen Grüßen
Gisela Karst
Leider habe ich mich noch nicht intensiv mit der Baugeschichte der Brücke auseinandergesetzt. Daher empfehle ich eine Anfrage an die Heimatgruppe Niederschelden, die diese Ausstellung ausgerichtet hat. Vielleicht weiß man dort mehr. Wenn nicht, dann muss wohl eine Auswertung der lokalen Presse im Siegener Stadtarchiv erfolgen, die u. U. über diesen Arbeitsunfall berichtet hat.
In der Siegener Zeitung erschien am 7. Januar 1985 der auch heute noch lesenwerte Artikel „Von Illusionen, Utopien und Realitäten im Städtebau. Erinnerungen, Gedanken und Vorschläge des Siegener Architekten Dipl. Ing. Walter Bonin“ – Danke für den Hinweis an HWG!
Heute erschienen in der Siegener Zeitung – leider nur im Print – der Artikel „Die Unliebsamen. Namensgeber für Siegener Straßen fallen in Ungnade. Acht historische Persönlichkeiten, acht Vorwürfe der Nähe zu den Nazis.“ von Irene Hermann Sobotka zur Arbeit des Arbeitskreises und der dazugehörige Kommentar der Autorin mit der Überschrift „Schilderstürmer“.
Nicht unerwartet erschienen heute in der Siegener Zeitung 2 Leserbriefe zu den beabsichtigten Straßenumbennungen. „Linke Ideologie“ unterstellt dem Arbeitskreis ebensolche und weist daraufhin, dass auch Martin Luther antisemitisch gewesen sei. Eine Umbennung dieser Siegener Straße aber nicht vorgesehen sei. Zudem wünscht der Schreiber, dass die Gesamtlebensleistung aus ihrer Zeit heraus gewürdigt werden sollte. So sollen bspw. die enormen Wahlerfolge Adolf Stoeckers berücksichtigt werden. Der 2. Leserbrief „Ersatz wäre denkbar“ begrüßt die Umbennung der Hindenburgstraße, verweist auf die unterschiedlichen Schreibweisen Stö-Stoeckers und widmet sich – off topic- der Kunst Hermann Kuhmichels im öffentlichen Raum, die aus der NS-Zeit stammt (Rubens-Brunnen am Oberen Schloss.) Hierfür schlägt einen Ersatz vor.
Heute sind es 4 Leserbriefe in der Siegener Zeitung zum Thema:
– „Personen herabgesetzt“ bedankt sich für den Kommentar und unterstellt dem Vorsitzenden des Arbeitkreis, dies getan zu haben, nicht ohne daraufhin zu weisen, dass auch er sich ja eventuell für seine Äußerungen zu verantworten habe.
– „Nur nach rechts“ bedankt sich für den Kommentar und bemängelt die politische Einseitigekeit bei der Auswahl der Personen.
– „Deckungsgleich“ bedankt sich für den Kommentar, weist allerdings auf eine dortige Verwechslung hin (Jacob Heinrich Schmick – Jacob Henrich) und warnt vor „unhistorischen Eifer“ bei Straßenumbenennungen.
– „Tätersuche beenden“ ist verwundert über ein „Sendungsbewusstsein“, das „nach etwa 80 Jahren“, die „deutsche Geschichte neu schreiben“ will und verweist darauf, dass die Mitgliedschaft in einer nationalsozialistischen kein Kriterium zur Bewertung einer Lebensleistung sein solle.
Pingback: Thomas Wolf: Lothar Irle (1905 – 1974). | siwiarchiv.de
Pingback: Thomas Wolf: Lothar Irle (1905 – 1974). | siwiarchiv.de
Pingback: Thomas Wolf: Lothar Irle (1905 – 1974). | siwiarchiv.de
Pingback: Warum ehrt(e) die Lothar-Irle-Straße in Siegen einen „bekennenden Antisemiten“? – Archivalia
Pingback: Online: „Künstlerinnen und Künstler in Westfalen. Werkverzeichnis“ | siwiarchiv.de
Es ist schön und wichtig unsere Kulturschätze zu erhalten,sie machen einen hervorragende Arbeit.
Gestern erschienen in der Siegener Zeitung 5 Leserbriefe zum Thema:
– „Geschichte bewahren“ fordert die vom Arbeitskreis angekündigt Transparenz ein und kündigt eine aktive Beteiligung der Zivilgesellschaft an. Das angekündigte Servicepaket für den von evt. Umbenennungen Betroffenen wird begrüßt. Straßennamen seien „Teil der Erinnerungs- und Lernkultur“, so daß die Erfahrungen mit ergänzenden und erklärenden Schildern genutzt werden sollen.
– „Unfair bewertet“ sieht der Leserbriefschreiber den Reichspräsident Hindenburg, da die nach ihm benannte Straße umbenannt werden soll. (“ … trotz dem hat er sich 1925 und 1930 als Reichspräsident die Verfassung und Republik geschützt ….“). Entgegen der Einschätzung des Arbeitskreises, die lediglich eine Erläuterung bei der Graf-Luckner-Straße vorsieht, fordert der Leserbrief eine Umbenennung („Graf Luckner war eine der vielen Personen, mit denen man in der Weimarer Republik der männlichen Jugend den Weltkrieg als Abenteuer verkaufte. Wie es wirklich war, kann man bei Remarque nachlesen.“)
– Anstelle Plätze und Straßen nach Personen zu benennen empfiehlt ein weiterer Leserbrief „Durchnummerieren“.
– „Welch ein Irrsinn“ sei die „plötzlich“e Prüfung und ggf. Umbenennung von Straßennamen, „weil irgendwer in den 1930er Jahren womöglich mal Adolf Hitler Guten Tag gesagt hat.“
– „Besser aufklären“ als umbenennen fordert ein weiterer Leserbrief.
Pingback: Stellungnahme zur Diskussion um Straßenumbenennungen in Siegen | siwiarchiv.de
Pingback: Stellungnahme zur Diskussion um Straßenumbenennungen in Siegen | siwiarchiv.de
Pingback: Stellungnahme zur Diskussion um Straßenumbenennungen in Siegen | siwiarchiv.de
Es ergibt mehr Sinn, das Original kennenzulernen als sich in die Stellungnahme des Blatts zu vertiefen. Es sei denn, man möchte vergleichen…
Vielen Dank für den Kommentar! Diskursanalytisch wäre ein Vergleich sicher sinnvoll. Daher wird der Arikel hier als Kommentar nachgereicht werden.
„…Deutungen und Erzählungenverraten…“ Ich spendiere eine _ hier; auch der Geschichtswerkstatt.
Ich denke aber nicht, dass dieser Lapsus dazu geführt hat, dass die in der Thematik engagierte Heimatzeitung den entsprechenden Textabschnitt nicht wiedergegeben hat.
Vielen Dank für den Kommentar! Der Fehler wurde korrigiert. Um das Engagement der „Heimatzeitung“ bewerten zu können, wird, der erwähnte Artikel hier noch nachgereicht werden. In der Tat war die Geschichtswerkstatt Siegen hier schneller. Dies hatte , sagen wir einmal, technische und private Gründe …..
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 1.2. – 13.2.2022 | siwiarchiv.de
Pingback: „Denkmalschutz würde schwächer“ | siwiarchiv.de
s. a. Stellungsnahme der Landesgruppe NRW des Verbandes der Restauratoren, 14.2.2022: https://www.restauratoren.de/neuer-entwurf-des-denkmalschutz-gesetzes-ein-opfer-des-zeitgeistes/
Heute erschien ein weiterer Leserbrief „Nicht in Ordnung“ in der Siegener Zeitung.
In der frisch erschienen Broschüre „Das Leben des Hugo Herrmann. Letzter Repräsentant der ehemaligen jüdischen Gemeinde in Siegen“ von Traute Fries findet sichauf S. 32 der Hinweis, dass Heinrich Böll am 15.11.1961 im Siegener Mädchengymnasium gesprochen hat.
Das NRW-Zeitungsportal liefert mit zunehmend durch Texterkennung erschlossenen Zeitungstiteln immer weitere Funde zu Lothar Irle:
1) Bochumer Anzeiger, 20.6.1934:
Vor dem NSLB im Kreis Wattenscheid hält Lothar Irle am 20.6.1934 vor der Kreisversammlung einen Vortrag zum Thema „Familienkunde“.
2) Bochumer Anzeiger, 12.12.1938:
In der Gauarbeitsgemeinschaft für deutsche Volkskunde übernimmt Lothar Irle die Arbeitsgemeinschaft „Wissenschaftliche Volkskunde“.
Heute erschienen im Print weitere Leserbriefe zum Thema:
– In „Erhebliche Kosten“ schlägt der Leserbriefschreiber vor, die belasteten Straßennamen beizubehalten und die Schilder mit einem kleinen Schild mit QR-Code zu versehen, um die Kosten einer Umbenennung zu sparen.
– Der Leserbrief „Fragwürdige „Belege““ nimmt lediglich Bezug auf einen Leserbrief vom 10.2., der einen Ersatz für den Rubens-Brunnen Hermann Kuhmichels anregte. Er verweist auf die problematische Quellenlage bei der Erforschung von Biographien während der NS-Zeit, die eine gründliche Quellenkritik erfordert.
s. a. [Tillmann, Elsabeth:] Kirchenrevolte in Neunkirchen 1759, in: Siegerländer Heimatkalender 1964, S. 87
„„Archiv für alternatives Schrifttum“ Größte private Sammlung linker Schriften sieht sich in Existenz gefährdet – Afas in Duisburg kritisiert Politik. Das Archiv für alternatives Schrifttum in Duisburg sieht sich in seiner Existenz gefährdet.“ Deutschlandfunk, Nachrichten v. 11.2.2022, via Archivalia v. 15.2.22
s. a. WAZ 17.2.2022, Link: https://www.waz.de/staedte/duisburg/groesstes-archiv-deutschlands-afas-geht-das-geld-aus-id234601191.html
Hier gibt es das Interview mit Dr. Jürgen Bacia: https://www.deutschlandfunk.de/juergen-bacia-im-gespraech-ueber-das-archiv-fuer-alternatives-schrifttum-duisburg-dlf-ad834259-100.html
Präzisierung durch das afas am 21.2.2022:
„Am 11. Februar sendete der Deutschlandfunk ein Interview mit Jürgen Bacia über das afas und seine aktuelle Finanzierungssituation. Wir freuen uns über den Bericht, die anschließenden Artikel in den Online- und Printmedien und die Diskussion in den sozialen Netzwerken. Aufgrund der notwendigerweise gekürzten Form des Radio-Interviews kann es zu Missverständnissen kommen, die einiger Anmerkungen bedürfen:
– Jürgen Bacia ist nicht hauptverantwortlicher Leiter des afas, sondern Teil des Leitungsteams
– Das afas erhält den überwiegenden Teil seiner Förderungen über Projektmittel des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW
– Die afas-Sammlung umfasst das gesamte Spektrum der Neuen Sozialen Bewegungen
– Das afas ist nicht das größte Archiv Deutschlands (sondern das größte Freie Archiv)“
Pingback: Literaturhinweis: Traute Fries „Das Leben des Hugo Herrmann. | siwiarchiv.de
Zu Irle s. a. SGV-Bezirk Siegerland (Hg.): 100 Jahre Kindelsbergturm. Festschrift zum Jubiläum am 17. Mai 2007, Christi Himmelfahrt, Siegen 2007, S. 51 58
Nur eine Lappalie:
Nachdem die von der Siegener Zeitung (Anm. 83) gelegte Spur zur „National Geographic Society“ in die Irre geführt hat (Warum hätte er dort auch Mitglied sein sollen?), schlage ich vor, es einmal bei der „National Genealogical Society“ (https://www.ngsgenealogy.org) zu versuchen.
Danke für den Hinweis! Ich werde es versuchen.
Auch diese Nachfrage blieb erfolglos.
Nach der Veröffentlichung des Artikels in Wikipedia erhielt ich den Anruf eines Nachkommens des Amtmannes Vollmer, der Vollmers Exemplar der Festordnung zum 24. September 1911 zur Verfügung stellte. Der Scan des historischen Dokuments ist bereits in den Artikel eingepflegt. Auf der Rückseite der Einladung findet sich ein Schreiben Vollmers zur Reichstagswahl (1912?).
Das ist ja eine schöne Reaktion!
Der Landrat hat die Einladung ebenfalls unterzeichnet: https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_von_Hartmann-Krey, s.a. https://www.siwiarchiv.de/siwiarchiv-adventskalender-201618/.
Müsste dann die Reichstagswahl am 12. Jan uar 1912 gewesen sein: https://de.wikipedia.org/wiki/Reichstagswahl_1912
Ein weiterer Bildfund im „Siegerländer Heimatkalender für das Jahr 1941“ u. a. auch zu Fissmer:

Pingback: siwiarchiv-Statistik: 14.2. – 26.2.2022 | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik Februar 2022 | siwiarchiv.de
Lieber Herr Lohrum,
in meinem im Dezember bei Hnetrich / Hentrich erschinenen Buch „Eine Waschmaschine in Haifa“ geht es um 14 Briefe aus der Nahkriegszeit. Besagte Waschmaschine soll, so in einem der Briefe, 1936 aus Siegen gekommen sein. Sie wurde durch die Familie Katz von Schenklengsfeld mit nach Palästina genommen.
Vielleicht können Sie mir helfen. Ich suche den Hersteller und von da aus würde ich einen Katalog suchen. Manchmal hat man ja Glück.
Mit freundlichen Grüßen, Marion Welsch
Liebe Frau Welsch, ich bin zwar nicht Herr Lohrum, aber ich erlaube mir, auf Ihre Frage zu antworten: Laut Adressbuch von 1935 gab es in Siegen die Firma Robert Thomas, Flurenwende 7/9, die Waschmaschinen herstellte. Die Firma gibt es auch heute noch und ist im nahe gelegenen Neuenkirchen ansässig. Vielleicht kann man Ihnen dort mit alten Katalogen helfen. Daneben gab es noch diverse Geschäfte für Haus- und Küchengeräte im Stadtgebiet und in den umliegenden Ortschaften. Das entsprechende Adressbuch ist online einsehbar unter: https://dfg-viewer.de/show?tx_dlf%5Bdouble%5D=0&tx_dlf%5Bid%5D=https%3A%2F%2Farchiv.siegen.de%2FBestand%2520774%2FNr.%252017%2Fmets.xml&tx_dlf%5Bpage%5D=22&cHash=18dc2e83e86b7a173d170f658b808a64
Viel Erfolg bei der weiteren Recherche.
Sven Panthöfer
Vielen Dank. Das ging ja schnell!
Pingback: VdA: Solidarität mit unseren Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine | siwiarchiv.de
Pingback: Bibliotheken stehen hinter der Ukraine (Stand: 03.03.2022) – Bibliothekarisch.de
Jetzt auch als PDF!
Pingback: VdA: Solidarität mit unseren Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine – Archivalia
Pingback: Netphen: Schulklassen erstellen Lapbooks über das jüdische Leben | siwiarchiv.de
Der Beitrag „Aus dem Leben eines tatkräftigen Stadtbaurates. Johannes Scheppigvon 1902 bis 1937 auf verantwortungsvollem Osten in Siegen“, Unser Heimatland 1983, S. 65 – 69, enthät auf S. 69 auch Hinweise zu Fissmer:
„….. Nach dem Kriegsende 1919/1920 trat Oberbürgermeister Anton Delius in den Ruhestand. An seiner Stelle zog Herr Alfred Fissmer in die Chefetage des Rathauses ein.
Von dem Verkauf des E[lektrizitäs]-W[erks]. und des Gaswerks hatte ich schon erzählt. Als letztes Objekt gelang es dem neuen Stadtoberhaupt, Das Oberlyzeum an den Mann, d. h. an den preußischen Staat zu bringen, der allerdings den Umbau des Gebäudes verlangte. Diese schöne Aufgabe fiel mir zu.
Größere Schwierigkeiten entstanden Herrn Spiegelberg als Bauleiter und mir als Chef beim Bau des neuen Krankenhauses am Kohlbett, weil selbstverständliche Einrichtungen, im Krankenhausbau unabdingbare Bestandteile, z. B. Doppeltüren in den Zimmern der Privatstationen und anderes mehr als zu teuer, dem branchenfremden Rotstift des Oberbürgermeisters zum Opfer fielen.
Eine weiter schöne, wenn auch kleine Aufgabe war die Umgestaltung des Leimbacher Weihers zum Freibad. Dieses Bauvorhaben wurde vom Magistrat beschlossen und begonnen, als Herr Fissmer in Urlaub war. …..
Gegen Ende meiner Dienstzeit fiel mir noch eine nicht große aber reizvolle Aufgabe zu. Siegen, als wirtschaftlicher Mittelpunkt von Südwestfalen, hatte endlich das ihm zukommende Landgericht erhalten. Da die Stadt die Kosten für den Umbau des als Sitz vorgesehenen Unteren Schlosses tragen musste, und ich die Verhandlungen mit dem Ministerialrat aus Berlin geführt hatte, schlug dieser mich als mit der MAterie vertrauter Bauleiter . ….“
Für das Siegerland sind die Opfer des Zwangsarbeitseinsatzes aus den besetzten Gebieten der Sowjetunion durch Namenslisten gut dokumentiert. Diese Listen hatten die Firmen nach dem NS-Ende für die Flüchtlingsorganisation der UNO zu erstellen. Sie zeigen einen sehr hohen Anteil von Arbeitskräften aus dem Donbass, also den Bergbaugebieten im Osten der Ukraine mit einer Bevölkerung, die sich in hohem Maße nicht als „ukrainisch“, sondern als „russisch“ betrachtet (was damals unwesentlich war, man war die sog. „Nationalitäten“ übergreifend Sowjetbürger. Es wäre in der Sache verfehlt, hier dem ukrainischen Neo-Nationalismus und Neo-Ultranationalismus Folge zu leisten und die nichtüberlebenden Opfer nun nachträglich und aus einer politischen Opportunität heraus zu nationalisieren.
Die Zahl der Toten dürfte, wie auch diese Listen anzeigen, deutlich über dem liegen, was das AMS-Gedenkbuch ausweist. Da ich über Listenkopien verfüge, hatte ich seinerzeit begonnen, sie systematisch für Eintragungen in das Gedenkbuch durchzugehen, kam aber leider nicht weit, weil mir der Schreibzugang zum Gedenkbuch gesperrt wurde. Die Erklärung dafür liegt nicht in vergangenheitspolitischen Kontroversen, sondern in einem formalen Detail. Man konnte sich nicht einigen, ob bei Datumsangaben bei nur einer Tages- oder Monatsangabe zusätzlich eine Null zu setzen war. Das erinnerte mich an bürokratische Praktiken und widersprach dem Duden, ich lehnte das also ab. Allerdings ist schon anzumerken, dass die komplette Übernahme der bekannten Fälle der die Zwangsarbeit nicht Überlebenden die Zahlenrelation zwischen den verschiedenen Opfergruppen erheblich verändern würde, möglicherweise auch was die Hauptgruppen der Betroffenheit angeht.
Pingback: Juliane von Stolberg-Wernigerode (1506 – 1580). Links und Literatur | siwiarchiv.de
Friedrich Menk?!? Ein neuer Stern am Himmel der regionalen Geschichtsschreibung.
Danke für den Korrekturhinweis!
Pingback: Juliane von Stolberg-Wernigerode (1506 – 1580). Links und Literatur | siwiarchiv.de
„Das Volk“ war bis auf ein paar Jahr nach der Machtübergabe keine Wochen-, sondern ein Tageszeitung. Sie hatte ein klares politisches Profil, denn sie war immer das Organ der sog. „Stoecker-Bewegung“, sprich der antisemitischen Christlich-Sozialen innerhalb des deutschnational-konservativen Meinungsspektrums. Das sollte, wie ich meine, durchaus in einem solchen Hinweis einen Platz haben. Dass die Einstellung des Blatts „infolge des Zweiten Weltkriegs“ geschah, ist eine unbelegte Vermutung. Kriegsereignisse waren 1941 an der Heimatfront noch nicht zu konstatieren. Die Gründe liegen im Dunkel. Plausibel wäre, dass Ressourcen eingespart werden konnten, nachdem mit der „Siegener Zeitung“ und der „National-Zeitung“ bereits zwei Blätter mit Nazi-Inhalt im Einvernehmen ihrer beider Verlage im Siegerland existierten und ein drittes Propagandaorgan überflüssig war, zumal viele der vormaligen Leser sich inzwischen in die NS-Organisationen eingegliedert hatte.
Um die Feststellung, dass „Das Volk“ einen aggressiv antisemitischen Kurs vertrat, zu veranschaulichen der Einfachheit halber einige Beispiele aus den Beiträgen des Stammautors Jakob Henrich („Bergfrieder“, Straßennamenstifter). Ich entnahm sie meinem Buch „Mit Scheibenklirren und Johlen“. Juden und Volksgemeinschaft, Siegen 2009, S. 58. Die Belegstellen sind den dortigen Fußnoten zu entnehmen:
„Seine Eltern hätten ihm, klagte er [= Jakob Henrich], einen „verworfenen Namen angehängt“. Der sei der Namensstifter „jener Erzvater der Juden“, der „geschäftelte wie ein Handelsmann“, wie es in der abwertenden Anspielung vom „wahren Jakob“ zum Ausdruck komme. Henrich schrieb als „Bergfrieder“ eine wöchentliche heimatschwärmerische politische Kolumne in Das Volk, nie ohne antisemitische Akzente. Für Henrich war eine Tagung der Nationalsozialisten „vom 15.-17. Ernting d. J.“ 1925 ein Lichtblick, weil sie alkohol- und nikotinfrei abgehalten worden sei. „Denn“ – er zitierte zustimmend die Begründung – „für Ahasver (den ewigen Juden!) sind die Rauch- und Rauschgifte nur Mittel zum Zweck, um die feinsten Nerven und den Willen der Wirtsvölker zu töten und die Betäubung ganz zu fesseln.“ Er ruhte nicht, das „verderbliche Treiben des jüdischen und verjudeten Linksertums“ anzuprangern, wandte sich gegen den Einfluss der „jüdisch vergifteten“ Arbeiterbewegung oder gegen die „Ueberfremdung deutschen Besitzes und deutschen Geistes und Blutes“ – selbstredend vornehmlich durch jüdischen übermächtigen Einfluss.“
Danke für die Präzisierung! Ich hatte lediglich die späteren Jahrgänge aufgerufen. Mir scheint die Geschichte des Blattes durchaus näher betrachtenswert, denn die ersten Jahrgänge erschienen nicht nur als Tageszeitung, sondern auch noch in Berlin. Später übernahm der Hagener Verleger Otto Rippel das Blatt und die Zeitung erschien in Siegen.
Zu Jakob Henrich s. a. https://www.siwiarchiv.de/heute-vor-160-jahren-jakob-henrich-geboren/
Ja, die Zeitung war seit Anbeginn das Zentralorgan dieser „Christlich-Sozialen“, die ja in den von ihnen vertretenen völkischen Inhalten über den Antisemitismus weit hinaus und auch als „Bewegung“, als die sie sich betrachteten, als Vorläufer der NS-Bewegung einzuordnen wären.
Wenig bekannt, aber bemerkenswert: Schon in den 1920er Jahren forderten sie „Konzentrationslager“ für „Ostjuden“. So in „Das Volk“ nachzulesen.
Rippel gehörte nach 1945 übrigens zu den Gründern der CDU.
Ich habe einmal das regionale Personenlexikon nach der Mitgliedschaft Christlich-Sozialen Volksdienst (bzw. EVD) durchsucht. Das Ergebnis lautet: Ernst Bach, Friedrich Barth, Otto Beckmann, Karl Bender, Hermann Böcking, Jakob Böcking, Karl Böcking, Karl Breitenbach, Robert Eliseit, Paul Fay, Wilhelm Fischbach II, Alfred Flender, Robert Flender, Rudolf Flender, Rudolf Flender, Rudolf Gädeke, Walter Heide, Friedrich Wilhelm Heider sen, Jakob Henrich, Alexander Hirschfeld, Oskar Höfer, Karl Hofmann, Otto Klein, Otto Marx, Bernhard Meuser, Albert Münker, Friedrich „Fritz“ Münker, Walter Nehm, Friedrich Ohrndorf, Artur Reiffenrath, Hermann Reuter, Otto Rippel, Friedrich Wilhelm Roth, Ewald Sahm, Heinrich Schäfer, Paul Schmidt, Wilhelm Schütz, (Theodor Siebel), Wilhelm Spies, Theodor „Theo“ Steinbrück, Gustav Strackbein, Albert Vogel, Ernst Weißelberg. Lehrer Fabrikanten, Geistliche, Verwaltungsbeamte, Medienvertreter, …. – eine interessante Gruppe. Daher ist die Online-Verfügbarkeit der Zeitung „Das Volk“ so wichtig.
Die Soldarität wird zwangsläufig an ihre Grenzen stoßen. Das ist auch die Meinung führender Ministerpräsidenten in der BRD. Wo nichts mehr ist, kann auch nichts mehr verteilt werden. Verdoppelung des Militärhaushaltes? Wo soll das Geld herkommen? Flüchtlingshilfe? Woher soll der Wohnraum kommen? Woher die Hartz-IV-Hilfen? Teuerung? Benzin? Senkung der Wohnkosten für Arme? All das sind Faktoren, die indirekt die Archive treffen werden. Denn überall schwebt das Damklesschwert der steigenden Kosten. Hilfszusagen sind ja recht und schön. Wie wollen deutsche Archivare und Archivarinnen aber konkret helfen, wenn die eigenen Mittel schwinden? Schon mal auf die Zapfsäulen geblickt? Auch Archive müssen heizen, auch archive benutzen Transportwagen, auch Archive müssen Gebäudestrukturen erhalten.
Keiner hat je behauptet, dass Solidarität zum Nulltarif erfolgt. Solidarität heißt immer sich einzuschränken, um den anderen zu helfen. Wie können Archive helfen ? Z. B. Raum zur Verfügung stellen, falls Archivgut geflüchtet wird, Lieferung von Restaurierungsmaterial, Notfallboxen etc. ….. oder so s. https://www.sucho.org/.
Zudem sind die Wünsche der ukrainischen Kolleg:innen an die Archive andere: Ausschluss der russischen Verttreter:innen aus den Gremien des Internationalen Archivrates (ICA), worüber übrigens heute entschieden werden soll, sowie Unterstützung des Wunsches der Ukraine zum Beitritt in die EU.
Letztlich schlägt die große Stunde archivischer Solidarität wohl erst im Friedensfall, wenn es sich um die Wiederherstellung zerstörter Archive handelt – da haben wir ja in Deutschland inzwischen traurigerweise genug Expertise (Flutkatastrophen an Elbe und Ahr, Stadtarchiv Köln). Allerdings ist m. W. halbwegs verlässlich erst ein Archiv in Charkiv betroffen. Ein weitere Archivzerstörung (Chernihiv) konnte noch nicht bestätitgt werden – https://archaeologik.blogspot.com/2022/03/propagandakrieg-im-kleinen-die.html .
Vermutlich Spam:
[Träumereien. Bei den steigenden Preisen wird in Zukunft jedes Archiv froh sein, wenn es den nötigsten Service zur Verfügung stellen kann. Ich bin ganz klar gegen jede Hilfe. 2035 wird der große Schnitt kommen. Dann gehen die geburtenstarken 68er Jahrgänge in Rente. D.h. dass alle öffentlichen Ausgaben wesentlich erhöht werden müssen, da signifikant weniger produktive Steuerzahler zur Verfügung stehen. Mit anderen Worten: Jede Hilfe, die man jetzt gewährt, wird später fehlen, Massenarmut zu bekämpfen. Für Archive wird nicht mehr viel Geld da sein. Das sind keine Schauermärchen, sondern knallharte Kallkulationen, die überaus realistisch sind. Es ist in diesem Staat nur auf wenig Ebenen wirklich vorgesorgt worden. Deutsche Archive werden sich in Zukunft selbst beim Klopapier einschränken müssen. Die derzeitige ökonomische Lage ist absolut bedenklich und keineswegs Resultat der Coronakrise und des Ukrainekonflikts. Sie liegt in Fehlentscheidungen der EZB-Notenbank begründet. Bitte: Man kann das komisches Geschwurbel abtun, doch sollte man stets bedenken, dass die derzeitigen Preissteigerungen schon jetzt extrem gravierende Folgen für viele Lebensbereiche haben. Heizöl: Plus 76,5 Prozent, Benzin: Plus 28,4 Prozent. Diese Preise werden weitergegeben. Ich glaube nicht, dass man sich auf Dauer „einschränken“ kann. Hier wird über Luxusprobleme gesprochen. Wie begegnen die Archive dem Problem der Inflation? Mir stehen die Haare zu Berge, wenn ich sehe, was für ökonomische Fehlentscheidungen in diesem Land getroffen werden!]Pingback: siwiarchiv-Statistik: 27.2. – 12.3.2022 | siwiarchiv.de
Pingback: Industriemuseum im Kreis Siegen-Wittgenstein? | siwiarchiv.de
Suche für ein Ahnenforschungsprojekt nähere Angaben über einen Emil Pfeil, geboren am 4. März 1886 in Langenau/Buschhütten, soll in Marburg aufgewachsen sein (keine Meldedaten vorhanden) und migrierte 1912 in die USA
Sehr geehrter Herr Pfeil, ich gehe davon aus, dass sich wegen des Geburtsortes bereits an das zuständige Stadtarchiv Kreuztal gewendet haben. Vielleicht ist dort auch der Wegzug nach Marburg in Melderegistern nachweisbar. Wegen Emigration in die USA, kann vielleicht das zuständige Staatsarchiv in Marburg weiterhelfen.
Pingback: Lesung: „Schulmeister Wilhelm Kühn in Dreisbach | siwiarchiv.de
Herr Heinz Pfeil ist, wie aus seiner Anfrage geschlossen werden kann, ein Freund knapper Worte. Das ist grundsätzlich lobenswert, obwohl es sich in manchen Fällen (nämlich wenn man etwas von jemandem will) mit den Geboten der Höflichkeit schwer vereinbaren lässt.
Ein Zeitungsartikel von Heinz Pfeil (https://www.myheimat.de/marburg/kultur/wer-hat-meine-kindheit-gestohlen-d3149159.html) enthüllt den Umfang seiner bisherigen erfolgreichen Recherchen. Es wäre rücksichtsvoll gegenüber den Empfängern dieser Anfrage gewesen, darauf hinzuweisen, was bereits bekannt ist (z.B. die auf https://mineralien.lima-city.de/familiengruppe/f202.htm gezeigte Kreuztaler Geburtsurkunde oder die auf https://www.alaskahistory.org/biographies/pfeil-emil-h zu findende recht ausführliche Biographie Emil Pfeils und seiner Ehefrau Muriel) und welches konkrete Zeitfenster (nämlich zwischen dem Umzug nach Marburg und der Auswanderung) überhaupt nur noch von Interesse ist. Unser Kreisarchivar hätte heute morgen um 6:55 Uhr sicher Sinnvolleres mit seiner Zeit anfangen können, als sich Gedanken über eine so wenig ernstzunehmende Anfrage zu machen.
Pingback: Anstelle der “Aktuellen Stunde”: News zum 73. Westfälischen Archivtag – archivamtblog
Pingback: Wikipedia-Artikel zu Augsut Jost (1811 – 1866) | siwiarchiv.de
Heute erschien in der Siegener Zeitung folgender Artikel zum Verlauf der Kreiskulturausschusssitzung:
„Industriegeschichte europaweit bedeutend
Das Nein aus Münster war eindeutig: Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe wird kein eigenes Industriemuseum im Kreis Siegen-Wittgenstein einrichten. Im Kreiskulturausschuss stieß die Ablehnung vor allem bei der FDP-Fraktion, die die Idee eines solchen Museums auf den Tisch gebracht hatte, auf wenig Begeisterung.
FDP-Sprecher Guido Müller fand die Haltung des LWL „beschämend“ und wunderte sich über die „Entspanntheit“, mit der sowohl Ausschussvorsitzender Hermann Josef Droege (CDU) als auch Landrat Andreas Müller (SPD) auf die Ablehnung reagierten.
Guido Müller fand, dass man beim LWL die Bedeutung Siegen-Wittgensteins für die Industriegeschichte ganz Europas nicht verstanden habe. Die Röstöfen der Grube Storch &Schöneberg in Gosenbach, die vom LWL als ein bedeutendes Zeugnis angesehen wurden, „sind weder attraktiv für Besucher noch werden wir jemals Gelegeneheit haben, auf diesem Grundstück etwas einzurichten“, schimpfte der Liberale.
Der Landrat sah sich nicht als Adressat für die Schelte: „Das muss man in der Landschaftsversammlung formulieren.“. Hermann Josef Droege blieb entspannt: „Das kann man alles bedauern, aber man muss sich fragen, ob man sich weiter verkämpfen will.“ Droege plädierte dafür, die Idee eines virtuellen Museums zu verfolgen.“
Pingback: Otto Rippel (1878-1957) | siwiarchiv.de
Pingback: Radiotipp: Zeitzeichen (WDR) – 8. Oktober 1821 – Der Geburtstag des Komponisten Friedrich Kiel | siwiarchiv.de
Pingback: Bad Berleburg: Gedenken der Opfer des Nationalsozialismus durch die Benennung der Odebornbrücke zwischen Poststraße und Ludwigsburgstraße | siwiarchiv.de
Pingback: Bad Berleburg: Gedenken der Opfer des Nationalsozialismus durch die Benennung der Odebornbrücke zwischen Poststraße und Ludwigsburgstraße | siwiarchiv.de
Den u.a. Kommentar hatte ich bereits am 5.5.2021 der FDP- Kreistagsfraktion, Siegen-Wittgenstein auf ihrer facebook-Seite übermittelt, er blieb aber bisher recht gut versteckt unkommentiert.
Zum Bunkerprojekt bleibt noch nachträglich anzumerken, dass bei der „derzeitigen Krisenlage“ (Zeitwende !) die Vernichtung von „Schutzräumen“ doch recht unverantwortlich erscheinen.
hier mein fb-Kommentar vom 5.5.´21 zur FDP-Aktivität:
Die Betrebungen der FDP-Kreistagsfraktion sind ja recht anerkennenswert, jedoch stellt sich hier die Frage, warum die „Polit-Aktivisten“ sich bisher denn niemals um dieses schon jahrzehntealte Thema gekümmert haben. Ist denn niemandem bisher aufgefallen, dass es keinen authentisch historischen Ort innerhalb des Siegerlandes mehr gibt, wo noch irgendein Original Zeugnis der alten Montan-Industriekultur erhalten geblieben ist. Einen geeigneten verkehrsgünstigen historischen Ort für den erforderlichen Neubau, oder Ausbau eines Siegerländer-Industriemuseums kann man vielleicht ja u.U. noch finden (s.a. div. Vorschläge i.d. Literatur), aber man wird vom LWL oder der NRW-Landesregierung sicher keinerlei finanzielle Unterstützung erwarten können, wenn sich nicht zuvor die Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein mit der Stadt Siegen einig wird, um gemeinsam einen bestgeeigneten Ort für ein derartiges Industriemuseum als Außenstelle des Siegerlandmuseums im Siegerland (und nicht ausschließlich in der Stadt Siegen) zu finden.
Die latenezeitlichen Ausgrabungen in Niederschelden- Gerhardseifen liegen aber dafür wohl verkehrsmäßig etwas zu ungünstig.
Die Bestrebungen der Stadt Siegen den Burgstraßenbunker für eine Erweiterung des Siegerlandmuseums (Abt. Siegerländer Montan-Industriekultur) für über 16 Mio Euro mit Landes-Steuermitteln erst einmal publikumsbegehbar zu machen, ohne auch nur einen einzigen historischen örtlichen Bezug zum Thema und auch nebenbei ohne die erforderlich günstige Verkehrserschließung für Massenbesucher, die ein solches Museum bieten muss, sollte doch zumindest Herrn Landrat Müller und eigentlich auch der FDP-Kreitagsfraktion bekannt sein.
s.a. auch unter :
http://www.siwiarchiv.de/siegen-foerderverein-sammelte-2…/
( und den siwiarchiv-Eintrag vom 12.4.2016 )
Es wäre eigentlich recht schade, wenn sich diese begrüßenswerte Aktivität mehr oder weniger nur als eine Wahl-Werbung der Kreistags-FDP herausstellen sollte.
Hallo Herr Dick, habe Ihre Anfrage gerade durch Zufall erhalten. Gerne nehme ich dazu Stellung. Würde morgen, wenn ich wieder Zugriff auf einen Laptop statt Handy habe eine Antwort geben.
Pingback: Friedrich Kiel: Jubiläumsband zum 200. Geburtstag | siwiarchiv.de
Pingback: Friedrich Kiel: Jubiläumsband zum 200. Geburtstag | siwiarchiv.de
Pingback: Bibliotheken stehen hinter der Ukraine (Stand: 22.03.2022) – Bibliothekarisch.de
Pingback: Bibliotheken stehen hinter der Ukraine (Stand: 22.03.2022) – Bibliothekarisch.de
Pingback: Bibliotheken stehen hinter der Ukraine (Stand: 22.03.2022) – Bibliothekarisch.de
Pingback: Bibliotheken stehen hinter der Ukraine (Stand: 22.03.2022) – Bibliothekarisch.de
Literatur zur Zwangsarbeit im Altkreis Wittgenstein:
– Achinger, Gerda Kyrillische Texte auf einer Wand der ehemaligen Arrestzelle in Arfeld, Wittgenstein, Jg. 65 (2001), Bd. 89, Heft 2, S. 51-55
– Achinger, Gerda Eine „Sonderbehandlung“ bei Arfeld. Die Hinrichtung des polnischen Zivilarbeiters Jan Zybóra, Wittgenstein, Jg. 98 (2010), Bd. 74, Heft 2, S. 45-68
– Dickel, Lars-Peter Zwangsarbeit im Landkreis Wittgenstein 1940 bis 1945
Gießen 2004, 220 Seiten, Magisterarbeit
– Kohlberger, Zwangsarbeiter in Niederlaasphe
Hans-Armin,Dorfbuch Niederlaasphe 1307-2007. Niederlaasphe 2007, S. 127-128
– Lange, Karl-Otto Kindheitserinnerungen, In: Begegnungen mit ehemaligen Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen im Wittgenstein. Dokumentation eines Projektes, (Hgg.) Arbeitskreis für Toleranz und Zivilcourage Bad Berleburg, Eitorf 2010, Seiten 57-60
– Prange, Hartmut Kriegsgräber russischer und polnischer Zwangsarbeiter auf dem Friedhof „Am Sengelsberg“ in Bad Berleburg, Wittgenstein, Jg. 95 (2007), Bd. 71, Heft 3, S. 88-96
– Prange, Hartmut Zwangsarbeiter bei der Fürstlichen Verwaltung in Berleburg
Wittgenstein, Jg. 98 (2010), Bd. 74, Heft 4, S. 142-150
– Schneider, Peter Im 20. Jahrhundert, Die wackere Gemeinde Schameder, Schmallenberg 2020, S. 282-295
[1. Weltkrieg, Spanische Grippe, Nationalsozialismus, Flugtag,
Flugplatz, 2. Weltkrieg, Zwangsarbeiter
So, am PC lässt sich doch komfortabler schreiben. Sie haben recht, Herr Dick, dass viele bauliche Zeitzeugen nicht mehr existieren. Die verfallenen Gruben wurde aus Bequemlichkeit und Sicherheit in den 70er und 80er Jahren einfach abgetragen. Ich selbst war als Kind im Leimbaahtal unterwegs und sowohl die Arbeitersiedlung als auch die Grube Ameise waren für uns Abenteuerspielplätze und gerne zu erwandernde Ziele. Schaut man heute in Orte wie Gosenbach, glaubt man kaum, dass hier mal einst eine der größten Gruben Deutschlands stand. Die Kritik der FDP an den LWL richtet sich auch darauf. Der LWL hat nicht erkannt, dass hier im Siegerland das industrielle Herz Europas (und damit der alten Welt) geschlagen hat und in einigen Bereichen noch immer noch schlägt. Ich bin Prof. Schawacht, ehemaliger Museumsdirektor im Siegerland Museum, sehr dankbar für die vor allem von ihm initiierte Ausstellung zur Wirtschaftsgeschichte im Oberen Schloss. Seit den 90er Jahren ist die aber nicht einmal neu angepackt worden. Und ich stimme Ihnen Herr Dick zu, dass eigentlich an echten historischen Orten diese Geschichte erlebbar gemacht werden muss. Deshalb will sich der Kulturausschuss des Kreises jetzt dem Thema virtuell nähern. Ich hoffe, dass die bestehenden Ziele (Altenberg, Gerhardseifen etc.) dabei live erfahren werden können. Ich würde darüber hinaus gerne die Geschichte entlang der Eisenstraße historisch erlebbar machen. Der Kreis wird eine Arbeitsgruppe einrichten, der ich mich als studierter Historiker gerne anschließen werden. Ob Stadt und Kreis an einem Strang ziehen werden? Keine Ahnung, das bleibt abzuwarten. Aber eine „Plattenausstellung“ in einem Museumssaal wird dem Thema alleine sicher nicht gerecht.
Pingback: Karl von Thielen (1832 – 1906) – ein weiterer kommissarischer Wittgensteiner Landrat | siwiarchiv.de
Der damals 29-jährige Regierungsassessor und „Landrathsamtsverweser“ Karl Thielen war nicht nur dienstlich in Berleburg. Sein Eintrag im Heiratsregister der ev. Stadtkirche weist auf sein Aufgebot und die Heirat am 24. September 1861 am Dienstort seines Schwiegervaters in Arnsberg hin. Zudem wurde Thielens erstes Kind, die Tochter Emma, 1862 in Berleburg geboren.
Pingback: Umbenennung des Bernhard-Weiss-Saales durch die IHK Siegen | siwiarchiv.de
Die Rolle der SIEMAG und die von Bernhard Weiss wird im folgenden Buch beleuchtet, es geht sogar auf die Zeit davor ein, einschließlich des 1. Weltkrieges:
Heimat-Fremde. „Ausländereinsatz“ im Siegerland 1939-1945, wie er ablief und was ihm vorausging Opfermann, Ulrich – 1991
Danke für die Ergänzung!
Bernhard Weiss war ja auch mit dem Thema „Ukraine“ gut vertraut. Er steht für das Interesse der deutschen Wirtschaft am zu erobernden Raum im Osten. In Teil 1 seiner Zeit als Führer der SIEMAG, also vor seinem Nürnberger Verfahren als Menschheits- und Kriegsverbrecher, gelang es ihm, in Dnjpropetowsk ein großes Unternehmen der Schwerindustrie für seine Familie an Land zu ziehen. Verlor es aber alsbald wieder. Die Rote Armee machte den Weiss einen Strich durch die Rechnung. Wie gewonnen, so damals zerronnen.
(eine Facette von Zwangsarbeit – die SIEMAG setzte zahlreich hier wie dort die so schön billigen ukrainischen und russischen Zwangsarbeiter*innen ein – daher in meinem Buch zum Thema nachzulesen)
Danke für die Ergänzung!
Ich hab ihr Buch gelesen, es ist im Stadtarchiv von Siegen verfügbar. Es waren auch Fakten aus ihrem Buch, die ich der IHK vorgetragen habe. Im Rat der Stadt Hilchenbach ist man hingegen noch nicht so weit, sich zu einer Namenänderung vom Bernhard Weiss Platz und Straße im Stadtteil Dahlbruch durchzuringen. Nachgewiesen sind auch verhungerte Kinder im Lager der Siemag Eiserfeld. Herr Opfermann könnte Sie mir bitte eine Email schreiben. Ich hätte da noch ein paar Fragen: ch.kiendl@gmx.de
Hallo Herr Opfermann, gibt es eine Möglichkeit Sie zu kontaktieren? Sonst bitte eine Email
ch. kiendl@gmx.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 13.3. – 25.3.2022 | siwiarchiv.de
Hi,
My name is Oranit Hager. Herbert Prager was my grandfather. Max Prager was his father. We would like to renew the contract between the family and Bad Lassphe.
Thank you,
Oranit
שלום אורנית
שמי נורית הבת של שמעון בורג קרוב משפחה של הרברט פרגר אשמח שתצרי איתי קשר
Wenn ich es richtig sehe erschien heute der este Leserbrief „Totalitär“ – als solches wird die Umbenennung charakterisiert – in der Siegener Zeitung zum Thema.
Link zum Bericht der Westfalenpost Wittgenstein vom 30.3.2022 über die Beratung in der Stadtverordnetenversammlung: https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/bad-berleburg-bekommt-einen-neuen-ort-der-erinnerung-id234946325.html
Heute erschienen zwei weitere, die Umbenennung ablehnende Leserbriefe in der Siegener Zeitung: „Wer will sich profilieren?“ und „Wichtiger Arbeitgeber“
Zu Bernhard Weiss s. a.
– Kim Christian Priemel: Flick. Eine Konzerngeschichte vom Kaiserreich bis zur Bundesrepublik, Göttingen 2007
– Norbert Frei/Ralf Ahrens/Jürgen Osterloh/Tim Schantzky: Flick. Der Konzern, die Famile, die Macht, München 2009
– Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Siegerland (Hrsg.): Konrag Kaletsch, der Flick-Konzern und das Siegerland, Siegen 1987
Pingback: Paukenschlag bei der Diskussion um Straßenumbenennungen in Siegen: | siwiarchiv.de
Pingback: Paukenschlag bei der Diskussion um Straßenumbenennungen in Siegen: | siwiarchiv.de
Herr Wolf vergaß zu erwähnen (oder musste er sich hierbei zum Stillschweigen verpflichten?), dass nicht nur die Umbenennung der FJM-Straße (sowie selbstverständlich auch des Gymnasiums) erfolgen wird, sondern gleichzeitig die Entfernung des „Krönchens“ von der Nikolaikirche. Dieses war bekanntlich ein Geschenk des bösen Fürsten an die Stadt Siegen gewesen, dessen öffentliche Zurschaustellung längst nicht mehr politisch korrekt ist.
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik März 2022 | siwiarchiv.de
Pingback: Entdecktes zum 01. April 2022 – Bibliothekarisch.de
Ein toller Aprilscherz! Mein Kompliment! Bei mir hat er funktioniert!
Danke für das Lob!
Pingback: Düsseldorfer Erklärung zur Zukunft des Denkmalschutzes in NRW 4. April 2022 – Archivalia
Heute erschienen 3 weitere Leserbriefe in der Siegener Zeitung, die sich kritisch zur Umbenennung äußern: „Säuberungsagenda“, „Unfassbare Aktion“ und „Eindeutig belogen“.
Reaktionen:
1) Radiobeitrag “ Neues Denkmalschutzgesetz – und jetzt?“, WDR 3 Mosaik. 07.04.2022. 05:37 Min: “ „Das Denkmal ist zu schützen“ hieß es 42 Jahre lang einleitend im Denkmalschutzgesetz von NRW. Jetzt steht da, es sei zu „nutzen“. Steffen Skudelny von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz beklagt ein rücksichtsloses Durchdrücken des Gesetzes und will retten, was zu retten ist.“
2) Novellierung Denkmalschutzgesetz NRW: Ministerin Ina Scharrenbach (CDU) mit der Brechstange gegen allen Fachverstand via Archivalia v. 6.4.2022
Ein Fund zum Thema im Bundesarchiv Berlin:
R 3001 Reichsjustizministerium/22124, Realgemeinden und gemeinschaftliche Nutzungsrechte, 1936.
Enthält : „Altsohlstättenrecht und Deuzer Konvention“. Ein Beitrag zur ungeschriebenen Geschichte des Sohlstättenrechts im Siegerland von H. J. Schäfer, Weidenau, 1936
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 26.3. – 7.4.2022 | siwiarchiv.de
Pingback: NRW: Neues Denkmalschutzgesetz gegen alle Widerstände verabschiedet – Archivalia
Nach dem Erscheinen der Broschüre „Kanonen und Kuhmchel“ wandte sich Julius Kuhmichel, der Sohn Hermann Kuhmichels, am 28.10.1985 an die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Siegerland. Der Brief enthält u.a. eine von Julius Kuhmichel erstellte Chronik der Jahre 1930 bis 1956, für diese hatte er Tagebuch(!)aufzeichnungen und Zeitzeugenberichte verwendet. Mit dieser Zusammenstellung wollte er die deutliche Kritik an Kuhmichels Wirken während der NS-Zeit entkräften. Das Schreiben befindet sich mittlerweile im Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein unter der Signatur 3.19. (Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Siegerland) Nr. 76 . Sie enthält auch folgenden hier interessanten Passus (S. 3-4): “
…. Mitte 1935: Ein Dr. Hinrichs (oder Heinrichs) erwirkte den Beschluss der Reichskulturkammer, das künslerische Werk von H[ermann] K[uhmichel] mit dem Verdikt „entartete Kunst“ zu belegen und ihm Ausstellungs- und Schaffensverbot zu erteilen. In der Begründung, anlässlich des Spruchkammer-Verfahrens 1948 verlesen, hieß es u.a. „verherrlicht in seinen Werke Kulte des Weltjudentumsund vernachlässigt trotz nachdrücklicher Einlassungen örtlicher Parteimitglieder seine Pflicht, „all sein Können in die Verewigung des arischen Menschen zu stellen.“ Sein des NS-Anstoßes waren Plastiken und Holzschnitte, die H[ermann] K[uhmichel] in den Schaufenstern Siegener Geschäftsleute ausgestellt hatte. Daruntern waren die zwischen 1928 und 1935 entstandenen Skulpturen „Loths Weib“, „Opferung Isaaks“, „Kain und Abel“, „Moses und die Zehn Gebote“, „Die Leiden des Hiobs“ und „Der Pharisäer“. Der Kulturkammer-Beschluss konnte aufgehoben werden dank der Fürsprache von Männern, in deren Besitz sich gerade solche verfemten Kunstwerke befanden: Oberbürgermeister Fissmer, NSKK-Führer Johannes Helmer, Arbeiter-Dichter Heinrich Lersch und der von Göring so geschätzte, halbjüdische Geigen-Virtuose Professor Beinhauer – sie allehatte bei H[ermann] K[uhmichel] „entartete Kunst“ erworben resp. sich schenken lassen.
OB Fissmer, beraten von General Hollidt, ließ H[ermann] K[uhmichel] wissen, die Aufhebung des Kulturkammer-Beschlusses sei das Ergebnis eines Kompromisses: H[ermann] K[uhmichel] verzichtet darauf, Kunstwerke anzufertigen und auszustellen, die das Weltjudentum verherrlichen, und beteiligt sich fortan an der künstlerischen Ausgestalttung öffentlicher Bauten. ….“
Unbedingt beachtenswert ist der Kommentar Dr. Opfermanns in der öffentlichen Facebook-Gruppe „Nachdenken über Alfred Fissmer“: https://www.facebook.com/groups/372599270383625/posts/818758292434385?comment_id=820655142244700¬if_id=1649602161305670¬if_t=group_comment&ref=notif
Beispiel: Hüttenmeisterhaus in Kreuztal Kredenbach-Lohe.
Die Kommune Kreuztal / Untere Denkmalbehörde lehnt es bis heute strikt ab, in diesem speziellen Fall ein zulässiges Enteignungsverfahren nach §30 DSch NRW einzuleiten, weil man dann die rel. hohen Renovierungs- und späteren Erhaltungskosten nicht tragen möchte. Eine erstrebenswerte soziale, allgemeinwohlfördernde Nutzung des renovierten Gebäudes wurde leider bisher von den dort politisch Verantwortlichen nicht gefunden.
Der priv. Eigentümer kann aber das bereits über 300 Jahre alte , ortsteilbestimmende Fachwerkgebäude keinem wirtschaftlichen Nutzen zuführen, weil sich das einfach bei den hohen Renovierungskosten, trotz evtl. zu erwartenden Landes-Zuschüsse , einfach nicht rechnet . Und wenn der Eigentümer es nicht freiwillig der Kommune übereignen möchte, (gesetzlich wäre die Kommune dann zur Übernahme aber gezwungen !) ist der weitere Verfall des denkmalgeschützten Fachwerkhauses unausweichlich vorgegeben.
Wenn hier aber in der Novelle des DSchG NRW für derartige speziellen Fälle, keine entsprechenden gesetzlichen Vorgaben gemacht werden, die der Unteren Denkmalbehörde eine zwingend gebotenen Übernahme in kommunaler Hand vorgibt, bleibt das DSchG NRW auch weiterhin nur ein „papierner Tiger“ .
(die zu erwartenden Renovierungskosten aus Steuermitteln müssen den evtl. geforderten priv. Entschädigungsforderungen gegengerechnet werden. Der Kommune werden max. 10 Jahre für die Renovierung des Denkmals zugebilligt)
Den nachfolgenden Generationen bleibt ja immerhin im Falle z.B. des Kredenbacher Hüttenmeisterhauses, nach Abriß oder völligen Verfall des Denkmals, die helle Freude an einer Hallenblechwand oder einem erweiterten Parkplatz. (s.a. Fotos)


Ob die dann dafür auch Verständnis aufbringen werden ?
Das wäre ja aber auch nicht der erste Fall , wo man sich dann leider viel zu spät über die Vernichtung Siegerländer Kulturgutes aufregt.
Wilhelm Scheiner (* 2. Juli 1852 in Siegen; † 6. November 1922 in Köln-Deutz) war ein deutscher Kunstmaler und Fotograf.
Danke für den Lösungsversuch, der uns an den 100. Todestags von Wilherlm Scheiner erinnert hat ! Es ist nicht Scheiner, der ausweichlich seines Wikipedia-Eintrags weder Lehrer noch Schriftstler bzw. Journalist war.
Ich tippe auf Luise Koppen aus Berleburg!
Der Tipp sieht es gut aus.
Der Tipp sieht nicht nur gut aus, er ist vollkommen richtig – Gratulation! Was hat denn Luise Koppen verraten?
Erste Informationenzu Koppen enthalten der Wikipedia-Eintrag, das Lexikon Westfälischer Autorinnen und Autoren und das Biogramm im Portal „Westfälische Geschichte“. Die Lippische Landesbibliothek hat einige Werke Koppens online verfügbar gemacht.
Wie ich darauf kam, ist eine etwas längere Geschichte, die mit Klimamodellen (Köppen und Geiger) und einer gescheiterten Buchrecherche während des Studiums zu tun hat:)
Pingback: ARCHIVAR 2022/1 ist nicht online – Archivalia
In der Ausgabe des „Heimatlandes“ der Siegener Zeitung vom 19. März 2022 legt Herbert Bäumer einen ersten Artikel zur Geschichte des Truppenübungsplatzes in Siegen-Trupbach vor.
“ …. Aber bei der Herrichtung hakte es. Es ging nicht schnell genug. Statt der vereinbarten 400 Mann waren nur 180 Mann im Einsatz. Oberbürgermeister Fissmer wurde am 21. April 1935 in einem Schreiben an die Arbeitsgauleitung Westfalen-Süd (Dortmund) deutlich: „In den letzten Wochen waren ca. 180 Mann mit 15 Rodeböcken beschäftigt. Wenn nicht in allernächster Zeit Mannschaft und Rodeböcke erheblich vermehrt werden, ist die Fertigstellung der Arbeiten zu den vorgeschriebenen Terminen (1. Oktober 1935 und 1. April 1936) unmöglich.“ Es musste schnell gehen, denn die ersten Soldaten sollten, wie oben geschrieben, bereits am 16. Oktober 1935 eintreffen!
Fissmer fährt fort „Es unterliegt keinem Zweifel, dass Ihnen und uns die größten Schwierigkeiten entstehen werden, wenn die Truppe hier ohne oder mit ungenügendem Übungsplatz zur Ausbildung der Mannschaft schreiten muss. Wie schwer das im vaterländischen Interesse zu verurteilen wär, brauche ich Ihnen nicht hervorzuheben, sehren wir doch im Arbeitsdienst eine Vorschule der Wehrmacht.“
Das fruchtete. …..
Noch bevor die Wehrmacht den Truppenübungsplatzin Besitz nahm, meldete sich Oberbürgermeister Fissmer am 5. Februar 1936 mit einem Schreiben bei Amtsbürgermeister Hirschfeld (Amt Weidenau) zu Wort. …. Er habe,so Fissmer, sich zunächst für eine Anpachtung der Flächen eingesetzt, sei aber damit gescheitert. Fissmer erteilt dann seinem „Sehr geehrten Herrn Kollegen“ Ratschläge. Es müsse, so schreibt er, „Aufgabe der maßgebenden Stellen sein, dafür zu sorgen, dass sich das Geld, welches sich über Trupbach ergießt, auch für die Zukunft gewinnbringend angelegt wird.“ Einsetzen wollte er sich, so der OB, dass die Trupacher in erster Linie die Weidegerechtsame (Weiderecht) für den großen Truppenübungsplatz erhalten. Allerdings, so rät er, nur für Ziegen und Schafe, da er von einem Sachverständigen erfahren habe, dass „wegen der Geringfügigkeit des Bodens“ eine Kuhhaltung nicht in Frage käme.
Seine Sorgen um die Nebenerwerbslandwirte, die ihren Betrieb auf Grund des Verlustes einstellen würden, münden in den Vorschlag, diese sollten „das Geld für den Ausbau der Scheunen zu Wohnungen verwenden. Damit würde bestimmt der hier in Siegen und im Siegerland herrschenden großen Wohnungsnot eine Rente für ewige Zeiten aus dem vergrößerten Hausbesitz gesichert sein.“ Die Sachverständigen seien sich einig, so führt er aus, „…. dass der Hauberg in Trupbach einer der schlechtesten im ganzen Siegerland und Sauerland ist. Fissmer schließt den Brief mit einer Hoffnung: „Wenn heute das Geld in Trupbach vernünftig angelegt wird, wenn heute endlich die Trupbacher sich ihrer bevorzugten Stellung als Vorort und Ausflugsgemeinde der Stadt Siegen bewusst werden und sich entsprechend umstellen, wird ihre Lage schlagartig sich bessern.“ Ein Antwort von Amtsbürgermeister Hirschfeld war nicht zu finden. ….
Enteignung ging weiter ….
Überaus bemerkenswert: Am 27. Januar 1937 schaltet sich Fismmer ein. Er schreibt in einem Brief an die Rechtsanwälte, dass in Wahlbach (Nationalzeitung 18. Januar 1937) bei einem freiwilligen Landverkauf Preise gezahlt worden seien, „die ganz wesentlich untern den von den Sachverständigen für Trupbach vorgeschlagenen Entschädigungen liegen.“ Dort seien, so schreibt Fissmer, je nach Lage nur 1 bis 3,70 RM pro Ruten gezahlt worden. ….“
Möglicherweise war Fissmer anfangs, als er das Militär nach Siegen lockte, nicht bewußt, wie groß der Flächenbedarf für dessen Übungsplatz sein würde. Die Stadt Siegen war damit überfordert. Fissmer löste das Problem, indem er der Wehrmacht kurzerhand ein Gelände jenseits der Stadtgrenzen, also außerhalb seines Zuständigkeitsbereiches als OB, anbot. Dieses erstreckte sich über Gebiet der Ämter Weidenau (Trupbach, Birlenbach, Langenholdinghausen) und Freudenberg (Alchen, Niederholzklau). Zu irgendwelchen vorherigen Absprachen darüber mit den betroffenen Kreisangehörigen (Landrat, Amtsbürgermeister, Gemeindevorsteher) sah er sich nicht veranlasst. Nachträglichen Widerstand brauchte er dann als von der Wehrmacht offiziell eingesetzter Bevollmächtigter für den Ausbau des Militärstandortes nicht zu befürchten. Diese Machtposition legitimierte ihn auch, stellvertretend für die Wehrmacht das Enteignungsverfahren gegen die Trupbacher Haubergsbesitzer (es waren knapp 100) einzuleiten. Diese waren ihm schon seit etlichen Jahren ein Dorn im Auge, weil sie sich seinen anscheinend sehr penetranten Bemühungen, ihre Haubergsflächen als Bauland dem Siegener Stadtgebiet zuzuschlagen, so hartnäckig widersetzt hatten.
Danke für diese Ergänzungen!
Ich tippe hier auf Carl Jung-Dörfler.
Danke für den Lösungsversuch! Aber Carl Jung-Dörfler ist es nicht.
Paul Dresler, Keramiker 1879-1950
?
Es sollte eigentlich ein Emoji mit einem Daumen nach oben zeigen, aber irgendwie werden sollte Zeichen von der Kommentarfunktion nicht korrekt ausgegeben.
Gratulation! Die Antwort ist richtig, was hat Paul Dresler verraten?
vor 10-12 Jahren besuchte ich eine Ausstellung im Keramikmuseum Berlin: Paul Dresler/Töpferei Grootenburg … zusätzliche Info brachte dann der Siegerländer Heimatkalender 1951 und das Deutsche Geschlechterbuch Bd. 139 (2. Siegerl. Band) mit den Stammfolgen Dresler
Danke!
Fotoeindrücke:
Paul Dresler hat 1899 in Siegen sein Abitur bestanden (siehe hierzu: Dr. Hans Kruse: 1536 – 1936 Geschichte des höheren Schulwesens in Siegen – Festschrift zum 400jährigen Jubiläum des Realgymnasiums in Siegen, hier: Schülerverzeichnisse von 1580 – 1936, S. 71, Siegen 1936).
Danke für den Literaturhinweis! Daneben findet sich im Siegerländer Heimatkalender 1951 ein kurzer Nachruf auf Paul Dresler sowie online einige Angaben hier.
Weitere Informationen zu Paul Dresler finden sich hier online:
– https://www.emuseum.ch/people/55181/paul-dresler;jsessionid=7F5B7B0DA328F09D30C16822C31248E9
– Deutsche Kunst und Dekoration 49(1921/22), Seite 114-115, Link: https://doi.org/10.11588/diglit.9142#0134
Pingback: Osterferienrätsel 2022 | siwiarchiv.de
Es könnte sich um Alfred Melsbach handeln, der 1856-1860 das erste Fotoatelier in Siegen betrieb.
Nicht ganz …..
korrigiert: Albrecht Melsbach
Gratulation! Diese Antowrt ist korrekt. Leider ist über Melsbach nur wenig bekannt: Melsbach (PDF).
Karl Münnich hat den Vornamen in seinem Beitrag zu 150 Jahre Photografie im Siegerland mit Alfred angegeben (Zeitschrift Siegerland, Bd. 67 (1990), S. 21-30). So musste ich noch das Intelligenzblatt von beispielsweise 1859 durchsehen, um den korrekten Vornamen Albrecht herauszufinden.
nur vier ??? nach der Geschäftsgründung …
bitte den Hinweis vervollständigen!
s. a. Münnich Karl: 150 Jahre Photografie im Siegerland. Rückblick auf eine Ausstellung im Rathaus der Stadt, in: Siegerland, Bd. 67 (1990), S. 27-28
Könnte es sich um Werner Kleb handeln?
Jetzt bin ich fast ein wenig erleichtert, denn Werner Kleb ist es leider nicht.
Wie kommen Sie auf W
ilhelmerner Kleb? Immerhin scheint er in München ja 1922 promoviert zu haben. Auf jeden Fall hat er dort 1921 studiert.Die Durchsicht der Münchener Matrikel auf Studierende mit Geburtsort Siegen und Studienfach Medizin – davon gab es Ende der 1910er/Anfang der 1920er Jahre nicht viele in München – ließ Werner (hier nicht Wilhelm) Kleb als möglichen Kandidaten erscheinen. Ich habe noch vier weitere mögliche Personen gefunden, aber Hinweise auf spätere Tätigkeiten finde ich bei allen vier Personen nicht. Die Greifswalder Studentenverzeichnisse sind scheinbar nicht online. Alles in Allem: Keine leichte Fragestellung, lieber Herr Wolf.
Danke für die Rückmeldung! Sie haben recht, es ist nicht einfach;. Der von Ihnen beschrittene Weg könnte durchaus zum Ziel führen. Die Greifswalder Studierendenverzeichnisse sind, soweit ich es sehe, nicht online. Die Bestände des Universitätsarchivs Greifswald sind allerdings online recherchierbar.
Können Sie Herrn Panthöfers Voraussetzung wenigstens bestätigen, dass die Studienzeit des Gesuchten in das Zeitfenster „Ende der 1910er/Anfang der 1920er Jahre“ fiel? Da die Volltextsuche in den Greifswalder Verzeichnissen (online verfügbar ab WS 1922/23) nicht funktioniert, wäre hier mit der Durchsicht enormer Zeitaufwand verbunden.
Ich habe doch schon geschrieben, dass der Ansatz erfolgversprechend ist – aber mühsam! Ob es noch einen anderen Ansatz gibt…..
Pingback: Osterferienrätsel 2022 | siwiarchiv.de
Pingback: Vortrag: „Der vergessene Teil des Holocaust ‚Aktion Reinhardt‘ – Erfahrungen einer Gedenkstättenfahrt“ | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 8.4. – 20.4.2022 | siwiarchiv.de
Ich korrigiere mich: Es sind auch Greifswalder Verzeichnisse vor 1922/23 zugänglich (wegen der variablen Titel ist alles ein wenig unübersichtlich). Das hilft aber auch nicht weiter. Und es ist nicht gesund, stundenlang am Bildschirm auf endlose Listen zu starren. Da muss es doch einen eleganteren Weg geben …
Lesen hilft vielleicht und ein bisschen Kreativität
Wenn Herr Wolf solche Rätsel stellt, versuchen wir mal die Schwarm-Intelligenz des Netzes zu nutzen:
In den Münchener Matrikeln habe ich lediglich
Artur Wagner
Hermann Geisecker
Ferdinande Nückel
Karl Bertina
mit Geburtsort Siegen und dem Studienfach Medizin ausfindig machen können. Die schnelle Durchsicht der Greifswalder Matrikeln hat leider keine Treffer ergeben. Ich bin nun erst einmal raus mit dem Versuch zu lösen. Muss ja noch arbeiten und mich um meine Familie kümmern.
Bevor der Schwarm die 4 Namen überprüft werden, sei ein Hinweis gestattet. Bei dieser Methode kommt es auf den Untersuchungszeitraum an. Noch einmal: alle Hinweise können weiterhelfen.
Auf den „Untersuchungszeitraum“ zielte meine abgeschmetterte Frage. Allmählich macht dieses Rätsel keinen Spaß mehr. Sorry. Habe jetzt zu viele Stunden meines Lebens damit verschwendet :-(
Hier wurde Dr. Franziska Radke gesucht.
Gratulation: diese Antwort ist korrekt! Zu Franziska Radke empfehlen sich folgende Links:
– Schlagwort: Franziska Radke, in: „Dorsten untern Hakenkreuz“
– Radke, Franziska, in: Dorsten-Lexikon
– Eintrag in der spanischen Wikipedia
– Zusammenstellungen zu Lehrer:innen in Siegen-Wittgenstein 1933 – 1945 auf siwiarchiv
Übrigens: Vielleicht hilft diese richtige Antwort auch bei der Lösung des noch ungelösten 4. Rätsels. Denn – dies nennt man wohl Web 2.0-Paradox – die fünfte Ausgabe war vor der vierten Ausgabe des Rätsels realisiert …..
Zu prüfen wären noch:
– Universitätsarchiv Greifswald, K 742 , Mittlere Universitätsbeamt, 1935 – 1936, enthält u.a.: Bewerbungen: Reinhold Liebetanz, dabei: Lebenslauf
– Stadtarchiv Düsseldorf 1-1-1 / Übernahmen 2000 -2030, Nr. 1-1-1-5751.0000,,Verdienstorden der BRD; Geehrte und Begründungen, 1971 – 1973
– MBl 1956, S. 593, Beförderung zum Regierungsrat bei der Bezirksregierung Düsseldorf
– MBL NW 1958, S. 2553, Ruhestand
– „Die Angeglichenen“ in: DER SPIEGEL 44/1959 v. 27.10.1959: “ …. Ehe nämlich Innenminister Biernat Schritte gegen die 27 Inkriminierten unternahm, trug er einem Beamten seines besonderen Vertrauens, dem Regierungsrat Liebetanz, auf, mit Hilfe von Entnazifizierungsakten und Berlins alliierter Dokumentenzentrale die politische Vergangenheit aller von der ÖTV attackierten Beamten noch einmal zu durchleuchten.
Anfang Mai 1957 legte Inquisitor Liebetanz dem sozialdemokratischen Innenminister seine Dossiers vor. Zu dem Hauptvorwurf der ÖTV, leitende Kriminalbeamte Nordrhein-Westfalens hätten hohe SS-Dienstgrade bekleidet und SS -Dienst verrichtet, stellte Liebetanz fest: »Diese Hauptbeschuldigung entbehrt jeglicher Grundlage. Es sind keine Anhaltspunkte vorhanden, die die Annahme rechtfertigen, daß die beschuldigten Beamten in der SS und im SD aktiv tätig gewesen sind. Bei den SS-Rängen handelt es sich… um die dienstgradmäßige Angleichung an die SS.« ….“
– Stefan Noethen: Alte Kamerade und neue Kollegen. Polizei in Nordrhein-Westfalen 1945 – 1953, Essen 2003, s. 492
Immerhin gab es einen gebürtigen Netphener (Walter Stein), der 1922/23 in Greifswald und 1924/25 in München als Student der Zahnmedizin eingeschrieben war. Aber wir suchen ja leider einen Siegener.
Dann müssten wir ja bald alle Ärzte durchhaben …..
Ich hoffe, dass die Chance genutzt wird und das Museumskonzept zur Identitätsfindung und Erinnerungskultur beiträgt. Das Siegerland ist Industrieregion. Auch mit den Schattenseiten während des 3. Reiches. Wir müssen raus aus der Heimatmuseums-Denke zwischen Backesfest und Hauberg
Danke für den Kommentar! Alle Anregungen sind herzlich willkommen.
Es handelt sich um Ella Buch, Hausärztin Konrad Adenauers. Weitere Informationen und Literaturangaben hier:
https://geschichte.charite.de/aeik/biografie.php?ID=AEIK01161 („Ärztinnen im Kaiserrreich“)
Bei weiteren Recherchen zu beachten: Nach ihrer Heirat führte sie den Doppelnamen Bebber-Buch.
Den Preis stelle ich gern als Spende zur Verfügung.
Nebenbei hat die Suche ergeben, dass Else Lixfeld (siehe Siwiarchiv 8. März 2020) ein Semester (WS 1928/29) in München studiert hatte (danach wahrscheinlich in Kiel, evtl. mit Zwischenstationen). Die schon genannte Ferdinande Nückel studierte als schon 35jährige ab 1917 Philosophie und nahm nach ihrer Promotion (über „Hauptmann und Nietzsche“) 1928 noch ein Medizinstudium auf. Vor 1914 tauchen gebürtige Siegener in München nur sehr sporadisch auf; ab 1930 wurde die Herkunft in den Verzeichnissen nicht mehr angeführt. Zwischen 1914 und 1929 lassen sich an der LMU 55 Siegener (teilweise mit seit der Geburt gewechselten Wohnorten) nachweisen. Zu Greifswald kann ich nichts sagen, weil ich mich wegen Faulheit auf Stichproben beschränkt habe – rein zufällig mit Erfolg.
Eindrücke vom 20.4.2022
.
s. a. Siegener Zeitung, 23.4.2022, Link: https://www.siegener-zeitung.de/siegen/c-lokales/ausstellung-stolenmemory-am-jakob-scheiner-platz_a272687
Vollkommen korrekt und sogar mit Link – Gratulation! Übrigens: Dr. Bebber-Buch findet sich auch im online-Archiv des Spiegels einige Male erwähnt – ein Auswahl:
-„Adenauers Tod. Jenseits des Tales“, 23.4.1967, Link: https://www.spiegel.de/politik/jenseits-des-tales-a-b475b74e-0002-0001-0000-000045293056
– „Adenauers Krankheit. Latentes Leiden“, 23.4.1967, Link: https://www.spiegel.de/politik/latentes-leiden-a-24caaadf-0002-0001-0000-000045293059?context=issue
– Zitate, 5.2.1967: „»Ich bin überzeugt, daß ich bei meiner guten und gesunden Lebensweise — und mit Frau Bebber-Buch (Adenauers Ärztin) an meiner Seite — hundert Jahre alt werden kann« (Altbundeskanzler Konrad Adenauer).“, Link: https://www.spiegel.de/politik/zitate-a-73520f3b-0002-0001-0000-000046473151
-„Die Situation ist da“, 15.12.1964, Link: https://www.spiegel.de/politik/die-situation-ist-da-a-43ff9358-0002-0001-0000-000046176668
– Briefe. SPIEGEL-Leser über Konrad Adenauer, 08.10.1963, Link: https://www.spiegel.de/politik/spiegel-leser-ueber-konrad-adenauer-a-e90fb33b-0002-0001-0000-000046172254
– “ Ella Bebber-Buch“, 05.12.1961, Link: https://www.spiegel.de/politik/ella-bebber-buch-a-13e983cb-0002-0001-0000-000043367752
– “ BUNDESKANZLER. Hausarrest“, 13.12.1960, Link: https://www.spiegel.de/politik/hausarrest-a-dbf75c61-0002-0001-0000-000043067894
Pingback: Wem gehört die Geschichte? | siwiarchiv.de
Pingback: Symposium: Pionier:innen der Geschlechterforschung – Helge Pross und Wolfgang Popp | siwiarchiv.de
Pingback: „Gerhard Stötzel-Ehrung“ in Netphen | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik April 2022 | siwiarchiv.de
Pingback: Landtagswahl 2022 in NRW – „Archiv“ in den Wahlprogrammen der Parteien | siwiarchiv.de
Pingback: Lutz Dehenn: „Die Chronik“ – Online-Ausstellung zur regionalen Graffiti-Geschichte | siwiarchiv.de
Pingback: Friedrich Kiel CD – eine Schenkung an das Kreisarchiv | siwiarchiv.de
Pingback: 6 archivpolitische Fragen zur Landtagswahl 2022 in NRW | siwiarchiv.de
Pingback: 6 archivpolitische Fragen zur Landtagswahl 2022 in NRW | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 21.4. – 3.5.2022 | siwiarchiv.de
Pingback: Wem gehört die Geschichte? | siwiarchiv.de
Pingback: Wem gehört die Geschichte? | siwiarchiv.de
Fissmer und Stoecker(-Str.):
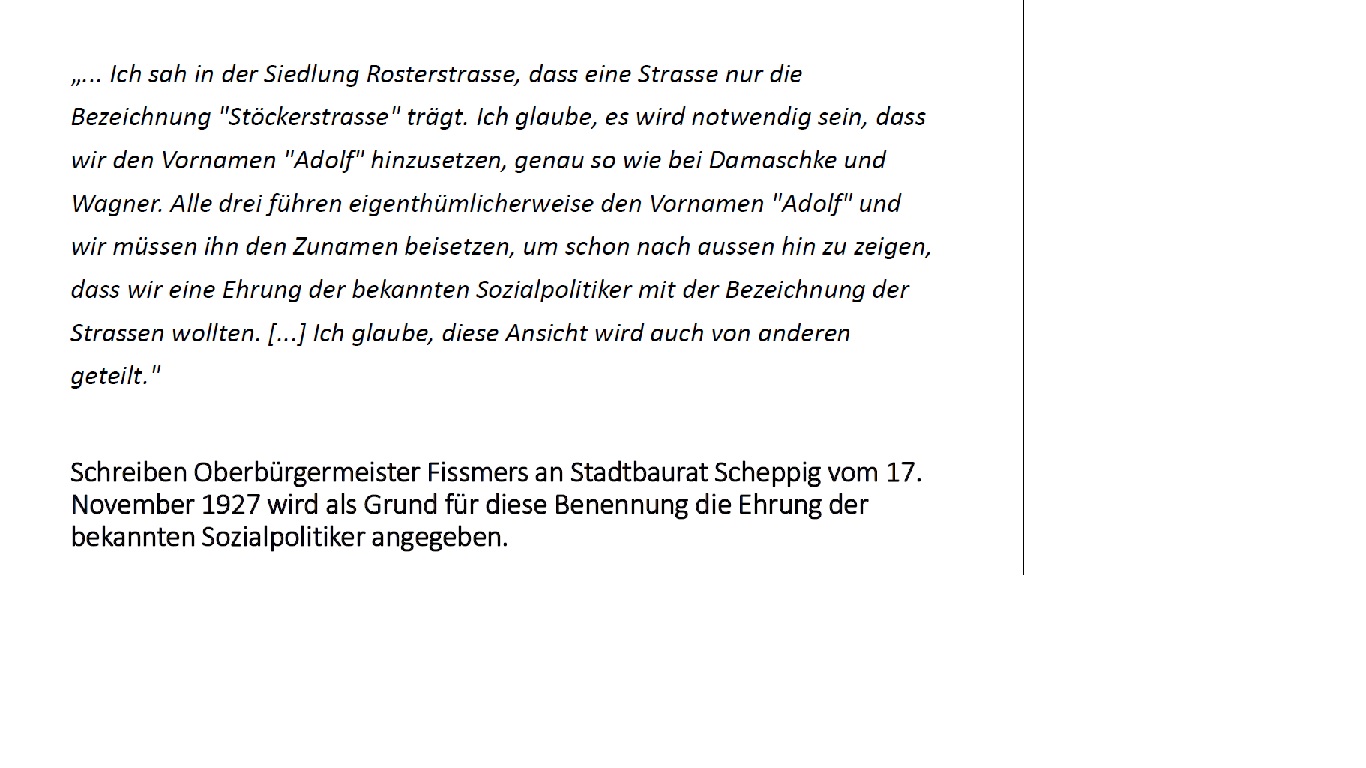
Quelle: Stadtarchiv Siegen
Zu Scheppig s.:
1) https://www.siwiarchiv.de/umbenennung-der-alfred-fissmer-anlage-in-siegen/#comment-116995
Ein visueller Eindruck:

Dr. Jens Aspelmeier (Aktiven Museum Südwestfalen e.V., Vorstandsmitglied ) bei der Kurzinformationen über Adolf Stoecker, „dessen“ Straße umbenannt werden soll.
Pingback: Zur Stimmung am 8. Mai 1945: | siwiarchiv.de
Pingback: 6 archivpolitische Fragen zur Landtagswahl 2022 in NRW – Archivalia
In der Siegener Zeitung erschien am 7.5. ein fast ganzseitiger Artikel – leider nur im Print (S. 5), daher hier eine PDF-Datei.
Die Westfälische Rundschau berichtete ebenfalls am 7.5.: https://www.wp.de/staedte/siegerland/diese-siegener-strassen-heissen-nach-gluehenden-antisemiten-id235276283.html und kommentierte auch die Veranstaltung: https://www.wp.de/staedte/siegerland/strassennamen-in-siegen-einfach-keine-menschenfeinde-nehmen-id235276329.html .
Zur Diskussion der Facebookeinträge der Westfälischen Rundschau s.
und
Die Präsentation zu Dr. Lothar Irle und Jakob Henrich wird hiermit nachgereicht: Präsentation v. 5.5.2022 zu Dr. Lothar Irle und Jakob Henrich (PDF)
Gibt es wirklich Änderungswünsche durch die Anwohner einer Straße oder geht es nur um ein Forschungsprojekt der Uni Siegen um Geld zu generieren? Wie wäre es mit einer „braunen“ Zusatztafel mit Hinweisen auf den benannten Menschen (mit positiven und negativen Einschätzungen) im geschichtlichen Kontext mit einem QR_Code? So gäbe es auch bei Bedarf eine Diskussion in Verbindung mit der Namensgebung. „Opa warum hängt da ein „braunes“ Schild“ unter dem Straßennamen?“, wäre ein erster Schritt zu einer längst überfälligen Erinnerungskultur. Glück Auf. Karl Heupel
Danke für den Kommentar! Der Arbeitskreis resultiert, wenn ich es recht sehe, aus 2 Quellen:
1) einem Bürger:innenantrag zur Erhöhung der Sichtbarkeit von Frauen im Siegener Stadtbild, der auch explizit Straßennamen mit einbezog, und
2) dem Antrag einer politischen Partei, die Lothar-Irle-Str. in Therese-Giehse-Str. umzubenennen.
Ich persönlich habe ein Problem mit den Erklärschildern unter den Straßennamen, da ich bis lang glaube, dass Strassennamen(sverzeichnisse) weder einen musealen Charakter haben, noch ein geschichtsdidaktisch höchst geeignetes Material zur Erinnerungskultur sind. Außerdem ist die Formulierung der Erklärschilder, seien sie kurz oder lang, schwierig, wie dies im Falle des Textes für die Alfred-Fissmer-Anlage in der Siegener Oberstadt dokumentiert ist. Strassennamen dienen primär zur Auffindung von Immobilien und werden – problematischer weise – zur Ehrung von Persönlichkeiten verwendet.
Ihre generationsübergreifende Version der Erinnerungskultur finde ich charmant. Ich habe da lediglich ein praktisches Problem: im Straßenverkehrszeichenwald weist die braune Farbe in der Regel auf positive konnotierte Sehenswürdigkeiten hin.
Ein Fund in der Hilchenbacher Zeitung vom 9. Januar 1929 – Zu prüfen ist wohl , in welcher Funktion Fissmer dem Verein angehörte und wie aktiv er war:
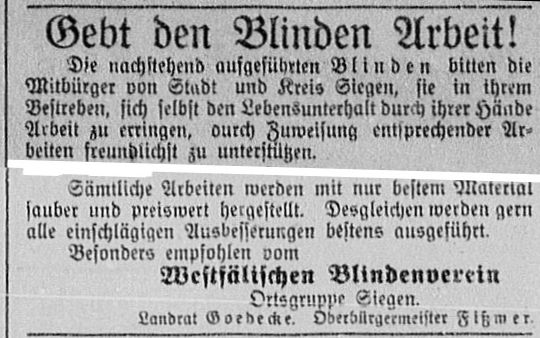
Bin auf dieses Beispiel aus Karlsruhe gestoßen. Ein Workshop für Jugendliche zu Straßennamen und den Umgang mit problematischen Namen.
Das wäre sicherlich auch interessant für Siegen-Wittgenstein. Zusammen mit dem VVN-BdA, AMS, Archiven, dem Stadt- und Kreisjugendring etc.
https://instagram.com/ehrenmaenner_workshop?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Vielen Dank für den Hinweis!
Die vor einem Vierteljahr hier vorgestellte „Bibliographie zur Siegener Stadtgeschichte“ verzeichnet eine 1972 erschienene Festschrift „50 Jahre Westfälischer Blindenverein, Bezirksgruppe Siegen e.V.“
Kurze Informationen zur Siegener Gruppe finden sich auch in verschiedenen historischen Dokumenten des Dachverbandes, siehe https://www.bsvw.org/historischedokumente.html. Mehreren dort einsehbaren Festschriften zufolge war „Frau Landrat Goedecke“ in den 1920er Jahren ein geschätztes (sehendes) Mitglied des Vorstandes. Dagegen werden weder ihr Mann noch der Oberbürgermeister erwähnt. Ich verstehe deren Nennung in der Hilchenbacher Zeitung lediglich so, dass sie dem (privaten) Aufruf der Siegener Blinden kraft ihrer Ämter, aber nicht notwendigerweise als Vereinsmitglieder, Nachdruck verleihen wollten.
In den genannten digitalen Unterlagen des Dachverbandes findet sich die Bezeichnung „Protekorat“ für das Engagement des Landrates und Fissmers. Würden wir heute wohl „Schirmherrschaft“ nennen? Treibende Kraft war die Landratsgattin, die dem Vorstand des Ortsvereins seit Gründung angehört hatte.
Ich habe den Direktkandidat:innen meines Wahlkreises diese Fragen via E-Mail gestellt. Geantwortet haben die CDU, FDP, AfD, Volt und die Partei. Sachliche Antworten habe ich nicht bekommen. Die Reaktionen waren eine Mischung aus Überraschung und Neugier. Auch ich selbst war überrascht, dass sich mit einem Kandidaten ein 30min Videoanruf ergab..
Es wird wohl immer ein Rätsel bleiben, warum die Universitätsleitung zwecks Illustration ihres Festbandes in so hohem Maße auf die Fotosammlung eines kommerziellen regionalen Presseunternehmens und keinesfalls auf die archivierte hauseigene zurückgreifen wollte. Der enge Schulterschluss zwischen Universität Siegen und Siegener Zeitung macht vielleicht nicht jeden glücklich, dem etwas an der politischen Unabhängigkeit von Hochschulen gelegen ist.
Danke für den Kommentar! Könnte man eigentlich auch nicht grundsätzlicher fragen, warum nur einen Bildband zum 50.? Die Archivalien zur Gründungsgeschichte unterliegen ja eigentlich keinen Fristen mehr, so dass einer fundierten Gründungsgeschichte nichts im Wege gestanden hätte – gerne hinreichend bebildert.
Herbert Bäumer widmete auf der Heimatland-Seite (Print) der Siegener Zeitung am vergangenen Samstag (14.5.) einen ausführlichen Artikel Edith Langner; bedauerlicherweise verzichtete die Siegener Zeitung auf Quellenangaben. Die zuständige Redakteurin stellte den lesenswerten Beitrag in Zusammenhang mit den aktuellen Straßennamendiskussionen in der Stadt Siegen.
Zu Edith Langner seien noch folgende Quellen im Archiv der Konrad-Adenauer-Stiftung präsentiert – Wahlkampfplakate für die Landtagswahlen 1966 und 1970:
Von CDU – Diese Datei wurde Wikimedia Commons freundlicherweise von der Konrad-Adenauer-Stiftungim Rahmen Wikimedia-Kooperationsprojekteszur Verfügung gestellt., CC BY-SA 3.0 de, Link
Quelle: KAS/ACDP 10-009 : 543
Von CDU – Diese Datei wurde Wikimedia Commons freundlicherweise von der Konrad-Adenauer-Stiftungim Rahmen Wikimedia-Kooperationsprojekteszur Verfügung gestellt., CC BY-SA 3.0 de, Link
Quelle: KAS/ACDP 10-009 : 652
Herbert Bäumers Artikel „In vieler Hinsicht eine Pionierin. Edith Langner war nicht nur in Siegen engagiert“ weist auch 2 Episoden auf:
1) “ …. Am 5. Juni 1953 stand der Fischbacherberg im Blickpunkt des Interesses der Öffentlichkeit. Die Siegener Zeitung berichtete, dass die Vermessungsarbeiten auf dem Fischbacherberg ohne Wissen der Stadtverwaltung durchgeführt worden seien. Diese Vermessungsarbeiten gaben in der Öffentlichkeit Veranlassung zur Annahme, dass neuerlich belgische Truppen, nämlich der Brigardestab, von Gummersbach nach Siegen verlegt werden sollten. Und diese Soldaten brauchten dann auch Wohnraum ….. Diese Arbeiten, so die SZ, sollten am 30. Mai eingestellt worden sein. Bei den Arbeiten habe es sich „um selbstherrliches Vorgehen untergeordneter Organe gehandelt“, wiegelte Stadtverwaltung in der SZ ab. Letztendlich handelte es sich aber um Vorarbeiten für den Bau der Nato-Zähne, der Querriegel davor und der Häuser für die belgischen Soldaten.
Die Debatte in der Stadtverordnetenversammlung wurde durch eine Anfrage von Edith Langner angestoßen, die sich am Ende zufrieden zeigte: „Wir können unsere Gärten wieder bebauen, und dafür danken wir“, führte sie aus. Die lagen nämlich inden vermessenen Gebieten. ….“
2) “ … Zum wiederholten Male: ärgerte sie sich über die Berichterstattung in der Lokalpresse, weil dort im Zusammenhang von Ratsbeschlüssen immer von „Ratsherren“ und „Stadtvätern“ die Rede war. Kurzerhand klebte sie sich einen Schnurrbart an, schlüpfte in Männerkleidung und erschien so in einer Ratssitzung, um gegen diesen unhaltbaren Zustand zu protestieren. Das beindruckte! ….“
Am kommenden Mittwoch, 25.05.2022, tagt um 17:00 Uhr im Rathaus Siegen-Geisweid, Großer Sitzungssaal, der Kulturausschuss der Stadt Siegen. U. a. wird dort der Abschlussbericht des Arbeitskreises „Aufarbeitung der historischen Hintergründe von Straßennamen“ (VL 881/2022) Thema sein. Bedauerlicherweise ist die Vorlage noch nicht online.
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 4.5. – 16.5.2022 | siwiarchiv.de
Im Siegener Stadtarchiv gilt es folgende Archivalien einzusehen:
– Best. E (Stadtverwaltung Siegen, 1945-1974) Nr. 82, Bildung der Ausschüsse, Sitzungen der Ausschüsse, Bd. 3., 1947-1953
enthält u. a. Fragebogen zu Entnazifizierung für Edith Langner (Adresse: Haig-Kaserne, Block C)
– Best. 384 (Nachlass Friedrich Neus) Nr. 3, Fotoalbum mit Aufnahmen zu offiziellen Anlässen, 1964 – 1979
enthält u. a.: 70. Geburtstag i. Bauhof mit Stadtdirektor Ramfort, Bürgermeister Vitt, Minister des Landes Langner, Stadtrat Reinhardt; Oberkreisdirektor Forster und Langhans, Obm. Althaus und Stadtdirektor Mohn
Im Landesarchiv NRW, Abteilung Rheinland, in Duisburg gilt es folgende Akten einzusehen:
– NW 0498 (Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie Organisation 1), Nr. 56, Regionale Wirtschaftsförderung im Siegerland, 1969
Enthält: Beantwortung der Kleinen Anfrage der Abgeordneten Langner (CDU) zur Nutzung der Obernau-Sperre
-( Im Bestand NWO müsste eine Akte zur Verleihhung des Bundesverdienstkreuzes vorhanden sein. Anm. ergänzt am 18.5.)
Else Lixfeld studierte im Ws 1928/1929 in München – s. https://www.siwiarchiv.de/osterferienraetsel-2022-iv/#comment-117363.
Sie heiratete am 24.6.1939 in Siegen den Bauassessor Arnt Wustmann – Quelle: Nachlass Wustmann in der Universitätsbibliothek Leipzig.
„Langner fand 1945 als schlesische Pfarrers- und Kriegerwitwe mit zwei kleinen Söhnen in einem Siegener Kasernenzimmer für Jahre ihr Zuhause. Sie kam 1947 in Siegens Sozialausschuss, gehörte 18 Jahre dem Stadtrat an und von 1966 bis 1975 dem NRW-Landtag, war Kreisvorsitzende der CDU-Frauenvereinigung, im CDU-Kreisvorstand, im Kuratorium der DRK-Kinderklinik, Presbyter von 1960-1976, Gründerin der Frauenhilfe und eines gemischten Chors, dazu Orgelspielerin sowie im Vorstand und in der Offenen Sozialarbeit der Inneren Mission. Großes Verdienstkreuz, Stadt-Ehrensiegel und andere hohe Auszeichnungen.“ aus: Siegerländer Heimatkalender 1988, S. 35
Pingback: Westfälische Drucker, Verleger und Verlage | Westfalenlob
Pingback: Siegen: Grabstätten am Gruftenweg auf dem Lindenbergfriedhof aufwändig restauriert | siwiarchiv.de
Guten Morgen,
leider ist das bis vor zwei Monaten noch zu Verfügung stehende Personenlexikon des nationalsozialismus nicht mehr abrufbar.
Eigenartig! Politisch so gewollt?
Charlotte Medenbach
M. W. hat der Hostanbieter des Weblogs seinen Betrieb eingestellt. Andere Gründe sind mir nicht bekannt.
Sehr geehrte Frau Medenbach, wir mussten dies am Wochenende auch sehr überrascht festellen. Alle unsere drei Blogs sind down. Der Support ist nicht erreichbar, von einer Vorwarnung wissen wir nichts. Die Daten sind sicher und wir werden versuchen sobald wie möglich umzuziehen. Wir werden hier und an anderer Stelle darüber berichten. Viele Grüße!
Pingback: Video: Heimkehr 1953 – Neuanfang nach der Kriegsgefangenschaft | siwiarchiv.de
Pingback: Ausflugtipp: „Der Alltag der 1960er Jahre“ | siwiarchiv.de
Pingback: „Aufarbeitung der historischen Hintergründe von Straßennamen“ in Siegen | siwiarchiv.de
Pingback: „Aufarbeitung der historischen Hintergründe von Straßennamen“ in Siegen | siwiarchiv.de
Bei der Erarbeitung der Kategorien gibt der Arbeitsbericht (S. 4 Z136-138) folgende Beispiele anderer Kommunen an:
– Augsburg: https://www.augsburg.de/kultur/erinnerungskultur/umstrittene-strassennamen
– Darmstadt: Im Blog des Stadtarchivs finden sich einige Einnträge zum Thema: https://dablog.hypotheses.org/?s=Stra%C3%9Fennamen
– Freiburg: https://www.freiburg.de/pb/1017982.html
– Hamburg: https://www.hamburg.de/bkm/strassennamen/13512150/ns-belastete-strassennamen/
– Mainz: https://www.mainz.de/kultur-und-wissenschaft/bibliotheken-und-archive/stadtarchiv/historische-strassennamen.php
Karlsruhe: https://www.karlsruhe.de/b1/stadtgeschichte/erinnerungskultur.de
München: https://stadt.muenchen.de/infos/historisch-belastete-strassennamen.html
Münster: https://www.muenster.de/stadt/strassennamen/wer-was-warum.html
s. a. Wien: https://www.wien.gv.at/kultur/strassennamen/strassennamenpruefung.html
Politisches Meinungsbild im Kulturausschuss:
– Alle Parteien für Erklärschildchen und Bürger:innenbeteiligung.
– CDU, AfD und GfS gegen Umbenennungen,
– SPD will nur Irle, Stoecker und Hindenburg umbernennen
– FDP, Grüne, Linke und Volt keine Änderung des Abschlussbericht.
Nächster Schritt ist die Bürger:innenbeteiligung.
Im Blog der Geschichtswqerkstatt findet sich eine kritische, zustimmungswürdige Anmerkung zur Beibehaltung der Graf-Luckner-Str.: https://geschichtswerkstatt-siegen.de/2022/02/11/umbenennung-von-strassennamen/#comment-101.
Für Göttingen:
https://www.stadtarchiv.goettingen.de/strassennamen/tamke-driever%20goettinger%20strassennamen_02.pdf
Danke für die Ergänzung!
Die Darmstädter Ergebnisse sind gesammelt unter https://darmstadt.de/strassennamen zu finden.
Danke für den Link! Ich hatte wenigstens die Blogeinträge noch im Hinterkopf.
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 17.5. – 29.5.2022 | siwiarchiv.de
Zur Straßenbennung in Düsseldorf gibt der Abschlussbericht des Beirats zur Überprüfung Düsseldorfer Straßen- und Platzbenennungen (Langfassung 2020), S. 312, an: “ …. Die „Hermann-Reuter-Straße“ wurde – anders als in der „Straßenbenennungsliste nach 1997“ angegeben – nicht nach dem ehemaligen Leiter der Stadt- und Landesbibliothek, sondern nach einem SPD-Lokalpolitiker benannt, der biographisch unverdächtig ist. ….“
Aus dem Abschlussbericht geht hervor, dass Reuter auch an folgende Straßenbenennungen in Düsseldorf angeregt hat:
16.12.1937: Leutweinstr. nach Theodor Gotthilf Leutwein, Lüderitzstr. nach Franz Adolf Eduard von Lüderitz; Petersstr. nach Carl Peters; Woermannstr. nach Adolph Woermann
19.5.1938: Schlieffenstr nach Alfred Graf von Schlieffen
März 1947: Münchhausenweg nach Börries Albrecht Conon August Heinrich Freiherr von Münchhausen
Pingback: „Aufarbeitung der historischen Hintergründe von Straßennamen“ in Siegen – Archivalia
Pingback: Keine Archive, Museen oder Bibliotheken im Sondierungspapier | siwiarchiv.de
Zur Zeit wird auf facebook in der Gruppe „Nachdenken über Alfred Fissmer“ das Ergebnis der Arbeit einer kommunalen Kommission zum Umgang mit NS-belasteten Figuren der Stadtgeschichte durch Straßennamen statt. Dabei wird von Seiten der SPD auch Wurmbach angesprochen. Er sei nicht nur völlig unbelastet, sondern unbedingt zu würdigen. Tatsächlich ist er im angelaufenen Verfahren der Beerdigung der Kommissionsergebnisse eigentlich eine ausgesprochene Nebenfigur. Es lohnt sich, auf die heftigen Interventionsversuche der SPD zugunsten von Wurmbach einzugehen, weil er repräsentativ für dieses m. E. bildungs- und kleinbürgerliche Milieu ist, das auch im Siegerland – dort mit einer überdurchschnittlichen Unterstützung vor allem bekanntlich von protestantischer Seite die Nazis und ihre deutschnationalen Bündnispartner an die Macht brachte und nach dem Disaster 1945 an diesen Größen festhielt, ja, geradezu festklebte.
Wurmbach begrüßte die Terrordiktatur am 21.3.1933 mit den folgenden Worten (ich übernehme im Folgenden der Einfachheit halber meinen fb-Kommentar):
„Lasst Fahnen wehn von allen Dächern,
Verkünden uns das deutsche Jahr,
Und macht der Glocken Mund zu Sprechern
Der grossen Tat, die Sieger war.
War wie ein Sturm in deutschen Landen
Der Freiheit strahlender Beginn;
Ein ganzes Volk ist auferstanden,
Die Zeit hat einen neuen Sinn.
Den Weltkriegsbeginn, das große raum- und rassenpolitische Naziunternehmen, begrüßte er 1939 dann so:
„O Deutschland, reich an Liedern und Wälderpracht -/Doch steht dir auch die Sprache des Zornes an,/Damit du züchtigest den Frevler,/Der an den heiligen Frieden rühret./Mit ihren Leibern schirmen der Besten viel/Und heißem Herzen Marken und Heimstatt dir,/Damit sie leben oder sterben -/Segne der Himmel den Schwur! – für Deutschland.“
Um 1941 in dieser Weise nachzulegen:
„Fürs Vaterland sterbe/O heilige Saat,/Du höchstes Opfer,/Verklärender Tat/ … /Gefallen – o, Deutschland,/Für dich, für dich!“
1944 lief es dann nicht mehr so gut. Da mussten Durchhalteappelle her:
„Zum Beginn!
Der Tag geht auf so morgenklar,
Ruft ihm entgegen von den Zinnen:
Wir grüßen dich, du junges Jahr,
Zu neuem Kampf, zu neuer Fahr,
Zu neuem Wagen und Gewinnen!
Laß uns mit Großem dich beginnen!“
(mit Ausnahme des ersten Zitats jeweils der sog. „Siegerländer Heimat-Kalender“)
Ja, der Wurmbach war nach nationalistischen Anfängen im und nach dem Ersten Weltkrieg zeitweise ein idealistischer Pazifist und nach dem Zweiten Weltkrieg war er es dann wieder. Zwischendurch offenbar nicht. Ein klassischer Wendehals. Die Sprecherin der SPD verwies im Ausschuss auf einen Wikipedia-Artikel (wie dort immer ein Artikel zahlreicher, in aller Regel unbekannter Autoren, ich zählte 19), fand Wurmbach werde dort schlechtgemacht („verunglimpft“) und warf in demselben Atemzug dem von den Nazis umgebrachten bekannten Antifaschisten Walter Krämer ins Blaue hinein vor, für Tötungen von Häftlingen in Buchenwald verantwortlich gewesen zu sein. Ekelhafter geht es nicht. Und die Frage, was dieser Wurmbach auf einem Straßenschild zu suchen hat, die stellt sich m. E. nicht. Ihn zu verschweigen, wäre eine Freundlichkeit, die sich in Frage stellen lässt.
Zu allem Überfluss erreicht mich nun eine Einladung jenes „Heimat“-Blatts, das sich im Mai 1933 enthusiastisch zum „Organ des nationalsozialistischen deutschen Staates und des unter Adolf Hitlers Führung erwachten Volkes“ erklärt hatte, zu einem „Gespräch, von dem ich sehr hoffe, dass es zustande kommt“.
Die rechte Blatt-Richtung bestimmten schon seit den 1920er Jahren als Eigentümer ein Stahlhelm-Mitglied, das nach 1933 der SA und dann der Nazi-Partei beitrat, und ein bis 1933 im antisemitischen Jungdeutschen Orden, dann freischwebender Akteur. Bald leitete ein bekannter Nazi die Redaktion. Und dabei blieb es bis zum Ende der Diktatur. Der erste „Hauptschriftleiter“ nach dem alliierten Verbot der Familienzeitung kam dann wieder aus der NSDAP und diesmal auch aus der SS. Bis heute und damit über drei, vier Generationen gab es keine auch noch so milde und widersprüchliche vergangenheitspolitische Distanzierung dieses Blatts von seiner schändlichen Vergangenheit, vielmehr fährt sie bis heute einen politischen Kurs, der sich nur rechts einordnen lässt. Wie in den zwanziger Jahren ohne parteipolitische Enge, immer auch ein klares Stück über die Enge hinaus.
Mit denen ein Gespräch? Ja, gerne, sobald sie zeigen können, dass sie lernfähig sind. Das ist bislang nicht erkennbar.
Nachtrag, Quellenangaben (Auswahl):
Herbert Knorr, Zwischen Poesie und Leben. Schriftenreihe des Instituts für Stadtgeschichte, Bd. 6), Essen 1995
(zu Knorr: https://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Knorr_(Literaturwissenschaftler)
Entnazifizierungsakte: https://www.siwiarchiv.de/wp-content/uploads/2014/10/EntnaziAWurmbachx.pdf
Diskussion: https://www.siwiarchiv.de/vorarbeiten-fuer-eine-noch-zu-schreibende-biographie-adolf-wurmbachs/
Selbstaussagen: SIEGERLAND, BD. 17, H. 2, 1935, S. 67, 76-77; SHK 1940, 4, 42, 1942, 49, 1944, 4; SNZ, 25.4., 27.4.1936, 1.11.1937, 20.7.1939, 9.4.1940, 14.6.1941; SZ, 18.6.1941, 5.5.1942; SZ/SNZ, 5.8., 7.8., 2.9., 15.9.1943; WR/RT, 12.11.1955, 13.8.1956
Übrigens, auch die Gedenkstätten fehlen. Aber wenigstens will man sich erinnern: “ …. Das Hochwasser im letzten Juli hatte verheerende Folgen, die Erinnerung an die Opfer werden wir wachhalten. ….“ (S. 4), “ …. Wir bekennen uns zu einer aktiven Erinnerungskultur und unterstützen diese….“ (S. 9)
Pingback: 22. Oktober 1957: Bundesverdienstkreuz für Adolf Wurmbach | siwiarchiv.de
Pingback: NRW: Keine Archive, Museen oder Bibliotheken im Sondierungspapier – Archivalia
Pingback: siwiarchiv.de
Nachdem unser Provider kürzlich den Dienst eingestellt hatte, waren unsere drei Blogs nun seit etwas mehr als einer Woche vom Netz. Damit wir bei einem neuen Dienstleister wieder online gehen konnten, waren etliche Anpassungen der Seiten notwendig. Aber nun ist es geschafft. Hier sind die Drei wieder In deutlich aufpoliertem Erscheinungsbild, wie wir finden. Wir hoffen es gefällt!
Regionales Personenlexikon zum Nationalsozialismus in den Altkreisen Siegen und Wittgenstein
http://akteure-und-taeter-im-ns-in-siegen-und-wittgenstein.de/
Widerspruch und Widerstand – Opposition gegen den Nationalsozialismus in den Altkreisen Siegen und Wittgenstein
http://widerspruch-und-widerstand-im-ns-in-siegen-und-wittgenstein.de/
Mitten unter uns – Zwangsarbeit im Siegerland 1939 – 1945
http://zwangsarbeit-im-siegerland.de/
In der heutigen Print-Ausgabe der Siegener Zeitung erschienen drei Leserbriefe zum Abschlussbericht: „Luxusprobleme“, „Unsinnige Gedanken“ und „Grünes Problem“.
Zudem erschienen online hinter der Bezahlschranke zwei Artikel, die sich mit dem „Sonderfall“ Adolf Wurmbach befassen:
– „Fall Wurmbach offenbart Balanceakt. Ein Prozesse, bei dem man viel gelernt hat“ und
– „Traute Fries macht sich für Heimatdichter stark. „Für mich ist Adolf Wurmbach kein Nazi“.
Zu Adolf Wurmbach sind auf siwiarchiv folgende Einträge erschienen:
– Vorarbeiten für eine noch zu schreibende Biographie Adolf Wurmbachs (2014)
– 22. Oktober 1957: Bundesverdienstkreuz für Adolf Wurmbach (2014)
– Entnazifizierungsakte Adolf Wurmbach (2014)
– Sicherung der Bibliothek Adolf Wurmbachs (2017)
s.a.
– Literaturtipp: „Westfälische Literatur im „Dritten Reich“. Die Zeitschrift Heimat und Reich.“ (2012)
– Literaturhinweis: Traute Fries „Die Deutsche Friedensgesellschaft. im Bezirk Sieg-Lahn-Dill in der Weimarer Republik. Eine historische Rekonstruktion“ (2013)
– „Siegerland“ Bd. 93 (2016) erschienen“
Der Abschlussbericht des Arbeitskreises besagt zu zu Wurmbach folgendes, so dass die ausführliche Berichterstattung etwas verwundert: “ …. Als unbelastet oder nur minderschwer belastet wurden in die Kategorie C eingestuft:
Adolf‐Wurmbachstraße …..
In diesen Fällen besteht kein Handlungsbedarf. Die Straßennamen können beibehalten
werden und eine Kommentierung ist aus Sicht des Arbeitskreises nicht erforderlich. Im Falle von Adolf Wurmbach regt der Arbeitskreis an, diese für die Siegener Geschichte wichtige Persönlichkeit an einem geeigneten Ort in Geisweid besonders differenziert darzustellen. Als Präsentationsform könnte eine größere Texttafel in Frage kommen.. …“
Ergänzende Literatur:
Torzewski, Christiane: Heimat sammeln: Milieus, Politik und Praktiken im Archiv für westfälische Volkskunde (1951-1955), Münster 2021, S. 36, 45, 57, 189:
Wallies, Esther: Georg Nellius (1891-1952). National-konservative Strömungen in der Musik der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts am Beispiel eines Komponisten, Münster 1991, S. 214 [„Ein Ländchen bloß, ein Raum so klein“ (1943, Adolf Wurmbach), 219 [op 94 Wandlerlieder (1949) nach Gedichten von Adolf Wurmbach]
Pingback: Online: Die Landes-Kultur-Gesetzgebung des preussischen Staates | siwiarchiv.de
s. a. Siegener Zeitung, 4.6.2022 (Rubrik Heimatland)
Pingback: 3 Datensammlungen zur Geschichte des Nationalsozialismus im Kreis Siegen-Wittgenstein wieder online | siwiarchiv.de
Im Landesarchiv NRW Abt. Westfalen in Münster gibt es eine Wiedergutmachungsakte zu Adolf Wurmbach, Signatur:
LA NRW Abt. Westfalen K 104 Regierung Arnsberg, Wiedergutmachung,
Nr. 59087;
Das Wurbach vor 1933 Mitglied der Deutschen Friedensgesellschaft
war, ist bekannt, laut der Selbstaussage in der Akte war er auch Mitglied im Republikanischen Lehrerbund.
Als Grund für seine Entlassung aus dem Lehramt 1934 gibt Wurmbach
seine Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Quäker an.
Auch gibt er an, das er ein Angebot der NSDAP zur Übernahme einer Arbeitsstelle in der Jugendfürsorge abgelehnt hat.
1942 wird er wieder im Schuldienst eingestellt, aber mit deutlich geringeren Bezügen als bei seiner Entlassung.
Berichtigung: 1941 (1.9.) nicht 1942 wird er wieder in den Schuldienst eingestellt.
Danke für die Ergänzungen! Sie sind in der gegenwärtigen Diskussion wichtig.
Ein allseits beglückender Kompromiss wäre es, lediglich den Vornamen zu ändern: Von der Umbenennung in „Emilie-Wurmbach-Straße“ würden sich die Fans ihres Ehemannes nicht gar zu sehr brüskiert fühlen, und in der Statistik könnte eine neue Quotenfrau ausgewiesen werden. Oder will jemand behaupten, die Emilie sei minder ehrenwert als ihr Adolf gewesen, weil sie diesen bekochte und ihm die Unterhosen wusch, während er „Dichter“ spielte? (Ihren Beruf als Lehrerin durfte sie ja auf Verlangen des teuren Gatten nicht länger ausüben.)
Und bei der Lothar-Irle-Straße könnte man den Vornamen einfach weglassen. Dann wäre sie eben nach der Irle-Brauerei benannt. Wohl bekomm’s!
Die Diskussion im gestrigen Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Siegen gibt der Eintrag auf der Facebook-Seite der Westfalenpost Siegen wieder.
Link zum Text von Traute Fries über Adolf Wurmbach: https://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/Adolf-Wurmbach-1891-1968.pdf
Stellungnahme der CDU-Stadtratsfraktion auf deren Facebook-Seite nach der Sitzung des Haupt und Finanzausschusses der Siegen zum Thema:
„Wir als CDU-Fraktion sind gegen eine Umbenennung von Straßennamen.
Nicht nur muss die immense Belastung der betroffenen Anwohner und Betriebe verhindert werden, auch die historischen Hintergründe der historischen Personen sehen wir zum Teil durch den Arbeitskreis zur Neubenennung von Straßennamen wissenschaftlich nicht differenziert genug dargestellt. Statt die Straßen umzubenennen, fordern wir Hinweisschilder anzubringen, um über die Gründe der Ehrung, aber auch die Kritikpunkte zu den entsprechenden historischen Personen aufzuklären.
Zudem fordern wir eine Beteiligung/Befragung der betroffenen Menschen, die in den besagten Straßen leben und wohnen anstatt über ihre Köpfe hinweg zu entscheiden. „
Steffen Schwab kommentierte in der Westfälischen Rundschau unter folgender Überschrift „Hindenburg, Irle Co müssen weg, sofort“
Ein Blick in den Vortragsraum:
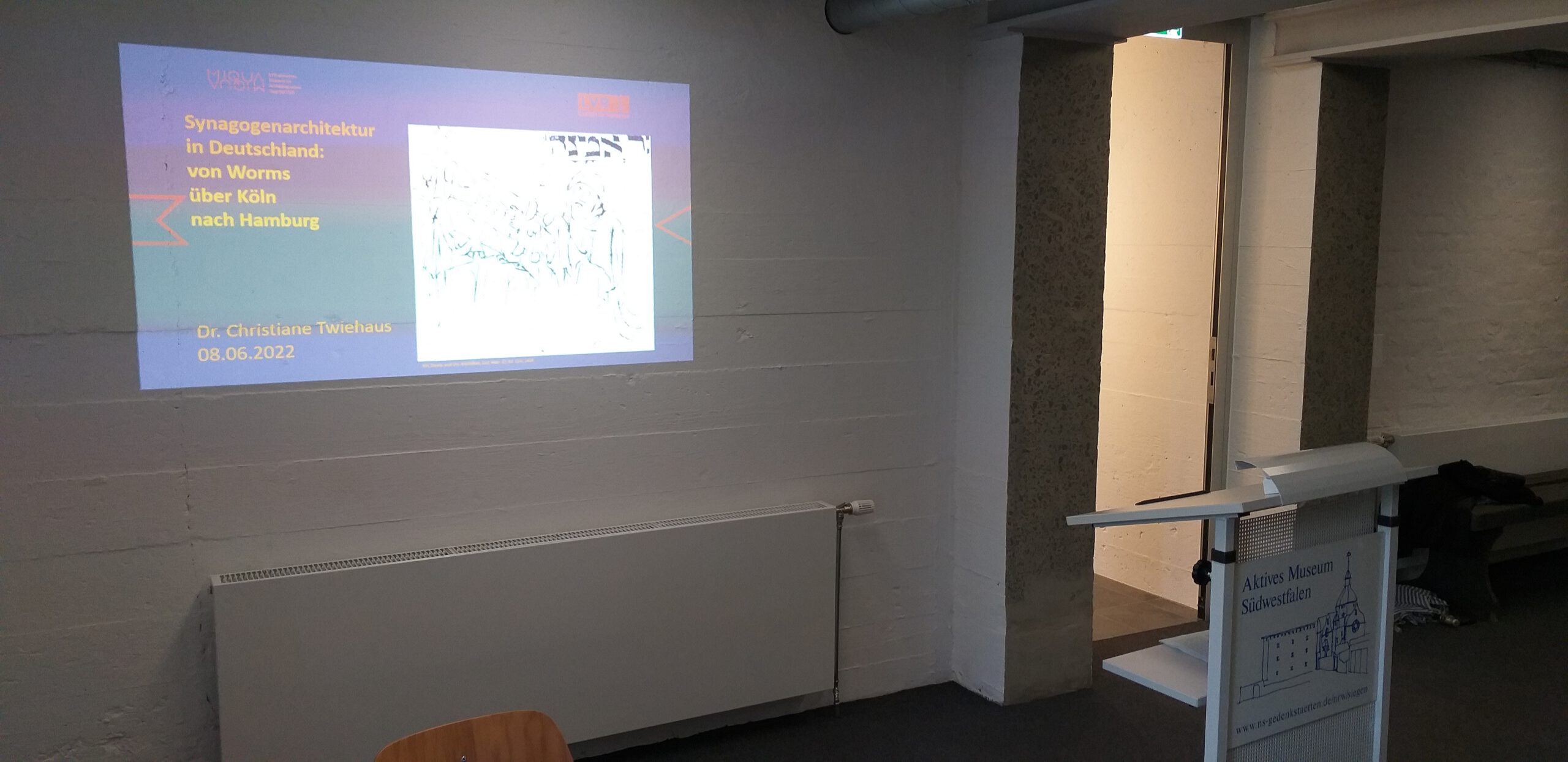
Sehr geehrte Archivverwalter,
von meinem Vater Albert Münker
geb. am 10.1.1894 aus Dreis-Tiefenbach
gibt es vermutlich Unterlagen. Ich bin seine jüngste Tochter Dietlinde, inzwischen 83 Jahre alt. Ich möchte gerne diese erwähnten Unterlagen einsehen u würde mit einem Enkel zu Ihnen kommen.
Im voraus vielen Dank für Ihre Mühe
Mit freundlichen Grüßen
Dietlinde Hirth geb Münker
Robert-Koch-Str.5
54328 Konz
richard.hirth@t-online.de
0650115288
Wie u wann wäre das möglich?
Die Signatur der Personalakte Wurmbachs im Landesarchiv in Münster lautet: LAV NRW W, R 001/Personalakten Nr. 724. Die bisherigen Ausarbeitungen zu Wurmbach lassen eine intensive Analyse der Akte nicht erkennen.
Am 14.6. erschien weiterer Leserbrief „Niemand zufrieden“ in der Siegener Zeitung und am 15.6 2 weitere: „Leichen im Keller“ und „Bezahlt nichts“.
Heute erschien in der Siegener Zeitung der Artikel „Strassenschild auf die Schippe genommen. Diskussion um geehrte Nazis erhält humorvollen Beitrag.“ hinter der Bezahlschranke. Die nach dem antisemitischen Hofprediger Afolf Stöcker 1927 benannte Stöckerstrasse erhielt ein inoffizielle Zusatzschild, das auf den noch lebenden Werner Stöcker als Grund für die Benennung angibt. Werner Stöcker ist als hochdekorierter Ausdauersportler in Erscheinung getreten.
Eine weitere inoffizielle Umbenennung
– die Hindenburgstr. anlässlich des 130. Geburtstagesvon Walter Krämer in Walter-Krämer-Str: https://www.instagram.com/p/Ce53Iv5sDi5/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 30.5. – 20.6.2022 | siwiarchiv.de
Link zu einem der ehemaligen „Untermieter“ des Kreisarchivs:
Heute erschien in der Siegener Zeitung ein Leserbrief, der fordert, die „Korrekturen vor(zu)nehmen „.
Heute im Print der Westfälischen Rundschau ein Artikel zum Thema: „Nazi-Namen für Straßen: Das sagt Siegens Bürgermeister Mues. „Da sind Namen dabei, die muss man nicht auf Straßenschildern lesen“, sagt der Bürgermeister – gibt aber auch zu bedenken: Wo wird die Grenze gezogen, wenn es um belastete Personen geht?“
Ein Beitrag zur Debatte
https://57politik.org/2022/06/22/zur-debatte-umbenennung-von-strasennamen-in-siegen/
Vielen Dank für den Link! Ich wünsche dem Beitrag ein breite und sachliche Diskussion.
Link zum aktuellen Blogeintrag „„Verschickungskinder“ als Archivnutzende. Anforderungen an und Auswirkungen auf das deutsche Archivwesen und seine Kundinnen und Kunden“: https://archivamt.hypotheses.org/16603
Pingback: Archivisches im NRW-Koalitionsvertrag 2022-2027 | siwiarchiv.de
Nach meinem Kenntnisstand ist das Landesarchivgesetz NRW immer noch nicht auf die DSGVO angepasst worden. Ist das immer noch der Stand? Wenn ja, würde das Kulturgesetz diesen Makel ausmerzen?
Das Archivgesetz ist tatsächlich noch auf dem Stand vor der EU-DSGVO. Wenn ich es recht überblicke, wird dieser unhaltbare Zustand nicht durch die Eingliederung als eigenständiges Gesetz in das Kulturgesetzbuch – das eher die Förderung von Kultur regelt – aufgehoben. Zudem ist die NRW-Archivcommunity gegen eine Eingliederung in das Kulturgesetzbuch. Salopp formuliert sind Archive nicht nur Kultureinrichtungen, sondern auch Verwaltungseinrichtungen. Auch eine Nähe zu Informationsfreiheitsgesetzen mit ihren Friktionen findet so eher keine Lösung.
Pingback: NRW-Koalition will Archivgesetz neufassen – Archivalia
Vor einigen Jahren im Siegener Stadtarchiv: Ein älterer Hobby-Stammbaum-Forscher störte die archivische Arbeitsatmosphäre, indem er einem anderen Hobby-Genealogen („Genitalogen“, wie mein früherer Chef zu lästern pflegte) quer durch den Lesesaal zurief „Ich bin ja sehr von Lothar Irle beeinflusst …!“ Der für meinen Geschmack etwas großkotzig auftretende Herr, der sich sicherlich für einen einigermaßen repräsentativen Siegerländer hielt, dürfte eine klare Meinung zum Thema der Straßenumbenennungen gehabt haben.
In einer gegensätzlichen Meinungsäußerung heißt es nun: „Wir Nachgeborenen erheben uns moralisch und urteilen im Lichte heutiger Maßstäbe. Und werden dazu Schilder stürmen.“ Das könnte zum krönenden Abschluss der „Diskussionen“ erklärt werden, denn mit dem Verweis auf eigene moralische Überlegenheit lässt sich nur noch Klassenkampf betreiben, keine von gemeinschaftlichem Interesse (um nicht zu sagen von Neugier) getragene Erkenntnissuche. Man mag bedauern, dass die sich im Alleinbesitz „heutiger Maßstäbe“ glaubende Partei nichts Interessanteres aufzubieten hat. Fragbares und Fragwürdiges, dem die Stimmführer beider Lager bisher aus dem Wege gegangen sind, ließe sich ja durchaus noch entdecken und in echte Diskussionen einbringen. Ebenso bedauerlich ist, dass sich die Opponentenseite beharrlich der Einsicht verweigert, hier in mehr als ein bloß von wichtigtuerischen Querulanten erfundenes Scheinproblem hineingezogen worden zu sein. Wenn sich auch die meisten Siegener momentan wohl um existenziell Näherliegendes sorgen als um Straßennamen, so zeigt doch die weltweit zu beobachtende Infragestellung alter erinnerungskultureller Verbindlichkeiten, dass dem vielbeschworenen „Zeitgeist“ Besseres angemessen wäre, als sich ihm mit permanentem Herumeiern und zeitschindendem Taktieren entgegenzustellen. Daraus kann sich niemals ein Konsens für praktikable Entscheidungen ergeben (das Risiko einer teuren und aufwändigen Bevölkerungsbefragung als ergebnisoffenes Mittel „direkter Demokratie“ wird vermutlich keine der Parteien eingehen wollen). Vielleicht wird es ja irgendwann sogar die eine oder andere Alibi-Umbenennung geben (was den überführten Sexualstraftäter Luckner wegen fehlender NSDAP-Mitgliedschaft nach jetzigem Klassifikationsstand schon mal nicht treffen würde); mehr ist von Diskussionen nicht zu erwarten, wenn sie durch parteidisziplinäre Rücksichten und dem Schielen nach Wählergunst kontaminiert werden, und der Zank wird sich ad infinitum fortsetzen. Herr Hellwig hat ja recht: Eine den wie immer zu definierenden „heutigen Maßstäben“ gerecht werdende Erinnerungskultur „setzt Bürgerinnen und Bürger voraus, die geschichtlich interessiert und sensibel sind“. Wenn er jedoch fortfährt „und die schweigen derzeit“, muss man ihm in diesem gerade noch durchklingenden Optimismus nicht folgen: Vielleicht gibt es diese Bürgerinnen und Bürger, die er zum Reden bringen möchte, ja gar nicht. Der Mensch ist ein gegenwartsorientiertes und schon mit deutlichen Abstrichen zukunftsorientiertes Wesen. Aber wie hält er es (abgesehen von den paar Historikern und nostalgischen Lebensuntüchtigen) mit der Vergangenheit? Es ist ein anthropologisches Problem, dass sicherlich nicht die kommunalen Gremien der Stadt Siegen oder eine von ihnen eingesetzte Arbeitsgemeinschaft lösen werden. Den Resignierenden bleibt der Trost: „Jede Stadtbevölkerung hat die Erinnerungskultur, die sie verdient.“
Es ist trivial, „im Lichte heutiger Maßstäbe“ urteilen zu wollen, denn das beanspruchen ohnehin alle für sich: Die „Progressiven“ (im weitesten Sinne) sowieso, aber auch die „Konservativen“ (wieder im weitesten Sinne), wenn sie ihre heute angelegten Maßstäbe mehr oder weniger evolutionär aus den früheren ableiten. In einer Grundannahme stimmen die „linken Revoluzzer“ und „rechten Ewiggestrigen“ (wie die Kontrahenten sich ja gern gegenseitig diffamieren) anscheinend überein: Straßen, Plätze, Gebäude, Eisenbahnzüge usw. mit den Namen historischer Personen zu versehen, sei in diesem 21. Jahrhundert, wie schon im 19., ein unverzichtbares Instrument von „Erinnerungskultur“. Und eben dieses Axiom kann in Frage gestellt werden.
Straßenbenennungen im späteren 19. Jahrhundert dienten, wie das Aufstellen martialischer Denkmäler, der politischen Demonstration und Vergewisserung urbaner Einigkeit. Die auf Straßenschildern zur Schau gestellte Obrigkeits- und Vaterlandstreue waren weitgehend störungsfrei auslebbare mentale Realitäten. Zur politischen und militärischen „Heldenverehrung“ gesellte sich die spezifisch bildungsbürgerliche: Selbstverständlich gehörte eine Goethestraße ins Stadtbild, wo in den „guten Stuben“ die wohlfeile und hübsch gebundene Goethe-Gesamtausgabe zwecks Demonstration eigener Aufgeklärtheit museal präsentiert wurde. (Zum Lesen hatte man ja die Zeitung.) Dass gründerzeitlicher Helden- und Personenkult anderthalb Jahrhunderte später keinen unbedingten Konsens mehr finden, ist immerhin erfreulich. Fruchtbarer wäre es freilich gewesen, sich nach den Erfahrungen zweier Weltkriege frühzeitig zu einem Paradigmenwechsel durchringen zu können, anstatt eine hohle, billige Form sogenannter „Ehrung“ weiter zu hofieren.
Vermutlich die für den Haardter Berg in Weidenau vorgesehene Zukunft als Hochschulstandort war das Motiv dafür, die neu angelegten Straßen der seit den 1960er Jahren entstandenen Wohnsiedlung nicht idyllisch nach Blumen, Käfern oder Bäumen zu benennen, sondern nach historischen Personen aus dem kulturellen Bereich: Brüder Grimm, Novalis, Rilke, Bruckner, Schumann, Riemenschneider, Dürer usw. Auf Politiker verzichtete man. Den Architekten Paul Bonatz würde man heute eher nicht mehr wählen und Richard Wagner vielleicht auch nicht, aber insgesamt kann das Ensemble wohl kaum als anrüchig gelten. Dennoch die Frage: Worin besteht hier die „Ehrung“? Und warum gab man gerade den ausgesuchten Persönlichkeiten, von denen ja meines Wissens keine einzige irgendwelche Beziehungen zum Siegerland hatte, Vorrang vor den zahllosen anderen ehrenwerten, die in Frage gekommen wären? Wenn es schon sein sollte, warum dann nicht auf Vorbilder ein wenig abseits vom bildungsbürgerlichen Mainstream zurückgreifen? War es wieder nur die gleiche alte Intention: „Bewährten Helden“ ein Denkmal setzen – zum Beweis, dass man als erfolgreicher Schulabsolvent ihre Namen parat hatte, ohne sich auf ihr Erbe ernsthaft einlassen zu müssen? Was hat es mit Friedrich Hölderlins Leben und Werk zu tun, dass sein Name einer Straße am Haardter Berg aufgepfropft wurde? Ist den Benennungs-Fanatikern jemals der Gedanke gekommen, dass er (wie viele andere ungefragte Namenspatrone) sich eine solche plumpe postume Verewigung vielleicht aus guten Gründen verbeten hätte? Und was die „politische Korrektheit“ der heutigen Weltenretter angeht: Will man den türkischstämmigen Anwohnern der Hölderlinstraße zumuten, dass dieselbe den Namen eines Dichters trägt, der in den griechisch-türkischen Konflikten seiner Zeit ganz gewiss nicht mit den osmanischen Besatzern sympathisiert hatte? Also umbenennen? Natürlich nicht! Aber vielleicht jetzt endlich damit anfangen, die anachronistische Praxis von Objektbenennungen, welche ohnehin oft nur von kleinen Interessentengruppen lanciert werden, ein für allemal aufzugeben. Diese Angewohnheit war ein historisches Phänomen, das schon allein deshalb nicht in Vergessenheit geraten wird, weil seine Auswirkungen aus pragmatischen Gründen (abgesehen hoffentlich von ein paar Ausnahmen) nicht konsequent rückgängig zu machen sind. Man muss aber „im Lichte heutiger Maßstäbe“ nicht noch länger daran festhalten. Wie neulich schon ein Zeitungskommentator anregte: Es gibt noch ein riesiges Reservoir potentieller Namen aus der Tier- und Pflanzenwelt, aus dem man bei Um- oder Neubenennungen schöpfen könnte. Fangen wir doch einfach mit dem Abarbeiten der „Roten Listen“ an – immerhin hätte das dann auch einen gewissen ernsthaften Bezug zum Treiben der Menschheit.
Niemand wird jedoch so naiv sein zu glauben, dass eine solche Alternative in den diskussionsfreudigen Gremien jemals Anklang finden könnte. Schließlich gibt es genug gute Menschen, die sich für so ehrbar halten, dass sie der späteren Benennung einer Straße nach sich selbst wahrscheinlich nicht abgeneigt wären und, da dies voraussichtlich nie erfolgen wird, dann wenigstens den Namen einer/s der Ihren auf dem nächsten frei werdenden Schild lesen möchten. So fällt wenigstens noch ein schwacher Abglanz des Ruhmes auf sie. Logisch und taktisch klug wird dabei eher nicht argumentiert. Wie will man denn jemandem die Peinlichkeiten der Irle-Stoecker-Fissmer-Beweihräucherung bewusst machen, wenn man selbst bei der ersten sich bietenden Gelegenheit die Benennung eines vakanten Platzes in Weidenau nach einem mit Sicherheit wieder polarisierenden Kandidaten durchsetzt? Man hat damit nicht nur eine Person auf den Sockel gehoben, die in ihrer menschlichen Integrität sicherlich nachstrebenswert ist, sondern zugleich den Funktionär und Parlamentsabgeordneten einer Partei, die am Vorabend der NS-Diktatur nun wahrlich keine Ruhmesrolle in der deutschen Politik gespielt hatte (einschließlich antisemitischer Entgleisungen) und deren Kurs jeder in ihrer Hierarchie Aufgestiegene wenigstens „moralisch“ mit zu verantworten hatte. Es war ja schon zu lesen: Verdienste und Verfehlungen können und sollen nicht gegeneinander aufgerechnet werden. Das gilt dann aber für beide Lager. Doppelzüngigkeit ist es auch, wenn eine der Fraktionen mit der angeblich „immensen Belastung der betroffenen Anwohner und Betriebe“ durch Straßenumbenennungen Stimmung zu machen versucht, wo man sich doch sicher sein darf, dass ihr dieses dümmliche „Argument“ nicht mehr einfallen würde, stände etwa die Umbenennung der Kohlbettstraße in Helmut-Kohl-Straße zur Debatte.
Als nächstes sollen ja die Frauen zu ihrem Recht kommen; lange Listen sind schon im Umlauf. Zweifellos sind Frauen irgendwie die besseren Menschen. Dann aber auch irgendwie ganz normale. Es bleibt zu hoffen – da der Benennungs-Unfug nun einmal nicht enden wird – dass hier nicht wieder vorschnell Entscheidungen getroffen werden, die in drei, zehn oder fünfzig Jahren zu neuem Katzenjammer führen, wenn dann Historiker tiefer graben und das im Moment vielleicht glänzende Bild der Geehrten trüben. Männliche Dumpfbacken vom unverdienten Sockel zu stoßen, mag einen gewissen sportlichen Reiz haben; bei Frauen, wenn sie erst einmal dort hingestellt wurden, wäre es unritterlich. Das wollen wir doch nicht.
„Ehre nur, wem Ehre gebührt“, fordert Herr Hellwig ganz zu recht und von jedem unterschreibbar. Man könnte variieren: „Ehre allen, denen Ehre gebührt“ – aber bitte nicht durch oberflächliche Benennungszeremonien und Lippenbekenntnisse zum Ausdruck gebracht, sondern durch tätiges Anknüpfen an die als ehrenwert eingeschätzten Absichten und Leistungen jener Personen. Und, da Ehrwürdigkeit in keinem proportionalen Verhältnis zu Prominenz steht: „Gebührende Ehre den Namenlosen in gleichem Maße wie den Namhaften!“
Pingback: Edith Langner (1913 – 1986) – eine Kandidatin für eine Strassenbenennung in Siegen | siwiarchiv.de
Pingback: Edith Langner (1913 – 1986) – eine Kandidatin für eine Strassenbenennung in Siegen | siwiarchiv.de
Pingback: Edith Langner (1913 – 1986) – eine Kandidatin für eine Strassenbenennung in Siegen | siwiarchiv.de
„Auch im Koalitionsvertrag von CDU und Grünen in Schleswig-Holstein finden Archive marginale Erwähnung:
„Mit der Erweiterung des Landesarchivs sorgen wir für den dauerhaften Erhalt wertvoller Quellen.“ (S. 49, Z. 1663f)“
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik Juni 2022 | siwiarchiv.de
Am 30.6. erschien in der Siegener Zeitungein Artikel, der die 7 Personen vorstellt, deren Strassennamen umbenannt werden sollen. Vor Allem auf der Facebook-Seite der Zeitung wurde auch dieser Artikel intensiv kommentiert.
Am 1. Juli üpostete die Stadtratsfraktion der Grünen zum Thema auf Facebook u. a. Folgendes: “ …. Eine #Umbenennung sollte nun zeitnah erfolgen. Bedeutende Frauennamen aus Siegen könnten dafür einen guten und würdigen Ersatz bieten. Die Anwohner:innen der betroffenen Straßen sollten von den bürokratischen Folgen entlastet werden und sollten umfassend informiert werden.
Das weitere Vorgehen wird in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 31.08. beraten. ….“
Am 3.7. postet die Volt-Wittgenstein auf Facebook ebenfalls zum Thema u. a.: “ …. Es gibt in der Politik aktuell keine Einigkeit über den Umgang mit den Straßennamen. Unter anderem die @cdufraktionsiegen möchte alle vom Arbeitskreis zur Umbenennung vorgeschlagenen Straßen in Kategorie B verschieben. Wenn man der Definition von „Kategorie B“ folgt, sind die Belastungen dieser Personen „weniger gravierend“, allerdings „kritisch zu kommentieren“. Diese Form der Geschichtsklitterung konterkariert den von allen Mitgliedern des Arbeitskreises (aus jeder Fraktion ein Mitglied) getragenen Abschlussbericht und befördert, dass Mitglieder des selben Arbeitskreises nun zum Teil bedroht und/oder beleidigt werden. ….“
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 21.6. – 3.7.2022 | siwiarchiv.de
Manu Köninger (Grüne Siegen) zur Veranstaltung: https://manu-koeninger.de/2022/05/05/dialogforum-strassenumbenennung-suedwestfalen/
Pingback: Stadt Bad Laasphe killt Radiomuseum – Archivalia
Heute erschienen in der Siegener Zeitung 2 weitere umbenennungskritische Leserbriefe: „Unsägliche Diskussion“ und „Genug blamiert“.
Niederschrift der Beratung des Abschlussberichts im Kulturausschuss am 25.5.2022 ist online (S. 7 – 9):
“ …. Frau I. Schmidt teilt im Namen der CDU-Fraktion mit, man sei gegen jegliche Straßenumbenennung, um das Vergessen zu verhindern und an der Aufklärung teilzuhaben. Die in Kategorie A genannten Straßennamen sollen daher in Kategorie B verschoben werden. Man werde für den HFA beantragen, dass alle Straßen in der Stadt Siegen nach und nach mit einem Hinweisschild (Text oder auch QR-Code) versehen werden sollen.
Den Vorschlag der CDU, alle Straßen mit einem Hinweisschild zu versehen, bewerte man positiv, so Frau Schwarz. Allerdings spreche sich die SPD-Fraktion für die Umbenennung der „Lothar-Irle-Straße“, der „Stoeckerstraße“ und der „Hindenburgstraße“ aus.
Frau Fries gibt eine umfangreiche Rückschau zu dem Thema und geht insbesondere auf die Persönlichkeit Adolf Wurmbach ein.
Der Meinung der CDU-Fraktion schließe man sich vollumfänglich an, so Frau Bialowons-Sting. Man könne ein Stück Zeitgeschehen nicht durch das Umbenennen von Straßen auslöschen, sondern solle die Bürgerinnen und Bürger mit entsprechenden Hinweistafeln erinnern.
Herr Dietrich spricht sich im Namen der Volt-Fraktion für eine Umbenennung der Straßen aus. Es gebe genügend Organisationen und Bewegungen in Siegen, die dafür Sorge tragen, dass nicht vergessen werde. Er greift nochmals die von Frau Fries beleuchtete Wurmbach-Thematik auf. Wurmbach sei ein gutes Beispiel dafür, wie die Widersprüchlichkeit einer Person mittels eine großen Infotafel angemessen gewürdigt werden könne.
Die CDU-Fraktion schlage vor, die Liste potenzieller weiblicher Personen für Straßennamen (s. Abschlussbericht S. 7) um die Namen „Carmen Klein“ und „Edith Langer“ zu ergänzen, so Herr Dr. Zybill.
Seitens der SPD-Fraktion wird von Frau Schwarzer außerdem die Erweiterung dieser Liste umden Namen „Waldtraud Steinhauer“ gebeten.
Herr Dr. Sturm weist aufgrund der Wortbeiträge seitens der CDU- sowie GfS-Fraktion darauf hin, dass laut einem Papier des Deutschen Städtetags aus 1980 mit einer Straßenbenennung explizit eine Ehrung und keine Mahnung verbunden sei.
Herr Hellwig stellt am Beispiel Karl Barich dar, dass es zu den Bewertungen des Arbeitskreises durchaus noch politischen Diskussionsbedarf geben könne. Diesem sowie dem Diskussionsbedarf in der Bürgerschaft solle man Raum geben und daher die Entscheidungen durch den HFA und Rat noch nicht in den Juni-Sitzungen treffen lassen. Er spricht sich außerdem
für ein Servicepaket für Bürgerinnen und Bürger aus, die von Straßenumbenennung betroffen seien.
Den Vorschlag, zunächst ein Echo aus der Bürgerschaft abzuwarten, befürwortet Frau Eger-Kahleis. Generell spricht sie sich eher gegen eine Straßenumbenennung und für Hinweisschilder aus, auf denen überwiegend das positive Wirken der Personen benannt werden solle.
Frau L. Schmidt gibt bekannt, die Grünen-Fraktion befürworte den Abschlussbericht des Arbeitskreises ausdrücklich sowie auch den Vorschlag, mehr Straßen nach Frauen zu benennen. Sie regt an, Bürgerversammlungen insbesondere für die von Umbenennung betroffenen
Bürgerinnen und Bürgern zu initiieren.
Frau A. Schneider fasst die Wortbeiträge zu den folgenden abstimmungswürdigen Vorschlägen zusammen:
– Vorschlag CDU, dass die Straßen in Kategorie A in Kategorie B übergesiedelt werden sollen
– Vorschlag SPD, dass nur drei Straßen umbenannt werden sollen
– Vorschlag CDU und SPD, dass drei weitere Frauennamen in die Liste der potentiellen Straßennamen aufgenommen werden sollen
– Vorschlag B‘90/Grüne, dass Bürgerbeteiligung stattfinden soll
Sie merkt außerdem an, dass der in der Vorlage aufgeführte Beschlussvorschlag auch eine Empfehlung über das weitere Vorgehen des Arbeitskreises seitens des KultA vorsehe.
Frau Gelling spricht sich für die Weiterarbeit des Arbeitskreises sowie die Verschiebung der Thematik im HFA und Rat aus, damit Zeit für ausführliche Bürgerbeteiligung bleibe.
Frau A. Schneider schlägt vor, den Ältestenrat in die Diskussion einzubinden, damit dieser diePunkte aus dem KultA nochmals aufgreifen, vermitteln und insbesondere die Empfehlung weitergeben könne, das Thema in HFA und Rat bis nach die Sommerpause zu vertagen.
Nach Diskussion darüber, in welcher Form der Kulturausschuss am besten die gewünschten Empfehlungen an die in der Beratungsfolge nachfolgenden Gremien weitergeben solle, einigt sich das Gremium auf folgenden Beschlussvorschlag, über den Frau Bialowons-Sting abstimmen lässt.
Beschlussvorschlag:
Der Kulturausschuss empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss sowie dem Rat der Universitätsstadt Siegen, die Entscheidung über den Abschlussbericht des Arbeitskreises „Aufarbeitung der historischen Hintergründe von Straßennamen“ sowie das darin empfohlene weitere
Vorgehen zu vertagen, damit eine Bürgerbeteiligung stattfinden kann.
Der Kulturausschuss bittet den Ältestenrat darum, bei der Thematik als Vermittler zu fungieren.
Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, eine Enthaltung (CDU) ….“
Link zur PDF-Datei: http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10120
– Zusammenführen, was zusammengehört:
Die erste Mitgliederversammlung in Bad Sassendorf, Heft 6/22, S. 301-303 [Erich Moning, Wahl in den Finanzausschuss des Deutschen Landkreistages, 25. Juni 1947, S. 301]
Das Zitat stammt aus: G. F. Christian Wendelstadt: Der Kreis Siegen im Jahre 1817, herausgegeben von Wilhelm Güthling, Siegen 1962, S. 19. Ursprünglich war der Text unter dem Titel „Durchflug durch’s Fürstenthum Siegen“ 1817 in Dortmund erschienen.
Gratulation die Antwort ist vollkommen korrekt!
Heute erschienen in der Siegener Zeitung 3 weitere umbenennungskritische Leserbriefe:“Wichtigeres zu tun“, „Geisterjäger“ und Pharisäerhaft“.
Heute ist ein weiterer Leserbrief, der die Umbenennungen kritisch sieht, in der Siegener Zeitung erschienen: „Mit Unfug befasst“
Ein blätterbares PDF der Broschüre findet sich hier: https://siegen-wittgenstein.1kcloud.com/ep162c7da30ace2b/#0
Eine blätterbare PDF-Datei der Broschüre von Wolfgang Haupt zur Frühgeschichte des Orchesters findet sich hier: https://siegen-wittgenstein.1kcloud.com/ep162c7da308a35a/#0
Zur Familiengeschichte Betzs s. https://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=hickengrund&ID=I23075&nachname=Betz&modus=&lang=de
Eitel Klein (Diss. phil., MR, 1936) Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Grafschaft Sayn-Wittgenstein-Hohenstein… wäre mein erster Tipp.
Leider nein. Aber ein guter erster Versuch.
Kleiner Tipp: das Zitat ist älter.
Natürlich ist es älter. Ich hätte das Zitat dem Freiherrn Vincke beim Übergang Wittgensteins von Hessen-Darmstadt an Preußen zugeordnet. Er hatte ja damals Staatskanzler Fürst von Hardenberg über den Zustand der Grafschaften Bericht erstattet. Jedoch fand ich bisher in meinen Büchern keine wörtliche Übereinstimmung mit dem Zitat.
Die Fundstelle des Zitats ist wesentlich jünger.
Einige Zuschriften Engels‘ (und weiterer Siegerländer Mitglieder) an die Mineralogische Sozietät zu Jena befinden sich im dortigen Universitätsarchiv und sind inzwischen digitalisiert zugänglich. Erweiterte Suchmaske:
https://archive.thulb.uni-jena.de/uaj/templates/master/template_uaj2/index.xml?XSL.DisplayExdendedSearch=true
Vielen Dank für den Hinweis! Eigentlich wollte ich nur kurz einige Angaben zum dem im 1. Teil des diesjährigen Sommerrätsels – https://www.siwiarchiv.de/siwiarchiv-sommerraetsel-2022/ – auftauchenden Engels gegeben haben, aber eine erneute Beschäftigung scheint ja lohnenswert zu sein.
In der heutigen Print-Ausgabe der Siegner Zeitung erschienen 2 Leserbriefe: „Locker bleiben“ empfiehlt eine die Umbenennungen befürwortende Einsendung, demgegenüber empfindet der ablehnende Leserbrief die Umbenennungen als „Ersatzbeschäftigung“.
Pingback: 20. Juli 1944: Beteiligte und Betroffene aus dem Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein | siwiarchiv.de
Pingback: 20. Juli 1944: Beteiligte und Betroffene aus dem Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 4.7. – 17.7.2022 | siwiarchiv.de
Quelle: Rhein und Ruhrzeitung, 15. November 1938
Quelle: Rhein- und Ruhrzeitung, 29. Januar 1940
evt. stammt das Zitat aus: Festschrift zur Einweihung des Kreishauses des Kreises Siegen am 3. November 1903, Berlin 1903.
Das alte Kreishaus war doch keine Wohlfahrtseinrichtung ;-) – also leider nein.
Pingback: Architektur 1960+, Brutalismus im Kreisgebiet: Evangelische Kreuzkirche in Kreuztal | siwiarchiv.de
Pingback: Architektur 1960+, Brutalismus im Kreisgebiet: Evangelische Kreuzkirche in Kreuztal | siwiarchiv.de
Pingback: Architektur 1960+, Brutalismus im Kreisgebiet: Evangelische Kreuzkirche in Kreuztal | siwiarchiv.de
Pingback: 20. Juli 1944: Beteiligte und Betroffene aus dem Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein | siwiarchiv.de
Pingback: 20. Juli 1944: Beteiligte und Betroffene aus dem Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein | siwiarchiv.de
Es dürfte sich um die Einweihung der Siegener Blindenwerkstatt handeln.
Danke für den Versuch – aber auch darum handelt es sich nicht. Der Wohlfahrtsbegriff ist heute in diesem Zusammenhang nicht mehr gebräuchlich.
Schuss ins Blaue: Einweihung des Reichs-Post- und Telegraphenamtes am 20. Juni 1894.
Im „Duell“ der regionalen, archivischen Ruheständler würde ich sagen: ein Treffer ins Schwarze – Gratulation! Das gesuchte Zitat befindet sich auf S. 18 dieser Publikation:
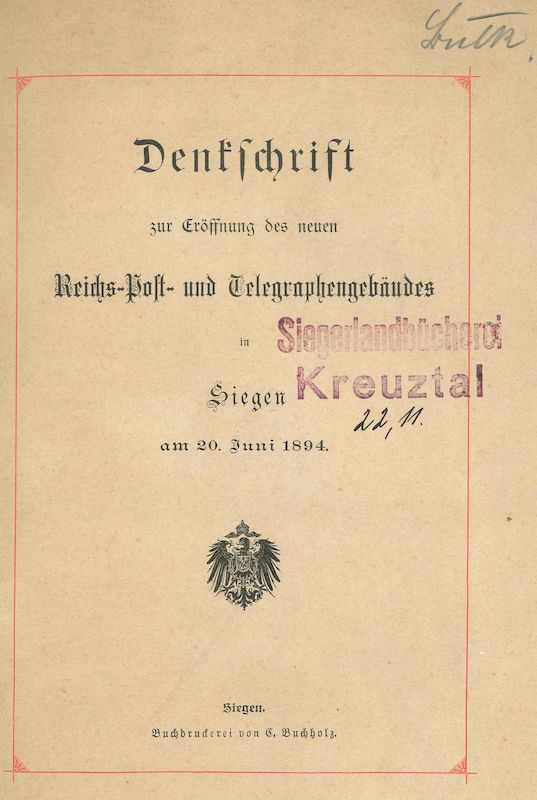
Pingback: Online: Übernahme der Unterlagen der Fraktionen des Stadtrats | siwiarchiv.de
Pingback: 20. Juli 1944: Beteiligte und Betroffene aus dem Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein | siwiarchiv.de
In der heutigen Print-Ausgabe der Siegner Zeitung erschienen 3 Leserbriefe (S 9; übrigens auf der gegenüberliegende Seite 8 erschien ein Beitrag zu Ehrung von Siegfried Betz):
„Nicht nur Mitläufer“ befürwortet die Umbenennungen, während „Krönchen entfernen“, auf die koloniale Vergangenheit Johann Moritz zu Nassau-Siegen anspielend, und „Geschehen lassen“ gegen Umbennenungen eintreten.
Pingback: Zauberhaftes aus dem Kreisarchiv: Bellachini und Siegen | siwiarchiv.de
Auf folgenden Artikel in der Thorner Presse vom 3. März 1901 (S. 3) verweist Peter Kunzmann via E-Mail:
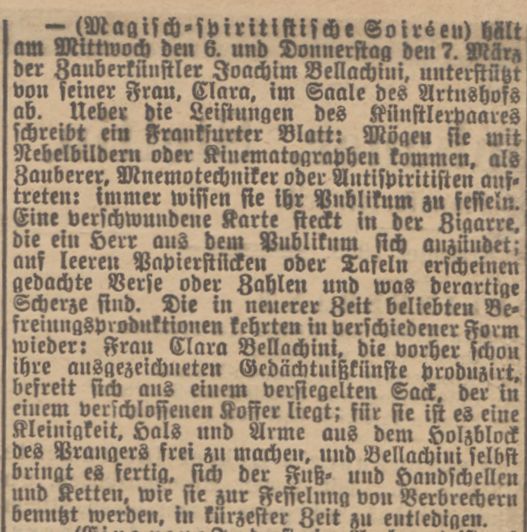
Sterberegister 1901 Stadt Frankfurt/Main, Standesamt I:
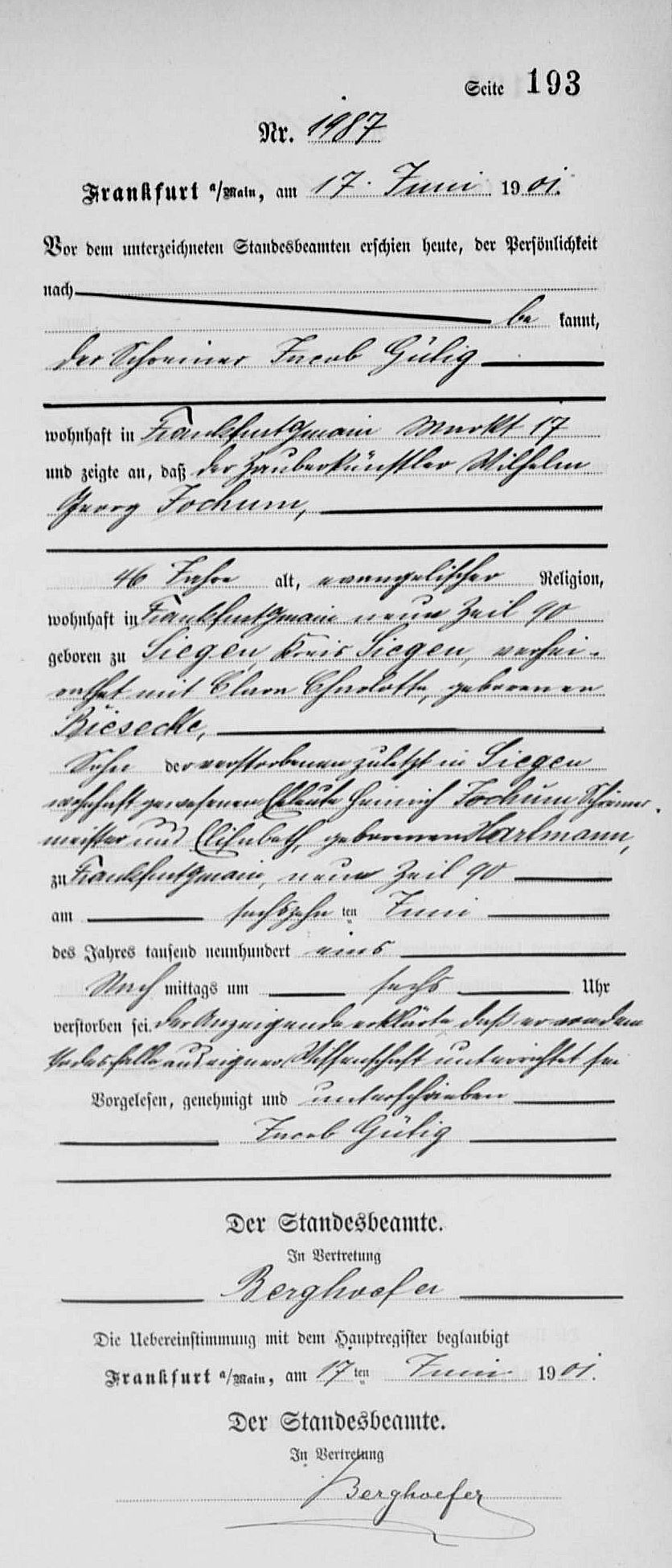
Quelle: Hessisches Staatsarchiv Marburg 903 Nr. 10551
Dem ersten (?) Siegener Adressbuch zufolge gab es 1879 in der Stadt Siegen keinen Schreinermeister Jochum (bzw. die Witwe desselben). Also beide Elternteile schon verstorben? Auch kein anderer Sohn vorhanden, der die Werkstatt übernommen hätte? Zu korrigieren ist wohl die Angabe „Bis zu seinem 14. Lebensjahr war er als Sekretär an der Steuerkasse in Siegen tätig“. Vielleicht bloß ein Druckfehler; gemeint „24“? Taucht sein Name im Schülerverzeichnis von Kruses Realschul-Geschichte auf (wenn ja, mit welchem Abgangsjahr)? Lassen sich im Siegener Kreisblatt Anzeigen von frühen Auftritten Jochums als Amateur-Zauberer in seiner Heimatstadt finden? Fragen über Fragen …
… Und die hilfreichen Geister im Stadtarchiv Siegen könnten einmal den in der „Siegener Zeitung“ 1901 erschienenen Nachruf heraussuchen …
Wrede, Günter.: Territorialgeschichte der Grafschaft Wittgenstein, Marburg 1927 (Diss. phil.)
Leider ist dies nicht richtig.
Niederschrift der 9. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Rates der Stadt Siegen vom 08.06.2022, Seite 3 – 5, ist online:
„TOP 4. Abschlussbericht des Arbeitskreises „Aufarbeitung der historischen Hintergründevon Straßennamen“:
Herr Groß dankt dem Arbeitskreis für seine Arbeit. Es ist nun die Aufgabe des Rates zu beraten, welche Straßen zur Umbenennung in Betracht kommen und vor allem, wie eine Bürgerbeteiligung aussehen kann. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen kann sich vorstellen, alle in der Kategorie A aufgeführten Straßen umzubenennen.
Herr Schiltz schließt sich für die SPD-Fraktion dem Dank an. Die Überlegungen zur Umbenennung würden in der Öffentlichkeit und besonders bei den Anliegern der in Rede stehenden Straßen sehr kontrovers diskutiert. Per Definition stelle die Benennung von Straßen nach Persönlichkeiten eine Ehrung dieser dar. Daher kommen Personen mit einer antisemitischen oder nationalsozialistischen Geschichte per se nicht in Betracht.
Die SPD-Fraktion stellt daher den Antrag
– Umbenennung der Hindenburgstraße, Stoeckerstraße und Lothar-Irle-Straße
– Verschiebung der weiteren in Kategorie A aufgeführten Adolf-Wagner-Straße und Bergfrieder Straße in Kategorie B, da die vorliegenden Informationen über die Persönlichkeiten nicht ausreichen. Weiterer Erkenntnisse sollten abgewartet werden.
Bei den Herren Porsche und Diem handelt es sich um sehr ambivalente Personen, die ebenfalls unter die Kategorie B fallen sollten.
Den übrigen Empfehlungen des Arbeitskreises stimmt die SPD-Fraktion zu, wie auch dem Vorschlag, Bürgerversammlungen und Bürgerinformationen für die drei umzubenennenden Straßen durchzuführen.
Auch die CDU-Fraktion dankt dem Arbeitskreis für seine Arbeit, erklärt Herr Marc Klein, bewertet die Ergebnisse aber anders und möchte keine Umbenennungen vornehmen. Vielmehr wird beantragt, die in Kategorie A genannten Straßen nach Kategorie B zu überführen und mehr als bisher über die Personen aufzuklären. Die Straßen wurden erst 1975 im Zuge der kommunalen Neuordnung benannt, lange nach dem Ende des zweiten Weltkrieges. In der Zwischenzeit hatten diese Personen Auszeichnungen für andere Verdienste erhalten. Daneben ist die Belastung der potenziell Betroffenen bei einer Umbenennung zu bewerten. Diesbezüglich ist ein Service-Paket für Verwaltungsdienstleistungen nicht ausreichend, da ein weit höherer Aufwand betrieben werden müsste.
Die CDU-Fraktion beantragt zusammenfassend, keine Umbenennungen vorzunehmen und sukzessive in allen nach Personen benannten Straßen Schilder mit entsprechenden Erläuterungen zu ihrer Vita zu versehen.
Herr Henning Klein erklärt, dass sich die Fraktion Die Linke dem entgegen für eine umfassende Umbenennung ausspricht. Zu dem Einwand, der Aufwand sei zu groß, ist auf die Umbenennung der Wildrosenallee zu verweisen, die geräuschlos und ohne Bedenken vollzogen wurde. Er möchte des Weiteren die Anregung des Kulturausschusses aufgreifen, noch andere Fachleute einzubinden und keine eine parteipolitisch geprägte Mehrheitsentscheidung zu treffen.
Das Projekt war nach Einschätzung von Herrn Bertelmann sehr anspruchsvoll und vielschichtig. Ein Richtig oder Falsch gibt es seines Erachtens nicht. Die UWG-Fraktion hält es für zielführend, dem Vorschlag des Fachausschusses zu folgen, die Entscheidung zu vertagen und ist nicht bereit, an dieser Stelle über Festlegungen abzustimmen. Darüber hinaus stellt sich für ihn die Frage, wie für wen eine Bürgerbeteiligung erfolgen sollte und wie die Anlieger zu den Vorschlägen stehen.
Die FDP-Fraktion befürwortet den Vorschlag des Fachausschusses, so Herr Walter. In der Bevölkerung ist Unmut über die Diskussion festzustellen.
Die Volt-Fraktion steht hinter dem Vorschlag des Arbeitskreises erklärt Herr Wittenburg, kann sich aber auch den Argumenten für die Empfehlung des Fachausschusses anschließen. Herr Groß weist darauf hin, dass die Diskussion schon lange geführt wird und die Argumente gleichermaßen lange bekannt sind. Von einem Schnellschuss kann daher keine Rede sein. Bei einem generellen Nein hätte man den Aufwand nicht betreiben müssen. Eine Beratung im Ältestenrat hält er angesichts der vorgetragenen Positionen für schwierig.
Bürgermeister Mues wirft ein, Aufgabe des Arbeitskreises war die Hintergründe der Personen zu erkunden und Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Die Politik muss diesen nicht zwangsläufig folgen.
Herr Wittenburg stellt den Antrag, die Umbenennung der nach Hindenburg, Stoecker und Lothar-Irle benannten Straßen zu beschließen und alle weiteren einer erneuten Betrachtung zu unterziehen.
Herr Sondermann merkt an, dass er dem Vorschlag des Kulturausschusse hätte folgen können. Nach dem heutigen Verlauf der Diskussion lehnt die GfS-Fraktion eine Umbenennung ab. Der Arbeitskreis hat sehr gut und ergebnisoffen beraten, die GfS-Fraktion erachtet aber die Schlüsse daraus für nicht richtig. Der Nutzen einer Umbenennung geht nicht einher mit dem Aufwand und der Akzeptanz der Anlieger.
Herr Bertelmann hält eine Bürgerbeteiligung in der Form für wichtig, die betroffenen Anlieger zu befragen und die Beweggründe für die Diskussion und die Vorschläge zu erklären. Er möchte keine reine Information.
Herr Groß sieht dagegen eine Bürgerbeteiligung nicht in der Befragung der Anlieger, wo das Ergebnis seines Erachtens absehbar ist. Vielmehr sollte das Thema in die Stadtgesellschaft getragen und die Frage gestellt werden, ob die Namen von Personen, die im Faschismus eine bedeutende Rolle innenhatten, beibehalten werden sollen. Er würde in Anbetracht der Diskussion den Vorschlag der SPD-Fraktion befürworten.
Frau Shirley verweist auf die in Zusammenhang mit der Untersuchung der historischen Hintergründe von Straßennamen ebenfalls diskutierte Frage der Präsenz von Frauen in der Stadtöffentlichkeit. Sie hält es für unglücklich, die beiden Themen zu verquicken.
Herr Tigges berichtet über den Unmut vieler Bewohnerinnen und Bewohner Kaan-Marienborns, nicht gefragt zu werden. Er ist erstaunt, dass sich eine Mehrheit über die Empfehlung des Kulturausschusses hinwegsetzen würde.
Bürgermeister Mues fasst die Diskussion und zusammen. Zu überlegen ist, in welcher Form eine Bürgerbeteiligung erfolgen kann. Mit dieser Frage könnten sich der Ältestenrat bzw. die Fraktionsvorsitzenden und die Verwaltung befassen. Wenn dazu eine Lösung gefunden ist sollte man versuchen, das Thema wieder aufzugreifen.
Herr Schiltz ist bereit, vor diesem Hintergrund den Antrag der SPD-Fraktion zurück zu ziehen. Er möchte aber vermeiden, das Projekt ohne Entscheidung im Sande verlaufen zu lassen.
Herr Groß hält es für richtig, einen zeitlichen Horizont für eine Entscheidung festzulegen.
Herr Marc Klein stellt mit dem Hinweis auf eine Bürgerbeteiligung den Antrag der CDU-Fraktion zunächst zurück.
Auch Herr Wittenburg zieht seinen Antrag zurück.
=> Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses sprechen sich dafür aus, die Entscheidung über den Abschlussbericht des Arbeitskreises „Aufarbeitung der historischen Hintergründe von Straßennamen“ bis zum Herbst 2022 zu vertagen. Auf der Ebene der Fraktionsvorsitzenden wird zunächst besprochen, auf welche Weise eine Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger erfolgen soll.“
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 18.7. – 31.7.2022 | siwiarchiv.de
Und einmal mehr wird private Initiative und der private Einsatz von Menschen für die Kultur einer Region und für den Erhalt historischen Gutes und historischen Wissens durch Sparzwänge zunichtegemacht. Ist es denn wirklich gewollt, solche Initiativen von vorneherein zu unterbinden? Wer will sich noch persönlich mit Idee und Tat für eine öffentliche Sache einsetzen, wenn immer wieder mit dem finanziellen Zeigefinger argumentiert wird, statt selbst nach Lösungen zu suchen und in der Kommunikation mit den Machern und Schaffenden zu bleiben? Welche Signale sollen hier ausgesendet werden? Etwas so etwas wie: „Ja, mach etwas für unsere Kultur und unsere Region, die uns Besucher in die Gastronomie und in die Stadt bringen, aber erwarte von uns dafür weder Gegenleistungen noch Verbindlichkeit!“
Schade, dass die Stadtväter und Stadtmütter offenbar nicht über den Tellerrand der Kosten hinaussehen können. Verein und Vertreter aus Kultur und Stadtverwaltung sollten sich Zeit nehmen, um Konzepte zu überlegen, die einen Kompromiss in den Interessen darstellen können und das sollte nicht am Schreibtisch passieren, sondern in neutral moderierten, gemeinsamen Gesprächen.
Danke für den Kommentar! In der Zwischenzeit scheint sich hoffentlich eine regionale Lösung anzubahnen. Zumindestens gibt es laut Radio Siegen vom 13.7.2022 Gespräche zwischen dem Radiomuseum und dem Bunker Erich in Erndtebrück
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik Juli 2022 | siwiarchiv.de
Im Stadtarchiv Krefeld gibt es neben den genannten Unterlagen eine Personalakte (Signatur 60/1338) zu Dresler sowie ein Foto vom ihm aus dem Jahr 1949, eine Mappe in der Zeitungsausschnittsammlung (StAKR 46/1378) und natürlich noch ein paar Treffer in der Aktenüberlieferung des Kaiser-Wilhelm-Museums.
Vielen Dank fürs Nachschauen! Da lohnt sich ein weiteres Nachforschen.
– Weichenstellungen im Sommer 1947:
Richtungsentscheidungen im Vorstand
des Landkreistags, Heft 7-8/22, S. 369-372 [Erich Moning, s. 369-370]
Pingback: Wow! Um das Sommerloch zu füllen, bietet das Kreisarchiv Siegen nun sogar “durchblätterbare PDFs”! – Archivalia
Pingback: Straßennamen: „Umbenennungswellen“ der letzten Jahrzehnte im Kreis Siegen-Wittgenstein? | siwiarchiv.de
Pingback: Straßennamen: „Umbenennungswellen“ der letzten Jahrzehnte im Kreis Siegen-Wittgenstein? | siwiarchiv.de
Pingback: Straßennamen: „Umbenennungswellen“ der letzten Jahrzehnte im Kreis Siegen-Wittgenstein? | siwiarchiv.de
Pingback: Straßennamen: „Umbenennungswellen“ der letzten Jahrzehnte im Kreis Siegen-Wittgenstein? | siwiarchiv.de
Zu historischen Straßenbenennungen in Siegen ist folgende Literatur einschlägig:
– Gerhard SCHOLL, Von der Pannengasse bis zur Basgonke. Streifzug durch Alt-Siegens Straßennamen, in: Unser Heimatland 1953, S. 55-56.
– Gerhard SCHOLL, Die Straßennamen der Stadt Siegen, in: Siegerland 31, Heft 1 (1954), S. 7-28.
– Siegens alte und neue Straßen vor 100 Jahren. Die ersten Straßenschilder im Ortsbild. Strenge Polizei-Ordnung für Siegener Bürger, in: Unser Heimatland 1967, S. 53-54.
– Neue Siegener Straßennamen vor 75 Jahren. Frühling 1895 gab es im „Krönchen“ rund 50 Neubezeichnungen, in: Unser Heimatland 1971, S. 2.
Ein weiterer Exkurs zu kurzfristigen Straßenumbenennungen auf Wunsch bzw. für Investoren sind übrigens:
„Zur Landeskrone in Wilnsdorf Wilden:
Die Straße wurde Ende der 1990er Jahre in Louis –Schuler-Straße umbenannt, weil das Unternehmen dort seinen Sitz hatte.
Als 2009 der Schuler Konzern den Standort schloss, wurde die Straße wieder umbenannt.
Die Wildrosenallee in Siegen Birlenbach wurde so benannt, weil der Investor wünschte, dass der alte negativ belastete Name Westhang weg sollte.“ (Danke für die Hinweise via E-Mail an TT)
Pingback: Literaturhinweis: Gerhard Aumüller, Andreas Hedwig (Hg.): Regionale Medizingeschichte. Konzepte – Ergebnisse – Perspektiven. | siwiarchiv.de
Dehnt sich die Diskussion im Kreisgebiet aus? Heute in der Printversion der Siegener Zeitung:
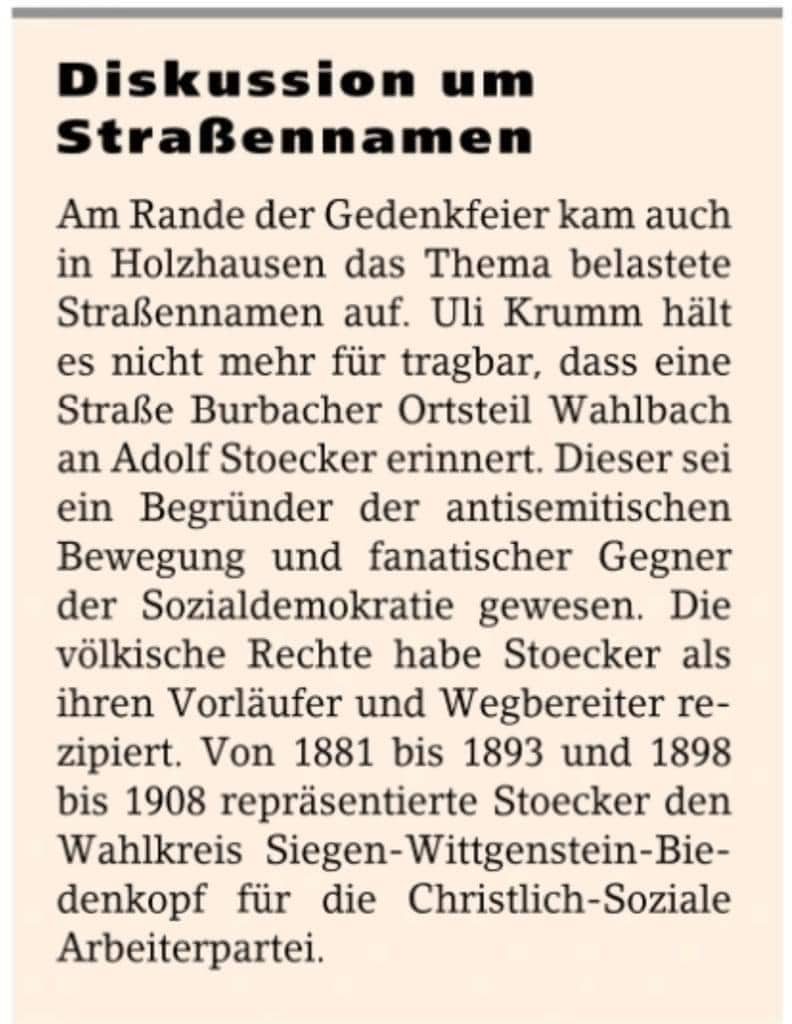
Pingback: Homepage des Arbeitskreises Verschickungskinder NRW e. V. | siwiarchiv.de
Pingback: Online (OA): Katharina Stengel: „Die Überlebenden vor Gericht | siwiarchiv.de
Pingback: Auschwitz-Häftlinge als Zeugen in NS-Prozessen (1950–1976) – Archivalia
Pingback: Online: Michael Imhof (1999): „Einen besseren als Stöcker finden wir nicht“ | siwiarchiv.de
s. a.
– „Olevian, Caspar“, in: Hessische Biografie <https://www.lagis-hessen.de/pnd/118834509> (Stand: 8.6.2022)
– Detailseite „Olevian, Caspar“ auf leo bw: https://www.leo-bw.de/detail/-/Detail/details/PERSON/wlbblb_personen/118834509/Olevian+Caspar
– „Olevian, Caspar“ in der Rheinland-Pfälzischen Personendatenbank: http://www.rppd-rlp.de/ps03247
– Sonderausstellung „Siegerländer Arbeitswelt“ im Deutschen Bergbaumuseum Bochum, bis 31. Juli 1988, mit Bilder Otto Arnolds
Erste archivische Anlaufpunkte dürften das Landesarchiv NRW, Abt. Rheinland, in Duisburg sein. Denn dort befindet sich der umfangreiche Nachlass (RWN 0172) Middelhauves: https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=BESTAND-Best_60c4669a-addf-4e8d-afa9-1eed00969504 und das Archiv des Liberalismus, Beständesuche.
Danke für den Hinweis und die Verlinkung!
Danke für die Rückmeldung!
Pingback: „Das Stumme Loch“ – eine Siegener Sage | siwiarchiv.de
Zum Verlauf der Veranstaltung s. https://www.4fachwerk.de/lechtstonn-geschichten-rund-ums-essen-und-trinken/
Pingback: „Das Stumme Loch“ – eine Siegener Sage über Wilhelm Hyazinth von Nassau – Archivalia
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 1.8. – 15.8.2022 | siwiarchiv.de
Lieber Herr Wolf,
die Sommerferien in NRW sind Geschichte. Nun wird es aber einmal Zeit, die ungelösten Sommerrätsel aufzulösen.
Danke und schöne Grüße
Nun der Sommer ist zwar noch nicht vorbei, aber die Lösung dieses Rätsels lautet: „siegen und das Siegerland im Bild“, Siegen 1960.
Die Lösung lautet: Adolf Weiershausen: Die neuere historische, sprachliche und volkskundliche Erforschung des Kreises Wittgenstein, in Das Schöne Wittgenstein, Heft 2 (1928), S. 76.
Die Lösung lautet: Wilhelm Weber: Musikgeschichte Wittgensteins, in Das Schöne Wittgenstein, Heft 3/4 (1928), S. 139.
Pingback: Online: „Der Dreissigjährige Krieg und der Alltag in Westfalen[“] – Archivalia
Pingback: Tagung: „Reisen und Religion im (langen) 18. Jahrhundert“. | siwiarchiv.de
Pingback: Burbach: Fördermittel für Landhaus Ilse | siwiarchiv.de
Einwohnerbuch der Stadt Siegen und der Kreise Siegen und Altenkirchen 1940, S. 54: Otto Arnold, Rektor Effertsufer 6, Reichsbund Deutscher Amateuer Fotografen, Ortsgruppe Siegen
Ein weiterer Zeitzeugenbericht zur Siegener Gesamtschulgeschichte:
Pingback: Lesung: Kathrin Thiemann, „In der zweiten Reihe“. | siwiarchiv.de
Neu hinzugekommen aus dem Kreisgebiet sind:
– Alte Burg bei Burbach: https://www.altertumskommission.lwl.org/de/forschung/burgen/die-alte-burg-bei-burbach/
– Alte Burg Obernau bei Netphen-Afholderbach: https://www.altertumskommission.lwl.org/de/forschung/burgen/die-alte-burg-obernau-bei-netphen-afholderbach/
– Burggraben bei Netphen: https://www.altertumskommission.lwl.org/de/forschung/burgen/der-burggraben-bei-netphen/
Pingback: Vor 90 Jahren: Grubenschließungen im Siegerland | siwiarchiv.de
Archive, Bibliotheken und Museen finden sich nicht in der Regierungserklärung von NRW-Ministerpräsident Wüst (CDU) am 31.8.2022: https://www.land.nrw/nrw-gestalten/nordrhein-westfalen-stark-durch-zusammenhalt .
Zur Kultur findet sich diese rein finanzielle, wenn auch erfreuliche Aussage:
s. a. Lilla, Joachim: Leitende Verwaltungsbeamte und Funktionsträger in Westfalen und Lippe (1918-1945/46), 2004, S. 199
Pingback: Geschichtswettbewerb „Mehr als ein Dach über den Kopf. Wohnen hat Geschichte“ | siwiarchiv.de
Pingback: Heute vor 100 Jahren: Ein Fund zur regionalen Kolonialgeschichte | siwiarchiv.de
Pingback: Sonderausstellung „Dimension Farbe“ | siwiarchiv.de
Pingback: Siegener Arbeitskreis Straßennamen: Infoveranstaltung am 13. September | siwiarchiv.de
Quasi vorab veröffentlichte Bernd Plaum eine sachliche Kritik an der Arbeit des Arbeitskreises und am Abschlussbericht – https://geschichtswerkstatt-siegen.de/2022/02/11/umbenennung-von-strassennamen/#comment-101 – , der man sich nur anschließen kann.
Haben die Medien, die Wissenschaft oder die anderen Institutionen alles richtig gemacht? Sicher nicht und es ist zu hoffen, dass alle (!) Beteiligten hieraus für zukünftig sicher anstehende, erinnerungspolitische Diskussionen ihre Lehren ziehen.
Plaum hatte schon auf die selektive Literatur- und Quellenauswahl hingewiesen. Man kann möglicherweise nachvollziehen, dass ein Bericht eines politischen Arbeitskreises keine wissenschaftliche Abschlussarbeit ist. Allerdings wirkt es befremdlich, wenn einschlägige Literatur nicht erwähnt wird, die explizite Hinweise zum Untersuchungsgegenstand des Arbeitskreises enthält. Gerhard Scholl veröffentlichte 1954 die Miszelle „Die Straßennamen der Stadt Siegen“ (Siegerland, S. 7 – 28). Das Straßenverzeichnis, der Hauptbestandteil der Veröffentlichung, enthält einige interessante Aspekte:
– Die Benennung der Albert-Richartz-Straße erfolgte nach dem Mitinhaber der Siegener Firma Betrams kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Firma Betrams hat Zwangsarbeiter:innen eingesetzt.
– Die Haroldstraße trägt ihren Namen nach der Titelfigur Hermann Bellebaums „Harold der Zigeunerkönig“.
– Die Martin-Luther-Straße ist eine Umbenennung aus dem Jahr 1935; sie hieß vorher Obere Häuslingstraße.
– Die Saarbrücker Str. am Wellersberg soll 1935/36 an die Rückgliederung des Saarlandes in des nationalsozialistische Deutsche Reich erinnern.
Ich bin mir sicher, dass diese Hinweise im Arbeitskreis diskutiert und bewertet worden sind. Aber warum finden sie sich nicht im Abschlussbericht wieder?
Problematisch ist, wie schon Plaum für Graf Luckner gezeigt hat, ist die fehlende Begründung, warum jemand als unbelastet eingestuft wurde. Dies zeigt auch ein Blick auf den Entwurf eines Biogramms zu Dr. Hermann Böttger – man hätte sich auch für alle „unbelasten“-Eingetuften eine fundierte Begründung gewünscht: http://www.siwiarchiv.de/wp-content/uploads/2022/09/boettger.pdf
Pingback: „Der restauratorische Weg einer Akte“ – eine Blogartikel-Serie | siwiarchiv.de
Zur Diskussion eines Berichtes der Siegener Zeitung vom 8.9. über die Bürgerbeteiligung auf deren Facebook-Seite: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02XBKaB1F3YdqXJPfoKfPZX2gagCP8YtvYQztQ4v9pbYq1Gv9SeuHbipT4QJPwV3Vvl&id=100047960994101
Facebook-Eintrag der Volt Siegen-Wittgenstein: https://www.facebook.com/620664945091925/posts/pfbid0364tvoBPxaFmc5ZrwZzY1ewEo9hYXgpkNvdcsdtTLj4Tg4gN1TAgyaRHnSySNvRYEl/
Die Westfälische Rundschau berichtet online ausführlich über die gestrige Anhörung: https://www.wp.de/staedte/siegerland/strassen-umbenennung-in-siegen-aeusserst-gereizte-stimmung-id236426707.html
Auch auf deren Facebook-Seite wird diskutiert: https://www.facebook.com/457512394310755/posts/pfbid035qgZnMzXm4CyNKEyCFGHcBFt4B1TmZjEBMmueDwatGn8J2DdiHkr1YDTUidDL4fjl/
-Online-Artikel der Siegener Zeitung zur Anhörung: https://www.siegener-zeitung.de/siegen/c-lokales/buerger-diskutieren-ueber-umbenennung_a286400 (Bezahlschranke)
– Kommentar der Siegener Zeitung zur Anhörung:https://www.siegener-zeitung.de/siegen/c-lokales/keine-ehrung-fuer-porsche-und-co_a286412 (Bezahlschranke)
– Diskussion des Artikels auf der Facebook-Seite der Siegener Zeitung: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.siegener-zeitung.de%2Fsiegen%2Fc-lokales%2Fbuerger-diskutieren-ueber-umbenennung_a286400&h=AT3hy9Cm6b5UZkejfg4T8BM2t5wzfK3sTMivcBDgx1HmArEBh21Qr4uBMSmjWN0oVSt8SLT0RbHydYaDmbC44ljbPSMUFZjDw8322WT-9kV6h3_Yu_bNcbGST2Z1SXi2ux0NY9j3xzNMWuFAUT3r&s=1
Bericht der Geschichtswerkstatt Siegen über die Anhörung zur Umbenennung von Strassennamen in Siegen: https://geschichtswerkstatt-siegen.de/2022/09/15/strassennamen/
Ein weiterer Bericht der Westfälischen Rundschau zur Anhörung: https://www.wp.de/staedte/siegerland/siegen-neuer-strassenname-was-kommt-genau-auf-anwohner-zu-id236444219.html
Mit entsprechender Diskussion auf der Facebook-Seite der Rundschau: https://www.facebook.com/457512394310755/posts/pfbid0cEEGR5JAcpPkV6TMDtiiWfa1YeUGVagwu5ESo1ojRsGK5wqbmBkznSoMwZQUtDg1l/
Der Kommentar dazu: https://www.wp.de/staedte/siegerland/siegen-wir-wissen-lothar-irle-war-nazi-und-ehren-ihn-id236449525.html
Mit entsprechender Diskussion auf der Facebook-Seite der Rundschau: https://www.facebook.com/457512394310755/posts/pfbid02KmBitHbnkoeb8Y3MuSHnVZLVxKz8UBVLtvFuwVUghqXpA9SR87t78uEVqaQXkK7fl/
Bericht der WDR Lokalzeit Südwestfalen zum Thema: https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/strassennamen-siegen-umbenennung-100.html
In der Aktuellen Strassennamen-Diskussion rückt auf Lothar Irle in den Fokus. Präzisierungen und Neufunde sind der Folge:
– Bernd Plaum verweist auf Irles Denunziation von Pastor Adolph Steinle in Netphen, die, wie andere auch, letztlich an die Staatspolizeistelle Dortmund gelangten, vgl. dazu Alexander Hesse, Völkische Seminaristen und deutschnationale Seminarlehrer? Die letzten Jahre des Lehrerseiminars Hilchenbach (1922-1925), in: Siegener Beiträge 4, 1999, S. 45-84, hier: S. 72, Fn. 14 (mit weiterführenden Angaben) – https://geschichtswerkstatt-siegen.de/2022/09/15/strassennamen/#comment-107
– „Wie gerade Pilze auf dem Mist sich wohlfühlten, war jene jüdische Literatur und Kunst, die den Nährboden bildete für jüdische Schweinereien.“ aus: Steffen Schwab: „Siegesparade setzt sichtbaren Schlusspunkt“, Westfälische Rundschau, 9.5.2015, s. a. Steffen Schwab:“Gipfeltreffen in Sachen Lothar Irle“, Westfälische Rundschau, 14.6.2013
– „Die Verbindung untereinander aufrechterhalten“: Der Informationsdienst
des Landkreistags, Heft 9/22, S. 441-444
Pressemitteilung der Stadt Siegen, 20.9.2022:
Empfehlungen des Arbeitskreises „Straßennamen“ bei Bürgerinfo vorgestellt

Die historischen Hintergründe von Straßennamen in Siegen hat der interfraktionelle Arbeitskreis „Straßennamen“ in zehn Sitzungen aufgearbeitet. Die Ergebnisse wurden jetzt (Dienstag, 13. September) bei einem Bürgerinfoabend im Großen Saal der Bismarckhalle in Weidenau vorgestellt.
Bürgermeister Steffen Mues begrüßte die zahlreichen Bürgerinnen und Bürger und ordnete die intensive Auseinandersetzung der Arbeitskreis-Mitglieder mit der Geschichte ein: „Es geht hier nicht um ein paar Namensschilder aus Metall, sondern darum, womit wir uns als Stadt Siegen identifizieren.“
Die Empfehlungen des Arbeitskreises, in dem Mitglieder aller im Rat vertretenen Fraktionen vertreten sind, seien einstimmig gewesen. „Die Benennung einer Straße nach einer Person ist eine der höchsten Ehrungen, die eine Stadt einem Bürger oder einer Bürgerin gewähren kann“, so Mues. Ziel des politisch eingesetzten Arbeitskreises sei es, und damit auch Wunsch der Politik, auf Basis „unserer heutigen freiheitlich-demokratischen Werteordnung zu empfehlen, ob die Straßennennung aufgrund einer Belastung aus der NS-Zeit noch angemessen erscheint oder nicht“.
Vor der engagierten Diskussion mit der Bürgerschaft, darunter viele Anwohnerinnen und Anwohner, hatten die Organisatoren einen Info-Block mit Kurz-Vorträgen der beteiligten Fachleute vorangestellt. Ziel war es, das komplexe Thema „Straßenumbenennung“ aus verschiedenen Perspektiven zu erläutern. Vertreter des Arbeitskreises mit Raimund Hellwig (FDP) als Vorsitzendem, Martin Heilmann (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) und Erik Dietrich (Volt-Fraktion) stellten den Abschlussbericht im Detail vor. Sie erläuterten die biographischen Hintergründe der Namensträger, die aktiv in der NS-Zeit beteiligt waren. Der Arbeitskreis empfiehlt, sieben historisch belastete Straßen in Siegen umzubenennen.
Darauf lag auch der Fokus bei der Bewertung der Straßennamen durch den Arbeitskreis: auf in der NS-Zeit auffällig gewordene Personen sowie auch Wegbereiter des Nationalsozialismus seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Der Arbeitskreis gelangte zu einer Einteilung in drei Kategorien. Am Ende waren es 23 Personen, davon fielen sieben (Straßen-)namen in die Kategorie A „schwere Belastung, Umbenennung empfohlen“. Konkret handelt es sich um die Adolf-Wagner-Straße, die Bergfriederstraße, Diemstraße, Hindenburgstraße, Lothar-Irle-Straße, Porschestraße und Stöckerstraße.
Seitens der Verwaltung gab Stadtarchivar Dr. Patrick Sturm einen Überblick über die historische Entwicklung von Straßennamen („Jede Generation muss für sich aushandeln, welche Straßennamen ehrungswürdig sind“) und stellte beispielhaft Verfahren von Straßenumbenennungen in anderen Kommunen vor. Andreas Becher, Leiter der Abteilung Vermessung und Geoinformation, informierte, wie eine Straßenumbenennung in der Praxis vonstattengeht und den praktischen Ablauf. Ihre Rechtwirkung entfalte eine Straßenumbenennung nach der öffentlichen Bekanntmachung. Becher betonte außerdem, dass die Behörden wie Finanzamt oder Rentenversicherung von städtischer Seite über eine mögliche Namensänderung informiert würden.
In der gut gefüllten Bismarckhalle nutzten im Anschluss vor allem Anwohnerinnen und Anwohner der von einer Umbenennung möglicherweise betroffenen Straßen die Gelegenheit zur Diskussion. Die finale Entscheidung, ob die genannten Straßen umbenannt werden, trifft der Rat in seiner Sitzung am Mittwoch, 19. Oktober 2022.
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 1.9. – 20.9.2022 | siwiarchiv.de
Ich besitze meinen Original-Entlassungsbericht aus der Lungenheilstätte Hilchenbach vom 14. Mai 1948.
Ist das Kreisarchiv daran inressiert?
Pingback: Potentiale und Grenzen der Einsparung von Energie in Kommunalarchiven – Archivalia
gibt es eine möglichkeit, das buch ohne den umweg über amazon direkt beim autor zu beziehen?
Heute findet sich der Leserbrief „Lösungen nicht durchdacht“ in der Westfälischen Rundschau, der die Berichterstattung über die Bürgerbeteiligung zum Anlass nimmt, sich mit der vorgeschlagenen Umbenennung der Porschestr. zu beschäftigen.
Pingback: Workshop „Schauspiel vor der Kamera“ | siwiarchiv.de
Pingback: Linktipp: Christina Schröder: In guter (Herrschafts-)Hoffnung? | siwiarchiv.de
Pingback: Interviewpartner für das Friedensdenkmal am Goetheplatz gesucht | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Monatsstatistik September 2022 | siwiarchiv.de
Pingback: Hermann Böttger (1884 – 1957) – Gymnasiallehrer, Vorgeschichtler, Flurnamen- und Siedlungsforscher | siwiarchiv.de
Pingback: Hermann Böttger (1884 – 1957) – Gymnasiallehrer, Vorgeschichtler, Flurnamen- und Siedlungsforscher | siwiarchiv.de
Pingback: Hermann Böttger (1884 – 1957) – Gymnasiallehrer, Vorgeschichtler, Flurnamen- und Siedlungsforscher | siwiarchiv.de
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 21.9. – 3.10.2022 | siwiarchiv.de
Pingback: Sekundarschule Netphen hat einen neuen Namen: | siwiarchiv.de
Heute erschien in der Siegener Zeitung der Leserbrief „Kein Argument spricht dagegen“, der sich für die Umbenennung der sieben Straßen ausspricht.
Facebook-Post der WDR Lokalzeit Südwestfalen v. 5.10.2022:
Pingback: Wer ist AS? | siwiarchiv.de
Pingback: Wer ist AS? | siwiarchiv.de
Erinnerung an den Standort der Kriegsschule:
Pingback: VdA: Energiesparen in Archiven | siwiarchiv.de
Ev. Sterberegister Siegen (Band 71: 1856-1861)
Albrecht Melsbach, gest. zu Siegen
Photograph geb. aus Feldkirchen bei Neuwied
42-3-7
hinterl. Gattin … Caroline Huster … (Textverlust)
gest. 22.01.1860, Brustleiden (Dr. Diesterweg als behandelnder Arzt)
begr. 25.01.1860
Danke für die Präzisierung!
Tatsächlich denke ich hier als erstes an Baumkuchen :-)
Essbar ist ja prinzipiell fast alles, aber die gesuchte Lösung ist es leider nicht.
Eine Toilettenpapierrolle
Mit so etwas historisch Wertvollem mache ich kein Rätsel. ;-)
Es könnten die Abnutzungsringe eines Kugellagers sein.
/vgl. https://twitter.com/chronohh/status/1578268701069312000
Oh, ein Vorschlag aus einer ganz anderen Ecke. Leider haben wir solche Bilder nicht in unserer Überlieferung von Firmen.
Dann bleiben ja nur noch die Saturnringe!
(Nein, ist es nicht.)
Wie Sie richtig schreiben, die sind es auch nicht. Wenn ich Sie in meinen Beständen hätte, dann wären sie hier schon mit einem großen Beitrag vorgestellt worden.
Ich habe spontan gedacht, es handelt sich um ein Werkstück auf einer Töpferscheibe…?
Es ist auch keine Töpferscheibe – leider.
Gut, das ist eindeutig die 1909er Ausgabe von Goethes Briefen „Alles um Liebe“!
/vgl. https://twitter.com/chronohh/status/1578307816997408768
Nein, ist sogar kein anderes aufgeschlagenes Buch. So früh gebe ich eher selten einen Tipp.
Löschwiege/Tintentrockner
Diese Antwort kommt zwar der archivischen Arbeit ein wenig näher, ist aber dennoch leider nicht richtig.
abgefahrene Bremsscheibe
Ich frabe mich ja, wie eine abgefahrene Bremsscheibe bzw. ein Foto davon, den Weg in das Kreisarchiv gefunden haben soll. Aber da ich „meine“ Bestände kenne, weiß ich, dass eigentlich nichts unmöglich ist. Aber: leider ist auch diese Antwort falsch.
Ev. Trauregister Siegen (Bd. 53 – 1843-1858)
1852/18
Carl Wilhelm Keller, Gold- und Silberarbeiter in Siegen
(v.a.H.: +06.09.1904)
34 J. (v.a.H.: *14.09.18), S. v. Buchbindermeister Joh. Friedr. Elias Keller
u. Johannette Wilhelmine geb. Steuber in Neuwied … (Rest unleserlich)
Helene Wilhelmine Blecher in Siegen
27 J. (v.a.H.: *02.10.25)
T.v. Johann Blecher, Siegen u. … (Textverlust)
oo am 12.10.1852 in Siegen
Vielen Dank auch für diese weiteren Angaben!
Detail eines Bilderrahmens
Nein ist ist keine Detailaufnahme eines Bilderrahmens.
Nächster Versuch: Der weiße Gummireifen eines Spielzeugautos.
Leider auch kein Gummireifen eines Spielzugautos.
Dan vielleicht ein Gummireifen von Roller, Dreirad, Kinderwagen, Flugzeug…
Dank Autosuggestion komme ich von dem Rad-Gedanken nicht mehr los. / https://twitter.com/chronohh/status/1578395906994470912
Alle genannten Lösungen sind traurigerweise nicht richtig.
Es ist eine halbrunde Holzverzierung um einen Fenster- oder um einen Türrahmen. Zu sehen ist ein Bildausschnitt der links-oberen Rundung. Am rechten Rand sieht man den Beginn des eigentlichen Fenster- bzw. Türrahmens.
Bedauerlicherweise ist es auch kein Fenster- oder Türrahmen.
Es ist ein aufgerollter Wasserschlauch. Wurde im Sommer für die Erfrischung des Archivars benötigt. :-)
Ich hatte schon ein wenig Sorge, wenn Sie antworten, dass das Rätsel gelöst ist. Aber noch kann man weiterraten. Wiewohl ich gestehen muss, dass mir in diesem Jahr ein Wasserschlauch in diesem Sommer sehr geholfen hätte.
Ausschnitt aus einem Produkt der Drehkoite (evtl. Girkhausen)
Oh, was für ein schöner Lösungsversuch! Ich bin ein wenig traurig, dass dies nicht korrekt ist.
Ein keramischer Isolator?
Nein, falscher Grundstoff! ;-)
Die Nahaufnahme einer CD-Rom?
Nein, es handelt sich nicht um die Nahaufnahme einer CD bzw. DVD.
„Neuhaus, Dr. Karl, 22.7.1910 Holzhausen b. Gl., V. Förster; Abitur Dt. Oberschule Laassphe/Westf.,
Stud. Theologe u. oriental. Sprachen, 1. u. 2. theol. Ex., Prom. z. Licentiaten über e. hebräisch-griech.-sprachwiss. Thema, Pfarrverwalter in Langen, Bruch mit der Kirche, dann Stud.ass. in Offenbach, Arbeit an e. Diss. über d. Theorie des Volkstums in der mod. evangel. Literatur (b. Prof. Nelis); Studienrat.
– Gauredner, Kreishauptstellenlt., Lehrer an Gauführerschule der NSDAP Offenbach, Kreisschulungsredner, Weltanschauungsunterr. an der Meisterschule d. dt. Handwerks Offenbach; Reg.rat b. KdS Posen; 11.42 Stubaf. RSHA, Reg.rat RSHA IV.B.1 [SSO; RS]“
aus: Harten, Hans-Christian: Weltanschauliche Schulung der SS und der Polizei im Nationalsozialismus:Zusammenstellung personenbezogener Daten
2017, S. 318
Ausweislich der im Landesarchiv NRW, Abt. Rheinland, befindlichen Entnazifizierungsakte NW 1.127-1.066 (Lothar Irle):
– fol1v trat Irle Irle aus Kirche aus, weil er sich zu einzelnen Dogmen (z. B. Auferstehung des Fleisches) nicht bekannte,
– fol 2r gehörte Irle in Marburg der christlich-deutschen Verbindung Franconia (Schwarzburgbund) und der Frankfurt/Main der christlich-deutschen Verbindung Falkenstein (Schwarzburgbund) an,
– fol21v/fol. 22r äußert sich der Entlastungszeuge Hermann Böttger u. a. wie folgt: “ …. Sein Buch „Volkskundliche Fragen der Gegenwart“ ist mir nur flüchtig [sic!] bekannt und ich weiß auch, daß dort die eine oder andere Stelle so aufgefasst werden kann,als wenn er auf nat[ional]soz[ialistische] Erkenntnisse Rücksicht genommen hätte. Das mag damit zusammenhängen, daß er tatsächlich wegen der Veröffentlichung geglaubt hat geringere und unwesentliche Konzessionen zu machen. ….“
– fol 57 – fol 65 enthalten von Irle geführte Schriftwechsel des NSLB von Juni 1933 bis Jannuar 1934. Bemerkensswert ist ein Schreiben den NSLB-Ortsgruppenobmann Knappmann in Netphen-Brauersdorf vom 14.8.1933 (fol 63): “ … Nach einem Schreiben des Pg. Gilfert an den Pg. Koll. Münker soll dieser nationalgesonnen bekannte Kollegen als Nationalmiserabele bezeichnet haben. Fordern Sie ihn auf, dass er die Kollegen nennt, die als solche bezeichnet worden sind. Ferner hat Pg. Gilfert Zeugen für diese Aussagen zu nennen. ….“. In einem Schreiben an alle NSLB-Ortsgruppenmänner des Kreises Siegen vom 24.11.1933 (fol 64) heißt es dann “ … Falls eine Lehrkraft sich eine abfällige Bemerkung über einen Führer oder über eine nationalsozialistische Organisation erlaubt, ist mir sofort Meldung zu erstatten. Geschieht es nicht, so wird der zuständige Ortsgruppenobmann zur Verantwortung gezogen.“
– Die entlastenden Aussagen über Irle haben den Tenor, dass eine aktive Verfolgung, die auf Irle zurückgeführt werden kann, in den Einzelfällen nicht nachgewiesen werden kann. Irle scheint sich Kollegen gegenüber, die er gekannt und geschätzt hat, unabhängig von deren poltischen Meinung loyal verhalten zu haben, dies traf sowohl für sozialdemkratische Lehrer wie Hermann Engelbert, aber auch auf „Alte Kämpfer“ (Walther Balzer) zu.
Eine alte Filmrolle
Nein, es ist auch keine alte Filmrolle.
Ein Fundstück in der „Freiheit“ vom 19. Februar 1929: Dort wird Heinrich Otto im Zusammenhang mit einem Ausschlussverfahren als Siegener Ortsgruppenvorsitzender des Verbandes für Freidenkertum und Feuerbestattung erwähnt.
Eine Abdeckung (Schmutzschutz) eines Wandschalters.
Ein Schmutzschutz für einen Wandschalter ist es leider nicht.
Vielleicht die Seitenansicht einer alten Schriftrolle?
Das Kreisarchiv verfügt bedauerlicherweise nicht über eine Schriftrolle, so dass auch diese Antowrt nicht korrekt ist.
Zum Verhältnis von Fritz Fries und Alfred Fißmer:
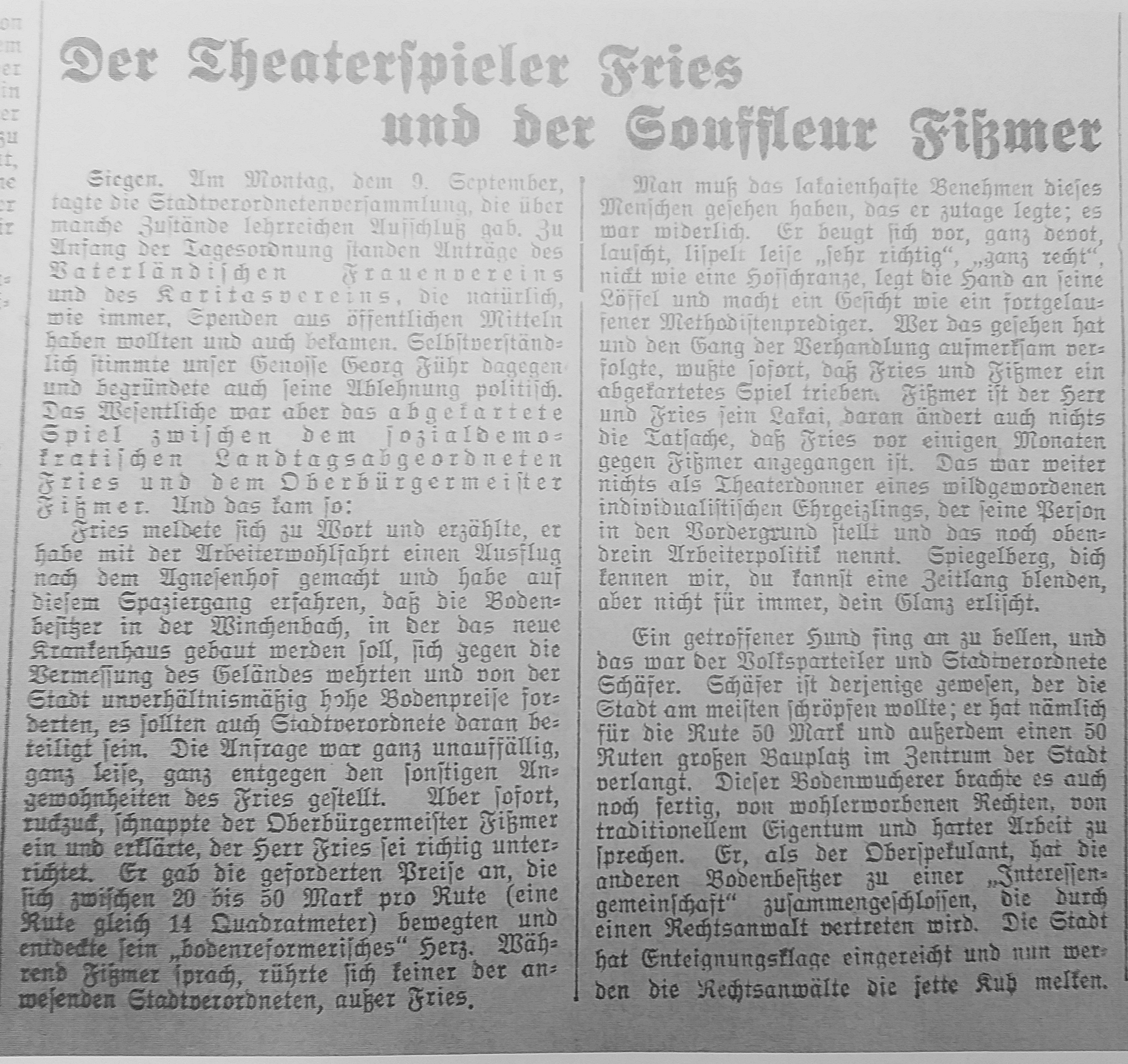
Mehr zu Fissmer Fries in:
Zabel, Manfred: Die Heimatsprache der Begeisterung. Ausgewählte Reden und Schriften von Fritz Fries, Siegen 1990:
S. 7 (Vorwort Hilde Fiedler)
„Fritz Fries war vom 24. April bis zum 1. Juni 1945 Oberbürgermeister der Stadt Siegen. Seinem Einsatz war es zu verdanken, dass Alfred Fissmer von der britischen Militärregierung als Oberbürgermeister ab Juni 1945 eingesetzt wurde(?).“
S. 51-52 Fries Rede im Preußischen La dagegen in der 347. Sitzung am 9.10.1924 zur Veranstaltung der Deutschen Friedensgesellschaft mit dem frz. General Verraux: “ … Wir erwarten von der Leitung der Polizei, sowohl von der örtlichen Organen in Siegen, von dem Oberbürgermeister Fissmer, als auch vom Landrat Gödicke[!], dass die Versammlung unter allen Umständen stattfinden kann …..“!
S.72 Fries am 8.4.1933 (Verhaftung): „…. Allgemein erkläre ich noch, dass ich mich ie an verbotenen oder illegalen Handlubgen beteiligt habe , nie auch je dazu aufgefordert habe. Auch diese ist dem Oberbürgermeister Fissmer und all seinen nachgeordneten Beamten absolut bekannt. …“
S. 112 Fries Siegener Volkszeitung 18.12.1929: „…. „“Fissmer-Hindenburg-Fries“ ….“ (?)
S. 135 – 137 Fries (1961): Der Abschnitt „Oberbürgermeister Fissmer in Siegen“ gibt die Fries´sche Sicht auf dessen Verhältnis zu Fissmer ausführlich wieder: 1927/28 „Burgfrieden“
S. 142 Fries (1961): „…. Für die große „Gagfah“-Siedlung auf dem Rosterberg sollte Ende der 20er Jahre für eine größere Anleihe der Stadt Siegen die Bürgschaft übernehmen; dafür brauchte sie die Genehmigung des preußischen Innenministeriums. OB Fissmer bat mich dieselbe einzuholen. Von Berlin aus telefonierte ich mit dem Oberbürgermeister: „Wenn man eine Sicherheit verlange, was ich anbieten sollte?“ “ Bieten Sie den ganzen Stadtwald und die Aktien vom Elektrizitätswerk an.“
Herr Ministerialdirektor Dr. von Leyden gab mir die Genehmigung für die Stadt Siegen, betonte aber, dass das die erste Genehmigung dieser Art sei, die an eine Stadt erteilt würde. Per Telefon gab ich OB Fissmer die Cemehmigung bekannt, betonte aber, dass diese befristet sei; sofort antwortete A. Fissmer „aus seinem vornehmen Wortschatz „: „In zehn Jahren können die uns am A…. lecken.“ …..“
Den Auschnitt einer Folienrolle (mit Papprolle und aufgewickelter Folie) schließe ich hiermit mal aus. Was soll man schon in einem Archiv einwickeln?
Tatsächlich haben wir Folienrollen in unserem Notfallset zum „Einwicklen“ von feuchten Archivgut. Aber: dies ist hier nicht zu sehen.
Detail eines Stuck- oder Verputzmusters
Leider nein, auch kein Muster für Stuck- oder Putzarbeiten.
Das ist schön,wenn er sich mit dem Thema beschäftigt hat.Trotzdem sind da viele Fehler drin.Habe die Daten im Kopf gespeichert.
Er sollte mit Leuten sprechen die AHNUNG von haben.
Ich würde mir eine konstruktivere Kritik wünschen – sei es als ausführlichen Kommentar oder als einen eigenen Gastbeitrag. Nur so funktioniert historischer Erkenntnisgewinn in den sozialen Medien. Wenn dies nicht gewünscht ist, dann bin ich davon überzeugt, dass Dr. Henrich-Franken, der über die Uni Siegen zu erreichen ist. Einem Zeitzeugengespräch nicht abgeneigt ist.
Pingback: VHS-Online-Kurs: Autorinnen aus Düsseldorf: Elisabeth Grube (1803-1872) und Katharina Diez (1809-1882) | siwiarchiv.de
Sie haben Freude. Das finde ich gut. Aber nun muss ich es leider auflösen:
Es ist ein Muster in der Butter /nach dem Schwamm-Drüber-Blues https://www.youtube.com/watch?v=mtGXaAvOLWI
Sie haben recht dieses Rätsel bereitet mir tatsächlich Freude und Sie sorgen ja auch mit Ihrer Antwort für weiteren Spaß – aber leider nicht für die richtige Lösung. Übrigens, ich muss gestehen, dass eine der bisherigen Antworten schon sehr in die richtige Richtung ging. Die Herbstferien in NRW dauern ja noch bis zum 16.10. (!), bis dahin wird wohl die richtige Lösung eintrudeln.
Heute in der Westfälischen Rundschau zur Benennung:
Geburtsurkunde von Anita Ruth Faber (Quelle: Aktives Museum Südwestafeln, Sammlung):
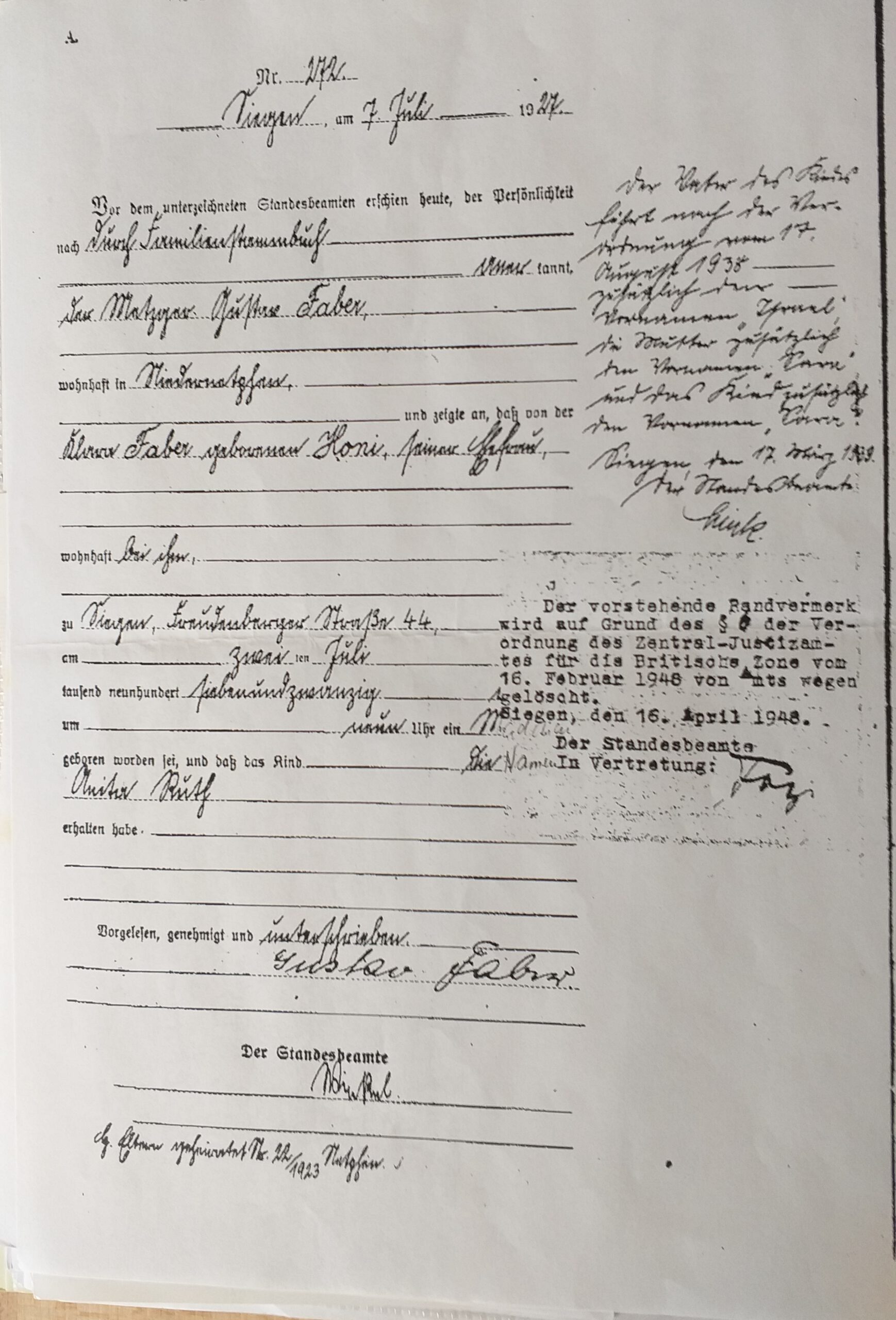
Könnte es eine Schallplatte sein?
Leider nein. Vermutlich hätte ich dann den 27.10. mehr betont – s. o. ;-)
Literaturhinweis: Plaum, Bernd D.: Die Leiden des jungen Dr. K. an Siegen – Hans Kruse und Siegens Stadtentwicklung während der Hochindustiralisierung, in Siegener Beiträge 19 (2014) S. 112 – 119
Weiterer Literaturhinweis, der gesundheitliche Probleme Kruses andeutet:
Traute Fries/Hartmut Prange: „Hier geschieht niemanden Unrecht!“ Zur Geschichte von Dr. Artur und Else Sueßmann und der Familie ihrer Tichter Annemarie Meyer. Eine Dokumentation, Siegen 2010, S. 23.
Die Antwort mit dem keramischen Isolator hat mich noch auf eine Idee gebracht. Vielleicht ist es das Gewinde eine alten Zündkerze? Die hat allerdings auch eher nichts in einem Archiv zu suchen.
Alte Zündkerzen haben wir tatsächlich nicht in unserem Archiv, aber die ein oder andere Fahrzeugakte. ;-)
Ein Zufallsfund:
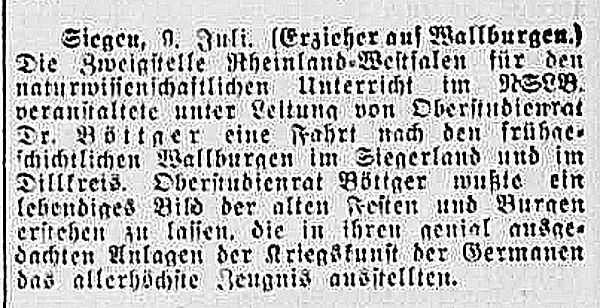
Quelle: Volksblatt (Ausgabe [Dortmund-]Hörde), 9. Juli 1937
Ev. Traureg. Siegen (Bd. 48 1737-1776)
1741 (vorl. Eintrag)
dom. ante nov. an.
Johann Philipp Engels, Sebastian Engels Bürgers alhier ehel. Sohn.
Jungfer Anna Catharina, des Ehren… und WohlWeisen … Johann Jacob Daub StadtSchöffen hierselbst ehel. Tochter
copuliret den 29. Jan. (1742)
Vielen Dank auch für diese weiteren Angaben!
Carriere – führt nach Wittgenstein:
Ev. Taufreg. Berleburg
1731, den 4ten Martii
Ludwig Carriere, Goldschmidt alhier und Magdalena Eheleute lassen taufen eine junge Tochter, ist genandt Sophia …
*******
1732, den 21. Decembris
Ludwig Carriere, Goldschmidt alhier und Magdalena Eheleute lassen taufen einen Jungen Sohn, ist genandt Christian Ludwig
*******
Ev. Sterbereg. Berleburg
1733
den 28ten julii ist alhier in der Stille begraben worden und auch an den Blattern gestorben Ludwig Carriere Goldschmidts alhier Söhnlein, seines Alters 5 Monat alt.
(nach Angaben in der Wittgensteiner Familiendatei von J.K. Mehldau wurde Ludwig Carriere in Marburg wegen Falschmünzerei hingerichtet, siehe auch HStA Marburg: Peinlicher Prozess gegen den Goldschmied und Kolonisten Louis Carrière zu Todenhausen wegen Falschmünzerei, 1738 ff.)
Tolle Hinweise! Danke dafür!
In Hessen findet sich dazu konkret folgendes:
HStAD Bestand S 1 Nr. NACHWEIS1:
Personenname: Carrière, Paul Louis
Geburtsdatum: 21.08.1698, Geburtsort: Vevey
Sterbedatum: vor 1757
Biografische Angaben
verh. 19.07.1719 Greifenthal: Hugues, Magdelaine (1698-1757), franz. Glaubensflüchtling
1710 Goldschmiedelehrling in Kassel
1734 Goldschmied in Todenhausen
1738 in Rauschenberg
Die Prozessunterlagen finden sich unter den Signaturen:
HStAM, 260 Marburg, 544 – 546, 548
Boden von Irdengeschirr („Mäckes-Ware“)
Solche „Ware“ ist wohl eher in einem Museum zu finden, bei uns leider nicht.
Pingback: Vortrag: Jana Sosnitzki M.A. (Lennestadt): Dr. Hans Kruse in der Zeit des Nationalsozialismus | siwiarchiv.de
Heute erschien in der Siegener Zeitung der Leserbrief „Schild soll bleiben“, der sich für die Beibehaltung der Lothar-Irle-Str. ausspricht. Zu Lothar Irle finden sich einige Einträge hier im Blog.
Heute erschien als Antwort auf diesen Leserbrief folgender Leserbrief „Ewig gestrige Person“ in der Westfälischen Rundschau (Print), der zu Lothar Irle u.a. folgendes ausführt: “ …. Aufsatz „Der Brauerei- und Brennereibesitzer-Zweig Irle in Marienborn“, erschienen im August 1934 in Dortmund in der „Familienzeitung des Geschlechtes Irle“, Band 2 Heft 4, auf S. 33 – 40, …. Dieser Aufsatz wird eingeleitet mit den Sätzen: „Blut und Boden sind zwei der wichtigsten Schlachtrufe aus dem Kampf um den sozialistischen Staat auf völkischer Grundlage. In diesem Kampf hören wir weder den einen noch den anderen Begriff allein, beide gehören zusammen wie die Begriffe Nationalismus und Sozialismus, Führer und Gefolgschaft, Mutter und Kind. Wenn man eins von dem anderen trennt, entstehen Unnatur und Zerrüttung geregelter Verhältnisse.“ ….
Als Vorsitzender des SGV-Bezirksverbands Siegerland durfte Lothar Irle während der 650-Jahr-Feier …. Grissenbach im Juli 1961 die anschließend in der angesehenen Zeitschrift „Siegerland“ im Wortlaut veröffentlichte Festrede halten. Wenn er darin u.a. bedauerte, wie klein im Siegerland die den Volkstanz pflegenden Gruppen gegenüber denen seien, die ‚den Tänzen der Primitiven huldigen‘, so zeigt dies doch mehr als deutlich, wie er sein völkisches, ja weiterhin braunes Denken ungestört in die bundesrepublikanische Siegerländer Gegenwart transportieren konnte. ….“
Hans Kruse ist ja auch ein Namensgeber einer Straße, die in der aktuellen Diskussion eine Rolle spielt. Der Arbeitskreis des Stadtrates schlägt folgendes Erläuterungsschild vor:
“Dr. Hans Kruse (1882‐1941), Historiker und Archivar – bei der Straßenbenennung 1975 blieben sein völkischer Hintergrund und die offene Unterstützung des NS‐Regimes unberücksichtigt.”
Von daher ist es interessant zu sehen, zu welchem Ergebnis die aktuellste Forschung gelangt ist.
Dafür, dass er nicht in der NSDAP war, gibt es bislang keine Belege, aber starke Indizien, dafür, dass er es war. Man denke nur nur an den Fall Wurmbach und die damaligen taktischen Empfehlungen. Alles nachlesbar. Nachlesbar sind auch Kruses Vorworte in der Jahrespublikation des „Heimatvereins“. Die ließen in ihrer Eindeutigkeit für einen Nazileser nichts zu wünschen übrig.
Ich gehe davon, dass die Magisterarbeit – die leider nicht auf dem Dokumentenserver OPUS der Universität Siegen verfügbar ist – auch folgende Akten des Berliner Bundesarchivs zu Rate gezogen hat:
– R 9361-V/26169 (Sammlung Berlin Document Center (BDC): Personenbezogene Unterlagen der Reichskulturkammer (RKK)) Kruse, Hans, *22.4.1882
– NS 5-VI/17640 Bd. 132: Kr, 1941, 1946-1950, enthält u. a.: Kruse, Dr. Hans, Museumsdirektor, 1941 [ Ns 5-VI Deutsche Arbeitsfront/Zentralbüro, Arbeitswissenschaftliches Institut]
Porzellan-Isolator
Es gibt übrigens ein ganz tolles Isolatorenmuseum in
Lohr am Main, Gründer ist der leidenschaftliche Sammler Herrn Vormwald ..passt doch wunderbar zum Ortsteil Vormwald im Kreis Siegen-Wittgenstein.
Danke für den interessanten Hinweis!

Dafür gibt es noch einen Tipp zur Lösung des Rätsel – es hat ein wenig hiermit zu tun:
Eine Klebebandrolle
Gratulation! Es handelt sich um ein wasserlösliches Klebeband, mit denen in Archiven Risse fixiert werden:
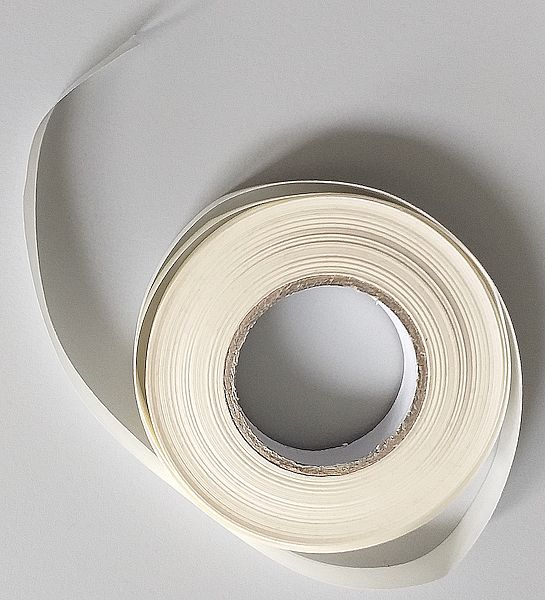
Ein Zufallsfund:
“ …. Auf Grund der Verfügung des Herrn Regierungspräsidenten in Arnsberg wurden im abgelaufenen Jahre zwei Ausbildungslehrgänge für Milchhändler durchgeführt. Jeder Kursus umfaßte 72 Stunden und vermittelte den Teilnehmern die so unbedingt notwendigen biologischen, technischen und hygienischen Kenntnisse für den Milchvertrieb. Nicht minder wichtig waren die geschäftskundlichen Belehrungen. Als Lehrer waren tätig der Handelsoberlehrer Fischer, Tierarzt Dr. Henrichs, Kreisarzt Dr. Sueßmann und Nahrungsmittelchemiker Dr. Fuchs. Das neue Reichsmilchgesetz stellt mit Recht weitgehende Anforderungen an die Vertreter des Milchhandels, kommt es doch zum Vertrieb des wichtigsten Nahrungsmittels für Säuglinge, Kranke und Gesundean. An jedem Lehrgang nahmen 33 Personen teil, die sich am Schluß einer Prüfung unter dem Vorsitz des Berichtserstatter [Anm.: Schulleiter Karl Breitenbach] und im Beisein von Vertretern der Kommunalverwaltungen, sowie des Kreischemikers Schemm und des Verbandsgeschäftsführers Dr. Klutmann, Essen, unterzogen. Welchen Wert die Regierung diesen Lehrgängen beimißt, geht schon daraus hervor, daß die Genehmigung zum Milchhandel künftig nur mehr solchen Personen erteilt wird, die die persönliche und geschäftliche Eignung nachweisen. ….“ aus: Jahresbericht 1929/30 der Städtischen Berufs- und Fachschulen Siegen, S. 8-9
Pingback: Vor 75 Jahren: Debatte über die Umbenennung von Straßen in Siegen. Oder: | siwiarchiv.de
Ein weiterer Zufallsfund belegt Artur Sueßmann als medizinischen Sachverständigen in dem aufsehenerregenden Mordfall Angerstein, wie dieser Ausriss aus der Bergisachen Zeitung vom 9. Juli 1925 dokumentiert:
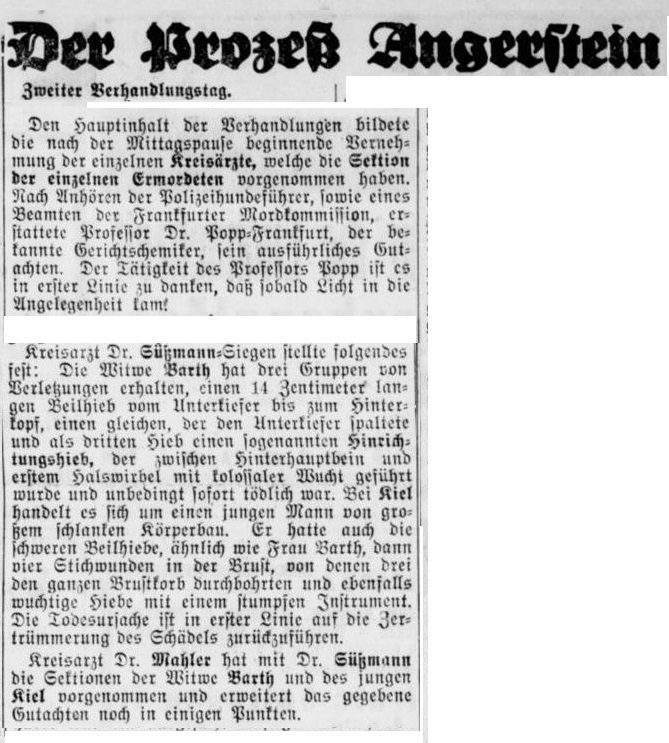
Nichts gegen Mr. Aldrin persönlich, aber es scheint mir nicht gerade feinfühlig zu sein, unter den gegebenen weltpolitischen Verhältnissen einen Platz ausgerechnet nach einem ehemaligen Berufs-Kampfpiloten zu benennen (der nebenbei noch einen Job auf dem Mond erledigte).
Die Nachkommenschaft der im frühen 18. Jahrhundert aus Trupbach ausgewanderten drei (?) Familien dürfte bis heute auf einige tausend Seelen angewachsen sein. Warum fiel die Wahl also gerade auf Mr. Aldrin und nicht auf einen anderen dieser vielen Menschen, worunter sich doch sicherlich eine Reihe verehrungswürdiger(er) Kandidaten hätte finden lassen? Man hätte in Trupbach natürlich auch ganz auf den anachronistischen Benennungs-Unfug verzichten können.
Aldrin entstammte der Trupbacher Familie Richter (amerikanisiert zu Rector). Wenn es zutrifft (wie u.a. auf https://homepages.rootsweb.com/~george/johnsgermnotes/trupbach.html nachzulesen ist), dass Richters Haus das einzige im Zweiten Weltkrieg bei einem Luftangriff, also quasi durch einen früheren Kollegen Aldrins, zerstörte Trupbacher Gebäude war, entbehrt die Benennung nicht einer gewissen Ironie.
Ich korrigiere meine Schätzung „einige tausend“. Es gibt ein Monumentalwerk von Laura Wayland-Smith Hatch, „Rectors remembered: The descendants of John Jacob Rector“, in dem „the lives of over 45,000 individuals“ als Nachfahren der emigrierten Trupbacher Familie Richter dokumentiert werden. Für die ebenfalls im 18. Jahrhundert nach Amerika ausgewanderten anderen Trupbacher Familien wird man ähnliche Fortpflanzungsraten ansetzen dürfen. Somit ist Buzz Aldrin einer von weit über 100.000 Amerikanern mit familiären Wurzeln im Siegerländer Trupbach. Schön für ihn.
Sie sind nicht alleine mit Ihrer Einschätzung dieser benennung. Auch von anderer Seite gibt es Klärungsbedarf: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0wGFSrJwVjHVZnNsGgB8LH9he4y2MzFU4c9PA22KLnSShyPQQbWWpEwfDCmCdQPLLl&id=1669173054
Menschen, die sich aus (ihrer Meinung nach) guten Gründen nicht bei Facebook registrieren wollen, werden wieder einmal benachteiligt, indem ihnen der Zugang zu Informationen versperrt bleibt. C’est la vie.
Hätte zu gerne den Facebook-Post eingebettet. War mir aber nicht möglich. Daher paraphrasierend: Der Post stellt die Begründung der Platzbenennung in Verbindung mit der aktuellen Straßennamendiskussion in Siegen: “ ….´Wegen Vorfahren aus Trupbach. Da wird das „wertvolle Erbe der Urahnen“ gepflegt.´….“
Danke.
Nicht neu, aber in dem Zusammenhang einmal mehr erwähnenswert ist, dass z.B. Anna Jarvis, die Begründerin des (nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg noch weit von der späteren Kommerzialisierung entfernten) Muttertages, eine Nachfahrin der Trupbacher Auswanderer war. Und dann wäre da natürlich auch noch Brad Pitt …
Zur Geschichte der Erinnerung an die Familie Faber in Netphen:https://www.vvn-bda-siegen.de/gedenken/faber/index.html
Ein Zitat für die Motivation zur Erforschung der Leher:innenbiographien aus Zabel, Manfred: Die Heimatsprache der Begeisterung. Ausgewählte Reden und Schriften von Fritz Fries, Siegen 1990:
S.79 Rede Fries, 22.6.1945 in Arnsberg: „…. Unsere Nazilehrer haben in einer Weise an unserem Volk gesündigt, dass darunter noch zwei Generationen zu leiden haben werden. Sie haben durch ihren Unterricht das Nazigift eingeträufelt. Es wird lange dauern, bis das beseitigt ist. Leute bis zu 30 Jahren sind durch ihre Nazischulen gegangen. Diese jungen Menschen sind in falscher Auffassung aufgewachsen. So ist leider ein großes Schuldkonto bei unseren Lehrern festzustellen. Wenn deshalb eine Animosität gegen sie besteht, so haben die Lehrer das sich selbst zuzuschreiben. Man sah sie überall mit dem Hakenkreuz in Nazitätickeit. Diese Zeit hätten sie gegen den Krieg aufwenden sollen. Viele Lehrer haben in wüstesten Weise gegen die Religion gehetzt. ….“
“ …. Im Nachlass von Wilhelm Fries befindet sich eine Sammlung von Korrespondenz der NSDAP, Lehrern und dem Leiter der Oberschule, später Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium, Dr. Reinhard Becker. Es gab zum Verhalten des Schulleiters gegenüber Lehrern und Außenstehenden verschiedene Vorfälle und Anschuldigungen, die zur Schlichtung an die Parteileitung gelangten. In diesem Zusammenhang wandte sich Hermann Böttger mehrmals an den Parteigenossen Paul Giesler und bat um Vermittlung. Oberstudienrat Böttger wandte sich genauso nach dem Umbruch am 19. Jumi 1945 an den Regierungspräsidenten und setzte sich für die Wiedereinstellung von Dr. Becker, der das Gymnasium von 1937 an bis zum Kriegsende leitete, ein. So wie er Paul Giesler schilderte, dass Dr. B. „unbedingt Nationalsozialist, seit 1931 Parteigenosse ist und Freikorpskämpfer war“, beschreibt er dem Reg.-Präsidenten Fritz Fries, dass Dr. Becker menschlich gewesen sei „und seine ganze Weidenauer Zeit ist überhaupt voll von oft sehr scharfen Auseinandersetzungen mit der Siegener Parteileitung und örtlichen Parteifunktionäremn. ….“ aus: Fries, Traute: Wilhelm Fries aus Weidenau. Ein beispielhaftes Leben im 20. Jahrhudert. Eine biographische Skizze, Siegen 2007, S. 47
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 4.10. – 16.10.2022 | siwiarchiv.de
Pingback: CDU-Fraktion: Wir sagen nein zur Umbenennung von Straßennamen in Siegen | siwiarchiv.de
1. Wenn ich es richtig verstehe, befürwortet die Siegener CDU-Fraktion, einen überführten Sexualstraftäter (Graf Luckner) weiterhin durch eine Straßenbenennung zu ehren.
2. Wenn ich es richtig verstehe, würde die Siegener CDU-Fraktion theoretisch kein Problem damit haben, z.B. die 1945 erfolgte Umbenennung der Adolf-Hitler-Straße (heute Sandstraße) rückgängig zu machen, sofern nur eine über den Namenspatron hinreichend aufklärende Hinweistafel angebracht würde. Deren Schlußsatz: „Nach heutiger Sicht würde eine Würdigung dieser Person nicht mehr erfolgen“.
3. Ich bin mir absolut sicher, dass die Christlich-Demokratische Union deutschlandweit auch den einen oder anderen intelligenten und ehrenwerten Menschen zu ihren Mitgliedern zählt.
4. Brechreiz ist kein Thema für Siwiarchiv.
Danke für den Kommentar und Entschuldigung, dass Sie dadurch körperlich beeinträchtigt wurden! Erinnerungspolitische Themen – zumal, wenn sie, wie in diesem Fall ein Archiv der Region treffen (immerhin war der Leiter des Siegener Stadtarchivs quasi Geschäftsführer des Arbeitskreises, der den o.e. Abschlussbericht vorgelegt hat) – sind leider ein Thema für das Blog. Wo, wenn nicht hier?
Da haben Sie, lieber T.W., mich missverstanden. Selbstverständlich gehört das Thema in diesen Blog. Was m.E. nicht hineingehört, sind allzu weitschweifige Ausführungen über persönliche Befindlichkeiten – weshalb ich es heute Nacht auch bei der knappen Andeutung beließ, dass ich mich von der CDU-Fraktion verarscht fühle.
Danke für die Klarstellung!
Aus dem Leserbrief „Ewig gestrige Person“ in der Westfälischen Rundschau vom 18.10.2022: “ …. Aufsatz „Der Brauerei- und Brennereibesitzer-Zweig Irle in Marienborn“, erschienen im August 1934 in Dortmund in der „Familienzeitung des Geschlechtes Irle“, Band 2 Heft 4, auf S. 33 – 40, …. Dieser Aufsatz wird eingeleitet mit den Sätzen: „Blut und Boden sind zwei der wichtigsten Schlachtrufe aus dem Kampf um den sozialistischen Staat auf völkischer Grundlage. In diesem Kampf hören wir weder den einen noch den anderen Begriff allein, beide gehören zusammen wie die Begriffe Nationalismus und Sozialismus, Führer und Gefolgschaft, Mutter und Kind. Wenn man eins von dem anderen trennt, entstehen Unnatur und Zerrüttung geregelter Verhältnisse.“ ….
Als Vorsitzender des SGV-Bezirksverbands Siegerland durfte Lothar Irle während der 650-Jahr-Feier …. Grissenbach im Juli 1961 die anschließend in der angesehenen Zeitschrift „Siegerland“ im Wortlaut veröffentlichte Festrede halten. Wenn er darin u.a. bedauerte, wie klein im Siegerland die den Volkstanz pflegenden Gruppen gegenüber denen seien, die ‚den Tänzen der Primitiven huldigen‘, ….“
Die Siegener Zeitung hat die Pressemitteilung bereits aufgegriffen. Der Artikel ist online und wird auf der Facebook-Seite der Zeitung bereits kommentiert:
Auch die Westfälische Rundschau berichtet dazu heute online und im Print.
Im Vorfeld der Sitzung des Siegener Stadtrats am 19.10.2022 hat mich ein in der SZ vom 13.10.2022 veröffentlichter, m.E. beschönigender und Falschinformationen enthaltender Leserbrief von Gisela Rauch veranlasst, hierauf in einem eigenen Leserbrief zu erwidern. Leider ist dieser bisher noch nicht in der SZ veröffentlicht worden, obwohl es dort seit meiner Einsendung bereits 2 Ausgaben mit Leserbriefen gegeben hat. Dankenswerterweise wurde mein Leserbrief heute in der WP / WR abgedruckt. Hoffentlich hat er noch Einfluss auf die Meinungsbildung bei den bisher noch schwankenden Siegener Politikern und Politikerinnen. Nachstehend der Wortlaut:
Zum Leserbrief „Schild soll bleiben“ in der SZ vom 13.10.2022
Mit Interesse verfolge ich die aktuellen Diskussionen zu den in Erwägung gezogenen Straßenumbenennungen in Siegen. Als ich noch in Siegen lebte, hatte die Straße, in der ich dort wohnte, in diesem Zeitraum drei verschiedene Namen, u.a. bedingt durch die kommunale Neugliederung. An ein Aufbegehren der davon betroffenen Anwohner hiergegen kann ich mich nicht erinnern.
Als Hobbyheimatforscher ist mir der Autor Lothar Irle kein Unbekannter. Zuletzt habe ich seinen Aufsatz „Der Brauerei- und Brennereibesitzer-Zweig Irle in Marienborn“, erschienen im August 1934 in Dortmund in der „Familienzeitung des Geschlechtes Irle“, Band 2 Heft 4, auf S. 33 – 40, gelesen. Dieser Aufsatz wird eingeleitet mit den Sätzen: „Blut und Boden sind zwei der wichtigsten Schlachtrufe aus dem Kampf um den sozialistischen Staat auf völkischer Grundlage. In diesem Kampf hören wir weder den einen noch den anderen Begriff allein, beide gehören zusammen wie die Begriffe Nationalismus und Sozialismus, Führer und Gefolgschaft, Mutter und Kind. Wenn man eins von dem anderen trennt, entstehen Unnatur und Zerrüttung geregelter Verhältnisse.“ Das Zitieren ähnlicher propagandistischer Entgleisungen dieses Akademikers möchte ich mir an dieser Stelle ersparen.
Als Dozent für Volkskunde an der Hochschule für Lehrerbildung Dortmund konnte der bekennende Antisemit Lothar Irle zahlreiche Lehrer und Lehrerinnen im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie indoktrinieren, die dann anschließend als Multiplikatoren vor den ihnen anvertrauten Schulklassen auftraten, um die deutsche Jugend ebenfalls in diesem Sinne zu infiltrieren und zu manipulieren.
Dass Lothar Irle nach dem Ende des Dritten Reichs „die wieder angebotene Lehrerstelle rigoros abgelehnt“ habe, wie die Leserbriefschreiberin anführt, deckt sich nach meinem Kenntnisstand übrigens nicht mit der Aktenlage, wonach Irle aufgrund seiner erheblichen NS-Belastung im Zuge der Entnazifizierung aus dem Schuldienst entlassen und nicht wieder eingestellt worden ist.
Als Vorsitzender des SGV-Bezirksverbands Siegerland durfte Lothar Irle während der 650-Jahr-Feier meines heutigen Wohnorts Grissenbach im Juli 1961 die anschließend in der angesehenen Zeitschrift „Siegerland“ im Wortlaut veröffentlichte Festrede halten. Wenn er darin u.a. bedauerte, wie klein im Siegerland die den Volkstanz pflegenden Gruppen gegenüber denen seien, die ‚den Tänzen der Primitiven huldigen‘, so zeigt dies doch mehr als deutlich, wie er sein völkisches, ja weiterhin braunes Denken ungestört in die bundesrepublikanische Siegerländer Gegenwart transportieren konnte.
Egal, welche „Verdienste“ um die Heimatkunde und Familienforschung im Siegerland man dem glühenden Nationalsozialisten Dr. Lothar Irle zuschreiben mag, der sich später nie öffentlich von seinen damaligen Überzeugungen distanziert oder diese bereut hat, seine Ehrung im öffentlichen Raum durch die in Siegen-Kaan nach ihm benannte „Lothar-Irle-Straße“ gehört zu Recht auf den Prüfstand und wird hoffentlich bald rückgängig gemacht.
Ich jedenfalls würde mich mit diesem Hintergrundwissen schämen, in einer Straße wohnen zu müssen, die nach einer solchen, bis an ihr Lebensende unbeirrbar ewig gestrigen Person benannt ist.
Wilfried Lerchstein aus Grissenbach
Danke für den Kommentar, mit den interessanten Informationen zu einem der in der Diskussionen stehenden Namensgebern!
Zu der prognostizierten Stimmenverteilung hätte ich gerne eine Quelle.
Da hat der Eintragende einmal die bisherigen Äußerungen mit der Ratszusammensetzung ins Verhältnis gesetzt. Ist natürlich nur eine Prognose bzw. Vermutung.
Pingback: Musikalische Lesung „Die Moosprinzessin“- ein Erwachsenen-Märchen der Romantik | siwiarchiv.de
Die Reaktion der Volt Siegen-Wittgenstein:
Radio Siegen berichtete benfalls zum Thema: https://www.radiosiegen.de/artikel/rat-siegen-entscheidet-ueber-strassennamen-1458471.html
„Reaktion“ der Siegener Grünen:
Ergänzender Antrag von Volt und SPD zur heutigen Sitzungen:
– Hindenburgstr. und Irle-Straße, Bergfriederstr. werden umbenannt
– Die nach Adolf Stoecker benannt Straße wird umgewidmet . Die neue Namenspatronin wird Helene Stöcker.
– Die die übrigen Straßen (Wagner, Porsche, Diem), die umbenannt werden sollten, werden in den Arbeitskreis zur weiteren Arbeit zurücküberwiesen.
– Die Graf-Luckner-Str. wird durch den Arbeitskreis wegen neuer Erkenntnisse erneut geprüft.
– Den übrigen Empfehlungen des Arbeitskreises wird gefolgt.
Link: https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz090/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZf2hrl5piAIfG50flRO9I5SSfYqI3Ta-4o5Yt-33r1FV/19.10.2022_Rat_Antrag_zu_VL_881_2022.pdf
Eine weitere Reaktion auf die Infoveranstaltung: https://gerhard-koetter.de/strrassennamen-umbenennen-der-vom-rat-der-stadt-siegen-eingerichtete-arbeitskreis-macht-vorschlaege/
Eine Reaktion zum Gedenkkonzert: https://gerhard-koetter.de/erinnerung-an-adolf-busch-das-besondere-sinfoniekonzert/
Heute erschienen 2 Leserbriefe in der Siegener Zeitung (Print):
1) der bereits am 18.10. in der Westfälischen Rundschau erschienene Leserbrief zur Person Dr. Lothar Irle. In der SZ allerdings gekürzt.
2) der Leserbrief „Passender Fauxpas“, der eine Vornamensverwechslung eines Protagonisten in der Diskussion vermerkt. Ob es sich um die im Rahmen der Diskussion vorgeschlagene Benennung des „Hauses der Musik“ in Siegen nach Friedrich Deisenroth – „weit über die Region bekannten und beliebten Dirigenten und Komponisten“ – handelt, ist leider nicht erkennbar. Jedenfalls wurde dieser irrtümlich mit Hermann bezeichnet.
Deutlich zu spät ist heute, nachdem die Entscheidung im Siegener Stadtrat ja bereits gefallen ist, mein Leserbrief zur Lothar-Irle-Straße in Siegen-Kaan doch noch in der Siegener Zeitung in einer stark amputierten Kurzversion erschienen. Und mein letzter Satz wurde einfach mittendrin für beendet erklärt.
Am 17.11. wird der Film in Kreuztal gezeigt:

Ich empfehle allen Schulen im Kreis Siegen-Wittgenstein einen Besuch im Kreisklinikum Hadamar ( ca 60 km) und dem dortigen Archiv. Eine mögliche Aufgabe für die Schüler: „Informiere dich über einen Patienten (mit Bild!) und stelle uns seine Geschichte vor“. Digital und als Teil einer Wandzeitung für eine Ausstellung. (Vorher Absprachen mit dem Archiv, Bereitstellung von Material (Kopien), Kurzvortrag / Einführung in die Arbeit der Dokumentationsstelle, …) https://www.karl-heupel.de/medien/krieg_im_siegerland/toetungsanstalt_hadamar/index.html
Pingback: Literaturhinweis: Festschrift zum 200jährigen Bestehen der Siegener Loge | siwiarchiv.de
Bericht der Westfälischen Rundschau über die Verlegung der Stolpersteine: https://www.wp.de/staedte/siegerland/stolpersteine-fuer-euthanasie-opfer-erinnern-in-walpersdorf-id236746519.html
Zur Geschichte der Loge befindet sich im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin unter der Bestandssignatur FM, 5.2. S 44 der Bestand „Johannisloge „Zu den drei eisernen Bergen“, Siegen“. Die legiglich mit einer Findkartei erschlossenen 90 (!) Verzeichnungseinheiten reichen von den 1820er Jahren bis zur Auflösung der Loge im Jahr 1935
Am vergangenen Donnerstag wurde im Vortrag über Dr. Hans Kruse, auf dessen ebenso intensive wie erfolglose Bemühungen hingewiesen, das Logenhaus in der Koblenzer Str. 5 in Siegen nach dessen Beschlagnahme durch die Nationalsozialisten als Erweiterung für das von ihm betreute Siegerlandmuseum zu erhalten. Allerdings geriet in diesem Zusammenhang Logeninventar in das Siegerlandmuseum. Unklar ist, so zumindestens die Referentin, ob alles zurückerstattet wurde.
Entschuldigung für die schlechte Bildqualität!
Kassation einer Akte?
Leider nein.
Ein Blick auf die Vitrine zum Klick:
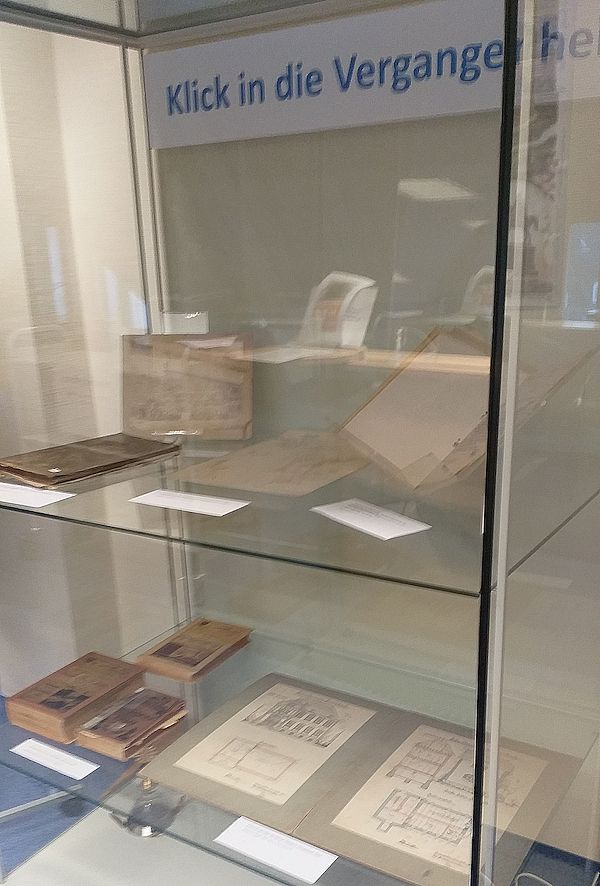
Eindrücke von der Ausstellung:

Be- bzw. Entladen eines Archivkartons
Auch dieser Lösungsversuch ist leider nicht korrekt.
Pingback: Bundesarchiv warnt vor Energiesparen als Gefahr für historische Dokumente | siwiarchiv.de
Umbetten einer Akte
Auch dies ist nicht richtig.
Ok, zweiter Versuch: Archivar beim Verzehr einer Tafel Schokolade. Nein ernsthaft: Auffalten eines Archivkartons.
Gratuliere Herr Kollege! Nachdem ich mich beim Auffalten des Archivkartons so abgemüht habe, hätte ich eigentlich schon Schokolade verdient gehabt.
Der Gewinn ist heute auf meinem Schreibtisch gelandet. Ganz herzlichen Dank!
Heute erschien in der Siegener Zeitung der Leserbrief „Bitterer Beigeschmack“, der den unglücklichen Verlauf des Schachlottos anlässlich der Schacholympiade thematisiert.
Papierschneidemaschine
Leider ist es keine Papierschneidemaschine.
Aktenbindung??
Es ist bedauerlicherweise keine Aktenbindung.
Ein Dokument zusammen rollen und dann mit einem Gummiband fixieren
Hier wird kein Dokument gerollt und fixiert.
Paulchen II., der Waschbär (das neue Maskottchen des Kreisarchivs), auf nächtlicher Futtersuche im Büro des Chefs.
(Paulchen I. war der Wisent – hat sich nach dem Scheitern des Auswilderungsprojektes in die Ewigen Jagdgründe verzogen.)
Das ist eine konstruktiviere Kritik,ihr könnt nur nicht die Wahrheit erfahren.
Wie es richtig verlaufen ist.Schrecklich sowas hauptsache die Leute bekommen was erzählt.
Noch einmal: mein Angebot zu einem längeren Gastbeitrag steht.
Pingback: Silber- und Goldschmiede in Siegen vom 16. bis zum 19. Jahrhundert – Silberpunzen
Pingback: Silber- und Goldschmiede in Siegen vom 16. bis zum 19. Jahrhundert – Silberpunzen
Pingback: Silber- und Goldschmiede in Siegen vom 16. bis zum 19. Jahrhundert – Silberpunzen
Pingback: Siegener Stadtrat trifft Entscheidung zu Strassenumbenennungen | siwiarchiv.de
Ich bin froh, dass kein Wasvhbär im LYZ haust
@alle Vielen Dank für das rege Mitraten und die tollen Lösungsvorschläge!
Pingback: Vor 98 Jahren: Achtfacher Mord in Haiger | siwiarchiv.de
In der heutigen Siegener Zeitung erschienen die drei Leserbriefe „Wichtigere Dinge“, „Ziel erreicht“ und „Keine Kapazitäten frei“, die sich allesamt kritisch über die beschlossenen Umbenennungen äußern.
Bei einer zukünftigen Diskursanalyse scheint es interessant zu sein, woher die Autorinnen und Autoren der Leserberiefe und – sofern verlässlich ermittelbar – der Kommentare in den sozialen Medien (in diesem Fall, wenn ich es recht sehe überwiegend Facebook) stammen. Denn in der entscheidenen Sitzung des Stadtrates wurde auf genau dieses Meinungsbild abgehoben.
I am a distant relative of the second wife of heinrich von dornberg. Wanda kubale von dornberg was my great garnd aunt. Where can I find which museums have his work(s)?
Any information would be greatly appreciated. Thank you.
Hallo,
sehr gerne würden wir den Film SiWi von oben im Heimhof Theater sehen.
Über 2 Karten würden wir uns riesig freuen!
LG Fam. Reh
Die Karten werden m. W. verlost.
s. dazu
– Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden Bestand 407 ( Polizeipräsidium Frankfurt a.M.) Nr. 889, Kriminalpolizeiliche Sammlung zum Mordfall Angerstein in Haiger im Jahre 1924, 1924-1925, 1950 (enthält: Presseausschnitte, Tatortuntersuchung des Instituts für gerichtliche Chemie und Mikroskopie in Frankfurt am Main 1924)
– Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, I. HA Rep. 90 Annex L ( Handakten des Geh. Finanz- und Ministerialrats Franz Hermann Reschke (Sitzungsprotokolle)), Nr. 5,Sitzungen des Preußischen Staatsministeriums, Enthält: – [a] 28.10.1925: (1) Todesurteile gegen Angerstein und Krause
– Im Bildarchiv des Bundesarchivs finden sich drei Fotografien, die während des Prozesses im Juli 1925 entstanden sind (Zwei Aufnahmen Angerstein bei Verlassen des Gefänisses sowie eine Aufnahme des Landgerichts Limburg mit Schaulustigen): https://www.bild.bundesarchiv.de/dba/de/search/?query=122204379
– Klaus Günther: Wann hat eine Tat ihren Täter? Ein Beitrag zur Rechtslehre als Wissenschaft vom Menschen, in: Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik (2018), S. 389 – 393, Link (PDF)
– Hörspiel „Bestie Angerstein“ (SWR 2019): https://archive.org/details/bestie-angerstein
Zu Dörnberg s.:
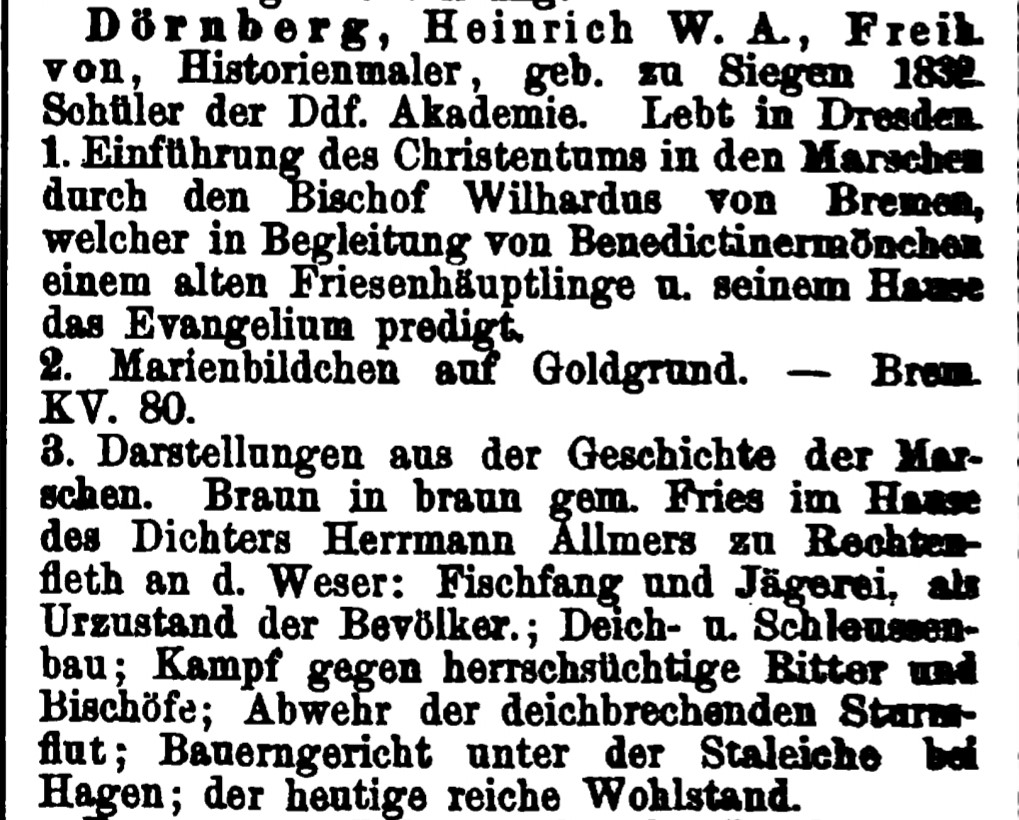
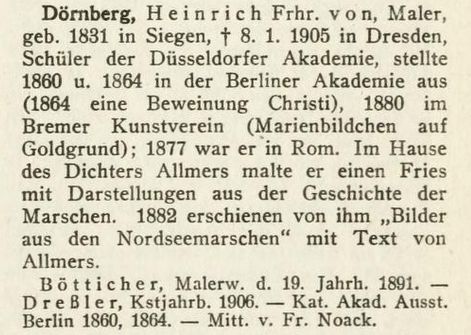
– Boetticher, Friedrich von: Malerwerke des neunzehnten Jahrhunderts. Beitrag zur Kunstgeschichte. Erster Band: Aagaard – Heideck, Dresden 1891, S. 234:
– Noack, Friedrich : Dörnberg, Heinrich Frhr. von. In: Ulrich Thieme (Hrsg.): Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker. Band 9: Delaulne–Dubois. E. A. Seemann, Leipzig 1913, S. 371:
– Gradel, Oliver, Düsseldorfer Malerschule in Rechtenfleth. Heinrich von Dörnberg (1831-1905) und seine Gemälde für Hermann Allmers, in: Ausstellungskatalog „Mensch sein und den Menschen nützen. Hermann Allmers und seine Künstlerfreunde“, hrsg. v. Axel Behne und Oliver Gradel, (Kranichhaus-Schriften; 4), Otterndorf 2002, S. 33-65
Bierdeckel-Marketing (?) für eine erfolgreiche Veröffentlichungsreihe von Lothar Irle (5 Bde zwischen 1960 und 1974). 6 Bierdeckel scheint es gegeben zu haben:
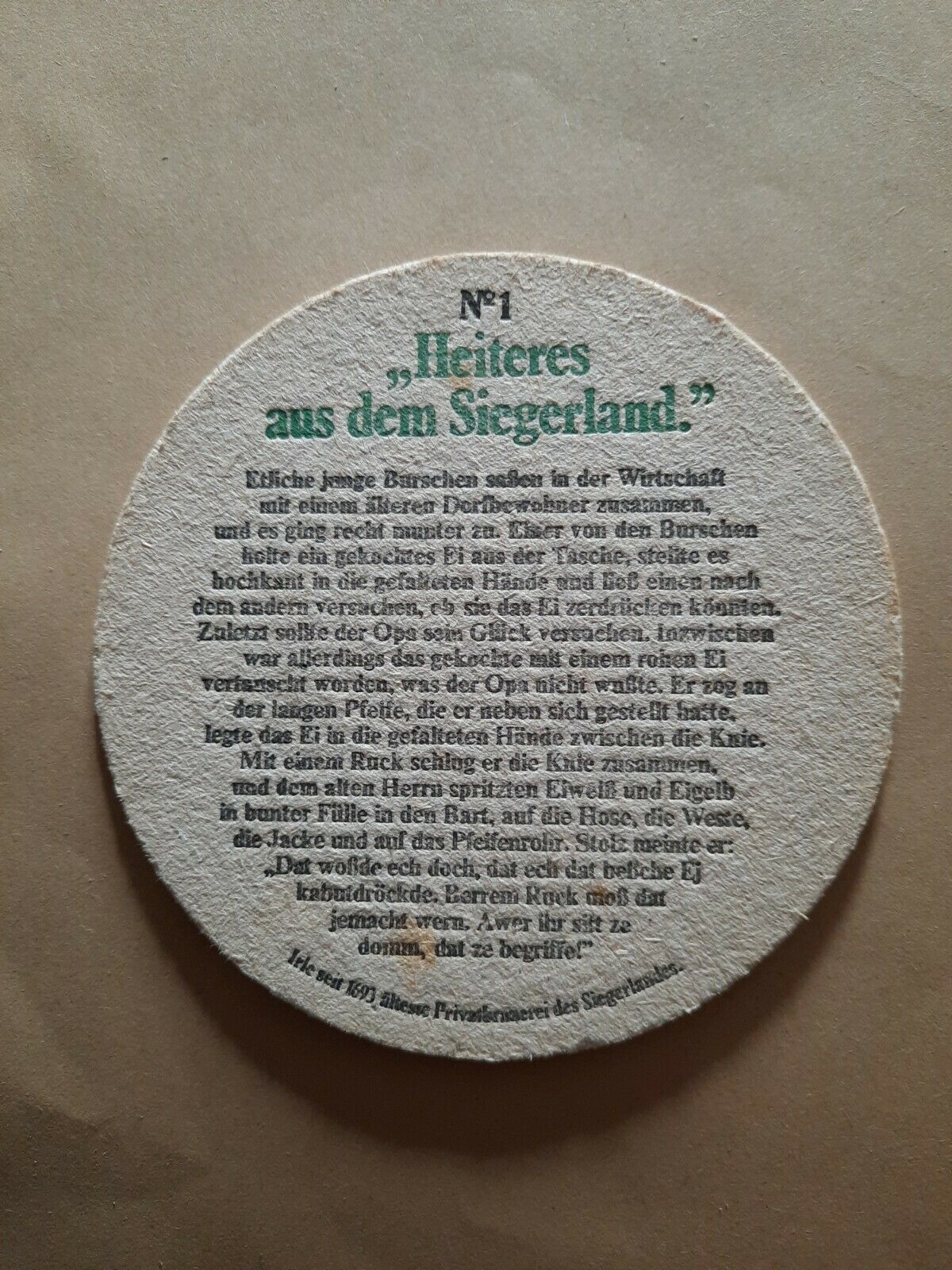
Weiß jemand Näheres?
s. a.:
„Villa als Tatort in Haiger, 1925“, in: Historische Bilddokumente <https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/idrec/sn/bd/id/45-116> (Stand: 28.6.2021)
Da der Welttag des audiovisuellen Erbes bereits vorbei ist, bin ich urlaubsbedingt wohl schon zu spät, jedoch hört es sich für mich so an, als würden Formulare in einen einfachen Papierordner einsortiert.
Sie sind leider etwas spät und das Rätsel ist bereits gelöst – s. o.
– Ein Zeitzeugen-Bericht Herbert Bäumers zur belgischen Garnisonsstadt Siegen:
Herbert Bäumer ist u. a. Autor des Buches „Von der Wehrmacht zur belgischen Garnison. Der Militärstandort Siegen in Wort und Bild. Dokumentation aus Anlass des Abrisses der Kasernengebäude, Siegen 2001.
– Im Bericht der Zeitzeugin Anne Margarete Ising schildert sie ihre „Kindheitserinnerungen an Trupbach und die Belgier“.
– Hermann Schmid berichtet über den „Fischbacherberg – ein Quartier im Wandel“:
Pingback: Ausstellung: „Hans und Hanna Achenbach. Ein Künstlerehepaar aus dem Siegerland. | siwiarchiv.de
Pingback: Ausstellung: „Hans und Hanna Achenbach. Ein Künstlerehepaar aus dem Siegerland. | siwiarchiv.de
Pingback: Ausstellung: „Hans und Hanna Achenbach. Ein Künstlerehepaar aus dem Siegerland. | siwiarchiv.de
Weitere Medienberichte über Dr. Sueßmanns Wirken:
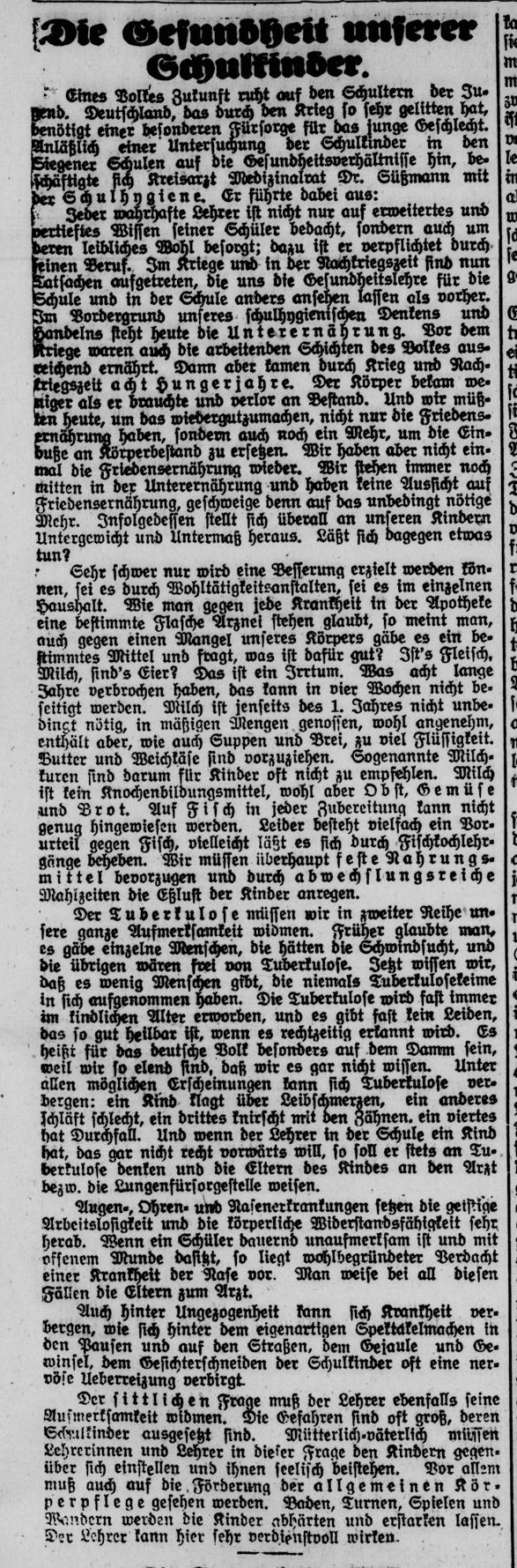
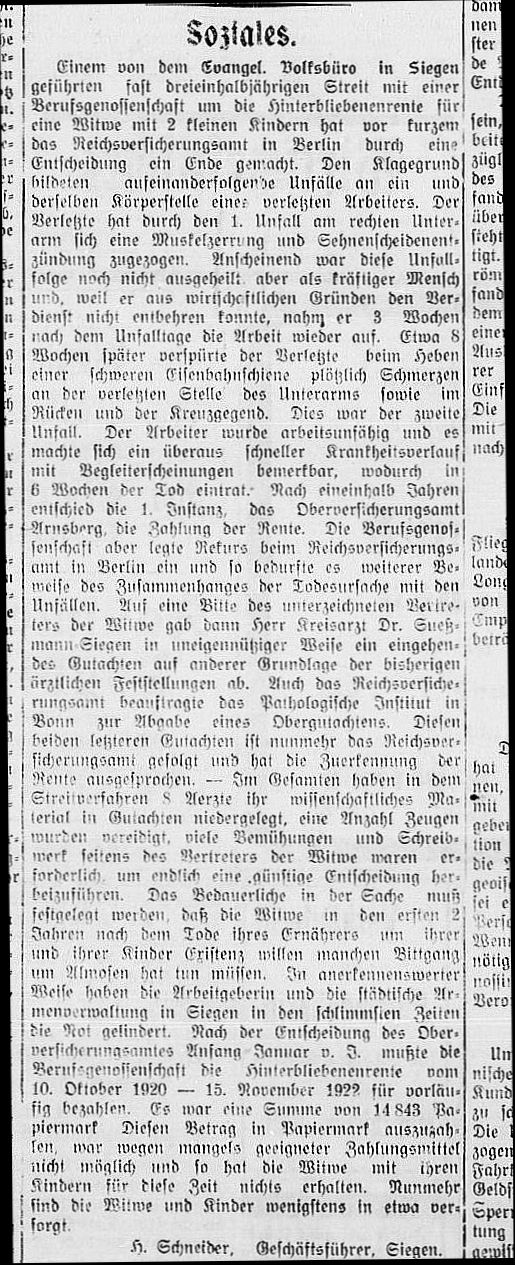
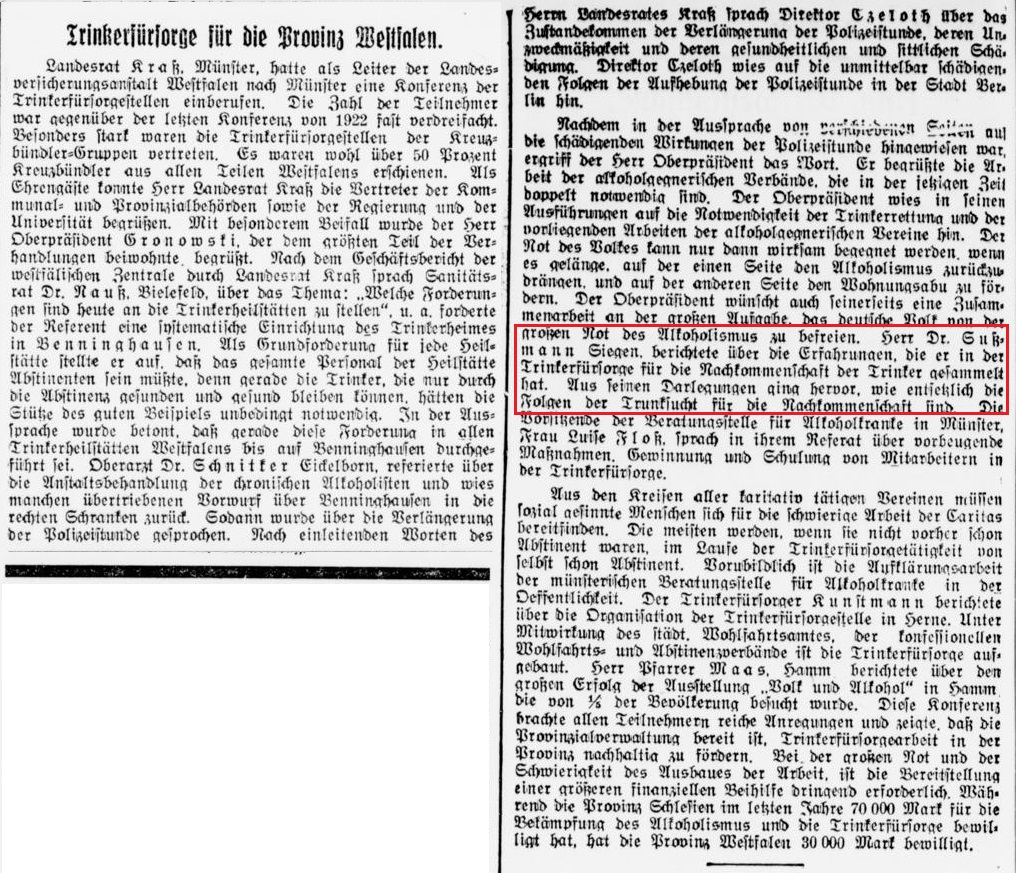

– Rheinisches Volksblatt, 29. März 1924:
– Sauerländisches Volksblatt, 12. September 1924:
– Bürener Zeitung, 19. Januar 1927:
– Central-Volksblatt für das gesamte Sauerland, 8. Oktober 1930:
s. a. Rassenhygiene in der Schule, Med.-Rat Sueßmann,
Siegen i. W., Zeitschrift für Medizinalbeamte,
Nr. 8. 15. April 1928. Dieser Hinweis verweist auf die erforderliche Durchsicht der medizinischen Fachliteratur auf Beiträge von Suessmann.
Pingback: Heute vor 70 Jahren: Einweihung des Kreisaltenheims | siwiarchiv.de
Heute erschienen 4 weitere Leserbriefe in der Siegener Zeitung, die sich kritisch zur Ratsentscheidung äußern: „Bürger nicht gefragt“, „Infotafel zur Aufklärung“ (Enkelin Dr. Lothar Irles), „Denn sie wissen nicht, was sie tun“ und „Geistig verarmt“.
Pingback: Heute vor 70 Jahren: Einweihung des Kreisaltenheims | siwiarchiv.de
Pingback: Heute vor 70 Jahren: Einweihung des Kreisaltenheims | siwiarchiv.de
Zu Umbenennungen in der frühen Bundesrepublik s. Hansen, Sebastian, Die Düsseldorfer Straßenbenennungen in der jungen Bundesrepublik, in: Internetportal Rheinische Geschichte, abgerufen unter: https://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Epochen-und-Themen/Themen/die-duesseldorfer-strassenbenennungen-in-der-jungen-bundesrepublik/DE-2086/lido/632c1f60898a75.45231921 (abgerufen am 04.11.2022)
Ev. Kirchenbücher Hilchenbach:
Beerdigungsregister 1948/55
SCHREY, Gerhard, Hilchenbach, Lehrer i.R. in Hilchenbach, Witwer
*21.05.1881 in Jüchen Kr. Grevenbroich
hinterl. 3 erw. Töchter, 2 Enkel
Gattin Emmy geb. Reifenrath verst. 06.05.1945
+11.11.1948, 21.40 h an Schlaganfall
begr. 15.11.
Trauregister 1911/8
SCHREY, Gerhard, Lehrer in Dreistiefenbach, ev., 30 J
S.v. Gerhard Schrey, Dreistiefenbach
Emmi Reifenrath, Hilchenbach, ev., 34 1/4 J
T.v. +Eduard Reifenrath, Gerbereibesitzer in Hilchenbach
oo am 18.04.1911 in Hilchenbach durch Pastor Vollpracht, Oberholzklau
(die Mutter von Emmi R. war Elis. Caroline geb. Vollpracht *04.12.1876 in Hilchenbach)
Danke für die ausführlichen genealogischen Ergänzungen!
Hallo, mein Name ist Ellen Drews aus Neunkirchen-Zeppenfeld. Zufällig bin ich auf diesen Eintrag gestoßen und kann etwas dazu beitragen. Die Bande zwischen Hamburg-Neuenfelde und dem Siegerland sind zahlreich gewesen.
Kapitän Otto Albers hat Dora Kraemer aus Kreuztal geheiratet.
Ottos Schwester Irma Albers (meine Oma) hat Günter Kraemer (meinen Opa), den Bruder von Dora geheiratet. Meine Großeltern hatten sich in Kreuztal niedergelassen. Meine Mutter wurde aber noch in Hamburg-Neuenfelde geboren.
Gretel, eine weitere Schwester von Otto, hat auch ins Siegerland geheiratet (Familie Klostermann).
Ein paar wenige Fotos hätte ich auch noch, vom Schiff und von Otto Albers.
Vielen Dank für diese erhellenden familiengeschichtlichen Informationen!
Pingback: Hermann Manskopf (1913 – 1985) | siwiarchiv.de
Pingback: Ausstellung: Thomas Kellner Kapellenschulen | siwiarchiv.de
Attacke auf Rubens-Gemälde: Über 10.000 Euro Schaden am Rahmen
Bayrischer Rundfunk, 4.11.22:
Attacke auf Rubens-Gemälde: Über 10.000 Euro Schaden am Rahmen
Im August hatten Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ versucht, sich in der Alten Pinakothek am Rahmen des Bildes festzukleben, der dadurch beschädigt wurde. In Rom attackierten Aktivisten am Freitag unterdessen erneut ein Van-Gogh-Gemälde.
Von
BR24 Kultur
Nach Abschluss der Restaurierungsarbeiten am Rahmen des im August attackierten Rubens-Gemäldes „Der bethlehemitische Kindermord“ steht nun fest: Der Schaden liegt auf jeden Fall über 10.000 Euro.
Aktivisten von „Die letzte Generation“ hatten sich festgeklebt
Er bewege sich im niedrigen fünfstelligen Bereich, teilte die Pressestelle der Museen mit. Zwei Aktivisten der Bewegung „Die Letzte Generation“ hatten sich damals am Rahmen des Gemäldes festgeklebt. Die Aktivisten waren nach kurzer Zeit durch die Polizei vom Rahmen getrennt und vorübergehend festgenommen worden. Bei diesem Ablösen war der Rahmen beschädigt worden. Nachdem ihre Personalien festgestellt waren, wurden sie entlassen und wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung angezeigt.
Generaldirektor Maaz ohne Verständnis für Aktion
Bernhard Maaz, der Direktor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, sagte, einige Schäden am Rahmen aus dem 18. Jahrhundert seien geblieben, womit sich sein Wert mindere. Im Gespräch mit dem BR zeigte er für die Protestaktionen in Museen kein Verständnis: „Wir hatten uns natürlich schon darauf vorbereitet und hatten Lösungsmittel zur Hand. Außerdem waren die Aufsichten geschult. Aber in dem Moment, wo es konkret wird, ist es natürlich empörend. Man kann doch nicht Kulturzeugnisse von Menschheitsrang in Gefahr bringen, um die Natur aus der Gefahr zu bringen.“
Die Aktivisten von „Die letzte Generation“ argumentieren zumeist damit, dass derartige Gemälde schon bald ohnehin nichts mehr wert sein würden, wenn man sich aufgrund der Klimakrise ums Essen streiten müsse – und versuchen auf diesem strittigen Weg auf den Klimawandel aufmerksam zu machen.
Das Museum reagiere nun mit stärkeren Kontrollen, Taschen im Ausstellungsbereich seien nicht mehr erlaubt. Zudem würden Kunstwerke häufiger verglast. Die Aktivisten erhalten drei Jahre Hausverbot. Nach dem Abschluss des laufenden Strafverfahrens würden zivilrechtliche Schritte gegen die beiden Aktivisten eingeleitet. Man sei gehalten „die finanziellen Ansprüche des Freistaats geltend zu machen“.
Neue Erbsensuppen-Aktion in Rom
In Italien griffen unterdessen Klima-Aktivisten ein weiteres Kunstwerk an: Nach Angaben der Gruppe „Letzte Generation“ bewarfen vier Aktivisten das in Rom ausgestellte Gemälde „Der Sämann“ des niederländischen Malers Vincent Van Gogh mit Erbsensuppe. Italienischen Medienberichten zufolge war das Kunstwerk hinter Glas ausgestellt und blieb unbeschädigt. Die Aktivistengruppe erklärte, es handele sich um einen „verzweifelten und wissenschaftlich begründeten Aufschrei, der nicht als bloßer Vandalismus verstanden werden kann“. Es würden weitere „gewaltfreie direkte Aktionen“ unternommen, bis dem Klimawandel mehr Aufmerksamkeit geschenkt werde. Italiens Kulturminister Gennaro Sangiuliano bezeichnete die Attacke als „schändlichen Akt, der aufs Schärfste verurteilt werden muss“.
Heute erschien in der Siegener Zeitung der Leserbrief „Keine Kavaliersdelikte“, der die beschlossenen Umbenennungen befürwortet.
Pingback: siwiarchiv-Statistik: 30.10. – 16.11.2022 | siwiarchiv.de
Am 9.11. (!) erschien in der Siegener Zeitung der Leserbrief „Zu viel Aufmerkssmkeit“, der sich hauptsächlich einer umstrittenen Kunstaktion widmet, um sich dann auch gegen die vom Stadtrat beschlossenen Umbenennungen auszusprechen.
s. a. den gleichlautenden Instagram-Post der Siegener CDU:
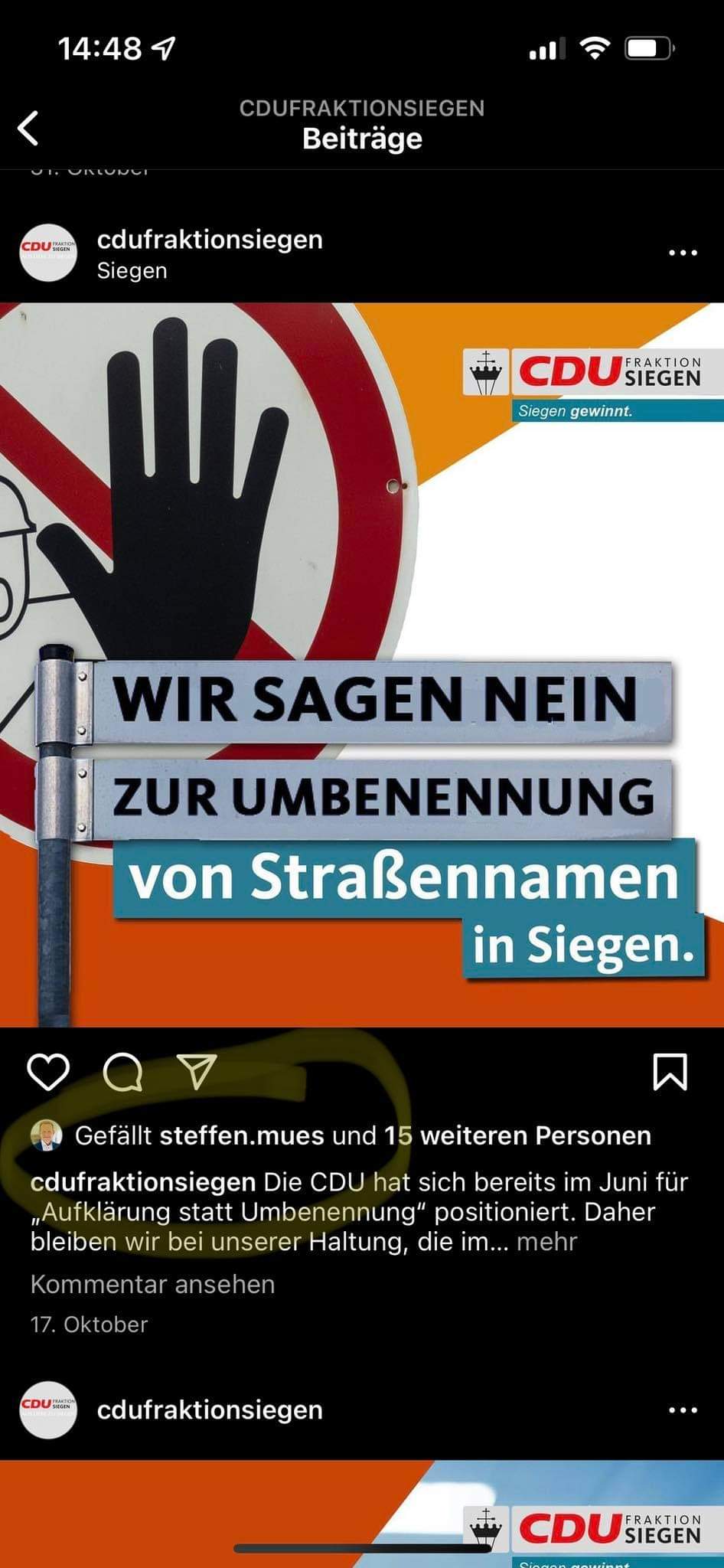
Nur der vollständigkeitshalber hier nochmal die Hinweise auf Hanna und Hans Achenbach im regionalen Personenlexikon:
Hans Achenbach:
http://akteure-und-taeter-im-ns-in-siegen-und-wittgenstein.de/verzeichnis/gesamtverzeichnis#achenbach8
Hanna Achenbach:
http://akteure-und-taeter-im-ns-in-siegen-und-wittgenstein.de/verzeichnis/gesamtverzeichnis#achenbach11
Schon irritierend, das im Flyer zur Ausstellung die NSDAP Zugehörigkeit von Hans Achenbach nicht erwähnt wird.
Vielen Dank für die Links!
Auch die Pressemittelung des Museums zur Eröffnungsveranstaltung enthält keinen Hinweis auf das Schaffen des Ehepaars während des Nationalsozialismus:
„Hans und Hanna Achenbach-Ausstellung im 4Fachwerk-Museum eröffnet
Retrospektive auf das Werk eines Siegerländer Künstler-Ehepaars
Mit einer umfänglichen Werkschau erinnert das 4Fachwerk-Museum an das Künstler-Ehepaar Achenbach. Der Kuratorin der Ausstellung, Dr. Ingrid Leopold, ist es gelungen, eine große Exponate-Auswahl zusammen zu tragen, womit umfassend die künstlerische Vielfalt und das Können von Hans und Hanna Achenbach deutlich werden. Zeitzeugen sahen in ihnen einst die „profiliertesten Vertreter der Siegerländer Künstlerschaft“.
Die Besucher der Vernissage zeigten sich von dem schöpferischen Erbe beeindruckt, fasziniert, dass auch nach Jahren die Bilder nichts von ihrer Wirkung eingebüßt haben. Diese belegten eindrucksvoll, wie vielschichtig und tiefgründig gerade schlichte Darstellungsweisen sein können.
Ihren gemeinsamen Siegerländer Lebensweg begannen Hans und Hanna Achenbach in (Netphen-) Obernau. Ein wohl gesuchter und gefundener Sehnsuchtsort: „Ich liebe die stille Schönheit Deiner Heimat und ich würde gerne auf einem Dorf und in bäuerlicher Umgebung leben,“ zitiert in einem Bericht Erika Falkson aus einem von Hanna Achenbach in Gleiwitz verfassten Brief an eine Siegener Freundin. „Den Reichtum des einfachen Lebens hat Hans Achenbach an der Quelle aufgesucht,“ porträtiert Hans Löw ihren Ehemann 1953. Die Wahl der Umgebung, die Einsamkeit des Siegerländer Lebens, dürfte ein Wesensbekenntnis sein, heißt es bei ihm weiter.
Am 25. November 1920 hatten Hans Achenbach und Hanna Junemann in Düsseldorf-Eller geheiratet. Beide lernten sich während ihres dortigen Kunststudiums kennen. Zwei Jahre leben die Achenbachs bescheiden von ihrer künstlerischen Tätigkeit in Obernau. 1923 und 1924 werden ihre beiden Töchter (Karin 1923, Renate 1924) geboren. Ihr Zuhause wird Siegen. Sie wohnen im elterlichen Haus von Hans Achenbach, 1938 konnten sie in ihr eigenes Eigenheim in der Winschenbach einziehen.
Beide üben zugleich einen Lehrberuf aus: Sie unterrichten „künstlerisches Weben“ an der Siegener Auschule. Von 1933 bis 1937 leitet Hans Achenbach den Fachbereich Weben an der Berufsschule für Mädchen in Siegen.
„Der Start in den Berufsalltag als freischaffendes Künstlerpaar war anfänglich nicht leicht, aber anderes hatten sie nicht erwartet, – sie waren zufrieden und genügsam. Die persönlichen Ansprüche an ihr Leben waren bescheiden. Der erste größere Auftrag war die Gestaltung der Kirchenfenster in Dorlar bei Wetzlar,“ legte Dr. Ingrid Leopold in ihrer Ansprache zur Eröffnung dar.
Hanna Achenbach ((1892-1982, Maria Johanna Junemann) erblickt am 2. Dezember 1892 in Dortmund das Licht der Welt – als Tochter des Fabrikdirektors Johann Konrad Junemann und seiner Ehefrau Maria. Als 22-jährige nimmt sie 1914 ihr Studium an der Kunstgewerbeschule in Düsseldorf auf, das bis 1919 andauert. Hier lernt sie ihren Mitstudenten Hans Achenbach kennen und lieben.
Wilhelm Ludwig Hans Achenbach (1891-1972), so sein vollständiger Name, entstammt ebenfalls einer Fabrikantenfamilie. Sein Vater Caspar Gustav Achenbach (1858-1915) war Mitbegründer des „Ohler Eisenwerks Achenbach, Kölsche & Co. Er hatte Emilie Berta Schneider (1865-1944) geheiratet, Hans, geboren am 3. März 1891, ist ihr zweiter Sohn.
Ihren Siegerländer Wurzeln folgend, ziehen Hans Eltern im Jahr 1900 nach Siegen. Nach dem Besuch des hiesigen Realgymnasiums studiert Hans Achenbach an der Königlich-Preußischen Kunstakademie Düsseldorf, denen sich Ausbildungen an den Kunstgewerbeschulen Düsseldorf und Wuppertal anschließen. Im Jahr 1913 kehrt er zunächst nach Siegen zurück und begibt sich ein Jahr später nach München, um hier aktuelle Kunstentwicklungen mitzuerleben. Der I. Weltkrieg bestimmt dann Hans Achenbachs Biografie. Es heißt, er meldet sich 1915 freiwillig als Soldat und nimmt am Kriegsgeschehen bis 1918 teil. Nach seiner Heirat mit Hanna Junemann sind beide bald dem Siegerland fest verbunden.
Hans Achenbach engagiert sich früh beim 1922 gegründeten Arbeitskreis Siegerländer Künstler (ASK). Eine Zeitungsanzeige nennt Hans und Hanna Achenbach-Junemann als Ausstellende („Malerei und Graphik“) bei der „Weihnachtsausstellung des Siegerländer Kunstvereins“ in der „Gesellschaft Erholung“. In den Nachkriegsjahren sind beide dann über Jahrzehnte bei den ASK-Ausstellungen regelmäßig vertreten, Hans Achenbach bezeichnet die Presse als „Nestor der Siegerländer Künstlergemeinschaft“ „Er ist als Künstler konsequent seinen Weg gegangen,“ sagt sein Kollege Theo Meier-Lippe über ihn.
„Hans Achenbach beschäftigte sich mit fast allen Techniken der bildenden Kunst. Er war Maler, ebenso wie Zeichner und Grafiker, und beherrschte auch die Hinterglasmalerei,“ porträtiert ihn Dr. Ingrid Leopold. Die Betrachtung der Natur, von Landschaften und Tieren, das Beobachten des nahen Umfeldes der Menschen, ihre Arbeitsgewohnheiten im Jahresverlauf verbinden Hans und Hanna Achenbach, die jedoch zu jeweils ganz eigenständigen charakteristischen Ausdrucksformen finden. Löw zitiert aus einem Brief Achenbachs aus dem Jahr 1947: „Für mich ist das Märchen die Urform aller Kunst.“ Märchen und Mythen hätten seinen Bildern die Signatur gegeben. „Achenbach bleibt immer im Märchenhaften, im Lebendigen, von der Phantasie Beflügeltem,“ ist in einem Zeitungsbeitrag 1954zu lesen. Seine Werke seien „klar und kindlich, aber nicht kindisch.“ Ähnlich „wie trauliche Volksmärchen, feinfühlig ausgearbeitet, lebendig“ werden seine Monatsblätter in einem Zeitungsbericht 1952 beschrieben. Den Reichtum des einfachen Lebens habe Hans Achenbach an der Quelle aufgesucht.
Die Einfachheit ihrer Umgebung bestätigte Dr. Martin Grotepaß über seine Großeltern Achenbach am Eröffnungsabend: „Die Einrichtung war spartanisch, überall standen Bilder herum. An Zank und Streit kann ich mich nicht erinnern, aber an die Großherzigkeit und liebevolle Zuwendung von Oma und Opa, auch den Mitmenschen gegenüber.“ Bis heute erinnert er sich gerne an die sonntäglichen Besuche dort.
Hier dokumentiert sich die Seelenverwandtschaft des Künstlerehepaars. Denn: „Das einfache Leben in ihrem Umkreis regte sie zu vielen starken Bildern an,“ heißt es über Hanna Achenbach. „In ihren Portrait- und Genrebildern von Kindern und einfachen Menschen, Bäuerinnen und Marktfrauen, zeigt sie sich immer wieder als Heimatchronistin,“ schreibt Erika Falkson über sie. Ihre Bilder seinen dem Leben „abgelauscht“, ein Ergebnis intensiver Beobachtung. Hanna Achenbachs Credo: „Ich möchte das (meine Bilder) für alle verständlich sind. Man soll spüren, dass mich die Menschen und das Leben intensiv beschäftigt haben.“ Dr. Ingrid Leopold erinnert auch an Vorbilder: „Beeindruckt war Hanna Achenbach von dem Worpsweder Malerkreis, – insbesondere von Paula Modersohn-Becker. Beide Künstlerinnen gleichen sich in Sujet und Stil und sind Meisterinnen in der Wiedergabe von Alltagsmenschen und Kindern.“
Apropos Heimatchronist: Das vielfältige Siegerländer Leben verewigt Hans Achenbach ebenso auf zahlreichen Kalenderblättern, die in den Ausgaben des „Siegerländer Heimatkalenders“ erschienen sind. In einer bemerkenswerten Artikelfolge haben Alfred Becker, Kirsten Schwarz und Cornelia Becker(-Bartscherer) die Zeichnungen inhaltlich zu- und künstlerisch eingeordnet (SIEGERLAND 2008, 2009) und damit eine wichtige Retrospektive auf sein Werk vorgenommen. „Sein vielfältiges Werk wurde bestimmt von Naturverbundenheit, Tierliebe und der Faszination guter Geschichten,“ so ein Fazit von Kirsten Schwarz (SIEGERLAND 86, 2009).
„Hans Achenbach liebte und beobachtete Tiere. Er stellte sie dar in der Monotypie-Technik, – expressionistisch beeinflusst, – wobei die Anatomie auf den äußeren Umriss reduziert und abstrahiert war,“ so Dr. Ingrid Leopold in ihrer Erläuterung.
Die Ausstellung zeigt ebenso eine Reihe christlicher Motive. „Die christliche Ethik war ihnen sehr wichtig,“ berichtet dazu Dr. Martin Grotepaß über die Einstellung der Großeltern. Über das Zerwürfnis zwischen Katholiken und Protestanten hätten sie sich sehr geärgert.
Die Präsentation „Hans und Hanna Achenbach – ein Künstlerehepaar aus dem Siegerland“ wird bis zum 22. Januar 2023 im 4Fachwerk-Museum zu sehen sein. Der Eintritt beträgt drei Euro. Das Museum ist mittwochs, samstags und sonntags von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet. Sonderführungen können abgesprochen werden.“
Auch die Berichterstattung in der Siegener Zeitung vom 12.11.22 zur Ausstellung enthält keine Hinweise: http://www.siwiarchiv.de/wp-content/uploads/2022/11/SZ121122.pdf
Mir scheint die regionale Kunstgeschichte in der Zeit des Nationalsozialismus immer noch ein auf zu arbeitendes Thema zu sein. Meine knappe Beschäftigung mit Hermann Manskopf zeigt dies ebenso wie die Nicht-Beschäftigung der Arbeitsgemeinschaft der Siegerländer Künstler (ASK) in deren „Jubeljahr“. Der ausführliche Katalog bringt lediglich den Wiederabdruck eines älteren Beitrags von Jürgen Schawacht und lässt die zwischenzeitliche „Debatte“ von Kirsten Schwarz und Ulrich Opfermann unberücksichtigt. Wenn ich es recht sehe, war gerade das Ehepaar Achenbach der Nukleus der ASK in den 30er und 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts.
– Schlaglichter aus 75 Jahren Verbandsgeschichte, Heft 10/22, S. 51 – 525
– Der Landkreistag festigt sich: Die zweite Mitgliederversammlung in Bergisch Gladbach, Heft 11/22, S. 545 – 549 [mit Hinweisen zu OKD Moning und Landrat Josef Büttner]
Eindrücke von der Ausstellungseröffnung (Fotos: Jens von Heyden):


Pingback: 4Fachwerk-Museum Freudenberg: Adventliche Sonderführungen durch Achenbach-Ausstellung | siwiarchiv.de
Aufzeichnung des Vortrags:
Pingback: Literaturhinweis: Andreas Marchetti: „Im Dienst der Kreise – Im Dienst der Menschen | siwiarchiv.de
s. a. Video des Siegerlandmuseum vom 27.11.2022:
s. a.
– Joseph Wilhem Büttner, in: Westfalenspiegel , Jg. 3 (1954) H 10 (Sonderheft Siegerland), S. 22
– Westfalenpost 10.3.1951, 8.12.1954
– Schiemer, Hansgeorg: 40 Jahre CDU für Siegerland und Wittgenstein (Schriftenreihe des CDU-Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein e.V. Nr.6), Siegen 1986, S. 8, 14 – 17, 19 – 20, 28 – 30, 34 – 35, 43, 46, 51, 54 – 56, 66, 70, 76, 107, 112
Pingback: Heft 97 der „Archivpflege in Westfalen-Lippe“ ist bald (?) online – Archivalia
Die einzelnen Beiträge sind im Inhaltsverzeichnis anklickbar und somit lesbar.
Jetzt auch online (via Archivalia): https://50jahre.uni-siegen.de/files/2022/06/Festband_fuenfzig_USi.pdf
Hallo, mein Name ist Horst Klostermann, ich bin der Sohn von Gretel Klostermann. Otto Albers war mein Patenonkel. Ich habe auf der Sietas
Werft gearbeitet, aber die Liebe hat mich auch ins Siegerland gebracht.
Schön, dass Sie sich melden! Haben Sie eventuell noch Fotos o.ä. zur „Siegerland“?
Inhaltsverzeichnis 64 (2022):
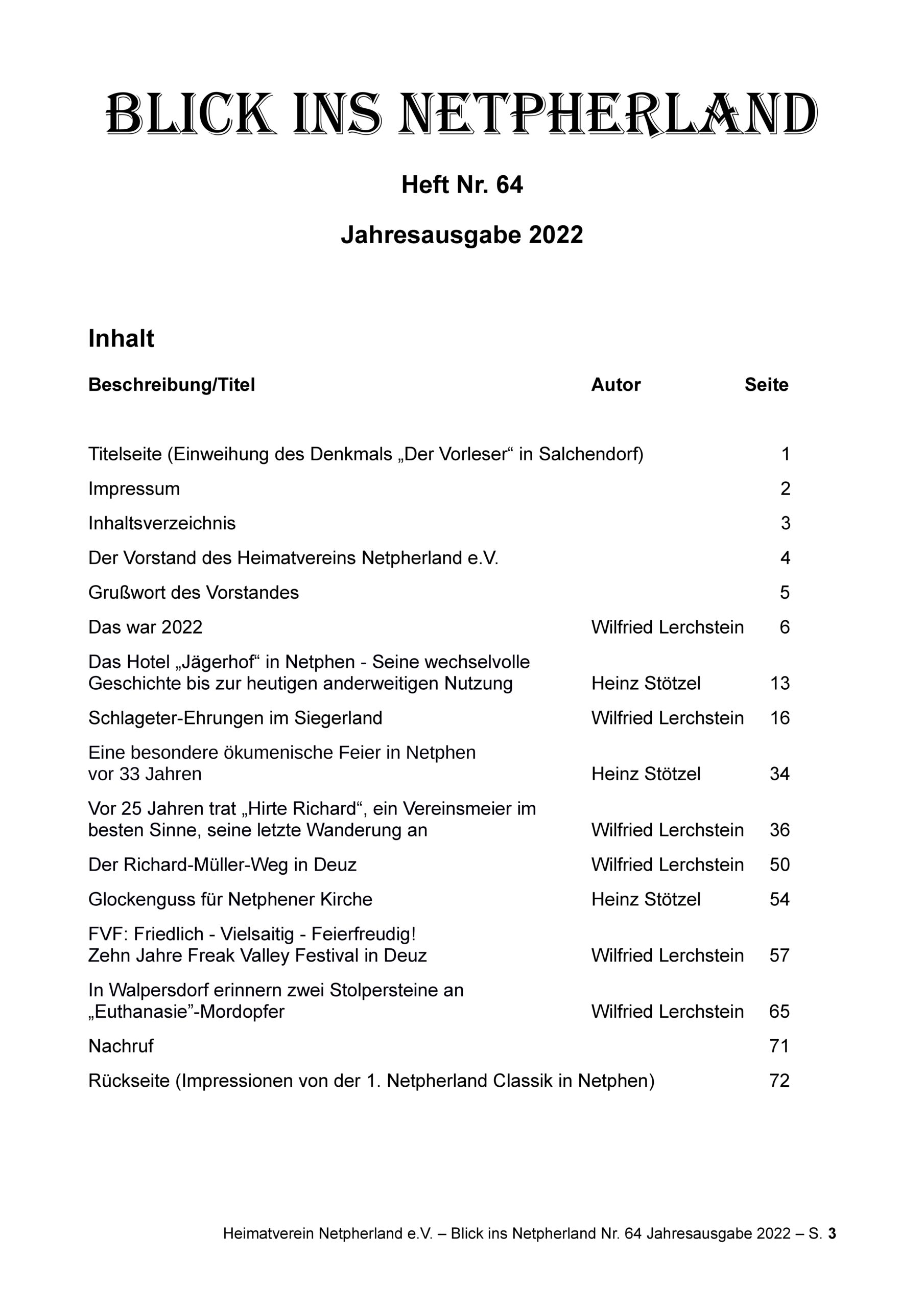
s. a.
Literaturhinweis zu Johann Moritz:
MONTEIRO, Carolina. „Slavery at the Court of the ‚Humanist Prince‘ Reexamining Johan Maurits van Nassau-Siegen and his Role in Slavery, Slave Trade and Slave-smuggling in Dutch Brazil.“ Leiden: Journal of Early American History, 2020, pp. 3-32.
Unser Archivar vergaß, seinen Literaturhinweis mit dem frei zugänglichen Volltext zu verlinken. (Zu viel Glühwein?)
https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/access/item%3A2968361/view
Nö. Nicht vergessen, daher umso dankbarer für den Link!
Auf der Seite des Wittgensteiner Heimatvereins kommt Andreas Krüger in seiner Buchvorstellung zu folgendem Fazit: “ …. Bald beschränkt sich in seinem lesenswerten und nachdenklichen Buch nicht auf die Todesanzeigen im Wittgensteiner Kreisblatt, er beschreibt dabei auch die Geschichte und Gestaltung der Zeitung, ihre Herausgabe und Drucker Matthey, Winckel sen., Winckel, jun. der Unternehmen bis zum Brand der Druckerei im Jahr 1976. Er schlägt den Bogen bis in die Gegenwart, zu den heutigen Todesanzeigen, den Veränderungen der Trauerkultur in den letzten Jahren, sei es hinsichtlich Form, Gestaltung und Inhalt von Todesanzeigen, dem Verzicht auf eine „Traueranschrift”, bis hin zum Wegfall des „Beerdigungskaffees”, oft verbunden mit der Formulierung „Wir gehen still auseinander”. Bald kritisiert nicht die Veränderungen, er stellt sie fest, er beschreibt sie.
Ein Buch, das einen großen Bogen schlägt aus dem „langen 19. Jahrhundert” bis in die Gegenwart, auch wenn der Titel in dieser Beziehung ein wenig täuscht. Hinsichtlich der historischen und biografischen Beschreibungen lesenswert, nachdenklich mit Blick auf die Entwicklungen der letzten Jahre.“
Lars Peter Dickel stellt auf der Homepage der Westfalenpost ebenfalls das Buch vor – leider hinter der Bezahlschranke.
Pingback: Frachtschiff „Siegerland“ – weitere Bilder | siwiarchiv.de
Zum Projekt s. Westfälische Rundschau, 19.3.2022:

Pingback: Bund beteiligt sich mit 378.419 Euro an dem Projekt „Alte Synagoge“ in Bad Laasphe | siwiarchiv.de
Pingback: Türchen 19 – 19.12.2022 – Winterfreuden – Meta-Adventskalender-Adventskalender
Pingback: Video: Sage „Das Bergmännchen“ | siwiarchiv.de
Pingback: Sagen aus dem Siegerland – Archivalia
Pingback: Neue Literatur zur Monatanarchäologie Südwestfalens | siwiarchiv.de
Weil derzeit so viel gesungen wird:
Vertonung einer Ode von Gustav Berlyn in
Sechs vierstimmige Lieder für gemischten Chor von Louis Spohr, Hamburg 1874, S. 21-23.
https://www.google.de/books/edition/Sechs_vierstimmige_Lieder_f%C3%BCr_gemischte/tkcCPzS9MPAC
Und weil man bei diesem trüben Wetter nur ungern aufsteht:
Dr. med. Christian Berlyn (Gustavs Vater), Schnelle Heilung einer langwierigen Bettsucht, in: Rheinische Monatsschrift für praktische Ärzte 4 (1850), S. 341-343.
https://books.google.de/books?id=ZigDAAAAYAAJ
Das Westfälische Autorenlexikon weist auf 2 Briefe Berlyns an L(o)uis Spohr, (Freudenberg 1855-1857) hin, die sich in der Hessischen Landesbibliothek in Kassel befinden. Vielleicht finden sich dort Hinweise zur Vertonung.
Pingback: Siegerland 2/2022 erschienen | siwiarchiv.de
Von privater Seite erhielt ich via E-Mail noch folgende Informationen zur Familie Berlyn:
“ …. Nach meinen Unterlagen lebte Christian Berlyn in den Jahren 1787 bis 1857 (Namentliche Nachweisung der in Freudenberg ansässigen Medizinal-Personen 1843 – 1894). Interessant ist, dass sich von ihm z.B. in der „Zeitschrift für psychische Aerzte“, Erster Band, Leipzig 1818 ein Aufsatz „Einer langwierige psychische Erkrankung, durch psychische Mittel schnell geheilt“ findet. (S. 363)
Bekannt geworden ist mir ein Brief des Arztes Johann Claudius Renard (Professor in Mainz und hessischer Leibarzt 1778-1827) vom 19. XI. 1817 an den Arzt Franz Gerhard Wegeler in Koblenz, in dem er „Ew. H. Wohlgebohren ‚den jungen Arzt und Geburtshelfer Christian Berlin aus Uerdingen am Rhein zur Wiedereinstellung durch die K. Preuß. Regierung‘ empfiehlt.
In FiZ 1/1991 erwähnt ihn G. Thiemann (Aus den Aufzeichnungen der Kirchengemeinde Oberholzklau) im Zusammenhang mit einem Bericht, den Pfarrer Dißmann dem Presbyterium am 3. Februar 1839 schilderte: „…In Freudenberg gab es den ‚Bürgermeisterey-Armen-Arzt‘ Dr. Berliyn“.
Die Familie Berlyn – zumindest zuletzt sein Sohn – bewohnte ein markantes Bürgerhaus neben der katholischen Kirche an der Bahnhofstraße, in dem später das Hotel „Kölner Hof“ eingerichtet wurde. ….“
– Martin Klein, Hauptgeschäftsführer des Landkreistags Nordrhein-Westfalen: Eine Heimstatt für die Kreise: Die Standorte der Geschäftsstelle des Landkreistags in Düsseldorf, Heft 12/22, S. 597-601
Aus(riss) dem Jahresrückblick der Westfälischen Rundschau von heute:
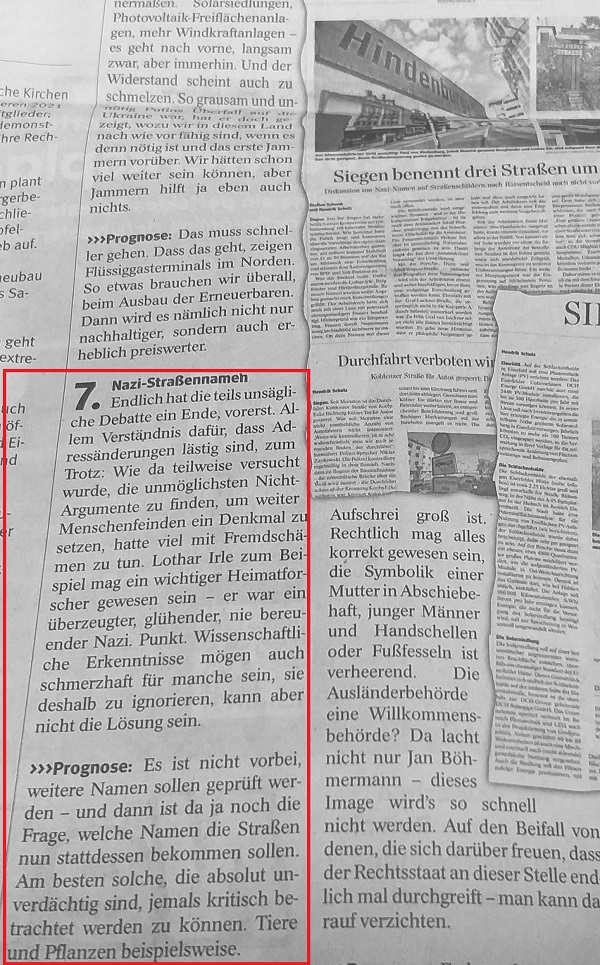
Der restauratorische Weg einer Akte- Teil 6: Wässrige Entsäuerung
Pingback: Wittgenstein Heft 2 (2022) erschienen | siwiarchiv.de
Wann hat die Ratssitzung denn nun stattgefunden?
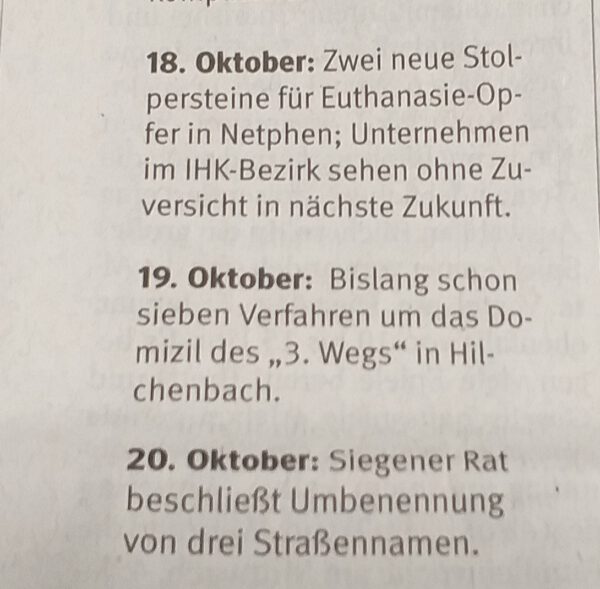
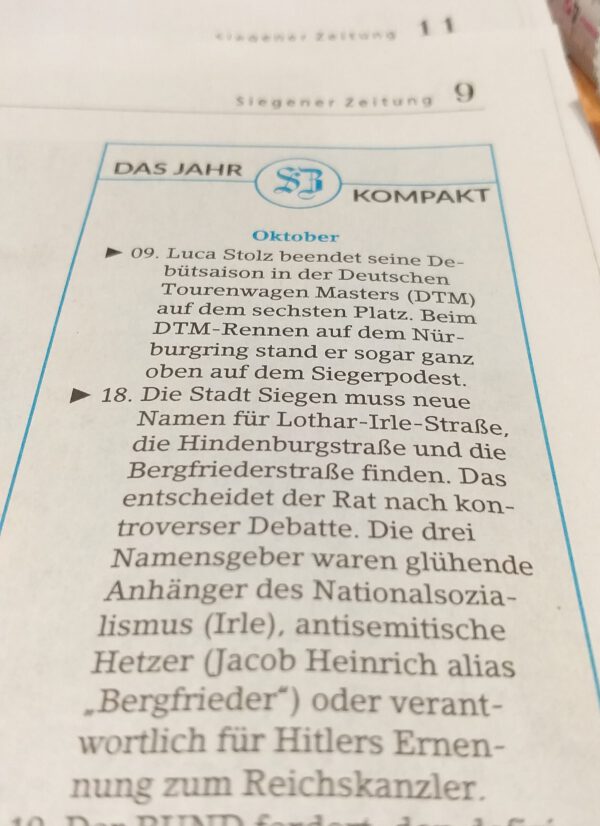
Jahreschronik der Westfälischen Rundschau, v. 30.12.2022
„gegen“
Jahreschronik der Siegener Zeitung v. 30.12.2022
Hallo Siwarchiv.de
Das letzte Mal war ich vor 10 Jahren mit Ludwig Kirchhoff beschäftigt und auf dieser Seite. Durch Zufall sehe ich, daß sich damals ein paar Leute ebenso dafür interessierten und Fragen hatten. Ich habe das nicht gesehen. Kann man daran anknüpfen, nach so langer Zeit?
Vielen Dank für Ihr Interesse und gutes Neues Jahr.
Mit freundlichem Gruß Ihr Heinz Werner.
Zu Yohanan Meroz s. Yohanan Meroz: In schwieriger Mission. Als Botschafter in Bonn, Berlin 1986, Link zu einer aktuellen Besprechung: https://www.hagalil.com/2023/01/in-schwieriger-mission-als-botschafter-in-bonn/
Pingback: Siwiarchiv hat Langeweile und nimmt Archivalia zur Kenntnis – Archivalia
Pingback: 2 Videos (engl.): David De Jong über Friedrich Flicks Kriegsverbrechen | siwiarchiv.de
Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes:
B 82 (Rechtsabteilung, Staats- und Verwaltungsrecht)-REF. 502/V3/758 Staats- und verwaltungsrechtliche Einzelfälle
(1961) 1968 – 1971
enthält u. a.: – Schach-Olympiade in Siegen, v.a. Teilnahme Rhodesiens
B 94 (Wissenschaft, Hochschulen, Jugendfragen, Sport, Medizinalangelegenheiten: Förderung des Sports)-REF. 604/IV5/580
Internationale Sportveranstaltungen in Deutschland
1970 – 1971
Enthält u.a. : – Klärung der Teilnahme südafrikanischer Spieler an der Schach-Olympiade in Siegen, 1970
Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes:
RZ 501/60613
Geheime Verschlußsachen des Referats Kult Gen C / Kult K
Dez. 1938 – Aug. 1941, enthält u.a. – Absage eines Gastspiels von Wilhelm Furtwängler in Stockholm – „deutschfeindliche“ Betätigung des Generalmusikdirektors Fritz Busch
RAV 250-1[Gesandschaft Stockholm]/1293
[Künstlerische Propaganda -] Konzerte, Theatergastspiele usw., Band 13
Okt. 1938 – Mai 1939, enthält u.a.: – Haltung Fritz Buschs zur Verpflichtung dt. Künstler
Der restauratorische Weg einer Akte- Teil 7: Anfasern
Pingback: Vortrag zur Zwangsarbeit auf der Verbundgrube Füsseberg-Friedrich Wilhelm | siwiarchiv.de
Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes:
– P 11 (Personalfragebögen aus dem Jahr 1944) /1, Achenbach, Ernst, Dr. (9.4.1909 – 2.12.1991)
– P 1 (Personalakten Altes Amt) /11, 12, Achenbach, Ernst, Dr. (9.4.1909 – 2.12.1991)
– RZ 502/60825, Dienstbetrieb der Abteilung VI des Auswärtigen Amts: Verschiedenes, Juli 1938 – Aug. 1943, enthält u.a.: – Leitung des Referats Kult Pol U durch Gesandtschaftsrat Dr. Ernst Achenbach, Mai 1943;
– kommissarische Leitung des Referats Kult Spr durch Gesandtschaftsrat Dr. Ernst Achenbach, Juli 1943
– RZ 502/60845, Dienstbetrieb der Abteilung VI: Personalien, Aug. 1942 – Juli 1943, enthält u.a.: Gesandtschaftsrat Ernst Achenbach
– RAV 204-1(Botschaft Paris)/1713, Achenbach, Dr. Ernst; Gesandtschaftsrat, 1936-1944
– B 2-B STS (Büro Staatsekretäre)/84, Wiedervereinigung, (1954-1957) 1959 – 1962, enthält u.a.: – Vorschlag von MdB Achenbach zur Deutschland- und Berlin-Frage; 1962
– B 8-ZA (Protokollabteilung [Orden])/107068, Achenbach, Dr. Ernst, 1965 – 1975
– B 10-ABT. 2 ((politisches Abteilung)/2168, Kriegsverbrecherprozesse in Belgien u.a. gegen von Falkenhausen – Exposé des faits e cause Reeder déposé par la défense allemande du président Reeder von Prof. Dr. Fr. Grimm und Dr. E. Achenbach (Druckschrift), 1951
– B 20-REF. 200 (Europäische Wirtschaftsgemeinschaft)/IA2/1645, Kommission der EG; hier: Mitglieder; SB: Kandidatur Achenbach, 1965 – 1970
– B 118-REF. 117 (Politisches Archiv)/329, Benutzung durch amtseigene Stellen Enth. u.a.: Akten für die deutsch-niederländischen Ausgleichsverhandlungen -Veröffentlichung über MdB Ernst Achenbach, 1957-1961
– B 118-REF. 117 (Politisches Archiv)/141 Übernahme von Nachlässen und Aufzeichnungen Amtsangehöriger, A – Be, 1954-1965, Enthält u.a. : – Achenbach, Ernst
– B 150-AAPD/206, Dokumente für die Edition Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland
1.7.1970 – 11.7.1970, enthält u. a: 06.07. Vermerk des Staatssekretärs Frank für Bundesminister Scheel [ohne Az], offen
(handschriftl. Vermerk über Gespräch mit MdB Achenbach)2 Seiten, VS-Bd. 1066 (Ministerbüro)
– B 150-AAPD/216, Dokumente für die Edition Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland
1.11.1970 – 10.11.1970, enthält u.a.: 09.11. Vortragender Legationsrat I. Klasse Hofmann an die Handels- MB 3347/70 vs-v
vertretung in Warschau, DE Nr. 357; AA ab: 18.11 Uhr, Betr.: Mögl. nochmalige Reise von MdB Achenbach nach Warschau
– NL 274/(Nachlass Rudolf Schleier), 7, Materialsammlung (Korrespondenz, Abschriften, Zeitungsausschnitte, Notizen, Aufzeichnungen)
ohne Datum, enthält u.a.: Schreiben R. Schleier an Dr. Achenbach. 30.03.1949 Verhandlungstermin vom 10.05.49; Schreiben R. Schleier an Dr. Achenbach. 13.06.1949
– NL 274/9, Materialsammlung (Korrespondenz, Abschriften, Zeitungsausschnitte, Notizen, Aufzeichnungen)
ohne Datum, enthält u.a.: Erklärung betr. Dr. Achenbach 28.02.41
NL 274/16, Materialsammlung (Korrespondenz, Abschriften, Zeitungsausschnitte, Notizen, Aufzeichnungen)
ohne Datum, enthält u.a.: 1 Br. R. Schleier an Dr. Achenbach. 20.12.1958
-NL 274/33, Materialsammlung (Korrespondenz, Abschriften, Zeitungsausschnitte, Notizen, Aufzeichnungen), ohne Datum, Enthält u.a. : Verhör Schleiers zur Person Dr. Achenbach Zeittafel Frankreich (1949)
NL 274/34, Materialsammlung (Korrespondenz, Abschriften, Zeitungsausschnitte, Notizen, Aufzeichnungen), ohne Datum, Enthält u.a. : Schreiben Dr. Ernst Achenbachs an Schleier. 26.11.1957
– NL 274/35, Materialsammlung (Korrespondenz, Abschriften, Zeitungsausschnitte, Notizen, Aufzeichnungen), ohne Datum, Enthält u.a. : Korrespondenz Schleiers zugunsten von Abetz mit Dr. Ernst Achenbach 02.01.1952
– NL 274/43, Materialsammlung (Korrespondenz, Abschriften, Zeitungsausschnitte, Notizen, Aufzeichnungen), ohne Datum, Enthält u.a: Jaffré, Avocat à la cour, an E. Achenbach. 06.04.51, Dr. Achenbach an Schleier. 22.05.51, Schleier an Dr. Achenbach. 06.07.49-19.10.51, Schleier an Achenbach. 14.01.52
– NL 274/63, Materialsammlung (Korrespondenz, Abschriften, Zeitungsausschnitte, Notizen, Aufzeichnungen), ohne Datum, Enthält u.a. : Der Auftrag Paris (1940) Stellvertreter von Abetz, Zusammensetzung der nach Paris entsandten Delegation: Professor Dr. Friedr. Grimm, Dr. Friedr. Sieburg, Dr. Carl Epting (bis Kriegsbeginn Leiter d. Dienststelle des Deutsch. Akademischen Austauschdienstes Paris), Dr. Ernst Achenbach, Deutsch-französische Gesellschaft: Prof. Achim von Anim, Abetz, Prof. Dr. Grimm, Reichskriegsopferführer Hanns Oberlindober u. Schleier.
– NL 259 (Nachlass Heinz Günther Sasse, Geschichte des Auswärtigen Amtes)/166, Ernst Achenbach, Fritz Gebhard von Hahn, Karl Klingenfuß, Hans Limpert, Herbert Müller-Roschach, Henning Schlottmann, Franz von Sonnleithner, Eberhard von Thadden, ohne Datum
Enthält :
Abschriften, Notizen, Kopien, Aufzeichnungen, Zeitungsartikel
Ein interessanter Sammelbestand im Bundesarchiv für die Erarbeitung einer Biographie dürfte „AllProz 3“ (=Alliierte Prozesse. Handakten von Rechtsanwälten) sein. Unter der dem Gliederungspunkt 18 finden sich 85 Akten des Anwalts Walter Siemers zur Verteidigung von Bernhard Weiss.
Pingback: Ausstellung: „Daniel Hees: Die Vögel. Hommage an Aristophanes. | siwiarchiv.de
Pingback: Siegen: Schlossmauer-Sanierung wird in diesem Jahr abgeschlossen | siwiarchiv.de
Pingback: #archivemadness – eine Blogparade | siwiarchiv.de
Pingback: #archivemadness – eine Blogparade – Archivalia
Pingback: Online-Recherche des Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes | siwiarchiv.de
Pingback: Internationale Tagung: „Ein transnationales Leben: Bausteine zur Biographie von Johann Konrad Dippel“ | siwiarchiv.de
„Schmick, Heinrich
Geboren den 27. August 1824 zu Unglinghausen bei Siegen, kommissarischer Lehrer an der Realschule zu
Siegen vom 1. Mai 1848 bis 1. Juni 1850, dann Rektor der höheren Stadtschule zu Kirchen vom 1. Juli 1850 bis 14. November 1851, darauf vom Sommer 1852 bis 1857 mit Unterricht und Studien in England und Frankreich beschäftigt. Von April 1857 bis Herbst 1857 Lehrer an der höheren Bürgerschule zu Bremen, von Herbst 1857 bis 1859 Lehrer an der Realschule zu Görlitz, von Herbst 1859 bis 1. Juni ej. wiederum Lehrer an der höheren Bürgerschule zu Bremen und von da ab zuerst 5. und gegenwärtig 3. Oberlehrer an der Realschule (Realgymnasium) zu Köln am Rhein. Unter dem 12. Februar 1874 wurde ihm der Professoren-Titel verliehen. Von ihm sind im Druck erschienen:
1) Mitteilungen aus dem englischen Schulleben. Köln 1868. 28 S. (Programm Köln Realgymnasium.)
2) Die Umsetzungen der Meere und die Eiszeiten, ihre Ursachen und Perioden. Köln, DuMont-Schauberg,
1869.
3) Thatsachen und Beobachtungen zur weiteren Begründung der neuen Theorie einer Umsetzung der Meere
etc. Görlitz, Remer 1871.
4) Die neue Theorie periodischer säcularer Schwankungen des Seespiegels etc. bestätigt durch geognostische und geologische Befunde. 2. Ausgabe. Leipzig, A. Georgi 1872.
5) Das Fluthphänomen und sein Zusammenhang mit den säcularen Schwankungen des Seespiegels. Leipzig, K.
Scholtze 1874.
6) Die Aralo-Kaspi-Niederung und ihre Befunde. Leipzig K. Scholtze 1874.
7) Die Gezeiten, ihre Folge- und Gefolge-Escheinungen. Leipzig, K. Scholtze 1876.
8) Der Mond als glänzender Beleg etc. Leipzig, K. Scholtze 1876.
9) Sonne und Mond als Bildner der Erdschale. Leipzig, A. Georgi 1878.
10) Ein Wissen für seinen Glauben. Köln, Lengfeld’sche Buchhandl. 1878.
11) Sonne und Mond als Motoren und Anordner der beweglichen Bestandteile der Erde, für die Schüler der
Oberklassen dargestellt. Köln 1879. 29 S. (Programm Köln Realgymnasium.)
Aus: Programm Köln Realgymnasium 1878“
aus: Kössler, Franz: Personenlexikon von Lehrern des 19. Jahrhunderts.
Berufsbiographien aus Schul-Jahresberichten und Schulprogrammen 1825 – 1918 mit Veröffentlichungsverzeichnissen, Band: Schaab – Scotti, Vorabdruck (Preprint), Stand: 18.12.2007, S. 166
Online einsehbare Werke Schmicks:
– Mittheilungen aus dem englischen Schulleben, in: Jahresbericht über die Realschule I. Ordnung zu Köln für das Schuljahr 1867-1868, Köln 1868
– Die Umsetzungen der Meere und die Eiszeiten der Halbkugeln der Erde, ihre Ursachen und Perioden, Köln 1869 via BSB
– Thatsachen und Beobachtungen zur weiteren Begründung seiner neuen Theorie einer Umsetzung der Meere durch die Sonnenanziehung und eines gleichzeitigen Wechsels der Eiszeiten auf beiden Halbkugeln der Erde zusammengestellt, Görlitz 1871 via BSB
Das Flutphänomen und sein Zusammenhang mit den säkularen Schwankungen des Seespiegels; Untersuchungen, auf Grund neueren und neuesten Materials angestellt, Leipzig 1874, via HathiTrust
– Die Aralo-Kaspi-Niederung und ihre Befunde im Lichte der Lehre von den säkularen Schwankungen des Seespiegels und der Wärmezonen, Leipzig 1874 via BSB
– Die Gezeiten, ihre Folge- und Gefolge-Erscheinungen: weitere Studien an Parallel-Flutkurven entgegengesetzter Breiten, etc. etc, Leipzig 1876, via BSB
– Der Mond als glänzender Beleg für die kosmisch bewirkte säkulare Umlegung verschiebbarer Bestandtheile der Weltkörper: eine Studie, Leipzig 1876, via BSB
– Sonne und Mond als Bildner der Erdschale erwiesen durch ein klares Zeugnis der Natur, Leipzig 1878, via BSB
– Die neue Theorie periodischer säkularer Schwankungen des Seespiegels und der Temperaturhöhe bestätigt durch geognostische und geologische Befunde: einige zusätzl. Betrachtungen ; Studien, Leipzig 1878, via BSB
– Ein Wissen für einem Glauben. Naturstudien, den zweifelden zur Beruhigung vorgelegt, Köln 1878, via HathiTrust)
– Der Mars eine zweite Erde, Leipzig 1879, Alexandria digital
– Übersetzung: Squier, Ephraim G.: Peru: Reise- und Forschungs-Erlebnisse in dem Lande der Incas, Leipzig 1883, via BSB
– Ist der Tod ein Ende oder nicht? Gespräche über das Erdenleben und die Menschennatur, Leipzig 1888 via HathiTrust
s. a.
Ebenfalls online:
– Die Umsetzungen der Meere und die Eiszeiten, ihre Ursachen und Perioden. Köln, DuMont-Schauberg,1869 via google books.
Die Zeichnung entstand um 1850 und stammt von dem in Unglinghausen geborenen Prof. Jakob Heinrich Schmick. In seinem bekannten Gedichtband auf Seejerlänner Platt „Riimcher uss d’m Seelerland“ ist auch das Gedicht „D’r Seejerlänner Mäckes“ enthalten. Da der Gedichtband in zahlreichen Auflagen immer wieder veröffentlicht wurde, ist es möglich, dass diese Zeichnung zur Illustration diente. Ich besitze zwar eine Ausgabe (Nachdruck der Ausgabe von 1882 im Verlag die Wielandschmiede von H. Zimmermann) die auch Illustrationen enthält (Siegerländer Hirte, Bergmann, Hammerschmied), aber das obige Bild der Familie der sog. „Mäckeser“ ist in dieser Ausgabe nicht enthalten. Vielleicht hat Herr Ulrich Opfermann da genauere Kenntnisse.
Auf Seite 98 im Siegerländer Heimatkalender 1934 sind sowohl diese Zeichnung als auch das mundartliche Gedicht „D’r Seejerlänner Mäckes“ abgedruckt. Danach (Fußnote) wurde die Federzeichnung „Die Mäckesfamilie“ dem Skizzenbuch von Jacob Heinrich Schmick entnommen.
Der Hinweis auf das Skizzenbuch Schmicks findet sich auch hier: Ebbinghaus, Gundula/Ebbinghaus, Rolf: Jacob Heinrich Schmick: Der bekannteste Unlinghausener, in: Bürgerverein Unglinghausen e.V.: 675 Jahre Unglinghausen 1344 – 2019. Aus alter und neuer Zeit. Unglinghausen in Wort und Bild, o. O 2019, S. 651 – 662
Ulrich Friedrich Opfermann hat die Zeichnung auf Seite 162 seines Buchs „Daß sie den Zigeuner-Habit ablegen“ – Die Geschichte der „Zigeuner-Kolonien“ zwischen Wittgenstein und Westerwald, abgebildet. Das Buch erschien 1996 bei Peter Lang, Frankfurt als Band 17 – Studien zur Tsiganologie und Folkloristik, herausgegeben von Joachim S. Hohmann. Im Bild die Schrift: „Irdengeschirrhändler – Federzeichnung, Siegerland, Mitte 19. Jahrhundert“
Die Zeichnung findet sich bereits in:
– Ulrich Opfermann: HeimatFremde. „Ausländereinsatz“ im Siegerland, 1939 bis 1945: wie er ablief und was ihm vorausging. Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung Bd. III, Hrsg.: Förderverein „Geschichte der Arbeiterbewegung und der Gewerkschaften für den Kreis Siegen-Wittgenstein“ e.V., Verlag, Siegen 1991, S. 15 mit dem Verweis auf den Siegerländer Heimatkalender und der Bildunterschrift: „Siegerländer jenische Famile mit Hund, Esel und Kiepen“ und in:
– Opfermann, Ulrich F., Sinti und Jenische – Ein Beitrag zur regionalen Minderheitengeschichte, Siegener Beiträge 20, 2015, 166-179 [S. 168]
@ Allen, die hier und auf Facebook zur Lösung beigetragen haben: Vielen Dank!
Ich habe die Suchanfrage auch genutzt die biographischen Veröffentlichungen zu Schmick zusammen zu stellen. Sie folgen hier noch.
Aber wie immer: ist die eine Frage gelöst, stellt sich die nächste, wo liegt dieses Skizzenbuch Schmicks?
Aufstellung der regionalen biographischen Literatur zu Jacob Heinrich Schmick:
– Bensberg, Heinz: “Vamm Brandewing stiff, dt Kend vrgesse“. Erinnerungen an den Unlinghäuser Lehrersohn Jacob Heinrich Schmick, in: Siegerländer Heimatkalender, 2003, 79, S. 130
– Ebbinghaus, Gundula/Ebbinghaus, Rolf: Jacob Heinrich Schmick: Der bekannteste Unlinghausener, in: Bürgerverein Unglinghausen e.V.: 675 Jahre Unglinghausen 1344-2019. Aus alter und neuer Zeit. Unglinghausen in Wort und Bild, o. O 2019, S. 651 – 662
– Faust Wilhelm: Jakob Heinrich Schmick, in: Siegerland 25 (1943), S. 13 – 21
– Faust Wilhelm: Jakob Heinrich Schmick, ein Deuter Siegerländer Volkstums, in: Siegener Zeitung v. 15.12.1943
– Henrich, Jakob, Jakob Henrich Schmick als Denker, in: Siegerländer Heimatkalender 30 (1955), S. 156 – 157
– Irle, Lothar: Siegerländer Persönlichkeiten- und Geschlechter-Lexikon, Siegen 1974, S. 293
– Kruse, Hans: Dem Siegerländer Dichter Jakob Heinrich Schmick zum Gedächtnis, in: Sauerländ. Gebirgsbote 40, 1932, S. 122 [mit Abb.]
– Menn, Walter: Hermann Romberg und Jakob Heinrich Schmick, in: Siegerland 19 (1937), S. 7 – 10
– NN: Das Geburtshaus des ersten Dichters der Siegerländer Mundart, Prof. Dr. Jacob Heinrich Schmick, geb. am 27. August 1824 in Unglinghausen, in: Heimatland, Siegen, 1, 1926, S. 161 [anonym; mit Abb.] –
– NN: Weihe einer Gedenktafel am Hause von Jacob Heinrich Schmick in Unglinghausen, in: Siegerland 14, 1931, S. 22f. [anonym; mit Abb.]
– NN: Ehrung des ersten Dichters der Siegerländer Mundart, Prof. Dr. Jakob Heinrich Schmick, in: Siegener Ztg. vom 30.5.1932 [anonym] –
– NN: Dem Gedächtnis eines großen Heimatdichters. Zum 50. Todestag von Prof. Dr. Jakob Heinrich Schmick, in: Siegener Zeitung v. 18.3.1955
– Plitsch, Heinrich: Dem ersten Dichter der Siegerländer Mundart Professor Dr. Jakob Heinrich Schmick zur 100. Wiederkehr seines Geburtstages, in: Siegener Zeitung v. 4.9.1924 (Unterhaltungsbeilage)
– Stähler, Otto: Drei Siegerländer Dichter (J. H. Schmick, H. Romberg, G. Hartmann), in:Mollat, Georg: Siegerländer Heimatbuch, Siegen 1914 , S. 126 – 127
– Vitt, Hans Rudi: Freundschaft in der Fremde. Jakob Heinrich Schmick und Ferdinand Freiligrath in England, in: Siegerländer Heimatkalender 32 (1957), S. 60-61
– Vitt, Hans Rudi: Johann Heinrich Schmick (1800 – 1859) Dorfschullehrer in Unglinghausen .Zum 100. Todestag seines Sohnes Prof. Dr. Jacob Heinrich Schmick, gestorben am 19. März 1905 in Köln, in: Siegerland 82 (2005), S. 43 – 48
– Vitt, Peter: Prof.Dr. Jacob Heinrich Schmick aus Unglnghausen, Blick in das Netpherland 61 (2019), S. 23 – 36
– Weyer, Wilhem: „Die Riimcher uss d’m Seejerland“ von Jakob Heinrich Schmick, in: Siegen und das Siegerland 1924, S. 64-69
Ist das ursprünglich wirklich eine Siegerländer bzw. Westerwälder Milieustudie gewesen? Es wäre in der Tat hilfreich, wenn das Skizzenbuch gefunden werden könnte – nicht zuletzt um die Frage zu klären, in welchem Kontext die Zeichnung dort steht. Sollte sie zwischen Mitte 1852 und Ende 1856 entstanden sein, wäre es unwahrscheinlich, dass sie eine deutsche „Mäckes“-Familie zeigt. Motive wie das dargestellte hätte Schmick aber in Irland, wo er sich ab dem Frühjahr 1853 eine zeitlang in einer der ärmsten Gegenden der Insel aufhielt, leicht finden können. (Zu Schmicks irischer Episode wäre einiges zu sagen – vielleicht später einmal.)
Eine nicht uninteressante Bagatelle: Auch Karl Marx hatte (einige Jahre vor Schmick) als Externer in Jena promoviert. Könnte das Schmicks spätere Entscheidung für Jena beeinflusst haben? Die beiden Herren waren in London im Freundeskreis Ferdinand Freiligraths miteinander bekannt geworden.
Apropos Freiligrath: Ein paar Briefe desselben an Schmick befanden sich seinerzeit im Privatbesitz des Sohnes Otto und wurden 1924 von Hans Kruse veröffentlicht. Was zu der Frage nach dem Schicksal des sicherlich umfangreichen Nachlasses J. H. Schmicks führt.
Die oben eingestellte Bibliographie ist sehr fragmentarisch. Das lässt sich ändern (wenn auch nicht von heute auf morgen).
Ich denke, dass bis zum 27. August 2024 – 200. Geburttag Schmicks – genügend Zeit ist, sowohl zu ermitteln, welches Schicksal das Skizzenbuch ereilt hat .(Siegerländer Heimat- und Geschichtsverein, wäre eine Möglichkeit, Siegerlandmuseum vielleicht eine weitere ….), als auch die bisher zusammengestellten Quellen, Literatur etc. zu ergänzen.
Ein erster Medienartikel findet sich hier:
– https://www.lokalplus.nrw/olpe/historiker-fuerchten-schlimmes-das-stadtarchiv-geht-vor-die-hunde-77450
– Auch die Siegener Zeitung – https://www.siegener-zeitung.de/lokales/kreis-olpe/stadt-olpe/stadtarchiv-olpe-offener-brief-gegen-politik-plaene-SQGDVMJRLFDZLFWMQEEWEILLIE.html – und die Westfalenpost – https://www.wp.de/staedte/kreis-olpe/historiker-in-rage-olper-archivars-stelle-auf-streichliste-id237445781.html – berichten im Print – leider hinter der Bezahlschranke.
WDR zum weiteren Verfahren: Der Prozess beginnt am 14.2., Link: https://www1.wdr.de/kultur/kulturnachrichten/prozess-klimaktivisten-muenchen-rubens-klebeaktion-100.html
Facebook-Seite der Westfalenpost Olpe:
Als einzige bibliothekarische Fachkraft in einer Museumsbibliothek mit kw Vermerk kann ich nur bestätigen, was ich im offenen Brief las. Die Bibliothek wurde Jahrzehnte von einer äußerst engagierten Ehrenamtlichen betreut, aber eine wissenschaftliche und fachlich korrekte Bearbeituzng des wertvollen Altbestandes war ihr nicht möglich. Ich habe 5 Jahre zum „Aufräumen“ und Erstellen eines korrekten Kataloges nach RID mit Verschlagwortung gebraucht, eine Systematik zu erstellen, hygienisch korrekte Maßnahmen einzuführen, Standards festzulegen usw, damit wir die Bibliothek jetzt der Öffentlichkeit zugänglich machen können. Wir sind sogar Mitglied im Arbeitskreis historischer Bücher des Landes NRW u.Rheinland-Pfalz geworden. Ich habe 20m schwerbeschädigter Bücher da stehen und 20m Bücher mit leichten Schäden schon fachgerecht repariert und habe kilometerweise Paketband von den Büchern entfernt, die die Bücher teilweise auch schädigten. Liebe Stadt Olpe, tun sie das ihrem Archiv bitte nicht an. Der Schaden kann kaum aufgefangen werden. Ich mache mir jetzt schon Sorgen, was in 10 Jahren passiert, wenn ich in Rente gehe. Und natürlich: Ehrenamt ist in der Kultur immens wichtig als helfende Hand, aber den Damen und Herren wissenschaftliche Arbeit aufzubürden wäre nicht fair, da sie das zu Ihrer und zur eigenen Zufriedenheit nur mit Ausbildung schaffen.
Mit freundlichen Grüßen
Danke für den Kommentar!
– In der Siegener Zeitung erschien heute im Print der Artikel „Axel Stracke: Pläne der Stadt Ausdruck mangelnder Wertschätzung für Stadtarchivar“ – online hinter der Bezahlschranke.
– Ein erster Leserbrief findet sich heute in der Westfalenpost mit folgendem Tenor: “ …. Jedoch ist es, und Belege gibt es viele, nicht unüblich, dass ein Museumsleiter auch die Funktion des Stadtarchivars in Personalunion wahrnimmt. Warum soll diesin unserer Kreisstadt, wenn es denn so umgesetzt wird, nicht funktionieren. Klar ist schlussendlich auch die Einsparung von Personalkosten.“
–
Stellungnahmen der Unterzeichnenden des Offenen Briefes:
Die folgenden Zitate aus den zustimmenden E-Mails dürfen mit
Namens- und Datumsnennung verwendet werden
7.1.23
Wenn das Stadtarchiv Olpe nicht fachkundig geleitet wird, nimmt das historisch-kulturelle Erbe Schaden, und das Geschichtsbewusstsein der Lebensgemeinschaft Stadt verdämmert im Nebel der historischen Ignoranz.
Klaus Droste, Olpe (ehemaliger Leiter der VHS Olpe)
3.1.23
Ich habe in den letzten fast zwanzig Jahren, zunächst als Leiter der Akademie Biggesee und dann als Leiter der VHS des Kreises Olpe die Arbeit von Herrn Wermert als hauptberuflichem Stadtarchivar in hohem Maße schätzen gelernt. Höchst professionell und mit deutlich mehr als der notwendigen Akkuratesse hat Herr Wermert einen exzellenten Archivbestand aufgebaut und für die Stadt und ihre BürgerInnen gesichert. Mit Sachverstand, Esprit und stets bereitem Engagement hat er die Heimatarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen jederzeit unterstützt. Seine Planstelle einem wie immer motivierten Sparwillen zu opfern, ist ein Schlag ins Gesicht aller, die mit Engagement in und für die Heimat in Stadt, Land und Region unterwegs sind.
Jochen Voß, Olpe (ehemaliger Leiter der VHS Olpe)
16.1.23
… … bin ich davon überzeugt, dass politische Bildung ihre Aufgaben immer auch aus der Geschichte ableiten muss und gesellschaftliche Wirklichkeit sich nur auf geschichtlichem Hintergrund erklärt und verstanden werden kann. Insofern sind Orte wie Museen, Gedenkstätten und natürlich auch Archive wie etwa das Stadtarchiv Olpe Orte der politischen Bildung, teils als Lernorte, die besucht werden können und müssen, teils als Lernorte, die historisches Wissen konservieren und zur Verfügung stellen.
Deshalb ist es mehr als unverständlich, dass einer solchen Institution wie dem Stadtarchiv Olpe seine Professionalität und damit die Basis zur Erfüllung seiner wichtigen Aufgabe … aus monetären Gründen entzogen werden soll. Nichts anderes ist die Streichung der hauptamtlichen Stelle des Stadtarchivars /der Stadtarchivarin.
Udo Dittmann, Geschäftsführer und Leiter der „AKADEMIE BIGGESEE“, Attendorn-Neulisternohl
8.1.23
… ich schätze die Arbeit von Herrn Wermert sehr; eine Stadt wie Olpe braucht ein funktionierendes Stadtarchiv – es ist Zentrum lokaler Geschichtskultur.
Ich hoffe, der kw-Vermerk wird zurückgezogen.
Prof. Dr. Werner Freitag, Gütersloh
16.1.23
… das ist ja eine ungeheuerliche Nachricht! Ich bin fassungslos, wie Kommunal-politiker eine solche Entscheidung der Verwaltung mittragen. Ein Archiv mit dieser überregionalen Bedeutung und historischen Beständen, die seines-gleichen suchen, nicht mehr personell mit einer archivischen Fachkraft zu besetzen, bedeutet, dass die Arbeit von Herrn Wermert mit Füßen getreten wird.
Jürgen Kalitzki, Lennestadt (Stadtarchivar a.D.)
17.1.23
Die Dienste des Stadtarchivs Olpe haben wir in der Vergangenheit immer wieder in Anspruch nehmen dürfen und wir würden uns freuen, wenn dies auch in Zukunft so bliebe.
Die Streichung der Stadtarchivarsstelle käme einer Schließung des Stadtarchivs gleich und würde eine empfindliche Lücke für die historisch-wissenschaftliche Befassung mit der Region Südliches Sauerland bedeuten. Ein großer Verlust für uns in jedem Fall, denn der Kreis Olpe ist für uns ein wichtiger Ansprechpartner in der Region für Forschungen zur Darstellung von Baukultur und Alltagskultur im LWL-Freilichtmuseum Detmold. Wir sind auf einen professionellen Ansprechpartner gerade im Archiv angewiesen.
Dr. Hubertus Michels, Detmold
3.1.23
… vielen Dank für Ihre Mail zu diesen mehr als unerfreulichen Plänen der Stadtverwaltung in Olpe!
Die Vorgänge in Olpe sind für mich unfassbar, zumal es sich bei dem Stadtarchiv Olpe um ein Kommunalarchiv handelt, das seit Jahrzehnten vorbildlich geleitet wird und eine hervorragende Arbeit leistet!
Gibt es denn politisch eine Mehrheit für den kw-Vermerk? Ich kann gar nicht fassen, dass eine Mehrheit im Rat für die Streichung der Stelle ist.
Rico Quaschny, Iserlohn (Stadtarchivar)
7.1.23
Mit besten Grüßen aus der rheinischen Metropole und Millionenstadt Köln, wo zu meiner Freude niemand solche Kahlschläge im Sinn hat, weder im Historischen Archiv der Stadt Köln noch in den städtischen Museen und Bibliotheken, auch nicht in der Erzbischöflichen Diözesan- und Dombibliothek oder im Historischen Archiv der Erzdiözese Köln …, auch nicht in der Universität zu Köln, in ihrer Universitäts- und Stadtbibliothek und im Universitätsarchiv.
Prof. Dr. Dr. Harm Klueting, Köln
2.1.23
Auch erscheint mir beim Lesen Ihres offenen Briefes (folgendes bedeutsam): den Entscheidern innerhalb der Verwaltung scheint der signifikante Unter-schied zwischen Archiv und Museum nicht klar zu sein. Das Museum kann anhand von Exponaten Teile der Geschichte „abbilden“ und „erzählen“. Der Inhalt, also die Geschichte als solches, insbesondere ab der frühen Neuzeit, liegt zu großen Teilen in den kommunalen Archiven. Was hilft es, einen Judenstern oder eine Uniform auszustellen, wenn wir nicht wissen, was es ist, wer es warum trug und was mit den Menschen hinter diesen Gegenständen geschah? Das Archiv erzählt uns die Geschichte zu den Exponaten. Hier bietet das Museum die Hardware und das Archiv die Software – das eine funktioniert meist nicht ohne das andere.
Veronika Hof-Freudenberg, Hilchenbach (Stadtarchivarin)
11.1.23
In den vergangenen Jahrzehnten, nicht zuletzt in den vergangenen Jahren, habe ich als Benutzer von Akten aus der Frühen Neuzeit mit sehr vielen Archiven (aller Art) zu tun gehabt. Die Verhältnisse sind sehr verschieden, gerade auch in den Stadtarchiven. So gibt es bestens funktionierende, gut ausgestattete Stadtarchive wie in Schwäbisch Hall. Hier gibt es einen kompetenten, rührigen wissenschaftlichen Archivar 100%, der die gesamte Ortsgeschichte und deren Verbreitung im Blick hat und entsprechend aktiv ist, und drei weitere Mitarbeiter je 100%, davon eine Diplomarchivarin. Es gibt aber auch missliche Zustände, so etwa in einer anderen ehemaligen Reichs¬stadt im Südwesten Deutschlands, wo eine städtische Verwaltungsangestellte, die keine näheren Kenntnisse hat, an einem Tag pro Woche ins Archiv abkommandiert wird und das Archiv für Benutzer vier Stunden geöffnet ist.
In Olpe sollte es natürlich wieder einen Archivar mit einer 100%-Anstellung geben. Am besten wäre wie bisher ein wissenschaftlicher Archivar. …
… Die bestehende weitere Mitarbeiterstelle im Stadtarchiv sollte von 33% auf wenigstens 50% aufgestockt werden.
Prof. Dr. Thomas Gerhard Wilhelmi, Heidelberg
12.1.23
Das ist ja tatsächlich ein starkes Stück, dass das Stadtarchiv Olpe auf diese Art und Weise abgewickelt bzw. marginalisiert werden soll. Selbstverständlich unterzeichne ich den „Offenen Brief“ und hoffe, dass diese Initiative von Erfolg begleitet sein wird!
Wilhelm Grabe, Paderborn (Kreis- und Stadtarchivar)
12.1.23
… … auch wir möchten uns zustimmend zu Ihrem offenen Brief äußern.
Es ist kaum zu verstehen, dass eine so wichtige Stelle ersatzlos gestrichen wird und damit vielen Interessierten der Zugang zur Geschichte der Stadt Olpe erschwert, wenn nicht gar unmöglich gemacht wird.
Es gibt nicht mehr viele Personen, die imstande sind, das verschriftlichte Material der vergangenen Jahrhunderte in heutige Schrift zu übertragen.
Bereits das Frakturlesen bereitet heutigen Studierenden große Schwierigkeiten. Wenn solche Institutionen wie städtische Archive mehr und mehr wegfallen, bedeutet dies für unsere Kultur einen nicht wiedergutzumachenden Schaden.
Deshalb sollte die Stelle eines Stadtarchivars in Olpe auch weiterhin hauptamtlich besetzt werden.
Dr. Corinna Nauck, Museum Wilnsdorf
Dr. Andreas Bingener, Siegen, Historiker und Paläograph
13.1.23
… als Historikerin … und gleichzeitig als Assessorin des Archivdienstes bin ich immer wieder mehr als erstaunt, wie Kommunen meinen, Pflichtaufgaben einfach mal so wegsparen zu können – ohne Rücksicht auf unwiederbringliche Verluste – und die geleistete Arbeit von KollegInnen mit Füßen treten.
Dr. Katrin Minner, Siegen
16.1.23
Ihre Ausführungen und den offenen Brief habe ich mit Bestürzung zur Kenntnis genommen. Die – hoffentlich nicht endgültige – Entscheidung, die Stelle der Olper Stadtarchivleitung zu streichen, ist nicht nur falsch, sondern sendet in auch für die Archivwelt schwierigen Zeiten ein verheerendes Signal nach außen.
Dr. Knut Langewand, Warendorf (Kreisarchivar)
Aus einem Interview mit Prof. Sternberg,
abgedruckt in der Zeitschrift „Der Archivar“ 2015, S. 145ff.
Prof. Sternberg hat uns autorisiert, Zitate aus dem geführten Interview für unsere Initiative „Offener Brief“ zu verwenden:
Zunächst mal glaube ich, ist es ein Problem, dass alle Einrichtungen, die mit Sammeln, Bewahren und Schützen zu tun haben, einen schweren Stand dadurch haben, dass sie nicht mit großen Zahlen punkten können. Und eine Kulturpolitik, die mehr und mehr auf Event setzt und auf das große Ereignis, werden solche Tätigkeiten weniger bewertet.
… … …
Darin liegt ein Problem für die Archive, denn sie haben die Aufgabe, über lange Zeiträume hin nicht tagesaktuell zu bewahren und zu sammeln.
Das entbindet die Archive auf der anderen Seite nicht von einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit. Auch sie müssen in die Öffentlichkeit gehen, müssen deutlich machen, was sie tun, wofür sie da sind. Sie müssen die Wichtigkeit und den Reiz von Archiven vermitteln und verbreiten.
… … …
Für die Politik halte ich es für zentral, dass Archive als öffentliche Aufgabe ernst genommen werden, sowohl kommunal wie auf Landesebene. Eine Popularität bekamen die Archive nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs, eine traurige Öffentlichkeit, aber sie hat bewirkt, dass man die Archive auf einmal in den Blick nahm. Ansonsten bin ich der Meinung, dass es politisch wichtig ist, dass die Archive ruhig arbeiten können, dass sie eine auskömmliche Ausstattung bekommen, die natürlich immer wieder auszuhandeln ist.
… … …
… natürlich ist für ein Archiv nichts wichtiger als Kontinuität – das weiß jeder, der mal irgendwann ein abgebrochenes Abonnement einer Zeitschrift hat. Kontinuität der Rechtsprechung ist nur möglich durch immer wieder erneuerten Rückgriff – und Verständnis der Vergangenheit nur durch die Möglichkeit der Konfrontation mit den Quellen.
… … …
Die identitätsstiftende Rolle von Archiven – dazu gehört auch die nur scheinbar banale Arbeit von lokalen Hobbyhistorikern, ist gewichtig. (Der Philosoph) Hermann Lübbe spricht davon, dass es noch nie eine Zeit von so viel Geschichtsaufbereitung gegeben habe wie heute. Jede Freiwillige Feuerwehr, jeder Gesangsverein, jeder schreibt seine Geschichte. Zumeist sind das Geschichten, die nicht viel weiter als 100 Jahre zurückreichen. Heimatmuseen haben eine Konjunktur sondergleichen, man sollte das nicht unwichtig nehmen, sondern sagen, wir helfen euch dabei, dass das, was ihr da macht, über die Erinnerung an die Großmutterzeit hinausgeht und in einen größeren Kontext gestellt wird. Das ist eine wichtige Aufgabe der Archive und das machen diese auch sehr gut. Aufgabe der Politik ist es, Projekte, die in diese Richtung laufen, zu unterstützen.“
Aus dem Tätigkeitsbericht 2021/2022 des Stadtarchis Olpe:
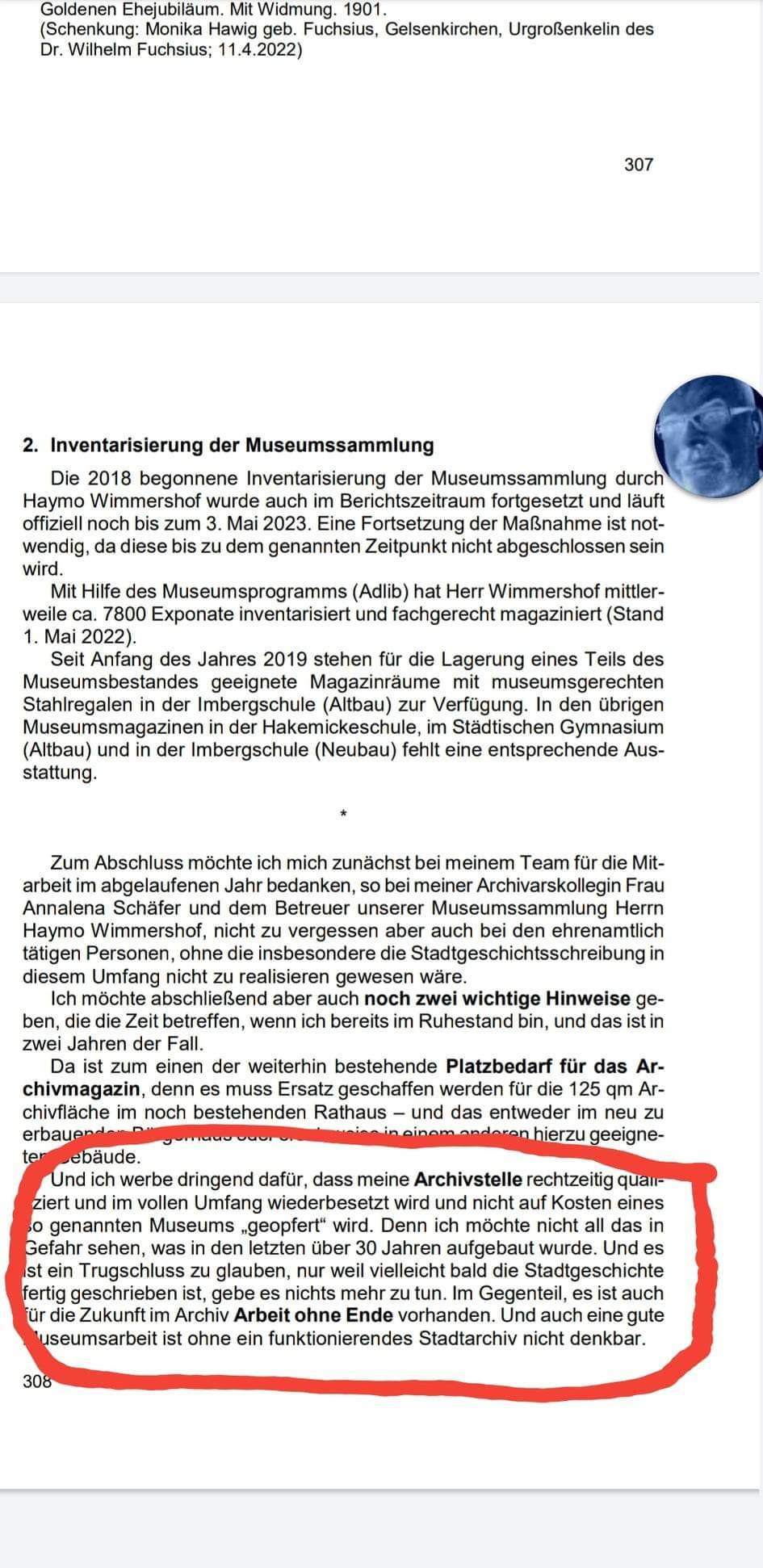 , Link unter dem Reiter „Aufgaben“:Link: https://www.olpe.de/Leben-Wohnen/Stadtportr%C3%A4t-geschichte/Stadtarchiv/ (Danke an MK für den Hinweis!)
, Link unter dem Reiter „Aufgaben“:Link: https://www.olpe.de/Leben-Wohnen/Stadtportr%C3%A4t-geschichte/Stadtarchiv/ (Danke an MK für den Hinweis!)
Auch die heutige Ausgabe des Sauerlandkuriers berichtet über den offenen Brief und (!) die Reaktion des Bürgermeisters und der „Grünen“:
“ … Auf Nachfrage des SauerlandKuriers hat sich Olpes Bürgermeister Peter Weber zu der Entscheidung geäußert. Zuerst betont er die „herausragende Leistung“ von Josef Wermert und es wäre nicht so, dass „seine Arbeit nicht geschätzt“ würde. Ganz im Gegenteil. Alleine die Bildbände der Olper Stadtgeschichte seien etwas ganz Besonderes für die Kreisstadt. Und ganz endgültig, ob die Stelle des Stadtarchivars gar nicht mehr besetzt wird, ist auch noch nicht klar. Der „kw-Vermerk“ steht erst einmal, wie es in der Sitzung im Dezember 2022 zur Besprechung des Haushalts 2023 besprochen wurde. Das bedeutet, dass erst einmal ohne die Stelle des Archivars für dieses Jahr geplant wird. Allerdings könnte die Stelle in der Sitzung zur Besprechung des Haushalts 2024 wieder in den Plan aufgenommen werden.
Dafür müssen jedoch noch andere Faktoren betrachtet werden. Zuerst einmal ist in der Olper Politik die Entscheidung gefallen, ein neues Museum zu planen. Der Leiter dafür ist seit Anfang Januar im Amt. Und mit diesem Museumsleiter soll sich auch der Blick ein wenig mehr auf das historisch und geschichtliche verschieben. Die Aufgaben des Museumsleiters werden anders, sind aber nicht völlig entfernt von denen des Stadtarchivars: „Josef Wermert betreut als Stadtarchivar auch die Museumssammlung der Stadt.“
„Der Aufgabenbereich wird sich ändern“, erklärt Bürgermeister Peter Weber im Gespräch. „Es werden erst einmal viele Gespräche laufen müssen. Welche Aufgaben des Stadtarchivars kann der neue Museumsleiter übernehmen und welche nicht? Welche Aufgaben aus dem Archiv brauchen wir später noch? Wir müssen erst einmal schauen, wie es sich in diesem Jahr entwickelt und auch mit dem neuen Museumsleiter reden.“ Es ist also nicht ausgeschlossen, dass jemand die Stelle von Josef Wermert weiterführen könnte, ob Vollzeit oder in Teilzeit.
Zaklina Marjanovic, Fraktionsvorsitzende der Olper Grünen zeigt sich auf Nachfrage des SauerlandKuriers betroffen. „Herrn Wermerts Tätigkeit ist unglaublich kostbar für die Stadt Olpe, für die Pflege und Dokumentation der Stadtgeschichte und somit auch für die Heimatverbundenheit. Ein Stadtarchiv ist somit auch prägend für die Identität Olpes. Allerdings ist nun ein Museumsleiter eigestellt, für ein Museum, dass es noch nicht gibt. Herr Wermert ist bis 2024 noch im Dienst, das Museum wird erst ein paar Jahre später entstehen. Ich stelle mir vor, dass ein Museumsleiter ohne Museum sicher auch viel zu planen hat, jedoch bestimmt auch die Kapazitäten hat, das Stadtarchiv, einen zukünftigen Teil des Museums, nachdem Herr Wermert seinen Ruhestand angetreten hat, mit zu betreuen.“
Die Grünen wollen die Veränderungen „eng begleiten“ und falls nötig sich auch für eine weitere Personalstelle einsetzen. Außerdem findet sie es wichtig, die Erfahrung und Meinung von Josef Wermert in diesem „besonderen Falle Gehör zu schenken“ und falls nötig die Entscheidung über die Streichung der Stelle zu überdenken.
Was antworteten die Olper Bundestags- und Landtagsabgeordneten auf folgenden Frage:
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die Stadt Olpe nicht wie geplant die Archivleitungsstelle streicht, wodurch eine wichtige fachliche Arbeit für die Stadt und die Öffentlichkeit wegfallen würde?
Nezahat Baradari (SPD, Bundestag):
“ … vielen Dank für Ihre Frage und damit auch den Hinweis auf die Streichung der Archivleitungsstelle. Es wäre in der Tat sehr zum Bedauern, wenn die Archivarbeit für unsere Kreisstadt Olpe nicht fortgesetzt werden kann. Sehr gerne kann ich mich aber an den Olper Bürgermeister wenden und nach den Ursachen der geplanten Schließung erkundigen.
Ich bitte Sie jedoch, zu berücksichtigen, dass es mir nicht erlaubt ist, als Bundestagsabgeordnete mich direkt in Kreisangelegenheiten einzumischen oder gar auf schon gefallene Entscheidungen auf Kreisebene rückwirkend Einfluss zu nehmen.
Mit besten Grüßen …“, Link: https://www.abgeordnetenwatch.de/profile/nezahat-baradari/fragen-antworten/werden-sie-sich-dafuer-einsetzen-dass-die-stadt-olpe-nicht-wie-geplant-die-archivleitungsstelle-streicht?
Florian Müller (CDU, Bundestag): “ …. vielen Dank für Ihre Nachricht.
Als Geschichte interessierter Mensch halte ich Museen und Archive für wichtige Einrichtungen.
Die Stellen- und Ausgabenplanung gehört im Zuge der kontinuierlichen und jährlichen Haushaltsplanung zum festen Bestandteil einer jeden Kommune und Kreises. Die entsprechende Planung obliegt in diesem Fall der Verwaltung und dem Rat der Kreisstadt Olpe.
Freundliche Grüße …“, Link: https://www.abgeordnetenwatch.de/profile/florian-mueller-0/fragen-antworten/werden-sie-sich-dafuer-einsetzen-dass-die-stadt-olpe-nicht-wie-geplant-die-archivleiterstelle-streicht?
Christin-Marie Stamm (SPD, Landtag): “ …. hierzu möchte ich Ihnen gerne antworten und auch gleichzeitig unsere Meinung als SPD-Stadtratsfraktion darstellen:
Zuerst einmal möchten wir als SPD-Stadtratsfraktion der Kreisstadt Olpe festhalten, dass die Arbeit der Verfasser ein hohes Maß an Anerkennung verdient. Es ist ihnen gelungen, in sehr sachlicher und emotionsfreier Form gute und schlüssige Argumente für den Erhalt der Stelle des Archivars zu formulieren.
Für uns als SPD-Stadtratsfraktion hat die Wahrnehmung der Pflichtaufgabe „Stadtarchiv“ einen hohen Stellenwert, den wir eindeutig vor den Belangen eines freiwilligen Museums angesiedelt sehen. Das Stadtarchiv sichert – wie in dem Brief überzeugend dargestellt – die historische Identität unserer Stadt.
Der Archivar schafft auch die Basis für die in hohem Maß eingebrachte ehrenamtliche Tätigkeit zu unserer Stadtgeschichte. Ein hohes Gut, das wir nicht schmälern oder preisgeben dürfen! Daher ist die fachlich qualifizierte Betreuung des Archivs im Hauptamt unabdingbar.
Auf dem Hintergrund, dass wir als SPD-Stadtratsfraktion die Errichtung eines Museum in Olpe sehr fragwürdig sehen, haben wir uns von Anfang an dafür eingesetzt, dass ein Archivar beschäftigt wird, der im Rahmen seiner Tätigkeit allenfalls museale Ausstellungen organisiert. Der Schwerpunkt sollte klar auf der Archivarbeit liegen!
Der Argumentation der Verfasser und letztlich auch der Unterzeichner können und wollen wir uns nicht entziehen.
Die Neuauflage der politischen Diskussion über die Art der Fortsetzung des Archivs sowie die personelle Ausstattung halten wir für unabdingbar! ….“, Link: https://www.abgeordnetenwatch.de/profile/christin-marie-stamm/fragen-antworten/werden-sie-sich-dafuer-einsetzen-dass-die-stadt-olpe-nicht-wie-geplant-die-archivleiterstelle-streicht?
Danke an JH!
Johannes Vogel (FDP, MdB), 7.3.2023: “ …. Grundsätzlich ist die Archivarbeit natürlich insbesondere für Dokumentationszwecke von enormer Bedeutung. Als Bundestagsabgeordneter kann und möchte ich mich allerdings nicht zu kommunalpolitischen Vorgänge äußern. Die Personalplanung der Verwaltung müssen von den Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern vor Ort bewertet werden. ….“
Link: https://www.abgeordnetenwatch.de/profile/johannes-vogel/fragen-antworten/werden-sie-sich-dafuer-einsetzen-dass-die-stadt-olpe-nicht-wie-geplant-die-archivleitungsstelle-streicht
Toll !! Das hilft ein gutes Stück weiter beim Verständnis der unterschiedlichen Währungs- und Maßangaben im „Rechenbuch“, in dem mein 3-Ur-Großvater ab 1800 seine Ein- und Ausgaben erfasste.
Ja, zweifellos – andererseits ist das wieder ein hübsches Beispiel für die Verschwendung von Arbeitszeit und Speicherplatz. Das Buch war bereits von der Sächsischen Landesbibliothek Dresden digitalisiert worden. Und die Bayerische Staatsbibliothek tat dies gleich mit beiden ihrer Exemplare der 1. Auflage (1814). Wie viel mehr Titel könnten gescannt werden, wenn solche unnützen Doppelarbeiten vermieden würden! Haben Bibliotheken ein Problem mit ADHS?
Heute findet sich ein Eintrag im Archivblog augias.net zum Thema: https://www.augias.net/2023/01/27/9697/.
Folgender Leserbrief „Historisches Gedächtnis ausgelöscht“ von Dr. Stefan Schwenke, der sich deutlich für den Wegfall des kw-Verwermerks ausspricht, erschien heute in der Westfalenpost: “ Mit großem Erstaunen und Entsetzen habe ich mitbekommen, daß die Stadt Olpe plant, die Stelle des Stadtarchivars nach Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabers in 2024 nicht wiederzubesetzen. Dies geht zumindestens aus dem Stellenplan der Stadt hervor. Wie es aussieht, wird diese Stelle als entbehrlich angesehen, auch, um damit die Stelle eines Museumsleiters zu finanzieren, einer Einrichtung, die vor 2026 nicht zu realisieren ist. Interessant ist dabei, dass Museum und Archiv dabei wieder einmal in einem Topf geworfen werden. Aber Museum ist nicht gleich Archiv und Archiv nicht gleich Museum. Bäcker ist ja auch nicht gleich Metzger und umgekehrt. Hier zeigt sich wieder einmal die Ignoranz mancher Entscheidungsträger dem Archiv gegenüber.
Es ist vollkommen unverständlich, wie man mit einem Strich das historische Gedächtnis einer Stadt auslöscht. Und, das historische Gedächtnis ist nicht das noch zu planenende Museum, sondern das Stadtarchiv mit seinem reichen Quellenbestand, der weit ins Mittelalter zurückreicht.
Zu erwähnen sind auch die umfangreiche Bibliothek und die über 2000 Zeitungsbände, u.a. das Sauerländische Volksblatt ab 1840. Hinzu kommen noch umfangreiche Sammlungsbestände und Depositia von Privatpersonen, Vereinen und Verbänden! Ein wahrer Schaft an Material für alle Interessierten an der Stadtgeschichte Olpes, der vom bisherigen Stelleninhaber in mühevoller Arbeit zusammengetragen und bewahrt wurde. Auch dessen Leistungen werden mit einem Wisch beiseitegeschoben. Ohne diese historischen Grundlagen ist die Einrichtung eines Museums übrigens hinfällig.
Das Stadtarchiv Olpe verahrt und bewahrt darüber hinaus auch das städtische Verwaltungsschriftgut und schafft damit Rechtssicherheitfür die Verwaltung, indem die Nachprüfbarkeit von Verwaltungshandeln gesichert ist. Mit diesem Beschluss wird deshalb nicht nur gegen geltendes Archivrecht (Archivgesetz NRW) verstoßen, sondern auch gegen rechtsstaatliche Prinzipien der Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Verwaltungshandeln.
Man kann nur dringend an die Entscheidungsträger appelieren, ihren Entschluss nochmals zu überdenken und die hauptamtliche Stelle im Stadtarchiv nicht zu streichen.“
Weitere Beispiele in mehr oder weniger jüngerer Zeit: München, Kreis Ostholstein, ….. Auch diese Liste darf gerne weiter ergänzt werden.
In einer säschsischen Gemeinde will der Bürgermeister die archivische Bewertung durchführen, weil die „Einlagerung“ im Kreisarchiv zu teuer wird:
Ein Blick in das sächsische Archivgesetz ist da m.E. hilfreich (§ 13)
Stürme der Entrüstung sind ganz interessant; noch interessanter sind nüchterne Darlegungen der Vorgänge, die zur Empörung der Menschheit geführt haben. An solchen sachdienlichen Informationen mangelt es bisher ein wenig, sieht man von den oben eingerückten knappen Ausführungen des Olper Bürgermeisters ab. Diese lassen eigentlich nicht den Schluss zu, die Stadt Olpe habe die Absicht, ihr Stadtarchiv zu zerschlagen oder ihm durch eine fiese Personalentscheidung die Existenzgrundlage zu entziehen.
Wenn ich es richtig verstehe, kann oder möchte man sich in Olpe für das altbewährte Archiv und für das vermutlich von der Bevölkerung gewünschte neue Museum nicht zwei separate Leitungen leisten, sondern die beiden kulturellen Einrichtungen in Personalunion leiten lassen oder wenigstens einmal testen, ob sich das in den kommenden paar Jahren bewährt. Ungewöhnlich ist diese Konstellation durchaus nicht, schon gar nicht in einer so kleinen Stadt wie Olpe. Wie das funktioniert, hängt maßgeblich vom Stelleninhaber ab.
Der in Olpe als „Museumsleiter“ erkorene Mensch ist ebensowenig wissenschaftlicher Archivar wie Museumswissenschaftler. Gleichwohl darf Historikern, auch wie in diesem Fall einem auf Archäologie spezialisierten, dank ihrer akademischen Ausbildung zugemutet werden, sich kompetent in die Belange sowohl eines Museums als eines Archivs einzuarbeiten. Grundsätzlich spräche sicher nichts dagegen, in Olpe das Stadtarchiv und das Stadtmuseum zu einer Art „Zentrum für Stadtgeschichte und Erinnerungskulturen“ zusammenzufassen und (wie z.B. in der viel größeren Stadt Bonn) unter eine gemeinsame Leitung zu stellen. Schwebt den Olpern in ihrer 26.000-Seelen-Kommune so ein Zentrum vor? Dessen Dimensionen wären sicherlich nicht so gewaltig, dass der eine Leiter unter seinen Aufgaben zusammenbrechen müsste. Die momentan gebrauchte Bezeichnung „Museumsleiter“ sollte in dem Fall aber ganz schnell vergessen werden, um die Archivfraktion nicht zu brüskieren. Und bis hier beträfe das eben nur die Neuorganisation der Leitung. Unverzichtbar wäre selbstverständlich eine ausreichende Personalausstattung für die Tagesgeschäfte „unterhalb“ der Leitung. Davon war nun hier bis jetzt noch gar nicht die Rede: Wie viele der im Stellenplan pauschal aufgelisteten „Verwaltungsangestellten“ arbeiten denn eigentlich im Stadtarchiv? Wäre das Archiv, auch wenn es sich demnächst die wissenschaftliche Leitung mit dem Museum teilen müsste, im Bereich der nicht-wissenschaftlichen Aufgaben noch lebensfähig, oder müsste dann auf den Tarifebenen des ehemaligen „gehobenen“ und „mittleren“ Dienstes dringend nachgebessert werden? Es ist zu hoffen, dass im Olper Rathaus auch diese Frage im Zusammenhang mit dem „kw“-Vermerk für die Archiv-Leitung (der womöglich zu Missverständnissen über die Olper Archivpolitik Anlass gab) erörtert wurde.
Danke für den Kommentar! Der hier eingeforderten ausführlichen Begründung der Massnahme bzw. der Darstellung der zukünftigen Ausgestaltung von Archiv und Museum ist ausdrücklich zuzustimmen. Für mich ist das Fehlen ein Grund für die „Entrüstung“.
Pingback: Proteste gegen die Streichung der Archivleiterstelle in Olpe – Archivalia
Pingback: Ernst Achenbach (1909 – 1991) – der Parlamentarier | siwiarchiv.de
Stellungnahme des Dozenten für a. a. Archivrecht an der Archivschule Marburg, Prof. Dr. Thomas Henne – unter Verweis auf ArchivG NW § 10 Abs. 1 und Abs. 3: “ …. Es ist nicht ersichtlich, wie bei einer Stadt von der Größe von Olpe (knapp 25.000 Einwohner.innen) die „archivfachlichen Anforderungen“ gewahrt werden können, wenn über die zweite Alternative lediglich eine „Beratung“ einer Nicht-Archivar.in erfolgt.
Und wenn der Protest erfolgreich ist und eine neue, archivfachlich ausgebildete Stadtarchivar.in für Olpe gesucht wird: Der laufende 60. Fachhochschullehrgang an der Archivschule Marburg – Hochschule für Archivwissenschaft wird im März 2024 die Archivschule verlassen.“
Weitere Resonanzen:
Am 28.1. erschien ein ausführlicher Artikel in der Print-Ausgabe des Sauerlandkuriers, der auch die oben schon skizzierte Äußerung des Bürgermeisters enthält.
Die Westfalnenpost vom 28.1. enthilet eine folgende Glosse von Jörg Winkel:
„Der Pland der Stadt Olpe, künftig keinen Archivar mehr zu beschäftigen, sondern desse Aufgabenquasi nebenher vom Leiter des geplanten Museums miterledigen zu lassen, hat bei Heimatfreunden und hauptberuflichen Historikern für Aufsehen gesorgt. Der offene Brief, den der in Neuenkleusheim lebende Dr. Hans-Bodo Thieme und die frühere Vorsitzende des Kreisheimatbundes, Dr. Roswitha Kirsch-Stracke, geschrieben haben, geht in Heimatkreisenviral.
Dabei kann Thieme sich gut erinennern, wie sein erster Kontaktzum Stadtarchiv war: Im alten Rathaus, dort wo heute Eis gegessen und Ein-Euro-Artikel gekauft werden können, ging eine Mitarbeiterin mit ihm um das Rathaus herum, öffnete eine Kellertür und ließ ihn in einem feuchten Raum, in dem von Mäusen angefressenen Akten lagerten.
Die Unterlagen, die ihn interessierten, können er ruhig mitnehmen, hieß es damals, er solle sie aber doch bitte irgendwann zurückbringen. Kein Vergleich zu dem, was heute als Stadtarchiv vorgehalten wird. Hier werden Akten entsäuert und zukunftsicher eingelagert.
Was mich regelmäßig fasziniert, ist die Beständigkeit von Urkunden. Jahrhundertealte Papiere, die zum Teil heute noch juristische Bedeutung haben, zieht der Archivaraus dem Regal und liest die für den unkundigen Laien nicht zu entziffernde Schrift flüssig vor. Versuchen Sie mal, eine noch 1995 täglich verwendete Diskette, irgendwoim Stadtgebiet einzulesen. Selbst CGs oder DVDs finden in neuen PCs schon keinen Platz mehr.
Auf die verbleibenden Archivare dieser Welt kommen ganz neue Aufgaben zu.“
Ebenfalls in Westfalenpost-Ausgabe erschienen heute 2 Leserbriefe. Prof. Thomas Gerhard Wilhelmi aus Heidelberg schreibt u. a.: “ …. In Olpe, wo ich vor längerer Zeit mehrmals zu tun hatte, sollte es natürlich wieder ein Archivar mit einer 100-Prozent-Anstellung geben. Am besten wäre wie bisher ein wissenschaftlicher Archivar; aber notfalls muss man Kompromisse eingehen und kann auch einen Diplom-Archivaren nehmen. Die bestehende
weitere Mitarbeiterstelleim Stadtarchiv sollte von 33 Prozent auf wenigstens 50 Prozent aufgestockt werden.
Im Hinblick auf das Museum und das Archiv wären ja aufgrund weitsichtiger, langfristiger Planungen Kombinationen gut denkbar. An vielen Ortenhat, wie ich weiß, der Stadtarchivar auch mit dem Ortsmuseum zu tun, und dies ist oft sehr sinnvoll und funktioniert gut. So könnte es doch auch in Olpe sein. Allerdings ist es abwegig, Archiv und Museum einer einzigen Person in Obhut zu geben.“
Der zweite Leserbrief bezieht sich auf den am 25.1. erschienen Leserbrief (s.o.): “ …. da täuschen Sie sich leider. Das Archivgesetz NRW § 10 (3) 1. + 2. legt detailliert fest, wer und mit welcher Qualifikation ein kommunales Archiv leiten darf.Nach § 10 (1) verpflichtet der Gesetzgeber sogar die Kommunen dazu“Sorge zu tragen, ihr Archivgut in eigener Zuständigkeit zu archivieren.“ Die Stadt Olpe ist gesetzlich verpflichtet, die Stelle des Stadtarchivars zu besetzen. Allenfalls kann die Stadt Olpe nach § 10 (2) 1. ihre Archivaufgabe durch „Übertragung auf eine für Archivierungszwecke geschaffene Gemeinschaftseinrichtung“ erfüllen. Die Leitung der freiwilligen Feuerwehr in Olpe, die in hoffentliche professioneller Hand liegt, sollte wohl auch nicht auf die Leitung der Feuerwehr in Drolshagen oder Wenden übertragen werden oder nebenbei von dem neuen Museumsleiter in Olpe geführt werden.“
Ich war in Radio Museum und zwar zwei mal ,das ist für mich Sehr interessant
Heute erschien in der Westfalenpost folgender Leserbrief von Dr. Michael Nies-Steffens (Nürnberg):
„Bei der Suche nach historischen Dokumenten in Olpe wurde mir immer der Name Josef Wermert genannt, den ich dann bald auch durch meine Besuche im Stadtarchiv Olpe näher kennenlernte. Durch die Gespräche mit ihm wurde ich, obwohl seit fast einem halben Jahrhundert nicht mehr in Olpe lebend, Mitglied im Heimatverein und seit zwei Jahren auch Autorim jährlich erscheinenden Jahrbuch. Die Qualität sowohl der mehrbändigen Olper Stadtgeschichte als auch die des Jahrbuches hatten mich sehr angesprochen.
Josef Wermert war mir bei meinen Recherchen immer eine große Hilfe und Stützew und als ich bei meinem letzten Besuch in Olpe von ihm erfihr, dass seine Stelle nicht wieder beyetzt werden soll, hielt ich seine Aussage für ein Gerücht. Scheinbar wird seine Arbeit im Verborgenen (Archiv) wohl nicht wahrgenommen und wertgeschätzt!
Zurzeit befinde ich mich auf einer Auslandsreise, bei der ich mich – wie beim Jahrbuch – ehrenamtlich einbringe. Als ich in Tokyo aus dem Newsletter der WP von der tatsächlichen Stellenstreichung erfuhr, habe ich mir die knappe mir zur Verfügung stehende Zeit genommen, um möglichst schnell durch diesen Leserbrief einerseits mein Unverständnis und meine Fassungslosigkeit über diese Stellenstreichung zum Ausdruck zu bringen und andererseits an alle, die diese Stellenstreichung zu verantworten haben zu appellieren, ihren Entschluss mit all den schon von anderen geäußerten Bedenken zu überdenken bzw. zurückzunehmen.
Nur weil durch die mehrbändige Stadtgeschichte und die Jahrbücher etwas Großes entstanden ist, darf nicht der Eindruck entstehen, es gäbe nichts mehr zu tun. Ein Museumsleiterkann nicht gleichzeitig das Stadtarchiv einer Kreisstadt führen – vielleicht ist dann die kommende Ausgabe des Jahrbuchs die letzte? ….“
Es gehört nicht zu den Pflichtaufgaben eines Archivleiters, den örtlichen Heimatverein bzw. dessen Jahrbuch zu betreuen. Herr Wermert wird dies wohl in seiner Freizeit tun, so dass der von Herrn Nies-Steffens konstruierte Zusammenhang mit der Olper Stellenbesetzung nicht besteht. Ferner ist es irrelevant, dass es sich um das „Stadtarchiv einer Kreisstadt“ handelt, da der Kreis Olpe (was im fernen Franken vielleicht nicht bekannt ist) für seine Überlieferung ein eigenes Archiv unterhält.
Wenn es denn – wie manche Leserbriefschreiber anscheinend wissen – zutrifft, dass das Personal im Stadtarchiv bislang nur aus 1,33 Stellen bestanden hat (1,0 für die Leitung + 0,33 für „eine weitere Mitarbeiterin“), bedeutet dies, dass sich der Leiter notgedrungen in beträchtlichem Maße mit Arbeiten befassen musste, für die er überqualifiziert und somit überbezahlt war. Denn was neben der Leitung in einem Stadtarchiv zu erledigen ist, hätte die/der FAMI oder gar abgeordnete Bürokraft mit ihrer/seiner Drittel-Stelle allein niemals bewältigen können. Es ist logisch, daraus zu schließen, dass für die wissenschaftliche Leitung dieses kleinen Archivs eine volle Stelle offensichtlich nicht zwingend erforderlich ist. Sollte dies der Fall sein (kann ich nicht beurteilen), ist es der Olper Stadtverwaltung kaum zu verdenken, hier Potential für die Einsparung von Personalkosten bei der Besetzung der Archivlleitungsstelle gesehen und diese Stelle quasi halbiert zu haben (Personalunion mit einem „halben“ Museumsleiter, auch wenn das im Stellenplan so nicht differenziert worden ist). Aber – und ich wiederhole mich – „Leitung des Stadtarchivs“ und „Personal des Stadtarchivs“ sind nicht das gleiche. Die Reduzierung der wissenschaftlichen Leitungsstelle auf 0,5 und gleichzeitig die Aufstockung der „weiteren“ Stelle auf 1,0 wäre ein Kompromiss, mit dem vielleicht beide Seiten leben könnten. Aber das müssten die unmittelbar Beteiligten in sachlicher Diskussion miteinander aushandeln. Endloses Lamentieren marginal betroffener Historiker und Waldorflehrer, die sich anhand fragmentarischer Medienberichte „ihre Meinung geBILDet“ haben, ist nicht konstruktiv und hilft dem Stadtarchiv Olpe konkret nicht weiter. Auch sollten nicht ständig die Kultubereiche „Archiv“ und „Museum“ – beide nicht auf Rosen gebettet – gegeneinander ausgespielt werden. Das ist unsolidarisch und kontraproduktiv.
Vielleicht hilft ein Blick in die vorhandene Literatur, um den archivischen Arbeitsanfall abschätzen zu können und die Stellenlage in Olpe präziser zu beurteilen:
– Wermert, Josef (Hrsg.): Stadtarchiv Olpe, Geschichte – Benutzung – Bestände (Quellen und Beiträge des Stadtarchivs Olpe 11), Olpe 2015
– Wermert, Josef : Der Archivverbund Olpe – Drolshagen – Wenden, in: Archivpflege in Westfalen-Lippe 89 (2018) S. 28-30
Der mittlerweile öffentlichen Diskussion täte es zudem gut, wenn die Stellungnahme des LWL-Archivamtes zur Stellenstreichung öffentlich gemacht werden könnte.
„Anita heißt nicht Ruth: Netphen streitet über Schulnamen“ – so die Westfalenpost heute online. Sie fasst die Debatte zur Vorbereitung der Schulausschusssitzung am 8. Februar und zur entscheidenden Ratssitzung am 16.2. zusammen.
Herr Peter Kunzmann wäre gut beraten, sich das Olper Stadtarchiv einmal vor Ort anzusehen und sich vom Stadtarchivar dessen Arbeitsgebiete erläutern und sich die umfangreichen Archivbestände vorstellen zu lassen. Da er diese offensichtlich nicht kennt, redet er wie der Blinde von der Farbe.
Wenn Sie schon persönlich herumpöbeln müssen, dann bitte nicht in die falsche Richtung. Ich wünsche viel Erfolg bei Ihren Protestaktionen und werde die Retter des Olper Stadtarchivs nun nicht weiter mit meinen frühern Erfahrungen aus der archivischen Praxis belästigen.
Sehr geehrter Herr Kunzmann, an Ihrer Antwort hat mich insbesondere gefreut, daß Sie mich fortan nicht mehr belästigen wollen. Halten Sie bitte Ihre Zusage ein, und „Schuster, bleiben Sie bei Ihren Leisten“, d.h., werkeln Sie als Bibliothekar in Ihrer Bibliothek, und rühren Sie nicht in fremden Töpfen herum!
Nur zur Information der restlichen Mitlesenden:
1. In „meiner“ Bibliothek kann ich seit meiner Berentung nicht mehr „werkeln“.
2. Als derjenige, der ab 2004 eine chaotische Ansammlung von Papierhaufen wenigstens so weit in ein funktionierendes Universitätsarchiv verwandelt hatte, dass ein fünf Jahre später dazukommender Diplomarchivar nicht mehr aus allen Wolken fallen musste, betrachte ich das Archivwesen durchaus nicht als „fremden Topf“.
Auf die von Herrn Thieme gestern und heute vorgebrachten und dem von einem Gymnasiallehrer i. R. zu erwartenden Niveau kaum angemessenen Unverschämtheiten werde ich nicht eingehen. Den Olpern kann ich nur wünschen, dass Herr Thieme mit seiner fragwürdigen Aktion (Auslösung eines bundesweiten „Shitstorms“ gegen die Olper Stadtverwaltung) dem Stadtarchiv keinen Bärendienst erwiesen hat. Und damit Schluss.
Pingback: Offener Brief des VdA an den Bürgermeister der Stadt Olpe | siwiarchiv.de
Herbert Bäumers Beitrag „Edith Langner – eine ungewöhnliche Frau der Stadt Siegen“ in der Zeitschrift Siegerland Band 99 Heft 2 (2022), S. 219 – 220, geht, wenn ich es recht sehe, nicht über dessen oben genannte Veröffentlichung hinaus.
s. a. Hans-Joachim Gleichmann: Adolf Achenbach – ein Siegerländer als Berghauptmann in Clausthal, in: Allgemeiner Harz-Berg-Kalender 2008, S. 41 – 44
Den Entscheidenden scheint nicht klar zu sein, dass sie nicht nur gegen gute Praxis und das nordrheinwestfälische Archivgesetz verstoßen, sondern sie die Geschichte Olpes für die Zukunft gefährden. Denn die fachlich kompetent geführte Sichtung und Bewertung der Akten schafft die alleinige Grundlage für historisches Arbeiten in zukünftigen Generationen. Ach ja, und seit der französischen Revolution sind die Archive ja noch ein – wenngleich vielen nicht bewußter – Grundpfeiler der Demokratie. Nur, wenn systematisch und fachlich kompetent Überlieferung gebildet wird, kann die Gesellschaft der Zukunft die Handlungen von Heute und Gestern anhand der Unterlagen im Archiv zumindest retrospektiv nachvollziehen. Will Olpe wirklich an solchen Grundpfeilern sägen? In jedem Falle ist die Olper Entscheidung nicht anders als dumm und gefährlich zu bewerten, den Entscheidenden war gar nicht klar, was sie riskieren.
@Peter Kunzmann
@
Prof.Dr. Thieme [Anm.: Mein Fehler. Danke für den Hinweis an J.B.!]@ alle
Ich darf ab jetzt um Äußerungen bitten, die keine persönlichen Angriffe, etc enthalten.
Heute erschien in der Westfälischen Rundschau, Ausgabe Siegerland im Print der Artikel „Stadtarchiv: „Die Entscheidung hat bundesweit für Aufsehen gesorgt.“ Verband deutscher Archivarinnen und Archivare übt harsche Kritik an geplanter Stellenstreichung in Olpe. ,Verweis auf archivfachliche Ausbildung des Nachfolgers.“ Zitat: „In den „Harry Potter“-Büchern kommen derartige Briefe als „Heuler“ per Eulenpost. So ähnlich wie einer der ausgeschimpften Hogwarts-Schüler dürfte Bürgermeister Peter Weber sich gefühlt haben, als er die Post des Verbandes deutscher Archivarinnen und Archivare (VdA) gelesen hat, die kürzlich im Rathaus einging. ….“
Auch die Siegener Zeitung berichtet heute: „Olpe. Archive leiten kann doch jeder – oder? Offener Brief zur Causa Olpe. Verband deutscher Archivarinnen und Archivare schließt sich dem Protest an.“ Zitat: “ …. „Das kann einem ziemlich sprachlos machen, wenn man es nicht zweimal gelesen hat“, sagt Ralf Jacob. Er hat den Brief als Vorsitzender des VdA unterzeichnet, fungiert ansonsten als Stadtarchivar in Halle an der Saale. Glücklicherweise seien solche Entscheidungen bislang immer noch Einzelfälle, es würden nicht flächendeckend Stellen gestrichen oder auf die hier geplante Weise ersetzt. Es sei bemerkenswert, wie hier versucht werde, „sich aus einer Pflichtaufgabe herauszuwinden.“ ….“
s. a. WOLL-Magazin v. 2.2.2023: https://woll-magazin.de/entscheidung-der-stadt-olpe-sorgt-fuer-bundesweites-aufsehen/
Ein weiterer Fund zur Biographie Irles (und zur NS-Geschichte des Siegerländer Heimat- und Geschichtsvereins):
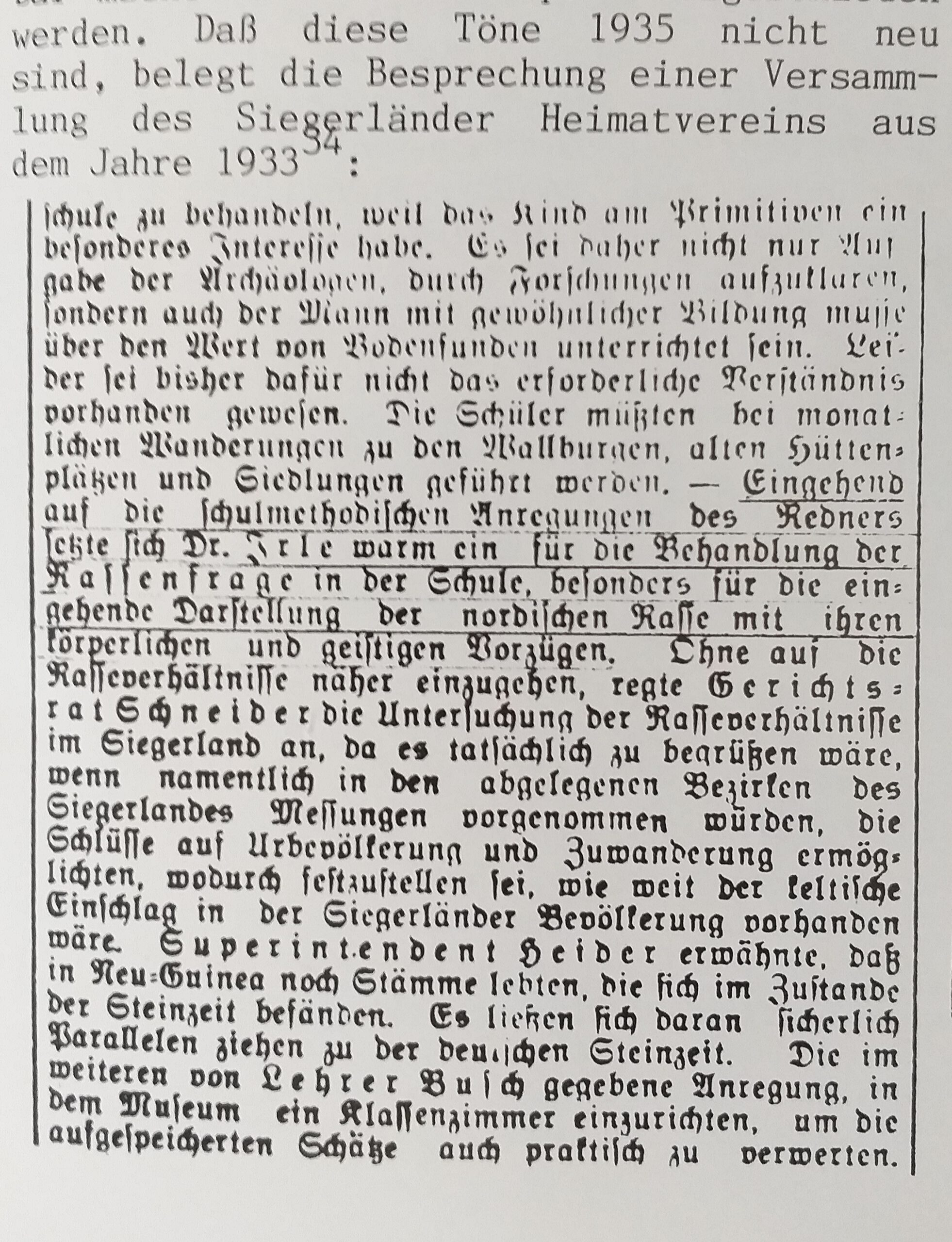
Quelle: Siegener Zeitung, 13. Februar 1933 (nach: Klaus Dietermann: Die Siegener Synagoge. Vom Bau und der Zerstörung eines Gotteshauses, Siegen 1996, S. 19
Gestern erschien in der Siegener Zeitung einer Artikel zur Namensgebung – leider hinter der Bezahlschranke: https://www.siegener-zeitung.de/lokales/siegerland/netphen/verwirrung-in-netphen-diskussion-um-neuen-namen-der-sekundarschule-67IPBLFVTVFDTOISY4UUERXWQI.html
Pingback: Stadtarchiv Kreuztal fragt: Wer ist hier zu sehen? | siwiarchiv.de
Sehr geehrte Damen und Herren,
beim Eintrag zum Artikel von Andreas Bingener sollte es im Untertitel
„Brauchwasserentsorgung“ heißen. Auch die Familie „Otto“ im Beitrag von Herrn Lerchstein sollte groß geschrieben werden.
Vielen Dank!
Danke und geändert!
Pingback: Gymnasium Stift Keppel (Hilchenbach): Von Zweitzeugen zur Zeitzeugin | siwiarchiv.de
„Finissage“ – die Ausstellung ist nur noch heute und morgen zu sehen:
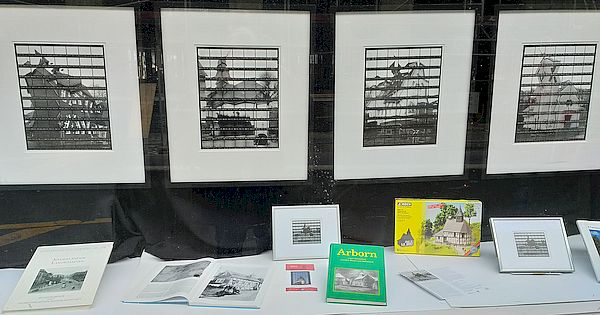
Für die, die es nicht schaffen oder geschafft haben: „Tatsächlich tourt die Ausstellung schon in diesem Jahr weiter in den Kunstraum Grevy nach Köln. Dort eröffnet die Scholl-Stiftung die Ausstellung am 10. November.“
Ein Flyer der Siegener Stadtratsfraktion GfS:
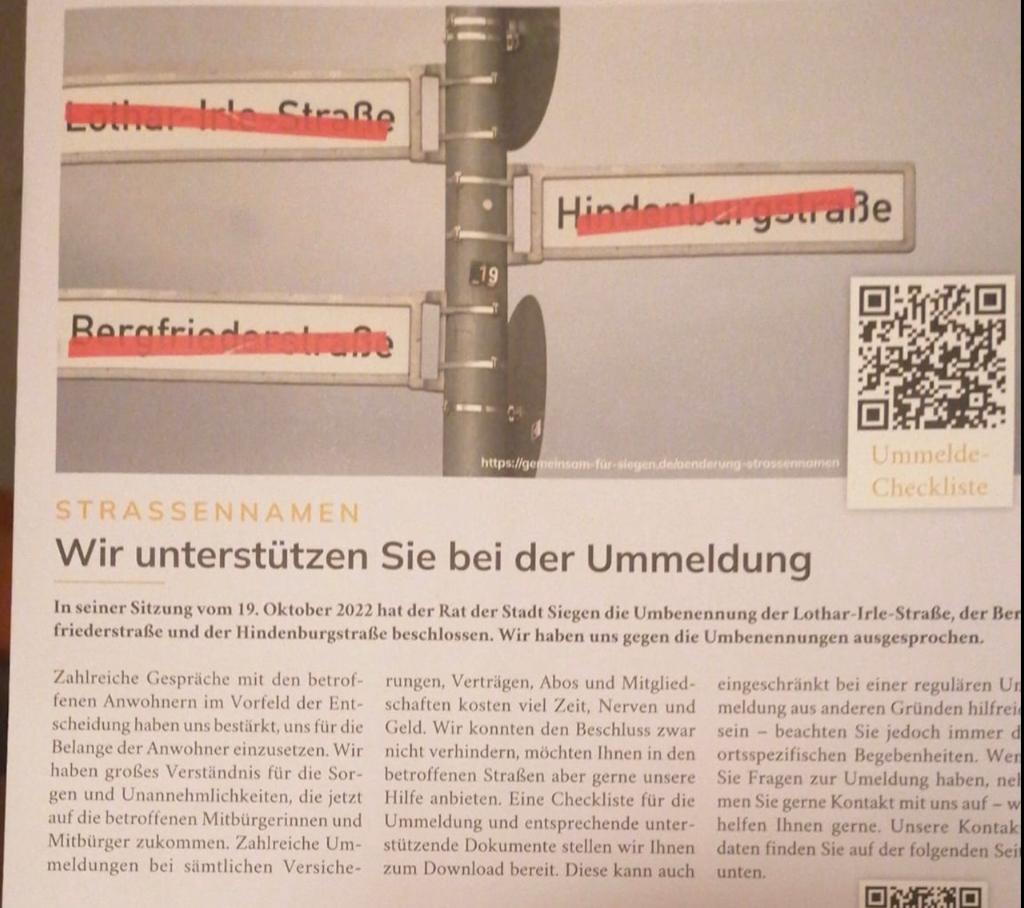
Heute erschien in der Westfalenpost Olpe folgender Artikel:
„SPD will Archivarsstelle neu diskutieren. Fraktion bezieht Stellung auf den offenen Brief in Sachen „kw“-Vermerk und betont die wichtige Rolle des Archivs.
…. Nun hat die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Olpe Stellung dazu bezogen: „Die bundesweite Aufmerksamkeitwurde durch einen offenen Brief an den Bürgermeister der Stadt ausgelöst, in dem die Verfasser in sehr sachlicher und emotionsfreier Form gute und schlüssige Argumente für den Erhalt der Stelle des Archivars formuliert haben“, schreibt Fraktionschef Volker Reichel.
Die Sorge um die qualizizierte Fortsetzung der Arbeit des jetzigen Archivars sei letztlich die Sorge um die Sicherung und Fortführung der Qualität des Stadtarchivs. „Für uns als SPD-Fraktion hat die Wahrnehmung der kommunalen Pflichtaufgabe „Stadtarchiv“ einen sehr hohen Stellenwert, den wir eindeutig vor den Belangen eines freiwilligen Museums angesiedelt sehen. Das Stadtarchiv sichert – wie in dem offenen Brief überzeugend dargestellt – die historische Identität unserer Stadt. Der Archivar schafft durch seine Arbeit auch die Basis für die in hohem Maß eingebrachte ehrenamtliche Tätigkeit zu unserer Stadtgeschichte.“
Allein das Autorenverzeichnis der Bände der Stadtgeschichte gebe eine Vorstellung vom enormen Maß an ehrenamtlicher Arbeit zum Wohle der Stadt. „Eine Arbeit, die vor allem auf den exzellent vorgehaltenen Quellen des Stadtarchivs fußt.
Dieser ehrenamtliche Einsatz ist ein hohes Gut, das wir nicht schmälern oder preisgeben dürfen! Daher ist für uns die fachlich qualifizierte Betreuung des Archivs im Hauptamt unabdingbar.“
Da die SPD die Errichtung eines Museums in Olpe sehr fragwürdig sehe, „haben wir uns von Anfang an dafür eingesetzt, dass ein Archivar beschäftigt wird, der im Rahmen seiner Tätigkeit allenfalls museale Ausstellungen organisiert“. Der Schwerpunkt müsse klar auf der Archivarbeit liegen. Die Neuauflage der politischen Diskussion über die Art der Fortsetzung des Archivs, über die Sicherung der Qualität der Archivarbeit sowie die personelle Ausstettung zur Gewährleistung dessen sei unabdingbar.“
„Der Weg zur historischen Wahrheit führt durch die Archive.“ (Ernst Klee 1942 – 2013)
Die ist in der Stadt Olpe wohl nicht mehr erwünscht.
Danke für den Kommentar! Leider fehlt bisher eine ausführliche Darstellung der Beweggründe der Stadtverwaltung bzw. der politischen Mehrheit, so dass man fröhlich mutmaßen kann. Wie zu hören ist beabsichtigt der Bürgermeister eine Erklärung auf der kommenden Stadtverordnetenversammlung am 15.2. Bis dahin wird man sich wohl gedulden müssen.
Was sagt eigentlich die konzeptionelle Grundidee vom Januar 2021 für das Olper Museum zur Übernahme der Archivleitung durch die Museumsleitung? Wenn ich es recht sehe – nichts!
Zur Qualifikaton der Museumsleitung finden sich folgende Angaben:
“ …. Anforderungen an die zu besetzende Stelle der
Museumsleitung (S. 9):
• Geisteswissenschaftliche Promotion (Europäische
Ethnologie, Kulturwissenschaften, Volkskunde oder
Geschichte)
• Einschlägige Erfahrungen im Bereich Museum
• Erfahrungen in den Bereichen Öffenlichkeitsarbeit,
Kulturmanagement, partizipative Projekte und
Museumspädagogik
• Teamfähig, engagiert und kreativ ….“
Da sich auch dort keine Hinweise auf die Übernahme der Archivleitung durch die Museumsleitung findet, wäre ein Blick auf die Stellenausschreibung nicht uninteressant …..
Ein Blick auf die Stellenausschreibung erlaubt: https://web.archive.org/web/20220709111711/https://www.museumsbund.de/stellenangebote/museumsleiter-in-m-w-d/ Dort wird die Übernahme archivischer Arbeiten durch die Museumsleitung nicht thematisiert – wenn ich es recht sehe. Die Museumsleitung soll lediglich als „projektbezogene Schnittstelle“ mit dem Stadtarchiv kooperieren.
Endlich wurde der Wikipedia-Eintrag zu Hilchenbach in puncto Biberstein geändert:
2 Funde zu Canstein:
„Canstein, Ernst
Wurde zu Wilhelmshütte (Lahn), Kreis Biedenkopf, am 14. Mai 1867 geboren. Nachdem er die Abiturientenprüfung am Großherz. Badischen Gymnasium zu Wertheim a. M. im Juli 1888 bestanden hatte, studierte er in Marburg Geschichte und neuere Sprachen. Im Frühjahr 1897 bestand er die Staatsprüfung in Marburg. Von Herbst 1897 bis Herbst 1898 war er Seminarkandidat am Realgymnasium zu Kassel. Von Herbst 1898 bis Ostern 1899 als Probekandidat an der Realschule zu Biebrich. Von Ostern 1899 bis 1. Oktober 1901 als Probekandidat und wissenschaftlicher Hilfslehrer an der Realschule zu Geisenheim am Rhein. Wird dann an die Oberrealschule zu
Kassel berufen. – Aus: Programm Kassel Oberrealschule 1902.“
aus: Kössler, Franz: Personenlexikon von Lehrern des 19. Jahrhunderts
Berufsbiographien aus Schul-Jahresberichten und Schulprogrammen
1825 – 1918 mit Veröffentlichungsverzeichnissen Band: Cadura – Czygan, Vorabdruck (Preprint) Stand: 18.12.2007, S. 11
– Ernst Canstein besuchte 1879 die Höhere Bürgerschule in Biedenkopf – s. Osterprogramm 1879 der Schule, S. 18
Pingback: Namensgebung der Sekundarschule Netphen – 2. Versuch | siwiarchiv.de
Der am 2. September 1928 geborene Netphener Heimatforscher Ewald Hatzig, der am 23. Dezember 2021 verstorben ist, hat mit Anita Ruth Faber alle 2 Jahre in Niedernetphen in derselben Klasse der katholischen Volksschule gesessen, da damals zwei Jahrgänge in einem Klassenraum gemeinsam unterrichtet wurden. Für ihn hieß seine Klassenkameradin mit Vornamen immer nur Anita, wie er mir einmal erzählt hat.
Vielen Dank für den Hinweis! In der Sammlung des Aktiven Museums Südwestfalen findet sich ein eigenhändiger Brief Anita Fabers, der mit Anita unterzeichnet ist:
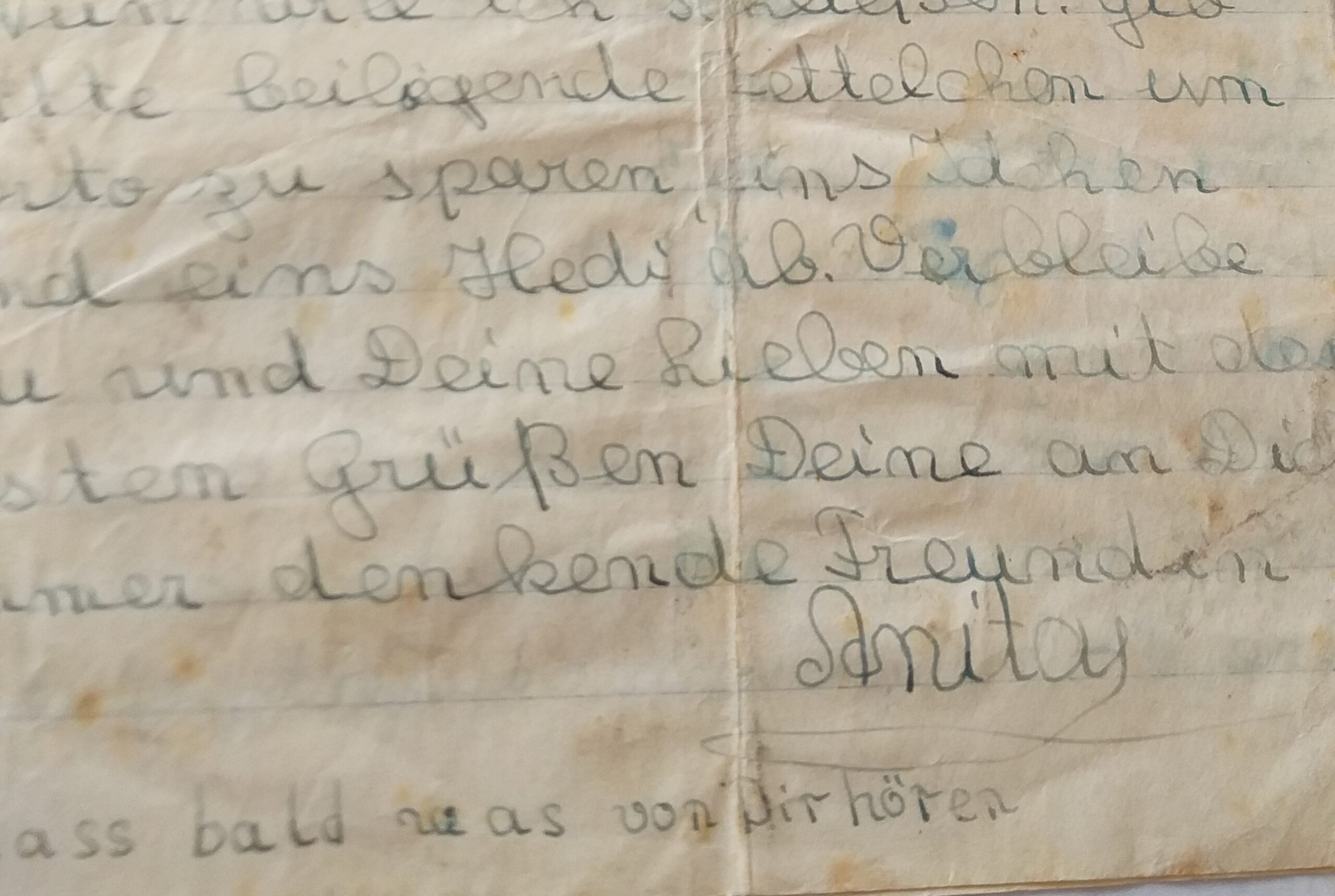
Der Ausschnitt des Briefes ist Bestandteil der Sitzungsunterlagen für den Rat der Stadt Netphen.
Link zur Buchbesprechung im Alltagskultur-Blog der Kommission Alltagskulturforschung für Westfalen: https://www.alltagskultur.lwl.org/de/blog/siegerlaender-kapellenschulen/
s. a. folgenden Blogeintrag: Anna Krabbe, „“Wir haben doch schon eine Behindertentoilette!” – Menschen mit Behinderung als Nutzende von Archiven“, Archivwelt, 08/02/2023, https://archivwelt.hypotheses.org/3294.
Hallo,
vielen Dank für die Bereitstellung der Unterlagen. Toll, dass diese Aufzeichnungen erhalten bleiben. Gibt es noch weitere Aufzeichnungen zu Taufen nach 1911 und Sterbefällen nach 1920. Ich bin auf der Such nach näheren Informationen zu meinen Ahnen und hätte dazu noch weitere Fragen.
Die katholischen Kirchenbücher werden auf der erwähnten Seite nach Ablauf der Schutzfristen kontinuierlch ergänzt. Für den Fall, dass Sie in evangelischen Kirchenbüchern recherchieren wollen, bleibt Ihnen zunächst nur das kostenpflichtige Portal archion. Die Abteilung Personenstandsarchiv des Landesarchivs NRW in Detmold stellt auch Digitalisate von regionalen Standesamtsregistern zur Verfügung.
Heute erschien in der Westfälischen Rundschau folgender Artikel „Archivar-Nachwuchs appelliert an die Kreisstadt. 60 Fachhochschullehrgang an der Archivschule Marburg schreibt in Sachen Stadtarchiv an Bürgermeister Peter Weber und weist auf Unstimmigkeiten hin.“:
“ …. Nun haben sich die Mitglieder des 60. Fachhochschullehrganges an der Archivschule Marburg – Hochschule für Archivwissenschaft – an die Stadtverwaltung gewandt und plädieren energisch für die Wiederbesetzung der Stelle, wenn Wermert geht. „Mit Verwunderung haben wir von den Plänen erfahren, die Archivarsstelle in Olpe zu streichen und das Archiv dem geplanten Museum zuzuschlagen“, heißt es in dem Schreiben. Die zuständigen Entscheidungsträger werden von den angehenden Archivarinnen und Archivaren dringend gebeten, ihre Entscheidung zu überdenken.
Die Berufsbilder der Richtungen Museologie und Archivwissenschaft, so der Fachhochschullehrgang, „weisen grundlegende Unterschiede auf, was man auch anhand unserer Ausbildung erkennt. Aktuell durchlaufen wir eine dreijährige Ausbildung, um nach unserem Abschluss als Archivarinnen und Archivare in den verschiedensten Archiven in ganz Deutschland arbeiten zu können, vor allemin Kommunalarchiven, das heißt Gemeinde-, Stadt- und Kreisarchiven. Dafür bekommen wir fundierte Kenntnisse in den archivischen Fachaufgaben Bewertung, Erschließung, Erhaltung und Nutzbarmachungvon Schriftgut vermittelt.“ Natürlich gehöre dazu auch ein kurzer Überblick über die artverwandten Berufe der Bibliothekare und Museologen. „Auch wenn auf den ersten Blick viele Ähnlicheiten zu bestehen scheinen, sind die Unterschiede zwischen den Berufen schon inden grundlegendsten Ansätzen sichtbar.“ Zum Beispiel arbeiteten Archivarinnen und Archivare vielfach rein mit Schriftgut, während sich Museologinnen und Museologen mit dreidimensionalen Objekten beschäftigten. „Die unterschiedlichen Materialien bringen unterschiedliche Voraussetzungen mit sich, müssen unterschiedlich behandelt, gelagert, klassifiziert, erschlossen und können unterschiedlich genutzt werden.“
Nach der Ausbildung für den gehobenen Archivdienst, so der Jahrgang, könnten sie nicht ohne eine grundlegende Weiterbildung in einem Museum arbeiten, ebenso wie Museologinnen und Museologen nicht ohne Weiteres nach ihrem Studium in einem Archiv arbeiten könnten. „Ein viel grundlegendenererUnterschied ist die Aufgabe der Bewertung. LAut den Archivgesetzen der einzelnen Länder und des Bundes obliegt es allein der Archivarin oder dem Archivar, in die Behörden seines Sprengels zu gehen und deren Verwaltungsschriftgut zu bewerten, also die Entscheidung zu treffen, was dauerhaft im Archiv aufbewahrt und was vernichtet wird. Dies ist ein gesetzlicher Auftrag, deren Erfüllung die Verwaltung transparent machen und zur demokratischen Kontrolle der Verwaltung beitragen soll.“ Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, würden Archivarinnen und Archivare nicht nur die theoretischen Methoden, Praktiken und möglichen Verfahrensweisen einer Bewertung vermittelt, sondern sie hätten auch in den langen Praxisphasen die Möglichkeit, aktiv an Bewertungen teilzuhaben und Erfahrungen zu sammeln. „Dazu gehören ebenfalls Kenntnisse über digitales Schriftgut und die Kompetenz, fachgerecht auf Veränderungen in der digitalen Welt reagieren zu können, schreiben Ellen Kaiser, Simon Rusche und Simon Ernst im Namen des Lehrgangs.“
Pingback: Vortrag: Paul Niederstein (Düsseldorf/Kreuztal): Eine Reise in die Geschichte des ältesten Familienunternehmens der Region. | siwiarchiv.de
Pingback: Stadtarchiv Olpe – Stellungnahme des Bürgermeisters: | siwiarchiv.de
Pingback: Stadtarchiv Olpe – Stellungnahme des Bürgermeisters: | siwiarchiv.de
Ein genaues Lesen der Stellungnahme lohnt:
1) Offener Brief v. 23.1.23 – “ …. 16. dass die zunehmende Digitalisierung des Schriftgutes und mehr noch die Übernahme des heute nur noch rein digital entstehenden Registraturgutes sowie deren digitale Verwaltung, Aufbewahrung und Pflege ein neues, zusätzliches und ausgesprochen umfangreiches Arbeitsfeld für den Stadtarchivar darstellt, so dass nach Stellungnahme des Archivamtes sogar eine personelle Erweiterung im Archiv angemessen wäre, wobei die derzeitige Drittelstelle (von Frau Annalena Schäfer) keineswegs ausreichend ist, ….“ gegenüber Stellungnahme des Bürgermeisters: “ …. Weber wies ausdrücklich daraufhin, dass neben Archivar Wermert noch eine weitere Mitarbeiterin im Stadtarchiv arbeite, die in der bisherigen Diskussion gar nicht erwähnt worden sei. Die zeige fehlende Wertschätzung, was er sehr bedaure…..“
Ich erlaube mir mal die Vermutung, dass es mit der Wertschätzung der Arbeit von Frau Schäfer von Seiten der Stadt nicht weit her sein kann, wenn man ihr alle zusätzlichen Arbeiten, die bisher von der Archivleitung durchgeführt wurden und die künftig durch eine Ausweitung des Berufsfeldes u.a. auf digitale Unterlagen anfallen werden, bei einer Beschäftigung mit 0,33 VZÄ aufdrücken möchte. Die Museumsleitung soll ja offenbar keine archivfachlichen Aufgaben erfüllen, denn dafür ist sie nach der konzeptionellen Grundidee von 2021 nicht qualifiziert. Also bleibt der Bereich an der bereits vorhandenen Kraft hängen. Das schafft kein zukunftsfähiges Archiv und ist erst recht keine angemessene Personalpolitik.
Kommunale Archive sind kein Topf, aus dem man sich mal eben für Nostalgie oder historische Prestigearbeiten bedient, um sie dann wieder zu verschließen. Sie dokumentieren Verwaltungshandeln und ermöglichen es Bürger*innen, die Entscheidungen ihrer kommunalen Gremien und Ämter transparent nachvollziehen zu können. Werden an dieser Stelle so erhebliche Einschnitte vorgenommen, gefährdet das nicht nur das „historische Gedächtnis“, sondern kann langfristig auch massive Schäden am Vertrauen der Gesellschaft in demokratische Strukturen bedeuten. Um das zu vermeiden, müssen Archive nicht nur fachlich qualifiziert sondern auch ausreichend mit Personal ausgestattet sein – eine Planung, die bei der Streichung der Stelle der Archivleitung offenbar ebenfalls nicht berücksichtigt wurde.
Danke für den Kommentar! Zu berücksichtigen ist bei der Drittel-Stelle, dass die übrigen Zweidrittel für die Archivarbeit zweier Olper Nachbarkommunen „belegt“ sind, so dass eine Aufstockung nicht einfach ist.
Der Name der Sekundarschule Netphen wurde durch den Rat der Stadt Netphen gestern bei 3 Enthaltungen in Anita-Ruth-Faber (um-)benannt.
s. a. hier: https://www.wp.de/staedte/siegerland/namensstreit-beendet-anita-ruth-faber-sekundarschule-id237669299.html
Pingback: Westfalen News #63
Heute erschien in der Siegener Zeitung, Ausgabe Kreis Olpe, der Artikel „Stadtarchivar „kann wegfallen“? So reagiert der Bürgermeister auf die Debatte.“:
“ …. Sein aktueller Tenor lautet, die Diskussion mit mehr Gelassenheit zu führen und zur „Versachlichung zurückzukehren.“ Dies begründet Weber anhand des Termins, an dem der aktuelle und seit 1989 in dieser Funktion tätige Stadtarchivar Josef Wermert in den Ruhestand eintritt. Dies wird am 30. Juni 2024, also in über einem Jahr, der Fall sein.
„Es war immer geplant, dass wir im Laufe dieses Jahres das Thema besprechen“, eröffnete Weber seine Stellungnahme vor der Stadtverordnetenversammlung. …. Trotz dieser zunächst pragmatischen Analyse war Peter Weber anzumerken, dass die neu entflammte Debatte um die Stadtarchiv-Leitung Spuren hinterlassen hatte. …..
Eines hatten diese Briefe und öffentlichen Meinungsäußerung für Peter Weber offenbar gemeinsam: einen Vorwurf der fehlenden Würdigung der Wichtigkeit des Stadtarchivs seitens Bürgermeister und Stadtverordnete. „Es ist eine Unterstellung, die nicht zutrifft, dass die Arbeit im Stadtarchiv von uns nicht gewürdigt wird“, reagierte Weber entsprechend. Gleichzeitig bekräftigte er, dass er sich im Austausch mit Axel Stracke als Vorsitzenden des Heimatvereins Olpe befindet. Auch zum Münsteraner Leiter des Archivamtes in Münster, Dr. Marcus Stumpf, bestünde seit vergangenem Jar ein erster Kontakt. Marcus Stumpf war dennoch einer der prominenten Unterzeichner des ersten offenen Briefes.
Der erste offene Brief hat die Politik zeitlich auf dem falschen Fuß erwischt. Jetzt sollen die Wogen geglättet werden. Wir beraten in diesem Jahr die NAchfolge Lösung. Diese wird dann in dem Stellenplan für 2024 einfließen.. Und dieser wird letztendlich hier von uns entschieden,“ sagte Bürgermeister Weber. Hierzu sieht er sich und die Stadt in der Pflicht, die künftigen Aufgaben eines möglichen Stadtarchivars festzustellen. Daran wiederum orientiert sich der entsprechende Arbeitsaufwand.
Zeit und Aufwand waren in den vergangenen Jahren durch die Arbeit an den vier Bänden der Stadtgeschichte unter dem Titel „Olpe – Geschichte von Stadt und Land“ entsprechend hoch. Das Werk wird mit dem vierten Band, welcher in diesem Jahr fertiggestellt werden soll, seinen abschluss finden. Auch der Einsatz von Jofef Wermert als aktueller Stadtarchivar beim Aufbau des neuen Museums und der Betreuung der Museumsleitung falle laut Bürgermeister Weber künftig in die Hände des neuen Museumsleiters Sebastian Luke. Diese Faktoren bewertet Peter Weber mit „sehr, sehr viel zusätzlicher Arbeitszeit“ in den vergangenen Jahren.
Am Ende seiner Stellungnahme äußerte der Erste Bürger der Stadt olpe den Wunsch „zur Versachlichung und Gelassenheit zurückzukehren“. Auch der Begriff der „verbalen Abrüstung“ fiel mehrfach. Die anwesenden Stadtverordneten im voll besetzten Ratssaal reagierten mit klopfenden Beifall.“
„Mit Erstaunen haben die Unterzeichneten die Erklärung des Olper Bürgermeisters Peter Weber zur Besetzung der Stadtarchivstelle vor der
Stadtverordnetenversammlung am 15. Februar 2023 zur Kenntnis genommen, wie es LokalPlus berichtet hat.
Den „Offenen Brief“ vom 23. Januar 2023, mitunterzeichnet von 91
Wissenschaftlern, Historikern, Archivaren und Kulturschaffenden, hat der
Bürgermeister entweder nicht sorgfältig gelesen oder er stellt manches bewusst nicht korrekt dar.
1. Wir verwahren uns mit Entschiedenheit dagegen, dass der Bürgermeister
seinen „Eindruck“ kundtut, „von interessierter Seite werde versucht, die
Stadtverwaltung in Misskredit zu bringen.“ Die Formulierung „von
interessierter Seite“ kann sich aufgrund des Kontextes nur auf die
Unterzeichneten und Mitunterzeichneten beziehen. Sie müssen die zitierte
Formulierung als Diffamierung empfinden. Wenn geäußerte Vorbehalte und
Kritik als „Misskredit“ interpretiert werden, zeigt dies Verachtung dafür,
dass freie Bürger in einem freien Land von ihrer Meinungsfreiheit Gebrauch
machen und das Recht für sich in Anspruch nehmen, „Offene Briefe“ zu
verfassen. Allen unterzeichneten Fachkundigen geht es im „Offenen Brief“
vom 23. Januar ausschließlich um die Sache „Stadtarchiv Olpe“. Dies wird
auch daran deutlich, dass der Brief nach dem Urteil mehrerer politischer
Mandatsträger „in sehr sachlicher und emotionsfreier Form mit guten und
schlüssigen Argumenten“ für den Erhalt der Archivarsstelle verfasst wurde.
Bürgermeister und Stadtverordnetenversammlung haben jedoch
anscheinend ohne nähere Sachkenntnis eine politisch motivierte
Entscheidung getroffen und die neu geschaffene Stelle des Museumsleiters
auf Kosten der als entbehrlich angesehenen hauptamtlichen Archivleitung
installiert. Haben sich Bürgermeister und Stadtverordnete jemals im
Stadtarchiv und insbesondere im Archivmagazin eine Vorstellung von der
dortigen Arbeits- und Materialfülle verschafft? Haben sie Kenntnis von den
Aufgaben genommen, die zu leisten die Kommunen verpflichtet sind
(„Pflichtaufgaben“)?
2. Der Bürgermeister geht in seiner Erklärung mit keinem Wort auf die vom
Archivamt des Landschaftsverbandes und die von den Verfassern des
„Offenen Briefes“ vorgetragenen Argumente ein, mit denen eine
hauptberufliche Archivleitung als unverzichtbar begründet wird. Vor allem
das Archivamt ist – neben dem Leiter des Stadtarchivs – diejenige
Institution, die sachgerecht und unabhängig Arbeitsanfall, Arbeitsbelastung
und Arbeitsweise im Stadtarchiv beurteilen kann.
3. Im „Offenen Brief“ der 93 Unterzeichneten ist sehr wohl und entgegen den
Worten des Bürgermeisters auf die vorhandene Drittelstelle im Archiv
hingewiesen worden, die derzeitige Mitarbeiterin ist sogar namentlich
erwähnt (vgl. Punkt 16 des „Offenen Briefes“). Von einer durch den
Bürgermeister behaupteten „fehlenden Wertschätzung“ seitens der
Briefverfasser kann also nicht einmal ansatzweise die Rede sein.
4. Es verwundert sehr, dass der Bürgermeister, wenn er denn das Gespräch
favorisiert, dieses nicht zuerst mit dem Stadtarchivar und sachkundigen
Bürgern vor Ort (Vertreter des Heimatvereins, Verfasser regional- und
lokalgeschichtlicher Beiträge, Ortsheimatpfleger, ausgewiesene Historiker
etc.) gesucht hat. Zusammen mit den Stellungnahmen des LWL-Archivamtes
hätte damit eine angemessene Entscheidungsbasis vor einem möglichen
„künftig wegfallend“-Vermerk geschaffen werden können.
Wir hoffen weiterhin im Sinne der Sache, dass eine Wiederbesetzung der
hauptamtlichen Archivleitung erfolgt – sinnvollerweise vor dem Ausscheiden
des derzeitigen Stelleninhabers, wie dies vorbildlich in Attendorn praktiziert
wurde.
Für weitergehende Informationen verweisen wir auf die in dieser Sache
vollständige Dokumentation im Blog siwiarchiv.de.
Olpe, 18. Februar 2023
Dr. Roswitha Kirsch-Stracke Dr. Hans-Bodo Thieme“
Online-Version als Leserbrief auf LokalPlus: https://www.lokalplus.nrw/olpe/buergermeister-geht-mit-keinem-wort-auf-argumente-ein-78149
Am 21.2.2023 erschien in der Online-Ausgabe der Westfalenpost – leider hinter der Bezahlschranke – der Artikel „Zukunft des Olper Stadtarchivs: Jetzt legen Kritiker nach“, der die oben wiedergegebene Reakktion der Verfasser des ersten Offenen Briefes wiedergibt.
Heute erschien der Artikel in der Print-Ausgabe der Westfalenpost.
Karnevalistischer Kommentar:
1. Auszug aus der Büttenrede vom „Entjräter“: :
„ …. Ich will heut´ nicht singen von Sundern,
die Stadt Olpe lässt mich wundern.
Das Stadtarchiv ward angezählt,
die Nachfolge ist längst erwählt.
Offenheit und Transparenz
finden dort bald ihre Grenz‘ .
Archivisches Arbeiten kann ein jeder,
sagt der Bürgermeister Weber.
Gezündet werden Nebelkerzen,
Briefeschreiber versucht anzuschwärzen,
um abzulenken von der eigenen Tat
wider bess‘ rem Experten-Rat.
Das Problem – verbal abgerüstet –
wird nun weggeflüstert.
Bleiben Misskredit oder politisches Gewürge?
Ach, ich hoff‘, es siegt der mündige Bürger! ….“
2. Fussgruppe der RKG „Lustige Historiker:innen“ für den Umzug mit dem
Motto: „Tom und Jerry im Archiv“ oder: „Schwarzer Kater jagt graue Maus“
3. Motivwagen des ACC „Närrische Regalbefüller“ unter dem Motto „Archivarischer Albtraum“:
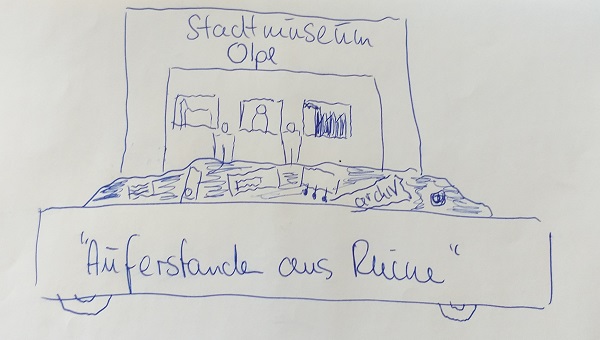
Abkürzungen:
ACC Archivisches CarnevalsCommittee
RKG Regionale Karnevalsgesellschaft
Heute erschien in der Westfalenpost (Olper Ausgabe) der Artikel „Bürgermeister drängt auf Beruhigung. Peter Weber betont: Entscheidung für Archivars-Nachfolge fällt erst 2024.“:
„Die vielen Briefe, die inzwischen geschrieben wurden, um auch in Zukunft für eine hauptamtliche Leitung des Olper Stadtarchivs zu werben, haben ein Echo bekommen. Bürgermeister Peter Weber (CDU) nutzte dazu einen ungewöhnlichen Weg: Er ergriff am Mittwoch am Ende der Ratssitzung unter dem Tagesordnungspunkt „Informationen“ das Wort, um in einer ausführlichen Stellngnahme, Öl auf die Wogen zu gießen. Er habe ja „den einen oder anderen offenen Brief dazu erhalten, auch die SPD-Fraktion hatte sich in einer Stellungnahme geäußert, die Weber lobte: Darin sei im Grunde das wiedergegeben worden, was zwischen Rat und Verwaltungvereinbart worden sei: „Wir hatten im Haushalt vereinbart, dass wir uns im Laufe des Jahres darüber unterhalten.“ Doch nun werde „von interessierter Seite versucht, mit etwas verkürzter Sicht die Stadt ein bisschen in Misskredit zu bringen.“ ….
„Wir werden uns in diesem Jahr darüber unterhalten in welchem Umfang eine Nachbesetzung des Leiters des Stadtarchivs stattfinden wird.“ Wermert scheide am 30. Juni 2024, „wohlgemerkt nicht 2023, sodass das Ergebnis der Beratungen in den Stellenplan 2024 einfkießen wird.“. …. „Der Leiter des Stadtarchivs ist nicht der einzige Mitarbeiter, die weitere Mitarbeiterin, die wir uns mit Wenden und Drolshagen teilen, findet in all diesen Briefen keine Erwähnung, was kein wertschätzender Umgang ist.“
Richtig an der in den Briefen angeführten Kritik sei, „dass wir uns mit der Politik darüber unterhalten werden, welche freiwilligen Leistungen des Stadtarchivs wir künftig abdecken wollen. Auch wird es um die Frage gehen, ob bei der Vermittlung der Stadtgeschichte weiterhin auf die Schriftform gesetzt wird oder auch andere, moderne Mittel verwendet werden. Das Thema war uns wichtig und wird uns immer weichtig sein.“
Auch gelte es zu berücksichtigen, dass in den vergangenen Jahrzehnten vom Leiter des Stadtarchivs die Olper Stadtgeschichte in vier Bänden mit mehreren Teilbänden“in ganz hervorragender Weise verfasstworden“ sei. Der letzte Teilband solle 2024 erscheinen „und damit ist eine Arbeit abgeschlossen, die viel Arbeitszeit des Archivars gebunden hat. Zudem hat er die Museumssammlung betreut, und wir haben nun einen Leiter des Stadtmuseums in dessen Arbeitsbereich dies fällt. Es ist ein völlig normaler Vorgang, dass wir prüfen, in welchem Umfang wir eine solche Stelle nachbesetzen müssen. Da bis 2024 genügend Zeit dafür sei, „rate ich allen, verbal ein wenig abzurüsten und das Gespräch zu suchen statt offene Briefe zu schreiben. Es ist keine leere Floskel, wenn wir in der Vergangeneheit die Arbeitunseres Archivars gelobt haben.“
Allerdings sehe er „ein bisschen unabhängig davon die Frage der Zukunft des Jahrbuchs des Heimatvereins“. In diesem Jahr betreue Wermert es, „Diese Unterstützung ist immer von uns gewollt gewesen und soll nach meiner Meinung auch künftig sein“, die Frage sei aber, ob dies in Form von personeller Unterstützung sein müsse oder sie auch durch finanzielle Förderung erfolgen könne. Er stehe mit dem Heimatverein im Kontakt, “ ich persönlich sehe das Heimatbuch nicht gefährdet.“
Er hoffe, dass „die medieale Aufregung, die auch sehr inszeniert worden ist, versachlicht wird.“ Der Stadtrat untersützte diese Stellungnahme mit Applaus.“
„Es wird umfassend zu den Überlegungen hinsichtlich der Personalstelle des Leiters des Stadtarchivs der Kreisstadt Olpe informiert.“ aus: Niederschrift über die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 15.02.2023 vom 21.2.2023, S. 12
Siwiarchiv hätte gerne die umfassenden Überlegungen hier im Wortlaut wiedergegeben. Denn schriftlich waren sie gegenüber einem hier zeitweise Mitdiskutierenden bereits vor der Stadtverordnetenversammlung formuliert worden.
Pingback: Museolog*innen als Archivar*innen? Ein Beitrag des 60. Fachhochschullehrgangs zur Debatte um die Stelle des Stadtarchivars in Olpe – Archivwelt
Heute erschien die Westfalenpost Olpe der Leserbrief „Gerne streiten, aber respektvoll bleiben. „Diskussion über die Stelle des Archivars“:
„In den letzten Wochen erschienen in der lokalen Presse und überregionalen Internetforen, z. B. im Blog der Archive im Kreis Siegen-Wittgenstein (siwiarchiv.de), viele Leserbriefe zum Wegfall der Stelle des Stadtarchivars in Olpe. Ich möchte hier nicht die zahlreichen Argumente dafür und dagegen wiederholen; diese sin hinreichend von den Autoren dargelegt worden. An dieser Stelle soll die Vorgehensweise des Bürgermeisters und der Politik, die zu einigen Irritationen führte, in den Fokus gerückt werden: Zunächst ist es unverständlich, dass weder kompetente Fachleute noch Sachkundige Bürger in den Entscheidungsprozess eingebunden wurden. Es existiert zwar – wie ich erfahren habe – eine Korrespondenz zwischen dem LWL-Archivamt für Westfalen als zuständiger und beratender Behörde des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe und dem Bürgermeister. Diese konnte jedoch vom LWL erst angeregt werden, als die Entscheidung bereits gefallen war. Es wäre für die Diskussion wichtig, etwas über den Inhalt des LWL-Schreibens und seine Rezeption durch den Kommunalpolitiker Weber zu erfahren. Auch der Stadtarchivar Josef Wermert wurde trotz seiner umfangreichen Fachkenntnisse nicht informiert; er erfuhr erst „auf der Straße“, dass seine Stelle schon jetzt mit einem kw-Vermerk (=künftig wegfallend) versehen ist. Der Schreiber dieser Zeilen, der an zahlreichen Publikationen des Stadtarchivs Olpe mitgearbeitet hat, ewrlebte, dass seine kritische Frage zu der zukünftigen Qualtät der Arbeit und der historischen Forschung im Stadtarchiv von Herrn Weber höflich mit Beschönigungen und Beschwichtigungen beiseitegeschoben wurde.
Die Stellungnahme des Bürgermeisters in der Ratssitzung am 15. Februar erscheint mir in erster Linie als Rechtfertigung für die getroffene politische Entscheidung und als ein Versuch, Wogen zu glätten. Webers Erklärung enthält einige Ungereimtheiten. Entgegen seiner Behauptung wurde im „Offenen Brief an den Bürgermeister unter Punkt 16 expressis verbis auf die Drittelstelle im Archiv hingewiesen und die Stelleninhaberin Annalena Schäfer namentlich genannt. Es ist bedauerlich, dass Her Weber den Eindruck hat, es werde von interessierter Seite versucht, die Stadtverwaltung in ÄMisskredit zu bringen. Ihm sei Folgendes ins Gedächtnis gerufen: Man kann in einer Demokratie in der Sache heftig streiten und dennoch sein Gegenüber respektvoll behandeln. Genau diesen Weg haben die Initiatoren und Unterstützer des Offenen Briefes eingeschlagen.“
Die Diskussion über die Wikipedia-Einträge von Kommunen aus dem Kreisgebiet wird durch die Siegener Zeitung um Kreuztal (Friedrich Flick) und Siegen (Adolf Hiteler als Ehrenbürger, Paul Giesler, Ernst Achenbach) erweitert:
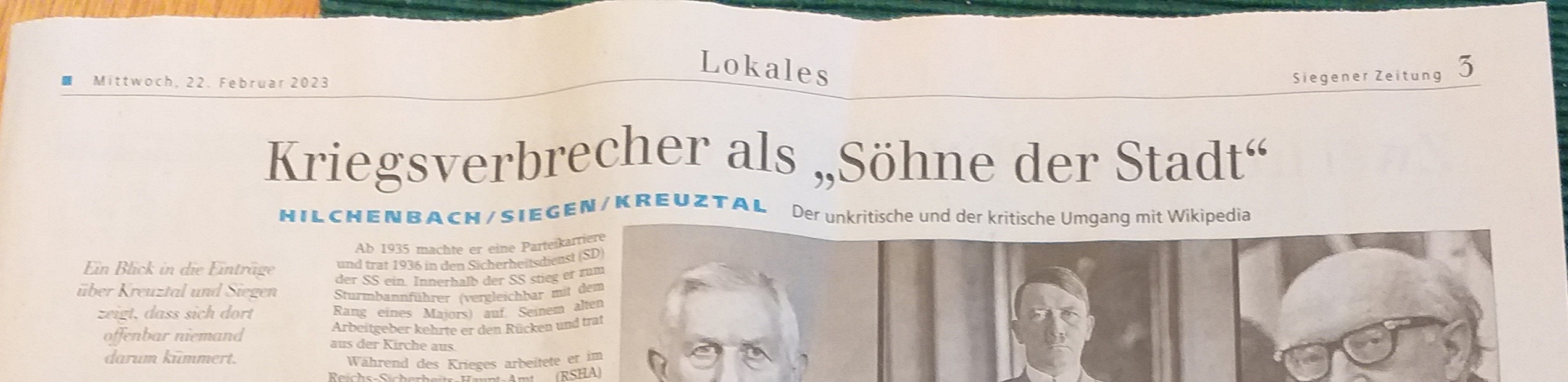
Die Frage ist müssen Kommunen die Seiten korrigieren?
Pingback: Video zur Geschichte der Sprachenschule Siegerland | siwiarchiv.de
Mit etwas Abstand bleiben einige Fragen an die Stellungnahmen des Bürgermeisters gegenüber dem Sauerlandkurier, einer zeitweise hier an der Diskussion beteiligten Person und gegenüber der Stadtverordentenversammlung:
1) Warum äußerte sich der Bürgermeister nur gegenüber diesen dreien? Für mich wäre es nachvollziehbarer gewesen, wenn er zuerst vor der Stadtverordnetenversammlung zu den bis dahin vorliegenden Äußerungen Stellung bezogen hätte. Dies hätte m. E. der gewünschten Versachlichung gedient. Allerdings auch nur dann, wenn man den vollen Wortlaut des Statements dokumentiert hätte.
2) Ist es politisches Kalkül gewesen, dass der Bürgermeister seine Sicht der Dinge unter dem Tagesordnungspunkt „Informationen“ dargelegt hat? Wenn ich es recht sehe, ist unter diesem Tagesordnungspunkt keine Aussprache vorgesehen, so dass die Debatte in die politischen Diskussionen dieses Frühjahr verschoben wird.
3) Aus den in den Medien dokumentierten Äußerungen geht immer noch nicht hervor, warum genau die Stelle der Archivleitung bereits im Stellenplan 2023 mit „kw“ versehen wurde. Wie der Bürgermeister selber angibt, tritt der Stadtarchivar erst Ende Juni 2024 in den mehr als verdienten Ruhestand. Ist es ein haushalterischer Trick, um die im Januar 2023 besetzte Stelle der Museumsleitung zu kompensieren?
4) Der Bürgermeister betont, dass der Stadtarchivar die Museumssammlung der Stadt zumindestens bis zum Januar 2023 betreut habe und dass die Betreuung nun wegfalle. Dies ist mehr als verständlich.
Aber: warum bleibt die personelle Untersützung, die der Stadtarchivar für die Erledigung dieser Aufgabe hatte unerwähnt. So entsteht für mich entgegen dem Wunsch zur Versachlichung ein falscher Eindruck.
5) Der Bürgermeister betont, dass die Erstellung der auch von ihm gelobten Stadtgeschichte viel Arbeitszeit des Stadtarchivaren gebunden habe und bis zur Vorlage des letzten Bandes auch noch bindet. Wer hat diese Stadtgeschichte in Auftrag gegeben?
War dem Auftraggeber nicht nicht bewusst, dass dieses Vorgehen dazu führt, dass die archivischen Tätigkeiten auf das Mindestmaß beschränkt werden müssen, um das Projekt zu einem guten Ende zu bringen?
Ob diese Fragen in den stehenden politischen Diskussionen beantwortet werden?
Zu Punkt 5 des vorstehenden Kommentars hilft vielleicht ein Blick in das Impressum eines Stadtgeschichtsbandes:
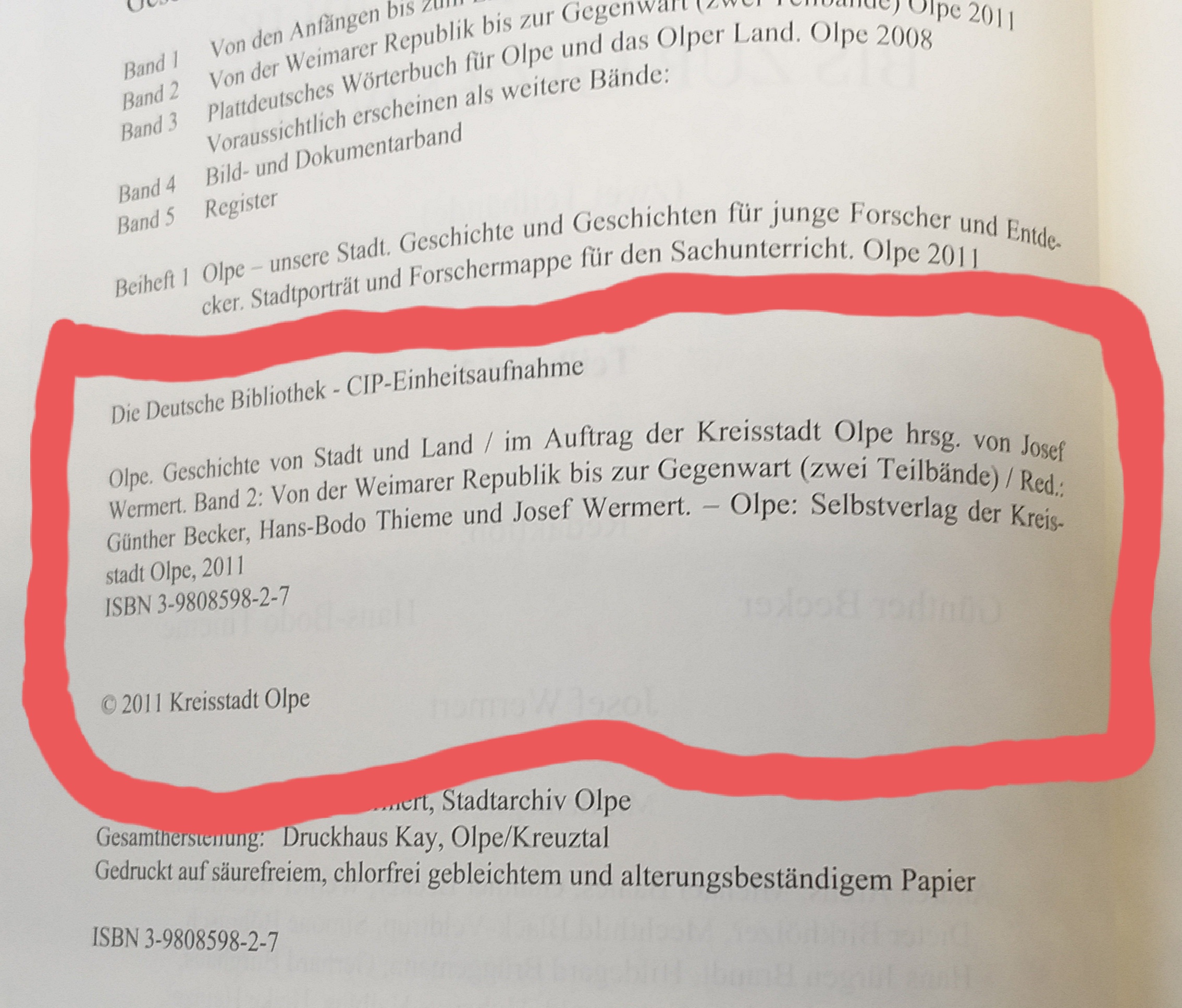
Eine herzerwärende Geschichte. Gefunden habe ich sie im Kontext zu dem Experiment, die Enstehungsgeschichte der vhs Siegen-Wittgenstein durch KI, in der Realisation durch Chat-GPT, zusammenfassen zu lassen. Das kann die Software irritierend gut, leider ohne Quellenangaben. Die Validität zu prüfen bleibt Angelegenheit der Benutzenden und – diese Geschichte hatte KI nicht entdeckt. Das finde ich liebenswert. Greifbares Wissen entsteht eben durch menschliche Forschung – und durch Archive, die dies möglich machen.
Liebe Grüße an meine Vorkommentatoren und an den Archivar!
Danke für diesen Kommentar! Tröstlich ist ja, dass das zurzeit in aller Munde seiende Programm auch nicht alles findet
Pingback: Neues OZG-konformes Online-Anfrageformular, aber nur für NRW-Kommunalarchive – Archivalia
Na, ja…………….irgendwie muß die Stadt ja, wie alle anderen auch, Kosten
einsparen um die Flut der Asylanten bezahlen zu können! Da bleiben die
kulturellen Bedürfnisse der „schon länger hier lebenden“ halt auf der Strecke!
Ein Schelm, der dabei Böses denkt…………………..
Danke für den Kommentar! Man macht es sich m. E. allerdings zu einfach den erhöhten Kostendruck auf die Kommunen lediglich mit der Aufnahme von Asylsuchenden zu begründen. So führen z. B. soziale oder bildungsbedingten Bedürfnisse „schon länger hier lebenden“ ebenfalls zu Mehrkosten.
Dank für einen solchen „Kommentar“? Wer Einsparungen im Kulturbereich ausschließlich mit einer „Flut der Asylanten“ begründet, verrät aus welcher – rechten – Ecke er kommt. Und obendrein verstecken sich diese einfach gewebten Geister auch noch hinter Pseudo-Namen!
Ach du Schei…..
Schon wieder so ein links-grün indoktrinierter
Gutmensch, der blind für die Realität ist!
Aber keine Sorge! Die Realität kommt schon
noch zu Ihnen…………………
Brat Pit hat schon recht! Täglich sieht, liest und
hört man in allen Medien von der katastrophalen
Lage in den Kommunen. Wo leben, Sie um das
zu ignorieren? Sie sind in der Tat ein Realitätsverweiger aller ersten Ranges! Die finanzielle Belastung der Kommunen durch die
Unterbringung, Verpflegung und medizinischen
Versorgung der Flüchtlinge steigt ins Unermeßliche. Die Verwaltungen der Kommunen sind restlos überfordert. SIE verleugen das und packen die „Nazikeule“ aus.
(Nur mal so: Diese „Keule“ hat schon längst ihre Wirkung verloren und wird in dem allergrößten Teil der Bevölkerung nur noch mit
einem mitleidigen Lächeln quittiert). Jeder, der mal die Wahrheit anspricht, wird wohl von Ihnen gleich in die rechte Ecke gestellt, was?
Offensichtlich wohnen Sie nicht nur in einem
„hohlen Weg“.
Bitte keine off topic Kommentare mehr! Ansonsten wird die Kommentarmöglichkeit für diesen Eintrag zurückgenommen!
@archivar: Das ist ja schon erstaunlich! Da wird meine angebliche Wohnstraße zusammen mit einem gewissen Bedrohungspotential („Ludewich“) vom Administrator unkommentiert auf dieser Seite veröffentlich, und ich soll jetzt schweigen. Da nehme ich mir doch die Freiheit heraus, noch einmal ganz freundlich zu antworten!
@Sonja Kellermann: Liebe Sonja! Mit dem Recherchieren ist das so eine Sache. Da machst Du Dir solch eine Mühe, nimmst sogar ein Telefonbuch in die Hand, schlägst auch noch beim richtigen Buchstaben auf und landest doch nicht nur im „hohlen Weg“, sondern auch noch auf dem Holzweg. Dumm gelaufen! Da nun der „archivar“ keine „off topic Kommentare“ mehr wünscht, schlage ich vor, dass Du mir Deine Adresse zukommen lässt, damit wir unseren Gedankenaustausch fernab der Öffentlichkeit fortsetzen können. Oder ging es Dir vor allem um den Beifall einer bestimmten Öffentlichkeit? Bis bald. Viele Grüße aus …
Ludwig Burwitz
Am 4.3.23 erschien im Sauerlandkurier der folgende Leserbrief „Von archivarischen Aufgaben ist jedoch keine Rede“:
„Die Verfasser dieses Leserbriefes gehören zu den Autoren des „Offenen Briefes“, in dem gegen die Streichung der hauptamtlichen Archivarstelle in Olpe Position bezogen wird, und sie äußern sich zu den Ausführungen des Olper Bürgermeisters im „Sauerlandkurier“ wie folgt:
1. Bürgermeister Peter Weber geht nicht auf die vorgetragenen Argumente des „Offenen Briefes“ vom 23.1.2023 ein, der in 19 Punkten die Aufgaben des Stadtarchivars thematisiert.
2. Der Bürgermeister begründet nicht den im Haushaltsplan vermerkten Fortfall der hauptamtlichen Archivarstelle.
3. Museums und Archivstelle sind bezüglich Ausbidung, Tätigkeit und wachsenden Anforderungen nicht austauschbar(ebensowenig wie ein Bäcker und ein Metzger, nur weil sie beide mit Lebensmitteln zu tun haben). Beide Bereiche, Archiv und Museum, benötigen entsprechend ausgebildete Fachleute, die sich nicht ersetzen, wohl aber ergänzen können.
Zu den geplanten Tätigkeiten des neunen Museumsleiters ist die Pressemitteilung der Stadt Olpe vom 13.12.2022 aussagekräftig: „Abgesehen von den mit der Museumsentwicklung verbundenen administrativen Tätigkeiten, liegt ein Schwerpunkt von Sebastian Luke als Leiter des Stadtmuseums auf der Zusammenarbeit und Netzwerkpflege mit unterschiedlichen Zielgruppen, z. B. Verbänden, Schulen, Vereinen sowie regionalen und überregionalen Institutionen. Nach Fertigstellung des Museums gilt es, neben der fachlichenn und organisatorischen Führung, Ausstellungen und Veranstaltungen zu organisieren sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung des Museums zu gestalten.“
Das ist ein umfangreiches Aufgabenspektrum, zu dem wir dem Museumsleiter von Herzengutes Gelingen wünschen. Von archivarischen Aufgaben ist in der Presseinformation jedoch keine Rede – abgesehen davon, dass die von Förderverein und Stadtarchiv über viele Jahre aufgebaute Sammlung für ein Stadtmuseum übernommen werden soll..
– Wer also wird die akten der Stadtverwaltung, analoge und zunehmend digitale ,übernehmen, verzeichnen und sichern?
– Wer wird die öffentliche digitale Bereitstellung (Olpe digital) vorantreiben?
– Wer kümmert sich um die Ensäuerung gefährdeter Archivalien?
– Wer ist Ansprechpartner für Vereine und Privatpersonen, die dem Archiv Sammlungen und Nachlässe übergeben wollen, um sie für die Stadtgeschichte zu sichern?
– Wer unterstützt Schüler, Schülerinnen und Studierende bei ihren Facharbeiten, hilft ihnen beim Suchen, Finden und Sichten passender Quellen und vor allem beim Lesen der historischen Schriften?
– Wer unterstützt und motiviert die vielen ehrenamtlich arbeitenden Heimatforscher und Familienforscher?
– Und wer schreibt die Geschichte der Stadt Olpe fort, wie es bisher im Jahrbuch des Heimatvereins für Olpe und Umgebung e. V. geschah?
Um diese Aufgaben zu klären und die Notwendigkeit ihrer Fortführung zu erkennen, müssen nicht“viele Gespräche geführt werden“ (BM Weber), sondern es reichen eine Führung des jetzigen Archivars durch das Stadtarchiv Olpeund ein Gespräch mit dem LWL-Archivamt in Münster.
Dr. Roswitha Kirsch-Stracke, Wenden
Dr. Hans-Bodo Thieme, Olpe“
@alle Gleichgültig wie schlagend die Argumente bezüglich des Rückzugs der Stadt Bad Laasphe aus der Unterstützung des Radio-Museums auch sein mögen, bitte ich darum, von persönlichen (Vor-)Verurteilungen oder Angriffen abzusehen. Ansonsten droht die Löschung von entsprechenden Kommentaren.
s.a. Klaus Dietermann: Kriegsbeginn – 1939 in Stadt und Kreis Siegen. Dokumentation 6, Siegen 1988, S. 16, 22, 32, 33, 39, 41
2 weitere Irle-Funde:
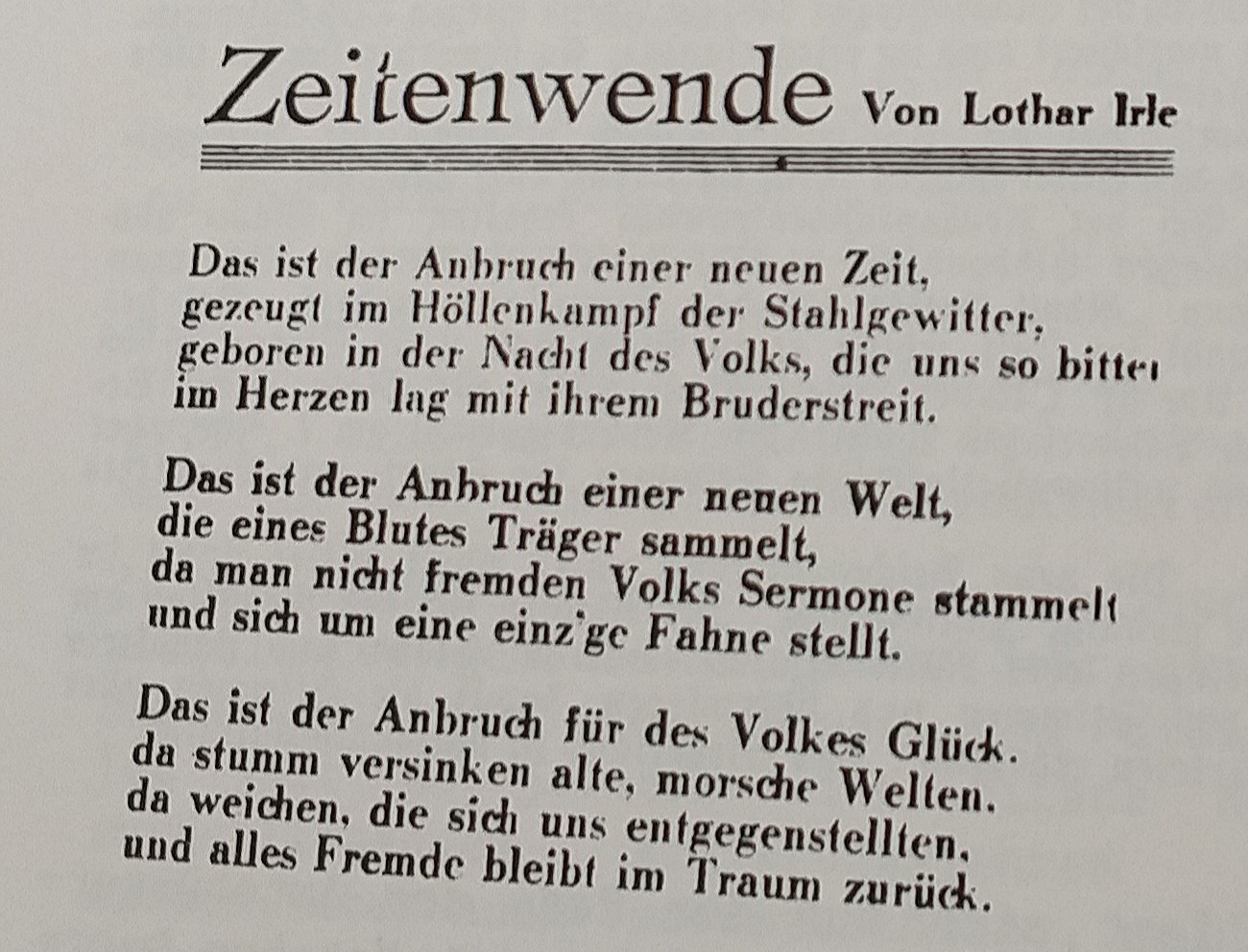
aus: Sonderbeilage „Von der Idee zur Erfüllung“ der Siegerländer Nationalzeitung v. 30. Januar 1939
zitiert nach: Klaus Dietermann: Kriegsbeginn – 1939 in Stadt und Kreis Siegen. Dokumentation 6, Siegen 1988, S. 8
– „…. Eine weitere große Feierstunde („Tag der Wehrmacht“) führte die NSDAP eine Woche nach dem „Heldengedenktag“ im Apollo-Kino durch. Sie wurde von den beiden Pädagogen Fritz Fromme (Neunkirchen) und Dr. Lothar Irle durchgeführt, die „sich in vorbildlicher Weise ergänzten“….“
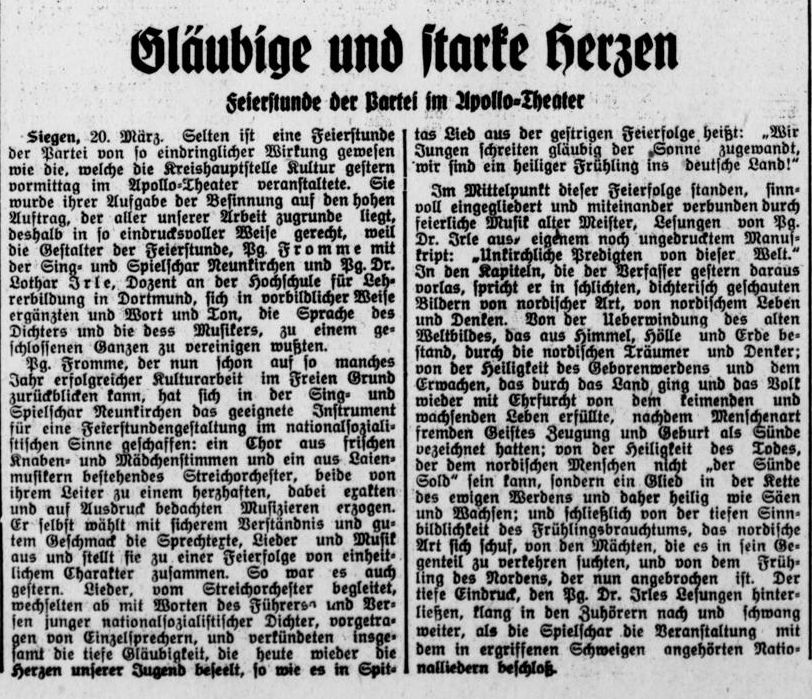
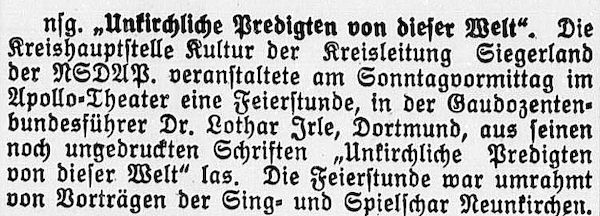
aus: Klaus Dietermann: Kriegsbeginn – 1939 in Stadt und Kreis Siegen. Dokumentation 6, Siegen 1988, S. 18:
Nationalzeitung vom 20. März 1939 (s. Bildergalerie oben)
Iserlohner Kreisblatt 23. März 1939 (s. Bildergalerie oben)
Der restauratorische Weg einer Akte- Teil 8: Stabilisieren- Hintergrund
Pingback: Elise Sommer (1761 – 1836) – eine Wittgensteiner Dichterin | siwiarchiv.de
Folgende Veröffentlichungen von bzw. zu Oscar Robert Achenbach konnten in der Siegener Zeitung aufgefunden werden:
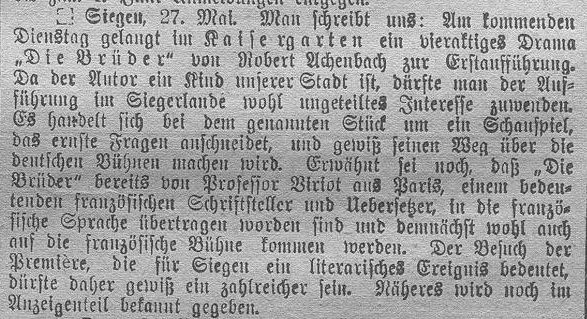
– „Der erste Schnee“, Jg. 79 (1901), Nr. 299
– „Das Glück auf der Walze“, Novelle, Jg. 80 (1902) Nr. 41, 42, 43, 44 Beilage 45, 46, 47 Beilage, 48
– „In letzter Stunde!“ Novellette, Jg. 80 (1902), Nr. 188 Beilage, 189
– „Der Siegener Dichter Oscar Robert Achenbach in München“ [darin sein Schauspiel „Schlagende Wetter“], Jg. 99 (1921), Nr. 83 vom 11. April
– Das Volk, 28. Mai 1908:
siehe auch: http://www.wittgensteiner.net/data_elise_sommer.html
Danke für den Kommentar! Link befindet sich bereits im Eintrag.
Pingback: Zum Internationalen Frauentag – Archivalia
Oscar Ludwig Bernhard Wolff: Encyclopädie der deutschen Nationalliteratur oder biographisch-kritisches Lexicon von deutschen Dichtern und Prosaisten seit den frühesten Zeiten nebst Proben aus ihren Werken, Band 7 Schmauss bis Z, Leipzig, 1842, S. 137:
Pingback: Heute vor 175 Jahren: Beginn der Revolution im Siegerland | siwiarchiv.de
Pingback: Neuerscheinung der Geschichtswerkstatt: Siegener Beiträge – Jahrbuch 27 / 2022 | siwiarchiv.de
Pingback: Siegen: Stellungnahme des Arbeitskreises „Aufarbeitung der historischen Hintergründe von Straßennamen“ | siwiarchiv.de
Es geht also weiter im Thema Straßenumbenennung in Siegen. Die Biografien zu verschiedenen Personen sind präzisiert (z.B. Porsche) oder erstmals (z.B. von Luckner) vorgelegt worden. Zu Porsche wie zu Luckner wird auf das Gutachten der Düsseldorfer Kommission durch einen Link Bezug genommen. Dazu eine Frage: Wie kann sich die Siegener Kommission auf das Düsseldorfer Gutachten beziehen, wenn Luckner in diesem Gutachten gar nicht erwähnt wird. Da scheint in der Belegführung etwas durcheinander geraten zu sein. Lässt sich das schnell nachbessern?
Eine berechtigte Frage – Danke für die kritische Durchsicht!
Vielleicht ist ja dies gemeint: Alexander Sperk / Daniel Bohse: Gutachten zur Einschätzung der Person Felix Graf von Luckner (1881–1966) hinsichtlich Straßenbenennung in der Stadt Halle (Saale), Halle (saale) 2005, Link: https://m.halle.de/VeroeffentlichungenBinaries/527/519/luckner-gutachten_12052011.pdf
@archivar, genau auf S. 34-35. Dort wird aus der Akte des Bundesarchivs, wo der Vorgang seinen Niederschlag gefunden hat, ausführlich zitiert.
Aber es kann ja nicht unsere Aufgabe sein, derartige Belegstellen richtigzustellen. Aber wenn es denn so wäre, dann müssten wir hier den Text erneut einfügen und richtig zitieren: Zitat im Zitat, Fußnote.
Da es sich um das Hallenser Gutachten handelte, habe ich hier die Fußnote entsprechend geändert. Der Rest liegt in der Zuständigkeit des Arbeitskreises, der dies hier sicher wahrgenommen hat.
Die Stellungnahme ist in der Zwischenzeit in einer korrigierten Fassung im Ratsinformationssystem aufrufbar.
1. Facebook-Seite der Westfälischen Rundschau:
2. Facebook-Seite der Siegener Zeitung:
In der gestrigen Aktuellen Stunde des Westfälischen Archivtages wurde unter Punkt 2 „Novellierung ArchivG NRW / Kulturgesetzbuch“ von Prof. Dr. Marcus Stumpf folgendes berichtet:
„Was die Novellierung des Archivgesetzes angeht, kann noch kein festes Datum genannt werde. Dass dies allerdings hinfällig ist, aufgrund der Erneuerung der Datenschutzverordnung, ist unangefochten.
Um Überlegungen anzustellen, wie es weiter geht, wurde seitens des Ministeriums bereits eine Arbeitsgruppe gebildet. In dieser wirken auch [Mark] Steinert [LVR-AFZ] und [Eric] Steinhauer [und das Landesarchiv NRW] mit, allerdings gibt es auch dort noch keine endgültigen Entscheidungen.
-wie geht es weiter: ….: Überlegung: [die wegen der EU-DsGVO notwendig gewordene] Derogation aus zunehmen [und über das LDSG zu regeln].“
Quelle: https://archivamt.hypotheses.org/19859
Anm.: Die archivischen Arbeitsgemeinschaften der nordrhein-westfälischen , kommunalen Spitzenverbände haben Anfang des Monats ihre Änderungswünsche dem Ministerium gegenüber formuliert.
Pingback: Archivsituation in der Stadt Olpe | siwiarchiv.de
Pingback: Online: Friedrich Vorländer: „Die Siegenische Kunst-Wiese. | siwiarchiv.de
Pingback: Historische Dimensionen wirtschaftlichen Handelns – Archivalia
Pingback: Vortrag „Vom Siegerland bis in den Ural“ | siwiarchiv.de
Pingback: Vortrag „Vom Siegerland bis in den Ural“ | siwiarchiv.de
Jetzt auch hier:
https://www.lokalplus.nrw/olpe/olper-stadtarchiv-auf-der-tagesordnung-des-archivtages-in-hagen-78795
Pingback: Siegen: Umbenennung von drei Straßen – Namensvorschläge | siwiarchiv.de
Zur Diskussion der Medienberichte auf deren FB-Seiten s.
1) Westfälische Rundschau:
2) Siegener Zeitung:
In der heutigen Sitzung sprachen sich die Vertreter von AfD und CDU für die Beibehaltung der nach Ferdinand Porsche und Carl Diem benannten Straßen aus. SPD, FDP und Volt folgten der Stellungnahme des Arbeitskreises. Die CDU-Fraktion beantragte die Graf-Luckner-Str. in Edith-Langner-Str. umzubenennen. Eine Aussprache erfolgte nicht.
Die Einordnung von Adolf Wagner in Kategorie B erfolgte mehrheitlich bei 9 Enthaltungen, ebenso wie die Umbenennung der Diem- und Porschestr. Überraschenderweise erfolgte ebenfalls mehrheitlich die Umbenennung der Graf-Luckner-Str. in Edith-Langner-Str., ohne den eigentlich zuständigen Kulturausschuss zu beteiligen bzw. ohne Expertise des Arbeitskreises.
Warum die Expertise durch den Arbeitskreis im Falle von Edith Langner wünschenswert gewesen wäre? Soweit mir bekannt ist, hat die federführend beantragende CDU-Fraktion keine biographische Ausarbeitung zu Edith Langner vorgelegt. Dass eine historisch-biographische Studie noch aussteht, zeigt der Eintrag auf siwiarchiv zu Edith Langner, der sich seit dem Ratsbeschluss schon um einige Aspekte geändert hat: https://www.siwiarchiv.de/edith-langner-eine-kandidatin-fuer-eine-strassenbenennung-in-siegen/#comment-128568 . Ändern die dortigen Funde die Einschätzung von Edith Langner? Nach gegenwärtigem Kenntnisstand eher nicht. Aber wer weiß?
Die Westfälische Rundschau berichtet heute nicht hinter der Bezahlschranke online und auch auf FB:
Der Artikel „Graf Luckner kommt vom Straßenschild“ in der heutigen Siegener Zeitung ist leider nicht online abrufbar.
– „Langner, Erich, * 27.12.1911 Murow bei Oppeln, Vater: Hermann L. Postassistent, Mutter: Emma Gerstenberger, Gymn. Strehlen, Uni Bsl Ord. 2.12.1938 Bsl d. D. Zänker, Pfarrvik. in Dittmannsdorf/FMÜ. 1.9.1942 Grünhartau (z. Zt. im Wehrdienst). Vermißt 27.6.1944 bei Bobruisk. verh. 9.10.1938 in Rothbach Krs Bsl Edith Diebitz, 23.1.1913, lebt um 1953/1984 in Siegen/Westfalen (Vater Hermann D. Gendarmeriemeister, Mutter Elsbeth Hoedt) K.: Hans Wilfried, *9.2.1940 Berufsoffizier, 9.2.1940 Dolmetscher“
[Lit: A 1942, 99,Dehmel, ord. Nr. 465, Silesia sacra 1953, 55.321, H-Blatt Strehlen-Ohlau 1984 Nr. 1, S. 27]
aus: Dietmar Neß: Schlesisches Pfarrerbuch: Dritter Band: Regierungsbezirk Breslau, Teil III, Leipzig 2014, S. 212
– Karteikarte des Bevölkerungsregister der Stadt Poznań aus den Jahren 1870-1931 zu Edith Christine Pauline Diebitz, Link: https://e-kartoteka.net/de/search?signature=14354&PageSpeed=off#show
Im Bundesarchiv Bayreuth (Lastenausgleichsarchiv) findet sich eine Akte zum Vater Edith Langners, die im Siegener Ausgleichsamt erstellt wurde und ggf. Auskünfte über die Lebensverhältnisse Edith Langners für die Zeit, in der sie bei Ihren Eltern lebte, zulässt:
ZLA 1/15742781 Diebitz, Hermann (Geburtsdatum: 28.11.1885) als unmittelbar Geschädigter an Grundvermögen in Rothbach (Kreis Breslau)1952 – 2014
Pingback: Südwestfalenbörse 2023 in Siegen | siwiarchiv.de
Kurzfristig musste die Veranstaltung auf Bitten der Siegerlandhallenverwaltung in den Leonhard-Gläser-Saal der verlegt werden.
Am 24.3.23 erschien in der Siegener Zeitung der Artikel „So geht Burbach mit belasteten Straßennamen um“. Anlass sind die in Burbach vorhandene Stöckerstraße, die Friedrich-Flick-Straße, die Graf-Luckner-Straße und die Hindenburgstraße.
Heute erschien in der Siegener Zeitung der Leserbrief „Ergänzen statt Entfernen“ einer Burbacher Bürgerin, die sich .u. mit der Umbenennung der Lothar-Irle-Str. und der Graf-Luckner-Str. auseinandersetzt.
Heute erschienen in der Siegener Zeitung 2 Leserbriefe, die auf diesen Leserbrief Bezug nehmen. Während die „Beste Idee“ ausdrücklich das Anbringen von Erklärschildern mit QR-Codes begrüßt,lehnt „Nicht geeignet“ diese unter besonderem Hinweis auf Graf Luckner ab.
Aus dem Protokoll der Sitzung des Rates der Gemeinde Burbach vom 2. Mai 2023: “ ….. Bürgermeister Ewers schlägt vor, zunächst mit den Fraktionsvorsitzenden über den
Umgang mit den Namen der Straßen zu sprechen, die nach Personen benannt sind, die für antisemitisches Gedankengut bekannt sind (Stöcker-, Friedrich-Flick-, Graf Luckner-
und Hindenburgstraße). Dabei soll die weitere Vorgehensweise abgestimmt werden …“
Die FDP hat zur heutigen Kulturausschusssitzung einen Änderungsantrag vorgelegt:
– Die Hindenburgstraße soll in Straße des Grundgesetzes umbenennt werden
– die Hindenburgbrücke in Luba-Brücke nach Luba Budischewsla
Pingback: Siegen: Umbenennung von drei Straßen – Namensvorschläge | siwiarchiv.de
Der Bürgermeister informiert auf youtube: Aktuelles aus dem Rat der Stadt Siegen | Sitzung vom 22. März 2023:
– ab 00:55 Stellungnahme des Arbeitskreises „Aufarbeitung der historischen Hintergründe von Straßennamen“ zu Adolf-Wagner-Straße, Diemstraße, Porschestraße und Graf-Luckner-Straße
In der gestrigen Kulturausschusssitzung wurde folgendes Vorgehen festgelegt:
Sämtliche Anträge auf Umbenennung müssen :
1. in den Bezirksausschüssen, dann
2. im Kulturausschuss und schließlich
3. im Haupt- und Finanzausschuss (im Dezember)
behandelt werden.
Eine Beschleunigung des Verfahres mittels einer Ratsentscheidung – vgl. Luckner/Langner – fand keine Mehrheit.
So besteht genügend Zeit um über den Antrag der FDP („Straße des Grundgesetzes“/Luba-Brücke) und über die Bitte des TV Jahn, die Diemstraße nach Hermann Diem umzuwidmen, zu beraten.
Siegener Zeitung und Westfälische Rundschau berichten heute leider nur hinter der Bezahlschranke über die Kulturausschusssitzung. Dennoch wird auf Facebook kommentiert.
Am 29. März erschien in der Olper Westfalenpost folgender Artikel „Archivarstelle: Wegfall sorgt in Hagen für Kritik. Bei Treffen diskutieren die Fachleute aus der Region über Olper Reizthema“: „Der 74. Westfälische Archivtag fand jetzt in Hagen statt, zu dem 280 Fachleute, Archivare, Historiker und Kulturschaffende aus Westfalen und ganz Deutschland angereit warten. Dabei wurde im Plenum auch über die derzeitige Situation im Olper Stadtarchiv berichtet. …. Diese Aussicht auf die Verschlechterung der Archivsituation in der Kreisstadt stieß bei den Fachleuten in Hagen auf massive Kritik, sorgte zudem auch für allgemeines Kopfschütteln und völliges Unverständnis.
Der für das Olper Stadtarchiv zuständige Referent im Münsteraner Archivamt, Dr. Gunnar Teske,berichtete: „Durch das Beispiel der voraussichtlichen Streichung der Leiterstelle des Stadtarchivs Olpe wird die angespannte Personalsituation nochmal deutlich. Von verschiedenen Seiten wurde die NAchbesetzung, unter anderen in offenen Briefen gefordert. Allerdings sieht der olper Bürgermeister die Zukunft eher im Stadtmuseum. Die Leistungen des Archivs können so jedoch nicht ersetzt werden. …. Dr. Teske äußerte sich anerkennend darüber, dass die Kritik amm „Künftig-wegfallend“-Vermerk der Stadtarchivarstelle aus Kreisen der Olper Historiker und Heimatvereine gekommen war, die immerhin einen massiven Qualitätsverlust vor Augen hätten.“
In der heutigen Siegener Zeitung erschien der Artikel „Archivare nicht nur in der Region besorgt. Warum die Causa „Stadtarchiv“ nach wie vor auf den Tagesordnungen steht. Die Debatte geht weiter. Trotz der Erklärung des Bürgermeisters im Februar im Rat wird weiterhin öffentlich und gerade in der Fachszene über das Olper Stadtarchiv diskutiert“
Artikel-Funde zu Fissmer in der Siegener Zeitung:
– „Bürgermeister Fißmer“, 7. Mai 1919
– „Die Vorstände der der Aufsichts des Magistratsunterstellten Innungen von Bürgermeister Fissmer zu einer Besprechung eingeladen“, 26. Juli 1920
– „Das Preussische Staatsministerium hat genehmigt, dass dem Ersten Bürgermeister der Stadt Siegen, Fissmer, die Amtsbezeichnung „Oberbürgermeister“ beigelegt wird“, 22. März 1922
– „Vor der Oberbürgermeisterwahl“, 7. Februar 1931
– „Das preußische Staatsministerium hat die erfolgte Wiederwahl von Oberbürgermeister Fißmer auf fernere 12 Jahre bestätigt“, 2. April 1931
– „Oberbürgermeister Fißmer in den Vorstand des Preußischen Städtetages gewählt“, 9. Juli 1932
– „Der Reichsminister des Innern hat Oberürgermeister Fißmer in den Ausschuß für das gemeindliche Kreditwesen berufen“, 26. Mai 1934
– „Drei Jahre nationalsozialistische Kommunalpolitik. Oberbürgermeister … vor der Ortsgruppe Hain“, 28. März 1936
2 Artikel-Funde zu J[akob?] Henrich in der Siegener Zeitung:
– „Wiege – Ade!“, 20. März 1940
– „Wenn ein Siegerländer hochdeutsch redet“, 13. April 1940
Pingback: Bismarck, Bodelschwingh, sowie Luther – aber auch Ebert und Bäcker | siwiarchiv.de
April, April.
Gestern erschien in der Siegener Zeitung leider nur im Print – der Artikel „Straßennamen: Umbenennung könnte doch früher erfolgen“. Städtischerseits beabsichtigt man die Beratung in den Bezirksausschüssen durch Sondersitzungen vorzuziehen.
In der kommenden Wochen stehen die Straßenumbenennungen auf den Tagesordnungen des Bezirksausschgussen Siegen-Eiserfeld (24.4.) und Siegen-Mitte (27.4.)
Schon im Blogeintrag hatte ich auf die im Landesarchiv NRW in Duisburg vermutete Ordensakte hingewiesen und bin die Signatur zunächst schuldig geblieben. Da nun eine Straße in Siegen nach Edith Langner benannt werden soll, habe ich dort nachgefragt und erhielt dankenswerterweise folgende Angaben:
NW O (Ordensakte) Nr. 21262
Name: Langner
Vorname: Edith
Geburtsdatum: 23.1.1913
Amt / Beruf: Hausfrau und Landtagsmitglied
Laufzeit: 19.12.1972-08.10.1973
Umfang: 36 Seiten
NW 1110 Nr. 2399
Aktenart: Entnazifizierungsakte
Name: Langner
Vorname: Edith
Geburtsdatum: 23.01.1913
Amt / Beruf: Kindergaertnerin
Pingback: Edith Langner (1913 – 1986) – eine Kandidatin für eine Strassenbenennung in Siegen | siwiarchiv.de
s. a. Siegener Zeitung, 23. Juli 1973, Leserbrief: „Eiserfeld sträubte sich gegen Mudersbacher Kinder“ [Stichwort: Gymnasium auf der Morgenröte]:
“ … 2. Warum stellen die SPD-Politiker Maurer, Sonneborn und Forster es fast als ihr Verdienst heraus, wenn endlich der Kultusminister Girgensohn sie zum 18. Juli 1973 nach Düsseldorf berufen hat, um ihnen die Aufnahme Brachbacher und Mudersbacher Schüler nahezulegen? Die Düsseldorfer Entscheidung war Eingeweihten schon längere Zeit vorher bekannt. Der Bundestagsabgeordnete Prinz Wittgenstein hatte von Minister Girgensohn eine klare Zusage für die Aufnahme der Kinder in Eiserfeld erhalten. Vorher hatte das Kultusministerium in Mainz, der Landtagsabgeordnete des Kreises Altenkirchen Paul Wingendorf, die Siegener Landtagsabgeordnete Edith Langner (mit ihren Fraktionskollegen Heinrich Köppler und Alfred Pürsten) lange genug und mit dem nötigen Nachdruck Eiserfeld und Düsseldorf auf die Unsinnigkeit und Ungerechtigkeit von Stadtdirektor Sonneborns hingewiesen. … Hat doch gerade Frau Langner durch ihre Erkundungen „vor Ort“ in Eiserfeld Lösungsmöglichkeiten herausgefunden und nach Düsseldorf weitergegeben. ….“
s. a. Ludger Gruber: Die CDU-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen, 1946-1980. Eine parlamentshistorische Untersuchung, Düsseldorf 1998, Link: https://digitaler-lesesaal.kas.de/download_file/force/294
Pingback: Monographienkrise: Texte und Untersuchungen zur Archivpflege – Archivalia
Pingback: 500 Jahre Schloss Junkernhees – Jahresprogramm 2023 | siwiarchiv.de
Guten Tag,
kann der ORIGINAL-Stummfilm (90 min. Dauer) über die Schacholympiade in Siegen 1970 (Nr. 4.1.5 / 164 im Archiv des Kreises Siegen-Wittgenstein) irgenwo angesehen werden ?
Danke und mit freundlichen Grüßen,
Arnd Hochhuth
Nur im Nutzerraum des Kreisarchivs Siegen-Wittgenstein kann der Film eingesehen werden.
Gehörte Bode zum Umfeld von G.C. Kichtenberg. Ein Hinweis auf die Weggefährten Lichtenbergs auf der Seite der Lichtenberg-Gesellschaft lässt die Vermutung zu:
“ …. Im einzelnen können hier genannt werden (* = keine Korrespondenz überliefert):
die Teilnehmer an der herzlich-lärmenden Göttinger Runde, die sich im Haus seines Freundes und Vermieters Johann Christian Dieterich trafen und die außer diesem selbst v. a. aus Hofmeistern [z. B. Heinrich Christian Boie (1744 – 1806), Ferdinand August Bode[n](*) (1733? – 1812) und Johann Friedrich Gervinus(*) (1744? – 1826)] nebst ihren Zöglingen (englischen und anderen wohlhabenden Studenten) sowie dem Universitäts-Zeichenmeister Joel Paul Kaltenhofer (1716? – 1777) bestand; ….“
Die Vermutung wird erhärtet durch die Verbindung Lichtenbergs zu Christian Heinrich zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg.
s. a. Lichtenberg Briefwechsel Bd. 5: Register: Personen- und Sachregister, München 2004, S. 860.
Aus der Einleitung von Lothar Irles „Heiteres aus dem Siegerland“, 5. Auflage, Siegen 1967, S. 11-13:
“ …. Herbert Schöffler schrieb: „Humor ist bluts- und raumgebunden wie Sprache und Dialekt.“ ….. Es ist aber ein Zeichen für noch vorhandenen Gemeinschaftssinn, wie er sich auch in andersartigen Volksgut darstellt. Wo noch das Brauchtum eines Dorfes lebt, da stellt sich jeder außerhalb der Gemeinschaft, der sich nicht an der Ausübung der Bräuche beteiligt. Wer in einem Trachtendorf städtische Modekleidung trägt, begibt sich automatisch geistig aus dem Kreis der Dorfbewohner. Wer als in dem Dorf Geborener die Mundart des Ortes nicht mehr spricht, richtet eine kalte Wand zwischen sich und der Heimat auf. Die Gemeinschaft verlangt eine Anpassung an ihre Normen. Wer auch nur gering von diesen Normen abweicht, fällt dem Spott oder der Verachtung der anderen anheim. …. Zum Volkstum findet man keinen Weg, wenn man den Derbheiten ausweichen will, die in einer verkrampften Gesellschaftsordnung voll Unechtheit gesellschaftsunfähig geworden sind, während sie im unverbildeten Volke noch leben. Aus dieser Divergenz zwischen dem Drastischen derer, die sich bewußt gegen Überfeinerung wenden, und derer, die sich unbewußt solcher Begriffe bedienen, die nicht mehr allgemein gebräuchlich sind, auf der einen und anderer, die sich etepetete und modisch benehmen, auf der anderen Seite entstehtmanche Situation, die vom Volke belacht wird und in seinem Anekdotenschatz haften bleibt. …..“
– Landesarchiv Berlin A Pr.Br.Rep. 042-01 (Preußische Bau- und Finanzdirektion) Nr. 1733, Personalakte des Herrn Landrat im Kreis Wittgenstein Karl von Rumohr (* 27.12.1900, † 08.08.1967), 1934, Enthält nur: Übertragung des Landratsamts im Kreis Wittgenstein zum 01. April 1934
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe mit viel Freude und Lernerfolg die beiden eLearning Kurse „Bestandspflege“ und „Notfallversorgung“ absolviert. Durch beide Kurse habe ich einen tollen Einblick erhalten und viel neues gelernt. Vielen Dank für das tolle Angebot!
Gibt es eine Möglichkeit ein Teilnehmer-Zertifikat oder ähnliches zu erhalten? Oder können Sie mich an die richtige Stelle für mein Anliegen weiterleiten?
Vielen Dank im Voraus. Ich freue mich von ihnen zu hören und wünsche noch eine angenehme Restwoche!
Mit freundlichen Grüßen
Franziska Rasmussen
Pingback: Thomas Wolf: Lothar Irle (1905 – 1974). | siwiarchiv.de
Pingback: Thomas Wolf: Lothar Irle (1905 – 1974). | siwiarchiv.de
Pingback: Thomas Wolf: Lothar Irle (1905 – 1974). | siwiarchiv.de
Pingback: Video „Westfalens Unterwelten“ (1) | siwiarchiv.de
Pingback: Linktipp: „1848/49 in Westfalen und Lippe. Einblicke in die revolutionshistorische Peripherie“ | siwiarchiv.de
Wolfgang Meyer „Der Weg zu den „Grauen Wölfen“. Friseur und U-Boot-Held Willy Meyer“, {Weyhe/Bremen] 2. Auflage 2022, weist auf die handgeschriebne 14-seitige Broschüre „Gestalten, die durchs Lager schlichen. Heitere Satiren“ von Lothar Irle hin. Sie entstand 1947 in Fallingbostel und enthält 8 Gedichten mit Beschreibungen des Lagerlebens.
…
Pingback: Video „Contergan – Das Leben mit einer Betroffenen“ | siwiarchiv.de
Rita Morgenschweis war eine Arbeitskollegin von mir. Sie arbeitete nicht im Straßenbauamt der Stadt Siegen sondern im Landesstraßenbauamt von Straßen NRW an der Koblenzer Straße 76. Das Gebäude wurde aufgrund vom Schimmelbefall im Jahre 2012 geschlossen.
Danke für die Richtigstellung!
Pingback: Thomas Wolf: Lothar Irle (1905 – 1974). | siwiarchiv.de
Pingback: Video „Westfalens Unterwelten“ (2) | siwiarchiv.de
Pingback: Video „Westfalens Unterwelten“ (2) | siwiarchiv.de
Zu Willi Busch s. a.:
– Kreppke, Hans Joachim: „Eine solche Fülle an begnadeten Künstlern . . . “
Bochum und die Brüder Busch – Eine Spurensuche“, in: Bochumer Zeitpunkte. Beiträge zur Stadtgeschichte, Heimatkunde und Denkmalpflege, Nr. 26 (1993), S. 25 – 49, Link: https://www.kortumgesellschaft.de/tl_files/kortumgesellschaft/content/download-ocr/zeitpunkte/Zeitpunkte-26-2011OCR.pdf
– Bundesarchiv Berlin,
R 9361-V/ (Sammlung Berlin Document Center (BDC): Personenbezogene Unterlagen der Reichskulturkammer (RKK) ) 47651
R 9361-V/ (Sammlung Berlin Document Center (BDC): Personenbezogene Unterlagen der Reichskulturkammer (RKK) ) 140350
– Staatsbibliothek zu Berlin. Handschriftenabteilung ; Nachl. Gerhart Hauptmann ; Signatur: GH Br NL (ehem. AdK) B 1798, Telegramm von Willi Busch an Gerhart Hauptmann, 14.11.1914
Pingback: Strassenumbenennungen in den vier Bezirksausschüssen der Stadt Siegen | siwiarchiv.de
Pingback: Strassenumbenennungen in den vier Bezirksausschüssen der Stadt Siegen | siwiarchiv.de
Pingback: Strassenumbenennungen in den vier Bezirksausschüssen der Stadt Siegen | siwiarchiv.de
Pingback: Siegener Stadtrat trifft Entscheidung zu Strassenumbenennungen | siwiarchiv.de
Pingback: Straßennamen: „Umbenennungswellen“ der letzten Jahrzehnte im Kreis Siegen-Wittgenstein? | siwiarchiv.de
Pingback: Wem gehört die Geschichte? | siwiarchiv.de
1) Link zum Facebook-Post (FB) der Siegener Zeitung:
2) Link zum Artikel in der Westfälischen Rundschau (WR): https://www.wp.de/staedte/siegerland/strassen-in-siegen-werden-umbenannt-das-sind-die-neuen-namen-id238217025.html
3) Link zum FB-Eintrag der WR:
Heute erschien in der Siegener Zeitung der Kommentar „Die Natur als Namensgeber?“. Neben Namen aus Flora und Fauna wird dort auch die Durchnummerierung von Straßen diskutiert.
Übrigens: Edith Langner war nicht die erste Frau im Siegener Stadtrat. Diese Ehre gebührt Hedwig Heinzerling.
Wenn man über ein hybrides Projekt bloggt, ist ein Link auf den digitalen Teil nie ganz verkehrt: https://www.zeitspuren-siwi.de ;)
Stimmt! Danke fürs Posten.
s. a.
Aus dem Print-Artikel geht hervor, dass der Bezirksausschuss einstimmig die Umbenennung beschlossen hat.
Klaus Dietermann, der Gründer und langjährige Leiter des Aktiven Museums Südwestfalen, besuchte 1984 Hermann Giesler in Düsseldorf (die Westf. berichtete ausführlich). Dietermann brachte als Geschenk ein Siegerländer Schwarzbrot mit. Er gab sich nicht zu erkennen. Giesler habe ihm gesagt, dass er nach wie vor Nationalsozialist sei. H. Giesler hat ein umfangreiches Buch geschrieben: „Der andere Hitler“, das K. Dietermann besaß.
s. zu Henrich: Schiemer, Hansgeorg: 40 Jahre CDU für Siegerland und Wittgenstein (Schriftenreihe des CDU-Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein e.V. Nr.6), Siegen 1986, S. 48 [Vorsitz der CDU-Ortsgruppe Krombach], 108 [Bei der Reaktivierung des Evangelischen Arbeitskreises der CDU Beisitzer]
Pingback: Vor 975 Jahren: Der Hileweg als Grenzbeschreibung dokumentiert (28. April 1048) | siwiarchiv.de
Westfälische Rundschau:
Siegener Zeitung:
Westfalenpost:
Siegener Zeitung:
Ein optischer Eindruck von der Veranstaltung:

Pingback: „Haus der Arbeit – Haus der Bildung“ | siwiarchiv.de
s. zu Henrich:
1) Arbeitsgemeinschaft Eiserner Vereine e.V. (Hrsg.): Festschrift 725 Jahre Eisern, Siegen 2014, S. 37-38:
“ ….. Anlässlich seines 90. Geburtstages bekommt Jakob Henrich, der „Bergfrieder“, die Ehrenbürgerrechte der Gemeinde Eisern verliehen. Er hat in seinen Erinnerungen die soziale Situation in Eisern reflektiert und ist als Publizist für die christlich-soziale Bewegung tätig.
Ende Februar 1957 wird ihm zu seinem 95 Geburtstag das Bundesverdienstkreuz 1 Klasse verliehen ….“
2) Lutz Hagestedt (Hrsg.): Deutsches Literatur-Lexikon. Das 20. Jahrhundert. Band 16: Heinemann – Henz, Berlin 2011, Sp. 537: mehrmals Abgeordneter der Provinzialsynode
Kurzstatement von Dr. Jens Aspelmier auf Radio Siegen zum Projekt:
Audio
Der Vortrag von Dieter Pfau über „Zeitspuren in Siegerland und Wittgenstein im preußischen 19. Jahrhundert“, eine Gemeinschaftsveranstaltung des Hilchenbacher Geschichtsvereins e.V. und der Volkshochschule des Kreises Siegen-Wittgenstein, findet nicht am 10. Mai 2023, sondern am Donnerstag, dem 11. Mai 2023, 18.30 Uhr, im Ratssaal des Rathauses Hilchenach statt.
Danke für die Korrektur! Eintrag ist entsprechend geändert.
Pingback: Vor 34 Jahren: Vater der Berliner Schnellstraßen gestorben | siwiarchiv.de
Da fehlt mir eindeutig die Frage, was der Kerl denn im NS so getrieben hat.
Mir auch noch. Aber auf die für die Klärung der Frage einschlägigen Unterlagen im Bundesarchiv und im Landesarchiv Berlin wurde hingewiesen.
Wie bekomme ich die Broschüre Dokumentation historischer Grenzsteine?
Ich bin Mitglied im LBC Banfetal e,.V. mit Skihütte auf dem Sohl. Die Hütte liegt direkt an der Grenze zwischen Hessen und NRW.. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich noch einige alte Grenzsteine.
Für ein Antwort bedankt sich
Gerda Hackler-Georg
Untere Mühlhelle 16
57334 Bad Laasphe
Heimatverein Holzhausen e.V.
heimatvereinholzhausen.de
Kapellenweg 4 · 57299 Burbach · ~85,5 km
02736 292119
Wenn auch etwas spät: Danke!
Als PDF-Datei wird hier nun eine überarbeitete Fassung dieses Eintrages vorgelegt.
Zu ergänzen ist noch folgender Quellenfund:
Archiv des Ev. Kirchenkreises Siegen Nr. 902:
Unterstützung und Beschäftigung von Ostpfarrern und deren Familien, 1946-1952
In der Ordensakte im Landesarchiv NRW, Abt. Rheinland, in Duisburg (Signatur: NW O 2508) findet sich eine ausführliche Begründung für die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Jakob Henrich. Mit Datum vom 8. Februar 1957 sandte der Siegener Oberkreisdirektor Erich Moning diese an die Bezirksregierung in Arnsberg:
„Herr Henrich wird für die Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz (Ansteckkreuz) vorgeschlagen.
Herr Henrich war von 1879 bisa 1880 zunächst als Hauslehrer am Preuß. Forsthaus Kalteiche (Kr. Siegen) tätig, bis er vom 1.4.1880 bis 31.3. 1883 das Lehrerseminar in Hilchenbach besuchte. Am 1.4.1883 trat Herr Henrich seine erste Lehrerstellein Weidenau an, am 13.1.1888 erfolgte seine endgültige Anstellung. Ab dem 1.5.1889 wurde er an die Volksschule in Krombach versetzt, wo er bis zur Erreichung der Altersgrenze im Jahre 1927 als Lehrer, seit 1906 als Hauptlehrer wirkte.
Herr Henrich war in seiner aktiven Zeit nicht nur ein vorbildlicher Pädagoge, der stets engsten Konnex mit der Jugend hatte, den er sich übrigens bis zum heutigen Tage erhalten hat, sondern er war neben seinem Hauptamt auch ehrenamtlich tätig als Gemeindevertreter und als Mitglied des Kreistages des Landkreises Siegen. Auf kommunalen Sektortrat seine besondere Aktivität dadurch hervor, daß er der Gründer der Krombacher Ortsfeuerwehr ist, die ihn für die Treue zur Sache und die Verdienste, die er sich um diese Feuerwehr erworben hat, zum Ehrenmitglied ernannte. In gleicher Weise führte ihn seine Verantwortungsfreude in die Kreis- und Provinzialsynode der evang. Kirche, wo er viele Jahre als gewähltes Mitglied mitarbeitete. Auf derselben Ebene liegen seine Bemühungen um die Förderung des kirchlichen Vereinslebens und der Jugendarbeit auf kirchlicher Basis. Wie stark er mit diesen Dingen verbunden war, zeigt die Tatsache, daß er ein persönlicher Freund des Hofpredigers Stöcker war, der bei seinen Aufenthalten im Siegerland stets bei Herrn Henrich Gastfreundschaft genoß. Aus dieser geistigen Grundhaltung resultiert auch die Mitgliedschaft und aktive Mitwirkung im ehemaligen evangelischen Volksdienst und an der Zeitung dieser politischen Richtung, nämlich der Wochenzeitung „Das Volk“, die in Siegen herausgegeben wurde. Trotz dieser vielseitigen Beanspruchung hat sich Herr Henrich seit Jahrzehnten auch schriftstellerisch mit bestem Erfolg als Heimatdichterund auf heimatkundlichem Gebiet betätigt. Durch seine Verbundenheit mit der Jugend, mit dem kirchlichen Leben, mit den politischen Anliegen seines Heimatbezirkes, mit den kulturellen Belangen der Siegerländer Bevölkerung hat sich Herr Henrich tief im Bewußtsein der Siegerländer Bevölkerung verankert. Als Beweis dafür mag gelten, daß er im Volksmund als „Bergfrieder“ lebt und sein Ruf bereits beginnt, Legende zu werden.
Nach 1945 hat Herr Henrich trotz des hohen Alters aus der Erkenntnis, daß alle Kräfte für einen staatlichen, geistigen und sittlichen Wiederaufbau wieder eingesetzt werden müssen, die Konsequenz gezogen, indem er die Christl.-Demokratische Union im Siegerland mitbegründete und aufbauen half. Er ist nicht nur bis zum heutigen Tage der Vorsitzende der Ortsgruppe Krombach der CDU, die er tätig leitet, sondern der älteste Ortsgruppenvorsitzende der CDU in der Bundesrepublik Deutschland überhaupt. Er hat durch rastlosen Einsatz auf der politischen Ebene über den örtlichen Bereich hinaus ein nachahmenswertes Beispiel gegeben und so einen beachtlichen Beitrag zum demokratischen Aufbau der Heimat geleistet. Herr Henrich ist auch nach wie vorals politischer Schriftsteller tätig, wie seine in der Siegener Zeitung ständig veröffentlichten Beiträge dartun, wobei er seine Aufmerksamkeit der grundsätzlichen politischen Linie widmet und seine Auffassungen über das politische Geschehen in einer volksnahen, vielfach heimatkundlich gebundenen Weise an die Leser heranträgt.
Durch seine Arbeit auf heimatkundlichem Gebiet, der nach wie vor seine unermüdliche Schaffenskraft gilt, leistet er in gleicher Weise einen wertvollen Beitrag zu den kulturellen Aufgaben des Siegerlandes. Seine beiden nach 1945 erschienenen Bücher („Bergfrieders Erinnerungen“ /Wilhelm Schneider-Verlag in Siegen und „Stöckerzeit – Steinzeit im Littfetal“/ Vorländer-Velag in Siegen) legen Zeugnis ab von seiner ungebrochenen Schaffenskraft. Dazu gehört auch das aktive Mitwirken im Siegerländer Heimatverein. Daß das Wirken im Sinne des Hofpredigers Stöcker Herrn Henrich ein echtes Anliegen hinsichtlich der geistig sittlichen Grundlag unserer jungen Demokratie ist, beweist die Tatsache, daß er nach wie vor der Vorsitzende der Stöckergilde im Siegerland ist.
Herr Henrich ist mit fast 95 Jahren noch von einer erstaunlichen körperlichen Frische und geistigen Lebendigkeit.“
Am 27. Februar 1957 erfolgte daraufhin die Verleihung durch den 1. Kreisdeputierten Joseph Büttner.
Arbeite an Lebenslauf von P. Alfred Delp SJ. Karl Neuhaus hatte ihn gefoltert. Beim Prozess gegen K.N. 1953 in Siegen wurde P. Delp Verletzung des Beichtgeheimnisses während der Aussageerpressung verleumderisch nachgesagt.
Wer weiß davon mehr. Herrn Rudolf Heider, der wohl ein Foto von K.N.hat, konnte ich nicht finden. Ebenso Hubertus Picard.
Peter Kern
67117 Limburgerhof
Pingback: Litaraturhinweis: Dieter Bald: „Frieda Claudy – Poesie aus Wittgenstein. | siwiarchiv.de
Zur Diskussion des Berichtes in der Siegener Zeitung über die Sitzung des Bezirksausschusses Ost bezüglich der Umbenennung der Lothar-Irle-Str.:
Der Bezirkausschuss Ost beschloss in der Sitzung die Umbenennung der Lothar-Irle-Str. einstimmig bei einer Enthaltung durch die CDU. (Quelle: Beschluss)
Westfälische Rundschau zur Sitzung des Bezirksausschusses Ost:
https://www.wp.de/staedte/siegerland/strassenumbenennung-siegen-kein-wort-mehr-ueber-lothar-irle-id238385023.html
… und danke für freundlichen Hinweis (S/W bleibt nicht unerwähnt, schließlich gab es zwei Verfahren in SI)
Gerne! Neben dem Berleburger Prozess zur Deportation der Sinti und Roma meinten Sie sicherlich auch den Prozess gegen Ernst August König, der hier auf siwiarchiv dreimal behandelt wurde:
– https://www.siwiarchiv.de/heute-vor-28-jahren-urteil-im-prozess-gegen-ernst-august-koenig/
– https://www.siwiarchiv.de/vortrag-klemens-mehrer-siegen-blick-in-ein-duesteres-kapitel-erinnerungen-an-den-1991-beendeten-ns-prozess-gegen-ss-rottenfuehrer-ernst-august-koenig-in-siegen/
– https://www.siwiarchiv.de/online-vortrag-75-jahre-justiz-nrw-erinnerungen-an-den-auschwitz-prozess-am-landgericht-siegen-1986-bis-1991/
Der Film wird jetzt auch auf einer Schachnachrichtenseite vorgestellt: https://de.chessbase.com/post/dokumentarfilm-zur-schacholympiade-siegen-1970
Pingback: Bundesarchiv digitalisiert alle Dokumente zur 1848/49er Revolution – Archivalia
Pingback: Eröffnung des Gerhard-Stötzel-Platzes | siwiarchiv.de
Pingback: Eröffnung des Gerhard-Stötzel-Platzes | siwiarchiv.de
Die „Verteidigung“ Stoeckers durch Ernst Bach findet sich bereits in desssen Schrift „Adolf Stöcker – ein Prophet und Vorkämpfer des Christlich-sozialen Volkdienstes“, Siegen 1931.
Pingback: Lesefunde – Ingram Braun
Pingback: Lesefunde – Ingram Braun
Pingback: Lesefunde – Ingram Braun
Pingback: Lesefunde – Ingram Braun
Pingback: Lesefunde – Ingram Braun
Pingback: Lesefunde – Ingram Braun
Pingback: Lesefunde – Ingram Braun
Am 30.5.2023 ist es so weit. Der Dorfplatz wird fortan den Namen Gerhard-Stötzel-Platz tragen. Ebenso wird dort eine Gedenktafel ihm zu Ehren verankert. Schön, dass die Anregung der Bürger und Bürgerinnen so umgesetzt wurde von der Stadt Netphen. :)
Heute ein Artikel in der Westfalenpost zur Eröffnung des Platzes: https://www.wp.de/staedte/siegerland/ein-grissenbacher-kaempft-fuer-arbeiter-und-gegen-bismarck-id238546401.html
Video und Foto zum Aufbau:
Link zur Pressemitteilung der Stadt Netphen über die Eröffnung des Platzes vom 2.6.2023: https://www.netphen.de/index.php?object=tx,3054.5&ModID=7&FID=3054.7682.1
Pingback: Beschilderung der „Alfred-Fissmer-Anlage“ in Siegen | siwiarchiv.de
Fotos vom Aufbau:

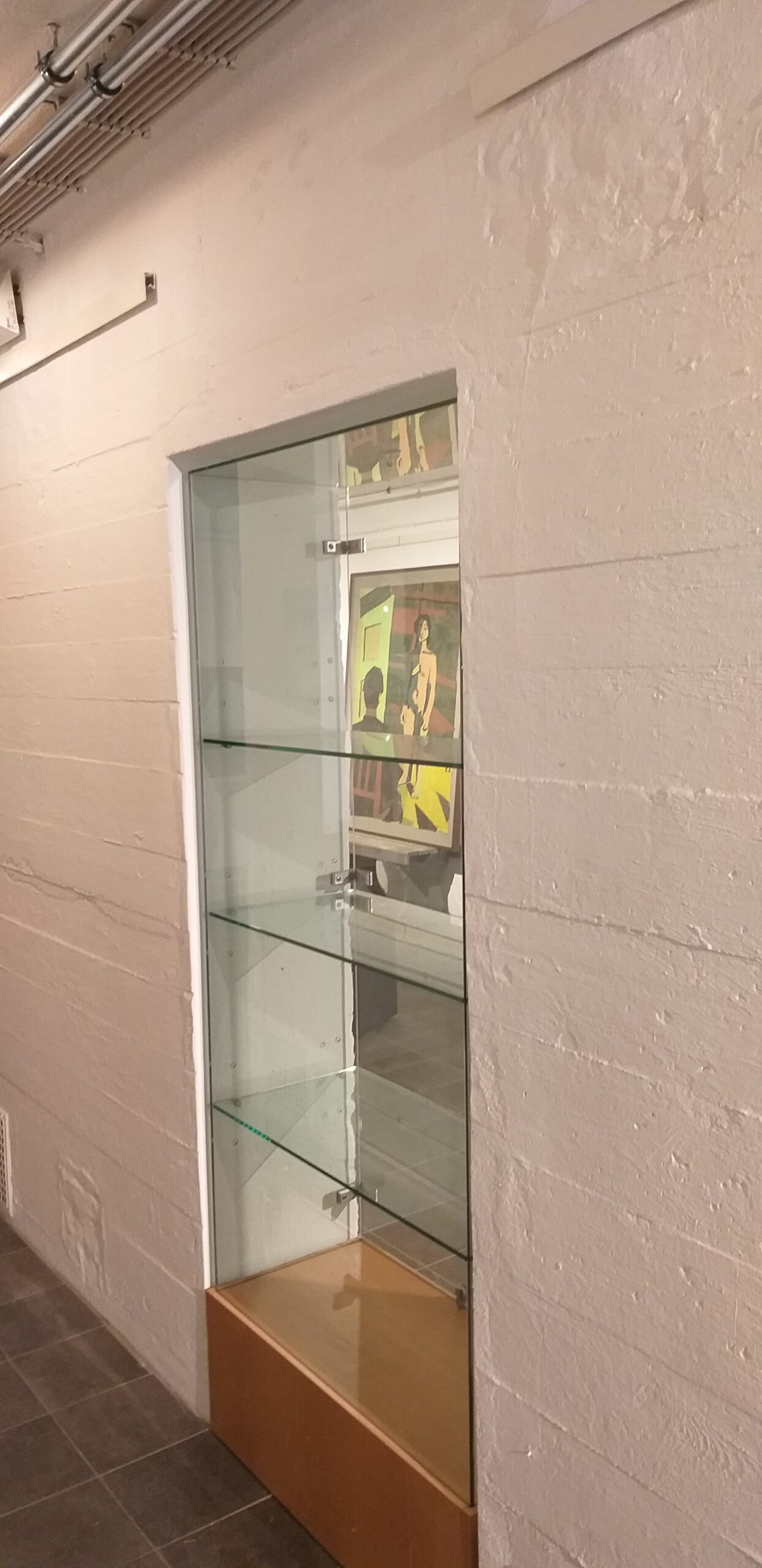
Pingback: Ernst Bach (1902-1965) – ein Kämpfer für das freie Wort? | siwiarchiv.de
Link zu einem weiteren Video zum Ausstellungsaufbau (FB-Account des Kreises Siegen-Wittgenstein)
Pingback: Umleitung: Zecken, die Kuh ist gemelkt, Kunst, Anastasia, Lamm Gottes, Ernst Bach, Sommer am U, Mack und Millionär*innen in Hagen, RWE im HSK und eine Margerite. – zoom
Pingback: Literatur zur 1848er-Revolution in Westfalen-Lippe | siwiarchiv.de
Pingback: Literaturhinweis: Wolfgang Popp: GERMANIST – PAZIFIST – SCHWUL. Mein Leben (2023) | siwiarchiv.de
Hallo, wir suchen das Buch „Hexenwahn im Wildenburger Land“.Leider blieb die Suche bis jetzt erfolglos. Können Sie uns einen Tipp geben? Vielen Dank LG C.Eichert
Bei einer Suche auf ebay fand sich heute ein Exemplar eines Sonderdruckes des gesuchten Titels.
Vielen Dank für die Veröffentlichung der Datei und die damit verbundene
historische Betrachtung der Baracke. Der Vollständigkeit halben
will ich zuerst auf zwei Artikel hinweisen die in der Siegener Zeitung
erschienen sind und sich mit der Baracke beschäftigen:
SZ vom 24.12.2022 „Wellblechbaracke kommt ins Museum“
SZ vom 22.5.2023 „Wellblech für die Ewigkeit“
In Bezug auf den Artikel vom 24.12.2022 ist zu berichtigen, das es sich nicht
um einen Neunkirchner Bürger, sondern um eine historische interessierte
Bürgerin handelte, der die Baracke im Sommer 2021 auffiel und welche sich dann gemeinsam mit der VVN-BdA an das Kreisarchiv SiWi wandte, von wo aus dann Kontakt zum LWL in Münster hergestellt wurde.
Der historische Blickwinkel, der zur Entdeckung führte war, kein auf die Architektur gerichteter, sondern darauf gerichtet, wer in der Zeit des Faschismus in solchen Baracken untergebracht war.
Leider ist in keinem der Artikel und der PDF Datei davon die Rede.
Es ist zu vermuten, dass in dieser Baracke Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter untergebracht waren. Eindeutig belegt sind für den Raum Neunkirchen mehrere Lager für Zwangsarbeiter und auch das diese in den Neunkirchner Betrieben und Gruben Zwangsarbeit leisten mussten.
Bisher fehlt ein eindeutiger Beweis für diese Nutzung der Baracke, widerlegt ist die Unterbringung von Zwangsarbeitern in ihr aber auch noch nicht!
Hoffentlich fließt dieser Aspekt zur Geschichte der Baracke in die weitere Forschung ein und findet im Museum Lindlar bei einer Gesamtdarstellung den entsprechenden Raum.
Im Dokument des Arolsen Archives ist unter dem Stichwort „LK Siegen“ auf Seite 6 für Neunkirchen dokumentiert, dass sich auf dem Werksgelände der Firma Capito ein Lager für Kriegsgefangene während des zweiten Weltkrieges befunden hat.
Es könnte sich dabei um diese Baracke gehandelt haben.
Herr Kamp vom Museum Lindlar rief im Artikel der Siegener Zeitung dazu auf, dass sich Personen, die Näheres zu der Geschichte der Baracke wissen, bei ihm melden sollten.
Vielleicht finden sich noch Zeitzeugen oder jemand erinnert sich an Berichte darüber.
Unter dem Stichwort „LK Siegen“ für Landkreis Siegen finden sich Hinweise zu Kriegsgefangenen aus allen Orten des Kreises.
Pingback: Vortrag: Christian Brachthäuser (Siegen): „Barocke Gartenkunst mit antikem Dekor: | siwiarchiv.de
Heute findet sich in der Print-Ausgabe der Siegener Zeitung ein Bericht über die Stellenausschreibung. Tenor ist, dass für die im kommenden Jahr stattfindende 800-Jahrfeier der Stadt keine Einscnränkungen erwartet werden, da die Stadt zur Unterstützung des Stadtarchivs, das eine einbändige Stadtgeschichte und eine Vortragsreihe zu verantworten hat, eine halbe Historikerstelle eingerichtet hat.
Heute findet sich auch in der Westfälischen Rundschau ein Artikel zum Wechsel des Siegener Stadtarchivaren: https://www.wp.de/staedte/siegerland/nur-drei-jahre-im-amt-stadtarchivar-verlaesst-siegen-id238731999.html
Auf dem Rheinischen Archivtag informierte der Leiter des LVR-Archiv- und Fortbildungszentrums, Dr. Mark Steinert, heute die Kolleg:innen über den aktuellen Sachstand:
“ …. Seit Verabschiedung der EU-DSGVO ist bis heute nichts passiert, um das Archivgesetz NRW zu novellieren, sodass es mit der DSGVO vereinbar ist. Im Oktober soll eine Arbeitsgruppe zusammenkommen, die die Weiterentwicklung des Archivgesetzes in Einklang mit dem Kulturgesetzbuch besprechen soll. Konkrete Lösungen gibt es noch nicht und in näherer Zukunft wird wahrscheinlich auch weiter nichts passieren, sodass die Integration der DSGVO in das Archivgesetz weiter auf sich warten lassen wird. Steinert bedauert sehr, dass er keine positiven Nachrichten bringen kann. Die Probleme für das Archivwesens in NRW sind massiv und dringend anzugehen.“, Link: https://lvrafz.hypotheses.org/7660
Eine Abbildung Brossoks findet sich in Müller, Otto (Hg.) 100 Jahre Landwirtschaftlicher Kreisverein Wittgenstein e. V, Eine Denkschrift im Auftrag des Vereins Laasphe 1932, Anhang S. 3.
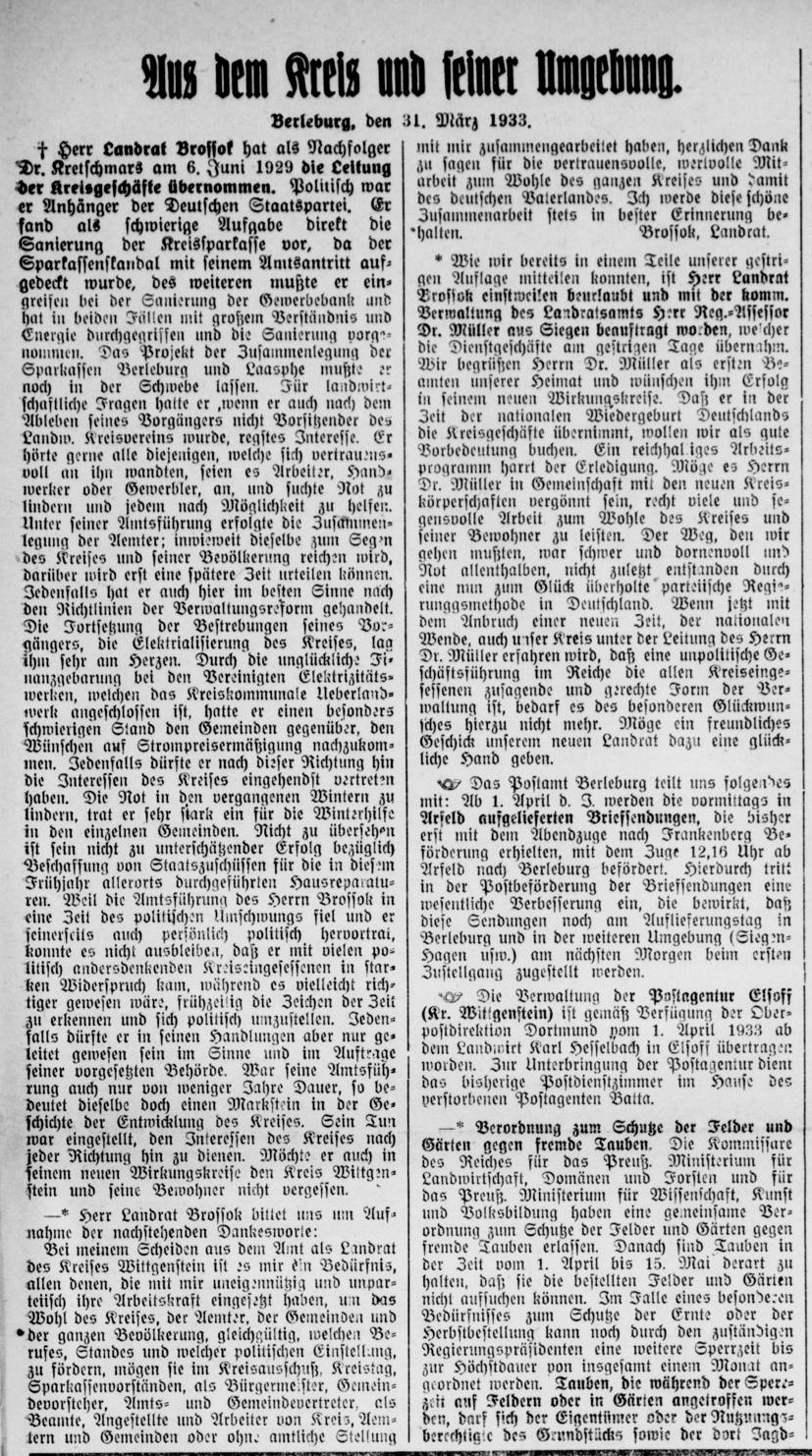
S.a. Lilla, Joachim: Leitende Verwaltungsbeamte und Funktionsträger in Westfalen und Lippe (1918-1945/46), Münster 2004, S. 128, Link: https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/finde/langDatensatz.php?urlID=1174&url_tabelle=tab_person
Folgende Archivalien sollten zu Brossok eingesehen werden:
1) Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin
– I. HA Rep. 77, Nr. 7494 [Ministerium des Innern] Personendossiers und Materialsammlung, v. a. zu NS-Mitgliedern und -Amtsträgern sowie NS-Gegnern, Buchstabe Bo – Bu, (1930), 1933-1934
Enthält v. a.:
– Strafrechtliche Ermittlungen, Entlassungen, Personalangelegenheiten, positive und negative Personenbeurteilungen, Stellenbesetzungen, Stellengesuche, Unterstützungsgesuche, Versetzungen, Weiterleitung von Informationen,
– I. HA Rep. 125, Nr. 775, [ Ober-Examinationskommission bzw. Prüfungskommission für höhere Verwaltungsbeamte], Einzelne Prüfungen: Brossok, Eberhard, Regierungsreferendar, Breslau, 1920
2) Bundesarchiv
– Berlin: R 1501/128032 [Reichsministerium des Innern, Personalkarten von höheren Beamten]
– Bayreuth: OSTDOK 10/23, Eberhard Brossok, Dezernent: Die Verwaltungstätigkeit bei der Regierung Königsberg/Pr. von Juni 1936 bis Ende Jan. 1945 (betr. Volks-, Mittel-, Berufsschulen, Kirchensachen, Volksbüchereien), 1959
3) Archiv der Evangelischen Kirche im Rheinland
– 6HA 005 (Studiendirektor Hellmut Lauffs), 46, Entwicklung eines Schulgesetzes in NRW, 1950-1951 enthält u.a.: Zusammenfassung des Referats von Landesverwaltungsgerichtsrat Brossok über den Schulgesetzentwurf
4) Staatsbibliothek zu Berlin. Handschriftenabteilung
– Archiv des Verlages J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) ; Signatur: Nachl. 488, A 0520,2, Blatt 239-242, 12.06.1951-07.09.1951
– Archiv des Verlages J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) ; Signatur: Nachl. 488, A 0516,2, Blatt 288-295, 18.07.1950-08.09.1950
Schließlich sei auf die Auswertung der Medien hingewiesen – s. bspw. Wittgensteiner Kreisblatt, 31. März 1933:
Nachtrag zu Archivalien:
Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland
– NW 1039-B (SBE Hauptausschuss Regierungsbezirk Münster), Nr. 759, Entnazifizierung Eberhard Brossok , geb. 25.08.1892 (Beamter)
Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein
– 1.04. (Kreistag Wittgenstein, Protokolle, 1948-1949), Nr. 3, fol 103, 124
Zwei weitere Artikel Landrat Brossok im Wittgensteiner Kreisblatt fanden sich bei der Suche in den Zeitungsfindmitteln des Wittgensteiner Heimatvereins :
07.06.1929 Neuer Landrat Brossok
11.04.1933 Landrat Brossok im einstweiligen Ruhestand
Pingback: Ausstellung „Days beyond time“ eröffnet | siwiarchiv.de
Link zur Online-Ausgabe
Pingback: Siegelsammlung: Hinweise gesucht – Archivalia
Link zur Online-Version
Pingback: siwiarchiv-Sommerrätsel 2023/1 | siwiarchiv.de
Das Plakat zu den
Fotografien zum Archivfinder des Kreises Siegen Wittgenstein
möchte ich vorschlagen
Wie sind Sie denn darauf gekommen? Es ist richtig!
Februar 1936 – Mitwirkung – Erstellung der Siegerland-spezifischen Ausstellungsteile – an der Ausstellung „Rasse. Sippe.Siedlung“ des NSDAP-Gauschulungsamtes Westfalen Süd, Quelle:
Siegener ZeitungNational-Zeitung, 3.2.1936, https://zeitpunkt.nrw/ulbms/periodical/zoom/15716581Korrektur der Quellenangabe: richtig ist
National Zeitung, Siegerländer Ausgabe.
leider liegt die Siegener Zeitung bis dahin noch nicht digital vor und ist damit auch nicht über zeitpunkt.nrw zugänglich.
Danke für die Korrektur! Nennt man im Fußball, glaube ich, Automatismus …..
Pingback: Hermann Böttger (1884 – 1957) – Gymnasiallehrer, Vorgeschichtler, Flurnamen- und Siedlungsforscher | siwiarchiv.de
Pingback: Hermann Böttger (1884 – 1957) – Gymnasiallehrer, Vorgeschichtler, Flurnamen- und Siedlungsforscher | siwiarchiv.de
Zu den Folgen der kommunalen Neugliederung (Kreisname, Wappen) siehe:
1) https://www.siwiarchiv.de/wie-der-kreis-siegen-wittgenstein-zu-seinem-namen-kam/
2) https://www.siwiarchiv.de/geschichte-des-wappens-des-kreises-siegen-wittgenstein/
Ferner weisen sowwohl die Siegener Bibliographie als auch die Bilbiographie zur Wittgensteiner Territorialgeschichte auf erste einschlägige Literatur hin.
In der Kreistagssitzung vom 2. Juni 1949 wurde Hermann Böttger zum ehren amtlichen Archivpfleger für das Amt Weidenau gewählt – s. Protokollauszug:
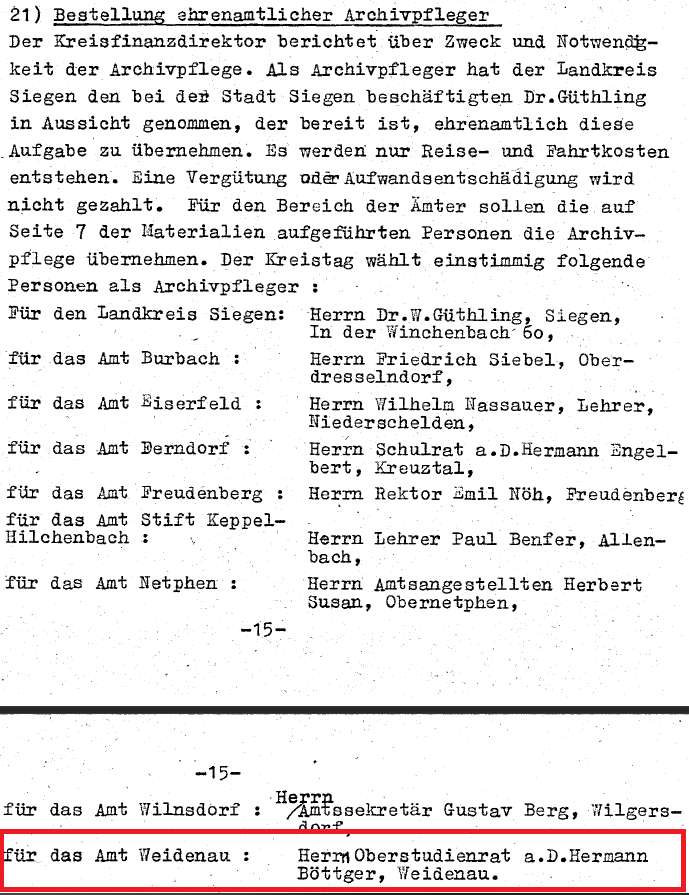
In der Kreistagssitzung vom 2. Juni 1949 wurde Dr. Wilhelm Güthling zum ehren amtlichen Archivpfleger für den Landkreis Siegen gewählt – s. Protokollauszug:
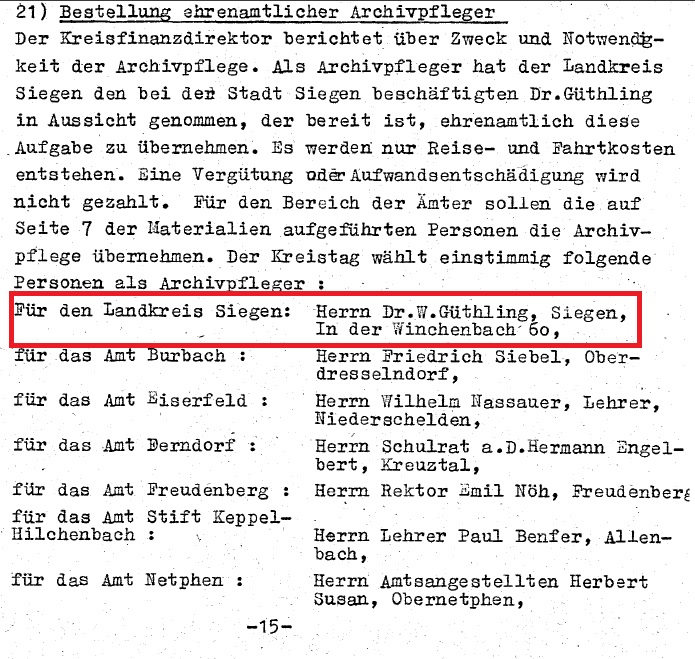
Warum beschäftigte sich Hermann Böttger mit der Vorgeschichte:
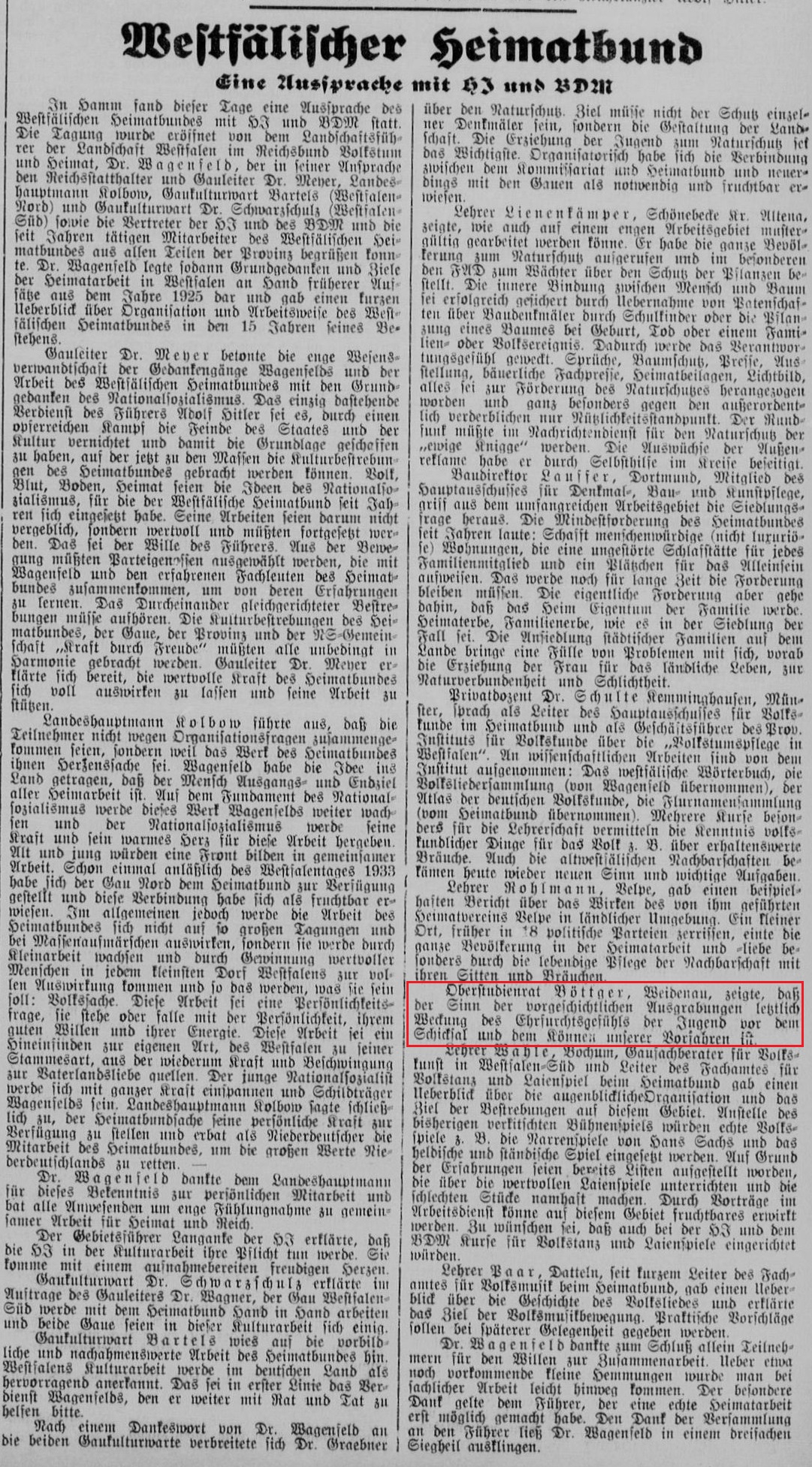
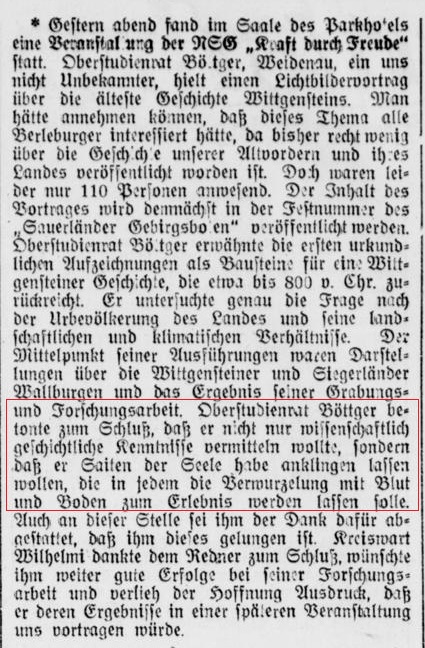
Tecklenburger Landbote, 20. März 1934:
Nationalzeitung Wittgensteiner Ausgabe, 9. März 1935:
Weitere noch nicht ausgewertete Presseartikel zu Böttger:
– Siegener Zeitung vom 14. Juli 1944 „Ehrung verdienter Schulmänner“ (darin Hermann Böttger)
– Siegener Zeitung v. 9. Januar 1936 über einen Vortrag Böttgers über die Wüstungen des Siegerlandes
– Siegener Zeitung v. 19. Juni 1929 über den Vortrag „Grundsätzliches über Heimatmuseen und dessen Anwendung auf das Museum des Siegerlandes“
– Siegener Zeitung vom 24. März 1927 „Über die Geschichte der Besiedlung des Siegerlandes sprach St.-Rat Böttger im Kursus für wissenschaftliches Wandern“
– Siegener Zeitung v. 14. Oktober 1922 Studentische Selbsthilfeorganisationen [s. a. „Das Volk“, 13.10.1922]
– Siegener Zeitung vom 10. April 1922 „Siegerländer Hilfe für das Deutschtum in den Grenzmarken“ [Wirklich von Hermann Böttger?]
– Siegener Zeitung v. 6. und 10. Augsut 1921 „Der deutsche Beamtenbund im Schlepptau sozialdemokratischer Gewerkschaften“ [s. a. „Eingesandt“, in: Das Volk, 5.8.1921]
s. a. Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung – Archiv, Berlin, Gutachterstelle für deutsches Schul- und Studienwesen im Berliner Institut für Lehrerfort- und -weiterbildung und Schulentwicklung – Personalbögen der Lehrer höherer Schulen Preußens, GUT LEHRER (Personalunterlagen von Lehrkräften), 79227
Pingback: Hermann Böttger (1884 – 1957) – Gymnasiallehrer, Vorgeschichtler, Flurnamen- und Siedlungsforscher | siwiarchiv.de
Pingback: Hermann Böttger (1884 – 1957) – Gymnasiallehrer, Vorgeschichtler, Flurnamen- und Siedlungsforscher | siwiarchiv.de
Die hier seit Oktober vergangenen Jahres ermittelten Presseberichte belegen überdeutlich, dass eine gründliche Presseauswertung aussteht. 2 weitere Artikel geben Hinweise zum politischen Engagement Böttgers im Jahr der Reichspräsidentenwahl 1925:
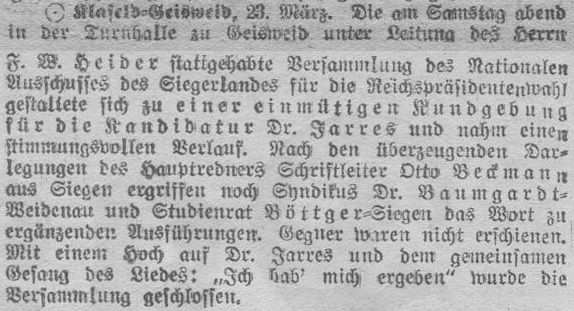
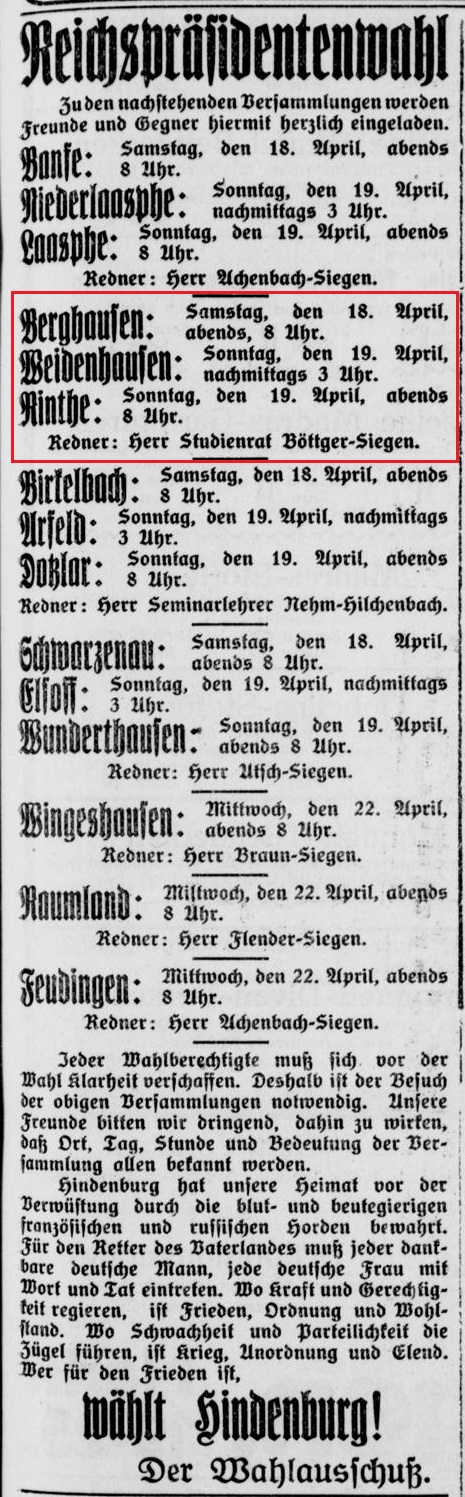
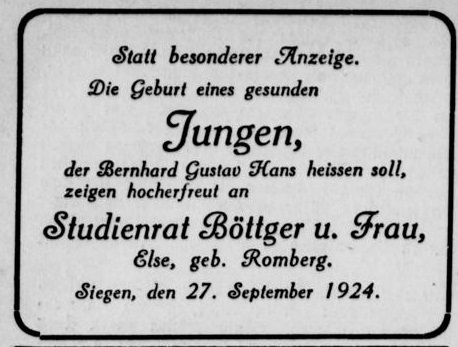
– Das Volk, 23. März 1925:
– Wittgensteiner Kreisblatt, 17. April 1925:
In den Anzeigenteilen der regionalen Zeitungen fand sich neben hauswirtschaftlichen Stellenangeboten der Familie Böttger auch folgende Geburtsanzeige, die die hier eher spärlichen Angaben ergänzt:
– Wittgensteiner Kreisblatt, 1. Oktober 1924:
s. a.: Das Volk, 18. März 1925 (Danke an B.P.)
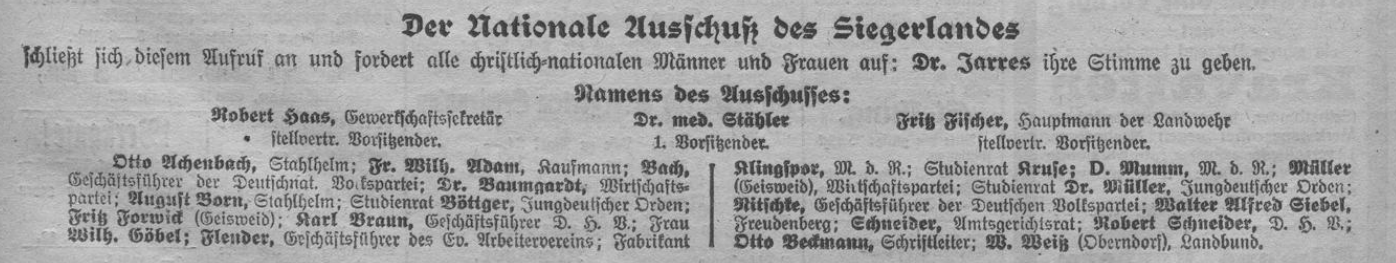
Pingback: Rubens-Fachblog meldet Versteigerung – Archivalia
Quelle: Deutsche Verlustliste, Ausgabe 2344 vom 25.2.1919, Seite 29336, via compgen
Pingback: Hermann Böttger (1884 – 1957) – Gymnasiallehrer, Vorgeschichtler, Flurnamen- und Siedlungsforscher | siwiarchiv.de
Pingback: Hermann Böttger (1884 – 1957) – Gymnasiallehrer, Vorgeschichtler, Flurnamen- und Siedlungsforscher | siwiarchiv.de
Pingback: Hermann Böttger (1884 – 1957) – Gymnasiallehrer, Vorgeschichtler, Flurnamen- und Siedlungsforscher | siwiarchiv.de
s, a, Rudolf Bergmann, Ortswüstungen im Kreis Siegen-Wittgenstein, Archäologie in Westfalen 2017, S. 250 – 254, Link
Link zur PDF-Datei
Gibt es eigentlich etwas Neues zur Situation in Olpe? Wohl eher nicht, wenn man diesen Bericht liest:
“ …. Mittlerweile gibt es in Olpe einige Reaktionen aus der Politik, so will die SPD die Archivstelle neu diskutieren und auch der Bürgermeister der Stadt Olpe drängte auf Beruhigung der aufgeregten Diskussion. In der letzten Sitzung verwies er auf den Termin des k.w.-Vermerkes, da er ja erst am 30.06.2024 zum Tragen komme. Bis dahin habe der Rat Zeit, um über den Stellenplan zu diskutieren. Man nehme die Kritik schon sehr ernst und wolle überprüfen, in welchem Umfang die Stelle neu besetzt werden soll. ….“
Zur Beteiligung Böttgers am „Deutschen Tag“ in Siegen am 15. Juni 1924 – s. „Das Volk“ vom 17. Juni 1924:
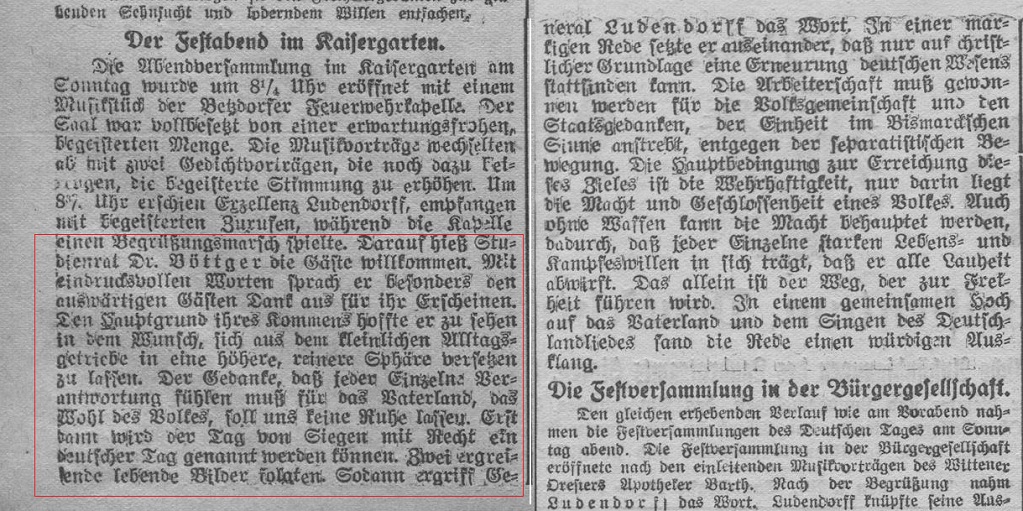
Teppichfransen?
Teppiche sind eher selten in Archiven zu finden – daher leider nein.
Seil zum Bücher binden?
Es auch auch kein Faden für die Fadenheftung.
Lesezeichenfaden
Nein. Es ist kein Lesezeichen.
Fransenborte
Wenn Sie jetzt noch sagen, woran sich die Fransenborte berfindet, dann haben Sie sich den kleinen Gewinn verdient. ;-)
vielleicht von einer Fahne
Ein wenig zu groß!
an einem Wimpel?
Gratulation! Es ist ein Wimpel, der im Rahmen des Partnerschaftsjubiläum mit dem israelischen Partnerkreis Emek-Hefer in das KReisarchiv gelangt ist.
oder an einer Uniform z.B. an einem Schulterbesatz
An einer Tischdecke
Leider auch nicht an einer Tischdecke!
Nicht an einer Uniform!
Gutenmorgen,
Und wo bekommt man das?
Es ist ja zunächst nur eine Vorstudie entstanden. Auf der Universitäts-Seite von Heiner Stahl findet sich folgende Literautr zum Thema:
– Stahl, Heiner: Flavours of frozen ice cream around 1800. Gustatory knowledge, courtly pastry craft and cookbooks, in: Christina Bartz/Jens Ruchatz/Eva Wattolik (eds.): Food-Media-Senses, Bielefeld: transcript, 2023. [Im Druck]
– Stahl, Heiner: Eisgenuss und Hupgeräusche. Sinneswissen und -praktiken in städtischen Raumordnungen (1900-1930), in: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften (OeZG) (Ellinor Forster/Regina Thumser-Wöhs (Hg.)),Sinnesräume, 33. Jg, (2022), 2, S. 96-117.
Vielleicht an einem Mop
Es ist auch kein Mop. Die Frage, woran könnte sich eine Fransenborte befinden. Es steht im übrigen in einem Zusammenhang mit einem aktuellen Jubiläum.
Jan Schleusener: Rezension zu: Windolf, Paul; Marx, Christian: Die braune Wirtschaftselite. Unternehmer und Manager in der NSDAP. Frankfurt am Main 2022 , ISBN 978-3-593-51559-5,, In: H-Soz-Kult, 02.03.2023, <http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-117578>.
s. a. Fries, Traute: Die deutsche Friedensgesellschaft im Bezirk Sieg-Lahn-Dill in der Weimarer Republik, Siegen 2013, 115, 124-126, 149, 150, 190
Pingback: Eine Milchbar für die „Plüschetage“ des Siegener Landratsamtes | siwiarchiv.de
Fotoplatten in einem Umkarton
Leider nein. Ich bin da pingelig.
Neuer Versuch:
Jeweils einzeln verpackte Glasplatten/Glasnegativen
Leider nein. Aber Sie sind sehr nahe dran.
Seitenansicht einer Glasplattenserie über das Siegerland, bzw. Wirtschaftsgeschichte.
Buchrücken (Z.B. Siegerländer Beiträge zur Geschichte und Landeskunde)
Leider falsch.
Sieht nach einem Kasten gefüllt mit alten Dias aus.
Gratulation! Sie haben gewonnen.
Pingback: Heute vor 73 Jahren: Justizrat Siegfried Frey (1871 – 1950) aus Siegen gestorben | siwiarchiv.de
Pingback: Heute vor 73 Jahren: Justizrat Siegfried Frey (1871 – 1950) aus Siegen gestorben | siwiarchiv.de
Ev. Taufregister St. Marien, Dortmund, 1871/30
Siegfried Ernst Frey, ehel, S.v. Lehrer Julius Frey u. Lina Schmitz
*29. April, ~11. Mai durch Pfr. Frey
Danke für die Ergänzung!
Pingback: Ausstellungstipp: Sammlung Kreutter im Raum | siwiarchiv.de
Pingback: Ausstellungstipp: Sammlung Kreutter im Raum | siwiarchiv.de
s. a. Westfalenpost vom 29.7.2023, Link:https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/ausflugstipp-digitale-tour-fuehrt-auch-zum-berleburger-baeren-id239052317.html
Heute erschien in der Siegener Zeitung der Leserbrief „Stoppt das Kuddemuddel“ zur Denkmalumgestaltung: „… Jetzt rückt man auch noch der Geschichte zu Leibe mit der Unvereinbarkeit von Kriegerdenkmal und Friedenssymbolen. Wir sind zwar auch keine Kaiser-Fans, aber der erste Kaiser Wilhelm unter schied sich deutlich vom fanatischen zweiten Kaiser. Und das Gedenken an gestorbene Kaiser hat auch seinen Stellenwert als Erinnerung an furchtbare Kriege. ….“
Demjenigen, der hier als “Archivar” die Regenten im Kaiserreich kommentiert und Wilhelm II. als “fanatisch” beschreibt, empfehle ich anstatt solcher laienhistorischer Einlassungen, einmal eine Biographie (z. B. von Tyler-Whittle https://www.amazon.com/last-Kaiser-biography-Wilhelm-emperor/dp/0812907167) zu lesen. Spätestens seit Christopher Clarks “Schlafwandler” weiß jeder historisch belesene Mensch, dass die Monarchen des Kaiserreichs Kinder ihrer Zeit, aber keinesfalls “fanatische” Kriegstreiber oder sonst irgendwie “fanatisch” waren. Die Bad Berleburger Funktionäre haben sich beim Denkmal von linksgrünen Ideologen auf die schiefe Ebene eines absurden Geschichtsbildes führen lassen.
Lesen hilft – der „archivar“ hat lediglich einen Leserbrief in der Siegener Zeitung zum Thema zitiert.
Stimmt. Das Zitat nahm den gesamten Post ein, so dass man vermuten darf, es drücke die Auffassung des Archivars aus. Sollte dem nicht so sein, freue ich mich …
Pingback: Siegerland Band 100 / Heft 1 (2023) erschienen | siwiarchiv.de
Das hier vorgestellte Gemälde als street art: https://streetartutopia.com/2022/08/21/old-woman-and-boy-with-candles-by-julien-de-casabianca-in-the-hague-netherlands/
Ergänzung der Veröffentlichungen von Kropffs:
– Die Bundesautobahnen Sauerlandlinie und Köln-Olpe-Hersfeld-Kassel, in: Kreis Olpe, Oldenburg 1970, S. 97-99
– Wiege der Eisenindustrie, in: Westfalenspiegel 1954 Heft 10 (Sonderheft Siegerland), S. 16 – 19
– Verkehrsfragen im südlichen Westfalen, in: Im Kranz bewaldeter Höhen, Dortmund 1955, S. 97-99
s. a. WP-Artikel „Banfe: Nazi-Opfer bekommen endlich ein Gesicht“ v. 9.8.2023, Link: https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/banfe-nazi-opfer-bekommen-endlich-ein-gesicht-id239143091.html
Pingback: Deutsche Schachmeisterschaften 1947 in Weidenau (Sieg) | siwiarchiv.de
Schon 1945 „erweckte“ Hermann Meyer den Schachverband Südwestfalen mit den Vereinen im Siegerland zu neuem Leben. 1947 war er maßgeblich an der Organisation der ersten gesamtdeutschen Schacheinzelmeisterschaft vom 10. bis 31. August in Weidenau beteiligt. Die Turniere fanden in der Turnhalle des Fürst-Johann-Moritz-Gymnasiums statt. Hermann Meyer war leidenschaftlicher Schachspieler und spielte auch Telefonschach. Er gründete und betreute die Schulmannschaft. Während seiner Tätigkeit beim Geisweider Eisenwerk gründete er ebenfalls eine Schachgruppe. Aus „Hier geschieht niemandem Unrecht!“ – Zur Geschichte von Dr. Artur und Else Sueßmann und der Familie ihrer Tochter Annemarie Meyer. Hermann Meyer war ihr Ehemann. Dazu auch: Schach-Highlight 1947 in Weidenau, Erste deutsche Nachkriegsmeisterschaft ein Volltreffer, in: Zeitschrift „Blickpunkt“, Das Hüttental im Spiegel von Berichten und Bildern, 4/1997.
Danke für die Ergänzungen!
Pingback: Vortrag: Knoch im Kontext: Drei „kleine“ Archivare und ihr Verhältnis zur Ordnung im späten 18. Jahrhundert | siwiarchiv.de
Pingback: Wilhelm Oechelhäuser (1820-1902) und dessen koloniales Engagement. Digitale Quellenfunde. | siwiarchiv.de
Pingback: Albert Ludwig Juncker – erster Präsident der IHK Siegen nach 1945 | siwiarchiv.de
Pingback: Albert Ludwig Juncker – erster Präsident der IHK Siegen nach 1945 | siwiarchiv.de
Der Kulturausschuss beschloss am 8.8. wie folgt:
1) Die Europastraße wurde mit einer Gegenstimme und 4 Enthaltungen angenommen
2) Die Margarete-Lenz-Straße wurde bei einer Gegenstimme [AfD-TD] und 2 Enthaltungen [AfD, GfS] angenommen.
3) Die Charlotte-Petersen-Straße wurde mit 2 Gegenstimmen und drei Stimmenthaltungen [AfD, GfS, UWG] angenommen.
4) Die Straße „Am Breitenbach“ wurde einstimmig bei 2 Enthaltungen [AfD-TD, GfS] angenommen.
[5) Die Straße „Auf dem Heuper“ wurde einstimmig bei 1 Enthaltung (GfS) angenommen.]
Quelle: Westfälische Rundschau, 10.8.2023 (Print); Ergänzugen aufgrund der Sitzungsniederschrift am 21.8.
Auf den Artikel „Schicksalsjahre einer Familie“ von Traute Fries in der Heimatland Beilage der Siegener Zeitung vom 28.1.2022 sei verwiesen, da dort weitere Angaben zu Albert Juncker und dessen Famile enthalten sind.
Ein Blick in die Siegener Kreistagsprotokolle des Jahres 1946 ergab folgendes: Albert Juncker war seit Februar 1946 Mitglied des Ausschusses für das Straßenverkehrsamt und Mitglied des gemeinsamen Ausschusses für den Wiederaufbau von Stadt- und Landkreis Siegen (bis Oktober 1946). Im April 1946 wurde Juncker als von Seiten der Stadt Siegen als Mit glied derr Entanzifizierungsspruchkammer vorgeschlagen.
In der heutigen Print-Ausgabe der Siegener Zeitung erschien der Artikel „Graf-Luckner-Straße: Anwohner gegen Umbenennung. Das beschlossene Vorhaben am Weidenauer Giersberg sorgt für Ärger. Dass weder der Bürgermeister noch die drei größten Fraktionen auf ihren Vorschlag [Anm.: Umwidmung der Straße noch Nikolaus Graf Luckner] eingehen, schockiert eine Reihe von Anwohnern, sie wenden sich jetzt an eine höhere Instanz.“
s.:
Ein weiterer Artikel zur Umbenennung der Graf-Luckner-Straße erschien in der heutigen Printausgabe der Siegener Zeitung unter der Schlagzeile: „Welcher Luckner war es denn nun? Der als „Seeteufel“ bekannte Kaperkapitän taugt nicht mehr als Namenspatron für eine Siegener Straße. Das ist für die Anwohner aber kein Grund, ihre Adressen umzubenennen. Was sie der Stadt Siegen vorhalten.“
Aus dem Bericht geht hervor, dass im Stadtarchiv Siegen kein Beleg aufgefunden werden konnte, dass die ehemalige Hindenburgstraße im Zuge der kommunalen Neugliederung 1975 nach Felix Graf Luckner benannt wurde. Aufgrund der Ungleichbehandlung mit den Anwohner der Stöckerstraße – hier fand eine Umwidmung (s. o.) von Adolf Stoecker in Helene Stöcker statt – haben sich die Anwohner an den Petitionsausschuss des Landtages gewendet.
S. a.:
Heute erschien in der Print Ausgabe der Siegener Zeitung der Artikel „Nach welchem Grafen die Luckner-Straße benannt ist. Können die Anwohner deren Umbenennung noch verhindern? Die Stadt kann nun belegen, wer der konkrete Namengebet ist.“ von Jan Schäfer:
“ …. Bürgermeitser Steffen Mues hatte in einem ersten Antwortschreiben in der Tat einräumen müssen, dass er im Archiv kein Dokument gefunden habe, das die Straßenbenennung seinerzeit eindeutig mit Felix von Luckner in Verbindung bringen könne. Er nehme aber an, dass es (sic!) der Rat damals den „Seeteufel“ ehren wollte, als er die einstige Hindenburgstraße im Jahr 1975 umbenannte. Mit einer „Annahme“ sei es aber nicht getan, meinten die Anwohner. Nun aber hat sich das Blatt gewendet: Die Verwaltung hat weiter suchen lassen im Archiv, um Klarheit zu bekommen. Uns sie wurde fündig. Inzwischen liegt ein Dokument vor, das die Widmung des Straßennamens eindeutig belegt.
In dem der SZ vorliegenden Schreiben vom 2. September 1975 sind 60 Straßen aufgelistet, die nach Personen benannt sind. Erläutert werden sie deshalb, weil im Rahmen der Kommunalen Neugliederung und damit der Eingemeindung der ehemaligen Stadt Hüttental zu Siegen eine ganze Reihevon Straßen wegen Dopplungen neue Bezeichnungen bekommen mussten, und zwar zum 1. Oktober 1975. In eben dieser Auflistung stehen die jeweiligen Namensgeber unmissverständlich. Im Falle der Graf-Luckner-Straße steht als Namensgeber: „Felix Garf Luckner, 1881 Dresden – 1966 Malmö, Seeoffizier“. Ein klare Sache also. ….“
„Auffällig ist wiederum die ausführliche und wohlwollende Berichtserstattung der ‚Siegener Zeitung‘ im Vorfeld der beiden ‚Luckner-Veranstaltungen‘. Siegener Zeitung v. 10.10.1924. Korvettenkapitän a. D. Felix Graf von Luckner sprach am 16.10.1924 in einer Versammlung in Siegen, Veranstalter war der ‚Verein Volkswohl‘. Am 18.10. fand in Kreuztal die Veranstaltung der Ortsgruppe des Deutschen Seevereins statt. Luckner sprach über ‚64.000 km Kreuzerfahrt mit dem’Seeadler‘ im Weltkriege‘, der Eintritt betrug 1,- Mark.“ (Anmerkung 196, T. Fries, Die Deutsche Friedensgesellschaft im Bezirk Sieg-Lahn-Dill in der Weimarer Republik.
Am 14.10. und am 16.10.1924 fanden in Kreuztal und Siegen Veranstaltungen der Deutschen Friedensgesellschaft statt. In Kreuztal sprach General Freiherr von Schoenaich über das Thema „Vom vorigen zum nächsten Krieg“, in Siegen lautete der Vortrag „Abrüstung, Sicherung und Vereinigte Staaten von Europa“. Beide Veranstaltungen dienten der Deusch-Französischen Verständigung. Der Auftritt des französischen Generals Verraux war von rechts gerichteten Kräften hintertrieben worden.
Bildersturm und kognitive Dissonanz
Die Provinz will nicht zurückstehen! Während in den Großstädten die Geschichtspolitk des allgegenwärtigen linksgrünen Establishments ohne Kompromisse durch Straßenumbenennungen und das Schaffen von stets steuerfinanzierten „Erinnerungsorten“ aller Art kompromisslos umgesetzt wird, wollen die Partei- und Verwaltungsvertreter im abgelegenen Bad Berleburg nicht zurückstehen. Erst recht nicht möchten dies die örtlichen Repräsentanten der mittlerweile schwindsüchtigen, aber dafür durchpolitisierten Evangelischen Landeskirche. Wie schon in vergangenen unglückseligen Zeiten entwickeln sie dabei sogar einen besonderen Eifer, gelehrig nachzuahmen, was ihre großen ideologischen Vorbilder vorleben. So setzten es die Anhänger der Grünen Partei tatsächlich durch, dass ein seit über 120 Jahren auf dem Bad Berleburger Goetheplatz vorhandenes Friedens- und Kriegerdenkmal postmodern „dekonstruiert“ und umgedeutet wird. Das Ergebnis ist ein mit Glasplatten verschandeltes historisches Bauwerk. Jenseits purer Ideologie und Bildungsferne ist kein Grund erkennbar, warum das historische, aus Namenslisten der örtlichen Kriegstoten der Bismarck‘schen Einigungskriege, der Verehrung Kaiser Wilhelms I. mittels eines Reliefs und einer Friedenseiche bestehende Ensemble einer Umgestaltung bedurfte. Das Denkmal weist eine eher kleine Größe auf und war in der Formensprache seiner Zeit ausgeführt worden, die sich wohltuend von der späteren monumentalen Denkmalarchitektur der Nationalsozialisten unterscheidet. Ganz ähnliche Gedenkorte finden sich überall in Europa. Bestand vor der Verschandelung des Berleburger Ensembles die Gefahr, das in einem Betrachter ohne weitere Belehrungen der Wunsch erwachsen könnte, die Monarchie wiederzubeleben? Oder mussten die Stadtoberen gar damit rechnen, dass bei den Berleburgern ohne weitere Erziehung zur Friedensliebe durch Parteien, Verwaltung und Kirche wieder Ressentiments gegen Frankreich Raum gewinnen könnten? Wohl kaum. Bei dieser Bilderstürmerei, die bewusst ein historisches Ensemble verschandelt und sinnentstellend, handelt es sich um einen kulturfremden Akt, der aus der Warte einer vermeintlich höheren Moral ein bestimmtes Geschichtsverständnis missionarisch verbreiten will. Es macht sprachlos, dass es gerade die linksgrünen, achso friedensbewegten Initiatoren dieser offen pazifistisch anmutenden Umgestaltung sind, die seit Monaten die Lieferung von immer mehr schweren Waffen in das Ukrainekriegsgebiet fordern. Friedensgespräche lehnen sie ab, es soll wieder „gesiegt“ werden, diesmal allerdings nicht mit heimischen Kriegsopfern, sondern ausschließlich mit ukrainischen. Anstatt sich selbst als Freiwillige bei den internationalen Brigaden der Ukraine zu melden, ziehen es die deutschen Parteien und ihrer Berleburger Abbilder vor, dass schon jetzt in jeder kleinen Stadt der Ukraine Gefallenendenkmäler und riesige Soldatenfriedhöfe entstehen. Auch diese Denkmäler tragen Tafeln mit langen Namenslisten der Opfer. Gelegentlich werden sie auch Bezüge zum Präsidenten der Ukraine, dem dortigen Staat oder seiner Regierung aufweisen. Stets aber drücken die ukrainischen Denkmäler Patriotismus und Trauer aus, ganz so, wie dies seit mehr als 120 Jahren das historische Berleburger Denkmal versinnbildlicht. Ob es in der Ukraine oder in irgendeinem anderen von Krieg und Elend betroffenen Land Leute geben wird, die die dortigen Denkmäler und Friedhöfe mit Glasplatten „dekonstruieren“ und verschandeln wollen, weil es ihnen an Respekt vor den Toten oder schlicht an historischer Bildung mangelt? An kognitiver Dissonanz sind die Berleburger Bilderstürmer aus Parteien, Kirche und Verwaltung, die sich allzu gerne mit den ukrainischen und Regenbogenfarben schmücken, jedenfalls nicht zu überbieten. Ob die vorangegangene Verschandelung des Goetheplatzes, die nun beim Denkmalsensemble ihren Abschluss fand, Rückhalt bei den Berleburgern hatte? Wohl kaum. Dies ist den ideologisierten Provinzpolitikern, Kirchen- und Verwaltungsleuten in ihrem bürgerfernen Resonnanzraum allerdings egal.
Eine Anmerkung sei zumindestens erlaubt: Ich kann weder in der Besetzung des Stadrates noch in der Besetzung des Kulturausschusses einen linksgrüne Mehrheit erkennen.
Umso trauriger ist es, dass die ehemals bürgerlichen Kräfte im linksgrünen Kulturkampf um die Deutungshoheit entweder nicht standhalten oder längst innerlich korrumpiert sind. Es tut sich in Bad Berleburg eine riesige Repräsentationslücke auf: Die ehemals bürgerlichen Kräfte repräsentieren einen wesentlichen Teil der Berleburger, besonders die hier angestammten, nicht mehr ausreichend. Die wählen CDU und bekommen grüne Weltanschauungspolitik. Abstimmungen der Bevölkerung über Sachfragen scheuen die Bad Berleburger Funktionäre wie der Teufel das Weihwasser.
Was aber kommt als nächstes? Glasplatten mit Kindergartenzitaten an der Bismarcksäule? Umbenennung der Moltke-, Roon- und Schützenstraße? Aufnahme der Regenbogenfarben in das Stadtwappen? Umbenennung des Schützenplatzes in Amadeo-Antonius-Platz?
Bürgerlichkeit heißt gegen jede Radikalität immun zu sein, weltoffen für Neues und verbunden mit dem Eigenen, der Heimat der eigenen Geschichte und Kultur. Erkennt der Stadtrat denn nicht, dass die Verschandelung und Umdeutung eines historischen Monuments die Vorstufe zum Abriss ist. Abgerissen wurden historische Denkmäler von den Taliban, Bücher verbrannten die Nazis. Selbst die DDR brachte genug Toleranz auf, um die vielen dörflichen Kriegerdenkmale, die an die 1864-er, 1866-er Kriege und den Krieg von 1870/71 erinnerten, unangetastet zu lassen. Wie umnachtet müssen CDU, FDP, der Bürgermeister und die Verwaltungsriege in Bad Berleburg sein, um so etwas mitzumachen?
Es hätte ja nichts dagegen gesprochen, an anderer Stelle ein “Friedensdenkmal” nach heutigem linksgrünen Geschmack zu errichten. Der Frevel der BAd Berleburger Funktionäre besteht darin, dass sie sich an einem denkmalgeschützten historischen Zeugnis vergriffen haben.
Steht das Kriegerdenkmal unter Denkmalschutz? Denn es findet sich lediglich im Kulturgutverzeichnis der Stadt Bad Berleburg und nicht in der Liste der eingetragenen Baudenkmäler, die Wikipedia angibt. Auch im Berleburger Ratssinformationssystem finden sich keine Hinweise auf eine Eintragung des Kriegerdenkmals in die Denkmalliste der Stadt.
Wenn es unter Denkmalschutz steht, sollte vor der Umgestaltung eine Abstimmung mit der oberen Denkmalbehörde stattgefunden haben.
Ästhetische Bewertungen von Umgestaltungen von Denkmälern sind auch immer eine Geschmackssache, über die man ja nicht streiten sollte.
Eine sehr bürokratisch-technokratische Sichtweise, die, um abzulenken, nicht zu den Argumenten des Beitrags durchdringt. Fakt ist, dass der Denkmalschutz bei der gesamten (misslungenen) Umgestaltung des Goetheplatzes, in dessen Mitte nun einmal das Denkmalsensemble steht, eine große Rolle spielte. Selbstverständlich wurde auch die Denkmalbehörde zu Platz und Denkmal konsultiert, und zwar mehrfach! Aus kunsthistorischer Sicht dürfte unbestritten sein, dass die Arbeiten Arnold Künnes nicht nur den Qualitätsanspruch der zeitgenössischen Berleburger, sondern auch aus heutiger Sicht den konservatorischem Rang des sogenannten Kaiser- und Kriegerdenkmals ausdrücken. Dabei geht es nicht um Ästhetik, wie der Archivar fälschlicherweise annimmt, sondern um den Erhalt eines historischen Monuments samt dessen Formensprache und seiner historischen Botschaft. Erst recht geht es nicht um persönlichen Geschmack.
Wenn wir aber schon einmal bei Ästhetik sind, so reicht ein schlichter Bildvergleich des Platzes im Zustand von etwa 1970 (vor der Asphaltierung) mit dem jetzigen Bauzustand aus, um festzustellen, dass die jetzige “Pflaster- und Betonwüste” in keinerweise mehr mit dem alten historischen Flair mithalten kann. Das mag zwar eine subjektive Sicht sein, sie dürfte aber von vielen Berleburgern geteilt werden. Ergo: Die Umgestaltung mit ihren “modernen” Baumaterialien aus Benton, der viel zu großen Steinfläche, ihrer Sterilität und der nun spärlichen Bepflanzung ist insgesamt misslungen.
Beim Denkmal aber geht es nicht um Ästhetik, sondern um Ideologie und linksgrünen Deutungsanspruch.
Danke für die Präziserung bezüglich des Denkmalschutzes!
Zur Verdeutlichung die Debatte hat ja mehrere Ebenen:
1) eine politische, die in den bisherigen Kommentaren, sehr eindeutig bewertet wird,
2) eine rechtliche, die bisher keine Rolle gespielt hat. Da der Denkmalschutz beteiligt wurde, scheinen dessen Belange durch die Gestaltung nicht berührt zu sein,
3) eine erinnerungskulturelle, die sich den Fragen widmet, ob Denkmäler der Kontextualiiserung bedürfen, und wie diese bestmöglich geschehen kann, und
4) sehr wohl eine ästhetische; wenn eine Einordnung als politisch befürwortet wurde, sie rechtlich zulässig, sie historisch als notwendig angezeigt ist, wie hat diese Einordnung auszusehen.
Ferner „leidet“ der konkrete Vorschlag der Denkmalumgestaltung auch unter der generellen Umgestaltung des Goetheplatzes (z. B. Baumfällungen), die aber m. W. in keinem ursächlichen Zusammenhang mit der Denkmalsumgestaltung steht. Also: Die Bäume wurden nicht wegen der Denkmalsumgestaltung gefällt. Die Baumfällungen eröffneten offentsichtlch die Möglichkeit der Denkmalumgestaltung
Ein wenig Lesestoff zur Buttlarschen Rotte:
Thomas HOEREN – Pietismus vor Gericht, in: Jahrbuch für Westfälische Kirchengeschichte, 1995: https://www.itm.nrw/wp-content/uploads/Buttlarsche.pdf
Eduard BECKER – Eine Handschrift zur Geschichte der Buttlar’schen Rotte;
Darmstadt, 1905 – http://www.wittgensteiner-heimatverein.de/Buttlarsche-Rotte.pdf
Johannes SCHERR – Mutter Eva; in: Größenwahn – vier Kapitel aus der Geschichte menschlicher Narrheit, Kassel, 1876, p. 22-86, [Link nachgereicht von AS am 22.8.2023]
Willi TEMME – Krise der Leiblichkeit – Die Sozietät der Mutter Eva (Buttlarsche Rotte) und der radikale Pietismus um 1700; Göttingen, 1998 (Vandenhoeck & Ruprecht), Marburg: Diss. theol. [Ergänzung durch archivar am 21.8.: Link]
Roman:
Roland ADLOFF – Evens Buch – Die Geschichte einer ungewöhnlichen Erpressung in der ehemaligen Grafschaft Wittgenstein; Kreuztal, 1996 (Verl. Die Wielandschmiede)
Danke für die Hinweise!
Bildersturm und kognitive Dissonanz
Die Provinz will nicht zurückstehen! Während in den Großstädten der Bundesrepublik die Geschichtspolitk des allgegenwärtigen linksgrünen Establishments durch Straßenumbenennungen und das Schaffen von immer neuen stets steuerfinanzierten „Erinnerungsorten“ aller Art kompromisslos umgesetzt wird, wollen die Partei- und Verwaltungsvertreter im abgelegenen Bad Berleburg nicht zurückstehen. Erst recht nicht möchten dies die örtlichen Repräsentanten der mittlerweile schwindsüchtigen, aber dafür durchpolitisierten Evangelischen Landeskirche. Wie schon in vergangenen unglückseligen Zeiten entwickeln sie dabei sogar einen besonderen Eifer, gelehrig nachzuahmen, was ihnen ihre großen ideologischen Vorbilder vorleben. So setzten es die Anhänger der Grünen Partei tatsächlich durch, dass ein seit über 120 Jahren auf dem Bad Berleburger Goetheplatz vorhandenes Friedens- und Kriegerdenkmal postmodern „dekonstruiert“ und umgedeutet wird. Das Ergebnis ist ein mit banalen Zitaten auf Glasplatten verschandeltes historisches Monument. Jenseits purer Ideologie und Bildungsferne ist kein Grund erkennbar, warum das historische, aus Namenslisten der örtlichen Kriegstoten der Bismarck‘schen Einigungskriege, der Verehrung Kaiser Wilhelms I. mittels eines Reliefs und aus einer Friedenseiche bestehende Ensemble einer Umgestaltung bedurft hätte. Das Denkmal weist eine eher kleine Größe auf und war in der Formensprache seiner Zeit ausgeführt worden, die sich wohltuend von der späteren monumentalen Denkmalarchitektur der Nationalsozialisten unterscheidet. Ganz ähnliche Gedenkorte finden sich überall in Deutschland und Europa.
Bestand vor der Verschandelung des Berleburger Ensembles die Gefahr, das in einem Betrachter ohne weitere Belehrungen der Wunsch erwachsen könnte, die Monarchie wiederzubeleben? Oder mussten die Stadtoberen gar damit rechnen, dass bei den Berleburgern ohne weitere Erziehung zur Friedensliebe durch Parteien, Verwaltung und Kirche wieder Ressentiments gegen Frankreich Raum gewinnen könnten? Wohl kaum. Bei dieser Bilderstürmerei, die bewusst das historische Ensemble mit Friedenseiche verschandelt und sinnentstellt, handelt es sich um einen kulturfernen Akt, der aus der Warte einer vermeintlich höheren Moral ein bestimmtes Geschichtsverständnis missionarisch verbreiten will. Einer vielstimmigen Deutung der Geschichte soll bewusst entgegengewirkt werden.
Es macht sprachlos, dass es gerade die linksgrünen, früher achso friedensbewegten Initiatoren dieser offen pazifistisch ausgeführten Umgestaltung sind, die seit Monaten die Lieferung von immer mehr schweren Waffen in das Ukrainekriegsgebiet fordern. Friedensgespräche lehnen sie ab, es soll wieder „gesiegt“ werden, diesmal allerdings nicht mit heimischen Kriegstoten, sondern ausschließlich mit ukrainischen. Anstatt sich selbst als Freiwillige bei den internationalen Brigaden der Ukraine zum Kriegsdienst zu melden, ziehen es die deutschen Parteien und ihre Berleburger Abbilder vor, dass schon jetzt in fast jedem Ort der Ukraine Gefallenendenkmäler und riesige Soldatenfriedhöfe entstehen. Auch diese Denkmäler tragen Tafeln mit langen Namenslisten der Opfer. Gelegentlich werden sie auch Bezüge zum Präsidenten der Ukraine, dem dortigen Staat oder seiner Regierung aufweisen. Stets drücken die ukrainischen Denkmäler Patriotismus und Trauer aus, ganz so, wie dies seit mehr als 120 Jahren das historische Berleburger Denkmal auf dem Goetheplatz versinnbildlichte. Ob es in der Ukraine oder in irgendeinem anderen von Krieg und Elend betroffenen Land Leute geben mag, die die dortigen Denkmäler und Friedhöfe mit Glasplatten „dekonstruieren“ und verschandeln wollen, weil es ihnen an Respekt vor den Opfern oder schlicht an historischer Bildung mangelt?
An kognitiver Dissonanz sind die Berleburger Bilderstürmer aus Parteien, Kirche und Verwaltung, die sich allzu gerne mit den ukrainischen und Regenbogenfarben schmücken, jedenfalls nicht zu überbieten.
Ob die vorangegangene Verschandelung des Goetheplatzes, die nun beim Denkmalsensemble ihren traurigen Abschluss fand, Rückhalt bei den Berleburgern hatte? Wohl kaum. Dies ist den ideologisierten Provinzpolitikern, Kirchen- und Verwaltungsleuten in ihrem bürgerfernen Resonnanzraum allerdings egal.
@archivar, gut strukturiert. Dann wollen “wir” doch einmal nach diesen Ebenen zusammenfassen, hoffentlich mit möglichst wenigen Wiederholungen:
Ad 3 “erinnerungskulturelle Ebene”
Man könnte auch von einer geschichtspolitischen Ebene sprechen. Und hier liegt auch gleich der eigentliche Knackpunkt der Debatte: die kultur- und bildungsferne Entgleisung der Bad Berleburger Partei- und Stadtfunktionäre. Diese besteht im Kern aus dem ideologischen Anspruch des grünen intellektuellen Milieus, ihr Geschichtsbild zu früheren deutschen Staaten mit semitotalitärem Anspruch im öffentlichen Raum und in den Diskursräumen zu verbreiten.
Hier will ich etwas ausholen: Angefangen haben die Kulturkrieger mit den Zeugnissen des verbrecherischen Nationalsozialismus, wogegen in vielen Fällen nichts einzuwenden war und ist. Und doch zeigte sich schon bei den NS-Themen seit dem sogenannten “Historikerstreit” (Nolte/Habermas) ein absoluter Anspruch auf Deutungshoheit. Seit dieser Zeit werden die himmelschreienden Verbrechen der Nationalsozialisten zur Selbstlegitimation und -erhöhung des grünlinken Milieus missbraucht. Joschka Fischer behauptete gar, der “Gründungsmythos” der Bundesrepublik sei Ausschwitz. Nach der NS-Zeit, deren Denkmäler mit Berechtigung geschliffen wurden, wandten sich die Kulturkrieger zunehmend dem deutschen Kaiserreich nach 1871 zu, das sie pauschal und unbeeindruckt von historischen Tatsachen als undemokratisch, kolonialistisch, rassistisch, imperialistisch und aggressiv brandmarkten. Zu einer Beurteilung nach den Maßstäben der damaligen Zeit, die sich um Distanz und Augenmaß bemüht, waren sie entweder nicht in der Lage oder nicht willens. Es geht ihnen darum, jegliche Traditionslinien zu zertrennen, um ihr multikulturelles globalistisches Gesellschaftsbild mit totalitärem Anspruch zu verankern. Seit vielen Jahren haben sie sich den woken US-Ideologien und deren Vertretern angeschlossen. Die Annahme eines “totalitären Anspruchs” ist leider keine polemische Übertreibung, sondern empirisch leicht nachweisbar. Die ideologischen Narrative und Disziplinierungsinhalte sind immer moralistisch gefärbt und erschreckend simpel. Die Durchdringung aller relevanten gesellschaftlichen und staatlichen Institutionen ist beachtlich. Die verbreiteten Inhalte reichen von Migration, LGBTQ, US-Werteideologie und -Geopolitik über Antirassismus, Multikulturalismus bis zur Klimaerzählung und einem ideologischen Geschichtsbild. Wer versucht nicht mitzumachen oder zu widersprechen, wird “gecancelt”. Das biedere Bad Berleburg ist dafür ein gutes Beispiel: LGBTQ, Migration, Klima und vieles mehr werden von oben übergestülpt oder die lokalen Funktionäre schalten sich selbst gleich. Was der Souverän denkt – denn nichts von alldem ist von unten gewachsen – ist schlicht egal. Soviel der Vorrede.
Nun zur geschichtspolitischen Deutung des Denkmalvorfalls. Was die dienstbaren Geister in Bad Berleburg auf die Glasplatten haben schreiben lassen, ist nicht zu beanstanden und inhaltlich schrecklich banal. Zu einer tieferen Reflektion des tiefschichtigen Friedensthemas waren sie wohl nicht in der Lage. Entscheidend aber sind nicht die Aussagen auf den Glasplatten, sondern die Negation der ursprünglichen Ausstrahlung und Wirkung des Denkmals: Vaterlandsliebe, Gefallenengedenken und eine positive Konnotation der damaligen Staatsform, damals dankbar unterstützt von den zeitgenössischen Berleburger Bürgern, sollen keinen Raum mehr haben auf einem der wichtigsten Plätze der Kleinstadt. Zentrales Ziel der Ideologen ist eine postmoderne Dekonstruktion dieser historischen Substanz. Dass den Bad Berleburger Lokalgrößen diese Zusammenhänge bewusst waren, davon ist nicht auszugehen. Vielleicht wollten sie wirklich nur ein naives Friedenszeichen setzen. Zudem haben es die Initiatoren aus der Grünen Partei bei Initiierung der Umdeutung des Denkmals nicht ahnen können, dass der auf den Glasplatten verewigte naive Vulgärpazifismus seit dem Beginn des Ukrainekriegs längst nicht mehr der Parteilinie entspricht. Aber wie gesagt, beim Kulturkampf der Woken und Grünen auf dem Gebiet vorhandener Straßennamen und Monumente geht es in erster Linie um Dekonstruktion und nicht um neue Inhalte.
Aus geschichtspolitischer Sicht ist die Dekonstruktion und faktische Umwidmung des Denkmals sehr verwerflich. Das historische Ensemble schloss die ältere Friedenseiche mit ein, weshalb selbst das Friedensanliegen bereits in der Formensprache der Zeit berücksichtigt war. Der Anspruch eines sogenannten “Perspektivenwechsels” ist eine geistige Anmaßung gegenüber einem schützenswerten historischen Monument, dem die dilettantischen Glasplatten noch nicht einmal gerecht werden. Er ist auch eine unverhüllte Bevormundung des Betrachters, dem nicht zugetraut wird, mit einem historischen Zeugnis umzugehen. Gleiches gilt für die paternalistische Vorstellung, historische Zeugnisse müssten “kontextualisiert” werden. Diese Vorstellung ist offen totalitär. Welche Lehrmeinung bestimmt denn, welche Kontextualisierung die Richtige ist? Der Stadtrat? Die Wissenschaft? Ein städtisches Amt für Wahrheit und Vordenken? Welche Grenzen hätte eine Kontextualisierung im öffentlichen Raum denn? Bekommt die Evangelische Stadtkirche demnächst auch eine Glasplatte, weil in ihr einst Pfarrer Hinsberg dem Fürsten huldigte? Muss nicht auch das Berleburger Schloss mit einer Mahnstele bedacht werden, um den Opfern der Leibeigenschaft zu gedenken? Oder sollte auf dem Gelände der Firma Stark nicht dem CO2-Ausstoß seit 1890 gedacht werden? Nein, diese Idee passt nicht zu einer freien und offenen Gesellschaft, wie sie Karl Popper beschrieb, sie würde nur zu einer “neuen DDR” mit einem staatlich verordneten Geschichtsbild passen. Bilderstürmerei darf in einer Kulturnation keinen Platz haben, auch nicht, wenn sie – wie hier – ideologisch und baulich kaschiert wird. Auch dann nicht, wenn Provinzfunktionäre nur nachäffen, was auf der großen politischen Bühne (leider) Usus geworden ist.
Ad 1 “politische Ebene”
Die politische Ebene ist hier im Wesentlichen identisch mit der geschichtspolitischen. Dass in Bad Berleburg bei der Dekonstruktion des Denkmalensembles wohl viele einer Meinung waren in ihrer kommunalpolitischen Blase, heißt nichts. In Schilda waren sie auch einer Meinung als dort Licht in Eimern transportiert wurde. Die Liste der städtebaulichen Sünden ist in Bad Berleburg besonders lang, obwohl es immer Mehrheiten bei den jeweiligen Funktionären gab, denn die Bevölkerung selbst darf ja nichts entscheiden.
Wenn es der Kommunalpolitik wirklich um ein Friedensdenkmal gegangen wäre und nicht um die Verschandelung und Umwidmung eines historischen Monuments, so hätte ich dagegen keine Einwendungen gehabt. Der Frieden ist tatsächlich in Gefahr und es wäre aller Ehren wert gewesen, ein wirkliches Friedensdenkmal zu errichten.
Die Grüne Partei könnte ja einen Vorschlag machen, der versucht, ihre nicht ganz widerspruchsfreie Programmatik in einem harmonischen und “bunten” Entwurf umzusetzen. Dazu habe ich folgende Anregungen: Das Denkmal könnte direkt vor dem Rathaus errichtet werden. Am linken Flügel könnte eine aus nachhaltigem Recycling-Kunstoff hergestellte Regenbogenflagge wehen. In der Mitte erhebt sich ein 20-Meter-langes Windrad mit je einer ausgestopften Friedenstaube auf den fünf Rotoren. Die Rotoren sind mit den Buchstaben L, G, B, T und Q benannt. Am rechten Flügel des Denkmals steht ebenfalls ein Fahnenmast mit der ukrainischen Flagge, davor eine Siegespalme aus der Toskana. In der Mitte vor dem Windrad könnte zur Abrundung ein parteigrün gestrichener Leopard-Panzer im Maßstab 1:3 mit roter Kanone stehen. Auf ihm werden vorerst leere Platten angebracht, auf die einmal die Namen der Berleburger Friedenskämpfer eingraviert werden sollen.
Ad 2: Rechtliche Dimension
Darum sollen sich die in ausreichender Zahl vorhandenen und von der Allgemeinheit alimentierten Beamten kümmern. Diese technokratische Ebene ist nicht wirklich relevant für die Kernfragen des Themas.
Ad 4: Ästhetische Ebene
Die Glasplatten mitsamt ihrer banalen Zitate sind einfältig und verschandeln das Denkmalensemble in baulicher Hinsicht sehr. Dies ist zwar Geschmacksache, aber viele Bad Berleburger dürften ähnlich empfinden. Die Neugestaltung des Goetheplatzes insgesamt ist misslungen. Ich empfehle einfach einmal historische Plätze in Polen, Litauen, Tschechien, Italien oder (schneller machbar) einfach das Städtchen Schmallenberg zu bereisen, vielleicht fällt dann der Groschen. Die klassizistische Altstadt Bad Berleburgs hätte fürwahr kulturhistorisch und ästhetisch besser bewanderte kommunale Funktionäre verdient. Aber sei’s drum: Der Platz passt jetzt gut zur Schlangenlinien-Poststraße, dem Betonbett der Odeborn, dem Autobahnzubringer Emil-Wolf-Straße, dem „herrlichen” Sparkassengebäude, der unproportionalen Seniorenheimbebauung an der Mühlwiese, dem Bürgerhaus-Glaskasten, der Ruine des 1A-Marktes samt Parkhaus, dem “Fernmeldegebäude” am Bahnhof, der Parkplatzwüste hinter McDonald’s und zu den vielen leerstehenden Schaufenstern der Odebornstadt!
Danke für die ausführliche Stellungnahme!
– Prof. Frank Lüdke, Ev. Hochschule Tabor, Marburg:
– ZeitZeichen 2. Januar 1702: Gründung der Buttlarschen Rotte (WDR %, 2006), Link
Weitere Literatur zur Buttlarschen Rotte:
– Bauer, Eberhard: Die Buttlarsche Rotte in Saßmannshausen, in: Wittgenstein, Jg. 62 (1974), Bd. 38, Heft 4, S. 148-161
– Bauer, Eberhard: Zeitgenössische Berichte zum Prozess der Buttlarschen Rotte in Laasphe (1705), in: Jahrbuch für Westfälische Kirchengeschichte, Bd. 71/1978/
S. 167-192 [Auch als Sonderdruck erschienen]
– Bauer, Eberhard: Eine Stellungnahme August Hermann Franckes zur Buttlarschen Rotte, in: Jahrbuch für Westfälische Kirchengeschichte, Bd. 72/1979/, S. 151-152
– Hartnack, Karl: Weitere Nachrichten über die Buttlarsche Rotte, in: Das schöne Wittgenstein 1939/Nr. 4/S. 28
– Lückel, Ulf: „Freie Liebe in Wittgenstein praktiziert“ Eva von Buttlar und ihre Gesellschaft (1670-1721), In: Siegerländer Heimatkalender 81 (2006), S. 124-128
– Lückel, Ulf: Die „Sozietät“ der Eva Margaretha von Buttlar in Wittgenstein und ihr merkwürdiges Treiben, in: Jahrbuch Westfalen 2015, Westfälischer Heimatkalender – Neue
Folge 69. Jahrgang, Seiten 251-257
– Lückel, Ulf: Die Gesellschaft der Eva von Buttlar. Ein Sonderphänomen im pietistischen Zeitalter um 1700
In: Heimatland, Beilage zur Siegener Zeitung, 20.10.2018
– Müller, Hermann: Die Buttlarsche Rotte in Saßmannshausen
Das schöne Wittgenstein 1939/Nr. 3/S. 18-19
– Temme, Willi: Die Buttlarsche Rotte. Ein Forschungsbericht. in: Pietismus und Neuzeit, Bd. 16, 1990, S. 53-75, Link
Reaktion von Bündnis90/Grüne auf die gestrige Hauptausschusssitzung der Stadt Siegen:
Weitere Reaktion aus dem politischen Raum:
Pingback: Vortrag mit Musik: Orgellandschaft im Wandel – Einblicke in die Hilchenbacher Orgelgeschichte | siwiarchiv.de
Beide lokalen Tageszeitungen berichten leider nur jenseits der Bezahlschranke; allerdings wurden diese Berichte auf den Facebook-Präsenzen diskutiert:
1) Westfälische Rundschau/Westfalenpost:
2) Siegener Zeitung:
In der heutigen Printausgabe der Westfälischen Rundschau erschien der Leserbrief „Strassennamen beibehalten“ zur Umbennenung der Graf-Luckner-Straße.
Ebenfalls heute erschien dort der Beitrag „Neue Straßenschilder sind bestellt. Anwohner erhalten Infoschreiben der Stadt“, der das weitere Vorgehen skizziert.
Letztgenannter Beitrag wird auf FB auch wieder kommentiert:
In der heutigen Print-Ausgabe der Siegener Zeitung erschien der o.g. Leserbrief wortgleich (?) unter dem Titel „Vertrauen nicht verloren“.
Zwei Beiträge haben einen regionalen Bezug:
Christian Brachthäuser: Friedrich Adolph Wilhelm Diesterweg (1790–1866). Die Diskussionen um eine Reform der Schulpolitik im Kreis Siegen 1848, S. 103 – 114
Andreas Krüger: Wilhelm Friedrich Groos (1801–1874). Schmerzenskind Wittgenstein, S. 205 – 216
Pingback: Archivare aus dem Kreisgebiet VII: Hermann Engelbert (1880-1953) | siwiarchiv.de
Pingback: Archivare aus dem Kreisgebiet VII: Hermann Engelbert (1880-1953) | siwiarchiv.de
Pingback: Archivare aus dem Kreisgebiet VII: Hermann Engelbert (1880-1953) | siwiarchiv.de
Pingback: Archivare aus dem Kreisgebiet VII: Hermann Engelbert (1880-1953) | siwiarchiv.de
s. a. hier „Siegen-Wittgenstein INSIDE“ v. 12.8.2023: https://siegen-wittgenstein.1kcloud.com/ep164d9e81537f31/#12
Die Siegener Zeitung hat nicht nur Hermann Engelbert, sondern auch dem Verlagsleiter der Siegener Volkszeitung und Sozialdemokraten Gustav Vitt (1895-1960), der nach dem Überfall am 2. Mai 1933 auf das Haus der Gewerkschaft durch die SA-Sturmtruppe unter SA-Führer R. Odenthal arbeitlos wurde, geholfen. Vom 1. April 1935 bis Ende August 1945 war er in verschiedenen Funktionen für die SZ tätig. Während der Zeit litt er an den Folgen der Misshandlung durch die SA und die Inhaftierung und war dadurch fortwährend in ärztlicher ambulanter und wiederholter stationärer Behandlung (Nervenkliniken).Nach dem Krieg baute er seine selbständige Tätigkeit (Vertrieb von Karten, Drucksachen, Büropapieren) aus. Er war Stadtverordneter der SPD in Siegen und führte verschiedene Ehrenämter. Er starb an einem Herzinfarkt und den infolge seiner Mißhandlung und politischen Verfolgung entstandenen Gesundheitsschäden.
s. a. https://www.compgen.de/2023/09/hunderttausende-entnazifizierungakten-aus-dem-landesarchiv-nrw-online/
In der heutigen Print-Ausgabe der Siegener Zeitung erschien zudem der Leserbrief „Alleinstellungsmerkmal“, der bezüglich der Umbebennung der Porschestraße weitere Maßnahmen zur Tilgung des Namen Porsche aus dem Siegener Stadtbild forderte (Umbenennung der Werksvertretung, Fahrverbot für Autos der Firma). Weniger ironisch als vielmehr albern ….. m. E.
Neben dem o.g. Bestand NW 1127
sind für das Kreisgebiet noch die Bestände
NW 1090 und NW 1128 interessant, da sie einige
Akten zu Personen aus der Region Siegen / Wittgenstein enthalten.
Danke für die wichtige Ergänzung!
Pingback: Umleitung: Germany is staring at the end of its economic model und mehr… – zoom
auch nett die Geschichte welche immer wieder rund um diesen Besuch von Willy Brandt aufklappt (ob wahr oder nicht, aber glaubhaft ist sie schon!): Als Willy Brandt seine Rede hielt soll ein Postbote mit einem Telegramm den Raum betreten haben:“Ist hier ein Willy Brandt?“. Dieser habe sich sofort gemeldet und ein Telegramm in Empfang genommen. Dieses solle von Prinz Botho gewesen sein, mit dem kurzen Text: „Störe meine Kreise nicht“ :-) Alles nicht belegt, jedoch würde es zu Bothos Humor passen…..
Danke für die Anekdote! Ob sich das Telegramm im Nachlass Willy Brandts – oder Bothos zu Sayn- Wittgenstein-Hohensteins – befindet – wäre doch zu schön, wenn dies stimmt.
Pingback: Frauen im goldenen Buch des Kreises Siegen-Wittgenstein | siwiarchiv.de
Bekanntmachung der Stadt Siegen zur Umbenennung der Straßen v. 28.8.2023: https://www.siegen.de/fileadmin/cms/pdf/VerwaltungUndPolitik/Bekanntmachungen/BekanntmachungStrassenumbenennungen.pdf .
Mediale Reaktionen auf die Bekanntmachungen:
1) Westfälische Rundschau, 7.9.2023:
2) 9.9.2023 Siegener Zeitung:
Politische Reaktion auf die Umbenennung:
Zu Hermann Engelbert sind im Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen, eine Personalakte und eine Wiedergutmachungsakte (zusammen mit seiner Ehefrau) vorhanden. Die Akten tragen folgende Signaturen:
• R 001/Personalakten, Nr. 782
• K 104/Regierung Arnsberg, Wiedergutmachungen, Nr. 26918
Pingback: Quellenkundliches Falschspiel der Hiko Westfalen – Archivalia
Pingback: Gespräch über historischen Reisebericht – „Pilgerreise“ von Christian Stahlschmidt (1740-1826) | siwiarchiv.de
Archivalia suchte nach einer Definition des Begriffs „Kuxenmarkt“. Eine Erklärung fand sich in in Peter Schaals Buch „Geldtheorie und Geldpolitik“, München/Wien 1998, S. 191:
Heute erschien in der Westfälischen Rundschau (Print) ein Leserbrief, der die politischen Umstände der Umbenennung der Graf-Luckner-Str. in Edith-Langner-Str. kritisch hinterfragt.
Heute erschien in der Siegener Zeitung folgender Artikel samt Kommentar zur Umbenennung der Graf-Luckner-Str. in Edith-Langner-Str.:


Auf der FB-Seite der Zeitung beginnt erwartungsgemäß eine Diskussion:
Heute erschienen in der Siegener Zeitung (Print) 2 Leserbriefe:
1) „Mit Porsche nichts zu tun“ verweist darauf, dass die Porsche-Strasse nach Ferdinand Porsche benannt worden war und der Grund für die Umbenennung dessen Verstrickung in das NS-System war. Die Firma Porsche sei erst 1948 von dessen Sohn gegründet worden, so dass die gerade in den sozialen Medien geforderte Umbenennung der Siegener Niederlassung des Fahrzeugherstellers sowie ein Fahrverbot für dessen Fahrzeuge jeglicher Grundlage entbehre.
2) „Gutsherrenart“ wird der Stadt Siegen im zweiten Leserbrief bei der Umbenennung der Graf-Luckner-Str. attestiert.
Die Verlinkung zur Mailadresse ist offenbar fehlerhaft. Hier die korrekte Mailadresse: Friedhelm_Ziegler@t-online.de. Weitere Kontaktdaten sind postalisch an Friedhelm Ziegler, Hauptstr. 27, 57250 Netphen-Unglinghausen oder telefonisch unter 02732-25117.
Danke für die Korrektur!
Heute erschien in der Siegener Zeitung der Leserbrief „Wie viel NS ist erlaubt?“ zur Edith-Langner-Str.: “ ….Was auch zu hinterfragen ist. ist die Tatsache, dass die Anwohner die Mitgliedschaft von Edith Langner in der NSDAP herausgefunden haben. Da hätte ich mir gewünscht, dass die Profis der Siegener Zeitung eine Recherche angestellt und darüber berichtet hätten. Dafür sind doch Journalisten eigentlich da.“
Anm.: 1) siwiarchiv hat bereits am 17. Mai 2022 auf das Vorhandensein einer Entnazifizierungsbogens im Siegener Stadtarchiv hingewiesen (Link). Dieser konnte über das NRW-Archivportal problemlos ermittelt werden.
2) Eine Mitgliedschaft Langners in der NSDAP ist bisher noch nicht nachvollziehbar belegt worden. Dem steht eine Auskunft des Berliner Document Centers aus dem Jahr 1973 entgegen, die im Rahmen des Ordensverfahrens routinemäßig eingeholt wurde. Es wurde damals keine Mitgliedschaft Langners nachgewiesen.
3) Für den am 20.9. erschienenen Artikel der SZ (s.o.) hat der Journalist die dem Kreisarchiv vorliegenden Scans bzw. Digitalbilder der Ordensakte und der Entnazifizierungsakte des Landesarchivs NRW sowie den Entnazifizierungsbogen des Stadtarchivs eingesehen.
Danke Archivar! Es ist schon erstaunlich, wie die „Luckner-Straße-Aktivisten“ mit aller Gewalt aus Edith Langner eine „Narzisse“ versuchen zu machen. Und das wider (potentiell) besseres Wissen. Am 14. / 15. September habe ich den hier veröffentlichten wissenschaftlichen Kenntnisstand einer der AktivistInnen in einem Mail-Austausch mit entsprechenden Links mitgeteilt.
Pingback: Stadtarchiv Olpe – ein Sachstandsbericht mit Happy End (?) | siwiarchiv.de
Der Autor Weber fordert in seiner Bachelorarbeit einen reflektierteren Gebrauch der deutschen Sprache, ist aber selbst nicht korrekt in den Begriffen („Bildarchiv des Bundestags“). Ist zwar eine Kleinigkeit, stört aber und verringert den Eindruck von Seriösität.
Auszug aus der Niederschrift der 19. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Siegen am 23.08.2023 (S. 5-6), in der unter TOP 6 die Straßenumbenennungen (Vorlage Nr. VL 1361/2023) final beraten und beschlossen wurden:
„Herr Schiltz blickt zurück auf die jahrelangen und kontroversen Diskussionen, die nunmehr mit der Entscheidung über die Umbenennung einiger Straße nach Personen, die durch antisemitische und nationalsozialistische Gesinnung aufgefallen sind und daher einer Ehrung nicht würdig sind, beendet werden können. Bei der Neubenennung hat die SPD-Fraktion zwei Kriterien zugrunde gelegt; mehr verdiente Frauen in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken und einen klaren Bezug zu Siegen zu geben. Mit dem Vorschlag „Europastraße“ sollen die Verbindung und die Vorteile von Europa für die Bürgerinnen und Bürger in Erinnerung gerufen werden. Er dankt den Mitgliedern des Arbeitskreises, die sich intensiv mit der Geschichte der in Rede stehenden Personen befasst und die Grundlagen für die Beschlussfassung geschaffen haben.
Herr Groß ergänzt und stellt die Methode des Arbeitskreises, sich quasi wissenschaftlich den Fragen zu nähern, als die richtige heraus. Bedenklich war und ist für ihn der Umgang mit dem Thema in den sozialen Medien, das von einigen Zeitgenossen als unnötig und Zeitvertreib abqualifiziert wurde. Er sieht es als Aufgabe der Politik, sich auch mit solchen Themen auseinander zu setzen.
Seine Fraktion hat sich gegen die Umbenennung ausgesprochen, so Herr Steffe. Die Bürgerinnen und Bürger sind nicht alle mit der Vorgehensweise einverstanden und haben sich vielmehr in der Graf-Luckner-Straße und der Diemstraße für eine Umwidmung ausgesprochen. Diesem Wunsch sollte der Ausschuss folgen.
Die Hintergründe für die Änderungen sind nach Aussage von Herrn Rompf hinlänglich bekannt und von allen Seiten beleuchtet worden. Die CDU-Fraktion möchte nunmehr diesen Vorgang abschließen.
Beschluss:
Der Haupt- und Finanzausschuss des Rates der Stadt Siegen beschließt folgende Straßen um-
zubenennen:
1. “Bergfriederstraße“ in “Auf dem Heuper“
2. “Hindenburgstraße“ in “Europastraße“
3. der Name “Hindenburgbrücke“ wird ersatzlos eingezogen und sie ist nur noch eine Brücke
innerhalb der Straße mit dem neuen Namen
4. “Lothar-Irle-Straße“ in “Am Breitenbach“
5. “Porschestraße“ in “Charlotte-Petersen-Straße“
6. “Diemstraße“ in “Margarete-Lenz-Straße“
Beratungsergebnis: 16 Stimmen dafür, 1 dagegen (AfD-TD), 0 Enthaltungen“
Pingback: Archivarstelle in Olpe soll nicht wegfallen – Archivalia
Heute erschienen in der Siegener Zeitung 2 Leserbriefe zur Edith-Langner-Straße, „Bürgerferne statt -nähe“ und „Eine Beleidigung“. Beide äußern sich und bewerten das politische Verfahren kritisch. Aus Letzterem sei die Bewertung der Biographie Langners zitiert: “ …. Nun stellt sich heraus dass diese Frau Mitglied der Deutschen Frauenschaft war, eine der Eliteorganisationen unter den NS-Frauenorganisationen. Im Jahr 1944 war sie dieser Naziorganisation beigetreten, als ein großer Teil der deutschen Bevölkerung schon wusste, was für ein brutales und menschenverachtendes System die Naziherrschaft war. Jetzt den Namen dieser Frau an unsere Straße zu heften, halten wir für eine Beleidigung“
Anm.: Langner gehörte eigenen Angaben zufolge seit Sommer 1944 dem Deutschen Frauenwerk (!) an. Soviel Präzision muss schon sein.
Präzision gehört nun mal nicht zu den Kompetenzen derer, die es gewohnt sind, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Der eigentliche Skandal hingegen ist die Politik jener „Heimatzeitung“, die nach wie vor wider besseren Wissens Leserbriefe der selbst ernannten Nazi-Jäger druckt, obwohl der Redaktion mindestens eine gegenteilige, den Sachverhalt richtig stellende Zuschrift vorliegt. Hier wird mit den Mitteln der bewussten Desinformation eindeutige Stimmungsmache betrieben.
Heute erschien der oben angekündigte Leserbrief „Recherche zielführender“ in dier Siegener Zeitung, der die emotionale Diskussion um die Person Edith Langner mit Hinweis auf die hier publizierten Recherchergebnisse versachlicht sehen will.
Lieber Herr Burwitz, leider tragen auch Sie zur Stimmungsmache bei und auch bei Ihrer Bewertung der Angelegenheit mangelt es an Präzision. Es wird der Vorgang der Umbenennung der Graf-Luckner-Straße kritisiert. Dieser erfolgte im Gegensatz zum Vorgehen bei anderen umbenannten Straßen ohne Einbeziehung der Anwohner und ohne vorherige Prüfung der Person Frau Langner. Genau dies wurde von der Fraktion Volt – wie im Protokoll der Ratssitzung nachzulesen – gefordert. Zum Beispiel ist es auch üblich, dass die Familie der Person befragt wird. Dies ist nicht erfolgt. Falls nun in einigen Jahren neue Dokumente auftauchen, weil nicht gründlich genug recherchiert wurde, dann steht die Straße vor einer erneuten Umbenennung. Und wie sehr leicht nachzulesen, ist im Abschlussbericht des
Arbeitskreises Aufarbeitung der historischen Hintergründe von Straßennamen des Rates der Stadt Siegen die Mitgliedschaft in einer NS Organisationen (und das deutsche Frauenwerk gehörte zweifelsohne dazu ) ein wichtiges Kriterium zur Umbenennung einer Straße!
Schade, dass keiner jetzt den Mut hat, die Fehler zu korrigieren. Nochmal: es geht nicht nur um die Personalie Edith Langner, sondern auch um die Art und Weise, wie von Seiten der Stadt mit den Anwohnern umgegangen wurde!
Als Autor des dieser Diskussion zugrunde liegenden Eintrages verweise ich darauf, dass seit dem 27. Juni 2022 bekannt war, dass das Berliner Bundesarchiv in seinen einschlägigen Unterlagen zur NS-Zeit keine Hinweise auf Edith Langner hat. Im Originaleintrag finden sich zudem die Hinweise auf den Entnazifizierungsbogen in den Beständen des Stadtarchivs Siegen sowie auf die „Ordensakte“ im Duisburger Landesarchiv. Die Auswertung dieser Archivalien erfolgte hier am 10. Mai 2023.
Bei der Bewertung des politischen Verfahrens sind wir zwar nicht so weit auseinander; aber dem Rat der Stadt Siegen steht es zu, eine Entscheidung selbst zu fällen.
Schließlich empfehle ich noch einmal die im Abschlussbericht des „Strassennamenarbeitkreises“ gemachten Bewertungskriterien mit den konkreten Entscheidungen abzugleichen. Für mich jedenfalls ist das Ergebnis klar: Edith Langner gilt als unbelastet – unter Vorbehalt, dass keine neuen Quellen erschlossen werden. Dies jedoch gilt für alle Personennamen der Kategprien B und C des Abschlussberichtes.
Ich habe lange mit mir gerungen, ob es überhaupt angemessen ist, auf die die Anwürfe eines Anonymus („ein Anwohner“) an mich persönlich zu antworten. Ich halte diese Form der Auseinandsersetzung für nichts weniger als eine Unverschämtheit! Aber da Stillschweigen als Einvernehmen mit dem Schreiber gewertet würde, hier nur so viel: Ich schließe mich inhaltlich voll und ganz den vorstehenden Ausführungen von „Archivar“ an. Im Kern ging es mir darum aufzudecken, wie die Anwohner mit der „Personalie Edith Langner“ durch falsche Interpretation von Fakten versucht haben, Geschichte zu instrumentalisieren.
Die Reaktion auf die Entwicklung in Olpe auf dem Deutschen Archivtag in Bielefeld:
s. a. Westfalenpost (Kreis Olpe), 29.9.2023, Link
Zu Hedwig Heinzerling gibt es hier weitere Informationen: https://www.siwiarchiv.de/100-jahre-frauenwahlrecht-hedwig-heinzerling/ und zu Landrat Josef Büttner hier: https://www.siwiarchiv.de/siwiarchiv-adventskalender-201617/
Pingback: Unterlagen zur regionalen Zeitgeschichte online recherchierbar | siwiarchiv.de
Irle versuchte sich beständig als Dichter – s. folgende Beispiele:
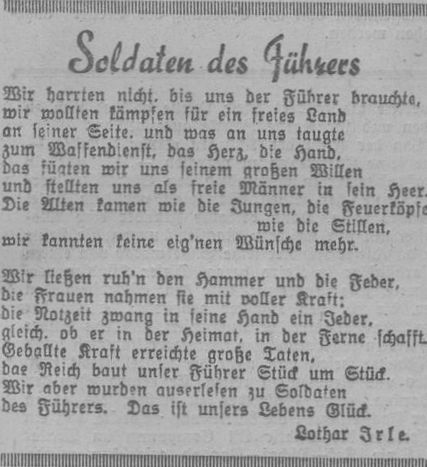
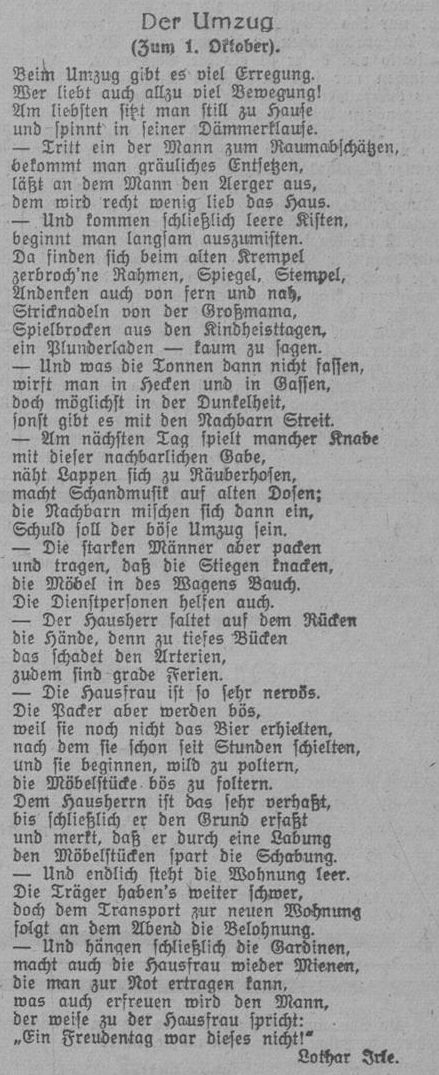
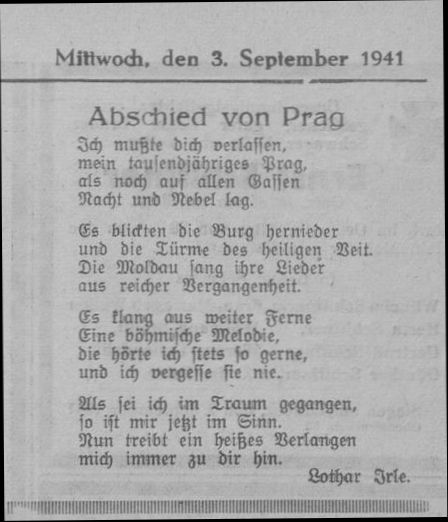
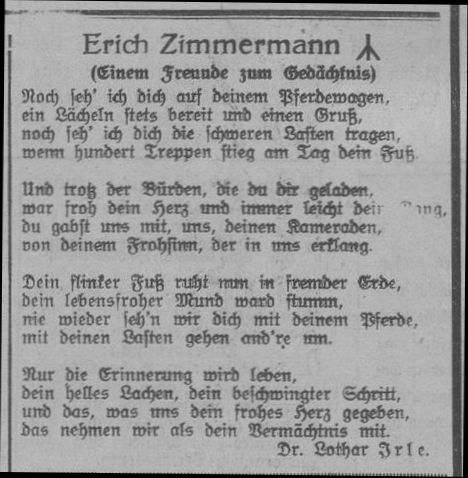
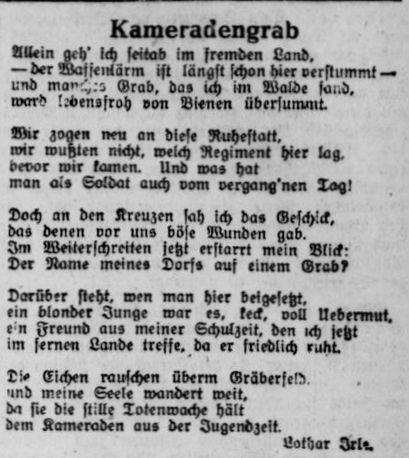
National-Zeitung, Siegener Ausgabe, 11. Januar 1940:
National-Zeitung, Siegener Ausgabe, 1. Oktober 1940:
National-Zeitung, Siegener Ausgabe, 3. September 1941; Wittgensteiner Ausgabe, 4. September 1941:
National-Zeitung, Siegener Ausgabe, 28. März 1942:
National-Zeitung, Wittgensteiner Ausgabe, 6. August 1942:
Pingback: Film: „Siegerland zwischen Gegenwart und Zukunft“ | siwiarchiv.de
Eine löbliche Ausstellung! Zur Ergänzung dieses Blogeintrags und des umfangreichen Berichts in der Siegener Zeitung von morgen ein Link auf die seit Jahren bestehende Seite der VVN:
http://zwangsarbeit-im-siegerland.de/
Danke für den wichtigen Link! Ist zwar auf siwiarchiv vorgestellt worden, aber hier leider versäumt worden einzupflegen.
Pingback: Ausstellung: „Archiv der Sorgen“ | siwiarchiv.de
In dem heutigen Artikel „Denkmäler für Arbeiterinnen. Frauen und ihre Leistungen sollen sichtbarer werden im Siegener Stadtbild“ in der Westfälischen Rundschau erwähnt am Rande auch die von den Anwohner:innen kritisierte Benennung der Edith-Langner Straße.
Pingback: Video-Trailer zur Ausstellung: Trailer ‚Verschleppt. Ausgebeutet. Vergessen? Zwangsarbeit im Siegerland“ | siwiarchiv.de
Zitat aus Christian Brachthäuser:Ein „Schöpfungsakt von säkularer Bedeutung“ Zur wechselhaften Gründungsgeschichte der Gesamthochschule Siegen, Link:
„….. Schließlich wäre die Auflösung der PH-Abteilung Siegerland auch in erst einigen Jahren ein „
[…] bildungspolitischer Rückschritt, verbunden mit einer Fehlinvestition größten Ausmaßes“, wie es die CDU-Landtagsabgeordnete Edith Langner formulierte. ….“ Als Quelle für diese Äußerung wird dort die Westfalenpost Nr. 277 vom 1. Dezember 1969 angegeben.
Dies Buch gibt es in Neuauflage 2022:
https://www.beck-shop.de/ehlers-wieser-friedrich-sammeln-archivieren-auswerten-leitfaden-vereinsarchive-festschriften-jubilaeumsausstellungen-/product/33664082
Sehr gut geeignet.
Danke für den Vortrag!
Danke fürs Kommen und für den Hinweis, den ich schon eingearbeitet habe!
Weiterer Nachruf auf Archivalia: https://archivalia.hypotheses.org/184429
Pingback: Edith Langner – 2 biographische Quellen | siwiarchiv.de
Eine Seite im oberen Dokument ist doppelt (Fragen 95-106), die Folgeseite fehlt.
Danke für den Hinweis! Mein Versehen. Ich tausche die PDF, sobald es mir möglich ist, aus. M.E. waren die fehlenden Fragen im Hinblick auf die Biographie Langners in der NS-Zeit nicht sehr aussagekräftig.
[Nachtrag 26.10: Austausch ist erfolgt]
Pingback: Edith Langner, die „Nazi-Ideologin“(?), oder: | siwiarchiv.de
Pingback: #SIEistSIEGEN zur abschließenden Beratung in den Stadtrat | siwiarchiv.de
Zur Vorberichterstattung in der Siegener Zeitung am 25.10.2023 erschien folgender Kommentar:
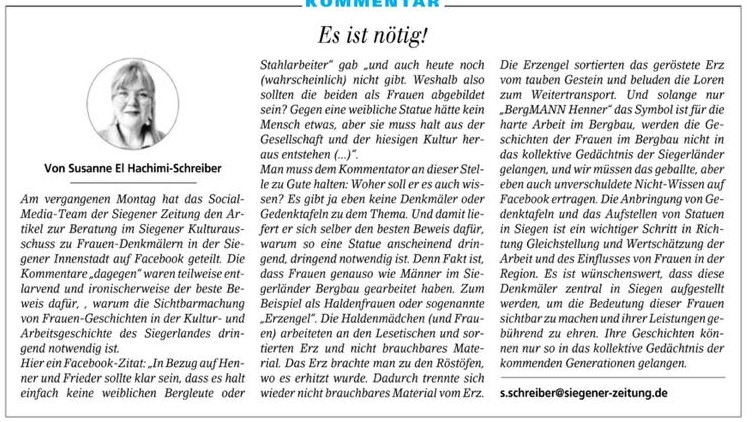
Das Abstimmungsergebnis im gestrigen Kulturausschuss lautet:
Punkt 1 des Antrags (Gedenktafeln) wurde gegen die Stimmen der AfD zugestimmt.
Punkt 2 des Antrags wurde mit den Stimmen von CDU und SPD abgelehnt.
Punkt 3 des Antrags „Die Verwaltung möge eine Auftaktveranstaltung für die Ehrung von Frauen im Stadtbild Siegens aus Anlass des Stadtjubiläums 2024 planen, in der Frauen, die aktuell oder in der jüngeren Vergangenheit prägend für Siegen waren, zu Wort kommen (z.B. Silvia Neid, Anna Heupel, Annemarie Carpendale o.Ä.). Eine Podiumsdiskussion wird angeregt.“ Diesem Änderungsantrag der VOLT wurde gegen die Stimmen der AfD zugestimmt.
Pingback: „Siegen800“: Eine Stadt feiert sich und ihre Geschichte | siwiarchiv.de
Kommentar „Siegens schwarz-rote Kulturpolitiker haben es nicht verstanden.“ in der Siegener Zeitung (27.102023) von Susanne El Hachimi-Schreiber zur Abstimmung im Siegener Kulturausschuss:
„Eine GroKo aus SPD- und CDU-Mitgliedern im Kulturausschuss hat gestern den Vorschlag der Stadtverwaltung abgelehnt, ein Denkmal für die hart arbeitenden Frauen der Siegerländer Kulturgeschichte zu errichten. Die Kulturredakteurin der SZ, Susanne El Hachimi-Schreiber, ist fassungslos angesichts eines solchen Mangels an Verständnis.
„Sie haben es nicht verstanden…“ Nicht nur die Kulturamtsleiterin Astrid Schneider war fassungslos, nachdem der Beschlussvorschlag zur Prüfung der Voraussetzungen zur Schaffung eines stadtbildprägenden Denkmals zur Ehrung arbeitender Frauen durch die Stimmen von SPD und CDU abgelehnt wurde.
Man muss es Kulturdezernent Arne Fries und Astrid Schneider zugutehalten – sie haben wirklich versucht, den Mitgliedern des Kulturausschusses zu erklären, welche Chance ein stadtbildprägendes Denkmal zur Ehrung einer Gruppe von Frauen beinhaltet. Aber die Mitglieder der SPD und CDU haben es trotzdem nicht verstanden:
Traute Fries (SPD): „Eine Statue oder Skulptur ist nicht zeitgemäß.“ Die Stadt hatte in der Vorlage dargelegt, dass sowohl die Leitung des Siegerlandmuseums als auch des Museums für Gegenwartskunst involviert sind. Aber was verstehen sie schon von zeitgenössischer Kunst? Fries findet eine Fotoausstellung versteckt im Rathaus oder ein weiterer Bildband zu Frauen-Biografien zeitgemäßer. Auf die Frage, inwiefern Fotoausstellungen oder Bildbände das Stadtbild prägen, gab es als Antwort: „Dann müssen die Leute halt mal ins Rathaus oder in die Volkshochschule gehen.“ Nicht verstanden.
Ausschussvorsitzende Sybille Schwarz (SPD): „Die Statuen von Henner und Frieder stellen keine Männer dar, sondern stehen symbolisch/exemplarisch für den Bergbau und die Hüttenindustrie.“ Ja, genau das ist das Problem: Männer stehen symbolisch für eine ganze Gesellschaft. Außerdem: „Die Tätigkeiten, die mit der Darstellung eines Erzengels oder einer Haubergsbäuerin dargestellt würden, waren Hilfstätigkeiten und keine wirklichen Berufe.“
Diese Bewertung der Tätigkeiten von Haldenfrauen oder auch Haubergsbäuerinnen nicht als echte oder vollwertige Berufe zu begreifen und sie deshalb für nicht darstellenswert zu erachten, ist gelinde gesagt schwierig. Natürlich waren Frauen nicht in leitenden Positionen im Bergbau oder Hüttenwesen beschäftigt. Natürlich wurden typische Frauenarbeiten, so wie heute, gering geschätzt.
Aber umso mehr ist so eine Skulptur eine Chance, auch darauf hinzuweisen. Denn genau dieses Problem haben wir heute noch: Tätigkeiten, die hochgradig gesellschaftsrelevant sind und traditionell weiblich, wie zum Beispiel Care-Arbeit, werden nicht als Berufe anerkannt. Nicht verstanden.
Wirklich sprachlos machte jedoch die Begründung von Isabelle Cathrin Schmidt (CDU): „Eine oder sogar zwei Frauenskulpturen einfach nur als „GEGENstatue“ zu Henner und Frieder zu erstellen, weil es Männer sind, das finden wir nicht richtig.“ Da wird es dann wirklich gefährlich.
Denn diese Begründung trägt den Gedanken in sich, dass Bestrebungen zur gesellschaftlichen Gleichstellung von Frauen sich GEGEN Männer richten würden. Gedankengut, das man an Stammtischen oder, wie es heute heißt, auf „Facebook“ findet. Nicht verstanden.
Es bleibt die Hoffnung auf den Haupt- und Finanzausschuss im November. Dort sitzen andere Vertreter der SPD und CDU – vielleicht haben sie es ja verstanden.“
Link
Leserinnen-Brief von Helga Dellori an die SZ-Redaktion zum SZ-Artikel „Schwarz-Rot blockiert stadtbildprägendes Arbeiterinnen-Denkmal“ und Kommentar vom Sa 28.10.2023 und zum Kommentar (s.o.)„Siegens schwarz-rote Kulturpolitiker haben es nicht verstanden:“ von Susanne El Hachimi-Schreiber
„Die mehrfache Bewertung im Kommentar von Frau El Hachimi-Schreiber …nicht verstanden zur Diskussion und Votum im Kulturausschuss halte ich für völlig unangemessen, insbesondere mit dem Tenor, dass Frauen eine ablehnende Meinung zur Frage des Denkmals eingenommen haben.
Wieso sollten Frauen kraft Geschlecht einheitliche Positionen zu einem Sachverhalt einnehmen, bei einer gesellschaftlichen Bandbreite die aktuell mal mindestens von Sahra Wagenknecht bis Frau Weidel, Frau von Stosch, Frau Eger-Kahleis. reicht. Das ist doch völlig absurd. Allem Anschein nach versucht Frau El Hachimi-Schreiber über ihre berufliche Tätigkeit Einfluss zu nehmen.
Der Bürgerinnenantrag aus 2020, der Pressetermin im September bis hin zum aktuellen Artikel verfolgt das Ziel – die Haube und die Haubergsfrauen als Symbol in Form einer Skulptur für die gesellschaftliche Leistung von Frauen zum Stadtjubiläum sichtbar zu machen. Dazu trat Heinz-Dieter
Sassenberg im Pressetermin auf, der in epischer Breite den versammelten Frauen die Welt der schweren Frauenarbeit, insbesondere im Haus, der Landwirtschaft und im Hauberg meinte erklären zu müssen.
Die Würdigung der gesellschaftlichen Leistung von Frauen, der bezahlten und der unbezahlten, verdient sichtbar zu werden im öffentlichen Raum der Stadt Siegen; allerdings zeitgemäß, die Haube, Haubergsfrau, in Demutshaltung sind dafür ungeeignet. Der aktuelle Beitrag zur Blüte der Textilindustrie mit vielen Frauen in Heimarbeit zeigt – „der Stoff war wichtiger als das Erz“. (Dr. Bartolosch, SZ 28.10.2023), im Verlauf der Geschichte.
Der Vorschlag von Astrid Schneider, die m.E. sehr gut die Meinungsvielfalt und eine mögliche praktische Umsetzung in der Verwaltungsvorlage aufgezeigt hat, verdient mehr Diskussion. Und Frau El Hachimi-Schreiber wer so einseitig und selbstgerecht agiert und schreibt, sollte doch wenigstens
die Fakten richtig erwähnen. So wird in der 2. Spaltes des o.g. Artikels Astrid Schneider zu Astrid Schmidt und die Wiedergabe des Beitrags von Traute Fries aus dem Kulturausschuss ist schlicht und ergreifend falsch. In dem mir vorliegenden Wortbeitrag von Traute Fries wird kein Bildband und keine Ausstellung zu Frauen aus der NS-Zeit vorgeschlagen.
Mein Fazit: Frau El Hachimi-Schreiber, Aufgabe sorgfältige Journalistin … nicht verstanden.
Als Initiatorin der Gewerkschafts-Frauen für Waltraud Steinhauer halte ich fest, dass es kein Votum für oder gegen eine Skulptur o.ä. gibt. Für unseren Vorschlag Waltraud Steinhauer haben wir als geeignetes Medium für eine Tafel mit Foto und biografischen Daten votiert und freuen uns, dass dies breite Zustimmung findet und zum Stadtjubiläum 800 Jahre Stadt Siegen realisiert wird.“
Dank gilt Frau Dellori für die Bereitschaft den bisher unveröffentlichen Leserinnenbrief hier auf siwiarchiv einstellen zu dürfen!
Pingback: Kommunalarchive im Kreis Siegen-Wittgenstein derzeit nicht erreichbar – Archivalia
Pingback: Filmsammlung Siegfried Vetter im Filmarchiv des LWL-Medienzentrums | siwiarchiv.de
Pingback: Gedenkstunde am Platz der Synagoge in Siegen | siwiarchiv.de
Um welche Uhrzeit beginnt die Gedenkstunde?
Herzliche Grüße
Karl-Heinz Richter
Danke für den Hinweis. Eintra gist ergänzt.
Pingback: Literaturhinweis: Peter Vitt: „Über die Zeiten hinweg – | siwiarchiv.de
Gestern erschienen in der Westfälischen Rundschau 2 Leserbriefe zur Kulturausschusssitzung – „Chance vertan“ widmet sich dem Sitzungsverlauf, der zweite Leserbrief schlägt vor den „Herrengarten um[zu]benennen“: in „Herren-Damen-Garten“.
Heuten erschienen die beiden schon in der Westfaälischen Rundschau veröffentlichten Leserbriefe auch in der Siegener Zeitung. Zusätzlich erschien noch der Leserbrief „Brauche kein Denkmal“, der das Denkmal als Quotendenkmal kritisiert.
Pubilkation liegt auch als PDF vor: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:6:2-1785567
Publikation liegt auch als PDF vor.
Tagungspublikation liegt als PDF vor.
Publikation liegt als PDF vor.
„Schreiben bis zum gewünschten Ergebnis – Diplomatisches Protokoll oder Sitzungsmitschrift – sie sind gar nicht so verschieden, sagt Medienwissenschaftler Peter Plener, sondern Ergebnis eines vorherigen Aushandlungsprozesses. Wahrheiten enthält ein Protokoll aber nur bedingt.“ aus dem Podcast „Lesart“ (Deutschlandfunk, 4.11.23) – Link
Pingback: ARD Retro in der Audiothek: Archivschätze aller ARD-Medienhäuser online verfügbar | siwiarchiv.de
Pingback: Siegener Heimat-Preis verliehen: Preisträger rekonstruierte Siegener Synagoge als Modellbau | siwiarchiv.de
Zur telefonischen Erreichbarkeit des Stadtarchivs Hilchenbach s.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0GHAUiAGF1dkU5vcL3mYzkYpFes9TiwxRXk11N6urX4zEAghdCsBskiD7nT1zbEmtl&id=100064773786823
Das Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein ist ab heute wieder telefonisch unter den bekannten Rufnummern erreichbar.
Pingback: Der Bestand „Evangelischer Brüderverein“ ist nun als Findbuch online verfügbar | blog.archiv.ekir.de
Pingback: 230-jähriges Geburtstagsjubiläum: Karl August Groos | blog.archiv.ekir.de
Pingback: Vortrag „Lidija -Das Schicksal einer Zwangsarbeiterin“ | siwiarchiv.de
Pingback: Ausstellung „Ein Leben für die Kunst“ | siwiarchiv.de
Das Stadtarchiv Bad Berleburg ist nun wieder telefonisch zu erreichen.
Das Stadtarchiv bad Berleburg ist wieder unter der normalen E-Mailadresse ( s. Menüpunkt „Archive“ erreichbar.
Das Stadtarchiv Siegen ist zwecks telefonischer Terminvereinbarung für einen angestrebten Archivbesuch ab sofort unter der Festnetz-Nummer 0271 / 404-3095 und per Email unter stadtarchiv@siegen-stadt.de erreichbar! Allerdings ist die Benutzung nach wie vor mit Einschränkungen verbunden, da der Zugriff zur Archivdatenbank und zum Katalog der wissenschaftlichen Bibliothek zur Regionalgeschichte zurzeit noch nicht möglich ist. Das Stadtarchiv empfiehlt in regelmäßigen Abständen die Notfall-Homepage der Stadtverwaltung (www.siegen-stadt.de) aufzurufen, um sich über Neuigkeiten und eventuelle Anpassungen der Archivbenutzung zu informieren.
Pingback: Video: Der Westfälische Frieden – | siwiarchiv.de
Pingback: Video: Der Westfälische Frieden – Archivalia
Pingback: Ausstellung „Zeichnung im Labor“ im Wallraf-Richartz-Museum in Köln | siwiarchiv.de
Das Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein ist infolge der Cyberattacke vorübergehend unter folgender Emailadreese erreichbar: archiv@kreissiwi.de
Das Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein ist wieder unter der E-Mail-Adresse t.wolf@siegen-wittgenstein.de zu erreichen.
Der Haupt- und Finanzausschuss hat das Denkmal knapp abgelehnt (auf jeden Fall mit Stimmen der CDU und SPD). [Anm. v. 21.11.23: Folgendes Abstimmungsergebnis ist siwiarchiv gegnüber übermittelt worden: 8 ja, 8 nein, 1 Enthaltung durch den Bürgermeister]
Die Redakteurin der Siegener Zeitung hat mich in ihrem Bericht vom 28.10.2023 falsch zitiert. Ich habe keinen Bildband und keine Fotoausstellung im Siegener Rathaus zu konkreten Frauenbiografien aus der NS-Zeit vorgeschlagen. Die SZ hat die Richtigstellung verweigert! Daher der Wortlaut meines Beitrags, den ich im Kulturausschuss vorgelesen habe.
Frauen in der Arbeitswelt – Pendant zu Henner Frieder
Die Siegerländer Symbolfiguren von Prof. Friedrich Reusch, wurden 1902 auf der Industrie-ausstellung in Düsseldorf ausgestellt und später auf die Siegbrücke, gestellt. Sie sollten m. E. auf die beiden Berufe beschränkt bleiben. Die Figuren können in gewissem Maß als patriarchalisch angesehen werden. Eine Frauengestalt in Bronze wäre nicht zeitgemäß.
Ich halte die Darstellung auf Fotos für passend.
Erzengel und Haubergsfrauen haben jeweils in Gemeinschaft gewirkt und sollten mittels vorhandener historischer Fotografien dargestellt werden. Fotos von den Haubergsfrauen sind in dem Bildband von Otto Arnold „Siegerländer Arbeitswelt“ von 1985 reichlich vorhanden. Ebenso ein Foto der Erzengel sowie Frauen in der Leimherstellung und beim Spinnen.
Horst Günter Koch gibt im Buch „Erzväter“ (1982) die Erzengel am Leseband auf einem sehr anschaulichen Foto wieder (S. 221), ebenso die Übertagebelegschaft 1906 mit Mädchen u. Jungen, Frauen und Männern vor Röstöfen der Grube „Henriette“ in Niederschelden (S. 83).
Auf dem Foto in „Bevor die Lichter erloschen“ von H.G. Koch ist die Belegschaft der Grube „Apfelbaumer Zug“ von 1908 ebenfalls mit Mädchen, Jungen, Frauen und Männern zu sehen.
Beim Blättern im Buch von H. G. Koch „Feuer u. Eisen“ von 1970 fand ich das Foto von der bundesweit einzigen Hochöfnerin Gertrud Siebel, die 1946 bei der Birlenbacher Hütte zu-nächst als Kauffrau im Einkauf u. Lohnbüro arbeitete. Sie wurde von Dr. Marenbach angelernt, die Möllerung/Beschickung des Hochofens für die Roheisen-Sorten zu steuern. Das hat sie über Jahrzehnte mit großer Leidenschaft gemacht. An sie könnte ebenfalls erinnert werden.
Es war nicht die Masse der Frauen, die in der Siegerländer Schwerindustrie arbeitete. Ich erinnere mich noch an Kolleginnen bei den Stahlwerken, die wegen des Krieges als Kranführerinnen tätig waren, z. B. Anneliese Hahmann und Ilse Kessler. Die meisten Frauen waren in kaufmännischen, technischen, erzieherischen/schulischen, pflegerischen, landwirtschaftlichen und handwerklichen Berufen tätig. Nicht vergessen werden darf die Arbeit der Mütter und Hausfrauen. Sie waren teilweise zusätzlich im Hauberg und der Landwirtschaft tätig.
Mir persönlich wäre es auch ein Anliegen, an Opfer des Nationalsozialismus zu erinnern. Da schlage ich die junge Inge Frank (1922-1943) und Lina Althaus (1910-1943), beide aus Weidenau, vor. Das Leben von Lina Althaus galt als „lebensunwertes Leben“ und wurde in Hadamar ausgelöscht.
Die Fotogalerie sollte in Gebäuden der Stadt ausgestellt werden. Vielleicht in einem ersten, temporären Durchlauf im Ratssaal. Sie könnten mal vorübergehend die Gemälde der Frauen, die aufgrund ihrer Geburt privilegiert waren, ersetzen.
Sollten die Fotos im öffentlichen Raum angebracht werden, müssten sie gesichert werden.
Danke für den ausführlichen Kommentar!
Am 17.11.2023 erschien in der Kulturrubrik der Siegener Zeitung folgende kurze Notiz zum Sitzungsverlauf:
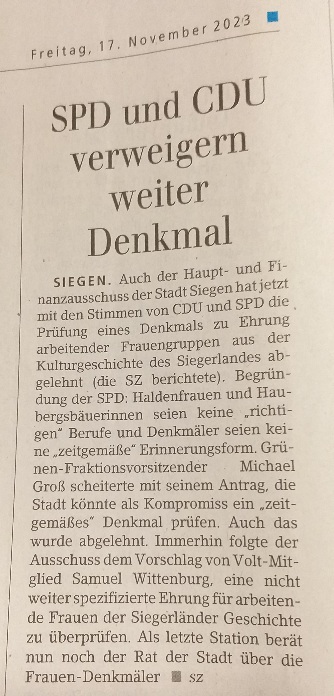
Einen Tag später erschien in der Westfälischen Rundschau der Artikel „Siegen: SPD lehnt Denkmal für arbeitende Frauen komplett ab“ und der Kommentar „Das, Sieener SPD, ist peinlich für eine´Arbeiterpartei´“ von Hendrik Schulz. Beides wird auf der Facebookseite der Zeitung kommentiert.
Pingback: Umleitung: heimliches Filmen, Rechtsextreme, Funke-Reporter bedroht, Hass auf Israel, Geschichte Westfalens, Dialog über Rassismus, Facebook, BlueSky und mehr – zoom
Literaturhinweis: NN: Zur Dresler-Ausstellung im Museum ( mit 4 Bildern), in: Siegerland 1939 Heft 1, S.21f
Gemeint ist das Siegerlandmuseum
Pingback: #SIEistSIEGEN zur abschließenden Beratung in den Stadtrat | siwiarchiv.de
Pingback: „Blick ins Netpherland 2023“ erschienen | siwiarchiv.de
In der heutigen Ausgabe der Siegener Zeitung erschien im Kulturteil der Artikel “ Frauendenkmal geht auch zeitgemäß“, der die Venuskogge in Uelzen als gelungenes Beispiel anführt.
In der Westfälischen Rundschau finden sich heute im Print die Leserbriefe „Ohne Frauen ging es nie“ und „Fotos sind würdiger“
Erst heute erschien auch in der Siegener Zeitung der Leserbrief „Ohne Frauen ging es nie“.
Pingback: #SIEistSIEGEN zur abschließenden Beratung in den Stadtrat | siwiarchiv.de
Gestern hat der Rat mehrheitlich beschlossen, dass der AK Strassennamen, Vorschläge für ein Kunstwerk – kein Denkmal – in öffentlichen Raum erarbeiten soll. Man mag mich korrigieren, wenn ich mich irre. Der Ton der Debatte folgte den jüngsten erinnerungspolitischen Diskussionen.
Pingback: Vortrag: „Provinz im Aufbruch. Siegens vergessene Kulturgeschichte“ | siwiarchiv.de
Der Artikel der Siegener Zeitung zur Entscheidung im Rat der Stadt Siegen ist leider hinter der Bezahlschranke: https://www.siegener-zeitung.de/lokales/siegerland/siegen/siegen-frauen-bekommen-kein-denkmal-zum-stadtjubilaeum-aber-ein-kunstwerk-4UWQONZCHZDR7FPCE3IHB42ZFQ.html

Dafür erreichte siwiarchiv ein als wortloser Kommentar aufzufassendes Bild zu der erinnerungskulturell erhellenden Debatte:
Quelle: Zonta Club Siegen, 2019
Heute erschien in der Westfälischen Rundschau der Artikel „Sie zanken wie die Kesselflicker. Debatte um Denkmal für arbeitende Frauen kocht im Rat noch ein weteres Mal hoch.“
Kommentare der VOLT-Fraktion: https://www.facebook.com/100066769669144/posts/pfbid0AJm4LBEeDAYvcRKqmWG7BkpoA7JKo56EX521iUHRYjfoSVoCqRiCLkk18HghBFYAl/
Heute erschien in der Siegener Zeitung der Artikel „Frauenforum will mitreden“, der die Forderung des Forums nach einer beratenden Teilnahme an den Sitzungen des zuständigen Rats-Arbeiskreises (Strassennamen) wiedergibt.
Pingback: Siegerlandmuseum-Weihnachtsrätsel 2023: 1. Advent | siwiarchiv.de
Pingback: "Wie ist, was seltsam anfing, so wunderbar geworden" -
Pingback: “Wie ist, was seltsam anfing, so wunderbar geworden”
Pingback: (K)eine Ehrung von Walter Kräner während des Siegener Stadtjubiläums? | siwiarchiv.de
Pingback: Lieben, sterben, überleben – Das Schicksal eines Zwangsarbeiterkindes in Siegen | siwiarchiv.de
Schade das man die Fotos nicht größer machen kann
Pingback: Siegerlandmuseum-Weihnachtsrätsel 2023: 3. Advent | siwiarchiv.de
Pingback: Zur Geschichte der FDP im Kreis Siegen-Wittgenstein | siwiarchiv.de
Pingback: Zehn Jahre Fachmagazin „Forum“ des Bundesarchivs: Neue Ausgabe 2023 online erschienen – Archivalia
Pingback: Siegerlandmuseum-Weihnachtsrätsel 2023: 4. Advent | siwiarchiv.de
En jo ihr Lagömbeser dad wird Zworn alles a de Chinese verscherwelt….bis de rore Genosse idr moschee dr lälles fa kinderbuchautor un dat furchtbare baerböckche….dad ganze heimatländche bid dem Olaf fa hamburch vollends vor de Wand jedeut ha….wad für wirre Lü Sinn dad bloß nur dumm Züch em Kopp….
Bitte beim Thema bleiben! Ansonsten behalte ich mir die Löschung weiterer Kommentare und schlimmstenfalls die Sperrung als Nutzer vor.
Pingback: Publikation „100 Jahre Privatarchive in Westfalen. Geschichte der Vereinigten Westfälischen Adelsarchive e.V. 1923 – 2023“ erschienen – Archivalia
Heute in der Siegener Zeitung:
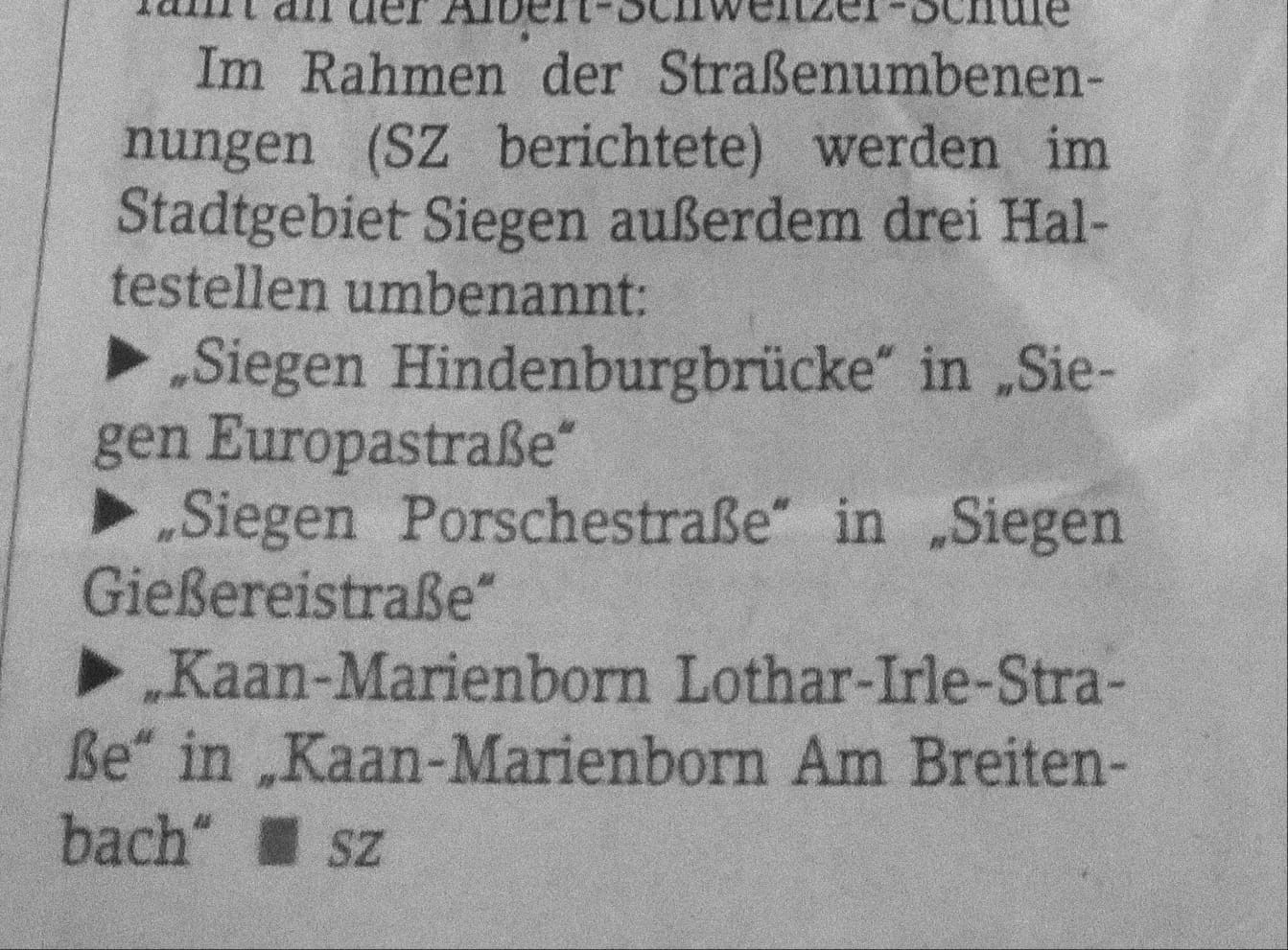
2. v.r. Erwin Alt via FB-Guppe „Unser Inseldorf Niederschelden in alten und neuen Bildern“
Mann am Kran Heinz Hilse (?), 2. v. r. Hans Schäfer (Elektriker) via FB-Gruppe “ Unser Inseldorf Niederschelden in neuen und alten Bildern“
Schepp veröffentlichte 1898 eine Zusammenstellung dreier Vorträge unter dem Titel “ Ländlichen Wohlfahrtseinrichtungen. Vorschläge aus der Praxis“. Die Vorträge „Eine Haushaltungsschule für das Land“, „Die Krankenpflege auf dem Land“ und „Die Wiederbelebung des Instituts der Waisenräte durch Einrichtung von Waisenämtern“ wurden für die Drucklegung mit Anhängen versehen.
Zum politischen Engagement Brossoks siehe: Auszug KT-Sitzung 15.12.1930 (PDF)
Leider kann man zurzeit die Digitalisate, welche 2021 veröffentlicht wurden (Register zu diversen Standesamtsbüchern), nicht öffnen. Bei allen zeigt der DFG-Viewer nur eine weiße Seite an.
Gibt es eine Möglichkeit, das Ganze zu beheben?
Liebe Grüße!
Leider hat dieses Problem mit dem Cyberangriff auf die Südwestfalen-IT zu tun. Die Behebung der Probleme kann noch lange dauern, da die Wiederherstellung des Verwaltungshandeln Priorität hat.
Pingback: Vortrag zur Stadtgeschichte: Die Urkunde von 1224 und die Stadtwerdung Siegens | siwiarchiv.de
Es können nach wie vor die Zweitschriften des Landesarchivs benutzt werden: https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=FINDBUCH-Fb_267F2A72-DCB3-4F8B-81A7-CF60D5C6C154
Eine Übersicht und Erläuterungen finden sich hier:
https://www.archive.nrw.de/landesarchiv-nrw/geschichte-erfahren/familienforschung/familienforschung-digital
Beste Grüße
Pingback: „Verschleppt. Ausgebeutet. Vergessen?“ – Themenabend im Café Herzstück, Hilchenbach | siwiarchiv.de
Pingback: Video: „Waldland Wittgenstein“ (1965) | siwiarchiv.de
Hallo, Brigitte, auch ich war von 1974-1976 in der Tagesschule Englisch und an die Reise nach London mit Dr. Bode im Grosvenor Victoria Hotel kann ich mich ebenfalls erinnern. Wir haben in der Sprachenschule sehr viel gelernt (auch über den Tellerrand hinaus) und Frau Bode war in ihrem Grammatikunterricht äusserst gründlich und gewissenhaft. Ich erinnere mich gerne an die Zeit zurück. Die Ausbildung hat mir einen guten Arbeitsplatz beschert. Nun bin ich auch schon im Ruhestand und grüsse hiermit alle ehemaligen Schüler und Schülerinnen des o.g. Jahrganges. Viele Grüsse von Birgit aus Bremen
Hallo, ich habe den tollen Film im Heimhoftheater, Würgendorf sehen dürfen. Im Film wurde Werbung für mobile Bauwagen gemacht, die man individuell mieten kann. Können Sie mir diesbezüglich einen Kontakt senden?
Vielen Dank.
LG Tanja Sanna
interessant…..
Als Kind welches in Siegen geboren wurde,habe ich die bedrückende Gemeinschaft einer Brüdergemeinde in Hilchenbach kennengelernt. Mein Opa war Unternehmer und hat diese pietistische ,sektiererische Gemeinde geleitet.Laienprediger,das war er,wo auch immer er ursprünglich her war.Ich bin dann in jungen Jahren nach Berlin gegangen,was für mich Freiheit im Denken pur war. Nichts hat mich an dieses Siegerland gebunden,ich war froh,dieser entsetzlichen Enge zu entkommen.Diese Gemeinden ,“Frei“kirchen gibt es immer noch. Es ist alles grau und schwarz wenn ich an diese 18 Jahre Siegerland zurückdenke.
Pingback: Vortrag: „Provinz im Aufbruch. Siegens vergessene Kulturgeschichte „ | siwiarchiv.de
Mit ihrer Dissertation („Schmerzenskinder der Industrie“) behandelt Dr. Ulrike Gilhaus „Umweltverschmutzung, Umweltpolitik und sozialer Protest im Industriezeitalter in Westfalen 1845 – 1914“.
Zahlreiche Beiträge des umfangreichen Werkes (600 Seiten) sind m.E. gut geeignet, den Ursache/Wirkung-Zusammenhang in der Stadtentwicklung Siegens deutlich zu machen und damit ein anspruchsvoller Beitrag im Jubiläumsjahr sein.
Auf Anfrage stelle ich gern 1 Expl. leihweise/unentgeltlich zur Verfügung.
Erich Kerkhoff
Im Wolfseifen 68
57072 Siegen
s. a dazu:
s. a.:
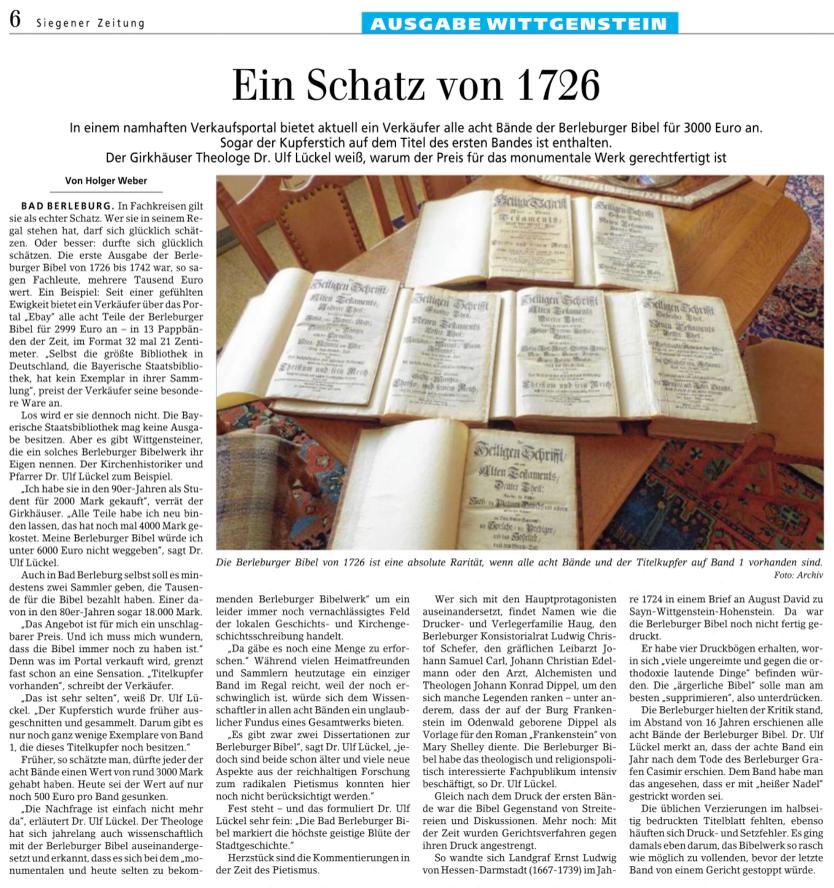
Dazu s. a.:
Nach ca, 50 Jahren privater Ahnenforschung und den damit entstandenen
Erfahrungen und Enttäuschungen kann ich nur voller Hochachtung auf
das Werk von Jochen Karl Mehldaus “ Wittgensteiner Familiendatei “
blicken und meine Glückwünsche dazu aussprechen,
Mit freunlichen Grüssen aus dem Sauerland
Horst Rother
Pingback: Ausstellung zur Zwangsarbeit im Siegerland bis zum 15. März verlängert | siwiarchiv.de
“ …. Am Mittwoch, 14.02.2024, um 17.00 Uhr startet die Ausstellung zu 50 Jahren Partnerschaft der Kreise Siegen-Wittgenstein und Emek Hefer in Israel im Bürgerhaus am Markt in Bad Berleburg offiziell. Das Jubiläum hatte 2023 stattgefunden, inzwischen besteht die Partnerschaft also sogar 51 Jahre. Der Verein für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Siegen hat die Ausstellung erstellt, die die Geschichte der Partnerschaft lebendig werden lässt. „Es sind die Menschen die diese Partnerschaft geprägt und mit Leben erfüllt haben“, lautet eine der zentralen Aussagen der Ausstellung, die einlädt sich zu informieren, auszutauschen und an der Weiterentwicklung der Partnerschaft mitzuarbeiten. Nachdem die Ausstellung in Siegen zu sehen war, wird sie nun also auch in Bad Berleburg gezeigt. Dazu sind alle Interessierten herzlich eingeladen. In die Ausstellung führt Heiner Giebeler vom Freundeskreis für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Siegen mit Wort und Bild ein. Die Ausstellung ist ab diesem Tag bis Donnerstag, 14.03.2024, zu den Öffnungszeiten der Tourist-Info im Foyer des Bürgerhauses am Markt zu sehen. Der Eintritt ist frei.“
Quelle: Stadt Bad Berleburg, Meldung vom 31.01.2024
Pingback: Wanderausstellung zur Geschichte der Partnerschaft mit Emek Hefer in Bad Berleburg | siwiarchiv.de
Im Bildbestand „Sammlung LVA Westfalen: Wohnungsnot und Wohnbauförderung in den 1920er-1950er Jahre“ des LWL-Medienzentrums für Westfalen befindet sich unter der Archivnummer 03_3704 eine undatierte Porträtaufnahme Salzmanns von Ernst Krahn.
Online kann eine Entnazifizierungsakte Salzmanns eingesehen werden (Landesarchiv NRW, Abt. Rheinland, NW 1039-S (SBE Hauptausschuss Regierungsbezirk Münster), Nr. 1011.
Im Berliner Bundesarchiv befindet sich eine Personalakte Salzmanns: R 3001 (Reichsjustizministerium), Nr. 73369.
Pingback: Projektmittel für das Bundesarchiv beschlossen | siwiarchiv.de
s. a. Kirchen der 1960er & 1970er in Bochum – Gelsenkirchen – Bünde | MARKANTES ERBE 03 – Dokumentarfilm:
s. a. Kirchen der 1960er & 1970er in Bochum – Gelsenkirchen – Bünde | MARKANTES ERBE 03 – Dokumentarfilm:
s. a. Kirchen der 1960er & 1970er in Bochum – Gelsenkirchen – Bünde | MARKANTES ERBE 03 – Dokumentarfilm:
s. a. Kirchen der 1960er & 1970er in Bochum – Gelsenkirchen – Bünde | MARKANTES ERBE 03 – Dokumentarfilm:
s. a. Kirchen der 1960er & 1970er in Bochum – Gelsenkirchen – Bünde | MARKANTES ERBE 03 – Dokumentarfilm:
Pingback: Online: „Karnevals-Zeitung“ (Siegen 1847) | siwiarchiv.de
mac paper, wurstkönig, hussel, city galerie, douglas, glücksstück, italienische pizza, ulla popken, liberty, dertour, adam&eve … und der ach so quirlige moderator hat fusseln am anzug.
in dreieinhalb von fünf minuten bekomme ich belangloses gequassel und werbung für die unterstadt-mall um die ohren, eine minute lang immerhin wird das wappen erklärt.
kein einziges bild des videos zeigt jedoch eine aussenaufnahme, zb. mit der martinikirche, auf die ja das stadtwappen vermutlich hinweist. das sind zu wenige facts, liebe leute, und noch weniger fun, sondern schlechtes konzept.
bitte neu machen!
Vielen Dank für den Kommentar!
Dies offensichtlich sehr niederschwellige Infotainmentangebot hätte m. E. eine Projektbeschreibung (inzwischen liegen drei Filme vor) verdient gehabt. Ziele und Zielgruppe hätten dort definiert werden können. Die eher knappe Auflösung im Siegener Stadtarchiv (Blick aus dem Multifunktionsraum in den Benutzerraum) hätte zudem mit weiterführenden Angaben zum Thema ebenfalls ergänzt werden können. youtube bietet dafür ja die Möglichkeit.
Etwas überraschend ist die Einordnung des Wappens als „funfact“. Sind Wappen wirklich nur noch eine amüsante, interessante Nebenbemerkung?
Pingback: Aktives Museum Südwestfalen: Übergabe der Förderurkunde durch die NRW-Stiftung | siwiarchiv.de
Pingback: Landeskirchliche Chronik von Westfalen online – Archivalia
Pingback: Stellenausschreibung Leiter/in des Stadtarchivs Siegen | siwiarchiv.de
Westfälische Rundschau (online hinter der Bezahlschranke, daher nicht verlinkt) schreibt am 21.2.: “ Die neue Leitung sollte schon im August [des vorigen Jahres] ihren Dienst antreten. …. Die Ausschreibung sei „ergebnislos“ gebleiben, heißt es jetzt aus dem Rathaus, wobei offen gelassen wird, ob die Bewerbungen nicht geeignet waren oder sich niemand beworben hat. …..“
Infolge einer familienkundlichen Recherche stieß ich auf folgenden Artikel in der Siegerländer Nationalzeitung, der die nunmehr einfache Recherche in norhrhein-westfälischen Zeitungen für zeithistorische Themen über das Portal zeit.punkt nrw belegt:
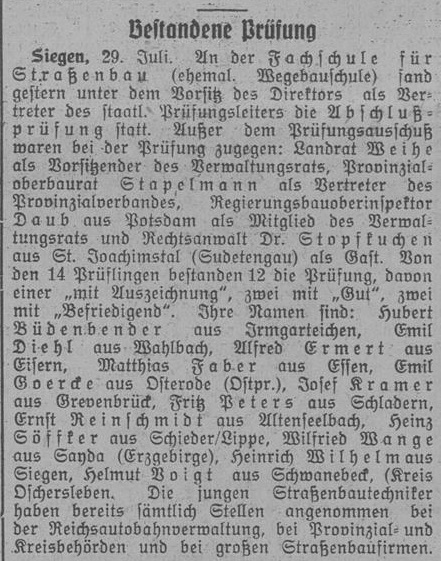
Auch die Entnazifizierungakten Weihes sind in der Zwischenzeit online:
1) Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland, NW 1127 / SBE Berufungsausschuss Siegen in Siegen, Nr. 682
2) Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland, NW 1037-BVI / SBE Der Sonderbeauftragte für die Entnazifizierung im Lande NW , Nr. 2777
Zu Joachim Frank höre man die Beitrag „Nobelpreisträger Joachim Frank. Von Zufällen, Teillösungen und Fortschritt“ im Deutschlandfung vom 24.2.24: https://www.deutschlandfunk.de/zeitzeugen-im-gespraech-der-biophysiker-und-chemienobelpreistraeger-joachim-frank-dlf-70be3585-100.html
Im Blog „Fusion“ findet sich am 8.2.ein Eintrag von Johanna Schirrmacher zum Vortrag: https://fusion.uni-siegen.de/?p=596
Link:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Melcher_(Landrat)
Literatur
Die Siegerländer Chronik im Siegerländer Heimatkalender (1936) vermeldet für den 18.07.1935: „Regierungsassessor Melcher übernimmt die Vertretung des Landrates.“
Joachim Lilla: Leitende Verwaltungsbeamte und Funktionsträger in Westfalen und Lippe (1918-1945). Biographisches Handbuch, Münster 2004, 218-219
Archivalien:
Bundesarchiv Berlin
R 3001(Reichsjustizministerium) /68012, [Personalakte]
R 9361-II/701684 (Sammlung Berlin Document Center (BDC): Personenbezogene Unterlagen der NSDAP / Parteikorrespondenz)
Als Bezeichnung für eine nicht eng ortsgebundene, sich mit kleinem Handel etwa mit irdenem Geschirr auf den Weg machende Bevölkerungsgruppe ist „Meckes“ keine Siegerländer Besonderheit, sondern weit verbreitet gewesen vom südlichen Sauerland bis zum Unterelsass. Auch übrigens als Familienname von Angehörigen dieser Sozialgruppe.
Danke für den Hinweis!
Pingback: Eine der zentralen Quellen zur Verwaltungs-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte ist nun online – Archivalia
Pingback: 12. TAG DER ARCHIVE 2024: „Essen und Trinken“ | siwiarchiv.de
UB Siegen sperrt 12000 Bände wegen potentieller Arsenbelastung: https://bibblog.ub.uni-siegen.de/8255/informationen-zu-moeglicherweise-arsenbelasteten-bestaenden-in-der-ub-siegen-information-on-possibly-arsenic-contaminated-holdings-at-siegen-university-library/?pk_campaign=feed&pk_kwd=informationen-zu-moeglicherweise-arsenbelasteten-bestaenden-in-der-ub-siegen-information-on-possibly-arsenic-contaminated-holdings-at-siegen-university-library
Folgende Entnazifizierungsakten Kuhbiers sind zwischenzeitlich online einsehbar:
1) Landesarchiv NRW Abteilung RheinlandNW 1127 ( SBE Berufungsausschuss Siegen in Siegen), Nr. 836
2) Landesarchiv NRW Abteilung RheinlandNW 1037-BVI (SBE Der Sonderbeauftragte für die Entnazifizierung im Lande NW )I, Nr. 3342
Eine Personalakte des Reichsjustizmiisteriums befindet sich im Berliner Bundesarchiv: R 3001/65117 (Kuhbier, Heinz, geb. 16.4.1907)
Guten Tag,
gibt es inzwischen eigentlich eine neuere Ausgabe der Siegener Beiträge? Die letzte ist offensichtlich die Ausgabe 27/2022 bzw. der Sonderband 2022. Ist danach keine neue Ausgabe mehr erschienen? Wann ist eine neue Ausgabe geplant
Guten Tag Herr Ahlering,
schauen Sie bitte einmal hier
https://geschichtswerkstatt-siegen.de/
Dort finden Sie fast alle der gewünschten Auskünfte. Wir versuchen unsere Homepage so aktuell zu halten wie möglich. Über die Kommentarfunktion können Sie auch nachfragen, ob und wann eine neue Publikation erscheint.
Archivalia gewohnt griffig: https://archivalia.hypotheses.org/195054.
Man höre auch: „Arsen in Bibliotheken, Arsen in unserem.Alltag?“, Deutschlandfunk, 28.2.24: https://www.deutschlandfunk.de/arsen-in-bibliotheken-arsen-in-unserem-alltag-dlf-cc980dbf-100.html
Links zum Thema:
KEK-Projekt „Arsenbelastete Einbände wieder nutzbar gemacht“ (2020/21)
TH Köln, Projekt „Konservatorischer Umgang mit arsenhaltigem Bibliotheksgut“, (2021)
Jessica Bruns, Kerstin Helmkamp, Ruth Sindt: Der Umgang mit potentiell arsenbelasteten Bibliotheksbeständen an der Universitätsbibliothek Kiel – ein Werkstattbericht, Bilbiohetheksdienst
Bibliotheksdienst Band 57 (2023) Heft 9
Noch mehr Links zum Thema:
https://www.bibliotheksverband.de/sites/default/files/2024-01/ArsenHandreichung2023-12-08.pdf
= ausführliche Stellungnahme des DBV, Stand Dezember 2023, mit Berücksichtigung der Vorarbeiten von UB Kiel, ULB Bonn und FH Köln.
https://sites.udel.edu/poisonbookproject
= Homepage des von zwei Restauratorinnen an der University of Delaware 2019 ins Leben gerufenen interessanten „Poison Book Project“.
Zeitlich knapp vorausgegangen (2018) war die Zufallsentdeckung der Arsen-Kontamination dreier Bücher aus dem 16. und 17. (!) Jahrhundert in einer dänischen Bibliothek:
https://theconversation.com/how-we-discovered-three-poisonous-books-in-our-university-library-98358
Es ist eine Binsenweisheit, dass alles, was in der Vergangenheit – vor allem, aber keineswegs nur, während des Aufschwungs der chemischen Industrie im 19. Jahrhundert – mit anorganischen Substanzen gefärbt wurde, potentiell gesundheitsgefährdend wirken kann, einschließlich sämtlicher für die Buchherstellung verwendeter Materialien. Dass diese seit Erfindung solcher Farben grundsätzlich bekannte Tatsache, der z.B. schon vor zwei Jahrhunderten in Lehrbüchern für Buchbinder Arbeitsschutzempfehlungen gewidmet waren, nun seit wenigen Jahren von Bibliothekaren als „neue Erkenntnis“ verkauft wird, ist ein kulturhistorisch interessantes Phänomen. –
Ganz unabhängig davon, ob tatsächlich ein akutes Problem für heutige Bibliotheksbenutzer vorliegt, das sofortige brachiale (und teure) Maßnahmen wie in Bielefeld, Siegen usw. erzwingt, oder sich alles nur als Sturm im Wasserglas („Viel Lärm um nichts“, wie es manche Fachkollegen anderwärts sehen) herausstellt: Die interessierte Öffentlichkeit sollte bei beiden Szenarien erwarten dürfen, dass sich die bibliothekarischen Spezialisten gründlich und konsequent mit dem Thema beschäftigen, bevor sie entweder die Leser ihrer Bücher vor qualvollem Siechtum warnen oder anderenfalls einfach die Kirche im Dorf lassen. Dreierlei zeugt aber weder von gründlicher Recherche noch von konsequenter Verfolgung eines zweifellos gutgemeinten Anliegens:
1. die in den Verlautbarungen seit 2018 immer wiederkehrende Hervorhebung der „verdächtigen“ Farbe Grün und Fixierung des Blicks auf arsenhaltige Farbstoffe: So wird dem fachfremden Publikum suggeriert, alle anderen Farben und seinerzeit verwendeten Metallverbindungen seien für die Beurteilung von Toxizität vergleichsweise irrelevant. Neben Arsen (häufig in anderer als grüner Farbgebung) kamen in breitem Umfang Salze von Chrom, Blei, Quecksilber, Cadmium, Kupfer und anderen Metallen als Farbstoffe zum Einsatz, die in ihrer Giftigkeit dem Arsen kaum nachstehen.
2. die aus Bielefeld mehrfach wörtlich übernommene Behauptung „Ledereinbände sind nicht betroffen“: Speziell im Siegerland mit seinem einst florierenden Ledergewerbe, aber auch anderenorts, sollte bekannt sein, dass seit dem 19. Jahrhundert die traditionell verwendeten Naturgerbstoffe (z.B. Eichenrinde) durch chemische Substanzen ersetzt wurden – in erster Linie durch hoch giftige Chromverbindungen (aber auch solche des Arsens und anderer Metalle). Diese dürften in den historischen Ledereinbänden sogar in höherer Konzentration vorliegen als ähnlich wirkende Gifte in gefärbten Vorsatzpapieren oder auf Buchschnitten und könnten, da sie bei der Lektüre am intensivsten berührt werden, ein Gesundheitsrisiko – z.B. für Allergiker – darstellen. Potentiell giftige Stoffe können ferner textile Bucheinbände (nicht nur gefärbte Papp-Deckel) kontaminieren; auch können sie während der gesamten Zeit, in der für den Buch- und Zeitungsdruck Bleilettern verwendet wurden, auf die Schriftseiten gelangt sein. Der Einsatz ungesunder Chemikalien schon bei der Papierfabrikation (oder davor der Pergamentherstellung) wäre gleichfalls zu bedenken. Kurzum: In jedem Teil eines Buches (farbige Illustrationen übrigens eingeschlossen) würde man, wenn man es darauf anlegt, auf Spuren von Giften stoßen können.
3. der regelmäßig wiederholte Verweis auf das „19. Jahrhundert“ oder gar nur Abschnitte desselben als Untersuchungszeitraum: Mit anorganischen Alternativen zu teuren oder unbefriedigenden pflanzlichen und tierischen Farbstoffen wurde experimentiert, seit der Bergbau farbenprächtige Mineralien ans Licht brachte. Gesundheitlich riskante Farben kamen definitiv lange vor 1800 zum Einsatz. Auch spricht nichts dafür, dass ihr Einsatz pünktlich im Jahre 1900 generell und international schlagartig zurückgegangen wäre und für die Massenproduktion von Büchern bis weit ins 20. Jahrhundert hinein keine Rolle mehr gespielt hätte. –
Solche buchhistorischen Reminiszenzen helfen natürlich kaum bei der Abwägung realer Gesundheitsrisiken. Diese müssen die Bibliothekare ohnehin medizinisch oder toxikologisch qualifiziertem Personal überlassen, wobei auch bei solchen Experten eine gewisse Meinungsvielfalt vorauszusetzen ist. Ein wenig Trost könnte den aufgescheuchten Bibliothekaren und von ihnen in Panik versetzten Bibliotheksbenutzern vielleicht der sogenannte „gesunde Menschenverstand“ spenden: Im Vergleich zu der Gesamtmenge gesundheitsgefährdender Schwermetalle, die jeder Erdbewohner während seines Lebens aus zahllosen Quellen seiner Umwelt aufnimmt und langfristig im Körper speichert, dürften die eher homöopathischen Dosen, die man sich gelegentlich bei der Lektüre von Büchern vielleicht einfängt, kaum ins Gewicht fallen. Für eine verringerte Lebenserwartung von Berufsgruppen, die jahrzehntelangen besonders engen Kontakt zu historischen Büchern pflegen (Bibliothekare, Antiquare, manche Gelehrte) oder Völkern, die sich intensiv vom bekanntlich stark arsenbelasteten Reis ernähren, spricht statistisch nichts – ganz im Gegenteil!
(PS: Als Siwiarchiv-Geschädigter weise ich vorsorglich darauf hin, dass dies ein Selbstgespräch war und ich auf die zu erwartenden Unhöflichkeiten gewisser Widersacher nicht reagieren werde.)
Sehr geehrte Damen und Herren, leider sind mir meine Unterlagen für das Geschlechterbuch Delius verlorengegangen. Könnten sie mir bitte eine Kopie senden damit ich es vervollständigen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Anna von Delius
Sie können den verlinkten Stammbaum auch als PDF-Datei herunterladen und ausdrucken.
Ankündigung in der Westfalenpost von heute: https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/article241836104/Zugfahrt-in-den-Tod-Anziehen-Ihr-kommt-nach-Polen.html
In der Siegener Zeitung vom 9.2.2024 erschien der Leserrief „Andere Gefahren größer“ von Dr. Winfried Leist, Bibliotheksdirektor a.D.:
„Da wird wieder einmal mit Kanonen auf Spatzen geschossen bzw. eine Mücke zum Elefanten aufgeblasen. Sicherlich gibt es eine Gefährdung durch ältere Bücher. Aber sie ist sehr gering im Vergleich zu den tatsächlichenund sehr viel größeren Gefahren, mit denen wir täglich in unseren Städten leben. Etwa durch Asbest, den sehr viiele neuere Häuser ausdünsten. Sein Verbot konnte 1990 nur gegen vielen Widerstand im Bundestag durchgesetzt werden. Hier sind Todesfälle aktenkundig – in Bibliotheken nicht.
Oder die Gefährdung durch den Feinstaub von abgasen und Abrieb von Reifen. Eine ernste Gefährdung sehe ich auch durch die Produkte unserer Lebensmittelindustrie. Hier wären strengere Gesetze und Überwachung dringend erfordelich. Aber die Industrie wünscht sie auf keinen Fall und setzt das durchihre Vertreter im Bundestag durch.
Durch Sensationsartikel über zumeist harmlose alte Bücher wird wieder einmal eine dringend notwendige Diskussion auf ein Abstellgleis geleitet und die Öffentlichkeit vergackeiert.
Ich selbst bin jetzt 86 Jahre alt, habe sehr früh mit vielen alten Büchern zu tun gehabt und bin gesundheitlich noch immer in einem dem Alter zum Trotz recht guten Zustand. Da habe ich offenbar in gefährlicher Umgebung viel Glück gehabt. Nicht nur ich. Denn ich kenne iele alte Kollegen und Wissenschaftler, die offenbar das gleiche Glück hatten. Kann ein in Rente lebender Arbeiter das von sich und seinen Kollegen auch sagen?“
Pingback: Arsenbelastung im Archiv? – archivamtblog
Pingback: Siegener Cyberattacke zeigt: Dezentrales Hosting der Digitalisate im Archivportal NRW ist schlecht – Archivalia
Pingback: Wittgenstein Heft 2 / 2023 erschienen | siwiarchiv.de
Am 29.11.2023 fand ein Experten-Workshop zum Archivgesetz statt. Landesarchiv NRW und die kommunalen Archive in NRW (vertreten durch die Archivämter der Landschaftsverbände und Vertreter der archivischen Arbeitsgemeinschaften der kommunalen Spitzenverbände) hatten diese Veranstaltung vorbereitet. Die Dokumentation des Workshops steht noch aus. Gegen Ende des Jahres 2024 soll eine Expertenanhörung im Landtag stattfinden, so dass man „vorsichtig optimistisch“ mit einem neuen Archivgesetz im Jahr 2025 rechnet.
Aus der aktuellen Stunde des Westfälischen Architages 2024:
“ …Neuigkeiten zum NRW-Archivgesetz – Prof. Dr. Marcus Stumpf
Zu einer Lösung kam es am 29.11.2023 auf dem Archivrechtstag. Eine Beratung durch Experten hat ergeben, dass die Integration des NRW-Archivgesetzes in das Kulturgesetz eine schlechte Idee sei. Daraufhin wurde dieses Vorhaben erstmal fallen gelassen. Ein Referentenentwurf ist bereits in Arbeit und soll frühestens Mai 2025, noch vor der Landtagswahl, entschieden werden. Das Archivgesetz soll als eigenständiges Spezialgesetz stehen bleiben. ….“
Das Ministerium legte folgenden detaillierten Zeitplan vor;
April 2024 Referentenentwurf mit Beteiligung des LAV und Leiter der LVR-AFZ
Juni 2024 Ressortabstimmung
August 2024 Verbandsabstimmmung
Ministerialabstimmung
19.11.2024 Kabinettsbeschluss
Juni 2025 Verabschiedung
Pingback: Räumung des Radiomuseums Bad Laasphe | siwiarchiv.de
Aktuell zur Arsenbelastung ist:
Torsten Arndt/Karsten Stemmerich: Zur aktuellen Diskussion um mögliche toxikologische Belastungen beim Umgang mit arsenfarben-haltigen Bibliotheksbeständen (im Druck), PDF
Am 9. März erschien in der Westfalenpost im Wittgensteiner Regionalteil der Kommentar „Nicht schon wieder! von Lars Peter Dickel über mögliche Lehren aus dieser Geschichte:
„Nicht schon wieder! Ich kann die Menschen sehen und hören, die bei der Erinnerung an die Verbrechen der Nazizeit abwinken und es einfach nicht mehr hören wollen. Die Argumente sind immer die gleichen. Ich habe damit nichts zu tun. Das ist doch lange her. Lasst die Vergangenheit ruhen!
Wa rum ich die Vergangenheit nicht ruhe lasse, ist ein Beispiel, das sich in Berleburg, meiner Heimatstadt, direkt vor unserer Haustür abgespielt hat. Und ich lasse die Vergangenheit nicht ruhen, weil man sehr viel aus ihr lernen kann. Zum Beispiel, warum wir großes Glück haben, seit fast 80 Jahren in Frieden zu leben, seit 75 Jahren ein Grundgesetz zu haben, das die Würde jedes Menschen zum obersten Gebot macht und weil wir in Freiheit und Demokratie leben.
Was wir ebenfalls aus der Geschichte lernen können, ist wie eine grausame, menschenverachtetende Diktatur eine Demkratie aushöhlt, abschafft und die Menschheit in Kriege stürzt. Das hat vor 91 Jahren mit dem Naziregime begonnen.
Und wenn wir heute von einer Konferenz in Potsdam am Wannssee hören, bei der Rechtsextreme Pläne für die Ausgrenzung von Andersdenkenden, anders Aussehenden und Andersgläubigen schmieden, dann lohnt sich ebenfalls ein Blick in die Geschichte. Nicht nur zur eigentlichen Wannseekonferenz von 1942, bei der die „Endlösung der Judenfrage“ geplant wurde, sondern zur Wittgensteiner „Selektionsbesprechung“ 1943 im Landratsamtsgebäude in Berleburg und sogar bis zu den Jahren ab 1933. Direkt nach der Machtübernahme der NAzis schmiedeten Wittgensteiner Politiker einen Plan zur „Endlösung der Z-Frage“. Wittgensteiner planten, wie man integrierte Deutsche ausgrenzt, entrechtet, ihnen nicht nur die Arbeit und Lebensgrundlage nimmt, sondern sie sterilisert, deportiert und umbringen lässt.
Mit Blick auf den aktuellen Rechtsruck in Deutschland und dem Wissen darum, was daraus erwachsen kann, sage ich dann: Nicht schon wieder!“
In seinem Artikelt „Berleburg, Keimzelle des Völkermords. Im Provinzstädtchen wird die „Emdlösung der Z-Frage“ gesucht – lange vor Krieg, Wannseekonferenz und Auschwitz“ nennt Dickel exemplarisch drei Täter: Dr. Theodor Günther, Dr. Robert Krämer und Otto Marloh.
Daneben nennt das regionale Personenlexikon für die Zeit des NAtionalsozialismus noch folgende Teilnehmer an der Berleburger Selektionskonferenz (1943):
Hermann Fischer, Robert Goedecke, Ernst Graf, Josef Iking, Friedrich Peußner, Emma Rittershaus, Norbert Roters, Karl Heinrich Schneider.
Im Siegerland war Mäckes ganz klar eine Schmähbezeichnung, die Asoziale meinte. In Gießen gibt es sie noch, sie sprechen Manisch.
Gesöcks.1) Zur Manischen Sprache s. https://de.wikipedia.org/wiki/Manische_Sprache
2) Abwertende Kommentare werden zukünftig kommentarlos gelöscht.
Dass die Fludersbach zum Ort des sog. Hilfskrankenhauses für „Ostarbeiter“, sprich für sowjetische Zwangsarbeitskräfte, und des dazugehörigen Gräberfelds wurde, ist alles andere als ein Zufall. Die Fludersbach am Stadtrand war seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der in Siegen markanteste Ort sozialer Ausgrenzung, etwa vergleichbar mit dem Berleburger „Zigeunerberg“. Hier fanden die ein äußerst bescheidenes Obdach, mit denen die klein- und großbürgerliche Stadtbevölkerung nicht zusammenleben wollte, angeblich „Asoziale“ der unterschiedlichen Herkunft, aus der lokalen Bevölkerung, Migranten, Sinti-Nachfahren, jenischer „Meckeser“ etc. pp. Es ist insofern ein Quartier mit tradierter Exklusion bis mindestens in die 2000er Jahre gewesen, wenn ich das richtig sehe.
Als ich in den ausgehenden 1980er Jahren die Geschichte der regionalen Nazi-Zwangsarbeit erarbeitete, stieß ich im Friedhofsamt(?) auf eine zeitgenössische Kartei der verstorbenen sowjetischen Zwangsarbeitskräfte, mit Angabe der Todesursachen. Gibt es die noch? Hat die heutige Nachrecherche sie ausfindig machen können?
Die Schließung des Friedhofs dürfte darauf zurückgehen, dass er damals Objekt einer Vandalenaktion war, die leider nie aufgeklärt wurde. Die Grabsteine wurden reihenweise umgekippt. Ich meine mich zu erinnern, dass unbekannt gebliebene Täter auch gegen Schlichthäuser von Bewohnern der Fludersbach vorgingen.
Uli, es war die Sterbekartei des Städtischen Friedhofsamtes. (Quelle: „Das Schicksal der Zwangsarbeiter im Siegerland – Projektwoche der Realschule „Am Häusling“ am 27./28.06.1986, Typoskript, SS. 18 und 19)
Und noch ein Hinweis: Schon vor Jahren stellte die regionale VVN-BdA umfangreich Informationen zur regionalen Nazi-Zwangsarbeit ins Netz, die nicht zuletzt auf eigene Recherchen zurückging. Wünschenswert wäre, dass hier eine integrative historische Forschung und Präsentation von Ergebnissen stattfände. Da hätten alle mehr davon.
Ja, das war damals der erste Einstieg. Wir haben dafür einen Preis des BuPräs in dem bekannten Wettbewerb bekommen.
Für mich der Einstieg auch in eine umfassende Bearbeitung des Themas. Ich hätte mir gewünscht, im Kontext der AMS-Ausstellung dazu mal nach Siegen kommen zu dürfen Auch als langjähriges Vorstandsmitglied.
U. a. soetwas stelle ich mir als integrative und kooperativ Geschichtsarbeit vor. Da lässt sich von der damaligen Projektgruppe am Häusling noch lernen.
Beitrag bezog sich auf die Abschlussarbeit der Projektwoche, die hier leider nicht gezeigt werden kann.
Die VVN-BdA Siegerland-Wittgenstein hat im Mai 2013 auf dem Friedhof in der Fludersbach eine Gedenkveranstaltung zum Jahrestag der Befreiung durchgeführt. https://www.vvn-bda-siegen.de/termine.html#mai13 Einen Schlüssel brauchten wir nicht. Dort wurde auch die Gedenkortidee und die Idee eines Verkehrsschildes mit Hinweis auf den Friedhof zum ersten Mal geäußert. Fast alle TeilnehmerInnen waren damals zum ersten Mal auf dem Friedhof und erfuhren erst duch unsere Einladung von dessen Existenz. Vor gar nicht allzu langer Zeit wurden beide Gedanken dem Bürgermeister im persönlichen Termin und auf anderem Wege vorgebracht. Ebenso die Sorge um das Verschwinden des Hilfskrankenhauses. Da der Kreisel am Schleifmühlchen gerade neu entsteht, war das für uns der richtige Zeitpunkt die Idee eines Siegener Verkehsschild „NS-Gedenkstätte“ ins Rennen zu schicken. Ich überließ auch die Pläne des KH aus Uli Opfermanns Buch dem BM. Leider haben wir nichts mehr gehört, außer das Edeka dort bauen will. Ich hatte da noch angekündigt nötigenfalls mit dem Konzern über eine Form der Erinnerung dort zu sprechen (Stolperstein, Gedenktafel, Mahnmal). Mir sind diese Hinweis an dieser Stelle hier wichtig. Was ist denn eigentlich aus der Günen-Idee geworden? Auch davon nix mehr gehört…
http://zwangsarbeit-im-siegerland.de/
„Seit Anfang der 1930er-Jahre ist der zunehmende Wandel der Zeitschrift zum Organ nationalsozialistischer Propaganda zu beobachten.“
Wer hat denn diese Dummheit geschrieben???
Die Vereinigten Stahlwerke Düsseldorf waren alles andere als Hitler-freundlich, hatten auch Juden in der Betriebsleitung, die, so gut es ging, geschützt wurden. (Notgedrungen mussten sie Kriegsmaterial liefern, waren aber so wenig kooperativ und nicht mit Hitlers Aggressions-Politik einverstanden, sodass Hitler einen Alternativ-Betrieb, die Herrmann-Göring-Werke Salzgitter bauen ließ.)
„Das Werk“ war ürsprünglich die Werkszeitschrift für die Mitarbeiter der Vereinigten Stahlwerke. Sie entwickelte sich aber rasch zu einer allgemein anerkannten und von vielen Menschen außerhalb der Stahlwerke gelesenen Kultur-Zeitschrift mit großem sozialen Engagement und auf hohem Niveau.
1943 wurde sie von Goebbels „mangels Staatstreue“ eingestellt und verboten.
Wer diese Monatszeitschrift als „aufwendig produzierte Illustrierte“ bezeichnet, wird wohl nie eine Ausgabe studiert haben: Er oder sie hätte sonst bemerkt, dass wertige Beiträge aus Kultur und Wirtschaft dort erschienen und – allerdings! – die Zusammenstellung der Beiträge mit viel Aufwand so gestaltet war, dass vom einfachen Arbeiter bis zu studierten Kreisen sich jeder angesprochen fühlte. Beiträge, welche Hitler und die Nazis hofierten sind sehr sporadisch und zurückhaltend eingeflochten, auch nach 1933.
Wer sich eingehender mit den Inhalten befasst, dem muss auffallen, dass die Herausgeber sich mit Fingerspitzengefühl zwischen Duldung und Verbot durch die Aufsicht des Propagandaministeriums bewegten.
Namhafte Autoren und erklärte Befürworter der Zeitschrift, denen man kaum Nazi-Nähe nachsagen kann (wie z.B. auch Albert Schweitzer), eben solche Fotografen und Fotografinnen (z.B. Ruth Hallensleben, nach 1945 vielfach ausgezeichnet und prämiert) zeugen ebenfalls von der qualitativen und moralischen Ausrichtung.
Bleibt noch zu sagen, dass der Chefredakteur und Schriftleiter von „Das Werk“, Wilhelm Debus, unter den Nazis als „politisch unzuverlässig“ deklariert war. Hermann Göring, der mit Wilhelm Debus im ersten Weltkrieg zeitweise in der gleichen Staffel geflogen war, wusste, warum er meinen Vater in diese Schublade steckte und auch nicht zuließ, dass er im 2.Weltkrieg mitkämpfen durfte, geschweige denn, seine erfolgreiche Laufbahn als Pilot wieder aufnehemen durfte.
Noch Fragen? Ich habe alle Jahresbände von „Das Werk“ bei mir. Jeder ist eingeladen, sie zu lesen und sich ein eigenes Bild zu machen.
Aber solche Unwahrheiten, oder mindestens Halbwahrheiten, wie sie oben verfassst sind, zu verbreiten, ist nicht zu akzeptieren.
Da die Quelle des Eintrages verlinkt ist, empfehle ich eine Kontaktaufnahme mit dem Thyssen-Krupp-Archiv.
Pingback: Erschienen: „Wüstungen in Westfalen“: | siwiarchiv.de
Aus der aktuellen Stunde des Westfälischen Architages 2024:
“ …. Gesundheitsgefahr Arsen – Marcus Stumpf, Vertretung für Birgit Geller.
In grünen Einbänden von Büchern des 19. Jahrhunderts könnte potentiell Arsen belastete Farbe verarbeitet worden sein. Durchgeführte Tests seien jedoch zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Vergiftung mit Arsen bei normalen Arbeitsbedingungen so gut wie ausgeschlossen ist. Daher sind auch keine tiefergehenden Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.
Es wurde abschließend trotzdem auf die Wichtigkeit der Einhaltung von hygienischen Arbeitsmaßnahmen hingewiesen. …“
Pingback: Siegener funfacts: Henner und Frieder | siwiarchiv.de
Heute. findet sich in der Siegener Zeitung der Artikel „Und wer macht jetzt das Programm für das Spiegelzelt? Bei der Stadt Siegen sind einige wichtige Stellen unbesetzt. Die Suche nach einem neuen Stadtarchivar und einem Festivalplaner stockt. . ….“ von Raimund Hellwig, Folgendes ist zu Stadtarchivleitung zu lesen:
“ ….Bereits im Mai 2023 hat Stadtarchivar Dr. Patrick Sturm seinen Abschied aus Siegen verkündet. Der Historiker hatte die Digitalisierung des Archivs fachkundig vorangetrieben und auch sonst viele neue Impulse gesetzt.
Kurz nach Bekanntwerden der Abwanderungspläne des Historikers startete die Verwaltung die erste Ausschreibung für die Nachfolge. Jetzt stellt sich heraus: Auch beidieser Stellenbesetzung scheiterte die Verwaltung, die nach TVÖD 13 ordentlich bezahlte Stelle wurde nicht besetzt. Dem Vernehmen nach gab es nur eine Bewerbung, die dann aber nicht realisiert wurde. Unangenehm ist nach wie vor das Fehlen des Statdarchivars. Der sollte eigentlich eine zentrale Rolle in den Vorbereitungen des 800-jährigen Stadtjubiläums spielen.. So sollte er eine moderierende Rolle im Redaktionsteam der historischen Festschrift spielen.
Das verbleibende Team des Stadtarchivs hat jedoch vieles aufgefangen, was durch die Vakanz nicht sofort erledigt werden konnte. Besetzt werden sollte die Stelle ursprünglich zum 1. August 2023. Die Suche nach einem Bewerber fällt in eine Zeit, in der gerade digitalisierungsbewusste Histroiker eher Mangelware sind. Zudem ist die Konkurrenz groß. In deutschen Archiven sind derzeit einige attraktive Stellen ausgeschrieben. …..“
Guten Tag!
Bin auf der Suche nach der Geburtsurkunde von Frau Gerda Schäfer, Mutter Elisabeth Schäfer geborene Witt.
Geboren in Siegen (wahrscheinlich)
Geboren um 1930 bis 1935
Danke im Voraus für weitere Hiweise
Quelle zur Geschichte des Kunstschutzbunkers in Siegen im Berliner Bundesarchiv:
R 4901/12297 (Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung), Auslagerung von Kunstbesitz. – Bergung in Bergwerke, März – Okt. 1944
Enthält: Überführung rheinischer Kunstschätze von Kochendorf (Württemberg) in Bergwerke; Einlagerungen in Alt-Aussee, Bergungsstollen für Museumsschätze in Siegen; Kunstgegenstände des Kölner Doms und anderer Kölner Kirchen (in Pommersfelden, Geibach, Köln)
In Otto Ermerts „Geschichte der Ingenieurschule für Bauwesen in Siegen, 1853-1962. Siegen 1967, finden sich auf den S. 46, 48, 59,60 Hinweise auf einen ehrenamtlichen Lehrer Arnold. Eine Überprüfung des Lehrerverzeichnises (Das Lehrpersonal der Wiesenbauschule und ihrer Nachfolge-Institutionen“ (1853-2003) beigefügt in Otto Ermert/Rudolf Heinrich:“ 150 Jahre Bauwesen in Siegen. 1853-2003 Von der Wiesenbauschule zur Universität.“ Siegen 2003, ergab folgende Angaben:
Arnold, Otto, †1944
1913 – 1932 Nebenamtlicher Lehrer der Wiesenbauschule/Kulturbauschule für Rechnen, Planimetrie, Geschichte, Erdkunde,
Naturkunde
Pingback: Tersteegen für Kurzentschlossene in Freudenberg | siwiarchiv.de
2 Funde zu Otto Arnold in „Das Volk“:
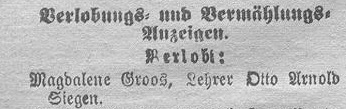
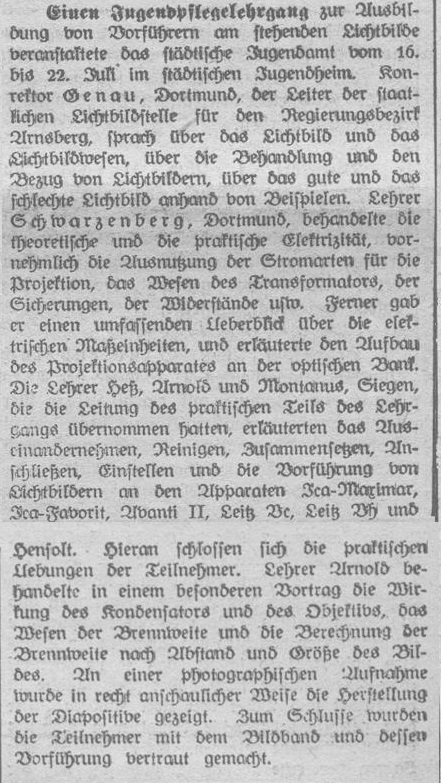
9. Juni 1906:
1. August 1929:
s. a.
Pingback: Video: „Lederherstellung im Siegerland“ (WDR retro) | siwiarchiv.de
Pingback: Archivvgesetz NRW: Unerwartete Wende | siwiarchiv.de
Hierbei handelt es sich – leider – um einen Aprilscherz.
s. a. Andreas Krüger: 1848/49 – Die deutsche RevolutionSteine fliegen in Laasphe, Tumulte in Erndtebrück, relative Ruhe in Berleburgund der Landrat als Hinterbänkler in Berlin. Der vorliegende Artikel ist die überarbeitete Fassung eines Beitrages in: 1848/49 in Westalen und Lippe. Biografische Schlaglichter aus der revolutionshistorischen Peripherie. Dort unter dem Titel „Wilhelm Friedrich Groos (1801-1874), Schmerzenskind Witgenstein.“ Herausgegeben von Felix Gräfenberg. Münster 2023, (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Westfalen, Neue Folge 48), Seiten 205-215
Pingback: Siegener funfacts: Der Stein | siwiarchiv.de
Pingback: Belegprogramm der Südwestfalenbörse | siwiarchiv.de
Pingback: Hermann Kuhmichel (1898-1965) als Soldat im Zweiten Weltkrieg | siwiarchiv.de
Finissage:


Bebrüßung Martina Kratzel:
Vortrag „Von der Stadtgöttin zur Stadtbaurätin“, Marianne Pitzen (Frauenmuseum Bonn):
Pingback: Blogserie zur Eröffung des Themen Pfads EisenZeitReiseWeg | siwiarchiv.de
Pingback: Blogserie zur Eröffung des Themen Pfads EisenZeitReiseWeg | siwiarchiv.de
Link zur Online-Version
Rezension im Blog der LWL-Alltagskultur: https://www.alltagskultur.lwl.org/de/blog/werner-freitags-landesgeschichte/
Heute in der Siegener Zeitung:

Sehr schön! Aber dieser Mühe haben sich in letzter Zeit auch die beiden Wittgensteiner Bernd Homrighausen und Bernd Stremmel unterzogen. Ihre Ergebnisse sind auf der -noch nicht vollständigen- Homepage von Bernd Homrighausen in den Grenzen des Altkreises Wittgenstein eingetragen. https://grenzsteine-wittgenstein.de/
Eine spannende Geschichte könnte der Vergleich dieser beiden Erfassungen von Grenzsteinen sein. Immerhin liegen zwischen den Exkursionen vier Jahrzehnte, in denen viel im Wald passiert ist. Grenzsteine verschwinden auch schon mal, fahrlässig oder absichtsvoll.
Danke für die Ergänzung! Und: ja, dies wäre ein schönes Projekt.
Suche geschichtliche Zusammenfassung Siegen/Siegerland von Rennöfen (ca. 400v.Ch.) bis Zur Universitätsstadt
Auf der Jubiläumsseite der Stadt findet sich eine Chronik: https://www.siegen800.de/geschichtliches/zeitleiste/
Pingback: Digitalisierungsprojekt: Die Siegener Charlottenhütte im Bild | siwiarchiv.de
Meine Großmutter, die Mutter meines Vaters war eine geborene Giebeler aus Niederschelderhütte. Zwei ihrer Brüder waren Unternehmer im Rheinland.
Pingback: Blogserie zur Eröffung des Themen Pfads EisenZeitReiseWeg | siwiarchiv.de
Pingback: Lesefunde – Ingram Braun
Pingback: Lucie Stöcker (geb. 1917) – eine „Herumtreiberin“ im Nationalsozialismus | siwiarchiv.de
Gestern erhielt siwiarchiv die Antwort der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück | Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten:
“ …. Die Recherche zeigte, dass wir keine originalen Dokumente zu Lucie Stöcker haben. Ein Dokument befindet sich in Wareschau bzw. in Lund. Dabei handelt es sich um eine Namensliste, die die Registrierung im KL Ravensbrück dokumentiert.
Laut dieser sogenannten Zugangsliste wurde sie am 12.9.1942 mit der Haft-Nr. 13825 im KL Ravensbrück registriert.
Quellen:
IPN Warschau, MF Nr. 135 Sygn. 57/108-109
Lunds Universitet, Samling Łakociński, Z., Volym 22
https://www.alvin-portal.org/alvin/imageViewer.jsf?dsId=ATTACHMENT-0267&pid=alvin-record:109656
https://collections.arolsen-archives.org/de/document/3761967 ….“
Die Geschichte von Lucie Stöcker ruft in Erinnerung, dass sozialrassistische/sozialchauvinistische Motive innerhalb der nazistischen Bevölkerungspolitik/Volksgemeinschaftspolitik neben zweitens ethnisch-rassistischen und drittens rassehygienischen Motiven eine große Rolle spielten. Es sei gesagt, dass die Bevölkerungsgruppe der als „Zigeuner“ oder „Zigeunermischling“ Kategorisierten immer aus den ersten beiden Gründen und mitunter auch aus allen drei (etwa als „Taube“ oder „Geisteskranke“) dieser Politik zum Opfer fielen. Dabei bedienten sich die Organisatoren der Ausgliederung und der Vernichtung an den Schreibtischen, an denen sie in der Regel saßen und über Auslese und Vernichtung entschieden, nicht nur „fachlicher“ Einschätzungen von Pädagogen, Medizinern und Bevölkerungsexperten, sondern zugleich der Ressentiments, die inzwischen mit modernen Massenmedien in die Bevölkerung eingebracht werden konnten und bei vielen Adressaten insbesondere aus den Mittelschichten auf einen fruchtbaren Boden fielen. Auch Angehörige der Roma-Minderheit gehörten – kollektiv gewertet als Angehörige der „Unterschichten“ – zu den Opfern der sozialen Auslese, der „Minusauslese“, wie die Experten es in ihren Schriften nannten. In diesem Fall kann das Aktive Museum mit seinem Namensverzeichnis der Opfer auf eine intensive Recherche verweisen.
Es ist auch festzustellen, dass das sozialchauvinistische Exklusionsmotiv nach wie vor lebendig ist und von der Mehrheitspolitik eingesetzt und wahlpolitisch genutzt wird. Z. B. in der Migrations- oder der Sozialhilfefrage.
Danke für den einordnenden Kommentar!
Auch Gottfried Karl Alfred Kohn, * 02.07.1918 in Siegen, † 08.04.1983 in Siegen, gehörte zur Gruppe der „vergessenen Opfer“. Seine Eltern, der zum Protestantismus konvertierte Fabrikarbeiter Johann Ferdinand Kohn, geboren am 21.04.1876 bei Königsberg, heiratete am 05.07.1917 in Siegen die Dienstmagd Lina Susanne Hommrichhausen (1887-1949), ließen sich 1923 scheiden. Die Mutter heiratete erneut.
Gottfried Kohn wurde am 10.07.1941 in Siegen angeblich wegen Arbeitsverweigerung inhaftiert. Am 4. August 1941 wurde er von Siegen in das berüchtígte Polizeígefängnis Dortmund (Steinwache) überstellt. Im Gefängnisbuch wird er unter der Nummer 2733 aufgeführt. Es finden sich dort die Vermerke „politisch“ und „Arbeitsverweigerung“. Durch die Staatspolizei wurde er von Dortmund am 08.08.1941 in ein Arbeitslager nach Recklinghausen gebracht. Dort befand er sich bis zum 08.10.1941. In der Folgezeit war Kohn Häftling in mehreren Polizeigefängnissen und Konzentrationslagern. Im KZ Sachsenhausen war er ab September 1943 inhaftiert (Häftlingsnummer 71276). Anschließend wurde er ins KZ Buchenwald (Häftlingsnummer 61071) überstellt. Ab 11.04.1945 war er im KZ Dachau interniert (Häftlingsnummer 152846). Befreit wurde er dort am 29.04.1945 durch US-amerikanische Soldaten. Sehr wahrscheinlich hat er als KZ-Häftling an einem Todesmarsch teilgenommen, der in der Endphase des Krieges vom KZ Buchenwald über Flossenbürg nach Dachau führte.
Nach dem Krieg wurde er in den Jahren bis 1954 verschiedentlich straffällig wegen Diebstahls, Betrugs und Unterschlagung. Mit seiner ersten Ehefrau, Hilde Müller, hatte er ab 1955 drei Kinder. In zweiter Ehe war er ab 1959 mit Erna Fischbach (1925-1976) verheiratet. Bis zu deren Tod wohnte das Paar in ihrem Haus Boschgotthardshütte 35, das mit den übrigen Häusern dem Bau der Hüttentalentlastungsstraße weichen musste.
Gottfried Kohn war in Weidenau als „Möbel-Franz“ bekannt, der mit seinem Handkarren Sperrmüllstandorte aufsuchte und verwertbare Gegenstände, z. B. kleine Möbelstücke und anderen Krempel einsammelte, die er beim Haus in Boschgotthardshütten deponierte. Das Antiquitätengeschäft Borkenhagen gehörte wohl zu seinen Kunden!! Der Spitzname „Möbel-Franz“ passte insofern, als G. Kohn als Beruf Schreiner angab. Zuletzt war er als Maschinenarbeiter tätig. Er bezeichnete sich als „Halbjude“. Seine Bemühungen um eine Entschädigung für die erlittene Freiheitsberaubung und Verfolgung wurden abgelehnt. Mitte der 1970er Jahre wurde für Gottfried Kohn eine Amtsvormundschaft eingerichtet. Zuletzt wohnte er in der Körnerstraße in Siegen.
Der Text ist verkürzt aus dem Buch „Mein Schulweg“ von Rüdiger Fries entnommen. Der nach einjähriger Suche Fotos von Gottfried Kohn, seiner Frau und dem Haus in Boschgotthardshütten erhielt, die die ehemalige Nacharin, Frau Anneliese Flender, gemacht hatte.
Danke für die Ergänzung!
Ein weiteres Opfer dieser Verfolgung ist:
“ ….. Robert Wilhelm König, Rangierer und später Nachtwächter im Zwangsarbeiterlager der Hüttenwerke Siegerland in Eichen, wird im Juli 1944 verhaftet und als „Berufsverbrecher“ im KZ Neuengamme inhaftiert. Dort stirbt der Häftling mit der Nummer 69 000 am 5. Februar 1945 angeblich an den Folgen einer Darminfektion. „Rassenschande“ wurde dem Müsener vorgeworfen, er soll sexuellen Kontakt zu Zwangsarbeiterinnen gesucht haben. Tatsächlich, so später die Richter in der Bundesrepublik, sei der Müsener als NS-Gegner verfolgt worden — dafür spreche allein schon die unverhältnismäßig lange Haft. ….“ (Westfälische Rundschau, 26.10.2016)
In Müsen ist ein Stolperstein verlegt für Robert König, der seinerzeit aus der Gemeinde Dobel (Baden-Würtemberg) vermutlich zum Bergbau nach Müsen kam. Ich konnte damals mit dem Archivar der Gemeinde Dobel mich austauschen und einiges über Robert König erfahren, z.B. dass er mit 12 Jahren Vollwaise wurde und das jüngste von 12 Geschwistern war. Bei der Stolpersteinverlegung wurde vom Hilchenbacher Archivar Herrn Gämlich Grußworte von noch lebenden Verwandten aus Dobel verlesen. Das war sehr berührend. Weniger berührend war, dass auch 2016 noch Gerüchte über Königs Verhältnis zu russischen Frauen im Dorf verbreitet werden mit einem recht gehässigen Unterton. Bei Interesse stelle ich gerne die Unterlagen und/oder Kontakt aus Dobel zur Verfügung.
Danke für die Informationen! Die Unterlagen und der Kontakt nach Dobel werden sicher sehr hilfreich bei der weiteren Aufarbeitung.
2 Presseberichte zu Lucie Stöcker:
Hilchenbacher Zeitung, 11. November 1939:
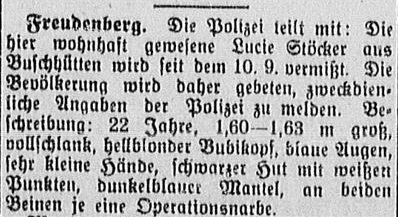
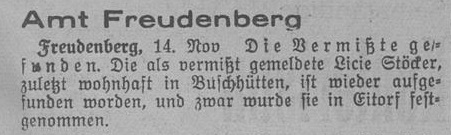
Siegerländer Nationalzeitung, 14. November 1939:
Eine personenbezogene Akte von Lucie Stöcker befindet sich im Archiv des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (Archiv LWL) im Bestand 663 (Landarmen- und Arbeitshaus Benninghausen). Die Signatur lautet: LWL-Archivamt für Westfalen, Archiv LWL, Best. 663/10588.
Lucie Stöcker ist am 7. August 1940 in Benninghausen aufgenommen worden und am 30. Juli 1942 mit einem Sammeltransport nach Dortmund entlassen worden.
Die Akte umfasst 63 Blätter.
Quelle: Email LWL-Archivamt, 15.4.2024
Auswertung der Akte als PDF
Pingback: Vortrag: „Filme im Archiv“ | siwiarchiv.de
Pingback: Vortrag: „Filme im Archiv“ | siwiarchiv.de
Pingback: Vortrag: „Filme im Archiv“ | siwiarchiv.de
Pingback: Jung in Jungenthal. Die größte Baumwollmaschinenspinnerei in Preußen -
Rezension:
Stefan Gorißen, Rezension zu: Bartolosch, Thomas A.: Jung in Jungenthal. Die größte Baumwollmaschinenspinnerei in Preußen. Gründung, Aufstieg und Blütezeit, Krisen und Niedergang im 18. und 19. Jahrhundert. Betzdorf/Sieg 2022 , ISBN 978-3-00-073721-3, In: H-Soz-Kult, 19.04.2024, <http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-143134>.
Pingback: Video-Vortrag: 300 Jahre Tersteegens „Verschreibung“ an Jesus | siwiarchiv.de
Pingback: Archaeology 2024-04-22 – Ingram Braun
Biographische Informationen zum Architekten des Siegener Landratsamtes (1903), Heinrich Markmann, finden sich hier:
https://glass-portal.hier-im-netz.de/hs/m-r/markmann_heinrich.htm.
Einen ersten Einblick in des Wirken Günter Reicherts in der Stadt Siegen erlaubt: Reichert, Horst: Nachkriegsarchitektur in Siegen – Bauten von Günter Reichert, in: Siegener Beiträge; Siegen; 16 (2011), S. 181-215
Die Erinnerungen des Zeitzeugen Lorenz sollten auf jeden Fall in die noch zu schreibende Geschichte des „FFH Trupbacher Heide“ einfließen. Für die 1930er Jahre wäre allerdings die durch „oral history“ nicht zu ersetzende Verwertung archivischer Dokumente (u.a. reichhaltig im Siegener Stadtarchiv vorhanden) unverzichtbar. Kleine Korrektur zum Video: Es trifft nicht zu, dass nach dem Einzug des ersten Regiments irgendjemand plötzlich bemerkt hätte, dass zu den Kasernen doch auch ein Übungsplatz gehören müsse, worauf „man beratschlagt“ habe und dann „zu einem Entschluss gekommen“ wäre. Während der anfangs geheim gehaltenen persönlichen Verhandlungen des Oberbürgermeisters Fissmer mit dem Kriegsministerium bzw. der Wehrmacht hatten diese von vornherein klargemacht, dass Siegen nur bei Bereitstellung eines Übungsgeländes in der Größe mehrerer hundert Hektar eine Chance hätte, Garnisonstadt zu werden. Ein solches Areal war innerhalb der Stadtgrenzen Siegens nicht verfügbar. Das Problem löste Herr Fissmer dank seines selbstherrlichen und skandalösen Amtsverständnisses kurzerhand dadurch, dass er der Wehrmacht die verlangte Fläche in den Ämtern Weidenau und Freudenberg des Landkreises Siegen offerierte, über die er als OB der kreisfreien Stadt Siegen keinerlei Verfügungsgewalt hatte. Als der Landrat endlich davon erfuhr, musste er sich mit den vollendeten Tatsachen abfinden, da Herr Fissmer inzwischen die nötige Legitimation vorweisen konnte, nachdem er von der Wehrmacht zu ihrem Bevollmächtigten („Kommissar“) für den Ausbau des Militärstandortes ernannt worden war und somit jenseits der Zuständigkeitsgrenzen eines Kommunalpolitikers agieren konnte. Das versetzte ihn dann auch in die Machtposition, die Enteignung der ca. 90 Trupbacher Haubergsgenossen zu veranlassen, nachdem die Verkaufsverhandlungen mit ihnen gescheitert waren. Den Dokumenten zufolge war das Verhältnis der Trupbacher zu Fissmer schon seit den 1920er Jahren zerrüttet, da diesen die permanenten Versuche des Siegener Oberbürgermeisters, als Bauland geeignete Flächen in der Weidenauer Gemeinde Trupbach „seiner“ Stadt einzuverleiben, schlichtweg auf die Nerven gingen. Die vom Reichsarbeitsdienst vorgenommene Rodung des Haubergsgeländes auf der Trupbacher Höhe erwies sich schließlich als deutlich schwieriger und aufwendiger, als Fissmer vorausgesehen hatte. Immerhin ergab sich während dieser Arbeiten nebenbei noch die Gelegenheit zu archäologischen Entdeckungen.
Danke für den Kommentar und die historische Korrektur! S. auch folgende Kommentare hier, hier und hier.
Ich bin da groß geworden, habe meine Jugend in der Fr.-Friesenstrasse verbracht. War mit meinem Vater sonntags zum Fußballplatz und habe den Sportfreunde Siegen (fast) jedes Spiel, zugeschaut.
Es war eine unbeschwerte Zeit.
Bin 1941 geb.
In der Reithalle wohnte später ein Haus-Mitbewohner.
Pingback: Blogserie zur Eröffung des Themen Pfads EisenZeitReiseWeg | siwiarchiv.de
Pingback: Blogserie zur Eröffung des Themen Pfads EisenZeitReiseWeg | siwiarchiv.de
Hallo Herr Moisel,
Sie erinnern sich gewiss, dass ich Ihnen vor einigen Jahren eine genealogische Baumscheibe geschenkt habe. Sie erinnern sich auch, dass ich damals geschrieben habe, dass ich mich mit den Hoffmanns aus Eisern und den Daubs aus Eiserfeld beschäftige. Meine Arbeit ist inzwischen abgeschlossen, und ich würde sie Ihnen gerne mal zusenden, um den Fachmann dazu zu hören. Ich habe die Arbeit Herrn R. Daub und vier interessierten Genealogen zur Verfügung gestellt, weil ich nicht möchte, dass
sie in der Schublade vergammelt. Wenn Sie interessiert sind, eine Warnung vorab: Die Arbeit kann aufgrund des Umfangs (ca. 430 Seiten) nur am Bildschirm gelesen bzw. geblättert werden. Sie müssen das einleitende Lesebuch nicht lesen, sollten Sie aber, um besser zu verstehen, was ich eigentlich gemacht und wie ich gearbeitet habe. Nun bleibt mir nur noch, Ihnen einen guten Abend zu wünschen.
Glückauf!
Dr. Eckart Hoffmann
Zur Sicherheit habe ich Ihren Kommentar auch direkt an Kollegen Moisel weitergeleitet. Übrigens: Ihre genealogische Forschungsarbeit ist auch für das Stadtarchiv Siegen und Kreisarchiv Siegen-Wittgenstein interessant.
Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund wichtiger Umstrukturierungen innerhalb des Arbeitskreises Heimatgeschichte Daadener Land wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns mitteilen könnten, wer von uns Ihnen zu welcher Zeit die Unterlagen der Erzbergbau überlassen hat.
Vielen Dank und freundliche Grüße
Volker Rosenkranz
Pingback: Ausstellung: „Siegen. Fremde. Heimat“ | siwiarchiv.de
Seit gut einem halben Jahr sind die Entnazifizierungsakten des Landesarchivs NRW online. Sie erlauben nicht nur die Suche nach einzelnen Personen, sondern auch die Suche nach Entnazifizierungsverfahren zu einer bestimmten Berufsgruppe (Suchworte Entazifizeirung + Siegen + Berufsgruppe). In der nachfolgenden Aufstellung finden sich nun Berufungsverfahren von Lehrerinnen, die am Siegener Berufungsausschuss nachgewiesen werden konnten. Ausgewertet wurden lediglich die zwischen 1933 und 1945 im Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein tätigen Lehrerinnen. Ein Hinweis noch: die bereits bekannten Lehrerinnen (s. o. ) wurden in der Aufstellung nicht(!) fett hervorgehoben: Entnazifizierungsverfahren des Landesarchivs NRW von Lehrerinnen, die zwischen 1933 und 1945 im Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein tätig waren
Krasas Entnazifizierungsakte ist online einsehbar:
Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland
NW 1127 / SBE Berufungsausschuss Siegen in Siegen NW 1127, Nr. 85
Link: https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=VERZEICHUNGSEINHEIT-Vz_fc42c0c6-652c-4f6a-a2b4-56fe9d236c82
Pingback: Lesefunde – Ingram Braun
Hello Mr. Moisel!
Belated congratulations on your 70th birthday celebrated last year. This is Hank Jones, formerly of San Diego, California now living (at aged 84) in Prescott, Arizona. We corresponded quite a few times about twenty years ago, and you were kind enough to purchase my two volume set THE PALATINE FAMILIES OF NEW YORK – 1710 as well as its companion volume MORE PALATINE FAMILIES, all of which contained some sections on emigrants from the overall Nassau-Siegen region. I wanted to let you know that all eleven of my books (now out of print) are available in a special section of Ancestry.com – the link being: https://www.ancestry.com/search/collections/62327/ if ever you would want to use some of my additional books such as the three volume EVEN MORE PALATINE FAMILIES. I am still collecting more information on the 18th century emigrant families and their origin.
I wanted to ask you specifically if you have ever encountered the PETER & JEREMIAH EIGNER (EICHENER, EGNER, AIGNER et var) family who arrived in colonial New York in 1710 – their origins still undocumented in Germany. The always seemed to associate with families from your area like the Hagers, Schramms, and Kiefers (see PFNY-1710). Any advice or suggestions certainly would be welcome. I started researching the 847 families in the „Palatine“ emigration while still at Stanford University in 1960 – and the hunt continues … it (happily) never ends.
My very best wishes to you and your family – and my thanks for all you have done over these many years in furthering our knowledge of Siegen history and genealogy.
Hank Jones
(Henry Z Jones Jr.,
Fellow and Past President of The American Society of Genealogists).
http://www.hankjones.com HZJ3@aol.com
Folgende Entnazifierungsakte zu Gustav Richter ist online einsehbar:
Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland
NW 1127 / SBE Berufungsausschuss Siegen in Siegen NW 1127, Nr. 1555, Link: https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=VERZEICHUNGSEINHEIT-Vz_bece199b-2583-41c6-8e09-c6ed6eef1a97
Zu Reinhard Lüster ist folgende Entnazifizierungsakte online einsehbar:
Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland
NW 1127 / SBE Berufungsausschuss Siegen in Siegen NW 1127, Nr. 1119, Link: https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=VERZEICHUNGSEINHEIT-Vz_2f550d51-009f-46b6-8d54-9800c6616967
Zu Ulf Lüster ist folgende Entnazifizierungsakte online einsehbar:
Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland
NW 1127 / SBE Berufungsausschuss Siegen in Siegen NW 1127, Nr. 1198, Link: https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=VERZEICHUNGSEINHEIT-Vz_3f33ff29-6317-481b-b52e-5a3f35a58c7a
Folgende Entnazifizierungsakte zu Moning ist online einsehbar:
Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland
NW 1127 / SBE Berufungsausschuss Siegen in Siegen NW 1127, Nr. 865, Link: https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=VERZEICHUNGSEINHEIT-Vz_04187897-dbac-4aa5-a5b3-15b26d4e79c7
Folgende Entnazifizierungsakte zu Alfred Sommer ist online einsehbar: Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland
NW 1127 / SBE Berufungsausschuss Siegen in Siegen NW 1127, Nr. 980, Link: https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=VERZEICHUNGSEINHEIT-Vz_1b13241f-24d2-4ffe-9a28-3a91baab9d10
Folgende Entnazifizierungsakte zu Alexander Hirschfeld ist online einsehbar:
Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland
NW 1127 / SBE Berufungsausschuss Siegen in Siegen NW 1127, Nr. 412, Link: https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=VERZEICHUNGSEINHEIT-Vz_de62b878-f84f-447d-87e7-5314ce90c330
Die genannte Entnazifizierungsakte ist online einsehbar: https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=VERZEICHUNGSEINHEIT-Vz_078f94b3-10d9-4642-92de-dccb6a73209a
Pingback: Blogserie zur Eröffung des Themen Pfads EisenZeitReiseWeg | siwiarchiv.de
Folgende Entnazifizerungsakte zu Paul Dresler ist onlöine einsehbar:
Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland
NW 1000 / SBE Hauptausschuss Regierungsbezirk Düsseldorf NW 1000, Nr. 13781, Link: https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=VERZEICHUNGSEINHEIT-Vz_56f09fd4-44ff-4173-976d-2db78f5dd544
Folgende Entnazifizierungsakte zu Frau Dr. Riecke ist online einsehbar: Landesarchiv NRW Abteilung Rheinland
NW 1127 / SBE Berufungsausschuss Siegen in Siegen NW 1127, Nr. 1015, Link: https://www.archive.nrw.de/archivsuche?link=VERZEICHUNGSEINHEIT-Vz_38a666d4-63aa-419a-8980-6f5b9ce6d13a
Pingback: Kunst im Treppenhaus – Archivausgabe 2024: „Charlottenhütte“ | siwiarchiv.de
Pingback: Kunst im Treppenhaus – Archivausgabe 2024: „Charlottenhütte“ | siwiarchiv.de
Pingback: Kunst im Treppenhaus – Archivausgabe 2024: „Charlottenhütte“ | siwiarchiv.de
Pingback: Kunst im Treppenhaus – Archivausgabe 2024: „Charlottenhütte“ | siwiarchiv.de
Pingback: Kunst im Treppenhaus – Archivausgabe 2024: „Charlottenhütte“ | siwiarchiv.de
0:25:14 Erndtebrück, Kreis Siegen-Wittgenstein
hallo,
wäre schon cool, nachdem bunker erich eine eingetragene wortmarke und denkmal an den kalten krieg ist, das oben in z.b.
0:25:14 Denkmal Bunker Erich ® Erndtebrück, Kreis Siegen-Wittgenstein
zu ändern.
lg aus dem bunker erich
Pingback: ‚Station 1‘ auf dem Weg zur Ausgrabungsstätte Gerhardsseifen komplett | siwiarchiv.de
Guten Tag,
ich suche Kontakt zur Familie von Gothmar Thiemann. Sein älterer Bruder Paul Gerhard war mit meiner Mutter befreundet, und ich habe in ihrem Nachlass Briefe von PG gefunden, die ich abgeben möchte.
Können Sie bitte meine email an die Familie weiterleiten?
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Vera Neumann
Hauptstr. 2
49536 Lienen
0157 – 5363 5827
Pingback: Adolf Busch – ein Komponist? | siwiarchiv.de
Anwort des Staatsarchivs München:
“ …. Lucie/Luzie Stöcker [konnte] in den hier verwahrten Haftbüchern und zeitgenössischen Karteien der Strafanstalt Aichach nicht nachgewiesen werden. Die Häftlingspersonalakten liegen zwar für die NS-Zeit relativ umfangreich vor (ca. 12.000 Einzelfallakten), für die Zeit nach dem 2. Weltkrieg wurde aber lediglich eine kleine Musterüberlieferung dieser Quellengruppe übernommen. Unterlagen zu Lucie/Luzie Stöcker befinden sich nicht darunter.“
Pingback: Online: Archivpflege in Westfalen-Lippe 100 (2024) – Archivalia
Pingback: Youtube-Serie: „Unterm Hakenkreuz. Westfalen 1933 – 1945 im Amateuerfilm“ | siwiarchiv.de
Pingback: Youtube-Serie: „Unterm Hakenkreuz. Westfalen 1933 – 1945 im Amateuerfilm“ | siwiarchiv.de
Pingback: Youtube-Serie: „Unterm Hakenkreuz. Westfalen 1933 – 1945 im Amateuerfilm“ | siwiarchiv.de
Pingback: Youtube-Serie: „Unterm Hakenkreuz. Westfalen 1933 – 1945 im Amateuerfilm“ | siwiarchiv.de
Die Freigabe des kostenpflichtigen SZ-Archivs war ein Schnellschuss, wenn man sich die Qualität der Texte anschaut, die das Textbearbeitungsprogramm den Lesern zumutet. Natürlich sind diese Fehler in den Originalzeitungsartikeln nicht enthalten. Für die Jahre bis 1945 kann man aber die Suche im SZ-Archiv mit den gratis im Internet aufrufbaren SZ-Jahrgängen kombinieren. Ist zwar etwas umständlich, kostet aber kein Geld.
Weitere Rezension: Schulte, David: Rezension zu “Westfalen. Geschichte eines Landes, seiner Städte und Regionen in Mittelalter und Früher Neuzeit”, in: Histrhen. Rheinische Geschichte wissenschaftlich bloggen, 13.05.2024, http://histrhen.landesgeschichte.eu/2024/05/rezension-freitag-westfalen-schulte [„Rezension“ der Rezension: s. https://archivalia.hypotheses.org/201602%5D
Zeitungsfunde zu Carmen Klein:
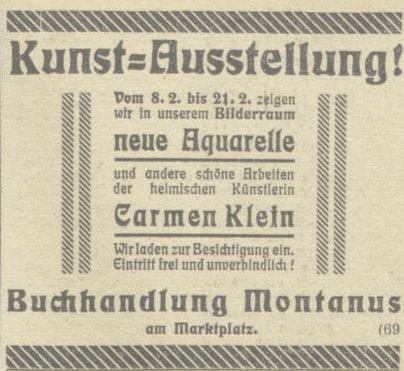
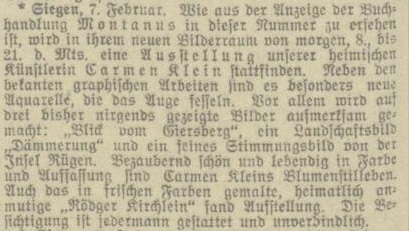
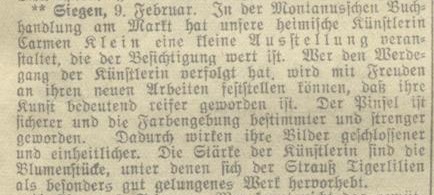
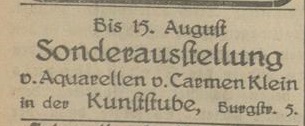
Siegener Zeitung, 7. Februar 1929:
Siegener Zeitung, 9.Februar 1929:
Siegener Zeitung, 3. August 1933:
Das Historische Archiv Krupp hat den Bestand Alfred Krupp online gestellt – s. https://www.archive.nrw.de/historisches-archiv-krupp/von-zuhause-die-aera-alfred-krupp-eintauchen . Eventuell finden sich dort Hinweise zu dessen politischen Duell mit Gerhard Stötzel.
Ich hätte etwas mehr von einem Zeitungsarchiv erwartet. Leider möchte man damit aber weiterhin Geld verdienen und es nicht komplett der Öffentlichkeit zu Verfügung stellen.
Zwar kann man mit Stichwörtern suchen und diese zeitlich eingrenzen, aber dan wird nur ein Teil des Artikels angezeigt und die Zeitungsseite in schlechter Qualität. Für mehr muss man 3-8€ bezahlen.
Bei den Ausgaben mit Frakturschrift, lässt die digitale Erfassung der Texte zu wünschen übrig. Überprüfen lassen sich diese dann auf der Originalseite natürlich nicht.
Ich hoffe man kann als Studierender auch weiterhin Anfragen an das SZ-Archiv stellen und bekommt dann zu dem entsprechenden Thema die Seiten konstenlos zu Verfügung gestellt. Für Seminar oder Abschlussarbeiten wird wohl niemand so viel Geld für mehrere Seiten an Artikeln ausgeben.
Danke an den Hobbyheimatforscher für den Hinweis zu den Ausgaben bis 1945.
Pingback: Gelungenes history marketing – ja oder nein? | siwiarchiv.de
Befinden sich in Geschichtsbüchern nur Fakten?
Finden sich in Archiven nicht zunächst einmal Quellen?
Was ist mit dem saloppen “ Drumherum“ gemeint?
Ich gestehe jeder Zeitung, die ihr Archiv online stellt, zu, sich abzufeiern. Ist wenigstens ein für Historiker:innen nützliches Produkt; sonst erschöpft sich History Marketing ja häufig in „Wir waren schon immer die Grössten!“.
Aus Prinzip gar nicht anfreunden kann ich mich hingegen mit der Kostenpflichtigkeit. Ob das Angebot wenigstens in Bibliotheken gratis zugänglich ist?
Danke für den Kommentar!
Es wird wohl eine Serie:
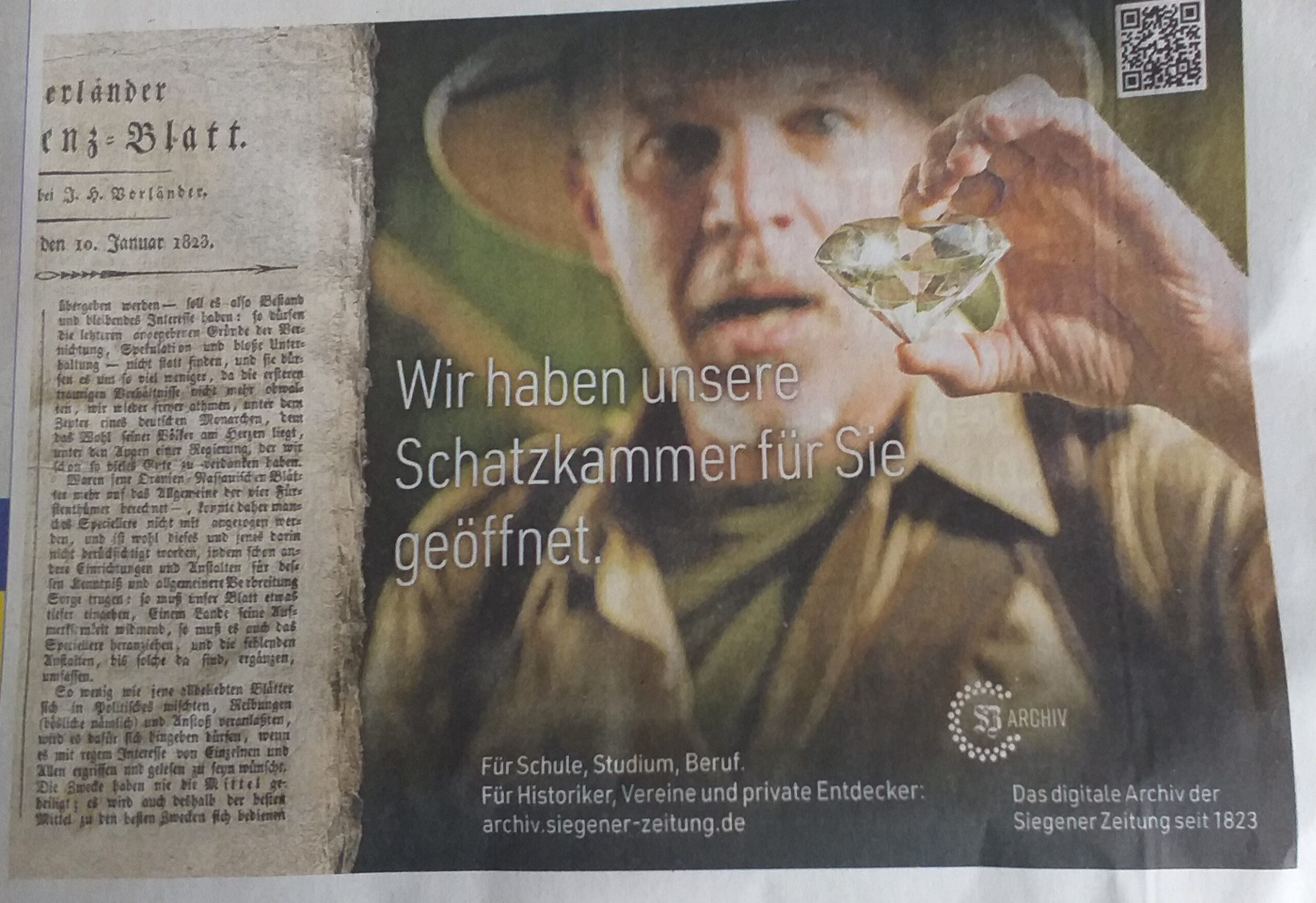
Quelle: SWA, 18.5.2024