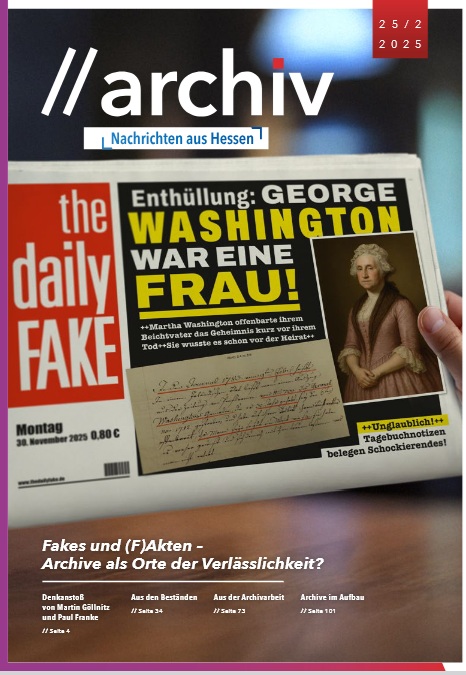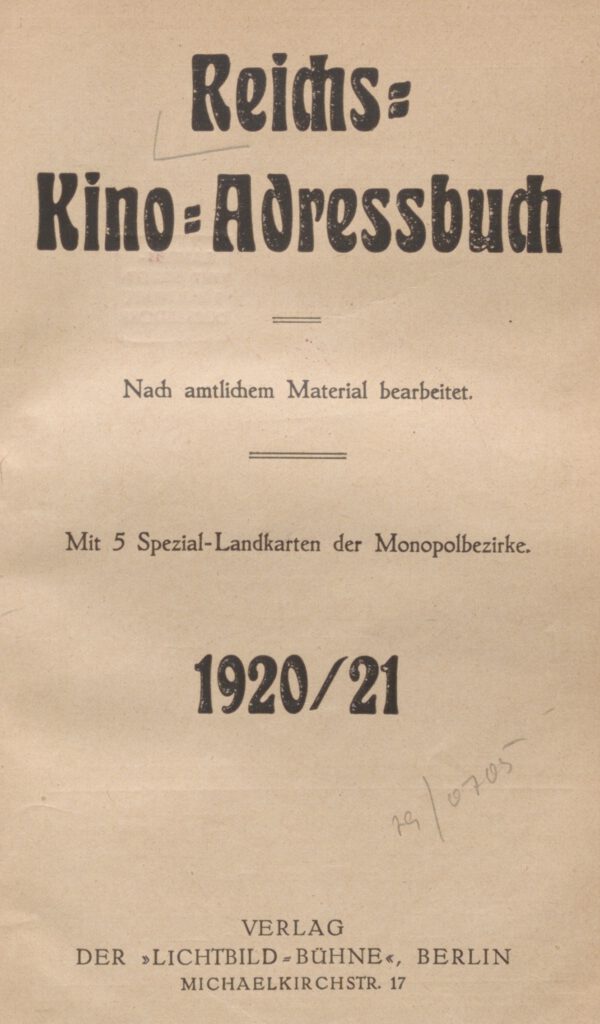40 Jahre Archiv des LVR – Archivarbeit neu erzählt

Einblick in die Kurzvideos. Foto: Ariane Jäger (LVR-AFZ)
Ein besonderes Jubiläum verdient besondere Einblicke: Anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Archivs des Landschaftsverbandes Rheinland (ALVR) ist eine unterhaltsame und zugleich informative kurzweilige Videoreihe entstanden, die den Archivalltag in den Mittelpunkt stellt. Entwickelt wurde das Projekt von den Archivar*innen des LVR in Zusammenarbeit mit dem LVR-Kulturzentrum Brauweiler.
Die Videoreihe nimmt die Zuschauer*innen mit hinter die Kulissen des Archivs und zeigt auf humorvolle, lebendige und leicht zugängliche Weise, was Archivarbeit heute ausmacht. Dabei geht es nicht nur um Akten, Dokumente und historische Quellen, sondern vor allem um die Menschen, die täglich mit Engagement, Fachwissen und Leidenschaft dafür sorgen, dass Geschichte bewahrt, erforscht und für die Zukunft zugänglich gemacht wird. Überraschende Einblicke und ein augenzwinkernder Blick auf den Berufsalltag machen deutlich: Archive sind alles andere als trocken oder verstaubt.
Weiterlesen →


 siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s
siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,
siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz
lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden
kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur
kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive
siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival
vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt
Kontakt


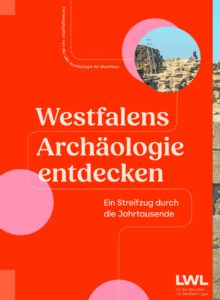 Was gibt es in Westfalen zu entdecken? Keine Frage, eine ganze Menge! Bei archäologischen Ausgrabungen wurden in den letzten Jahren überall in der Region Orte freigelegt, an denen Menschen vergangener Zeiten lebten, arbeiteten und ihre Verstorbenen bestatteten. Die Spuren, die sie dabei hinterließen, reichen von einfachen Verfärbungen im Boden bis zu wahren Meisterwerken, die uns heute noch staunen lassen. Wer schuf in der Steinzeit die Megalithgräber? Wie weit konnte man von einem mittelalterlichen Kirchturm aus blicken? Und woran scheiterte im 19. Jahrhundert der Bau einer Eisenbahnstrecke? Dieses Buch entführt in 90 kurzen Texten in die Forschungen der LWL-Archäologie für Westfalen, die hier anlässlich des Ruhestandes ihres Direktors Prof. Dr. Michael M. Rind Einblicke in ihre Arbeit während seiner 16-jährigen Dienstzeit von 2009 bis 2025 gewährt.
Was gibt es in Westfalen zu entdecken? Keine Frage, eine ganze Menge! Bei archäologischen Ausgrabungen wurden in den letzten Jahren überall in der Region Orte freigelegt, an denen Menschen vergangener Zeiten lebten, arbeiteten und ihre Verstorbenen bestatteten. Die Spuren, die sie dabei hinterließen, reichen von einfachen Verfärbungen im Boden bis zu wahren Meisterwerken, die uns heute noch staunen lassen. Wer schuf in der Steinzeit die Megalithgräber? Wie weit konnte man von einem mittelalterlichen Kirchturm aus blicken? Und woran scheiterte im 19. Jahrhundert der Bau einer Eisenbahnstrecke? Dieses Buch entführt in 90 kurzen Texten in die Forschungen der LWL-Archäologie für Westfalen, die hier anlässlich des Ruhestandes ihres Direktors Prof. Dr. Michael M. Rind Einblicke in ihre Arbeit während seiner 16-jährigen Dienstzeit von 2009 bis 2025 gewährt.  „Bei der 73. Sitzung der Bundeskonferenz der Kommunalarchive am 6./7. Oktober 2025 in Fulda wurde das vom BKK-Unterausschuss Historische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit erarbeitete Positionspapier Historische Bildungsarbeit in Archiven beschlossen. Es ersetzt das BKK-Positionspapier „Historische Bildungsarbeit als integraler Bestandteil der Aufgaben des Kommunalarchivs“ von 2005.
„Bei der 73. Sitzung der Bundeskonferenz der Kommunalarchive am 6./7. Oktober 2025 in Fulda wurde das vom BKK-Unterausschuss Historische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit erarbeitete Positionspapier Historische Bildungsarbeit in Archiven beschlossen. Es ersetzt das BKK-Positionspapier „Historische Bildungsarbeit als integraler Bestandteil der Aufgaben des Kommunalarchivs“ von 2005.