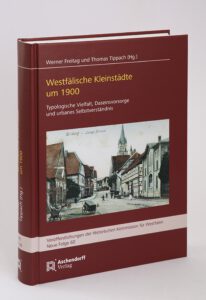 Typologische Vielfalt, Daseinsvorsorge und urbanes Selbstverständnis. Beiträge der Tagung am 4. und 5. Oktober 2019 in Büren, Hg. von Werner FREITAG und Thomas TIPPACH, Münster 2021, 456 Seiten, Festeinband (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Westfalen, Neue Folge 60).
Typologische Vielfalt, Daseinsvorsorge und urbanes Selbstverständnis. Beiträge der Tagung am 4. und 5. Oktober 2019 in Büren, Hg. von Werner FREITAG und Thomas TIPPACH, Münster 2021, 456 Seiten, Festeinband (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Westfalen, Neue Folge 60).
Aschendorff ISBN 978-3-402-15141-9
Ein dichtes Netz an Kleinstädten war charakteristisch für Westfalen um 1900 – diese Eigenart an ausgewählten Beispielen vorzustellen und zu differenzieren, war Aufgabe der Tagung in Büren am 4. und 5. Oktober 2019. Sie knüpft dabei an die aktuelle Kleinstadtforschung, aber auch an den „Historischen Atlas Westfälischer Städte“ an.
Vollzog sich in den Kleinstädten der soziale, topographische und urbane Wandel ähnlich wie in den Großstädten, nur eben „bescheidener“ und später? Oder gab es spezifisch kleinstädtische Lösungen und urbane Kulturen? Nach einführenden Beiträgen werden in der ersten Sektion Beispiele gezeigt, für die das späte Kaiserreich eine Zeit des Wachstums, der Funktionsgewinne und der Zunahme von Urbanität war. Allerdings gab es auch Städte, die nur wenig oder gar nicht wuchsen – diesen wird in der zweiten Sektion nachgegangen. In der abschließenden, dritten Sektion werden die Versuche westfälischer Titularstädte thematisiert, sich von der preußischen Landgemeindeordnung von 1856 zu lösen und volle Stadtrechte zu erlangen.
Die Beiträge des Bandes: Weiterlesen →

 siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s
siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,
siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz
lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden
kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur
kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive
siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival
vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt
Kontakt








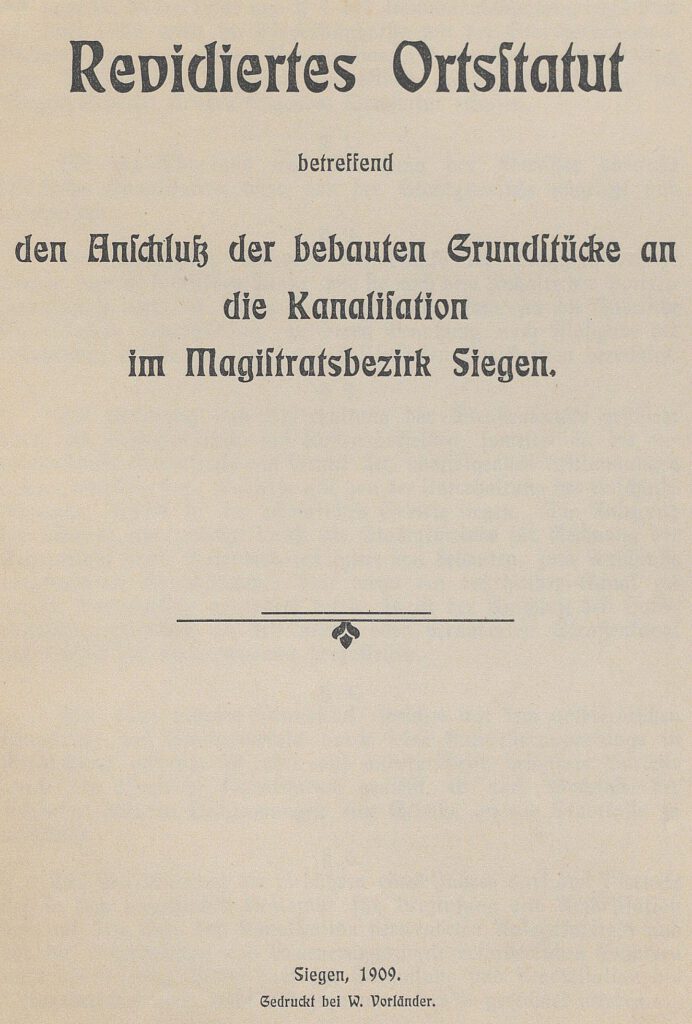 Die Universitäts- und Landesbibliothek Münster hat vor kurzem das revidierte Ortsstatut betreffend den Anschluß der bebauten Grundstücke an die Kanalisation im Magistratsbezirk Siegen aus dem Jahr 1909
Die Universitäts- und Landesbibliothek Münster hat vor kurzem das revidierte Ortsstatut betreffend den Anschluß der bebauten Grundstücke an die Kanalisation im Magistratsbezirk Siegen aus dem Jahr 1909 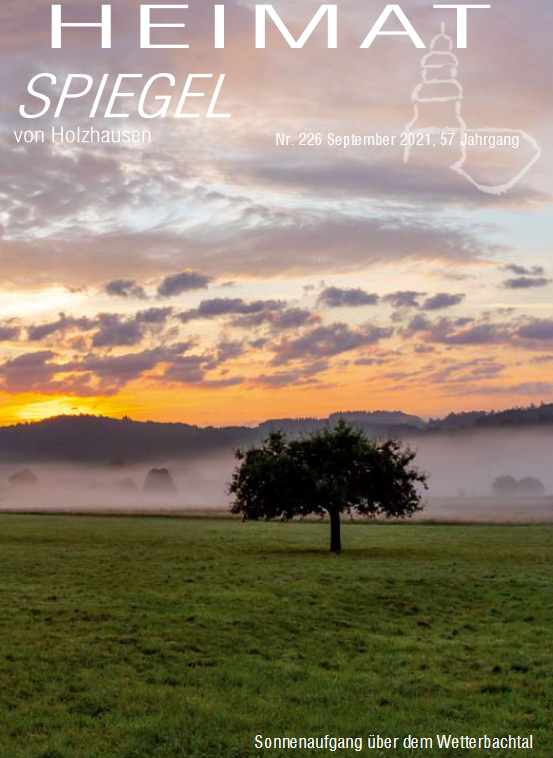
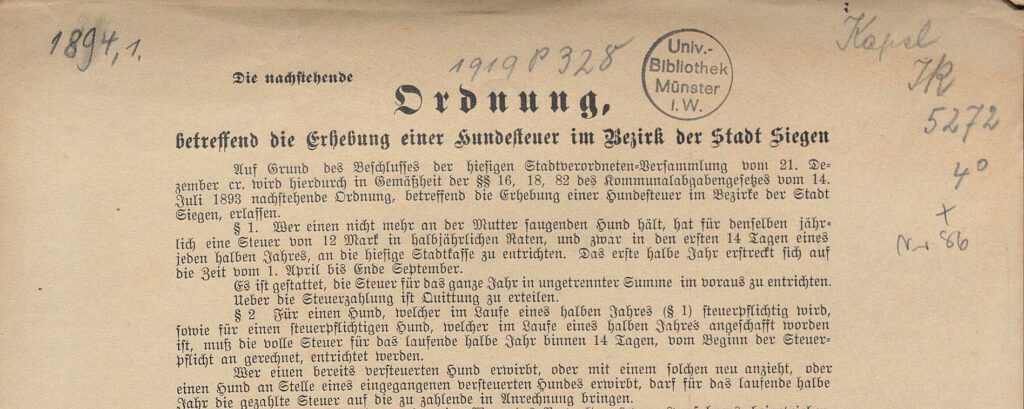 Die Universitäts- und Landesbibliothek Münster hat unlängst die
Die Universitäts- und Landesbibliothek Münster hat unlängst die 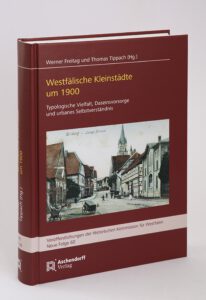 Typologische Vielfalt, Daseinsvorsorge und urbanes Selbstverständnis. Beiträge der Tagung am 4. und 5. Oktober 2019 in Büren, Hg. von Werner FREITAG und Thomas TIPPACH, Münster 2021, 456 Seiten, Festeinband (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Westfalen, Neue Folge 60).
Typologische Vielfalt, Daseinsvorsorge und urbanes Selbstverständnis. Beiträge der Tagung am 4. und 5. Oktober 2019 in Büren, Hg. von Werner FREITAG und Thomas TIPPACH, Münster 2021, 456 Seiten, Festeinband (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Westfalen, Neue Folge 60).

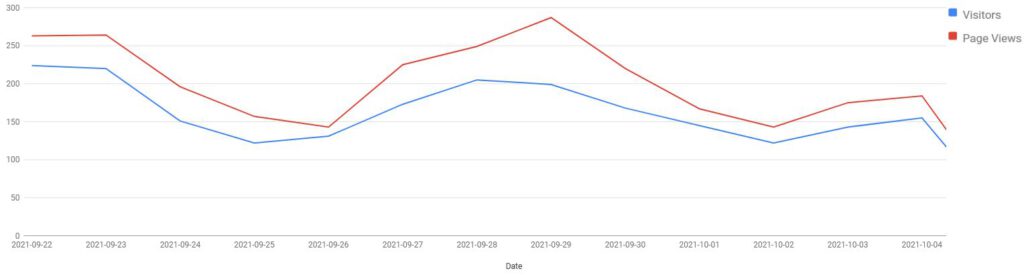 Link zur vorherigen
Link zur vorherigen