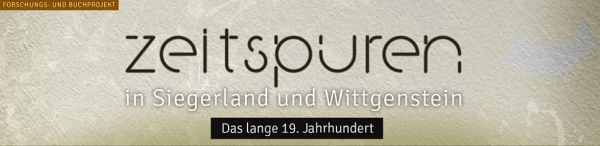Eine Höhepunkt: Eröffnung des Hauses Stöcker aus Burgholdinghausen im Juli

Das Haus Stöcker zeigt ab Ende Juli das Wohnen in den 1950er/1960er Jahren im Siegerländer Weiler.
Foto: LWL/Michels
Runde Geburtstage sind immer etwas Besonderes. Vor 50 Jahren hat das LWL-Freilichtmuseum in Detmold (Kreis Lippe) zum ersten Mal seine Tore geöffnet. Nun feiert das Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) die ganze Saison mit der größten Geländeausstellung in der Museumsgeschichte und zahlreichen Programmen „Juhubiläum“, auch wenn aufgrund der aktuellen Corona-Situation noch nicht klar ist, wann das Museum in das Themenjahr starten kann.
„Am 7. Juli 1971 eröffnet, ist das Museum heute das größte Freilichtmuseum Deutschlands und eines der bedeutendsten in Europa. Die 10,6 Millionen Besucher:innen, die in den vergangenen 50 Jahren ins LWL-Freilichtmuseum Detmold gekommen sind, sind der beste Beweis dafür, dass hier erstklassige Museumsarbeit geleistet wird“, sagte LWL-Direktor Matthias Löb am Donnerstag, den 22.4., in Detmold.
„Der Besucher und die Besucherin kann hier seit 50 Jahren durch ein spannendes, reich bebildertes Geschichtsbuch spazieren gehen. Es dreht sich darin aber nicht um Feldherrn oder Königinnen wie sonst in Geschichtsbüchern, sondern um Bauern und Bürgerinnen aus westfälischen und lippischen Dörfern – um ihre Höfe, um ihre Häuser und ihre Tiere, kurz: um ihren Alltag auf dem Land in den vergangenen fünf Jahrhunderten.“ Weiterlesen

 siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s
siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,
siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz
lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden
kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur
kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive
siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival
vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt
Kontakt

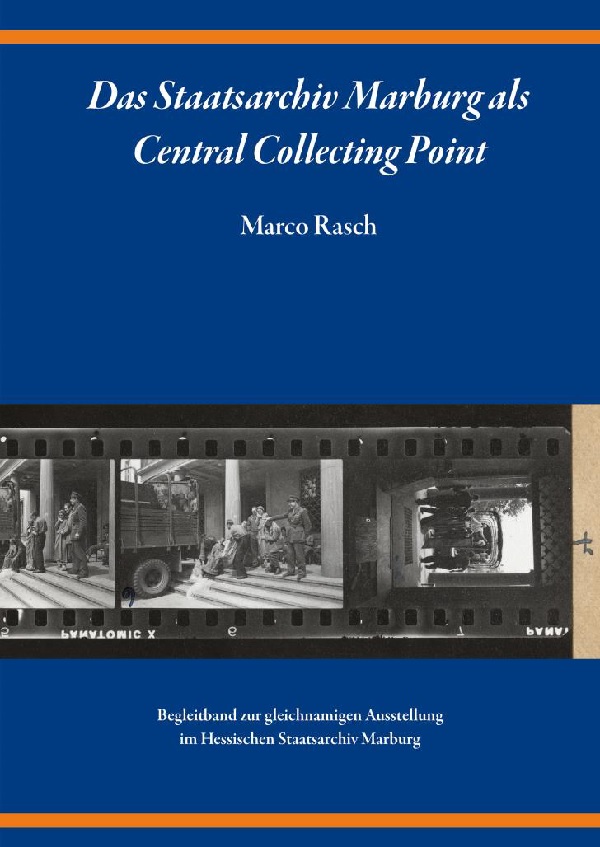 „Im April 1945, nur wenige Tage nach der amerikanischen Besetzung inspizierte der US-Kunstschutzoffizier Walker Hancock die hessische Universitätsstadt Marburg. Er gehörte zu den
„Im April 1945, nur wenige Tage nach der amerikanischen Besetzung inspizierte der US-Kunstschutzoffizier Walker Hancock die hessische Universitätsstadt Marburg. Er gehörte zu den 

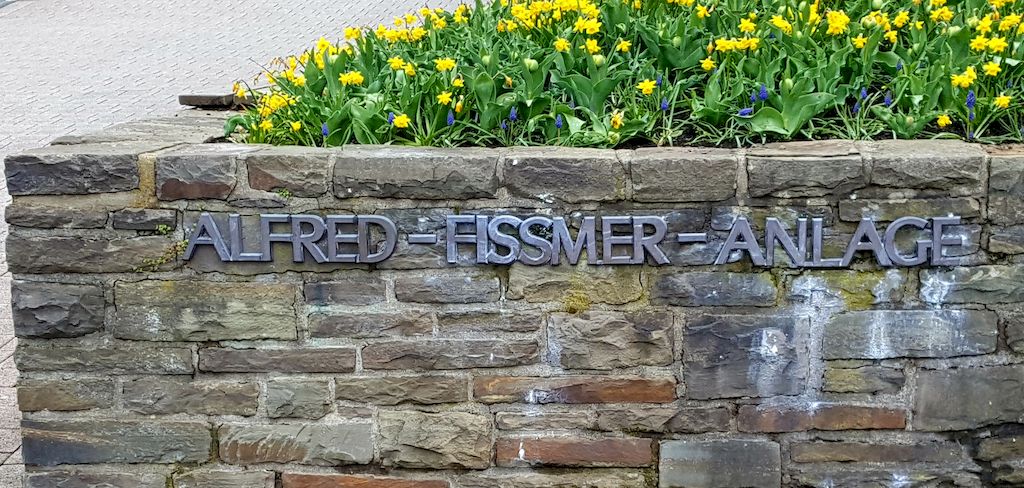
 Ein Beitrag zum Landschaft Lesen Lernen in Südwestfalen.“
Ein Beitrag zum Landschaft Lesen Lernen in Südwestfalen.“