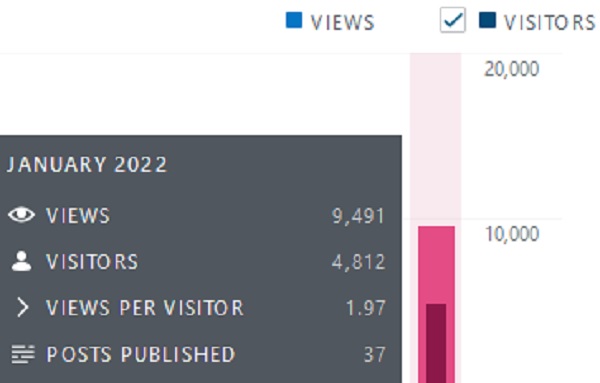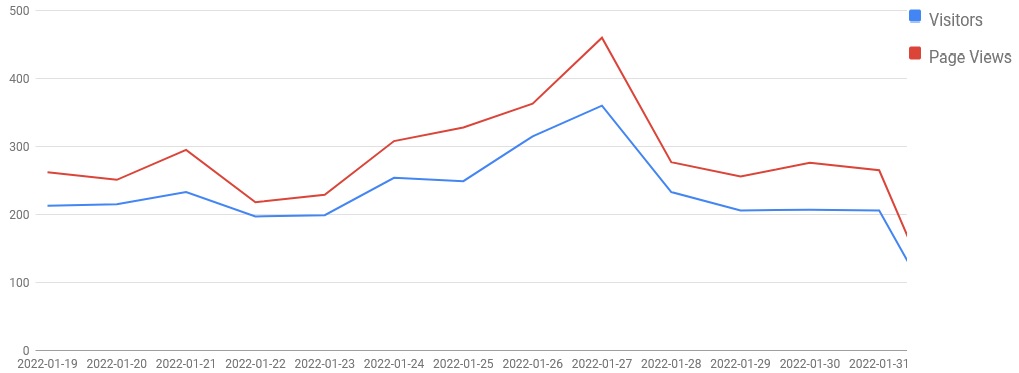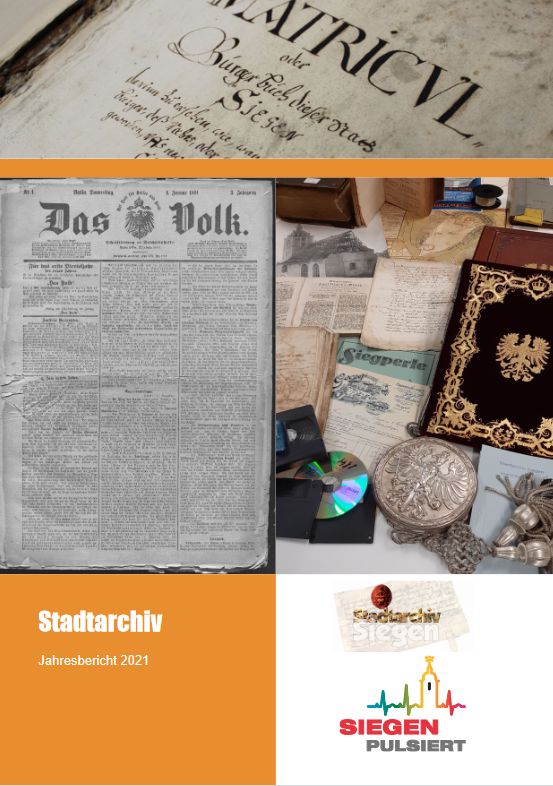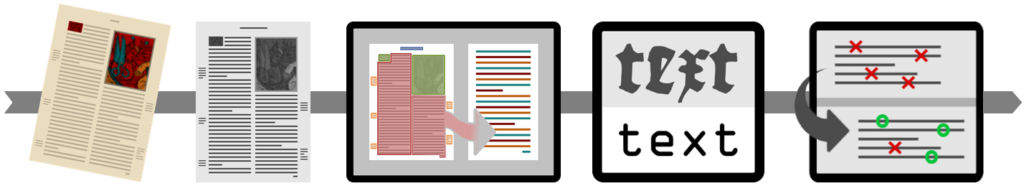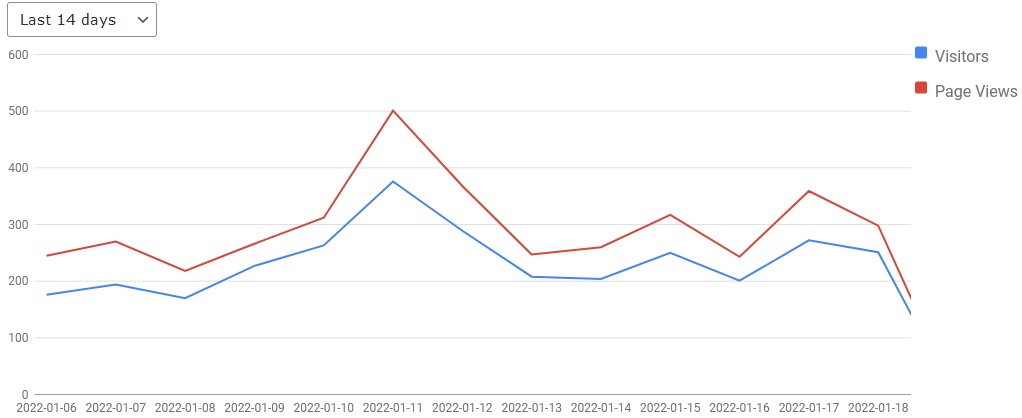Melvin Busch (links), Jugendtreffleiter, und der 14jährige Mika Neuhaus haben die Littfelder Stolpersteine wieder auf Hochglanz poliert und in Gedenken an die Opfer eine Rose niedergelegt.
Am 27. Januar wurde international der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. In Kreuztal findet an diesem Tag seit vielen Jahren traditionell eine Gedenkstunde am Littfelder Fred-Meier-Platz statt, die von der Stadt Kreuztal und der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Siegerland organisiert wird. Um mit Blick auf die aktuelle Infektionslage größere Ansammlungen zu vermeiden, wurde bewusst auf eine feierliche Gedenkstunde mit Redebeiträgen und Musikstücken verzichtet. Damit dennoch gemeinsam die Erinnerung an das Schicksal der 10 Kreuztaler Jüdinnen und Juden aufrechterhalten werden kann und um zusammen dafür einzustehen, dass die Geschichte sich nicht wiederholt, hatten die Kreuztaler Ratsfraktionen, die Littfelder Dorfgemeinschaft, die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit und Bürgermeister Walter Kiß vereinbart, am internationalen Holocaust-Gedenktag in aller Stille Blumen am Gedenkstein Fred Meiers in Littfeld niederzulegen. Weiterlesen

 siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s
siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,
siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz
lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden
kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur
kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive
siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival
vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt
Kontakt