
Der Marstall des Unteren Schlosses auf der Tuschezeichnung „Rekonstruktion des Unteren Schlosses zu Siegen um 1720“ des Siegener Künstlers Wilhelm Scheiner (1852-1922). Vorlage: Stadtarchiv Siegen
Im Rahmen des aktuellen Jubiläums zur 300jährigen Vollendung des Unteren Schlosses im Herzen der Universitätsstadt Siegen zeichnet Professor Dr. Joseph Imorde an diesem Abend die bauliche Entwicklung und die Nutzungsgeschichte der stadtbildprägenden Residenz nach.
Die Geschichte des Unteren Schlosses ist nicht nur durch einen häufigen Nutzungswechsel gekennzeichnet, sondern auch durch bauliche Maßnahmen, die über die Jahrhunderte immer wieder die Substanz des Gebäudes verändert haben. Der Referent wird in seinem bebilderten Vortrag auf einzelne Aspekte eingehen, wie etwa auf die Rolle des Schlosses für das Siegener Stadtjubiläum im Jahr 1924 oder die Wiederaufbauentscheidungen nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges. Weiterlesen

 siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s
siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,
siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz
lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden
kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur
kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive
siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival
vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt
Kontakt

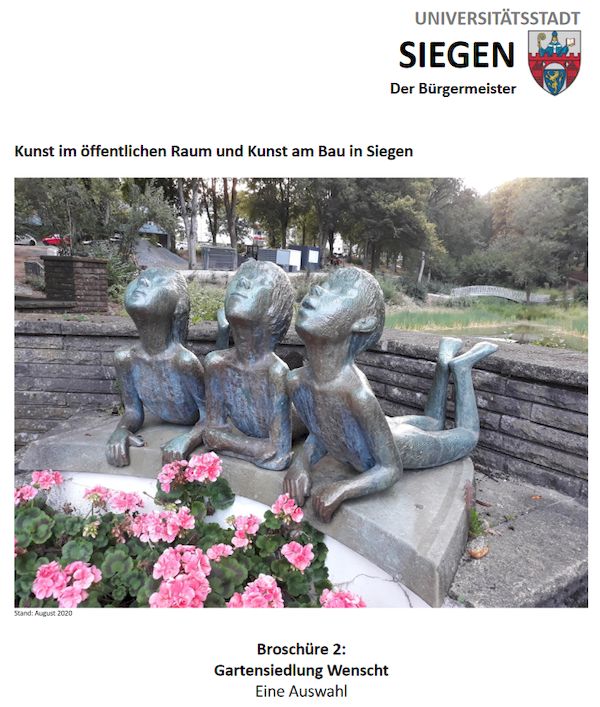

 Der Tag des offenen Denkmals steht 2020 unter dem Motto „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken.“ Auch das
Der Tag des offenen Denkmals steht 2020 unter dem Motto „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu denken.“ Auch das 








