Das forderte die Lebenshilfe zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar.

Mit einem Kranz am T4-Gedenkort in Berlin erinnerten am 28. Januar Lebenshilfe-Vertreter*innen an die Opfer der NS-„Euthanasie“. Von links: Dagmar Schmidt, MdB und Mitglied im Bundesvorstand der Lebenshilfe, Christian Specht, Selbstvertreter und Mitglied im Landesvorstand der Lebenshilfe Berlin, und Bundesvorsitzende Ulla Schmidt, Bundesministerin a.D. © Lebenshilfe/Peer Brocke
Erst im vergangenen Jahr, 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, wurden die Opfer von „Euthanasie“-Morden und Zwangssterilisierungen als Verfolgte des Nazi-Regimes anerkannt. Dafür hatte sich die Lebenshilfe jahrelang beharrlich eingesetzt. „Nach dem Beschluss des Deutschen Bundestages muss die Anerkennung als Verfolgte nun auch rechtlich verankert werden“, fordert Ulla Schmidt, Bundesvorsitzende der Lebenshilfe und Bundesministerin a.D., anlässlich des Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar. Weiterlesen

 siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s
siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,
siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz
lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden
kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur
kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive
siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival
vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt
Kontakt




 „Bei der 73. Sitzung der Bundeskonferenz der Kommunalarchive am 6./7. Oktober 2025 in Fulda wurde das vom BKK-Unterausschuss Historische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit erarbeitete Positionspapier Historische Bildungsarbeit in Archiven beschlossen. Es ersetzt das BKK-Positionspapier „Historische Bildungsarbeit als integraler Bestandteil der Aufgaben des Kommunalarchivs“ von 2005.
„Bei der 73. Sitzung der Bundeskonferenz der Kommunalarchive am 6./7. Oktober 2025 in Fulda wurde das vom BKK-Unterausschuss Historische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit erarbeitete Positionspapier Historische Bildungsarbeit in Archiven beschlossen. Es ersetzt das BKK-Positionspapier „Historische Bildungsarbeit als integraler Bestandteil der Aufgaben des Kommunalarchivs“ von 2005.
 Im vergangenen Sommer wurde
Im vergangenen Sommer wurde 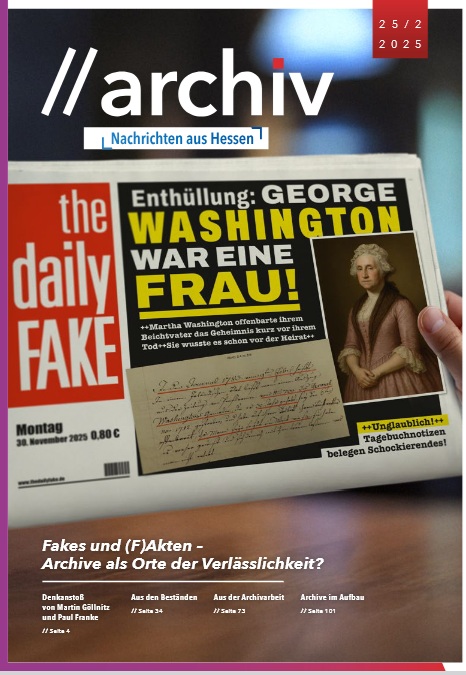
 „Abstract: Bekanntlich sind Archive und Bibliotheken große und wichtige Player für den Erhalt des kulturellen Erbes eines Landes. Während Archive sich insbesondere auf handschriftliche und unikale Akten und Urkunden konzentrieren, deren Großteil sie zuvor bewerten, verfolgen Bibliotheken einen anderen Ansatz. Sie makulieren i.d.R. wenig und bauen ihren Bestand auf der Grundlage von Sammelrichtlinien und bestimmten Sammlungsschwerpunkten selbst auf. Anhand bestehender Kooperationsprojekte zwischen kommunalen Archiven und den drei Universitäts- und Landesbibliotheken in NRW soll in diesem Praxisbericht deutlich gemacht werden, weshalb gerade Landesbibliotheken und Archive künftig (noch) stärker und ggf. arbeitsteilig zusammenarbeiten sollten, um nicht nur die knapp vorhandenen Ressourcen zu schonen, sondern um auch möglichst effektiv und (digital) nachhaltig das kulturelle Erbe eines Landes für die Nachwelt zu bewahren.“
„Abstract: Bekanntlich sind Archive und Bibliotheken große und wichtige Player für den Erhalt des kulturellen Erbes eines Landes. Während Archive sich insbesondere auf handschriftliche und unikale Akten und Urkunden konzentrieren, deren Großteil sie zuvor bewerten, verfolgen Bibliotheken einen anderen Ansatz. Sie makulieren i.d.R. wenig und bauen ihren Bestand auf der Grundlage von Sammelrichtlinien und bestimmten Sammlungsschwerpunkten selbst auf. Anhand bestehender Kooperationsprojekte zwischen kommunalen Archiven und den drei Universitäts- und Landesbibliotheken in NRW soll in diesem Praxisbericht deutlich gemacht werden, weshalb gerade Landesbibliotheken und Archive künftig (noch) stärker und ggf. arbeitsteilig zusammenarbeiten sollten, um nicht nur die knapp vorhandenen Ressourcen zu schonen, sondern um auch möglichst effektiv und (digital) nachhaltig das kulturelle Erbe eines Landes für die Nachwelt zu bewahren.“