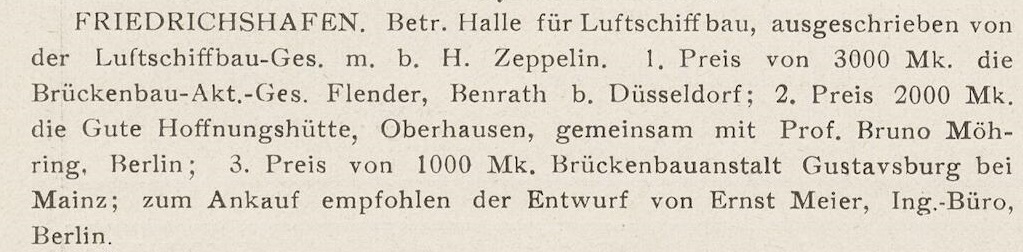14. Oktober 2023, 15:00 – 18:15, Ev. Martinikirche Netphen
„Kirchen prägen das Erscheinungsbild unserer Dörfer und Städte. Sie symbolisieren ein Stück Heimat. Selbst für die, die ansonsten mit Kirche und Glauben nur wenig anfangen können. In Zeiten, in denen auch in unserer Region immer mehr Gottesdienststätten auf dem Prüfstand stehen, erscheint es verheißungsvoll, sich näher mit der Geschichte des Kirchbaus im Siegerland und in Wittgenstein zu beschäftigen. Wann wurden welche Kirchen gebaut und warum?
Beim zehnten Teil unseres nun schoen seit Jahren laufenden beliebten Veranstaltungsformates stehen die Evangelische Martinikirche und die St. Peterskapelle in Netphen auf dem Programm. Die Evangelische Martinikirche Netphen kann auf eine fast 800jährige Geschichte zurückschauen. Errichtet ist sie auf einem Felssporn am Zusammenfluss von Obernau und Sieg. Die Kirche ist von einem klassischen Kirchhof (Friedhof) umgegeben, der von einer Bruchsteinmauer eingefasst ist. Die Kirche wurde im Laufe der Jahrhunderte mehrfach umgestaltet. Der jetzige Außenputz etwa wurde im Jahr 1890 angebracht. Bis zur Weihe der benachbarten katholischen Kirche Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Martinikirche simultan genutzt. Die Ev. Ref. Kirchengemeinde und die Katholische Gemeinde feierten also beide ihre Gottesdienste in der Kirche. Eine Situation, die durchaus von beiden Seiten als spannungsvoll erlebt wurde. Hochinteressant ist auch die Geschichte der auf dem Petersplatz gelegenen St. Peterskapelle. Die ältesten Hinweise auf eine Kapelle an diesem Ort sind ca. 750 Jahr alt. Ein an der Ostseite angebrachter Fachwerkanbau wurde lange als Schulgebäude von Niedernetphen genutzt. Weiterlesen →


 siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s
siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,
siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz
lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden
kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur
kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive
siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival
vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt
Kontakt

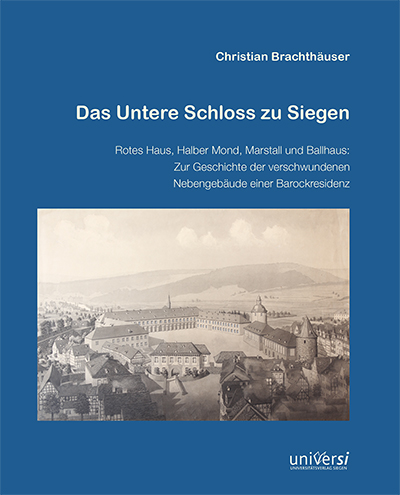

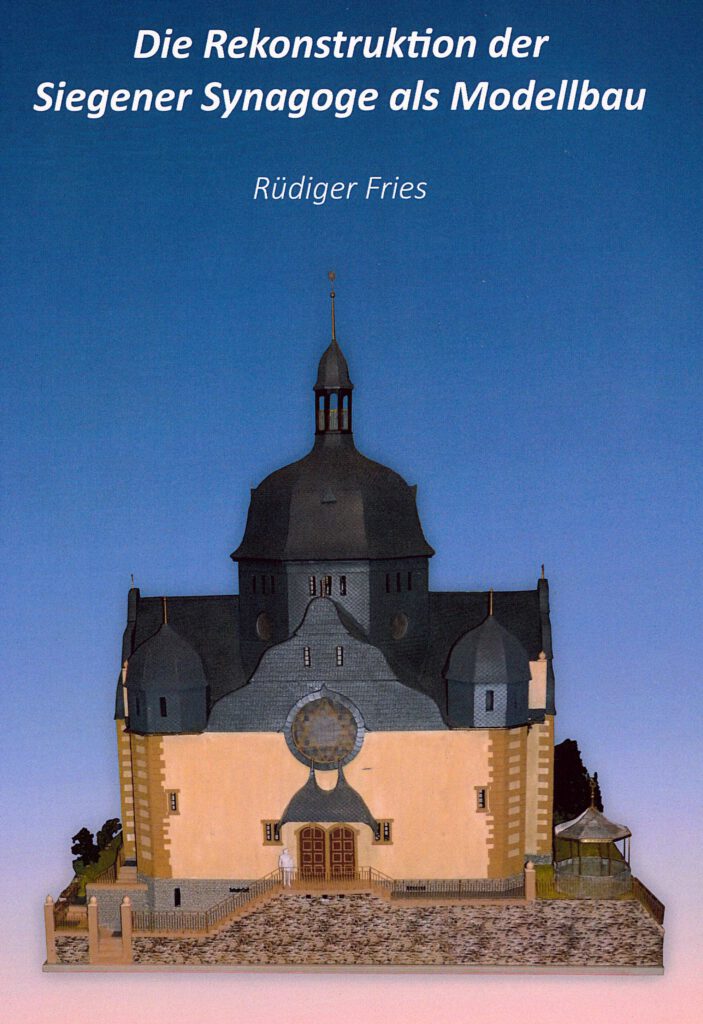
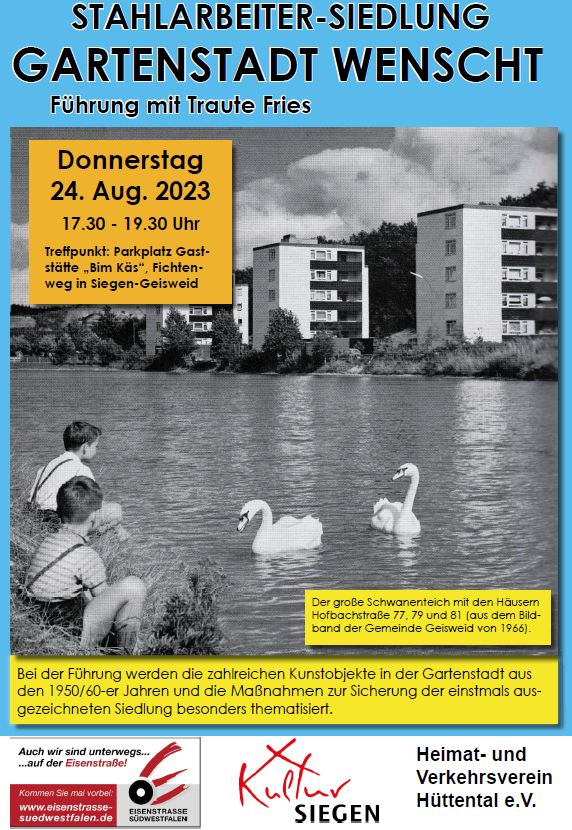
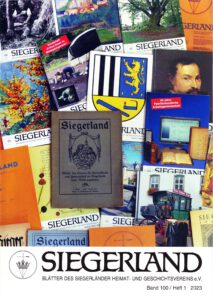 Inhalt
Inhalt