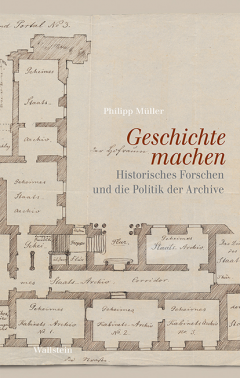 Historisches Forschen und die Politik der Archive“, Göttingen 2019
Historisches Forschen und die Politik der Archive“, Göttingen 2019
„Archive und historisches Wissen: Die Geschichte einer zunehmenden Verflechtung.
Die Archivrecherche zu historisch-analytischen Zwecken ist heute selbstverständlich. Ob aus journalistischem, genealogischem oder historischen Interesse – historisches Wissen ist an die Einsicht in Quellen und Dokumente gebunden. Dennoch ist diese Selbstverständlichkeit das Ergebnis eines relativ jungen historischen Prozesses. Archive dienten zunächst keineswegs der historischen Forschung, obwohl das historische Aktenstudium im 19. Jahrhundert zunehmende Beliebtheit erlangte.
Philipp Müller ermittelt die Voraussetzungen und Bedingungen, unter denen die Archivrecherche im 19. Jahrhundert zu einem wesentlichen Kennzeichen professionellen historischen Forschens aufstieg. Er rückt damit einen in der Forschung wenig berücksichtigten, für die Geschichtswissenschaft jedoch zentralen Zusammenhang in den Vordergrund. Zudem zeigt er die historischen Prozesse und Dynamiken auf, die schließlich beides verändern sollten: die institutionelle Kultur der Archive wie auch das historische Wissen und Erkennen. Weiterlesen

 siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s
siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,
siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz
lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden
kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur
kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive
siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival
vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt
Kontakt



 Das soeben erschienene Sonderheft der „Archivnachrichten aus Hessen“ publiziert die auf einem Workshop in Darmstadt gehaltenen Referate zum Thema „Geschichtswissenschaft und Archive“. Im Frühjahr hatten sich im dortigen Staatsarchiv Universitätswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler sowie Archivarinnen und Archivare zusammengefunden, um über diese für beide Seite wichtige Thematik in Austausch zu treten.
Das soeben erschienene Sonderheft der „Archivnachrichten aus Hessen“ publiziert die auf einem Workshop in Darmstadt gehaltenen Referate zum Thema „Geschichtswissenschaft und Archive“. Im Frühjahr hatten sich im dortigen Staatsarchiv Universitätswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler sowie Archivarinnen und Archivare zusammengefunden, um über diese für beide Seite wichtige Thematik in Austausch zu treten.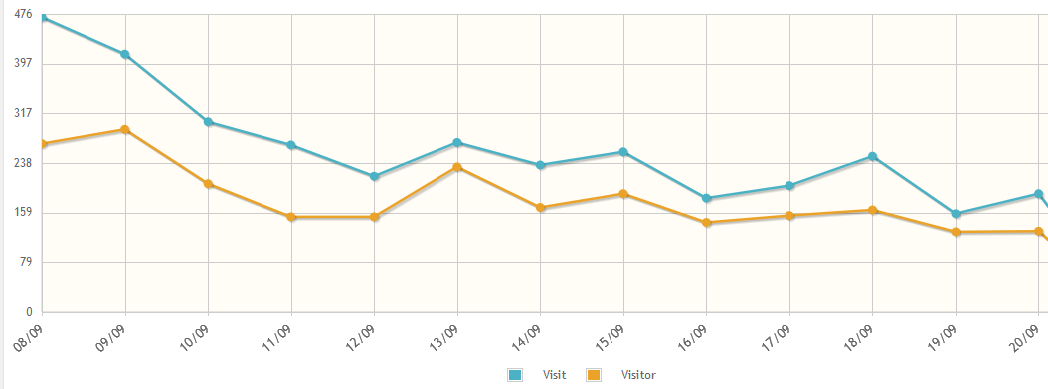

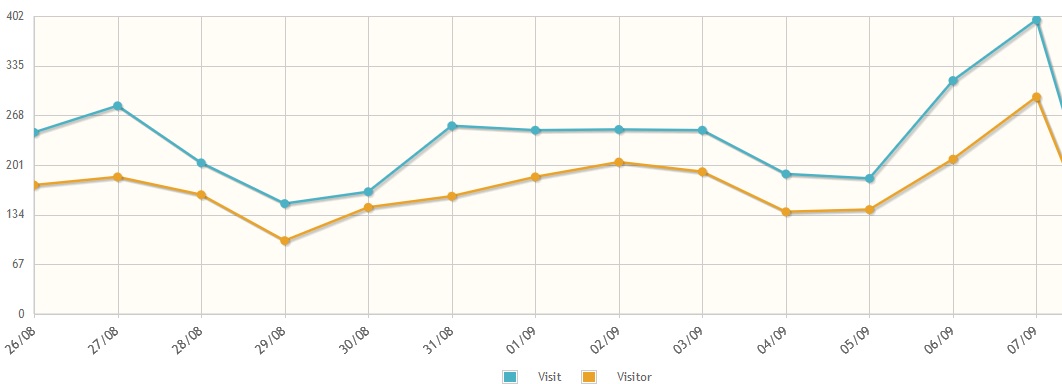 Link zur vorherigen
Link zur vorherigen 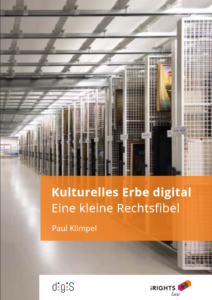 „Kunst- und Kulturinstitutionen beschäftigen sich zunehmend mit der Digitalisierung ihrer Sammlungen, auch und gerade im Angesicht der Pandemie 2020. Dabei spielen nicht nur technische und organisatorische Fragen eine Rolle, vor allem rechtliche Aspekte führen oft zu Unsicherheit bei der digitalen Zugänglichmachung der Daten.
„Kunst- und Kulturinstitutionen beschäftigen sich zunehmend mit der Digitalisierung ihrer Sammlungen, auch und gerade im Angesicht der Pandemie 2020. Dabei spielen nicht nur technische und organisatorische Fragen eine Rolle, vor allem rechtliche Aspekte führen oft zu Unsicherheit bei der digitalen Zugänglichmachung der Daten.