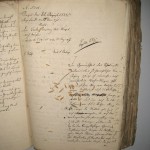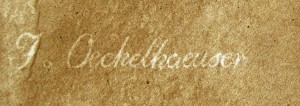Vor gut einem Jahr hat das Kreisarchiv Palmblattmanuskripte erhalten. Nach der Ermittlung der Sprache und ersten Hinweisen darauf, was auf den Manuskripten steht, wollte ich sicher gehen, dass im Inneren der Manuskripte nicht noch weitere Notizen verborgen sind – denn nicht nur erkennbare Blätter ließen diese Vermutung durchaus plausibel erscheinen. In der Restaurierungswerkstatt des LWL-Archivamtes für Westfalen sollte diese Hypothese überprüft werden. Weiterlesen
Vor gut einem Jahr hat das Kreisarchiv Palmblattmanuskripte erhalten. Nach der Ermittlung der Sprache und ersten Hinweisen darauf, was auf den Manuskripten steht, wollte ich sicher gehen, dass im Inneren der Manuskripte nicht noch weitere Notizen verborgen sind – denn nicht nur erkennbare Blätter ließen diese Vermutung durchaus plausibel erscheinen. In der Restaurierungswerkstatt des LWL-Archivamtes für Westfalen sollte diese Hypothese überprüft werden. Weiterlesen
Archiv der Kategorie: Bestandserhaltung
Bearbeitung eines Depositums – ein Bildbericht.
Kölner Stadtarchivunterlagen wurden abgeholt

 „Fünf Jahre ist es her, dass das Kölner Stadtarchiv einstürzte und Kartons mit Unterlagen zum Verwahren nach Siegen gebracht wurden. Die wurden jetzt Stück für Stück wieder abgeholt – ganz aktuell zum Beispiel: Am 13. März traf ein Spezial-Transporter aus Köln vor dem Siegener Stadtarchiv ein. Bis zum Mittag belud ein Team etwa 8 Paletten Archivgut. Damit verbleiben in Siegen noch etwa 350 laufende Meter. In einigen Monaten soll weiteres Archivgut abgeholt werden.
„Fünf Jahre ist es her, dass das Kölner Stadtarchiv einstürzte und Kartons mit Unterlagen zum Verwahren nach Siegen gebracht wurden. Die wurden jetzt Stück für Stück wieder abgeholt – ganz aktuell zum Beispiel: Am 13. März traf ein Spezial-Transporter aus Köln vor dem Siegener Stadtarchiv ein. Bis zum Mittag belud ein Team etwa 8 Paletten Archivgut. Damit verbleiben in Siegen noch etwa 350 laufende Meter. In einigen Monaten soll weiteres Archivgut abgeholt werden.
Auch in Freudenberg werden Unterlagen aus Köln aufbewahrt – voraussichtlich noch bis Ende 2016.“
Quellen: Radio Siegen 13.3.2014, Siegener Zeitung 14.3.2014
5 Jahre nach dem Archiveinsturz in Köln:
Archivare in Siegen – Wittgenstein lernen aus Kölner Katastrophe: Notfallverbund, Ampelsystem und Fortbildungen
„Auch fünf Jahre nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs beschäftigen sich die Archivare in Siegen-Wittgenstein mit der Tragödie. Mitarbeiter sollen besser auf Katastrophen wie diese vorbereitet werden. Deshalb hat der Kreis einen Notfallverbund gegründet, dem sich Stadtarchive anschließen können. Der Verbund erarbeitet Ideen, die im Notfall eine Bergung des Archivguts erleichtern sollen. Rettungskräfte sollen zum Beispiel durch ein Ampel-System erkennen, welche Dinge zuerst gesichert werden müssen. Rot markierte Regalabschnitte seien zum Beispiel besonders wichtig und müssten zuerst gerettet werden. Kreisarchivar Thomas Wolf sagte gegenüber Radio Siegen, dass außerdem ständige Schulungen wichtig wären, um im Ernstfall gut reagieren zu können.“
Quelle: Radio Siegen, 3.3.2014
Link zum Podcast von Radio Siegen u. a. mit Kollegen Ludwig Burwitz über die Asylarchive in Freundenberg und Siegen
Linktipp: Gefriertrockung von Archivgut
Das Blog des LWL-Archivamtes stellt die hauseigene Gefriertrochnungsanlage vor. Lesenswert!
Entdeckungen bei der Erschließung VII
Theaterspiele und andere genehmigungspflichtige Veranstaltungen im Kreis Siegen und Erlaubnisse dazu; im Juli 1884 vom Ministerium des Innern in Berlin über den königlichen Ober-Präsidenten zu Münster an den Landrat des Kreises Siegen erteiltes
- „Verzeichnis der zur Aufführung zugelassenen Theaterstücke, in welchen verstorbene Mitglieder des königlichen Hauses handelnd dargestellt werden
- 1. Thomas Thyyrnaw, Schauspiel von Birch-Pfeiffer
- 2. Der große Kurfürst und der Schöppenmeister, Schauspiel von Ernst Wicher
- 3. Preußens erstes Schwurgericht. Schauspiel von Kette
- 4. Der Spion von Rheinsberg. Lustspiel von R. von Gottschall
- 5. Der alte Fritz und seine Zeit, von Bods
- 6. Die Brautschau Friedrichs des Großen, von Koeppen (: Bacher:) Weiterlesen
Entdeckungen bei der Erschließung VI
(nach längere Pause, bedingt durch Ablegen der Prüfug durch die Autorin + die Feiertage/ Jahreswechsel/ Urlaub)
eine kleine Kuriosität beim Aufschlagen der nächsten Akte:
Getreidekörner in der Akte!
Lagerungsbedingt? – hat die Akte irgendwann mal in einer Vorratskammer gelegen? wurde sie zusammen mit Getreide transportiert? ist jemandem das Korn ausgekippt?
Ist das eine Art der Lesezeichensetzung?
Getreidekörner saugen – ähnlich wie Reiskörner – Flüssigkeit auf und könnten damit die Funktion erfüllen, Papiere trocken zu halten / vor Feuchtigkeit zu schützen?
Getreide, wie vieles andere war auch mal eine Art der Naturalien-Bezahlung – handelt es sich hier um „Schmiergelder“?
Autorin: Dagmar Spies
DFG – Projekt „Digitalisierung archivalischer Amtsbücher und vergleichbarer serieller Quellen“
Mit der Einstellung von Stephan Makowski als Projektleitung ist am 1.3.13 im LWL-Archivamt für Westfalen das Projekt „Digitalisierung archivalischer Amtsbücher und vergleichbarer serieller Quellen“ gestartet. Als Teil des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Pilotprojektes „Digitalisierung von archivalischen Quellen“ hat das aktuelle Vorhaben zum Ziel,
in den westfälischen Archiven vorhandene und für die lokale und regionale Geschichte besonders wichtige Amtsbücher sowie vergleichbare Quellen zu digitalisieren und online zugänglich zu machen. Im Mittelpunkt stehen hierbei Protokolle der städtischen Entscheidungsgremien, also etwa des Rats oder der Stadtverordnetenversammlung.
An der Pilotphase nehmen 31 Gemeinde-, Kreis- und Stadtarchive (u. a. auch das Stadtarchiv Siegen) aus ganz Westfalen teil, die somit diese zentralen Quellen aus ihren Beständen digitalisieren lassen können. Vor allem im Bereich der Digitalisierung von archivalischen Quellen sollen daher in den 24 Monaten der Projektphase Erfahrungen und Erkenntnisse gesammelt werden. Dabei werden auch Lösungsoptionen erarbeitet, um die Quellen für interessierte Archivbenutzerinnen und -benutzer besser recherchierbar und leichter nutzbar zu machen. Weiterlesen
Entdeckungen bei der Erschließung V
Und hier der Rest der gefundenen Wasserzeichen und ihrer verwendenden Stellen:
Unter Kürzel der Papiermacher / verwendet von:
J.H. Neuser -> Bürgermeistereien Wilnsdorf und Ferndorf; I.H.I. -> Bürgermeisterei Freudenberg und Gemeinde Netphen; Kempf -> Bürgermeisterei Dresselndorf
FIL -> Bürgermeisterei Freudenberg und Weidenau bzw. Fickenhütten, I.H. Neuser -> Bürgermeisterei Ferndorf
I.H. Neuser -> Bürgermeisterei Siegen
Entdeckungen bei der Erschließung II
Aus: Josten, Hans-Dirk: Mühlen und Müller im Siegerland, Mit einem Verzeichnis der Wasserkraftanlagen dieser Region; Waxmann, Münster/New York, 1996:
„(…) Im Siegerland gehörte die Papierherstellung nicht zu den wichtigen Industriezweigen. Der erste, wahrscheinlich mißlungene Versuch, eine Papiermühle zu errichten, erfolgte gegen Ende des 18. Jahrhunderts in Niederschelden. Die erste und auch als einzige erfolgreich betriebene Papiermühle war die von Johannes Oechelhäuser 1818 gegründete, der später noch eine zweite folgte.(…)“
Aus: 1840-1955 Waldrich Siegen. Zur Geschichte der Stadt Siegen und des deutschen Werkzeugmaschinenbaues. Festschrift Dr.-Ing. E.H. Oskar Waldrich zum 75. Geburtstag; H.A.Waldrich GmbH Siegen in Westfalen; S. 141-144:
„Der zum Kloster gehörende „Johannes-Weiher“, der wahrscheinlich von einem aus der Leimbach abgezweigten Graben mit Frischwasser versorgt wurde und wohl als Karpfenlieferer für die Fastenspeisen diente, lag auf dem Gelände des heutigen Mädchen-Gymnasiums und Landratsamtes; er ist in der ältesten Katasterkarte des Siegener Stadtteils Hammerhütte vom Jahr 1826 eingetragen und wurde hiernach begrenzt von Linien, die im Südosten etwa der Fahrbahnmitte der heutigen St.-Johann-Straße, im Nordwesten der heutigen Koblenzer Straße entlang liefen und von Kochs Ecke im Nordosten bis unterhalb des heutigen Landramtsamtes im Südwesten reichten. Der etwa 165m lange und 50 m breite „Gehanswäjer“ scheint um 1835 herum zugeschüttet worden zu sein.“ Weiterlesen

 siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s
siwikultur.deDie Website des Kultur!Büro.s siwitermine.deKultur!Aktuell,
siwitermine.deKultur!Aktuell, lyz.deKulturhaus Lÿz
lyz.deKulturhaus Lÿz kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden
kulturhandbuch.deDas Kulturhandbuch Siegen-Wittgenstein mit allen Infos zu kulturellen Angeboten, Einrichtungen, Künstlern und Kulturschaffenden kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur
kulturpur-festival.deInternationales Musik- und Theaterfestival KulturPur siwiarchiv.deDer Blog der Archive
siwiarchiv.deDer Blog der Archive vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival
vielseitig-festival.euEuropäisches Literaturfestival Kontakt
Kontakt